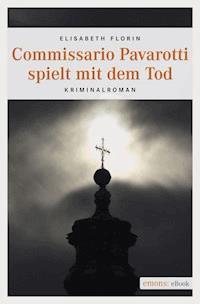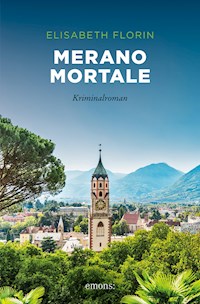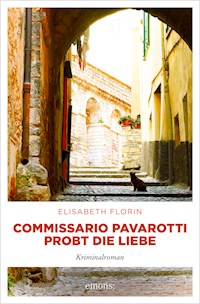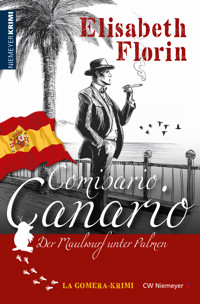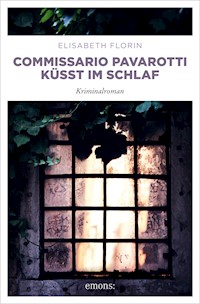
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Commissario Pavarotti, Lissie von Spiegel
- Sprache: Deutsch
Ein drückend heißer Sommer in Meran. Der Chefingenieur eines italienischen Kreuzfahrtschiffes wird in einer psychiatrischen Klinik ermordet. Bevor Commissario Pavarotti und die Deutsche Lissie den Täter jagen können, müssen sie dem Opfer auf die Spur kommen, denn der Mann lebte unter falschem Namen. Ein Verwirrspiel um Identitäten beginnt - bis sie schließlich den Keim des Bösen in der gemeinsamen Vergangenheit Italiens und Deutschlands entdecken ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Florin arbeitet neben ihrer Autorentätigkeit als Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Sie war Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Filmemacherin beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg und hat Features für den RIAS in Berlin produziert. Ihre ersten journalistischen Sporen hat sich die Autorin Anfang der achtziger Jahre beim deutschen Sender der Radiotelevisione Italiana(RAI) in Bozen verdient. Aus dieser Zeit stammt ihre Liebe zu Südtirol und seinen Menschen. Die Autorin lebt mit Ehemann und Kater im Taunus.
Mehr über Elisabeth Florin unter www.elisabethflorin.de.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig..
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/misterQM Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-587-7 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Schneeball
Wer mit Ungeheuern kämpft,
mag zusehn,
dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.
Und wenn du lange
in einen Abgrund blickst,
blickt der Abgrund
auch in dich hinein.
Friedrich Nietzsche, »Jenseits von Gut und Böse«, 1886
The wild boys are calling
on their way back from the fire
in August moon’s surrender
to a dust cloud on the rise
Wild boys fallen far from glory
reckless and so hungered
on the razor’s edge you trail
because there’s murder by the roadside
in a sore afraid new world
Juli 1985– Sein erster Tag…
Er saß auf dem Bett des Toten und lächelte.
Er strich über die Kuhle in der Matratze. Da hatte der andere in der Nacht gelegen.
Am liebsten hätte er sich in dem Bett gewälzt, um den Geruch der fremden Haut auf sich zu übertragen. Aber dafür blieb keine Zeit.
In der Ferne war das Knattern des Polizeihubschraubers zu hören. Sie suchten nach Leichen oder Leichenteilen. Nichts würden sie finden. Die Explosion hatte alle Körper in Fetzen zerrissen. Die waren mittlerweile unterwegs in Richtung Meeresboden.
Alles war super gelaufen, sogar noch besser als erwartet.
Als er den grellen Blitz gesehen hatte, war ihm ein Ziehen durch den Unterleib gefahren.
Er öffnete die Nachttischschublade. Vorsicht. Nicht zu viel.
Er überlegte kurz und steckte drei Dinge ein.
Einen handgeschriebenen Brief überflog er. Die Mama des anderen würde bald in den Verbrennungsofen einfahren. Krebs im Endstadium. Ihr Sohn würde nun leider nicht mehr zu ihrer Beerdigung kommen können.
Es lief wie am Schnürchen. Er hatte nicht viel tun müssen. Bloß reden.
Er warf einen letzten prüfenden Blick durch den Raum. Dann erhob er sich und strich die Bettdecke glatt. Es war so weit.
Vorsichtig öffnete er die Tür, streifte die Handschuhe ab und steckte sie in die Tasche. Der Gang war menschenleer. Er stieg zwei Treppen hinauf und trat durch eine Eisentür ins Freie.
Die Sonne brannte erbarmungslos auf Hunderte von Menschen. Weinende Frauen pressten schreiende Kinder an sich. Es roch nach Kot, Urin und Angst. Neben ihm erbrach sich ein Mann ins Wasser.
In der Menschenmenge entdeckte er ein bekanntes Gesicht. Verzweiflung und Entsetzen spiegelten sich darin. Schnell wandte er sich ab. Sein Mund verzog sich zu einem Grinsen, doch niemand achtete darauf.
Als Uniformierte die Gangway hochstürmten, drückte er sich in den Schatten, bis sie vorüber waren.
Auf der anderen Seite der Gangway waren die bunten Häuser einer alten Stadt zu sehen. Niemand beachtete ihn, als er darauf zuging. Niemand hielt ihn auf
Erstes Buch
1
Meran– Freitag, 13.Juli, am Morgen
»Halt die Ohren steif, mein Alter. Wir sehen uns.« Das waren ihre letzten Sätze gewesen, als sie aus Meran abgerauscht war.
Wir sehen uns, von wegen.
Seit drei Monaten kein Telefonanruf, keine Mail, von einem Brief ganz zu schweigen. Überhaupt kein Mucks. Wenn er sie auf dem Handy anrief, klingelte es zwar ein paarmal durch, aber dann sprang die Mailbox an. Er hatte zwei E-Mails geschrieben– keine Antwort. War Lissie überhaupt in Frankfurt angekommen?
Commissario Luciano Pavarotti überlegte, ob er nicht doch einen Kollegen in Deutschland kontaktieren sollte. Er hatte die Durchwahl eines Bekannten im Frankfurter Polizeipräsidium bereits gewählt und den Hörer am Ohr gehabt, da war plötzlich statt des Freizeichens Lissie von Spiegels helle Stimme, die bei Aufregung scharf werden konnte, aus dem Orkus in sein Ohr gekrochen.
»Sag mal, spinnst du? So dicke sind wir nicht, dass du mir nachspionieren kannst!«
Pavarotti hatte den Hörer auf den Tisch fallen lassen, als ob er kochend heiß wäre.
Es stimmte ja. Es war nichts gewesen zwischen ihnen, jedenfalls so gut wie nichts.
Sie hatten im Frühjahr einen Mordfall zusammen aufgeklärt, damit hatte es sich.
Obwohl sie bloß eine Touristin gewesen war, die sich zufällig in Meran aufhielt, hatte Lissie einen entscheidenden Anteil an der Aufklärung gehabt. Ihr Scharfsinn und ihre Unerschrockenheit, die an Leichtsinn grenzte…
Zickig und widerborstig, wie sie war– was zu ihrer überschlanken Figur und ihren kurzen strohblonden Haaren passte–, merkten die meisten Menschen anfangs nicht, wie warmherzig sie im Grunde war.
Pavarotti schaute nach unten auf den Butterteller, den er in der Hand hielt. Die Butter floss nach allen Seiten auseinander. Genauso wie sein Leben. Früher hatte es feste Strukturen gehabt. Seit Lissie hereingeplatzt war, hatte sein Leben seine Fasson verloren.
Pavarotti zog Beständigkeit bei Weitem vor, auch wenn sie manchmal ein bisschen langweilig war. Er rümpfte die Nase. Die Butter verströmte einen ungesunden, ranzigen Geruch.
Pavarotti fluchte und entsorgte das Malheur in eine Abfalltüte. Am vorigen Abend war er zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, um daran zu denken, Lebensmittel in den Kühlschrank zu stellen.
Widerstrebend griff Pavarotti nach der kalorienarmen Butter. Vielleicht war es Zeit, endlich seinem ins Stocken geratenen Diätplan wieder aufzuhelfen. Er hatte in den letzten drei Monaten fünf Kilo abgenommen. Besser als nichts, aber ein Klacks im Vergleich zu den fünfundzwanzig, die noch fehlten.
Pavarotti schaute auf die Klimastation vor seinem Küchenfenster. Erst kurz nach sieben, und schon sechsundzwanzig Grad Außentemperatur. Er seufzte. Die meisten Leute hatten während dieser Hitzewelle, die Meran seit zwei Wochen im Griff hatte, nur wenig Appetit. Leider war bei ihm das Gegenteil der Fall. Je mehr er schwitzte, desto mehr knurrte sein Magen.
Die Küchentür öffnete sich einen Spalt. Justus schlurfte herein und ließ sich grußlos auf die Eckbank fallen. Pavarotti unterbrach seine Frühstücksvorbereitungen, um ihm einen prüfenden Blick zuzuwerfen. Der Junge war immer noch mager und viel zu klein für seine mittlerweile vierzehn Jahre. Seine Epilepsie, die ihm vor ein paar Monaten oben in den Bergen fast das Leben gekostet hatte, hatten sie inzwischen zum Glück im Griff, dank gut eingestellter Medikamente. Es war das tägliche Zusammenleben mit dem Jungen, das Pavarotti den letzten Nerv kostete.
Nicht dass Justus pampig gewesen wäre wie die meisten in seinem Alter. Damit wäre Pavarotti klargekommen. Denn in diesem Fall wäre da etwas gewesen, an dem er den Jungen hätte packen können. Aber da war nichts, keine rotzfrechen Antworten, keine Provokationen. Justus besaß definitiv den schwarzen Gürtel in der Disziplin des trotzigen Schweigens.
Der Junge griff nach dem Glas Nougatcreme.
Pavarotti unterdrückte einen Fluch. »Ebenfalls einen schönen guten Morgen, Justus!« Der verzog keine Miene. Pavarotti atmete tief ein und startete einen weiteren Versuch. »Möchtest du einen Toast?«
Kopfschütteln.
Plötzlich fiel Pavarotti auf, dass das T-Shirt des Jungen über Brust und Oberarmen spannte. »Ist dir das Shirt beim Waschen eingegangen?«, fragte er erstaunt.
Justus warf ihm einen verächtlichen Blick zu. Dann bequemte er sich zu einem genuschelten Satz: »K’nn ich’n Kaffee haben?«
Herr, ich danke dir. Er kann noch sprechen.
Pavarotti beobachtete, wie der Junge aufstand, den Kaffeebecher nahm und sich mit gesenktem Blick nach draußen verdrückte. Er hörte eine Treppenstufe knarzen, dann das Öffnen und Schließen der Tür, die zum ausgebauten Dachstuhl führte.
Pavarotti steckte den Kopf hinaus auf den Flur. Und richtig, da war es, dieses knirschende Geräusch, wenn sich ein Schlüssel im Schloss dreht.
Frustriert schüttelte Pavarotti den Kopf. Wenn er abends heimkam, erwartete ihn eine leere Wohnung. Kein Justus, keine Nachricht. Allerdings waren Wurst oder Käse aus dem Kühlschrank verschwunden. Meistens erschien der Herr dann so gegen elf und marschierte wortlos in sein Zimmer. Gutes Zureden nützte so wenig wie Verbote. Sollte er ihn etwa einsperren? In den Sommerferien?
Natürlich war Pavarotti klar gewesen, dass ihn die Erziehung eines Vierzehnjährigen hoffnungslos überfordern würde. Aber er hatte sich verpflichtet gefühlt, sich um den Jungen zu kümmern. Pavarotti hatte die vor Kurzem verstorbene Elsbeth Hochleitner, Justus’ Großmutter, seit vielen Jahren gekannt. Außer ihr hatte der Junge niemanden gehabt. Pavarotti hatte es nicht über sich gebracht, ihn in die Fürsorge zu geben.
Pavarotti ließ sich schwer auf den Sitz fallen, auf dem Justus gerade noch gesessen hatte. Sollte er ihn wirklich weiter bei sich behalten? Vielleicht würde das Sozialamt eine neue Familie für ihn finden? Justus brauchte dringend einen Vater und eine Mutter, die sich um ihn kümmerten. Er selbst hatte einfach zu wenig Zeit und Geduld für einen Jungen in Justus’ Alter.
Pavarotti beobachtete, wie eine Frau im Nachbarhaus ein Fenster öffnete, ihre Oberbetten durchschüttelte und an die frische Luft hängte. Wenn sich beide ein wenig anstrengen würden, könnten sie sich über den engen Durchgang hinweg die Hand geben. In Steinach, dem ältesten Meraner Stadtteil, waren die Mieten auch für ein Polizistengehalt noch halbwegs erschwinglich, jedenfalls am Steinachplatz, wo noch nicht alles luxussaniert war. Seine Wohnung war sogar eine Art Maisonette, mit drei Zimmern auf zwei Etagen.
Die Frau im Nachbarhaus warf ihm einen kurzen Blick zu, dann schaute sie weg. Er wusste nicht einmal, wie sie hieß. In den paar Monaten seit seiner Versetzung von Bozen nach Meran war er fast ausschließlich im Büro gewesen, um sich in die neue Dienststelle einzuarbeiten.
Seine Gedanken kehrten zu Justus zurück.
Das Liebeswerk-Fürsorgeheim ist doch gar nicht so schlecht.
Er war vor ein paar Monaten mit einer Frau vom Sozialamt dort gewesen, als nach Elsbeths Tod noch nicht feststand, was mit Justus passieren würde. In einem Viererzimmer war ein Platz frei gewesen. Die drei Knaben in Justus’ Alter hatten gemeinsam auf einem Bett gesessen, rot im Gesicht, die Lippen zusammengepresst, um ihr Lachen zu unterdrücken. Vermutlich hatten sie sich angerempelt und herumgealbert, bevor er mit der Frau hereinkam. Als er die drei beobachtete, war ihm Justus eingefallen, wie er still und weiß in seinem Krankenbett lag, den Kopf zum Fenster gewandt.
»Wollen Sie den Platz jetzt oder nicht?« Mit Mühe hatte sich Pavarotti auf die Behördentante konzentriert, die ihn auffordernd anschaute. Vernunft und Logik in ihm hatten laut »Ja!« geschrien. Trotzdem hatte er den Kopf geschüttelt.
Aber jetzt war Pavarotti sich nicht mehr so sicher, ob er in Justus’ Sinn gehandelt hatte.
Er hörte Lissie in sein Ohr flüstern: »Lass ihm Zeit.«
Wie viel denn noch? So kann’s nicht weitergehen.
Wenigstens war es im Dienst zurzeit ruhig. Die einzigen Kriminellen, die Hochkonjunktur hatten, waren die Taschendiebe in der Laubengasse, in deren Arkaden sich die Touristen drängten. Bis auf einen Raub hatte es nur kleinere Delikte gegeben, seit den Mordfällen im Frühjahr, die er gemeinsam mit Lissie aufgeklärt hatte.
Lissie.
Auf halber Strecke nach oben klingelte das Telefon. Pavarotti rannte die Treppe wieder hinunter. Aber es war nicht Lissie, sondern bloß Emmenegger, sein einziger Mitarbeiter.
»Commissario, ich brauch Sie! Dringend!«, rief Emmenegger aufgeregt.
Verärgerung stieg in Pavarotti auf. Wahrscheinlich wieder ein Tourist, dem man die Geldbörse geklaut hatte. Das könnte sein Sergente nun wirklich mit den Kollegen von der Ortspolizei selbst übernehmen.
»Wo ist es diesmal passiert? Unten an der Passer?«
Stille. »Woher wissen Sie das, Commissario? Hat Direttore Alberti Sie informiert?«, kam es misstrauisch aus dem Hörer.
Hat dieser Vollpfosten etwa den Polizeichef in Marsch gesetzt?
»Ich trinke noch meinen Kaffee aus, dann mache ich mich auf den Weg«, knurrte Pavarotti.
»Chef, Sie haben wirklich die Ruhe weg!«
Pavarotti verdrehte die Augen. »Das Geld ist eh fort, da kommt’s auf ein paar Minuten früher oder später wohl nicht an.«
2
Frankfurt am Main– Freitag, 13.Juli, am Vormittag
Vielleicht sollte sie umsatteln. Eine Privatdetektei gründen oder so. Ihre bisherige Branche erwies sich zunehmend als Sackgasse.
Ihr rechter großer Zeh fing plötzlich an, höllisch zu schmerzen.
Lissie von Spiegel bückte sich, um den aufmuckenden Körperteil zu untersuchen, da ging ihr auf, dass sie ihren Fuß in der letzten Viertelstunde permanent gegen eine volle Umzugskiste gestoßen hatte, die neben ihrem Schreibtisch stand.
Lissie bewegte ihre Zehen und setzte ihren seidenbestrumpften Fuß auf dem Boden auf.
Billiges Laminat.
An der Decke prangte eine Neonröhre. Das Kabuff hatte noch nicht einmal eine Klimaanlage.
Die heiße, nach Asphalt stinkende Luft und der permanente Verkehrslärm, der mit der Ampelschaltung an- und abschwoll, machten Lissie aggressiv. Sie warf das Fenster zu. Die Passanten, die gerade vorbeigingen, ruckten mit dem Kopf und glotzten zu ihr ins Zimmer. Dafür brauchten sie sich nicht den Hals zu verrenken, denn sie waren auf Augenhöhe mit ihr. Wütend starrte Lissie zurück.
Mehr als dieses abgewohnte Büro im Erdgeschoss, direkt an einer verkehrsreichen Straße, wie die Hochstraße eine war, war zurzeit nicht drin.
Ohne Kohle bekam man nur Parterre und landete mit der Nase im Straßendreck. Lissie fühlte sich wie eine Pennerin in der Weserstraße. Aber alles war besser als Homeoffice. Das bedeutete, alles schleifen zu lassen, Schlafanzug bis mittags. Ihre Selbstachtung war sowieso schon angeschlagen.
Jede Absage machte es schlimmer, ob für einen festen PR-Job oder als freie Kommunikationsberaterin.
Lissie ließ sich zurück in den Sessel fallen und pfefferte eine Bewerbungsmappe auf die nächstbeste Umzugskiste.
Gleich im Anschluss an ein Bewerbungsgespräch die Mappe wieder in die Hand gedrückt zu bekommen, das kam einer Ohrfeige ziemlich nahe.
»Es tut uns leid, aber wir können Sie nicht in die nähere Auswahl einbeziehen. Frau von Spiegel, nun, Sie…« Der Personalleiter hatte nach einer unverfänglichen Floskel gesucht und schließlich eine gefunden. »Es ist so, wir glauben einfach nicht, dass Sie in unser Kommunikationsteam passen.« Lissie brannte die Enttäuschung im Magen.
»Wieso denn nicht? Ich habe fünfzehn Jahre PR-Erfahrung im Banking, sogar in leitender Position!« Sie hatte gewusst, dass ihr Aufbegehren zu nichts führen würde. Die Ablehnung stand bereits fest.
»Das ist es ja gerade, Frau von Spiegel«, hatte der Personalleiter zurückgegeben. »Wir suchen keinen Kommunikationschef. Und Sie sind kein Mensch, der sich unterordnet.«
Auf einmal war wildes Gebell auf dem Flur zu hören. Es folgte ein Knurren, dann ein schabendes Geräusch an der Tür. Lissie stöhnte und stand auf. Bloß gut, dass der Vermieter nicht im Haus war.
Was in aller Welt sollte sie künftig mit Spock machen? Allein lassen ging bei einem Dobermann definitiv nicht. Der Hund würde das Büro zu Kleinholz zerlegen. Aber das aktuelle Arrangement war längerfristig auch nicht tragbar. Ihr Exfreund Alexander hatte das Tier von Anfang an gehasst. Spock war der letzte Sargnagel für ihre Beziehung gewesen.
Als sie die Tür öffnete, schoss der Hund ins Zimmer und veranstaltete einen Radau, als ob sich seit Stunden keiner um ihn gekümmert hätte.
In der Türöffnung stand ein schlaksiger Mittdreißiger, einer der Fahrer vom Paketdienst, die das Büro nebenan belegten. Lissie versuchte, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. »Hallo Andreas, vielen Dank, dass du ihn wieder mitgenommen hast. War er einigermaßen brav?«
Brav? Spock wusste gar nicht, was das war.
»Alles okay gelaufen?« Sie musterte Andreas.
Andreas mied ihren Blick und war bereits dabei, den Rückwärtsgang einzulegen. »Nee, du, ich kann dir sagen… Scheiße, dein Vieh ist durchs Wagenfenster, mir nach und auf den Hund einer Kundin los. Ein Spitz war das, die haben ja immer so ein echt grauenhaftes Gekläffe drauf, und das hat dem deinen offenbar nicht geschmeckt. Die Frau und ich konnten gar nicht so schnell schalten, wie die Tölen sich ineinander verkeilt haben.«
Lissie schloss kurz die Augen. Das war’s dann mit ihrer Notlösung für Spock, die in den letzten Wochen mehr schlecht als recht funktioniert hatte, wenn sie einen Termin in der City hatte.
Andreas gluckste. Dann erinnerte er sich daran, was er eigentlich hatte sagen wollen, und wurde schlagartig ernst. »Sorry, du, aber ich kann ihn wirklich nicht mehr nehmen. Wenn der Chef–«
»Schon okay«, sagte Lissie. »Alles klar. Tut mir echt leid.«
Andreas zuckte die Achseln und stieß sich vom Türrahmen ab. »Ist ja nicht viel passiert. Bis dann.«
Als Lissie sich umdrehte, lag Spock seitlich auf seiner Decke, streckte ihr seinen schokoladenbraunen Bauch entgegen und guckte treuherzig.
Der glaubt im Ernst, ich lob ihn jetzt dafür.
Spock war drei, fast so groß wie eine Dogge und ein Paket aus Muskeln und Sehnen.
Sie hatte den Hund im letzten Frühjahr aus Meran mitgebracht. Er hatte einem Mordopfer gehört. Die Ehefrau war vollkommen durch den Wind gewesen. Das Leben komplett aus den Fugen, ein neugeborenes Baby und dazu noch ein halbwüchsiger Dobie. Was hatte Lissie bloß geritten, den Hund zu nehmen?
Mittlerweile hatte sich Spock aufgerappelt und stupste sie auffordernd in die Seite.
Nicht zur Kenntnis nehmen.
Das war die schlimmste Strafe. Lissie schob Spocks Schnauze beiseite, stand auf und schaute in eine der Umzugskisten. Studien, Research, Präsentationen. Wertloses Zeug, das sie nicht hätte mitzuschleppen brauchen. Mehr war ihr nicht geblieben von fünfzehn Jahren im Investmentbanking.
Spock stimmte ein Geheul an. Sofort bollerte jemand von oben an die Zimmerdecke. Lissie klatschte auf ihren Oberschenkel. Der Hund ließ sich nicht zweimal bitten und legte seine Schnauze darauf. Als sie anfing, ihn hinter den kupierten Ohren zu kraulen, schloss er die Augen.
Lissie starrte auf das Kommen und Gehen vor dem Hilton Hotel, ihr gegenüber auf der anderen Straßenseite. Zwei junge Männer in Anzügen, Aktenkoffer bedeutungsschwer im Griff. Sie stellte sie sich vor, wie sie dreißig Jahre später aussehen würden. Pavarotti fiel ihr ein. Oder vielmehr Luciano, man duzte sich ja. Rein theoretisch allerdings, es gab ja derzeit keinen Kontakt. Er hatte ein paarmal probiert, sie zu erreichen, wohl aus Höflichkeit. Er war ihr sowieso viel zu… nett.
Sie schloss die Augen und versuchte, sich sein Gesicht vorzustellen. Zu ihrer Überraschung gelang es ihr auf Anhieb. Schwarze Haare, mit einem Hauch Grau darin. Hagere Gesichtszüge, die nicht zu seiner Figur passten. Kräftige Nase. Ein ironisches Lächeln auf den schmalen Lippen. Doch die warmen braunen Augen straften seinen Mund Lügen.
Sie hatte keine Lust auf sein Mitleid. Erst einmal brauchte sie wieder festen Boden unter den Füßen, bevor…
3
Meran– Freitag, 13.Juli, zur selben Zeit
Als Pavarotti den Steinernen Steg überquerte, stellte er fest, dass der Fluss nur noch wenig Wasser führte. Der Promenadenweg auf der anderen Uferseite lag ausgestorben in der prallen Sonne.
Pavarotti wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er hatte das Gefühl, auf heißem Gummi zu laufen statt auf den Sandsteinplatten, aus denen das Brückenpflaster bestand. Auf der Brücke regte sich kein Lüftchen.
Als er die andere Uferseite erreichte, prallte er zurück. Wie eine unbezwingbare Wand stand die Hitze auf der Winterpromenade vor ihm. Schwer atmend blickte er hoch und blinzelte gegen die grelle Sonne. Hier musste es sein.
Er kannte das Haus, das direkt vor ihm aufragte. Jeder, der den Steinernen Steg passierte, egal ob hinauf zum Tappeiner Weg oder in umgekehrter Richtung zum Elisabethpark und nach Obermais, musste daran vorbei. Pavarotti hatte nie einen Gedanken daran verschwendet, was sich wohl hinter den Mauern der etwas heruntergekommenen Villa abspielte. Auf eine Irrenanstalt wäre er im Leben nicht gekommen.
Pavarotti grinste. Diese Bezeichnung musste er sich drinnen natürlich verkneifen. Privatklinik für psychische Störungen, so nannte sich das heute.
Die Villa sah unbewohnt aus. Die Fensterläden waren geschlossen. Ihr Holz musste einmal in einem satten Grün geglänzt haben. Inzwischen war die Farbe an vielen Stellen abgeblättert. Über der ockerfarbenen Fassade lag der scharf konturierte Schatten eines vorspringenden Giebeldachs. Zur Linken ragte ein schlanker Turm mit spitzem Dach auf, der dem Gebäude eine eigenartige Disharmonie verlieh. Aus Pavarottis Perspektive sah es so aus, als neige sich der Turm einer Gruppe von Zypressen zu, die seine Fassade schwarz und elegant begleiteten.
Links neben dem Gebäude sah er eine schmiedeeiserne Gartenpforte, die vor Rost starrte, daneben eine einfache Klingel. Auf dem Klingelschild stand »Empfang– Apotheke«, sonst nichts. Pavarotti drückte den Knopf, dann drehte er probehalber am Türknauf.
Geräuschlos schwang die Tür auf.
Offenbar konnte sich hier jeder Zutritt verschaffen.
Pavarotti trat in den Schatten einer Zypresse, um durchzuatmen.
Wo steckte eigentlich Emmenegger?
Von der Hitze auf der Winterpromenade war hier nichts mehr zu spüren. Ein Windhauch strich über Pavarottis feuchte Unterarme, und er bekam Gänsehaut. Plötzlich glaubte er, Stimmen zu vernehmen. Er spitzte die Ohren. Eine Stimme war jetzt deutlich herauszuhören. Sie gehörte der hiesigen Gerichtsmedizinerin. Pavarotti hob die Augen zum Himmel und wappnete sich. Eine schreckliche Frau. Bedauerlicherweise war sie seine Schwester.
Bevor er sich auf den Weg nach hinten machen konnte, öffnete sich zur Rechten eine Tür, und ein Mann trat ihm in den Weg.
»Sind Sie der Ermittlungsleiter?«
Pavarotti nickte. »Ja, ich bin Commissario Pavarotti. Und Sie sind…?«
»Anselm Matern, ich bin…«, der Mann machte eine kurze Pause und fuhr sich mit der Hand über seinen fast kahlen braun gebrannten Schädel, »… der Chefarzt.«
Matern sah schlank und durchtrainiert aus und trug ein weißes Poloshirt über dunkelblauen Chinos. Die Oberarmmuskeln wölbten sich unter den knapp sitzenden Ärmeln.
Pavarotti war baff. Wo war der weiße Kittel?
»Sie sind Arzt?«
Matern nickte und lächelte. Er hatte ein freundliches Gesicht mit Grübchen in den Wangen. Sein vorspringendes energisches Kinn wollte dazu nicht recht passen.
»Psychiater und Psychotherapeut. Außerdem leite ich diese Klinik. Der Tote war mein Patient. Ich bin fassungslos. Ein Mord… hier bei uns… undenkbar!«
»Offenbar nicht«, sagte Pavarotti trocken. »Wer ist der Tote?«
»Seine Name ist… war… Michael Cabruni. Er war erst seit ein paar Wochen bei uns.«
Pavarotti beschloss, es zunächst dabei bewenden zu lassen. Erst einmal wollte er sich einen Eindruck verschaffen. »Können Sie mich hinführen?«
»Einfach geradeaus, Commissario. Nach Ihnen.«
* * *
Der moosüberwucherte Weg führte in einen weitläufigen Garten. Materns Schritte hinter ihm waren nicht zu hören. Mehrfach war Pavarotti versucht, sich umzuschauen, aber er unterdrückte den Impuls.
Im Garten war es schattig, fast düster. Ein stattlicher Bestand alter Olivenbäume mit wuchtigen Kronen säumte den Weg. Durchs Gehölz drangen nur wenige Lichtfunken, die sich im Blattwerk von Wacholderbüschen und hell schimmernden Schneeballsträuchern fingen.
Er passierte mehrere Bänke, auf denen niemand saß. Das Gelände machte einen ausgestorbenen Eindruck.
Die erregten Stimmen, die Pavarotti vorhin am Eingang gehört hatte, waren verstummt. Vielleicht war seiner Schwester Editha und Kohlgruber, dem Leiter der Spurensicherung, das verbale Gift ausgegangen. Pavarotti stellte sich die beiden vor, wie sie am Tatort nebeneinander arbeiteten und feindselig schwiegen, um sich ihre Bosheiten aufzusparen. Editha mochte den Spusi-Chef nicht, aber ihren Bruder hasste sie.
Plötzlich öffnete sich der Weg zu einer kleinen kreisförmigen Lichtung, auf der ein schindelgedeckter Holzpavillon stand.
Pavarotti blieb stehen. Ohne Vorwarnung herrschte wieder eine solche Hitze, als habe jemand über ihnen einen Heizstrahler angeknipst.
»Commissario, endlich!«
Pavarotti hatte unvorsichtigerweise nach oben in die Sonne geschaut und blinzelte, um die schwarzen Punkte auf seiner Netzhaut zu verscheuchen. Über ihm ragten die Einsneunzig seines Sergente auf.
Machte die Sonne seinen Augen immer noch zu schaffen, oder war Emmenegger blass um die Nase?
Arnold Kohlgruber, bekleidet mit dem grünen Tatortdress aus Nylon, trat aus der Türöffnung des Pavillons. Sein Gesicht war rot angelaufen. Stöhnend zog er sich die Gummihandschuhe von den Händen.
Als er Pavarotti sah, stemmte er die Hände in die Hüften. »Na prima, auch schon da! Schon klar, dass du als Italiener deinen Schönheitsschlaf brauchst! Andere rutschen schon seit Stunden in der Hitze auf dem Boden herum und schwitzen wie die Sau!«
Kohlgruber erwartete keine Antwort, das wusste Pavarotti. Sie waren halbwegs befreundet. Über einen bestimmten Punkt ging ihr Verhältnis allerdings nicht hinaus. Das lag daran, dass Kohlgruber als eingefleischter Südtiroler Italiener nicht mochte. Für Kohlgruber war das Zusammenleben mit Italienern immer noch strapaziös, auch wenn er gegenüber dem Commissario einmal widerwillig zugegeben hatte, dass sich im Laufe der letzten Jahre so einiges verbessert hatte.
Pavarotti ahnte, dass es zu Kohlgrubers seelischer Hygiene gehörte, einem Italiener in regelmäßigen Abständen einen verbalen Tritt in den Hintern zu verpassen, sozusagen stellvertretend für alle anderen, unter anderem seinen Behördenleiter, ebenfalls Italiener. Für Pavarotti ging das in Ordnung, wenn es sich in Grenzen hielt.
»Was habt ihr?«
»Eine Leiche halt«, brummte Kohlgruber.
Pavarotti verdrehte die Augen. »Geht’s etwas genauer?«
Die Schärfe in Pavarottis Stimme bewirkte eine Veränderung in Kohlgrubers Miene.
»Mann Ende vierzig«, antwortete er sachlich.
Mein Alter, schoss es Pavarotti durch den Kopf. Klapsmühle. Tod. Vorbei. Ratzfatz.
»Sitzt im Rollstuhl, von hinten erstochen«, hörte er den Spusi-Chef fortfahren. »Ein einziger Messerstich, so wie es ausschaut. Sehr scharfe Klinge.« Kohlgruber hielt eine Beweismitteltüte hoch, die ein blutverschmiertes Messer enthielt, dem Anschein nach ein gewöhnliches Fleischmesser, wie es in den meisten Küchen zu finden war. »Die Klinge ist durchs Fleisch gegangen wie durch Butter«, ergänzte Kohlgruber. »Mehr hat mir deine Schwester nicht verraten.«
Pavarotti wandte sich an Anselm Matern, der vor dem blutigen Plastiksack zurückgewichen war. »Erkennen Sie das Messer? Schauen Sie sorgfältig hin!«
Der Mann warf dem Sack einen angeekelten Blick zu. »Unsere Küchenmesser sehen anders aus. Außerdem fehlt keines.«
»Haben Sie die Leiche gefunden?«
Der Klinikleiter schüttelte den Kopf. »Das war eine Patientin. Hanna Landsberg heißt sie. Sie hat sich hingelegt. Das Ganze hat sie ziemlich mitgenommen, wie Sie sich denken können.«
Pavarotti überlegte kurz. »Signore Matern, bitte gehen Sie jetzt ins Haus und bleiben in Rufweite. Ich will später ausführlich mit Ihnen sprechen. Das gilt auch für alle anderen.«
»Alle andern?«, echote Matern.
»Nun, das Klinikpersonal und die Patienten. Jeder, der sich im Moment auf dem Gelände aufhält. Als Erstes möchte ich nachher die Patientin befragen, die den Toten gefunden hat.«
Matern nickte bloß.
Nachdenklich blickte Pavarotti ihm nach, wie er in Richtung Turm davonging, der im Gegenlicht scharfzackig und dunkel in den blauen Himmel hineinragte.
* * *
Kohlgruber wartete, bis der Arzt verschwunden war, dann wandte er sich an den Commissario: »Da hast eine schöne Nuss zu knacken, das sag ich dir. Das ist wie ein öffentlicher Park hier. Sträflich so was. Die lassen hier einfach die Pforte unversperrt, obwohl sie einen Haufen Verrückte im Haus haben!«
Pavarotti sparte sich eine Antwort.
Gleich würde es losgehen. Ad-hoc-Analysen zum Tathergang direkt vor Ort, sozusagen während die Leiche noch warm war, waren Kohlgrubers Spezialität. Kohlgruber glaubte allen Ernstes, dass er eine Art sechsten Sinn für den Tathergang hatte. Einmal hatte er sich zu der Aussage hinreißen lassen, er könne die Aura des Bösen am Tatort spüren. Kohlgruber war tief beleidigt gewesen, als Pavarotti gelacht hatte. Ein Tatort war genau das, was das Wort besagte. Nämlich der Ort einer Gewalttat. Leiche, Fingerabdrücke, Spuren. Von wegen Aura.
Mittlerweile liefen in Kohlgrubers Abteilung bis hoch zum Behördenleiter bei jedem Mord Wetten, ob er recht behalten würde. Seine Erfolgsquote lag derzeit bei leicht über fünfzig Prozent. Nicht mal so schlecht, wenn man den Unsinn bedachte, den der Mann in den restlichen neunundvierzig Prozent verzapfte.
»Pavarotti, das war todsicher ein Profi. Der Pavillon war für ihn perfekt, und deshalb hat er genau dort zugeschlagen.«
Pavarotti unterdrückte eine ironische Bemerkung. »Wieso das denn?«, hörte er sich stattdessen sagen. Falsch, ganz falsch. Er hätte sich nicht darauf einlassen sollen.
»Weil der Mörder ganz genau gewusst hat, dass wir hier massenweise Fingerspuren finden würden, in der gesamten Hütte, auch am Rollstuhl selbst. Die uns allerdings null Komma nichts bringen.« Kohlgruber wackelte mit dem Kopf. »So wie es aussieht, wurde hier nicht geputzt. Die Abdrücke stammen von Generationen von Patienten, mitsamt ihren Besuchern. Und wir haben keinerlei Möglichkeiten, sie abzugleichen.«
Kohlgruber zeigte mit dem Daumen hinter sich, in Richtung Pavillon. »Dass der Killer das Messer hat stecken lassen, deutet auch auf einen Profi hin. Eiskalt, arrogant. Ihr könnt mir nichts, heißt das. Und damit hat er recht. Das Küchenmesser ist absolute Dutzendware. Fast unmöglich, herauszukriegen, woher es stammt.« Kohlgruber streckte seinen rechten Arm aus, sodass der Beweismittelsack mit dem Messer direkt vor Pavarottis Gesicht baumelte.
»Wahrscheinlich Auftragsmord«, tönte der Spusi-Chef. Es klang triumphierend. Und dann kriegte er die Kurve, auf die Pavarotti gewartet hatte: »Viele, die hier einsitzen, stammen von außerhalb. Gibt ja in dem verschissenen Italien«, er spuckte aus, »kaum noch richtige Irrenhäuser. Wirst sehen, der Tote ist gar nicht von hier. Und der Mord, der hat nichts mit den Hiesigen zu tun.«
Hatten Morde in Kohlgrubers Augen meistens nicht. Die Meraner waren in seinen Augen allesamt Engel, die zu Gewaltverbrechen überhaupt nicht fähig waren.
»Jaja, bis nachher.« Pavarotti hatte keine Lust, Kohlgrubers Schnellschuss-Analyse, ein Zirkelschluss wie aus dem Schulbuch, noch weiter mit Kommentaren zu beehren.
Kein Mensch würde heutzutage den Fehler begehen, Fingerabdrücke auf einer Tatwaffe zu hinterlassen. Dazu brauchte es keinen Profi. Viel wahrscheinlicher war, dass der Täter aus der Klinik stammte und die Gelegenheit beim Schopf gepackt hatte.
Vor dem Eingang zum Pavillon zögerte Emmenegger. Pavarotti wunderte sich.
»Sergente, was haben Sie denn?«
* * *
Als Pavarotti eintrat, konnte er Emmenegger verstehen. Der Anblick, der sich ihm bot, war verstörend, aber nicht wegen der zur Schau gestellten Gewalt. Blut war überhaupt keines zu sehen.
Es war der Kontrast zwischen Hell und Dunkel, der der Szene einen surrealen Anstrich verlieh. Der Strahl der Schweinwerfer und die Sonne, die durch das einzige Fenster schien, tauchten die Gestalt im Rollstuhl in gleißendes Licht. Überall tanzten Staubkörnchen. Hinter den Scheinwerfern lag der übrige Pavillon im Halbdunkel.
Der Mann saß vornübergebeugt und war leicht zur rechten Seite gesackt. Ob der Messerstich die seitliche Drehung ausgelöst hatte oder Editha mit ihren Untersuchungen, konnte Pavarotti nicht feststellen, bevor er nicht einen Blick auf die Tatortfotos geworfen hatte.
Die Leiche war komplett schwarz gekleidet. Stoffhose mit Bügelfalte. Ein hauchdünner Rolli aus Seide. Die linke Hand des Toten umklammerte die Armlehne aus Chrom, die im Scheinwerferlicht silberkalt aufblitzte.
Die blonden Haare, die dem Toten in die Stirn hingen, bildeten einen scharfen Kontrast zur Kleidung und schienen im Licht zu vibrieren.
Im Halbdunkel außerhalb des Lichtkegels krochen grünliche Maden herum: die Spusi-Leute in ihren Schutzanzügen, die damit beschäftigt waren, Fingerabdrücke sicherzustellen. Plötzlich ein heller Lichtblitz. Erschrocken riss Pavarotti die Hand nach oben.
»Oh, Entschuldigung«, sagte Lundi, der Fotograf. »Das war die Letzte. Großaufnahme vom Gesicht. Der Macker sah gar nicht mal so schlecht aus für sein Alter. Vielleicht ein Popstar von anno dazumal? So wie dieser Dieter Bohlen. Den würden ein paar Frauen bestimmt auch ganz gern abmurksen.« Lundi kicherte. »Noch einen Sonderwunsch, Commissario, oder war’s das?«
Pavarotti nickte.
»Dann mach ich mich auf die Socken. Die Fotos haben Sie in einer guten Stunde auf dem Tisch.«
Pavarotti beobachtete Lundi, wie er seine Ausrüstung zusammenpackte, dann konzentrierte er sich wieder auf den Rollstuhl. Auf einmal musste er niesen. Was war das eigentlich für ein Geruch nach orientalischem Puff hier drin? Er warf seiner Schwester, die ebenfalls am Zusammenpacken war, einen durchdringenden Blick zu. Hatte wohl wieder einen gezwitschert, die Dame, und versuchte jetzt, ihre Alkoholausdünstungen durch eine Dreifachportion dieser übel riechenden Substanz zu überdecken.
»Wann ist er gestorben?«, fragte er sie.
»Irgendwann zwischen zwei und fünf Uhr morgens«, sagte Editha einsilbig.
»Die Wunde?«
»Ein einziger Stich. Glatt… sauber. Keine Fehlversuche, soweit ich s… sehen kann.« Dann drückte sie sich an ihm vorbei. Er sah, dass sie sich kurz an der Tür des Pavillons festhielt.
»Wie viel Kraft…?« Doch da war sie schon weg.
Lang geht das nicht mehr gut mit ihr.
Ein Mitarbeiter Kohlgrubers näherte sich. Pavarotti sah, dass der Mann eine behandschuhte Hand ausstreckte. In der anderen hielt er einen Beweismittelsack.
Erst jetzt fiel Pavarotti auf, dass etwas auf dem Schoß des Toten lag.
»Einen Moment bitte!«
Der Spusi-Mann nickte und trat zurück.
Es war ein kleiner Feldstecher. Ein altes Argus-Modell.
»Habt ihr die Fingerabdrücke gesichert?«
Der Spusi-Mann nickte und reichte Pavarotti ein paar Handschuhe.
Als Pavarotti das Gerät in die Hand nahm, bemerkte er, dass es eine Menge Gebrauchsspuren aufwies. Das Lederband, mit dem man sich das Gerät um den Hals hängen konnte, war allem Anschein nach erst vor Kurzem erneuert worden.
Hatte der Feldstecher dem Toten gehört?
Pavarotti stellte sich den Mann vor, wie er mit seinem Rollstuhl in den Pavillon gefahren war. Im Schutz der Hütte konnte man beobachten, ohne selbst gesehen zu werden.
Wen hatte das Opfer durch seinen Feldstecher beobachtet?
Pavarotti ging neben dem Rollstuhl in die Hocke, bis er auf Augenhöhe des Toten war. Dann schaute er durch das Fernglas, stellte es scharf.
Er hatte drei Fenster im obersten Stockwerk der Villa im Blick. Die Fensterscheiben waren dunkle Vierecke im hellen Sonnenlicht. Hinter ihnen war nichts zu erkennen.
Pavarotti richtete sich auf. Er beabsichtigte, so schnell wie möglich herauszufinden, was sich hinter diesen Fenstern abspielte.
4
Meran– Freitag, 13.Juli, im Laufe des Tages
Die Eingangstür zur Klinik stand halb offen.
Matern saß im Wartebereich der Eingangshalle und las in einer Zeitschrift.
»Wieso kann hier eigentlich jeder rein und raus, wie es ihm passt?«, fuhr Pavarotti ihn an.
Matern ließ die Zeitung sinken. »Weil wir hier ein offenes Haus führen, Commissario. Bei uns in Italien sperrt man schon lange keinen psychisch Kranken mehr ein. Unsere Patienten dürfen sich frei bewegen.«
Pavarotti starrte ihn an.
»Haben Sie das nicht gewusst? Psychiatrische Anstalten, in denen die Kranken eingesperrt werden, gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Die sind in den achtziger Jahren geschlossen worden. Es war höchste Zeit. Die Zustände in den Häusern waren fürchterlich.«
»Geschlossen worden?«, stotterte Pavarotti. »Aber… wohin…? Wo sind denn die Verrückten hin?«
Ohne auf Pavarottis sprachlichen Ausrutscher einzugehen, sagte Matern: »Den Anstaltspsychiatern ist es nie um Heilung gegangen, sondern darum, den Wahnsinn möglichst effizient zu verwalten. Ich finde, Leute lebenslang wegzuschließen, bloß weil sie nicht in unser Raster passen, ist nichts anderes als soziale Euthanasie.«
»Aber man kann diese Leute doch nicht einfach auf die Straße setzen und so tun, als wären sie geheilt!«, empörte sich Pavarotti.
»Das hat man ja auch nicht«, sagte Matern. »Man hat die Behandlung dezentralisiert. Überall in Italien, auch bei uns in Meran, sind Anlaufstellen für die Kranken gegründet worden.«
»Anlaufstellen? Aber–«
»Es gibt inzwischen viele ambulante, halb stationäre und stationäre Zentren, in denen die Leute rund um die Uhr Hilfe finden. Schwere Fälle und Akutfälle werden in die psychiatrischen Abteilungen der Krankenhäuser eingewiesen. Außerdem gibt es Privatkliniken wie die unsere. Ein Teil der Kranken ist zu ihren Familien nach Hause entlassen worden.«
»Na, die werden sich aber gefreut haben!«
Matern zuckte mit den Schultern. »Die Psychiatriereform hat bei einigen Familien keine Begeisterungsstürme ausgelöst, stimmt. Man konnte lästige Familienangehörige nicht länger einfach wegschließen.«
»Aber… manche dieser Leute sind doch extrem gefährlich! Es hat doch bestimmt… Vorfälle gegeben!«
»Sicher, Commissario«, nickte Matern. »Aber die wenigen von psychisch Kranken verübten Morde sind, im Vergleich zur Gesamtkriminalität in Italien, statistisch unerheblich.«
»Wie bitte?«
Matern stand auf. »Unsere Patienten werden nicht fixiert und auch nicht unnötig mit Medikamenten behandelt, solange ich hier das Sagen habe. Möchten Sie jetzt mit Frau Landsberg sprechen?«
Nur mit Mühe konnte sich Pavarotti auf den Mordfall konzentrieren. Er schaute Matern an. »Vielleicht ist Signore Cabruni auch einer dieser… statistischen Unerheblichkeiten zum Opfer gefallen?«
»So ein Blödsinn«, fauchte Matern. »Ich kenne meine Patienten. Keiner von ihnen stellt eine Gefahr für andere dar.«
Kopfschüttelnd folgte Pavarotti dem Psychiater.
»Sie möchte nicht, dass Sie ihr Zimmer betreten.« Im Gehen wandte sich Matern zu Pavarotti um. »Frau Landsberg ist in dem Punkt sehr eigen. Und wir achten die Privatsphäre unserer Patienten.«
Pavarotti zuckte mit den Schultern. »Wo kann ich mit ihr sprechen?«
»Wir gehen in einen unserer Therapieräume im zweiten Stock.«
Matern strebte auf eine breite Steintreppe zu, die in die oberen Etagen hinaufführte. Die Treppe war wie der gesamte Eingangsbereich im Schachbrettmuster burgunderrot und weiß gefliest. Durch die Art, wie die Fliesen gesetzt waren, entstand ein eigenartiger, perspektivisch verkürzter Eindruck, so als führten keine Stufen nach oben, sondern der Zugang sei zugemauert.
Pavarotti blieb davor stehen. »Sie gehen doch nicht davon aus, bei der Befragung anwesend zu sein?«
Matern hielt Pavarottis Blick stand. »Selbstverständlich, Commissario. Ich möchte sicherstellen, dass Frau Landsbergs Rechte respektiert werden.«
»Sie missverstehen hier etwas, Dottore. Ich befrage die Frau lediglich als Zeugin.«
»Trotzdem.« Mittlerweile waren sie die Treppe ins zweite Obergeschoss hinaufgestiegen. Matern stellte sich vor die Tür und verschränkte seine muskulösen Arme vor der Brust. »Mit mir oder gar nicht, Commissario.« Er setzte ein entschuldigendes Lächeln auf, um seinen Worten die Schärfe zu nehmen.
Pavarotti beschloss, sich vorerst geschlagen zu geben. »Meinetwegen. Was fehlt der Frau denn? Ich meine, kann sie… kann ich ganz normal mit ihr reden?«
»Normal. Damit meinen Sie wohl Ihr eigenes Kommunikationsverhalten, Commissario?«
Pavarotti, für den der Umgang mit Menschen ein Buch mit sieben Siegeln war und der Gesprächen über Persönliches aus dem Weg ging, wäre um ein Haar rot geworden.
Anscheinend hatte Matern keine Antwort erwartet. »Was ihr fehlt? Abgesehen davon, dass ich kein Freund davon bin, vorschnell Diagnosen zu stellen und die Patienten in eine Schublade zu stopfen, ist die Frage im Fall von Hanna Landsberg besonders schwer zu beantworten.«
Er kratzte sich am Kinn. »Ich bin zu Vertraulichkeit verpflichtet. Nur so viel: Sie leidet an schweren Depressionen. Es muss ein traumatisches Erlebnis stattgefunden haben, an das sich Frau Landsberg nicht erinnert.«
* * *
In dem Zimmer standen drei Stühle, die als Dreieck angeordnet waren. Auf einem Küchenstuhl, der Pavarotti als der bei Weitem unbequemste erschien, saß eine ältere Frau mit dem Rücken zur Tür.
Die Frau hatte eine massige Statur, ihr Hals war fleischig, und die grauen Haare hingen ihr in Strähnen in den Nacken. Sie schien auf der harten Stuhlkante zu balancieren. Den Rücken hatte sie durchgedrückt. Kerzengerade und starr saß die Frau da.
Pavarotti setzte sich in einen hässlichen, mit Cordsamt bezogenen Esszimmerstuhl, der ihm einigermaßen stabil erschien, und überließ Matern den dritten, einen Freischwinger.
Die Frau trug einen silbrig glänzenden Pulli, der ihr zwei Nummern zu klein war. Mit Knitterfalten überzogene Arme schauten daraus hervor. Das Gesicht selbst war überraschend faltenfrei, mit Ausnahme tiefer Einkerbungen neben Mund und Nase.
»Frau Landsberg, das ist der Commissario, von dem ich Ihnen erzählt habe«, sagte Matern.
Hanna Landsberg schaute auf ihre Hände. Ihre Kiefer mahlten.
Pavarotti wartete. Vielleicht versuchte die Frau etwas zu sagen? Als sie stumm blieb, sagte Pavarotti: »Frau Landsberg. Meiner Information nach haben Sie den Toten heute Morgen gefunden. Bitte erzählen Sie mir, wie das gewesen ist.«
Hanna Landsbergs Kopf ruckte nach oben, als merke sie erst jetzt, dass noch eine dritte Person im Zimmer war. Dann richtete sie ihre Augen auf Matern, der fast unmerklich nickte.
»Auf dem Weg zur Arbeit hab ich ihn gefunden«, sagte sie.
Pavarotti war verdutzt. »Arbeit… Sie sind doch… Wo arbeiten Sie?«, brachte er heraus.
»Hanna Landsberg arbeitet in unserem kleinen Gartenbetrieb«, mischte sich Matern ein. »Wir ziehen unser Gemüse selbst. Aber Frau Landsberg ist auch eine vorzügliche Rosenkennerin.«
»Aber ich dachte…«, entfuhr es Pavarotti.
Matern sah ihn warnend an. »Weiter, Frau Landsberg.«
»Musste an dem Pavillon vorbei. Da hab ich sie gesehen.«
»Sie? Wen?«, riefen Pavarotti und Matern unisono.
Hanna Landsberg warf Matern einen Blick zu, der Pavarotti fast boshaft vorkam.
»So viele Fleischfliegen. Rein und raus aus dem Haus. Rein und raus«, wiederholte die Frau in singendem Tonfall und fing an, mit dem Oberkörper zu schaukeln. Hatte Pavarotti sich getäuscht, oder hatte der Mann neben ihm eben erleichtert ausgeatmet?
»Es waren also die Fleischfliegen, die Ihnen das Gefühl gaben, es könnte etwas nicht stimmen?«
»Hab gedacht, jemand hat vielleicht ein Wurstbrot liegen lassen. Die Insassen hier kümmern sich um nichts und haben keinerlei Verantwortungsgefühl, müssen Sie wissen«, sagte sie auf einmal in einem ganz normalen Tonfall. »Als ich ihn sah, von hinten, wusste ich gleich, wer es war. Der Schwarze.« Sie kniff missbilligend die Lippen zusammen. »Schwarz. Das ist doch keine Farbe für den Hochsommer.«
»Ist Ihnen im Pavillon etwas Besonderes aufgefallen, oder haben Sie vielleicht jemanden gesehen?«
Wieder ein winziges Zögern, ein kaum merklicher Blick, der hinüber zu Matern huschte. »Hab niemand Besonderen gesehen. Außer den Schwarzen.«
»Erinnern Sie sich, ob Sie im Pavillon irgendetwas angefasst haben?«, fragte er.
»Hab ihn von hinten angetippt. Da ist er umgekippt.«
»Haben Sie den Messergriff angefasst?«
Die Frau schüttelte den Kopf und sah ihn dabei unverwandt an.
»Kam Ihnen der Griff bekannt vor?«
Kopfschütteln.
»Hatten Sie mit dem Mann Kontakt?«
»Der hat nie was gesagt. Nicht mal ›Guten Tag‹. Das gehört sich nicht, finde ich.«
»Na gut. Vielen Dank, Frau Landsberg. Sie können gehen.« Er sah der stämmigen Gestalt, die keinerlei Taille besaß, hinterher.
* * *
»Dottore, was sollte die Geschichte mit den Depressionen?«, fragte Pavarotti. »Die Frau macht doch einen einigermaßen normalen Eindruck, jedenfalls steht sie morgens auf und werkelt in Ihrem Gemüsegarten!«
Matern verzog den Mund. »Dass Hanna Landsberg jeden Morgen um sieben Uhr in den Garten geht, ist ein Märchen. Sieben Uhr war ihr Arbeitsbeginn in dem großen Gartenbaubetrieb, in dem sie angestellt war. Sie ist hier bei uns, weil sie nicht mehr zur Arbeit erschien. An guten Tagen klappt es mit dem Aufstehen, doch die sind selten. Meistens müssen wir sie erheblich… motivieren, ihr Bett zu verlassen.«
»Aber warum…?«
»Warum ich ihr nicht widersprochen habe? Es ist sehr wichtig, den Patienten ein Stück Normalität zu bewahren. Auch dann, wenn es nicht ganz der… Wirklichkeit entspricht.«
»Finden Sie es nicht eigenartig, dass sie gerade an diesem Morgen aus dem Bett gekommen ist, Dottore?«
Matern zuckte mit den Achseln. »Was heißt schon eigenartig? Vielleicht hat sie draußen oder im Nebenraum etwas gehört, ohne sich dessen bewusst zu sein.«
»Im Nebenraum?«
»Nun, ihr Zimmer befindet im Erdgeschoss, unmittelbar neben dem von Signore Cabruni.«
Pavarotti fuhr hoch. »Und das sagen Sie erst jetzt?« Schnell stand er auf, trat auf den Flur hinaus und schaute nach unten in den Treppenschacht. Er sah, dass Hanna Landsberg ein Stockwerk tiefer am Fenster stand. Ihr Blick war unverwandt auf etwas gerichtet, das sich dort draußen befand.
»Frau Landsberg, kommen Sie bitte noch einmal!«
Das Schachbrettmuster machte Pavarotti schwindlig, er musste sich am Geländer festhalten.
Als Hanna Landsberg Pavarotti bemerkte, trat sie abrupt vom Fenster zurück und stieg die Treppe wieder nach oben.
»Haben Sie heute Nacht zwischen zwei und fünf Uhr früh etwas im Zimmer Ihres Nachbarn gehört?«
Zu seiner Überraschung nickte die Frau langsam. »Da war eine Stimme. Nebenan. Ich glaube, ein Mann.«
»Gab es Streit?«
»Weiß nicht. Hab nur eine Stimme gehört.«
»Wissen Sie, um wie viel Uhr das war?«
»Hab nicht auf die Uhr geschaut.«
»Kann Signore Cabruni es selbst gewesen sein? Vielleicht hat er im Schlaf gesprochen?«
Hanna Landsberg schaute ihn an. Ihre Mundwinkel zuckten. »Woher soll ich das wissen?«
* * *
Als Pavarotti in den Therapieraum zurückkehrte, spürte er immer noch einen leichten Schwindel. Er trat er ans Fenster und wollte den Griff drehen. Doch der bewegte sich keinen Millimeter.
»Diese Fenster lassen sich nicht öffnen, Commissario«, sagte Matern hinter ihm. »Nach zwei bedauerlichen Vorfällen haben wir sämtliche Fenster im obersten Stockwerk verrammelt.«
Pavarotti zog die Augenbrauen hoch, dann fiel sein Blick in den Garten. Der Pavillon befand sich genau in seiner Blickrichtung.
»Wer praktiziert in diesem Raum?«
»Ich selbst«, antwortete Matern in erstauntem Ton.
»Und die beiden Räume links und rechts davon…?«
»Sind Patientenzimmer. Belegt von unserer Sylvie Steyrer und unserem Paul Tschugg.«
Pavarotti merkte sich vor, sich die beiden als Erstes vorzunehmen.
»Ich möchte gerne das Haus sehen und, wenn wir schon dabei sind, das Zimmer des Toten«, befahl er.
Matern zuckte die Achseln. »Ihr Sergente hat das Zimmer bereits durchsucht, soviel ich weiß. Na schön. Kommen Sie.«
Während sie über den Flur schritten, ließ sich Pavarotti über die Klinik unterrichten.
Das Sanatorium trug den Namen »Villa Speranza« und befand sich in der Hand von einem Dutzend privater Investoren. Matern war Chef und Eigentümer der Betreibergesellschaft, die den Zweck hatte, die medizinische Versorgung der Villa Speranza sicherzustellen.
»Bei uns sind gute psychiatrische Arbeit und eine attraktive Rendite für die Investoren keine Gegensätze«, dozierte Matern. Ein Satz wie aus einer Hochglanzbroschüre für künftige Geldgeber.
In der Villa befanden sich, den Toten mitgerechnet, derzeit achtundzwanzig Patienten. Die Klinik war fast vollständig belegt. Sechs Patienten waren im zweiten Obergeschoss, zwölf im ersten Stock und zehn im Erdgeschoss untergebracht. Zwei Fachärzte für Psychiatrie arbeiteten in der Klinik. Einer der Psychiater war Anselm Matern selbst. Dazu kam ein Diplom-Psychologe. Eine Schwester und zwei Pfleger waren für die tägliche Betreuung zuständig. Die Klinik unterhielt eine eigene Apotheke, die die Patienten mit Psychopharmaka und Medikamenten gegen ihre körperlichen Beschwerden versorgte, aber auch externen Kunden offenstand.
»Kann ich nachher mit Ihren beiden Kollegen sprechen?«, fragte er.
Matern antwortete nicht gleich. »Das geht leider nicht«, sagte er schließlich. »Meine Vertretung ist momentan im Urlaub. Und unser Psychologe hat uns gerade verlassen. Die Stelle ist noch nicht nachbesetzt.«
»Soso«, sagte Pavarotti. »Der Personalstand bei Ihnen ist nicht gerade üppig, was?«
»Wir können das hohe Versorgungsniveau unserer Patienten problemlos aufrechterhalten«, schnappte Matern. »Sie müssen sich nicht unseren Kopf zerbrechen.«
Sie gingen die Treppe zum Mittelgeschoss hinunter.
Matern öffnete eine Tür. »Hier ist eins der beiden Stationszimmer unserer Pflegekräfte.« Das Zimmer war leer.
»Ich hatte doch angeordnet, dass das Personal hierbleibt!«, sagte Pavarotti scharf.
Matern tat so, als habe er den Rüffel nicht gehört. »Im Erdgeschoss befindet sich ein zweites Stationszimmer. Vermutlich sind sie dort.«
* * *
Ein großer Mann mit Stiernacken, den Matern als Pfleger Bruno Slawicz vorstellte, und eine füllige Sommersprossige saßen in der Teeküche und hatten Maxi-Tassen vor sich stehen, aus denen Dampf hochstieg. Auf der Tasse der Sommersprossigen stand ANNA in verschnörkelten Buchstaben.
Angeblich wusste keiner der beiden, wie Michael Cabruni durch den Garten zur Lichtung mit dem Pavillon gekommen war.
»Ich kann mich nicht erinnern, dass Signore Cabruni in der kurzen Zeit seines Hierseins überhaupt einmal draußen war«, sagte Schwester Anna kopfschüttelnd. »Ich verstehe das nicht. Er hielt sich meistens in seinem Zimmer auf. Am Ende war er kaum noch ansprechbar. Man musste seine Hand nehmen, um ihn…« Sie verstummte.
»Er war aber gesundheitlich so gut beieinander, dass er sich selbst mit dem Rollstuhl vorwärtsbewegen konnte, oder?«
»Das ist es ja, was ich nicht verstehe«, sagte die Schwester unglücklich. »Er hatte gar keinen Rollstuhl in seinem Zimmer. Er konnte ja gehen, ich hab ihn geführt, wenn er zur Therapie musste. Natürlich gibt es Rollstühle in unserem Versorgungsraum im Erdgeschoss. Aber der ist normalerweise abgeschlossen.«
»Diese… Apathie. Die ist also in den letzten Tagen schlimmer geworden?«, forschte Pavarotti.
Die Schwester nickte, doch dann färbten sich ihre Wangen rötlich, als sie zu Matern hinüberschaute. »Da müssen Sie Dr.Matern fragen«, sagte sie schnell und biss sich auf die Lippen. »Mit solchen Diagnosen kenn ich mich nicht aus. Ich muss jetzt Medizin austeilen.« Ihr Rock raschelte, als sie verschwand.
* * *
Draußen baute Matern sich vor Pavarotti auf. »Ich protestiere, Commissario. Fragen Sie mich gefälligst selbst, wenn Sie sich Informationen über den psychischen Zustand meiner Patienten verschaffen wollen! Ich werde Ihnen helfen, soweit ich es vertreten kann. Aber versuchen Sie nicht, mein Personal auszuhorchen!«
»Ich frage Ihre Mitarbeiter das, was ich für richtig halte«, entgegnete Pavarotti. »Also, was hat dem Toten gefehlt?«
Matern warf ihm einen zornigen Blick zu. »Michael Cabruni hat einen Nervenzusammenbruch erlitten, nachdem er einen groben Fehler bei seiner Arbeit gemacht hat. Ich konnte mit ihm nur zwei Sitzungen abhalten. Danach war eine Gesprächstherapie nicht mehr möglich. Auf Antidepressiva sprach er bislang nicht an.«
»Was für ein grober Fehler bei der Arbeit?«
»Anscheinend war er Chefingenieur auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich glaube, er stand im Dienst der Reederei LeStelle. Etwas Schwerwiegendes muss bei seiner letzten Fahrt passiert sein. Etwas, wofür er die Verantwortung trug. Aber jedes Mal, wenn ich die Rede darauf brachte, hat Signore Cabruni vollkommen dichtgemacht.«
Matern zögerte kurz. »Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass dieses Ereignis, was es auch immer sein mag, die Schwere seines Zusammenbruchs erklärt. Vielleicht war der Vorfall nur ein Auslöser, eine Art Trigger. Aber damit können Sie vermutlich nicht viel anfangen.«
Das traf die Sachlage ziemlich gut. Pavarotti hatte keine Ahnung von diesem Psychokram, und er interessierte sich nicht im Geringsten dafür.
Psychologie. Lissies Ding. Diesem Doc würde sie jetzt ordentlich den Marsch…
Unnütze Gedanken, die zu nichts führten.
»Mochten Sie den Toten?«, fragte er.
Matern blieb stehen. »Viele meiner Kollegen würden angesichts einer solchen Frage nur den Kopf schütteln, Commissario.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Für die meisten Psychotherapeuten sind Gefühle für Patienten tabu. Allerhöchstens Empathie. Verständnis.«
»Und für Sie?«
»Wir können Menschen nur helfen, wenn wir uns selbst wie Menschen verhalten«, sagte Matern. »Jedenfalls ist das meine feste Überzeugung. Ich versuche, alle meine Patienten zu mögen, so, wie sie durch die Tür kommen. Aber bei ihm wollte es mir einfach nicht gelingen.« Matern wirkte nachdenklich. »Er war so ein… Geheimniskrämer. Ich glaube, er machte sich einen Spaß daraus, mich im Unklaren zu lassen. Ich habe es nicht begriffen. Es ging ihm schlecht, und er bezahlte eine Menge Geld für die Sitzungen.«
* * *
»Hier sind wir.« Matern drückte eine Klinke. »Das war Signore Cabrunis Zimmer.«
Pavarotti sah sich um. Ein Bett auf Rollen. Ein Schrank. Ein Tisch. Ein Stuhl.
Er holte sein Handy heraus und rief Emmenegger an. Der Sergente hatte das Zimmer tatsächlich bereits durchsucht.
»Der Tote hatte ein Blackberry, Commissario. War ausgeschaltet und passwortgesichert. Der ist schon beim Gruber.«
Die Passwortsicherung stellte kein Hindernis dar. Ein Klacks für Gruber von der Bozner Kriminaltechnik. Gruber war ein Freak, den man nicht auf andere Leute loslassen durfte, aber fachlich war er einsame Spitze.
Pavarotti stöberte zur Sicherheit noch einmal selbst durch Cabrunis Toilettensachen und tastete die Kleidungsstücke ab. Schwarze Hemden, schwarze Hosen, sogar die Unterhosen waren schwarz.
In der Seitentasche einer schwarzen Lederjacke steckte ein Bahnticket vom 5.Juli. Venedig nach Meran, einfache Fahrt. Zwei Mal umsteigen, in Verona und Bozen. Überrascht ließ Pavarotti das Ticket sinken. Gleichzeitig war er wütend. Wer konnte ein Bahnticket übersehen? So etwas brachte nur Emmenegger fertig.
»Der Ermordete kam mit dem Zug?«, fragte er. »Ich dachte, man wird im Krankenwagen hergebracht? Oder in schweren Fällen von der Polizei?«
Matern lächelte. »Das war früher einmal so, Commissario. Als Psychiatriepatienten wie Schwerverbrecher behandelt und in Anstalten weggeschlossen wurden. Heute suchen viele Menschen von sich aus Hilfe. Auch Signore Cabruni hat sich freiwillig bei uns eingewiesen. Er ist selbst angereist.«
»Anscheinend war er zu diesem Zeitpunkt noch Herr seiner Sinne. Er konnte seine Reisevorbereitungen treffen und eine längere Zugfahrt selbst bewältigen«, sagte Pavarotti nachdenklich und faltete das Ticket zusammen. Merkwürdig. »Wie kann jemand binnen weniger Wochen dermaßen den Verstand verlieren?«
Matern zuckte die Achseln. »Jetzt werden wir das nicht mehr herausfinden, Commissario.«
Wieso hatte sich der Mann nicht in Venedig behandeln lassen? Wieso Meran?
»Hatte Signore Cabruni hier Familie?«, fragte er den Psychiater.
Matern hatte aus dem Fenster geschaut. Jetzt drehte er sich um. »Sie fragen mich am laufenden Band Dinge, auf die ich keine Antwort habe, Commissario. Jedenfalls hatte er keinen Besuch, solange er hier war. Ich habe keine Ahnung, warum er sich unsere Klinik ausgesucht hat.«
Wieder eine Sackgasse.
»Dann möchte ich jetzt anfangen, die Patienten zu vernehmen, Dottore. Bitte veranlassen Sie, dass ich zu Beginn ein paar Worte zu allen sprechen kann.«
Matern sah ihn ein paar Sekunden an. Dann schien er einen Entschluss gefasst zu haben.
»So einfach ist das nicht, Commissario. Die meisten unserer Patienten sind schwer gestört. Heute ist ein besonders komplizierter Tag. Diese Menschen haben sich hier bei uns sicher gefühlt. Der Mord hat ihnen einen Schock versetzt. Dazu kommt die Hitze.«
Er verzog das Gesicht. »Sie werden das vielleicht nicht verstehen, aber ein paar unserer Patienten sehen die Hitzewelle als eine Bestrafungsaktion, die sich gegen sie persönlich richtet… Wenn Sie aus diesen Menschen etwas Vernünftiges herausbekommen wollen– sofern das überhaupt klappt–, dann müssen Sie abwarten, bis sie sich etwas beruhigt haben. Kommen Sie morgen Vormittag wieder. Wenn wir Glück haben, gibt es in der Nacht endlich ein Gewitter.«
* * *
Vormundschaftsgericht Bozen•Gerichtsplatz1•39100 Bozen
An Herrn Dr.Sigmund Frahm
Winkelweg 43
39012 Meran
Bozen, 1.August
Beauftragung eines psychiatrischen Gutachtens
Sehr geehrter Herr Dr.Frahm,
hiermit werden Sie in Ihrer Eigenschaft als Psychiater und Kriminalpsychologe sowie als staatlich bestellter Sachverständiger der Kommune Meran mit der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens über die beschuldigte Person in einem Mordfall beauftragt.
Sämtliche Fallakten und andere Aufzeichnungen des Ermittlungsleiters(Commissario Luciano Pavarotti, Meran) zur beschuldigten Person werden Ihnen in Kürze zur Verfügung gestellt.
Die Fragestellungen, mit deren Prüfung Sie beauftragt werden, lauten:
Hat die beschuldigte Person zur Tatzeit an einer psychischen Störung gelitten– und wenn ja, an welcher?
War die beschuldigte Person zur Tatzeit wegen dieser psychischen Störung unfähig zur Einsicht in das Unrecht der Tat?
Zeitpunkt der Fertigstellung des Gutachtens: 20.August
Der Ordnung halber weise ich Sie auf Ihre Pflicht zur Geheimhaltung sämtlicher mit dem Gutachten in Zusammenhang stehenden Tatbestände sowie auf die strafrechtlichen Folgen eines fehlerhaften Gutachtens hin.
5
Meran– Mittwoch, 8.August
1. Gesprächsprotokoll von Dr.Sigmund Frahm,
Kriminalpsych.
Vormittagssitzung
Sie wollen sich also ein Bild über meinen Geisteszustand machen, Herr Doktor. Ich bin nicht verrückt, aber das sagen sie alle, nicht wahr?
Womit soll ich anfangen? Ich finde chronologische Erzählungen langweilig, Sie auch?
Nein. Sie sind ein Typ, der es gerne ordentlich hat. Vermutlich hätten Sie liebend gerne einmal einen Patienten mit einem sauberen und appetitlichen Innenleben. Stattdessen servieren Ihnen die meisten einen großen Haufen Dreck, und Sie müssen die Gummihandschuhe überstreifen und bis zum Ellbogen hineinfassen. Sie sind wirklich nicht zu beneiden.
Ich bedauere zutiefst, bei mir wird’s nicht viel anders. Aber wenigstens ist mein Fall etwas Besonderes.
War das ein Lächeln? Ich versteh schon. Alle Patienten lechzen nach Ihrem Verständnis. Jeder will Ihr wichtigster Fall sein. Ist es nicht so?
Ich wette, die meisten steigen mit einem Knaller ein.
Ich dagegen beginne mit einer banalen Szene vor dreißig Jahren. Der 14.Juni 1985.
In der Welt passierte an dem Tag etwas, das mich hätte vorwarnen können. Flug TWA847 von TransWorld wurde über dem Mittelmeer entführt. Auch für mein Leben erwies sich der Tag als ungemein wichtig. Ohne diesen kurzen Vorfall hinter dem Frankfurter Hauptbahnhof, nicht mehr als ein Fliegenschiss auf der großen Ereigniskarte…
Aber es ist müßig, darüber zu spekulieren.
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich auf dieser dreckigen Straße stehen, als wären seither erst ein paar Wochen und nicht so viele Jahre vergangen.
Ich spüre noch das T-Shirt, das mir am Rücken klebte, und die Schweißtropfen, die mir die weiten Hosenbeine hinunterliefen. Es war ein heißer Tag, und Schatten spendender Baumbestand war in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs eher spärlich.
Ich stand da, wartete und starrte auf den großen Torbogen auf der anderen Straßenseite. Ich dachte, wenn ich nur fest genug hinschaue, dann kommt sie endlich raus, und die Warterei in der Hitze hat ein Ende.
Es war bereits nach fünf. Büroschluss. Es erschienen ein paar Leute aus den Hofeinfahrten. Aber von ihr war weit und breit nichts zu sehen. In den Häusern der Hinterhöfe sollten tolle Lofts mit angesagten Firmen untergebracht sein. Von dort, wo ich stand, sah man davon allerdings nichts. Hässliche Mietskasernen, wohin man blickte.
Direkt neben dem Torbogen war ein Laden, der Autoteile verkaufte. Ich weiß nicht mehr, was auf dem Blechschild über der Ladentür stand, aber ich glaube, es war Italienisch. Unter den Fenstern, die blind vor Schmutz waren und bestimmt schon seit Jahren kein Wasser mehr zu sehen gekriegt hatten, war ein Haufen Autoreifen aufgestapelt. Es stank widerlich nach Gummi, bis zu mir rüber auf die andere Straßenseite.
Ich war das erste Mal hier und ziemlich baff. In dieser Gegend sollte etwas untergebracht sein, das die Bezeichnung »angesagt« oder »schick« verdiente?
Nur dass Emma nicht »untergebracht sein« sagte. Mit so banalen Ausdrücken hielt sie sich nicht auf. Bei ihr hießt das »re-si-die-ren«.
Himmelherrgott, warum musste sie bloß immer so gespreizt daherreden! Bei ihr war immer alles schick und superspannend und wasweißichnichtalles.
Wenn mich mein Erinnerungsvermögen nach fast dreißig Jahren nicht täuscht, waren in dem Haus bloß ein Schulbuchverlag, eine Druckerei und natürlich »ihre« Mini-Werbeagentur untergebracht. Nun, nicht ihre selbstverständlich, sie arbeitete halt dort. Oder tat zumindest so, als ob. Wahrscheinlich war es aber wieder das Übliche: Alle scharwenzelten um sie herum, und die kleine Prinzessin brauchte nicht viel mehr zu tun, als huldvoll zu lächeln.
Ich probierte, mich an der Häuserwand anzulehnen, aber dann ließ ich es sein, weil der Verputz grobkörnig war und ich fürchtete, mein neues Leinenjackett, todschick mit extradicken Schulterpolstern, zu ruinieren. Unsere Eltern ließen sich mit den Schecks nicht lumpen, das musste man ihnen lassen.
Ich höre noch den lang gezogenen Pfiff von einem Zug, der ein paar hundert Meter hinter mir in den Frankfurter Bahnhof einfuhr. So, als wollte er das Erscheinen Ihrer Hoheit ankündigen– und prompt kam sie raus. Natürlich nicht allein, sondern wie immer von einer Menschentraube umgeben, alles Büromädels, lauter gackernde Hühner.
Ich sehe noch, wie sie verschwörerisch zu mir rübergrinst, und ich denke, Emma, jetzt komm endlich, damit wir loskönnen.
Aber sie kommt nicht, sondern tuschelt weiter mit diesen Miezen. Zuerst denke ich, sie will mir bloß demonstrieren, wie beliebt sie ist. Obwohl es mir bis heute ein Rätsel ist, wieso, denn sie war potthässlich.
Meine Schwester Emma war vorne so platt wie eine dürre alte Jungfer. Dafür hatte sie bei der Nase dreimal »Hier« geschrien. Und dann dieses permanente Grinsen, wie Axel Foley in »Beverly Hills Cop«. Bloß dass Eddy Murphy cool war und sie nicht.
Wo war ich?
Emma und die anderen Schnecken flüsterten auf der anderen Straßenseite, als ob es ein großes Geheimnis zu besprechen gäbe. Da fiel mir auf, dass sie immer wieder ihr neues gesmoktes Oberteil an der Brust zusammenschob, damit es obenrum mehr auftrug. Sinnloses Unterfangen. Außerdem hatte sie ganz rote Backen, und sie riss die Augen so weit auf, dass sie fast so groß wie Untertassen waren. Und plötzlich erinnerte ich mich, dass sie schon in den letzten Tagen so aufgedreht gewirkt hatte. Die alte Martha, die uns den Haushalt führte, hatte es auch gemerkt und die Stirn gerunzelt.
Als ich sie so beobachte, fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Die ist verknallt, denke ich. Und als sie dann endlich zu mir rübergestürzt kommt, sie guckt nicht links oder rechts, da wusste ich, dass ich recht hab. Schon hängt sie an meinem Hals und faselt einen Haufen Zeugs, wie immer. Ich will gerade meine Ohren auf Durchzug schalten, da höre ich, wie Emma sagt, sie möchte mir jemanden vorstellen und dass er gleich hier wäre.
Die anderen Mädels rennen in Richtung Hauptbahnhof, um ihre Bummelzüge zu erwischen, und als sie außer Sicht sind, ist es wieder ruhig auf der Straße. Ich schüttle Emma ab, die sich bei mir unterhaken will– bei den Temperaturen!–, und starre auf den vor Hitze flimmernden Torbogen. Als der Typ um die Ecke biegt, sehe ich zuerst einen Schuh, dann noch einen, und dann kommt der Rest von ihm. Wenn ich heute an diese Sekunden zurückdenke, bin ich sicher, dass die Zeit wirklich und wahrhaftig langsamer lief.
Der Kerl saß im Rollstuhl.
Aber das war noch nicht alles.
Als ich begreife, was mir meine Augen mitteilen, fühle ich, wie das Lachen in mir aufsteigt und mich am Gaumen kitzelt.
Unsere Eltern waren die Lippenliberalen schlechthin. Ich habe das Gefühl, Sie sind auch so einer. Haben Sie eine Tochter, Herr Doktor?