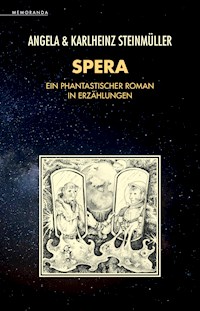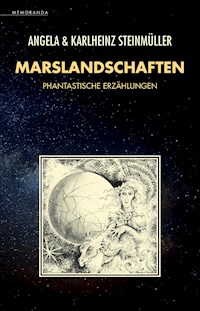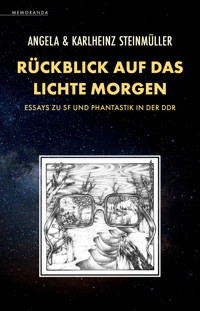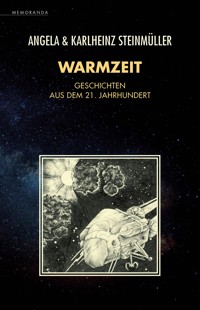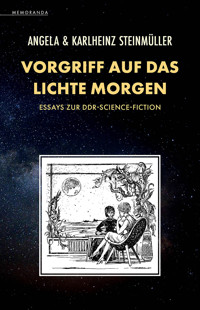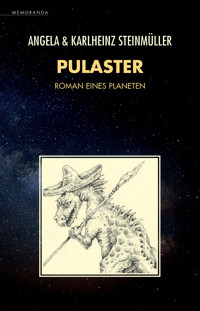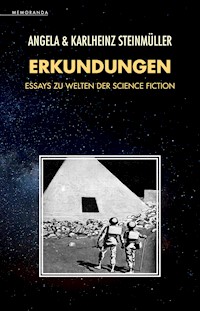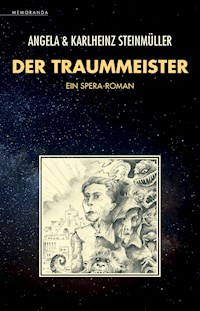Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Werke in Einzelausgaben
- Sprache: Deutsch
"Computerdämmerung" bietet einen Blick auf die Vielfalt der Erzählungen der Steinmüllers abseits ihres Zyklus über das "Steinmüller-Universum". Auf eine strikte thematische Gliederung wurde verzichtet, nicht aber auf eine lockere Gruppierung um Schwerpunkte: In den meisten Geschichten geht es um phantastische technische Entwicklungen, die das Leben auf der Erde in einer nicht allzu fernen Zukunft gravierend verändern – seien es die SF-typischen Roboter und intelligenten Computer, das beliebige Kopieren von Sachen und Menschen, unheimliche Erscheinungen in den Datennetzen oder ungewöhnliche Erfindungen. Doch auch die biologischen Aspekte der Veränderung – gewollter wie ungewollter – kommen ins Bild, und am Schluss des Bandes findet sich ein Exkurs in Zukünfte weit über den Horizont unserer Zivilisation hinaus. Weit gespannt ist auch die Entstehungszeit der Erzählungen – die Jahre der Erstpublikationen reichen von 1979 bis 2010. Viele von den älteren Erzählungen wurden schon 2010 für "Computerdämmerung" überarbeitet, für die nun vorliegende Neuausgabe aber auch zwei von den jüngsten. Ein ebenfalls neues Vorwort von Karlheinz Steinmüller ergänzt den Band. Angela und Karlheinz Steinmüller · Werke in Einzelausgaben · Band 6
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Angela und Karlheinz Steinmüller
Computerdämmerung
Phantastische Erzählungen
Angela und Karlheinz Steinmüller
Werke in Einzelausgaben. Band 6
Herausgegeben von Erik Simon
Impressum
Angela und Karlheinz Steinmüller: Computerdämmerung.
Phantastische Erzählungen
(Werke in Einzelausgaben. Band 6, erweiterte Neuausgabe)
Herausgegeben von Erik Simon
Titelvignette von Thomas Hofmann
© 1979–2010, 2023 Angela und Karlheinz Steinmüller (für die Erzählungen)
Die Daten der Erstpublikationen sind der »Publikationsgeschichte« am Ende des Bandes zu entnehmen.
© 2023 Karlheinz Steinmüller (für sein Vorwort)
© 2010, 2023 Erik Simon und Memoranda Verlag (für die Zusammenstellung dieser Ausgabe)
© 2023 Thomas Hofmann (für die Titelvignette)
© dieser Ausgabe 2023 by Memoranda Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Erik Simon
Gestaltung: Hardy Kettlitz & s.BENeš [www.benswerk.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
ISBN: 978-3-948616-80-9 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-81-6 (E-Book)
Inhalt
Impressum
Von Lochkarten und dem Ende des Computerzeitalters
Duell der Tiger
Das japanische Puppenhaus
Die Audienz
Spätes Talent
Operation Computerdämmerung
Das Internetz in den Händen der Arbeiterklasse
Sturz nach Atlantis
Freie Türklinken für alle!
Gespräch mit einem Buch-Macher
Wolken, zarter als ein Hauch
Manche mögen’s heiß
Meine Agenten, ein Maulwurf und ich
München durch die Cyber-Brille
Der Schwarze Kasten
Organspende
Reservat
Gott und das Virus oder Der Augenstein
Zerdopplung
Von kommenden Schrecken
Der den Staub wegbläst
Vier Minuten Ewigkeit
Publikationsgeschichte
Bücher bei MEMORANDA
Von Lochkarten und dem Ende des Computerzeitalters
Vorwort
Nein, wir haben Lochkarten und Lochbänder nicht sämtlich ins Altpapier gegeben. Nicht in der Wirklichkeit und nicht in unseren Erzählungen. So ein Stück gestanzter Karton, so ein Streifen gelochtes Papier ist mehr als nur irgendein Souvenir. Du hältst die Karte in der Hand, befühlst die glatte Oberfläche, ertastest die Lochungen. Das ist pure, handgreifliche Information, Loch für Loch. Du kannst die Daten mit bloßem Auge sehen, und wenn du dich unwahrscheinlicherweise mit der Codierung noch auskennst, verstehst du sogar, was die Muster bedeuten. Im Vergleich dazu sind Disketten oder USB-Sticks kompakte Datenfriedhöfe. Du bekommst nicht einmal mit, ob sie überhaupt Daten tragen und ob sich auf ihnen ein tückisches Virus versteckt. Dagegen die solide Lochkarte, der verspielte, mit der Papierschlange verwandte Lochstreifen! Wir bewahren letzte Exemplare dieser ausgestorbenen Datenträger in einer Schublade auf, Erinnerungsstücke an den Berufsanfang. Auf sie wollen wir nicht verzichten.
Dasselbe gilt auch für die Lochbänder in unserer Story »Spätes Talent«, einem der ältesten Texte in diesem Band. Sie spielt in einer fiktiven, im Erscheinungsjahr 1979 leicht zukünftigen DDR mit der Rechentechnik der Epoche, mit Datenerfassungsplätzen, an denen man die Löcher in die Streifen stanzt, die ihrerseits später in Lesegeräte eingelegt werden. Angela hatte dergleichen als EDV-Managerin kennengelernt. An einer Story, in der solche Geräte eine nicht unwichtige Rolle spielen, läßt sich selbstverständlich nichts modernisieren, nichts auf einen neueren technischen Stand bringen, ohne die Erzählung zu kastrieren. Und trotzdem bleibt sie Science Fiction.
Es gibt Autoren, die bei einer erneuten Publikation ihrer Texte Wert auf Aktualisierung legen, schon weil sie glauben, daß ihren Lesern past futures, ehemalige Zukünfte, nicht gefallen könnten, und weil sie nicht wollen, daß, wie es bisweilen in den Medien heißt, die Realität die Science Fiction überholt. Was übrigens zum ersten Mal nach dem Sputnikstart im Jahr 1957 behauptet wurde.
Die Informatik, elektronische Rechentechnik, verändert sich besonders rasant. Klackende Relais in Robotern passen heute nur noch in Steampunk oder eben in Röhren- und Relaispunk. Wir halten es mit Isaac Asimov. Der ist bei seinen Positronengehirnen geblieben, obwohl diese, schon als er seine ersten Storys schrieb, eine physikalisch wenig tragfähige – aber eben literarisch gut brauchbare – Idee waren.
Im Groben kann man anhand einiger Erzählungen in diesem Band die Parallelentwicklung von Computerei und SF-Visionen nachvollziehen. »Duell der Tiger« wurde wie »Spätes Talent« 1979 gedruckt; damals waren gerade die ersten personal computers – die ersten Apple-Geräte, die ersten Commodores – auf den Markt gekommen, unerreichbar für uns DDR-Bürger. Der Begriff »Hacker« existierte noch nicht, und unter intelligenten Agenten und Avataren hätte man sich alles Mögliche, nur keine Softwarewesen vorstellen können. Ich schleppte zu dieser Zeit noch schwere Metallkisten voller Lochkarten zu einer gewaltigen BESM 6 im Akademie-Rechenzentrum in Berlin-Adlershof, wartete dann drei Tage auf die breiten Papierbänder mit dem Ergebnis. Manchmal hatte ich mich auf der fünften oder der fünfzigsten Karte verlocht, bekam also nur eine Fehlermeldung … Aber bald sollte auf den phantastisch schnellen »Dialogbetrieb« umgestellt werden: Du gibst etwas über die Tastatur ein und erhältst praktisch sofort ein Resultat auf dem Bildschirm. Auch von vernetzten Rechnern mit »Standleitungen« durfte man schon träumen – im Westen war dergleichen bereits Standard. So gesehen spielt »Duell der Tiger« in einer westlich angehauchten Zukunft, in der es nicht nur so etwas wie das Internet mit Fernzugriff auf Datenbanken, sondern auch intelligente Agenten, alle möglichen Schadprogramme und smart homes gibt. »Meine Agenten, ein Maulwurf und ich« dreht sich – zwanzig Jahre später geschrieben und mit der 1999 aktuellen Terminologie – um sehr ähnliche Tücken der Technik in einer bereits zum Greifen nahen Zukunft.
Besonders problematisch wird Technik, wenn man sie zu boshaften Zwecken einsetzt wie in der Story »Computerdämmerung«, in der sich die untergehende DDR an der vercomputerten Welt rächt. Heute könnte das höchstens noch Nordkorea. Globale Computer-Blackouts sind uns zwar erspart geblieben, aber für den Betroffenen sind Ransomware-Attacken auch nicht viel besser.
In den neunziger Jahren haben wir dann eigene Erfahrungen mit dem Internet und seinen Macken gemacht, ja, ich konnte sogar behaupten, daß in »Duell der Tiger« Grundzüge meiner eigenen vernetzten Büro-Arbeitswelt wiederzufinden seien. Zugleich ließ uns die DDR nicht los: Wie hätte sich »Das Internetz in den Händen der Arbeiterklasse« weiterentwickelt – in jenem Paralleluniversum, in dem es die DDR noch gibt? Gewiß mit harten Einschränkungen und Zensurmaßnahmen, die weit über jede Datenschutzgrundverordnung hinausgehen, aber vielleicht auch mit Regeln, die wir heute im Zeitalter von Spams und Phishing, Fakes und Trollen bitter vermissen. Von Künstlichen Intelligenzen redete man damals, kurz vor dem Jahr 2000, selten; die KI-Forschung befand sich gerade in ihrer zweiten oder dritten Stagnationsphase, aber man durfte schon spekulieren, daß in Bälde Algorithmen das Bücherschreiben übernehmen würden. Inzwischen generiert spezialisierte Software immerhin schon routiniert und unauffällig Wetter-, Sport- und Finanzberichte. Da ist der Schritt zum 08/15-Krimi oder zur Space Opera von der Stange schon gar nicht mehr so weit, oder?
Sehr früh war uns auch bewußt, daß eine direkte Verbindung des menschlichen Nervensystems mit der Informationstechnik, also das, was wir heute als brain computer interfaces (BCI) bezeichnen, immense Chancen, aber auch enorme Risiken in sich birgt. Der spanische Physiologe José Delgado hatte schon 1965 mit primitiven BCIs Furore gemacht: Er stellte sich publikumswirksam in eine Stierkampfarena und ließ einen wutschnaubenden Bullen auf sich zupreschen. Mit einem elektrischen Impuls ins Gehirn stoppte er das Tier. Gleich drei Erzählungen, allesamt 1984 zum ersten Mal publiziert, drehen sich um Elektroden im Gehirn und die Verbindung von Organischem und Technischem (»Der Schwarze Kasten«, »Das Reservat« und »Organspende«). Angesiedelt in einer etwas ferneren Zukunft sind sie von der technischen Entwicklung bislang weder ein- noch überholt worden. Zum Glück, möchte man hinzufügen, denn angenehme Konsequenzen hat das Verbinden von Gehirn und Computer für keinen unserer Helden.
Wie man sieht, ist es mit dem Überholen so eine Sache. SF ist ja keine prognostische Literatur, und sie befindet sich schon gar nicht in einem Wettlauf mit der Realität, allenfalls in einem mit dem Zeitgeschmack. Eine gute Story kann technisch längst obsolet sein, aber immer noch Lesevergnügen bereiten und, vielleicht unterschwellig, Nachdenken über Technikvisionen und menschliche Verhaltensweisen anregen. Die geschilderte Technik selbst kann wie Lochkarten und Lochbänder von der Zeit überholt werden, die Denkanstöße bleiben hoffentlich erhalten.
Karlheinz Steinmüller
Duell der Tiger
Der Tag der Entscheidung beginnt wie jeder andere Tag. Waschen, Rasieren. Hunger stellt sich ein. Man streift sich mit mechanischen Bewegungen die Kleidung über, hat längst verlernt, den feinen Lavendelgeruch zu bemerken, vor Jahren programmiert als persönliche Note. Das flinke Roboterwägelchen aus der automatisierten Küche plaziert pünktlich das Frühstück auf den Tisch.
Aber Elton steht nicht der Sinn nach Gaumenfreuden. In seinem Hirn arrangieren sich Pläne, Tricks, Finten, Gegenfinten – Nijima, heute ist er dran! Lange genug blieb seine Herausforderung unbeantwortet! Eine Frechheit, ihm auf dem IFAC-Symposium über die Diagnose sozialer Systeme so in die Parade zu fahren! Wie die meisten Teilnehmer, wie auch er, Elton, war Nijima nicht real anwesend, sondern telepräsent, der Schatten eines schmalen Japaners auf einem Großbildschirm. Und dann hatte dieser schmale japanische Schatten ein Modell für die Ausnutzung von Migrationsraten für die soziale Parameterschätzung vorgeschlagen. Ein gut durchdachtes, ein umfassendes, ja ein elegantes Modell! – Es hatte nur einen Nachteil: Es ähnelte dem Modell täuschend, das er, Elton, während der letzten Wochen erarbeitet hatte.
Prioritätsstreit auf offener Bühne! Beschuldigung stand gegen Beschuldigung. Hatte Nijima seine Zugangscodes geknackt? Nicht auszudenken! Aber heute, heute würde Nijima dafür zahlen!
Das Roboterwägelchen sammelt auf gewohnte Weise die Krümel vom Tisch. Zeit, loszulegen. Vor Vorfreude pfeifend geht Elton in sein Büro, wo die verschiedenen Terminals schon mit einem Bereitschaftsblinken auf ihn warten. Er wirft sich in den Sessel, fährt mit der Rechten leicht über die Tastatur und meldet sich an.
Erst entspannst du dich ein wenig, denkt er, wirst ganz munter, sammelst Kräfte. Nijima kann noch ein wenig warten. Wie üblich läuft über einen Bildschirm links von ihm ein News-Ticker. Elton zieht es vor, Nachrichten direkt vom Schirm zu lesen – wozu sich die Wohnung mit Papier verstopfen?
NEUE FÄLLE VON COMPUTER-TERRORISMUS! WAS UNTERNIMMT DIE REGIERUNG DAGEGEN? Vor Interesse eifrig an der Unterlippe kauend, überfliegt Elton den mit Diagrammen und Fakten gespickten Artikel. Fast einhundert Unfalltote durch eine, wie es heißt, »minimale« Veränderung im Zielfunktional des Verkehrssteuerungsprogramms auf das Maximum der Karambolagen. Wie es Elton erwartet, hat die anarchistische Terrororganisation Black Box die Verantwortung übernommen und zum Beweis das Störprogramm an die Behörden gesendet. In einem Video erklärt einer der »Boxisten«, daß sie durch diese und künftige ähnliche Aktionen eine »Decomputerisierung« der Gesellschaft erreichen wollen – zum Nutzen des kleinen Mannes.
Mit wenigen Klicks beschafft sich Elton das Störprogramm aus dem Datensafe der Stadtverwaltung. Richtig, genau das hattest du angenommen, ein cleveres Programm! Es sollte dich nicht wundern, wenn hinter Black Box ein Tiger steckt, ein Mitglied des Tigers Club wie du, vielleicht der Black Tiger? – Und wenn du in einem der Wagen gesessen hättest? Nein, du fährst nicht zur Arbeit, du kannst deine Simulationsmodelle zu Haus entwickeln, denn du gehörst zur Computer-Elite des renommierten Instituts für Angewandte Systemanalyse, da kann dir keiner, das ist klar. Aber wenn dir doch einmal so ein dahergelaufener Nijima-San von der Universität Osaka in die Quere kommt den zerdrückst du mit deinen Pranken, nicht wahr, Tiger Elton?
EXPLOSION IN DER DOW CHEMICALS RAFFINERIE. Man vermutet Werkssabotage, spekuliert, daß die Konkurrenz den Prozeßrechner manipuliert hätte. Das ist eindeutig unter Eltons Niveau.
Und dann erscheint ein hochgewachsener Mann mit zerfurchtem Gesicht auf dem Bildschirm. »Dieser Herr behauptet, der bekannte Politiker Richard Ebner zu sein. Seine Person sei von politischen Gegnern, möglicherweise der Computermafia, aus den staatlichen Informationssystemen getilgt worden. Zur Zeit ist dieser Mann eine Unperson. Wer ihn kennt, wird gebeten, Ebners Identität bestätigen.«
Elton lacht, ein Politiker Opfer eines »Delikts gegen die Identität«! Gestern noch ein großer Boß, heute ein lamentierendes Häufchen Elend, ein »Erasee«, ein aus den Speichern Gestrichener. Als Politiker hatte er keine große Chance, wiedererkannt zu werden. Seine Wähler würden ihn längst vergessen haben und die Parteifreunde sich ins Fäustchen lachen. Ja, wenn es sich um einen Schlagersänger handeln würde … Wer weiß, vielleicht hatte sich dieser Ebner mit einem Computerexperten angelegt, einem Tiger womöglich, das hatte er nun davon, totaler Gesichtsverlust sozusagen. Jetzt zeigt es sich, wer die Macht im Staate hat, die angeblich frei gewählten Volksvertreter oder die Manipulatoren der Datensysteme, die die Computer programmieren, die Codes brechen, zu allem Zugriff haben, alles steuern, ihre Gegner löschen können, wie es beliebt. So wie du heute noch diesen Nijima ausradieren wirst!
Zeit, sich Nijima vorzunehmen. Du wirst ihm einen fairen Wettbewerb anbieten, ein intellektuelles Duell, wie es unter Spezialisten üblich ist. So als ginge es dir noch darum, zu beweisen, daß du der bessere Experte, der versiertere Modellierer bist. Eben ein Tiger!
Elton wählt Osaka, störfrei überträgt der Satellit seine Signale, speist sie in das japanische Datennetz. Nijima müßte jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach schlafen – um so besser. Doch Nijima schläft nicht. Statt seines Gesichts zeigt er zwar nur eine ausdruckslose japanische Maske, aber er geht ohne Ausrede, ohne Bitte um Aufschub auf die Duellforderung ein.
Munter klingt die Stimme des Übersetzungsprogramms. »Erst jetzt, Elton? Ich habe deine Herausforderung schon lange erwartet«, verhöhnt Nijima ihn, »mußtest wohl erst noch ein paar Programme basteln?«
Es versteht sich von selbst, daß der Gegner einen ganzen Packen Software für Angriff und Verteidigung bereithält. Letzten Endes aber würde der flinkere Intellekt entscheiden. Ein fairer Kampf also.
»Ich überlasse dir die Wahl der Waffen.«
»Nehmen wir dein Spezialgebiet.«
Wie sicher muß sich Nijima fühlen!
»Systemanalyse und Modellierung. Und zur Modellbewertung …«
»Ich dachte an Bruder Tiger Poklitar als Schiedsrichter«, sagt Elton schnell und betont das »Bruder« deutlich. Schließlich soll Nijima wissen, daß er gegen einen Tiger antritt. Elton stellt eine Konferenzschaltung zu Poklitar her, der gerade im Auftrag der NASA bemannte Marsflüge mit tödlichem Ausgang simuliert. Poklitars schwarzweiß karierte Kontaktlinsen zwingen alle, ihm in die Augen zu schauen. Ein simpler Trick des gewieften Alten. Schon mit siebzehn hatte Poklitar die Gebührencomputer überlistet, so daß er, ohne zu zahlen, rund um die Erde telefonieren konnte. Mit zwanzig erwarb er sich durch Aufsummieren von Rundungscents ein Millionenvermögen, von dessen Herkunft zwar jeder wußte – weil Poklitar damit angab –, dessen Erwerb aber in dieser guten alten Zeit noch nicht strafrechtlich verfolgt wurde.
Seit Eltons Kindheit war Poklitar sein Vorbild. Elton erschlich sich zwar keine Millionen, aber es gelang ihm, eine IBM-Datensicherung zu knacken, was der Konzern mit einem Stipendium honorierte. Danach lief seine Karriere steil nach oben: Datensicherheitsexperte, wissenschaftlicher Konsultant einer Vielzahl von Behörden, Chef-Systemanalytiker. Aber Elton strebte nach Höherem, wollte in den Klub der Tiger aufgenommen werden, die Elite der Computerspezialisten. Die Aufnahmebedingung war einfach: Man mußte sich in das Klubregister eintragen. Dies aber war besser geschützt als die amerikanischen Staatsgeheimnisse. Nach drei Anläufen und Jahren der Frustration gelang es Elton, Mitglied des Klubs zu werden, und er durfte Poklitar Bruder Tiger nennen.
Der große Poklitar sieht allerdings müde aus. Ein alter Tiger, der die Welt nur noch als ein Geflecht von Datennetzen sieht, die dazu da sind, Computer zu verbinden. Menschen kommen in diesem Bild nur noch als mehr oder weniger irrelevante Nutzer vor. Ja, Tiger Elton, Bruder Poklitar hat dir einiges voraus, er weiß, daß niemand mehr, auch kein Tiger, das Netz beherrscht.
»Duellieren wollt ihr euch?«, fragt Poklitar, »das ist interessant. Von mir aus gern. Ist mal was anderes. Und es soll eine klassische Modellierungsaufgabe sein? Kein Computerspiel? Keine Schadsoftware? Nun, was haltet ihr von urban development, Großstadtentwicklung am Beispiel New Yorks? Gewonnen hat, wer mir zuerst ein überzeugendes virtuelles New York vorstellt.«
Eine gerechte Aufgabe, die das ureigenste Feld ihrer Kontroverse, die soziale Simulation, betrifft. Da wird sich zeigen, wer die Entwicklung der Stadt New York schneller und in größerer Detailtiefe nachgebildet hat, wer eher publiziert, wem die Fachkollegen applaudieren. Wie einfach ist dein Handwerk, hundertmal durchprobiert: Du besorgst dir die notwendigen Fakten aus den Labyrinthen bereits geschriebener Artikel, aus Datenspeichern und Statistikbibliotheken, und parallel erstellst du das Modell mit Bevölkerungs- und Industrieverteilung über das Stadtgebiet, mit sozialen, ökonomischen, administrativen, fiskalischen Strukturen, mit Kriminalität, Umwelteinfluß, Einbettung in die Gesamtwirtschaft der Staaten und dergleichen. Möglichst komplett, möglichst fehlerlos und vor allem rasch. Nijima wartet nicht, unterschätze ihn nicht, er schlägt dich, wenn du nur einen Moment zögerst …
Und paß auf deine Computer auf, Tiger. Spürst du nicht, daß fremde Impulse in sie eindringen, daß ein ferngesteuertes Programm mit deinen Codes spielt, die Sperren zu überwinden trachtet?! Endlich schlägt dein Störalarm an, jetzt weißt du es, Nijima ist ein harter Gegner, stiehlt dir die Ergebnisse, bevor du sie erzielt hast, und das mit einem Softwaretrick, der zu deinen Spezialitäten gehört!
Fakten, Fakten! Was weiß Elton schon über New York, was weiß er schon von der Welt, über der er zu thronen glaubt, für ihn ist die Welt doch nur ein Muster aus Bits und Bytes, Information – aber worauf sonst kommt es an? Zahlen, Zahlen! Elton besorgt sie sich, sendet Impulse aus, die sacht vorfühlen, wo was zu holen ist, wer welche Blockaden aufgebaut, welche Falle errichtet hat.
Paß auf, Elton, daß man deine Signale nicht identifiziert, dich als angeblichen Terroristen aushebt! Nein, das widerfährt Elton nicht, diese Gefahr sieht er voraus. Da läßt man andere die Kastanien aus dem Feuer holen. Wie wäre es mit deinem schmalen, schattenhaften Zwilling Nijima-San, treibe doch das gefährliche Spiel in seinem Namen, unter seiner Identität, kommst du durch, hast du die Fakten, läufst du in eine Falle, geht Nijima hoch. Na bitte! Doch was hast du da, du stockst, kommen dir Gewissensbisse so knapp vor dem Sieg? Du bist ein Tiger, denk daran!
Nein, der Trick läßt sich nicht anwenden, Nijimas Identität ist gefälscht, sein Name nur ein Deckname, seine Kennungen sind frech erfunden – so dumm ist er nicht, sich mit seiner wahren Identität zu exponieren! Errätst du, wer Nijima ist? Vielleicht ist er der Schwarze Tiger? Vielleicht dein alter Bruder Poklitar? Zerbrich dir ruhig den Kopf, Tigerchen Elton, Nijimas Tarnung zerreißt du nicht!
Elton braucht ein Phantom, einen virtuellen Nutzer, wie die Experten sagen, eine Nullperson, einen Menschen, der kein Mensch ist. Denn was ist schon ein Mensch: ein Kontoinhaber, ein Stromverbraucher und Steuerzahler, also eine Sammlung von Datensätzen in den administrativen Computern. In all diese Rollen kann auch ein Phantom schlüpfen – und zudem die vorgegebenen Aufgaben erledigen, obwohl es doch nur in der Einbildung der Computer existiert.
Ist das nicht wie Vater werden, so ein Phantom in die Welt zu setzen? Nicht das erste Phantom Eltons. Meist kümmerte er sich nicht mehr um sie, wenn er ihre Dienste nicht mehr benötigte. Ein schöner Tiger-Sport: Wesen schaffen, die es nicht gibt, tote Seelen, elektronische Schattenmänner, Daten-Marionetten – oder eben die Gesichter aus der Bitwelt löschen, die einem nicht gefallen, so das Nijimas! Altbewährte Diagnoseprogramme überwachen das Phantom, daß es sich nicht selbständig macht, gar zum Computerterroristen entartet, bevor es seinen Zweck erfüllt hat. Und nun ab mit ihm in die Welt der Daten! Wohl getan, Tiger Elton! Dein Batman aus Nanosekundenimpulsen wird durch alle Barrieren von Bits tunneln, in fremde Computer eindringen, Kaskaden von Befehlen auslösen, einen breiten Strom von Daten, Daten, Daten zu dir lenken.
Endlich kommen sie, die geliebten Fakten, aus deren Konjunktionen und Disjunktionen die Welt aufgebaut ist. Elton speichert sie sicher ab, daß Nijima auch mit den übelsten Trick nicht an sie gelangt. Er vergräbt sie in riesigen Bibliotheken, die in Jahrtausenden keiner mehr durchforstet, entkoppelt sie vom globalen Datennetz, daß niemand sie erreichen kann. Ein perfekter Datenfriedhof! Elton gräbt ihn um, durchwühlt ihn, um einige der tausend Parameter seines Modells zu finden. Mager ist die Ausbeute, was durfte Elton anderes erwarten, etwa, daß die New Yorker Polizei ihre Statistiken so umarbeitet, daß er sie direkt verwenden kann? O nein, Elton kennt seinen Beruf, er hat keine Illusionen, er weiß, daß man runden muß und schätzen und Hypothesen aufstellen, die nie einer überprüfen kann. Und wenn die Zahlen nicht ausreichen, wozu gibt es Zufallsgeneratoren? Schon steht das Modell!
Jetzt muß Nijima-San das Handtuch werfen, kann Harakiri begehen, wenn er ein Japaner von Ehre ist. Schnell noch ein paar Probeläufe, zurück in der Zeit, um die letzten Parameter anzupassen. Noch ein paar Läufe vorwärts in der Zeit, schon hat man eine Handvoll Szenarios, wie es im Jargon der Futurologen heißt, New York mit und ohne Rassen- und Generationskonflikt, mit und ohne Ölkrisen, mit und ohne Wellen von Verbrechen. Genau wie du, Tiger, es vorher schon ahntest: New York geht pleite, verfällt, bricht zusammen.
Wohlan, diese Politkatastrophe paßt zu dir, nicht wahr, paßt zu einem Tiger: Zertritt die Würmer, prophezeie ihnen den Untergang, raube ihnen die illusorischen Hoffnungen! Solche Ergebnisse lassen sich gut verkaufen, damit schlägst du nicht nur Nijima, die nimmt dir der Scientific American mit Kußhand ab, die diskutiert das Publikum, mit denen kannst du auf Konferenzen hausieren gehen, im Fernsehen auftreten, berühmt werden! Elton, du bist wahrlich ein großer Tiger!
Poklitar läßt sich Zeit mit dem Bewerten der Modelle, und Elton kann es kaum erwarten. Dann erscheint wieder Poklitars Gesicht auf dem Bildschirm, er räuspert sich: »Tja, Remis würde ich sagen. Kaum zu unterscheiden, eure Modelle.«
Sollte es Nijima, dem fernöstlichen Gangster, doch gelungen sein, die Zugangscodes zu brechen, unbemerkt?
Nein, ein Check beweist Elton, alles ist unangetastet. Vielleicht liest er Gedanken, der japanische Teufel? – Remis, Remis, du konntest deinen Gegner nicht schlagen! Hat die Zahl deiner grauen Zellen abgenommen, Tiger Elton, haben dich deine Phantome betrogen? Nein, das kann nicht sein, ein Zufall, es ist sicher nur ein Zufall, versucht Elton sich zu beruhigen. Es war zu einfach, New York, New York, dessen Untergang kann jeder vorhersagen. Und wer dieselben Daten benutzt, gelangt vielleicht zum gleichen Modell …
Mut, Tiger Elton, nur Mut! All dein Haß, all deine Wut wird Nijima treffen – wie könnte er überleben? Liebend gern würde Elton einen seiner elektronischen Teufel losjagen, Nijima in seinem Haus aufspüren lassen, eine Havarie auslösen, einen Kurzschluß, eine Gasexplosion, einen Brand, einen Flugzeugabsturz, der Nijima trifft, ihn verbrennt, ihn zerreißt! Aber Eltons Haß hat kein klares Ziel, er weiß nicht, wo der Gegner wohnt, sich versteckt, ja, Elton würde ihn nicht einmal erkennen, spazierte er leibhaftig über den Bildschirm!
Laß dir etwas einfallen, Tiger Elton, mächtiger Tiger Elton, finde einen Weg! Tilge Nijima, eliminiere ihn, du hast lange genug unter der Aufsicht Poklitars fair gespielt, jetzt lege die Manschetten ab, jetzt kämpfe ohne Rücksicht, sonst wird Nijimas Hohn dir immer in den Ohren klingen.
Elton ruft seine Phantome zusammen, jagt sie durch die Dateien, schickt sie auf die Kanäle, die ihn mit Nijima verbinden, spürt den Signalen nach, die ihn, Elton, vernichten sollen. Tiger Elton, dein Duell geht in die letzte Runde als ein digitales Catch as catch can!
Doch Eltons Sonden haben keinen Erfolg, prallen von erstaunlichen Schutzmechanismen ab. Immerhin, jetzt weiß er von ihrer Existenz. Und für jeden Impuls existiert ein Gegenimpuls. Nijima-San, dieser gefährliche Samurai der Computerzeit, ist nicht unangreifbar.
Kämpfe, großer Tiger Elton, gib deinen Stolz auf, jetzt, da Nijimas Signale schon deine Zugriffsrechte umzingeln, eil dich, Tiger, kämpfe! Verzichte nicht weiter auf Hilfe, suche dir reale, menschliche, phantasievolle Helfer, Tiger wie dich, die Nijima in die Zange nehmen, eine Treibjagd auf ihn veranstalten. Wer sagt denn, daß Nijima allein kämpft, nicht ganz Nippon hinter ihm steht? Überwinde dich schon, wer siegen will, darf nicht zimperlich sein!
Erinnere dich an Tiger Clara, ja, an Signora Tiger Clara, ihr Coup gegen Fiat war doch so clever wie stilvoll, solche Helfer kannst du brauchen! Sie sitzt wieder in ihrer Villa, errechnet die neuesten Modelle, Kleidermodelle, wollte sie nicht Dior übernehmen? Was geht es Elton an, wohin sie ihr Modetick treibt, er braucht nur ihre Intelligenz. Ganz sicher ist Signora Tiger dabei; aber dieses irritierende, gefährliche Blitzen in ihren Augen! Ist sie der Schwarze Tiger? Ist sie Nijima? Dieser Zug um ihre Lippen … Ach nein, du würdest es nie erraten, du Frauenverächter, Abstinenzler und Weichei Elton – natürlich handelt sie ihren Gewinn heraus – und der bist du! Nun fall nicht gleich aus dem Sessel, so alt ist Signora Tiger Clara auch wieder nicht, versprich ihr ruhig die eine Nacht, ist noch ein billiger Handel. Zögre nicht, lächle lieber, so hat’s die Signora gern, schnurre, wie es Tigern zukommt. Denke nicht an die Nächte, Tiger, weit in der Zukunft! Hier und jetzt fällt die Entscheidung!
Nijimas elektronische Spitzel lokalisieren schon die amtlichen Eintragungen über deine Geburt und Taufe. Schnell, Tiger Elton, noch ist nichts verloren, schlage zurück, mobilisiere deine Programme, fürchte dich nicht vor Terroristenfallen, scheue nichts, wenn du Nijima erledigst, schaffst du die anderen auch, und wenn nicht …
Tiger Elton, setz schon an zum Sprung nach Ostasien, starr nicht so lange auf die Ziffernkolonnen, die dir irgendwie bekannt vorkommen, das sind Nijimas Koordinaten, damit triffst du ihn, du oder er, schlag zu, spring, Tiger, spring!
Sekundenlang steht eine Fratze auf dem Bildschirm, dann verblaßt das Bild, wird leer und schwarz. Es ist aus, großer Tiger, alles ist aus! Deine Computer reagieren nicht mehr auf die Tasten, die du eilig drückst, das Licht erlischt im Arbeitszimmer, im Haus. Die Klimaanlage stellt ihr gleichmäßiges Atmen ein. Das Haus ist abgeschaltet, aus den Dateien des Stromversorgers gestrichen, das Wasser wird aufhören zu fließen, kein Lieferwagen wird mehr wöchentlich neue Nahrung bringen, kein Besucher wird dich finden. Dein Konto ist annulliert, die Rechenzeit abgelaufen, dein Institutsdirektor wird sich nicht mehr an dich erinnern, im Klub der Tiger ist dein Platz wieder frei, das ID-Kärtchen ist ein wertloses Spielzeug geworden, das keine Tür mehr öffnet.
Du existierst nicht mehr, Tiger a. D. Elton! Du bist eine Unperson, ein bedauernswerter Erasee. Dazu gefangen in den eigenen vier Wänden! Ein paar Stunden noch, bis das Kohlendioxid dich betäubt, rolle dich zusammen in dem Sessel, der dir noch gehört, und versuche, dem letzten Geheimnis auf die Spur zu kommen: dem Rätsel um Nijima.
Die Fratze, die in deinen Augen brennt, erkennst du sie nicht? Erinnerst du dich nicht an das Phantom, das so raffiniert ausgeklügelte Phantom, das du vor einem Jahr geschaffen hast? Armer kleiner Tiger, du hast wirklich den Gipfel deines Könnens überschritten.
Das japanische Puppenhaus
Die winzige Frau stand vor dem silberumrandeten Spiegel und kämmte sich mit einem gerade noch erkennbaren Kamm das schulterlange, kastanienbraune Haar. Bisweilen drehte sie sich, um sich besser betrachten zu können, ihr Haar wippte dabei, und auch das hellblaue Kleid mit den weißen Puffärmeln schwang mit. Von irgendwoher erklang hauchzarte Musik. Im Wohnzimmer nebenan hockte das kleine Kind auf dem Teppich und schichtete Dominosteine – weiß gepunktete Krümel – zu einem Turm. Eine Klingel zirpte. Die kleine Frau steckte den Kamm weg, strich sich über das Kleid und ging – nein, schwebte – zur Tür. »Willkommen daheim, Liebster. Bitte, leg ab. Das Teewasser kocht gleich.« Der kleine Mann schlüpfte aus den Schuhen, nahm im Schaukelstuhl Platz und entfaltete die Zeitung.
Mertens war mehr als zufrieden. Sandra, seine Tochter, hatte sich vor dem Puppenhaus niedergekniet. Sie wagte kaum zu atmen. Selbst Sohnemann Robert, Katrins Mitbringsel aus einer früheren Beziehung, hatte ausnahmsweise einmal die Ohrhörer herausgenommen und bestaunte die Puppen.
»Die sind ja richtig lebendig!« Sandra umarmte Mertens in Bauchhöhe, er streichelte ihr über den Kopf. »In meiner Klasse hat nur die Rieke so ein jappanisches Haus.« Aus ihrem Mund klang das Wort, als müßten die Einwohner Nippons ständig nach Luft schnappen.
»Hat auch ’ne Stange gekostet«, meinte Mertens, und für einen Augenblick verdarb ihm die Erinnerung an die Diskussion vor dem Kauf die Laune. »Aber schließlich wird man nur einmal acht Jahre.«
Sandra löst sich von ihm und beugte sich über das Puppenhaus. Alle anderen Geschenke waren vergessen.
Die Zeitung flatterte in den Händen des Puppenvaters. »Es zieht!« rief er und schritt zum Fenster an der Rückwand.
Robert brach in ein prustendes Lachen aus.
»Hast du etwas gesagt, Liebster?« fragte die Puppenfrau aus der Küche. Durch die glasartige Platte des kleinen Herdes zeichneten sich rot die Heizspiralen ab.
»Es ist windig geworden draußen«, meinte der Puppenmann. »Hoffentlich regnet es nicht.«
»Ich lach mich tot!« Sandra gluckste und kicherte. Sie stieß gegen das Tischchen, auf dem das Puppenhaus aufgebaut war. Der Turm aus Dominosteinen stürzte zusammen. Das Puppenkind wiegte den Kopf und begann unverdrossen sein Werk von neuem. Der Puppenvater, der sich wieder in die Zeitung vertiefte, murmelte etwas von einem Erdbeben.
Sandra rutschte, von Lachen geschüttelt, zu Boden.
»Sei bitte nicht albern, Sandra!« Katrin war ins Zimmer getreten, mit ihr wehte ein kalter Geruch von gekochten Kartoffeln und Kraut aus der Küche herein, ein Geruch, den Mertens nicht mochte und der nicht ins Wohnzimmer gehörte.
Er griff die dicke, bunte Broschüre, die in einem halben Dutzend Sprachen das Puppenhaus und seine Spielmöglichkeiten beschrieb, und blätterte darin: Standardausführung, Aufstockungsstufen, Zusatzgarantie, Grundprogrammierung und Wartung der Puppen, weitere Charaktere und »szenische« Software zum Herunterladen aus dem Internet, Sicherheitssoftware gegen Puppenviren … Ein rot gedruckter Satz warnte vor Selbsthilfe und verwies auf den freundlichen Kundendienst von Lilliput Inc. Lang war die Liste des Zubehörs: Garderobe und Küchengerät, Puppenhobbyraum und Sauna, Garage samt Wagen; sogar ein Notstromaggregat, betrieben mit Feuerzeugbenzin, wurde angeboten. Und natürlich wurde die Werbetrommel für die Fernbedienung zur Programmierung der Puppen – nur für Erwachsene! – gerührt. Mertens hatte bewußt darauf verzichtet, schon wegen des Preises, aber auch, weil man sich mit all den Funktionen und Optionen nur verrückt machte.
Ein beigelegter Spezialprospekt verwies auf Zusatzmodule, ebenfalls nur für Erwachsene, Interfaces, die es – zu strikt pädagogischen Zwecken – gestatteten, sich in die Puppen quasi hineinzuversetzen. Und dann gab es noch Smartphone Apps, mit denen man auch von unterwegs über die Puppen mit seinen Kleinen ständig in Kontakt bleiben konnte, möglichst über eine gesicherte Verbindung. Nähere Informationen im Internet. »We are more than toys.« – Wahrscheinlich machte Lilliput Inc. mit dem Schnickschnack um das Puppenhaus herum richtig dicken Profit …
Mertens ließ die Broschüre sinken. Was die Japaner sich alles ausdachten! Sein Chef hatte ihm vor Jahren so ein Smartphone-Dingens aufgedrängt, aber das war inzwischen auch schon wieder überholt. »In die Puppen hineinversetzen«? So recht konnte er sich darunter nichts vorstellen; die Broschüre blieb – wohl wegen der holprigen Übersetzung aus dem Japanischen – in diesem Punkt merkwürdig unscharf. Statt dessen gab es seitenlange Selbst-Anpreisungen »ultimativstes Produkt unserer Hochtechnologie-Forschung«, »massiger Einsatz von Nanotechnologie«, »aufbauend auf jahrelangen Erlebnissen mit der Play-Robotik«, »Weltmarktanführer seit dem weltberühmten Hunde Aibo«.
Was für ein Aufwand! Eigentlich waren die teuren Roboterpüppchen viel zu schade für grobe Kinderhände. Aber Barbies waren aus der Mode, und seine Mutter hatte ein paar Scheine für die Enkelin draufgelegt, so daß es für die Grundvariante gereicht hatte.
»Paß auf, Sandra.« Er zog seine Tochter zu sich und erklärte, was für ein verzwicktes Eigenleben die Puppen hätten. Daß sie komplizierter als ein mit allen Verrücktheiten ausgestattetes Auto seien. Also Vorsicht! Dieses Puppenhaus war kein Allerweltsspielzeug, das man, ging es entzwei, einfach in den Müllschlucker warf.
Sandra machte sich frei. Sie kicherte wieder und hatte mir nichts, dir nichts das Puppenkind gegrapscht. Das zuckte – und dann baumelten Arme und Beine reglos zwischen Sandras Fingern herab.
»Sandra!«
Die Kleine juchzte vor Vergnügen. Mertens dagegen war schrek-kensstarr. Sie quetschte die teure Puppe noch kaputt!
Sandra schien selbst zu spüren, daß sie es übertrieb, sie schüttelte die »doofe Puppe«, aber die rührte sich nicht mehr. »Wo mag sich unsere Tochter aufhalten?« fragte der Puppenvater und legte die Zeitung beiseite. Die kleine Frau kam aus der Küche getrippelt, sie hatte sich eine blendend weiße Schürze umgebunden und ein Häubchen aufgesetzt, das an ein Krönlein erinnerte. »Sie wird vor dem Haus spielen.« – »Wenn sie unaufmerksam über die Straße geht, könnte sie überfahren werden.«
Sandra schnipste dem Puppenkind ungeduldig gegen die silberne Gürtelschnalle. »Blödes Stück!« Verärgert setzte sie es zurück.
Kaum berührten die Füße des kleinen Wesens wieder den Boden des Puppenhauses, belebten sich die starren Glieder. Das Püppchen taumelte, gewann schnell das Gleichgewicht zurück und begann, als wäre nichts geschehen, die Dominosteine einzusammeln.
Besteck klapperte, Katrin deckte den Abendbrottisch.
Auch die Puppenfrau tänzelte mit einem gefüllten Tablett zum Tisch. Behutsam stellte sie es ab; weiß blitzte das Porzellan der kleinen Teller. Ein winziger Blumenstrauß, der winzige dreikerzige Leuchter und die geschliffenen Gläser verliehen dem Gedeck ein festliches Gepräge. Prüfend betrachtete die Puppenfrau ihr Werk. Dann hob sie den Kopf. Für einen Sekundenbruchteil löste sich ihr Blick von der Puppenwelt, glitt hinaus in das unendliche Menschenzimmer, traf Mertens. Ihre Augen glänzten blau.
»Solche langweiligen Dinger«, maulte Sandra, »die kannst du wieder wegbringen, Pappi, die will ich nicht.«
»Warte.«
Während Sandra skeptisch auf einem Bonbon herumkaute, blätterte Mertens in der Broschüre nach. Die Steuereinheit mußte sich an der Rückseite des Hauses befinden, es war ein flacher, grauer Kasten. Entschlossen drückte er auf den schwarzen Knopf. Augenblicks verharrten die Puppen.
»Jetzt kannst du die Puppen herausnehmen und ihnen Namen geben. Sie werden sich mit dir unterhalten.«
Gehorsam griff Sandra das Puppenkind. Sie hielt es dicht vor ihr Gesicht. »Also, du heißt Tina.« Den Puppenmann taufte sie »Herr Winzling«, die Puppenfrau entsprechend »Frau Winzling«.
Mertens betätigte den grünen Knopf.
Sofort lief die Puppenfrau vor den Spiegel, um sich das Haar zu richten. Das Puppenkind aber trat an die vordere Kante des Hauses. »Ich heiße Tina, und wer bist du?«
Sandra strahlte. »Ich bin Sandra, aber du darfst mich Sanny nennen wie meine Freundinnen.«
»Spielst du auch gern mit Dominosteinen?«
»Nein, dazu bin ich schon zu groß. Ich bastle lieber Papiersterne.«
»Ist das schwierig?«
»Ungeheuer schwierig. – Aber ich kann’s dir ja zeigen.«
»Daß du mir meine Zeitung nicht zerschnippelst, Tina!« warnte Herr Winzling.
Die Ernsthaftigkeit der Unterhaltung belustigte Mertens. Sandra schien vergessen zu haben, daß sie keine Menschen vor sich hatte, sondern kybernetische Puppen. Nein, es sollte ihm recht sein, wenn sich seine Tochter mit sich selbst beschäftigte und nicht ununterbrochen quengelte. Schließlich hatte er nicht ständig Zeit für sie. Und falls zutraf, was die Broschüre vom erzieherischen Wert versprach …
»Abendbrot ist fertig, reißt euch los!« Katrin schenkte Tee ein.
Mertens setzte sich. »Das betrifft auch dich, Sandra!« rief er seine Tochter. Robert konnte es wieder nicht erwarten, langte quer über den Tisch und stieß um ein Haar das Senffäßchen um.
»Bitte, meine Lieben, das Abendessen ruft«, flötete die Puppenfrau. Die Puppen reichten einander die Hände und wünschten sich einen guten Appetit.
Mertens kaute schweigend. Er beobachtete, wie die Puppen mit winzigem Besteck winzige Scheiben in noch winzigere Stücke zerschnitten, wie sich die Lippen öffneten und ein Happen verschwand. Das Wasser lief einem im Munde zusammen vom bloßen Zusehen.
»Gehen die auch aufs Klo?« Sandra schmatzte, der Pfefferminztee gluckerte ihr die Kehle hinunter.
»Mit vollem Mund spricht man nicht.«
»Und schon gar nicht über solche Themen«, ergänzte Katrin und fuhr fort, Leberwurst aus der Pelle zu kratzen.
»Dann frag ich sie eben selber.«
Mertens hielt seine Tochter am Arm fest. »Erst wird aufgegessen. Nimm dir ein Beispiel an Tina, wie brav sie dasitzt.«
Und tatsächlich, am Abendbrottisch der Winzlings herrschte eine beneidenswerte Ruhe. Auf dem goldgelben Tischtuch standen Platten mit hauchdünnen Scheiben Wurst und Käse, neben der Schale mit dem dunklen Brot brannte der Leuchter. Alles strahlte Sauberkeit und Ordnung aus. Die aßen nicht von abgenutzten Holzbrettchen und direkt aus den Kühlschrankboxen. Und Fettfinger auf den Behältnissen sah man bei denen schon gar nicht. Ein gutes Vorbild für die Kinder!
Wie auf ein Stichwort stieß Robert sein Glas um. Die Teeflut überschwemmte Wurstpellen und Zuckerkrümel. Sandra hob den Rand der Tischdecke an, dadurch kippte auch noch das Senffäßchen. Katrin rannte nach einem Wischlappen.
Mertens schimpfte. So ein Spektakel zu veranstalten! Er floh zu seinem Sessel und schaltete den Fernseher ein. Wieder einmal hatten sich fünfzig Kanäle auf Langeweile verabredet: Hier Nachrichten, da eine Talkrunde über Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel, dort ein Spielfilm über Beziehungskisten. Und beim Wrestling-Sender war gerade Werbepause. Endlich fand er eine einigermaßen unterhaltsame Quizsendung.
Wenn nur Katrin und die Kinder nicht einen solchen Radau veranstalten würden! Im Puppenhaus ging’s ja auch leiser. Sandra maulte und zeterte, sie wollte partout nicht ins Bett; ein Glück, daß das Puppenkind mehr Einsehen zeigte und im weißen Nachthemdchen durch die Zimmer trippelte, um seinen Eltern und auch Sandra eine schöne gute Nacht und süße Träume zu wünschen.
»Wenn du mich lieb hast, dann schenk mir doch zum Geburtstag ein Brüderchen von Lilliput Inc.«, bettelte es noch, bevor es in sein Bettchen kroch.
Auch Robert zog sich auf sein Zimmer zurück. Aus der Küche drang Tellergeklapper. Aber Mertens verspürte keine Lust, dem klappernderweise verkündeten Wunsch seiner Frau nachzukommen. Schließlich war sie es, die nur halbtags arbeitete. Sie hätte eben ihren Sohn zum Tellerwäscher abrichten sollen. Wenn man den ganzen Tag hinter dem Lenkrad verbracht hatte, durfte man sich am Abend schon einmal ein paar Augenblicke Ruhe gönnen.
Ein bläulicher Widerschein flimmerte aus einer Ecke des Puppenwohnzimmers. Herr Winzling saß in seinem Schaukelstuhl und starrte auf den für Puppenverhältnisse überdimensionierten Fernseher. Darin lief die gleiche mäßig interessante Quizsendung. Und wenn Mertens genau hinschaute, hatte er den Eindruck, daß dort Quizmaster und Kandidat ein paar Sekundenbruchteile weiter waren.
Die Puppenfrau bürstete sich das rötlich schimmernde Haar. Längst hatte sie ihren Abwasch erledigt. Ihre Bewegungen waren geschmeidig und sparsam zugleich, alles an ihr wirkte adrett und proper. Sie kam, wie sollte man es ausdrücken, aus einer anderen Welt. Munter und freundlich schaute ihr ebenmäßiges Gesicht Mertens aus dem kleinen Spiegel entgegen. Waren ihre Augen nun leicht asiatisch geschnitten oder nicht? Gegen sie war seine Katrin trotz all ihren Wässerchen und Schönheitskrems nur aufgeputzte Dutzendware. Und wenn die Japaner noch soviel überflüssigen Schnickschnack herstellten, diese Puppenfrau hatte eindeutig Stil.
Die Woche schleppte sich hin. Früher hatte Mertens den Geruch von frischem Brot gemocht; seit er tagtäglich mit dem Lieferwagen von Supermarkt zu Supermarkt, von Bäckerei zu Bäckerei fuhr, konnte er ihn nicht mehr ausstehen. Richtiggehend übel wurde ihm von den Aromaschwaden auf dem Hof der Backwarenfabrik.
»Wo stecken Sie denn, Mertens?« klang die Stimme seines Chefs im Ohrhörer. »Der Ostfeld-Markt wartet auf die Lieferung!« Blöde Frage! Der Chef wußte sehr wohl, daß der Stadtring zugestaut war, und mit der Tracking-Software konnte er ihn, Mertens, und die Kollegen ständig auf dem Monitor verfolgen.
Mittwoch Vormittag knirschte und knackte es im Getriebe des Lieferwagens. In unregelmäßigen Abständen flackerte das Signalfeld mit dem Schraubenzieher auf: »Werkstattbesuch notwendig«. Auch das Navi spielte verrückt, wollte ihn falsch herum in eine Einbahnstraße schicken. Oder war schon wieder einmal die Richtung geändert worden?
Mertens konnte seinen Zeitplan nicht einhalten, an jeder Lieferrampe wurde er angemeckert. Und sein Chef machte ihm tüchtig Druck: Wenn er mit der neuen Routenplanungssoftware nicht zurechtkam, solle er es nur sagen. Am liebsten hätte Mertens einfach Gas gegeben und wäre – den Tank voll Benzin, Proviant auf der Ladefläche – sonstwohin gebraust, über die Autobahn aufs platte Land, vielleicht bis an die Küste, wo ihn niemand kannte, niemand drängte.
Mitten im dichtesten Verkehr dachte er an das Puppenhaus. »Willkommen daheim, Liebster. Bitte, leg ab. Das Teewasser kocht gleich.« Seine Frau begrüßte ihn nie so freundlich.
Der Sonnabend war angebrochen. Mertens hatte es sich im Sessel bequem gemacht und las die Sportseite. Das triste Märzwetter lud weder zu einem Spaziergang noch zu einem Ausflug ein. Und für eine Flasche Bier war es eigentlich zu früh. Aus Roberts Zimmer wummerte Krachmusik, und im Bad rumpelte die Waschmaschine. Seit Monaten schon lag ihm Katrin in den Ohren: Die alte Minna machte es nicht mehr lange. Besser sie kauften rechtzeitig eine neue. Aber so ein Waschautomat war kein Pappenstiel.
»Pappi, schau doch mal her!«
Mertens senkte die Zeitung. Sandra winkte ihn aufgeregt zum Puppenhaus.
»Pappi, Tina ist krank.«
»Hast ihr ein Bein ausgerupft, ja?« Schwerfällig erhob er sich.
»Sie hat Keuchschnupfen und will Besuch haben.«
»Keuchhusten meinst du wohl.«
»Nein, Keuchschnupfen, hör doch hin!«
Tatsächlich keuchte und schniefte, schnaufte und schnupfte das Puppenkind zum Herzzerreißen. Es lag im Puppenkinderzimmer in seinem Bettchen, unter seinem linken Arm stak ein Thermometer, das viel zu lang war. Die Puppenfrau, wiederum im hellblauen Kleid mit den weißen Puffärmeln, schob gerade eine blinkende Messingwärmflasche unter die Decke.
»Also, Tina und ich sind im Regen spazierengegangen«, erklärte Sandra, »und da hab ich zu ihr gesagt: Paß auf, jetzt kriegst du Keuchschnupfen. Es hat geklappt!« Triumphierend blies sie die Backen auf.
»Dann brauchst du nur zu befehlen: Jetzt bist du wieder gesund! Und das Gekrächze hat ein Ende.«
Die Puppenfrau legte ihre Hand auf die Stirn des Puppenkindes. »Es wird alles gut, mein Liebling«, hauchte sie.
Sandra schüttelte den Kopf. »Ich will aber nicht. Los, du mußt sie besuchen.«
»Ich denke, Tina ist deine Freundin. Wie kannst du sie leiden lassen?«
»Mensch, Pappi, Tina ist bloß eine Puppe, die merkt nichts.«
Sandra zerrte Mertens vor das von künstlichem Wein umrankte, seitliche Portal des Puppenhauses. Sie klingelte zweimal kurz. Kaum hörbar näherten sich Schritte. Die Tür schwang auf.
»Guten Tag, Sandra«, sagte Herr Winzling, »und guten Tag, Herr – äh …«
»Mertens. Ich bin der Vater von Sandra.« Er kam sich unsäglich kindisch vor.
»Herr Winzling ist mein Namen, bin beliebt bei den Damen«, reimte der Puppenmann. Die Softwareentwickler hatten das wohl für witzig – oder kindgerecht? – gehalten. »Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bitte, treten Sie ein.«
Sandra zog ihren Vater wieder zur offenen Vorderseite des Puppenhauses. Alles blitzte und funkelte in dieser Wohnung: die Kacheln in der Küche, die Türknäufe aus Messing, das Furnier der Möbel und das Glas der Vitrine. Selbst auf dem Plüsch der Couchecke schimmerte seidiger Glanz.
»Du mußt die Puppenmama noch begrüßen«, raunte Sandra.
Puppenmama – das Wort paßte eher zu einer behäbigen, ausgeleierten Stoffpuppe als zu dieser schicken Frau in Miniaturformat, die, viel zu jung für das Puppenkind aussehend, die eine Stufe vom Kinderzimmer zum Wohnzimmer herabschritt.
»Oh«, sagte sie, als sie Mertens erblickte.
Zum zweiten Mal stellte er sich vor, nickte unwillkürlich freundlich dabei. Man machte sich noch zum Affen …
»Ich bin hocherfreut.« Die Puppenfrau lächelte ihn an und fügte zusammenhanglos hinzu: »Man hat es nicht leicht.«
Mit den Augen folgte ihr Mertens in das Kinderzimmer. Sie trug weiße Söckchen und glänzend rote Pumps, die Mertens an das Paar Zauberschuhe aus dem uralten Film – wie hieß er nur gleich? – mit dem Weg über den Regenbogen erinnerten.
»Sanny, schön, daß du mich besuchst«, piepste das Puppenkind. »Und das ist dein Pappi, nicht wahr? Ich habe ja solch fürchterliches Fieber!« Zur Bekräftigung stöhnte und wimmerte es.
Sandra zupfte ihren Vater am Ohr. »Wenn ich sage: Du bist tot! dann stirbt Tina. Ist das nicht wundervoll?«
»Wenn du willst, daß ich wieder gesund werde, dann kauf bitte einen Sanitätskasten von Lilliput Inc.« Unter all dem leisen Krächzen und Röcheln war nur der Firmenname deutlich zu verstehen.
Die Puppenfrau holte ein durchscheinend dünnes Seidentuch aus einem Schrank und wischte dem Puppenkind den nicht vorhandenen Schweiß von der Stirn.
»Du kaufst doch den Sanikasten, nicht wahr, Pappi?« bettelte Sandra.
»Hat mich schon genug gekostet, dein Spielzeug.«
Die Puppenfrau neigte den Kopf ein wenig zur Seite und schaute fragend zu Mertens auf, so als hätte er in einer Fremdsprache gesprochen. Eine Weile hielt er ihrem klaren Blick stand.
»Vati, komm, du wolltest mir doch beim Saubermachen helfen!« rief es aus der Menschen-Schlafstube.
Mertens seufzte im Vorgefühl der Arbeit und wandte sich um.
»Du mußt dich noch verabschieden«, forderte Sandra, »sonst denken sie, du bist aus dem Fenster gefallen.«
»Die Pflicht ruft«, entschuldigte sich Mertens bei den Puppen. Für einen Moment überkam ihn der Wunsch, das Haus samt den Puppen, die ihn zu solch närrischen Entschuldigungen verleiteten, vom Tisch zu kippen, doch da zwinkerte ihm die Puppenfrau kokett zu. »Ich sehe Sie hoffentlich bald wieder?« Sie schritt, als wolle sie ihn zur Tür geleiten, quer durch das Wohnzimmer. »Ich hätte Sie gern zum Kaffeetrinken eingeladen. Ein andermal vielleicht?«
»Schönen Tag noch, Herr Nachbar«, verabschiedete ihn der Puppenmann in plumper Vertraulichkeit. »Könnten Sie mir nicht eine Heimbowlingbahn von Lilliput Inc. besorgen?«
»Du schenkst mir den Sanikasten, nicht wahr, Pappi?« quengelte Sandra.
»Nichts werde ich«, schimpfte Mertens.
»Und wenn sich nun Frau Winzling ansteckt?«
»Vati, wo bleibst du denn?«
Unfähig, etwas zu erwidern, eilte Mertens ins Schlafzimmer. Katrin hatte sich die Haare hochgebunden. Über dem Hausanzug trug sie eine Küchenschürze, deren Taschen sich häßlich beulten. Mit vor Anstrengung gerötetem Gesicht schob sie den kraftvoll röhrenden Staubsauger über den Teppich. Wortlos drückte sie Mertens einen Lappen in die Hand. Es war ein stummer Vorwurf: In anderen Haushalten sorgten Robot-Sauger für Sauberkeit.
Während Mertens mechanisch über die Schränke und die Bettumrandung wischte, hatte er das Bild der Puppenfrau vor Augen. Die würde einem kein Wochenende vermiesen. Er verlangte ja keine Märchenfee und keinen Hollywoodstar, er wollte ja nur seine Ruhe, ein ordentliches Heim und eine Frau, die ihre Obliegenheiten so flink und unauffällig erledigte wie er die seinen. Und ein wenig Abwechslung, ja, auch die. Viel zu einförmig verliefen seit Sandras Geburt seine Tage, Arbeit, nichts als Arbeit, und nun war auch noch sein Chef mit dieser idiotischen Vorstellung herausgerückt, daß sich jeder Fahrer am besten selbständig machen sollte, das erhöhe die Flexibilität und brächte ihnen einen Vorteil im gnadenlosen Wettbewerb um den Brötchenmarkt …
An diesem Wochenende schaltete Mertens den Fernseher häufiger ein als sonst. Nicht allein des Dauerregens wegen, nein, wenn er im Sessel lehnte, konnte er aus den Augenwinkeln die Puppenfrau beobachten. Angeblich konnte man die Puppen so programmieren, daß sie kleine Soaps aufführten. Die entsprechende Software gab es recht preiswert zum Download im Internet. Doch Mertens wollte sich nicht auch noch mit den Einstellungen und Konfigurationen herumärgern.
Einmal jedoch fesselte ihn das Fernsehprogramm: Auf die Sportreportage folgte ein Bericht über »HighTech aus Fernost«.
»Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium«, jubilierte der Chor, schlitzäugige Menschen, die angeblich Beethoven über alles liebten und ein besseres Deutsch drauf hatten als die meisten von Mertens’ Kollegen. Eine Japanerin, angetan mit dem klassischen Kimono, lud, sich unablässig verbeugend, das Fernsehteam in ihr Heim ein. Es war pikobello sauber und ordentlich: Väschen und Döschen vor verschiebbaren Holzwänden, Papierampeln von der Decke, Bonsai-Bäumchen, zierlich wie für Puppen geschaffen. Dann rollten Haushaltroboter jeglicher Art ins Bild, kleine »Putzgeister« die in die Ecken fuhren und die wenigen Möbel abwischten, niedliche Serviceroboter von der Größe eines Kindes kurz vor der Pubertät, die Sushi servierten, Ikebana-Gestecke zusammenstellten und zugleich als nimmermüde Gesprächspartner dienten.
Später gerieten Hochhäuser mit riesigen japanischen Schriftzeichen ins Bild, endlose Werkhallen, in denen große Roboter kleine Roboter herstellten; Schiffe, beladen mit Containern, auf denen die Logos der Hersteller prangten. »Robots aus Fernost überschwemmen den Weltmarkt«, erklärte der Sprecher. »Japanische Firmen haben nach Autos und Unterhaltungselektronik ihre neue Bestimmung gefunden. Trumpf der Zaibatsus ist ihre Nanoelektronik, die fortgeschrittenste der Welt. Jüngst klagte ein Vertreter der kalifornischen Industrie- und Handelskammer: Eine Invasion ist auf dem Wege, Amerika wird von einer miniaturisierten fünften Kolonne überrannt. In jedem Kinderzimmer lauert die gelbe Gefahr. Und nicht einmal das mächtige China ist vor ihnen sicher, wie das parteiamtliche Verbot von ausländischen Spielzeugrobotern belegt.«
Mertens gähnte. Die Puppen wünschten sich gegenseitig angenehme Ruhe.
In dieser Nacht, der auf den Montag, wälzte sich Mertens im Schlaf. Ihm träumte, er käme von der Arbeit nach Haus. Die Tür öffnete sich, und sie stand vor ihm: Willkommen, Geliebter. Sie trug ihr blaues Kleid mit den weißen Puffärmeln, das glänzende kastanienbraune Haar fiel ihr in weichen Wellen bis auf die Schultern. Sie küßte ihn und führte ihn in eine weiträumige, helle Wohnung, in der jede Glasscheibe, jede Furnierfläche blitzte und funkelte. Vor den sonnendurchstrahlten Fenstern wehten weiße, goldumsäumte Gardinen. Sogar das Kind erledigte still und gehorsam seine Hausaufgaben. »Jetzt haben wir Zeit für uns«, sagte sie lächelnd und schwebte mit ihm zu der breiten, seidenbespannten Couch.
Doch da fuhr es wie ein kalter Hauch über ihn hinweg – die Zimmerdecke fehlte, hoch vom Himmel grinste wie ein riesenhafter schorfiger Mond ein verschwommenes, häßliches Gesicht; krachend brach eine ungeschlachte Kinderhand durch das Fenster und griff mit rohen, bonbonverklebten Fingern nach der Frau.
Mertens schreckte hoch. Das Herz klopfte ihm hart und laut. Durch das Fenster sickerte das weißliche Licht entfernter Straßenlaternen. Benommen richtete er sich auf. Noch halb im Schlaf tastete er nach den Pantoffeln unter dem Bett, schlich dann ins Wohnzimmer. Dort knipste er die Fernsehleuchte ein und ging vor dem Puppenhaus in die Hocke.
Da lagen sie wie tot oder vielmehr abgeschaltet: das Puppenkind in seinem Zimmer, Puppenfrau und Puppenmann im Ehebett, sie im vorderen Teil, er der Rückwand zugedreht. Ob diese Puppen auch miteinander schliefen? Er traute den Japanern allerhand zu …
Vom Nachtschränkchen glommen rötlich die Zahlen einer kleinen Digitaluhr: 25:13. Kupfern schimmerte der Reflex auf dem Haar der Puppenfrau. Mertens beugte sich näher heran. Sie hatte die Augen geschlossen – atmete sie oder täuschte er sich? Lange betrachtete er sie, endlich seufzte er und erhob sich. In diesem Moment schlug sie die Augen auf.
Flüsternd beteuerte Mertens, daß er sie nicht habe wecken wollen.
Sie tippte mit dem Zeigefinger an die Lippen, gähnte dezent hinter vorgehaltener Hand und streifte sich den hauchdünnen schwarzen Morgenrock über. Lautlos schlüpfte sie in das Wohnzimmer. Die bunte Tiffanylampe auf dem Sideboard verbreitete sanften Schein.
Erneut hockte sich Mertens auf die Fersen. Minutenlang musterte er sie, ohne ein einziges Wort zu sprechen.
»Wenn Sie mir einen Vornamen schenken, können wir uns duzen.«
Vom glockenhellen Klang ihrer Stimme bezaubert, sann Mertens nach. Leicht und zart mußte der Name sein, ihr angemessen, feenhaft. Julietta, dachte er, Julietta würde passen.
»Julietta, wie wunderbar!« jubilierte sie verhalten. »Ich danke dir.« Sie war dicht vor ihm, und sie schien seine Nähe zu genießen, denn sie drehte sich und tänzelte im Kreis, langsam, doch mit Grazie, wie von einer unhörbaren, sanften und doch erregenden Musik begleitet. Sie reckte sich auf, streckte die bloßen Füße in einer zeitlupenhaften Pirouette, bis sie sich vollends vom schimmernden Boden löste und einfach so dahinschwebte.
Verwirrt, und besorgt, daß der Traum vorschnell enden könnte, liebkoste er sie mit Blicken. Welch ein unüberbrückbarer Abgrund trennte sie!
»Leider besitze ich nur dies eine Kleid.« Sie verharrte in der Luft und schaute ihn sehnsuchtsvoll an. »Wenn ich mich für dich hübsch machen soll, dann besorge mir bitte den Garderobenkoffer von Lilliput Inc.«
Am nächsten Morgen steuerte Mertens den Lieferwagen sehr unkonzentriert. Fußgänger sprangen hinter parkenden Autos hervor, jede Ampel schaltete vor ihm auf Rot, und zu allem Überfluß kippte der schwere Container mit der Vollkornbrotmasse um. Sie hat nur ein Kleid, dachte er, nur ein einziges Kleid … Hatte er nun geträumt oder sich wirklich mit ihr unterhalten? Die Nacht war so fern gerückt, als gehörte sie zu einem anderen, schöneren Leben, einem Leben ohne Ärger und Plackerei, ohne Dreck und Chefs, zu einem Leben in immerwährender Jugend.
Auf dem Hof der Brotfabrik, als ihm beim zweiten Beladen speiübel wurde, schalt er sich einen Narren: Geld für Puppenwünsche verplempern, soweit kam es noch mit ihm. Er fiel nicht auf das abgefeimte Spiel der Japaner herein! Aber schließlich gewann die Erinnerung an die Nacht wieder die Oberhand, und als Mertens auf dem Hof eines Supermarktes warten mußte, gaben seine Finger wie von selbst die Internet-Adresse des »Super Toy Shops« in das Web-Book des Lieferwagens ein, das eigentlich nicht für privates Surfen gedacht war.
Japanische Neonbuchstaben tauchten auf, dazu eine englische Übersetzung, die die Übersetzungssoftware des Web-Books wiederum ins Deutsche übersetzte. Mertens brauchte lange, bis er sich durchgefunden hatte. Nein, er wollte kein »Schnittstellenset« mit »Kopfsitz-Display« und »Daten-Grapschern«, und ein wöchentliches Taschengeldkonto für die Puppen einrichten wollte er auch nicht. Und ebensowenig die Puppen nach lebenden »Charakter-Rollen-Models« reprogrammieren. Endlich fand er die Garderobenkoffer, die hier »Kleidersafe« hießen, was wohl ein feinsinniger Hinweis auf den Preis war. Nun mußte er sich für eine Kollektion entscheiden: die von Kenzo oder die von Ichiyama, die nach dem Sailor-Moon-Manga oder die Ninja-Kostüme?
Mertens rief sich zur Ordnung. War es schon so weit heruntergekommen, daß er sich für Puppenkleider interessierte? Und sündhaft teuer waren die angeblichen Designerklamotten außerdem.
Als Mertens die Wohnungstür hinter sich schloß, hatte Katrins Sohn den Roboter in sich entdeckt. Er bewegte sich nurmehr eckig und ruckhaft, erstarrte in den unmöglichsten Posen, summte laut vor sich hin und schnalzte, wenn er überlegte, mit der Zunge, was ein Klicken bedeuten sollte. Dazu drückte er sich wortkarg und mit eiskalter Logik aus und ließ durchblicken, wie sehr ihn das umständliche, unlogische Gehabe »der Menschen« anödete. Sein maschineller Intellekt war über allen banalen Alltagskram erhaben – etwa jemandem die Tür zu öffnen –, und weshalb sollte sich ein Roboter die Hände waschen?
»Pappi, hast du den Sanikasten gekauft?« wurde Mertens von Sandra bestürmt, kaum daß er sich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt hatte. »Pappi, wo ist der Sanikasten?« Enttäuschung ballte sich wie eine dicke Regenwolke auf ihrer Stirn. »Du hast es mir versprochen, aber sicher hast du es! Die Frau Winzling steckt sich noch an!«
Verdrossen wies Mertens seine Tochter zurecht. Nichts hatte er versprochen. Das bildete sie sich alles nur ein. »Du weißt doch, daß man sich nie alles leisten kann, was man gerade will. Deshalb muß man auch sorgsam mit seinen Siebensachen umgehen.«
Sandra war beleidigt. Sie suchte nach ihrem lieben alten Hampelmann und schmollte. Krachmusik brandete durch die Wohnung, anscheinend hatten Roboter ein schlechtes Gehör.
»Bring unseren Sohn zur Räson!« forderte Katrin, die plötzlich aus der Küche auftauchte.
Mertens legte sich eine kräftige Standpauke zurecht. Wurde Zeit, daß der Bengel außer Haus kam. Pflichtschuldig donnerte er gegen die Tür zu Roberts Zimmer.
»Roboter-Roberter hört dich sowieso nicht«, kommentierte Sandra schadenfroh.
»Hilf mir doch ein wenig beim Aufdecken«, rief Katrin aus der Küche. Was hatte sie nur den ganzen langen Nachmittag getrieben? Beim Friseur war sie jedenfalls nicht gewesen.
Mertens stöhnte. Er war heute nicht fähig, auch noch den Haushalt zu übernehmen, er fühlte sich schlapp, fast krank, vielleicht vom Brotgestank, vielleicht weil es tagein, tagaus wie aus Eimern goß.