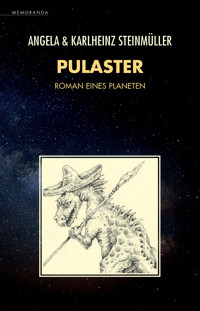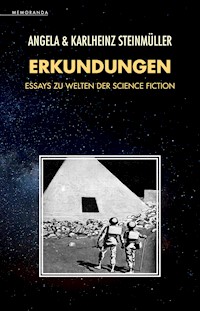8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Band der Werkausgabe der Steinmüllers ist zugleich der Einstieg in einen Zyklus, zu dem der überwiegende Teil ihres Œuvres gehört und der in einem Lichtjahre weiten, sich über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg verändernden, dabei aber weitgehend kohärenten Weltentwurf angesiedelt ist. Die Geschichten in "Warmzeit" spielen teils auf der Erde, teils auf Planeten und Asteroiden unseres Sonnensystems, manche in einer nahen, schon absehbaren Zukunft, die letzte handelt vom Start des ersten interstellaren Schiffs im Jahre 2100. Für die Jahrzehnte dazwischen entwerfen die Autoren ein Kaleidoskop von Erzählungen mit weit gefächerten Themen, traditionellen wie auch innovativen SF-Ideen und sehr unterschiedlichen Stimmungen – abenteuerlich und philosophisch, tragisch und humoristisch, utopisch und dystopisch, satirisch und melancholisch. Die vorliegende Neuausgabe des erstmals 2003 erschienenen Bandes ist um ein Vorwort von Karlheinz Steinmüller und drei neue Erzählungen erweitert, das "Kurzinfo Weltraumkolonisation" und Erik Simons Nachwort wurden aktualisiert und ergänzt. Angela und Karlheinz Steinmüller · Werke in Einzelausgaben · Band 1
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Angela und Karlheinz Steinmüller
Warmzeit
Geschichten aus dem 21. Jahrhundert
Angela und Karlheinz Steinmüller
Werke in Einzelausgaben. Band 1
Herausgegeben von Erik Simon
Impressum
Angela und Karlheinz Steinmüller: Warmzeit
Geschichten aus dem 21. Jahrhundert
(Werke in Einzelausgaben. Band 1, erweiterte Neuausgabe)
Herausgegeben von Erik Simon
Vignette von Thomas Hofmann
© 1977–2003, 2021, 2022 Angela und Karlheinz Steinmüller
(für die Erzählungen und das »Kurzinfo Weltraumkolonisation«)
Die Daten der Erstpublikationen sind der »Publikationsgeschichte« am Ende des Bandes zu entnehmen.
© 2003 Hans-Peter Neumann und Erik Simon (für das Vorwort zur Ausgabe von 2003)
© 2022 Karlheinz Steinmüller (für sein Vorwort)
© 2003, 2022 Erik Simon (für das Nachwort)
© 2022 Erik Simon und Memoranda Verlag (für die Zusammenstellung dieser Ausgabe)
© 2022 Thomas Hofmann (für die Titelvignette)
© dieser Ausgabe 2022 by Memoranda Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Erik Simon
Korrektur: Christian Winkelmann
Gestaltung: Hardy Kettlitz & s.BENeš [www.benswerk.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
ISBN: 978-3-948616-62-5 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-63-2 (E-Book)
Inhalt
Impressum
Vorwort zur Ausgabe von 2003
Von warmen Zeiten, Westmüll und dem Großen Roten Fleck
Umbruch
Warmzeit
Abschied von Melchizedek
Der Laplacesche Dämon
Das Auge, das niemals weint
Beltbürger
In der Nähe von L5
Korallen des Alls
Alle Flüche der Welt
Leben, wohin man schaut
Carlo, das Tier
Schöne neue Planeten
Der letzte Tag auf der Venus
Die Lieder vom Mond
Motten an Bord
Sauerstoffmangelgeschichte
Mars, auf immer und ewig
Aufbruch
Der Traum vom Großen Roten Fleck
Vor der Zeitreise
Das Auswandererschiff
Kurzinfo Weltraumkolonisation
Von der Erde bis an den Belt, und dann geradeaus
Publikationsgeschichte
Bücher bei MEMORANDA
Vorwort zur Ausgabe von 2003
Hans-Peter Neumann und Erik Simon[1]
Angela und Karlheinz Steinmüller gehörten nicht nur zu den wichtigsten Science-Fiction-Schriftstellern der DDR, auch in der deutschsprachigen Nachkriegs-SF überhaupt haben sie einen bleibenden Platz neben Österreichern und Westdeutschen wie Herbert W. Franke, Carl Amery und Wolfgang Jeschke oder den Ostdeutschen Johanna und Günter Braun errungen.
Wie viele SF-Autoren ihrer Generation (und der vorangehenden), schlug das Ehepaar Steinmüller zunächst naturwissenschaftlich-technische Karrieren ein: Angela, 1941 in Schmalkalden geboren und in Berlin aufgewachsen, ist Diplommathematikerin und war in der EDV beschäftigt, der 1950 in Klingenthal geborene Karlheinz wurde nach einem Studium in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Berlin Diplomphysiker. Auch nach dem Wechsel der Fachrichtung und seiner Promotion zum Doktor der Philosophie 1977 blieb er den Naturwissenschaften verbunden: Seine Dissertation schrieb er über »Die Maschinentheorie des Lebens. Philosophische Fragen des biologischen Mechanizismus«, und anschließend befaßte er sich mit der kybernetischen Modellierung von Ökosystemen.
Als SF-Autor debütierte Karlheinz Steinmüller zunächst allein 1977 mit der Erzählung »Alle Flüche der Welt«, der einige weitere sowie 1979 sein Sammelband Der letzte Tag auf der Venus folgten. Ihren ersten Roman Andymon verfaßten die Steinmüllers bereits gemeinsam, und als er 1982 erschien, wurden beide freischaffende Schriftsteller. Es folgten bis 1990 in DDR-Verlagen ein gemeinsamer Erzählungsband, zwei weitere SF-Romane und das biographische Sachbuch Charles Darwin. Vom Käfersammler zumNaturforscher (1985). Außerdem schrieben die beiden – meist gemeinsam, gelegentlich aber auch einzeln – weitere phantastische und SF-Erzählungen für Anthologien und Zeitschriften, und Karlheinz veröffentlichte Essays und Artikel zur SF und ihrem Umfeld.
So, wie in der an neuen, interessanten Autoren reichen DDR-SF der siebziger Jahre Johanna und Günter Braun die herausragenden Gestalten waren, haben die Steinmüllers die achtziger Jahre dominiert. Zwischen den beiden Autorengespannen gibt es aber einen signifikanten Unterschied, der wohl mit ihrem Weg in die Science Fiction zusammenhängt und geeignet sein mag, den besonderen Erfolg der Steinmüllers anschaulich zu erklären. (Darum nun zunächst ein paar Sätze zu den Brauns – den Vorrang der Steinmüllers vor dem einen oder anderen Routineschreiber darzulegen, wäre müßig; es geht uns, gerade bei durchaus kommensurablen literarischen Qualitäten, um den Unterschied in der Spezifik.)
Als die Brauns sich (nach einigen wenigen früheren Kurzgeschichten) zu Beginn der siebziger Jahre der Phantastik und SF zuwandten, hatten sie schon eine lange Erfahrung auf anderen Gebieten der Literatur hinter sich, und ihre Haltung zu den Konventionen des Genres war immer von einer spielerischen Distanz geprägt, die das SF-Motiv ausschließlich als Mittel zur Illustration eines literarischen Zwecks versteht. Mit ihrem neuartigen, ungewohnt lockeren Ton und den unverkennbar satirischen Inhalten eroberten die Brauns einen Gutteil des anspruchsvolleren SF-Publikums, vor allem aber die professionelle Literaturkritik – sie sind bis auf den heutigen Tag die von der Kritik am stärksten wahrgenommenen SF-Autoren der DDR geblieben, und das weit über den deutschen Sprachraum hinaus. Seit den späteren siebziger Jahren begannen sie jedoch, einen Teil ihrer Leser wieder zu verlieren, als sich die Faszination ihres hochgradig individuellen, sofort erkennbaren Stils abzunutzen begann und die Gleichnishaftigkeit der phantastischen Konstellationen immer deutlicher ausgestellt wurde; den konventionelleren Teil der SF-Leserschaft haben sie wahrscheinlich von vornherein nicht erreicht.
Die Steinmüllers kommen dagegen unverkennbar von der SF her; sie waren, lange bevor sie SF-Autoren wurden, SF-Leser.[2] Karlheinz’ Debütband Der letzte Tag auf der Venus ist mit seinen SF-Ideen und der Machart der meisten Geschichten noch sehr deutlich in der traditionellen SF verwurzelt und läßt Vorbilder erkennen – anglo-amerikanische SF der vierziger bis sechziger Jahre, sowjetische der Sechziger, aber beispielsweise auch Herbert W. Franke. Die Leser in der DDR wußten das durchaus zu schätzen, zumal die konkreten SF-Ideen originell waren, die Ausführung kaum hinter berühmten Vorbildern zurückstand und sich in einigen Erzählungen wie »Der Traum vom Großen Roten Fleck« und insbesondere »Zerdopplung« bereits die besondere Stärke der Steinmüllers ankündigte: eine SF-Idee (oder ein Bündel von Ideen) nach der ihr innewohnenden Logik zu entwickeln, die Geschichte um ihrer selbst willen zu erzählen, sie dabei aber auf die menschlichen, gesellschaftlichen, philosophischen Implikationen abzuklopfen und diese in poetische Bilder zu fassen. Science Fiction beruht ja auf einer Absprache zwischen Autor und Leser, so zu tun, als seien die phantastischen Ereignisse mit einer rationalen, wissenschaftlichen Weltsicht vereinbar, und die Steinmüllers sind mit ihren Geschichten näher an dieser konventionellen Zwischen-Wirklichkeit als die Brauns; sie schreiben schlicht SF-mäßiger.[3] In ihrem gemeinsam verfaßten Erzählungsband Windschiefe Geraden (1984) blieben die Steinmüllers diesem Ansatz treu, konnten jedoch einen erheblichen Zugewinn an stilistischem Können, Originalität der Ideen und Motive und an Bedeutsamkeit der Themen verbuchen. Den Durchbruch in der Gunst des Publikums erreichten sie allerdings schon zwei Jahre früher mit ihrem Roman Andymon.
Die Steinmüllers waren nicht nur die besten, sondern auch die beliebtesten SF-Autoren in der DDR der achtziger Jahre, was ja durchaus nicht unbedingt zusammentreffen muß. Die Literaturkritik in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik äußerte sich lobend (soweit sie SF überhaupt zur Kenntnis nahm); ihre Bücher verkauften sich gut (die Gesamtauflage ihrer fünf SF-Bücher in der DDR von reichlich einer halben Million sättigte den Bedarf nicht); alle ihre Romane und ein Auswahlband mit Erzählungen erschienen auch in bundesdeutschen Verlagen, Andymon zudem in der Slowakei und einzelne Erzählungen in bulgarischer, chinesischer, japanischer, polnischer, russischer und tschechischer Übersetzung.
Besonders kennzeichnend (und gut belegt) ist indes die Reaktion jenes relativ kleinen, aber intensiv interessierten und kenntnisreichen Teil des Publikums, der sich in offiziellen SF-Klubs (und nebenbei in inoffiziellen Freundskreisen) organisierte: des SF-Fandoms. Mit Andymon lösten die Steinmüllers eine riesige Begeisterung aus, wie sie in der DDR-SF bis dato höchstens Sergej Snegows Space-Opera Menschen wie Götter und die ersten Timothy-Truckle-Geschichten von Gert Prokop bewirkt hatten, beides übrigens Werke, die in ihrer Machart weder einander noch Andymon im mindesten ähneln. Der Ostberliner SF-Klub, der damals größte in der DDR, gab sich den Namen »Andymon«, ein in der DDR beispielloser Vorgang. Bei einer 1989 durchgeführten Umfrage unter den organisierten SF-Fans wurde Andymon zum beliebtesten DDR-SF-Buch gewählt, die Steinmüllers zu den beliebtesten Autoren. Die Leser honorierten den großen Reichtum an Science-Fiction-Ideen, den in der DDR-SF so häufig vermißten »sense of wonder« und nicht zuletzt die utopische Komponente: Entwürfe von und Diskussionen um verschiedene Lebensmodelle. Andymon war der Vorreiter mehrerer Romane von verschiedenen Autoren, die sich in den achtziger Jahren nach längerer Abstinenz in der DDR-SF wieder utopischen Gedankengängen zuwandten. Die geradlinig erzählte Handlung mit ihren zur Identifikation einladenden Helden dürfte ein übriges getan haben, vor allem aber wohl doch die Weite des Entwurfs – es geht ja um nichts Geringeres als um die Gründung einer neuen Menschheit auf dem terraformierten Planeten Andymon, Lichtjahre von der Erde entfernt und ohne jeden (direkten) Kontakt zu ihr und ihren Geschicken – »völlig losgelöst von der Erde«, wie es ungefähr zur selben Zeit in einem westdeutschen Schlager hieß, und nirgends ein sowjetischer Raumschiffkommandant.
Pulaster, der zweite Roman der Steinmüllers, erschien 1986 und ist (wie sein Vorgänger) nach einem Planeten benannt, wo die irdische Raumflotte einen kleinen Stützpunkt unterhält und der Held erst mit Bürokratie irdischer Machart und dann mit den Ureinwohnern, vernunftbegabten Sauriern, konfrontiert wird. Das Buch wurde etwas ruhiger aufgenommen – es ist komplexer und im Grunde besser geschrieben als Andymon, wird aber nicht so mundgerecht erzählt und kommt etwas schwer in Fahrt, bis das eigentliche und nachhaltig beeindruckende SF-Abenteuer beginnt. Nichtsdestoweniger wurde Pulaster von den Fans zum besten Roman der beiden Jahre 1986/87 gewählt und mit dem »Traumfabrikanten«, dem ersten in der DDR gestifteten SF-Preis, ausgezeichnet. Auf dem Eurocon 1988 erhielten die Steinmüllers einen Preis der Europäischen Science-Fiction-Gesellschaft.
Bemerkenswert an der Entwicklung zu komplexeren Erzählstrukturen und anspruchsvollerem Stil ist die Tatsache, daß es den Steinmüllers gelang, ihre Leser auf diesem Weg »mitzunehmen«. Daß sich das von ihrem dritten Roman, der wohl als ihr gelungenster gelten darf, nicht mit ebenso großer Sicherheit belegen läßt, hat durchweg außerliterarische Ursachen. Der Traummeister ist von der Anlage her wohl noch vielschichtiger als Pulaster, dabei aber kompakter und dynamischer erzählt. Nicht allein wegen seiner literarischen Qualitäten, auch dank seiner Thematik hat er in der DDR-SF kaum seinesgleichen: Der Roman spielt auf einem fernen Planeten, wo eine irdische Kolonie ins Mittelalter zurückgesunken ist und wo die Bürger der Stadt Miscara das Träumen verlernt haben, sich aber mit Hilfe einer noch funktionierenden Apparatur aus alter Zeit von einem von außerhalb stammenden »Traummeister« dessen Träume eingeben lassen – und wo verschiedene politische Gruppierungen versuchen, per Manipulation der normierten Träume ihre Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft durchzusetzen. Als das Buch jedoch (wegen wiederholten Terminverzuges des Illustrators) mit über einem Jahr Verspätung 1990 erschien, nahm eine real existierende Gesellschaft, die sich für ideal ausgegeben hatte, gerade das ihr im Roman prophezeite Ende. Den damit verbundenen Perturbationen ist es geschuldet, daß Der Traummeister im ostdeutschen Fandom weniger Resonanz als die vorangegangenen Bücher auslöste; in der alten Bundesrepublik jedoch wurde er von der SF-Kritik sehr positiv aufgenommen.
Nach dem Zusammenbruch der DDR und ihres Verlagswesens standen den Steinmüllers – anders als vielen ihrer ostdeutschen SF-Kollegen – zwar noch immer professionelle Publikationsmöglichkeiten offen, doch sie erkannten auch sofort, daß das Schreiben von SF in Deutschland in erster Linie eine Nebentätigkeit ist, ein Hobby, von dem kaum ein Autor leben kann. Sie zogen sich daher zunächst weitgehend aus der SF zurück – freilich nicht vollständig, wie etliche in den neunziger Jahren publizierte neue Erzählungen von ihnen belegen. Karlheinz wandte sich 1991 der Futurologie zu, erst im »Sekretariat für Zukunftsforschung« in Gelsenkirchen, derzeit als wissenschaftlicher Direktor der »Z_punkt GmbH. Büro für Zukunftsgestaltung«, Essen und Berlin. Er hat zahlreiche fach- und populärwissenschaftliche Artikel veröffentlicht und ist heute einer der bekanntesten deutschen Futurologen: Experte in Fernseh-Gesprächsrunden, beliebter Interviewpartner von Zeitschriften und Politmagazinen sowie Referent bei zahllosen Symposien deutscher und ausländischer Industriekonzerne. In den letzten Jahren haben auch zwei Sachbücher zu dieser Bekanntheit beigetragen, die beide Steinmüllers gemeinsam verfaßt haben: Visionen 1900·2000·2100. Eine Chronik der Zukunft (1999) und Ungezähmte Zukunft. Wild Cards und die Grenzen der Berechenbarkeit (2003). Während das zweite sich auf ein futurologisches Thema konzentriert, spannt ersteres einen weiten Rahmen von Szenarios der aktuellen Zukunftsforschung über Ingenieurprojekte der Vergangenheit, Utopien, Zukunftsentwürfe der Science Fiction bis zu etlichen in den Text eingebetteten SF-Erzählungen.
Nicht nur das Visionen-Buch belegt, daß die Steinmüllers auch nach 1990 der SF treu geblieben sind. In den frühen neunziger Jahren hat Angela an Forschungsprojekten über den Literaturbetrieb in der DDR mitgearbeitet und dabei u. a. das Verhältnis der staatlichen Zensur zur DDR-SF untersucht; gleichzeitig arbeiteten die Steinmüllers an einem Sammelband von Studien zur DDR-Science-Fiction, der 1995 unter dem Titel Vorgriff auf das Lichte Morgen erschien und insbesondere die gesellschaftlichen und politischen Aspekte des Gegenstandes behandelt. Auch an anderen Stellen haben sich die Steinmüllers in Artikeln und Essays zur SF geäußert, und kaum einer der Journalisten, der sie vor allem als Futurologen befragt, verschweigt ihren Hintergrund in der Science Fiction.
Und schließlich haben die Steinmüllers auch nach 1990 noch neue SF-Erzählungen publiziert – einige wenige nur, doch mit bemerkenswertem Erfolg: 1992 gewann Angela allein, 1994 zusammen mit Karlheinz und Erik Simon den Kurd-Laßwitz-Preis für die beste Kurzgeschichte bzw. Erzählung.
Diese neueren Erzählungen sind zusammen mit einem Teil der zu DDR-Zeiten publizierten auf ein Abenteuerheft, Anthologien und Zeitschriften verstreut, darunter auch auf solche, die nicht speziell der SF und Phantastik gewidmet sind. Von den in der DDR erschienenen SF-Büchern der Steinmüllers ist heute keines mehr lieferbar, einige in den letzten Jahren entstandene Erzählungen sind unveröffentlicht. Die Herausgeber und der Shayol Verlag haben daher eine Werkausgabe der Steinmüllers in Angriff genommen, die ihre gesamte phantastische und SF-Literatur versammeln soll: alle drei Romane und mindestens vier Erzählungsbände. Die Erzählungsbände werden völlig neu konzipiert, zwei von ihnen – darunter der vorliegende – enthalten Geschichten, die zusammen mit den Romanen in einen lose gefügten durchgehenden Weltentwurf, das »Steinmüller-Universum«, eingebettet sind. Ein Teil der älteren Werke wird für diese Ausgabe von den Autoren überarbeitet; den Romanen wird ergänzendes Material beigegeben. Sie, die Leser, sind eingeladen, das Œuvre dieser faszinierenden Autoren zu entdecken – auch, wenn Sie es vielleicht schon zu kennen glauben.
[1] Mit diesem Vorwort haben Hans-Peter Neumann und ich im Jahre 2003 die Werkausgabe der Steinmüllers eingeleitet, damals noch für den heute nicht mehr existierenden Shayol Verlag. Jetzt, fast zwei Jahrzehnte später, ist der Text immer noch richtig, nur eben unvollständig, und das aus erfreulichen Gründen: In den nunmehr zehn Bänden der Werkausgabe mit Romanen und Erzählungen ist rund die Hälfte der Texte nach 1990 entstanden, an ihre Seite ist 2021 ein zweiter Strang mit Essaybänden getreten. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, hier einige Formulierungen zu aktualisieren und noch ein paar Absätze anzustricken – der Biographie der Steinmüllers ist nichts sensationell Neues hinzuzufügen, abgesehen von weiteren futurologischen Arbeiten; ein Überblick über das »Steinmüller-Universum«, in dem die meisten SF-Werke der beiden Autoren spielen, findet sich auf aktuellem Stand im Nachwort. Außer dieser hier standen auch alle meine Fußnoten schon in der Fassung von 2003. – E. Simon im Oktober 2021.
[2] Von dieser für fast alle halbwegs bekannten Autoren der internationalen SF gültigen Regel gab es in der DDR merkwürdig viele Ausnahmen. Die Verfasser etlicher bemerkenswerter SF-Romane der fünfziger, sechziger Jahre haben eingestanden, vorher kaum andere SF gekannt zu haben, aber zumindest danach einiges Interesse für das von ihnen gewählte Genre entwickelt; bei manchen Autoren von DDR-SF ist aber selbst nach langjähriger Praxis deutlich zu erkennen, daß sie andere SF kaum zur Kenntnis nehmen, nicht einmal die seinerzeit in der DDR gedruckte. Demgegenüber war insbesondere Karlheinz Steinmüller einer der wenigen DDR-Schriftsteller mit einem wirklich guten Einblick in die internationale SF.
[3] Solche Konventionen gibt es übrigens überall in der Kunst, und über die Nähe zur Wirklichkeit, auf die jedes respektable Werk letzten Endes abzielt, ist damit nichts gesagt, nur über die Art der Darstellung: Wenn man vom Zuschauersaal auf die Bühne schaut, weiß man natürlich, daß dort oben ein Spiel stattfindet, aber nach der Theatertradition des 19. Jahrhunderts sollte dieses Spiel die Wirklichkeit nachahmen, nach Ansicht neuzeitlicher Regisseure muß ein antiker oder mittelalterlicher Soldat grundsätzlich eine Wehrmachtsuniform tragen, Faust wie Einstein aussehen und die Hälfte des Ensembles nackt sein, und zur Konvention der Oper gehört, daß tödlich Verwundete nicht bluten, sondern singen. SF ähnelt in ihrem Kern dem Theater des späteren 19. Jahrhunderts mit viel Bühnenmaschinerie, um Geister, Drachen und Vulkanausbrüche ganz echt wirken zu lassen, aber immer im Dienste der Fabel. Im modernen SF-Film ist davon oft nur noch die Maschinerie übrig.
Von warmen Zeiten, Westmüll und dem Großen Roten Fleck
von Karlheinz Steinmüller
Selbstverständlich ist der Klimawandel eine sowjetische Erfindung. Ich kann es belegen, denn ich wurde mit der menschgemachten Erderwärmung zum ersten Mal Anfang der 1980er Jahre durch einen Artikel in der Wissenschaftszeitschrift Priroda konfrontiert. Der Beitrag mit seinen Rückblicken auf vergangene Klimaextreme und mit dem Ausblick auf eine heißere Zukunft faszinierte mich, ich schlachtete ihn gleich für einen Französischkurs aus. Da trug ich dann lang und breit über »une hypothèse de Budyko« vor. Prof. Michail Iwanowitsch Budyko war damals Leiter der Abteilung zur Erforschung des Klimawandels am Hydrologischen Staatsinstitut in Leningrad.
Budyko, ein überaus versierter Geophysiker und Klimatologe, hatte eine eigene Methode entwickelt, um das irdische Klima über lange Zeiträume zu prognostizieren: die Methode der »Paläoanalogien«. Klimamodelle gab es um 1970, als Budyko seine Theorie erstmals vorbrachte, noch nicht. Er stützte sich daher auf Vergleiche. Er untersuchte das Klima älterer erdgeschichtlicher Epochen und fand heraus, daß sich in wärmeren Zeitaltern mehr CO₂ in der Erdatmosphäre befand. Die Schlußfolgerung lag auf der Hand: Wenn die Menschheit immer mehr CO₂ in die Luft pustet, würde uns nicht, wie man damals noch überwiegend annahm, eine weitere kleine Eiszeit bevorstehen, sondern eine ausgemachte Warmzeit mit der Verschiebung von Klimazonen, dem Abschmelzen des Polareises, einem Anstieg des Meeresspiegels und nicht zuletzt gravierenden Auswirkungen für die sozialistische Landwirtschaft. Und das alles sollte schon innerhalb der nächsten fünfzig Jahre geschehen. – Budykos Szenario wirkte, als hätte es sich ein SF-Autor aus den Fingern gesogen.
Es verging allerdings ein volles Jahrzehnt, bis wir, Angela und ich, »Budykos Hypothese« in unserer ersten und einzigen CliFi-Story umsetzten und darin die klimabedingte Völkerwanderung mit der Geisteshaltung deutscher Schrebergärtner kombinierten. »Warmzeit« nannten wir die Erzählung. Heute spricht man von »Heißzeit«. Warmzeit mag zwar erdgeschichtlich korrekt sein, klingt für die jungen Klimaaktivisten aber viel zu harmlos. Wenn schon Panik, dann heftig!
Für uns drängten sich damals allerdings andere Themen in den Vordergrund. »Die Grenzen des Wachstums« waren in aller Munde. Der Club of Rome hatte 1971 mit dem Buch das vorherrschende Zukunftsbild deutlich verdüstert. Ein ganzes Bündel globaler Probleme sollte in den Jahrzehnten ab 2000 die Menschheit überrollen: Bevölkerungsexplosion, Ressourcenerschöpfung, Umweltverschmutzung, Welternährungskrise, Zusammenbruch. Natürlich lehnten die Parteiideologen in der DDR diesen typisch westlichen Pessimismus ab. Die Umweltprobleme aber erlebten wir buchstäblich hautnah. Einmal wurden wir als Autoren nach Bitterfeld eingeladen. Nach der Lesung mußten wir unseren Trabbi von einer merkwürdig grauen Asche befreien, die sich in den vergangenen drei Stunden millimeterstark auf die Rennpappe gelegt hatte. Und wie man uns erzählte, bekamen manche Menschen aus dem Chemierevier sogar Kopfschmerzen, wenn sie im Urlaub zu lange unverschmutzte Luft atmeten.
Dazu beunruhigte uns der Umgang mit Atommüll. Drei Jahre vor dem Reaktorunfall von Tschernobyl spekulierten wir darüber, wie eine Gesellschaft aussehen müßte, wenn die Radioaktivität sozusagen in jedem Winkel lauert. Dabei ging es uns nicht nur um radioaktiven Abfall. Wir hatten auch im Kopf, daß die DDR den Westberliner Müll gegen gute Devisen – dann aber mit Kußhand – aufnahm. Weshalb sollte nicht irgendwann einmal ein Drittwelt-Land sein Auskommen als Atommüll-Importeur fristen? Das wäre zwar schlecht für die Gesundheit, aber lukrativ für die Unternehmen und gewiß ein satter Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt. In der Konsequenz ergibt sich eine »nukleare Demokratie«: Jeder bekommt etwas vom strahlenden Kuchen ab.
Gesellschaften, die dem Einzelnen kaum Freiraum bieten, in denen alles geregelt und festgelegt ist, waren für uns in den 1980ern ein sehr nahe liegendes Schreckbild – und sie sind es auch heute noch. Nicht nur ein politisches System, auch eine scheinbar perfekte Hochtechnologie kann die Menschen versklaven. Und vielleicht bemerken sie dies nicht einmal. Damals ließen wir uns von E. M. Forsters »The Machine Stops«, der ersten bedeutenden Antiutopie des 20. Jahrhunderts, inspirieren. Man stelle sich vor, daß die Menschen vereinzelt gehalten werden, auf der Erde kein Platz mehr für individuelles, nicht sozial konformes Verhalten ist, alle zu Rädchen in einer übermächtigen Maschinerie werden und letztlich ihr völlig ausgeliefert sind. Im besten Fall können sie noch in virtuellen Realitäten von unerreichbar fernen Welten träumen.
Aber wir ließen und lassen uns nicht nur von Futurologie und klassischer Science Fiction inspirieren. »Jeff Wayne’s Musical Version of the War of the Worlds« klingt uns, seit wir die aus Westberlin eingeschmuggelten Platten zum ersten Mal hörten, immer wieder im Ohr. Also lag es nahe, in einer noch ganz neuen Erzählung über das Ende einer Marssiedlung einige Zeilen daraus zu zitieren – ebenso wie zwei Kurzgedichte (dem Haiku verwandte Senryū) unseres Freundes Erik Simon, der uns auch bei diesem Band mit zahllosen Anregungen und Ratschlägen unterstützt hat.
Es mag sein, daß wir es mit unseren bisweilen recht düsteren Erzählungen etwas übertrieben. Als ein Bändchen mit unseren Storys in der renommierten Phantastischen Bibliothek des Suhrkamp-Verlags herauskam, schrieb ein Rezensent in der Wochenzeitung Die Zeit von »verkorksten Welten«. Besonders mißfiel ihm, daß wir »das Schicksal vereinzelter, oft desorientierter Menschen im Mahlstrom alltäglicher Freizeitelektronik (atomgetriebene, vollelektronische Eierkocher) und unmenschlicher (weil emotionsloser) Regierungssysteme« darstellten. Wir waren stolz auf die Besprechung und zitierten die vernichtende Kritik immer wieder gern. Zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2003, erschien die erste, noch etwas kürzere Ausgabe dieser Erzählungssammlung im Shayol-Verlag. Und wieder stieß sich ein Rezensent – diesmal in der Jungen Welt – am pessimistischen Ende einer Story: Müßte die Heldin von »Der Laplacesche Dämon« sich nicht aufraffen und aktiv werden? Das war völlig richtig beobachtet und gedacht, aber wenn der Leser von selbst auf diesen Gedanken kommt, müssen wir ihn nicht explizit in die Story hineinschreiben.
Nein, wir sind keine Pessimisten, obwohl, wie es scheint, zu den ungelösten alten Problemen neue bedrohliche Entwicklungen dazugekommen sind, obwohl sich beispielsweise Fake News schneller ausbreiten als Nachrichten mit Fakten und gesunder Menschenverstand offensichtlich keinen Wettbewerbsvorteil bietet. Gelegentlich fragt man sich, ob all der Blödsinn, der in den sozialen Medien kreist, nicht doch in Melchizedek oder anderswo fabrikmäßig produziert wird.
Unser angerissenes Jahrhundert wird von der Warmzeit und vielen anderen dramatischen Umbrüchen geprägt, aber zugleich befindet sich die Menschheit permanent im Aufbruch, auch wenn man im Chaos der Veränderungen nicht weiß, wohin. Wie der Titel der Erzählung »Der Traum vom Großen Roten Fleck« andeutet: Vielleicht liegt die Hoffnung in den kaum erforschten Weiten des Sonnensystems? Als Beltbürger mag man eine Freiheit gewinnen, die es auf der übernutzten und überreglementierten Erde nicht mehr gibt. In der Realität bleibt der »freie Weltraum« leider ein schöner Traum – wie ja auch nach neueren Erkenntnissen der berühmte Große Rote Fleck auf dem Jupiter im Schrumpfen begriffen ist und vielleicht irgendwann einfach verschwinden wird.
Umbruch
Warmzeit
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.
Jakob van Hoddis
Das Brausen schwebte, als komme es vom fahlblauen Himmel herab, über den Quadern der Wohnblocks. Es füllte die hitzeflirrende Straße und umhüllte die Frauen in der Schlange wie ein unsichtbarer Schleier. Doch sie vernahmen es nicht und unterhielten sich mit gedämpfter Stimme. Als das Brausen Deike zum ersten Mal heimsuchte, war er vor dem ungewohnten, allgegenwärtigen Geräusch geflohen, er hatte die Türen hinter sich zugeschlagen und den Kopf in Kissen vergraben und sich die Ohren mit den Fingern verstopft. Gleich, ob er den Verstärker der implantierten Hörhilfe auf Null herunterregelte oder ihn voll hochzog, vor dem Brausen gab es keine Zuflucht.
Eine Staubhose fegte heran. Deike kniff Lider und Lippen zusammen. Als er wieder zu atmen wagte, lag ein Geruch von warmem Asphalt und faulendem Tang in der Luft. Weiter vorn in der Reihe rieb sich Vanessa, seine Frau, mit dem Taschentuch die Augen; ihr war ein Staubkorn hineingeraten. Deike wagte es nicht, zu ihr zu gehen und ihr das Korn aus dem Auge zu wischen. Die Blocknachbarn kannten ihn so wenig wie er sie, und deshalb mochte er für alleinstehend gelten und eine Extraration ergattern.
Mehr als gewöhnlich sehnte er den Nachmittag herbei. In der Stadt kannst du wohnen, aber leben nur draußen im Grünen, wo die Hitze noch erträglich ist und der Blick zu den Wolken frei, wo sich die Nachbarn mit Heckenscheren und Duftstoffallen aushelfen und immer die Zeit für einen Schwatz finden. Im »periurbanen Ballungszentrum«, wie es behördlich hieß, kommunizierte man per Internet, draußen redete man über den Zaun hinweg von Mensch zu Mensch. Und genau das brauchte er, Deike, jetzt. Er konnte ja seinen persönlichen Avatar nicht einfach über das Netz in den Kommunalen Koordinationspunkt senden, Paßwörter knacken und die Amtsdateien durchsuchen lassen … Draußen in der Gartensiedlung jedoch hatte er Richard, seinen Freund aus Lausbubentagen und nun Mitarbeiter im K.K.Punkt, in Fleisch und Blut vor sich. Er würde ihm nach ein paar Klaren auf die Schulter klopfen: Na, mein Alter, eure Computer spinnen wohl? Wieso schließt ihr die Ferienhotels mitten in der Hochsaison? Das neue Kurverwaltungsgebäude steht auch leer. Und wieso zieht ihr die Baumaschinen von den Küstenschutzdämmen ab? Das brummt doch nicht umsonst in meinem Schädel …
Plötzlich hatte Deike Angst. Das Gefühl, daß es mit der Welt, die er kannte, zuende gehe, bemächtigte sich seiner, so wie damals in den schlimmsten Zeiten der UV-Hysterie, als man sich nicht ungeschützt unter den ozonlöchrigen Himmel wagen durfte …
Der rote Tankwagen bog in die Straße und kam in einer Wolke von Staub zum Halten. Die Frauen schlossen auf, Schritt um Schritt rückten sie voran. Deike hob den Plastikkanister an, der klare Strahl sprudelte in die Öffnung: zehn zusätzliche Liter sauberes, trinkbares Wasser – die Warterei hatte sich gelohnt.
Im Hausflur nahm Deike Vanessa den zweiten Kanister ab. Während er die doppelte Last schwitzend die Treppen emporschleppte, verrauschte das Brausen. Oben angekommen, setzte er die Kanister neben den Kühltaschen ab. Aus dem Hahn im Bad quoll eine leicht grünliche Lorke, die Wasseruhr zählte die Milliliter und schaltete, da sich das Kontingent soeben erschöpfte, auf einen höheren Preis um. Deike hielt die Luft an und benetzte sich mit der chlorierten Flüssigkeit das Gesicht. Es hatte eine Zeit gegeben, in der er zweimal am Tag geduscht hatte – ein unvorstellbarer Luxus heutzutage. Er lief, die nassen Arme schlenkernd, in das stickig-warme Wohnzimmer und zerrte die Lamellen der Jalousie auseinander: Wann endlich kam Dorothee aus der Schule? Der Zitronenbaum auf dem Balkon war von feinem Staub bedeckt und ließ die Blätter hängen. Auch er verlangte nach seinen täglichen fünfhundert Kubik.
Das Türschloß summte. Dorothee trapste herein und schleuderte ihre Schultasche durch die einen Spalt offenstehende Tür ins Kinderzimmer. »Mein Teddy braucht sein Bett doch nicht«, platzte sie heraus, dann schlang sie die Ärmchen um Vanessa. »Ein kleines braunes Brüderchen paßt da doch rein, nicht wahr, Mammi?« Sie strahlte und reckte sich stolz zur vollen Größe ihrer acht Jahre auf: »Ich habe uns nämlich ein Brüderchen bestellt.«
Über der Couch schwebten Stäubchen in einem Streif Sonnenlicht. Deike preßte die Hände gegen die Schläfen. Das Blut pochte ihm gegen die Finger.
»Du hast was?« vernahm er Vanessa, darauf die Antwort der Tochter, nun schon weniger selbstsicher. Nach der nächsten schrillen Frage setzte sie zum Flennen an.
Automatisch regelte der Verstärker der implantierten Hörhilfe die Lautstärke herunter; es bedurfte nur eines gedanklichen Impulses, und Deike hatte sich vollständig ausgeklinkt. Aus dem Gezeter wurde Stummfilm. Vanessa kniete, rüttelte Dorothee an den Schultern. Deike ahnte, wovon die Kleine unter Schluchzen erzählte. Von der Schulstunde und dem unverschämten Vorstoß ihrer Lieblingslehrerin »Frau Schnipsel«, von hungernden Kindern in Afrika oder von indischen Familien, deren Hütten das steigende Meer verschlang … Die Leute vom Hilfskomitee hatten vor drei Wochen Handzettel verteilt: Wenn in ihrem Stadtteil nur einhundert Evakuierte Unterschlupf fänden, dann wären dies im ganzen Land … – Milchmädchenrechnungen, die nach Deikes Überzeugung nie aufgingen und schon gar nicht die Flüchtlingsprobleme der Welt lösten; zumindest nicht, solange man in den niederen Breiten auf Gedeih und Verderb Kinder heckte …
Ein Geräusch zerriß den Stummfilm, das Phantom eines Türklingelns. Zu dem unwirklichen Klingeln stellte sich ein Bild ein: Da drängen sie grinsend herein, die beiden Komiteemitglieder, hinter ihnen Frau Schnipsel. Sie weisen auf ihre Liste, die Tochter habe berichtet … Überzähliger Wohnraum … Herzliche Gratulation, Herr Böttger, daß Sie sich bereit erklärt haben, zwei Bangladeshi aufzunehmen … Und sie schauen in jedes Zimmer, spulen dabei die alte Leier ab. Wenn jeder von uns ein wenig von seinem Überfluß abgäbe, Herr Böttger, anderswo lebt man zu zehnt in einer Hütte. Ja, ja, unsere Vorfahren, die haben aus dem Vollen gewirtschaftet, die Erde geplündert, nun geht’s ans Bezahlen. Besten Dank, Herr Böttger, daß Sie Ihren Beitrag leisten.
Deike regelte mit einem Gedankenimpuls den Verstärker hoch. »Seid ihr nun fertig?« fragte er so laut, daß er selbst darüber erschrak. Vanessa wischte Dorothee die Tränen aus den Augen. »Ich werde mit dieser Frau Schnipsel ein Wörtchen reden. Ohne Regierungsbeschluß und Polizeigewalt setzen die uns keine Würmerfresser in die Wohnung!«
Gemeinsam beluden sie den Wagen. Der war ein Modell vom Anfang des Jahrhunderts, das Deike schon wegen der Benzinrationierung nur selten benutzte. Heute jedoch hatte der gute Packesel viel zu schleppen: einen der Wasserkanister und einen Kasten Bier, Würstchen, Kotletts und was es sonst noch an Eßbarem gab. Freunde von Vanessa hatten ihren Besuch angesagt.
Der Garten lockte. Sie schossen auf der Asphaltpiste zwischen den modernisierten 5+1-Geschossern aus DDR-Zeiten hindurch, die spärlichen Wolken über der Küste im Rückspiegel. Das flache Land öffnete sich vor ihnen, die Kuppeln der Silotürme glänzten im Sonnenschein, dicht stand der Frühjahrs-Mais auf den Feldern. Dorothee, die sich wieder gefangen hatte, plapperte ohne Unterlaß: daß auch sie »Knetikerin« werden wolle, um den Regenwald »nachzuzüchten«, daß ihre Banknachbarin Caroline …
Deike schaltete erneut ab. Es war eine Lust, lautlos dahinzujagen, die Hände am Steuer, den Fuß auf dem Gaspedal. Aus dem leisen Rauschen des Ohres schälte sich ein Rhythmus hervor, die harten Schläge einer Heavy-Metal-Band aus der guten alten Zeit. Dicke Strähnen von rotbraunem Dreck zogen sich quer über die Fahrbahn. Der warme, zwei Tage anhaltende Wolkenbruch neulich, vom Volksmund Monsun getauft, hatte ihn angeschwemmt. Traumhaft sicher und flink wie in einem Videospiel reagierte Deike, bremste kurz, fing ein Schlingern ab und beschleunigte von neuem. Es roch plötzlich nach Fäkalien; er betätigte die Scheibenschließknöpfe. Schon grüßten von fern die hohen Bäume und die schwarzen Sonnenkollektorflächen der Laubenkolonie. Der Wagen glitt durch das Metalltor mit den goldenen Lettern WALDESFRIEDEN. Vorbei an den roten Klinkermauern der ersten Gärten. Vorbei an abschüssigen Einfahrten. Vorbei an dem ausbetonierten Hof mit den Müllcontainern. »Life’s a dead end race«, dröhnte die Band. Die Garagentür rollte nach oben, und Deike parkte ein. Die Autotüren klappten, die Phantom-Musik verklang.
Deike trat ins Freie, die Sonne schlug ihm ins Gesicht. Der trockene Rasen knisterte unter den Füßen, im Bassin lagen abgerissene Zweige und die Mumien von Regenwürmern. Roter Staub hatte sich in der Schüssel der Satellitenantenne gesammelt. Er löste die Sturmverriegelung des Windrades auf dem Bungalowdach, ächzend nahm die Pumpe die Arbeit auf. Jetzt, im April, reichte ihre Leistung bei mäßigem Wind noch für Rasen und Bassin.
Sobald sie den Wagen entladen hatten, schwang sich Deike auf sein Rad und fuhr den engen, holprigen Weg zwischen den Hecken entlang zu Richards Grundstück, eine Flasche Klaren in der Satteltasche. Richard bekleidete zwar lediglich den Posten eines Fachinformatikers für Kurangelegenheiten, doch er kannte eine Menge wichtiger Leute, und wenn es irgendwo ein Gerücht gab, etwa daß Einquartierungen geplant wären, schnappte er es als erster auf.
Deike wurde enttäuscht. Richards Frau, eine eher rundliche Dame, die sich die Lippen knallrot malte und Blumenrabatten in der Art von Stickkissen liebte, lud ihren Ärger auf ihn ab. Da warte und warte sie auf den Mann, doch der mache sich rar, nichts als Überstunden in den letzten Wochen, die besten Jahre ihres Lebens verstrichen, ohne daß sie etwas davon hatte! Sie griff eine Harke, hackte auf Unkräuter ein, sie traf in ihrem Zorn sogar Stiefmütterchen und allerlei exotische Neuzüchtungen, deren Namen Deike nicht kannte. Nein, sie wolle nicht wissen, was im K.K.Punkt vor sich ginge, sie wolle von nichts auf der Welt wissen, scheren sollten sie sich alle, und er, Deike, dazu.
Verblüfft von der Heftigkeit ihres Ausbruches zog sich Deike zurück. Erst als er wieder in die Pedale trat, kam ihm zu Bewußtsein, daß die nostalgische Zierde der Terrasse, ein messingbeschlagenes Steuerrad, ein Erbstück von Richards Großvater, der noch ein Fischerboot besessen hatte, verschwunden war. Er hielt inne und lugte durch eine schüttere Stelle der übermannshohen Thujahecke. Richards Frau machte sich im Häuschen zu schaffen. Das Steuerrad fehlte. Und ebenso vermißte Deike den rotweißen Plastikleuchtturm. Im Schatten der Terrassenumfriedung verbarg sich ein Koffer. Du siehst Gespenster, sagte er sich, als er mit geöffneter Hemdenbrust an den Zäunen entlangschoß. Weshalb sollten sie den Garten aufgeben? Vielleicht hatte man Richard anderswo eine bessere Stelle geboten – aber würde dann seine Frau dermaßen keifen?
Als Deike zurückkehrte, fuhren gerade Brenners in ihrem schnittigen Wasserstoffmobil vor. Helmut und Marga Brenner gehörten zu den Bekannten, die Vanessa vor Jahren in die Ehe eingebracht hatte und mit denen Deike nie warm geworden war. Wie stets hatten sie sich modisch herausgeputzt: Er trug enge Naturseidenhosen und einen Strohhut, sie ein dunkles Solarkleid, das die gewonnene Energie in zwei Knopfzellen speiste, die von ihrem Gürtel blitzten. Ihr Sohn Charles (französisch auszusprechen) besuchte dieselbe Schule wie Dorothee.
Marga Brenner überreichte Vanessa ein Kästchen aus Holz und Japanpapier. Es enthielt fünf zartgrüne Pflänzchen in fünf Töpfchen. »Das sind enorme Stickstoff- und Kohlenstoffixierer«, erklärte sie dazu, »neustes gentechnisches Produkt aus dem Institut meines Mannes. Ungeheuerer Biomassezuwachs. Könnten die Atmosphäre wieder auf vorindustrielle Werte bringen. Sind leider noch etwas heikel.«
Vanessa bedankte sich geziert. Sie päppelte nicht gerade gern anfällige Pflänzchen auf, zumal wenn es dabei einen Wust von Hinweisen über das nötige Temperatur-, Luftfeuchte- und Strahlungsregime zu beachten galt.
Deike warf eine Handvoll Chlorierungsmittel in das halb gefüllte Bassin und rückte die Liegestühle zurecht. Die Sonne stand hinter den Pappeln, es war weniger heiß als sonst. Aus dem Bungalow drang der Lärm einer Nachrichtensendung. Dorothee hockte vor der Fernsehwand und schaute sich die alltäglichen Katastrophen an.
Irgendwo in Asien gruben sie Massengräber für die üblichen Überschwemmungsopfer. Oder waren es die Opfer der üblichen Hungerkatastrophe?
Der UN-Hochkommissar für Flüchtlingsfragen richtete den üblichen Appell an die Weltöffentlichkeit, sich der üblichen Millionen Evakuierter anzunehmen. In Genf verhandelte der »Club der Gemäßigten Breiten« bereits das zehnte Jahr über Aufnahmequoten. Politisch nicht durchsetzbar, hieß es im Kommentar.
Deike knipste die Fernsehwand aus. »Das verstehst du noch nicht«, wies er Dorothee zurecht. »Außerdem geht der Strom von unserem Kontingent ab. Hol lieber den Rechen und angle die Äste aus dem Bassin.«
Vanessa kam mit einem Tablett herangetrippelt. Sie kredenzte das Überraschungsgetränk des Abends: Limonade, gepreßt aus selbst gezüchteten Zitronen und ohne jede Chemie. Letzteres zweifelte Marga an – nach ihren Erfahrungen akkumulierten sich stets Schadstoffe aus Boden und Wasser in den Früchten. »Wirklich reine Naturprodukte kriegst du heute nirgendwo her. Nicht einmal mehr aus dem eigenen Garten.«
Schlechte Luft, schlechtes Wasser, heißes Wetter, kletternde Preise, eine unfähige Regierung: Vanessa stimmte das alltägliche Klagelied an.
Ein Gutes habe die Warmzeit, konterte Marga, die Erträge in der Landwirtschaft wie in den Kleingärten stiegen wieder, schon wegen des erhöhten CO₂-Gehaltes der Luft und der beiden Vegetationsperioden im Jahr, aber auch dank den neuen Sorten, an denen ihr Mann arbeite. Im Moment entwickelten sie maßgeschneiderte Pflanzen für die amazonischen Erosionssteppen …
Sie redete, und nach einer Weile spitzte selbst Deike die Ohren: Neue Entseuchungsverfahren für den Ackerboden wurden erprobt; die Deponien im Nordosten der Stadt wurden – nach über zehnjährigem Abbau – geschlossen, vielleicht hatte man die Schürfrechte ans Ausland verkauft? Die Arbeit an den Dämmen stockte, sogar die dänischen Spezialisten – seit der Überflutung halb Jütlands selber Flüchtlinge – würden abgezogen. Und im Institut aß man nur noch vegetarisch …
Deike erhob sich, um den Grill für das Abendbrot vorzubereiten. Er säuberte den Rost im gemauerten Rauchfang, die Flasche Spiritus stand bereit, desgleichen das Tablett mit diversen Dips. Würstchen und Kotletts warteten darauf, den Flammen überantwortet zu werden. Brenner junior beobachtete ihn aus der Hollywoodschaukel, er wippte mit den Füßen, zuckte mit dem Kopf nach links und nach rechts.
»Du verdirbst dir die Ohren«, warnte ihn Deike, »zu viel Walkmanhören schädigt das Trommelfell.«
Der Junge starrte ihn an; die Mahnung war wohl nicht durchgedrungen. Deike packte ihn am Ohr, brüllte hinein. Wenn sich nun jeder abkapseln würde!
Brenner junior zog eine verächtliche Schnute. »Mann, das ist doch Schruz aus dem Zwanzigsten. Du läßt dir den Sound direkt in den Nerv koppeln, da geht nichts in die Binsen.« Er sprang von der Schaukel und trollte sich, mit dem Oberkörper nach links und nach rechts schwankend, zu den Erdbeerbüschen.
Deike goß den Spiritus über die Holzkohlen und zündete an. Vom Bassin her klang Vanessas Stimme. »Jetzt agitieren sie schon die Kinder, erkundigen sich in der Schule, wie die Eltern zu einer Einquartierung stehen.« Vanessa schätzte Brenners Meinung, den sie für intelligent und weltgewandt hielt.
»Also, wir tun bereits genug für die Drittweltler«, fuhr Marga spitz dazwischen. »Überweisen monatlich ein hübsches Sümmchen für die Ausbildung von diesem – wie heißt er doch gleich, Scharl? – Was denen da unten fehlt, das sind Spezialisten. Ohne Spezialisten verbessern die ihre Lage nie.«
Brenner hüstelte. »Betrachte das als einen Versuchsballon«, meinte er kurz. »Fakt ist, die Regierung bereitet ein Gesetz vor. Requirierung aller für Dauerbewohnung geeigneten Kleingärten. Könnten schätzungsweise 15 Megamenschen darin unterbringen. Was der UN-Quote entspräche.«
Es war still geworden. Deike richtete sich auf und blickte zu der Gruppe am Bassin hinüber. Vanessa lachte hysterisch auf: »Das werden die niemals wagen!« Im Bungalow nannte Dorothee Brenner junior einen »doofen Zombie«.
»Keiner kann sie hindern«, behauptete Brenner, »die Opposition ist auch schon eingeknickt.« Brenners hatten ja nichts zu befürchten, sie wohnten in einem hübschen solarbedachten Einfamilienhäuschen. »Ein Kollege von mir hat Pläne gesehen: drei Ausbaustufen. Die Infrastruktur ist hier meist unzureichend. Sanitäranlagen und Versorgungseinrichtungen fehlen. Dazu die Lebensgewohnheiten der Asiaten. Ist klar, daß wir uns Probleme ins Land holen.«
Der Geruch verbrannten Fettes stieg Deike in die Nase. Zwei Würstchen waren verkohlt. Er packte sie mit der Zange, knallte sie auf einen Teller und säbelte ingrimmig die schwarze Kruste ab. Von den Würstchen blieb nicht viel übrig. Er warf das Messer hin und stieß sein Rad durch die Gartentür.
Noch bevor er in den Weg einbog, hatte ihn das Brausen eingeholt, und schon nach der dritten Hecke setzten die metallharten Töne der Gruppe »Dawn of Mankind« ein, die kurz nach der Jahrtausendwende mit ihren Klängen die Welt erschüttert hatte. Die Propheten eines neuen, heißen Zeitalters. Eines Jahrhunderts der Kämpfe und Katastrophen. Und Deike brauchte nur um sich zu blicken, um die Vorboten der Kämpfe und Katastrophen zu erspähen: Richards Frau packte, ihre Nachbarn pflückten unreife Avocados. Auf einem anderen Grundstück hieb man sogar die Obstbäume um.
An der Kreuzung zweier Hauptwege hatten sich Männer, teils in Gartenkluft, teils in Badehose, versammelt. Sie debattierten lautstark und armeschwingend. Wenige Worte nur drangen zu Deike durch: »Unsere Steuern« und »Kanaken«. Vor dem »Café Solar« in der Mitte der Anlage sammelten Frauen Unterschriften – sie winkten Deike zu, aber er preschte an ihnen vorüber, Musik und Brausen verschmolzen zu einem einheitlichen kreischenden Getöse, das ihn weitertrieb, vorbei an gemauerten Gartenumfassungen, hinter denen schwarze Flaggen wehten, hinaus auf die Landstraße, wo Kinder über ein Stoppelfeld liefen und Drachen steigen ließen. »You’re part of the pest spoiling the world«, dröhnte die Gruppe, »multiplying, swarming microbe.«
Später hatte Deike eine Panne. Er lehnte das Rad an einen Zaun und flickte den Schlauch. Langsamer ging es zurück. Anstelle der Musik stellten sich Stimmen ein. Eine von ihnen, die des Cyberchirurgen, der ihm vor Jahren die Hörhilfe implantiert hatte, übertönte alle anderen: »An meiner Elektronik liegt es nicht, junger Mann, die Geräusche kommen aus Ihrem Hirn. Zentraler Tinnitus. Ich könnte Ihnen einige Nervenbahnen kappen; Sie wären ein anderer danach. Verstehen Sie, jeder von uns ist auf die eine oder andere Art gestört. Solange die Geräusche Ihnen keine Schmerzen bereiten …«
Als Deike wieder in das Kolonietor bog, spannten dort drei Männer ein Transparent auf: »Eingeborenenreservat – Betreten für Ausländer verboten«. Gleich hinter ihnen schweißte man stählerne Zaunspfähle zu einer Art Wagensperre zusammen.
Weiter drinnen, wo sich der Hauptweg gabelte und die langen Reihen der Sonnenkollektoren sich anthrazitschwarz und flauschbedeckt zwischen den Gärten spreizten, begegnete Deike einem Jungen. Der sprang mit bloßen Füßen über die heißen Betonplatten, sein schmächtiger Körper war braun und sein Haar glänzte schwarz. Als der Knabe Deike erblickte, verschwand er schnell zwischen den Stützen der Sonnenkollektoren. »Du bist wohl ein Vorläufer«, rief ihm Deike nach, und im anschwellenden Brausen sah er sie um sich: braunhäutige Kinder, die über die kotigen Wege quirlten, und braunhäutige Männer, die vor dem ehemaligen »Café Solar« herumlungerten und auf den Tankwagen oder den Lebensmittellaster warteten. Braunhäutige Frauen wuschen in hölzernen Bottichen Wäsche und spannten Leinen von Zaun zu Zaun. Die meisten Bäume waren umgehackt, an den verschmutzten Häuschen lehnten primitive Unterkünfte aus Möbelresten, Dachpappe und Zeltplanen. Rauch quoll von zahllosen Herdstellen, und überall flitzten und sprangen Kinder und Hunde durcheinander, Hühner flatterten über die vertrockneten Hecken, heilige Kühe lagen mitten auf dem Weg. Auf dem Grundstück, das er nicht mehr sein eigen nennen durfte, sielten sich Schweine im Schlamm des Bassins – und in der umgestürzten Satellitenantenne briet sich ein alter Mann die beiden Eidechsen, die an der Bungalowmauer gelebt hatten.
»Bleibt, wo ihr seid!«, gellten die Stimmen seiner Gartennachbarn. »Ersauft, aber laßt uns in Frieden!«
»Lernt richtig zu arbeiten, dann könnt ihr euch selber helfen!«
»Warum wohnt ihr auch so niedrig? Zieht doch in den Himalaya!«
Im Brausen verloren sich die Stimmen. Deike stieg ab, wischte sich über die Stirn und schob das Rad die letzten Meter. Mit den Stimmen war auch seine Wut verebbt. Hatte es nicht seine Berechtigung, daß sie hier einrückten, Besitz ergriffen? Das Klima hatte sich verändert. Seit Jahren schneite es kaum mehr, stattdessen suchten Monsunregen das Land heim, und anstelle der üblichen norddeutschen Sommer herrschte nun von Mai bis September tropische Hitze. Das Land verlangte geradezu nach braunen Menschen. Und schließlich – war es nicht die Industrie der Europäer und Nordamerikaner gewesen, die die Warmzeit verursacht und die Bewohner südlicherer Breiten ihrer Heimat beraubt hatte? – Auswandern sollte man. Nach Grönland oder in die Antarktis.
Vanessa empfing ihn mit geröteten Augen. Brenners waren davongefahren, auf dem Rost lagen einseitig gegrillte Kotletts. Dorothee saß auf dem Rand des Bassins, ließ die Beine ins Wasser baumeln und kratzte sich die Arme wund.
»Wir lassen uns nicht vertreiben«, sagte Vanessa, »so dürfen sie nicht mit uns umspringen.«
»Und wie willst du dich dagegen wehren?« fragte Deike, »mit dem Rasenmäher?«
Wortlos drehte sich Vanessa um und ging in den Bungalow.
»Die Braunen wollen auch irgendwo leben!« rief ihr Deike nach.
Sie fuhr herum: »Du spinnst, Deike Böttger. Wenn du ein Mann wärst, würdest du etwas unternehmen – aber du hast ja nur dein Brausen im Kopf.«
Er zog sich die Sandalen aus und setzte sich zu seiner Tochter.
»Bekomme ich nun ein kleines braunes Brüderchen?« quengelte sie.
Deike schwieg, das kühle Wasser tat seinen Füßen wohl. – Manchmal wünschte er sich, ein oder zwei Generationen früher geboren worden zu sein.
Die Straßenlaternen zwischen den Parzellen waren erflammt und beleuchteten einen Teil der Gärten taghell. Auf anderen Grundstücken flackerten Lichtorgeln, Partylichter warfen bunten Schein. Deike rechnete nicht mehr damit, Richard vorzufinden, allein der Wunsch nach Gewißheit trieb ihn ein letztes Mal den holprigen Weg entlang.
Richard fläzte in einem Gartenstuhl; bei der künstlichen Beleuchtung war sein Gesicht grau wie Umwelt-Klopapier.
Deike erinnerte sich an die Flasche Korn, die er den ganzen Tag spazieren gefahren hatte, doch Richard winkte müde ab. Seine Frau rumorte im Häuschen. Deike holte sich einen Stuhl und ließ sich neben Richard nieder. »Es geht da ein Gerücht um«, flüsterte er, »du kannst es bestimmt widerlegen.«
»Gerüchte widerlegt man nicht«, antwortete Richard ebenso leis.
»Also ist was dran?«
Richard schwieg.
»Dann stimmt es also«, bohrte Deike, »wir …«
»Rede nicht, genieß lieber die letzten schönen Tage.«
Deike dachte an die Nachrichtensendung, und ein Funken Hoffnung glomm in ihm auf. Was die Regierung plante, war politisch nicht durchsetzbar. Das sollte Richard wissen. Die Menschen würden um ihre Gärten kämpfen.
»Willst du lieber ersaufen? Oder aus dem Wohnzimmerfenster angeln?« Richard verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Was verlangst du eigentlich? Die Flut steigt, ob du es wahrhaben willst oder nicht, und nach der Evakuierung wirst du – wahrscheinlich irgendwo in den Bergen – in einem hübschen Garten wohnen. Vorausgesetzt, daß dich die Leute dort nicht steinigen.«