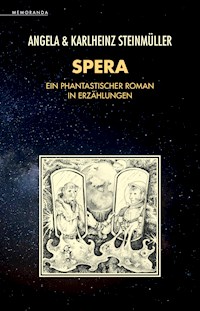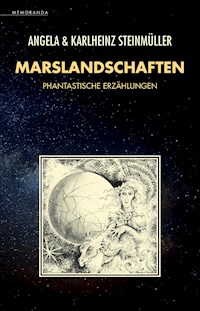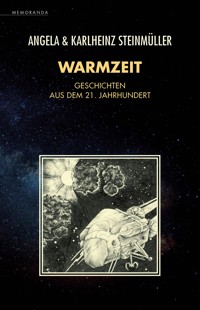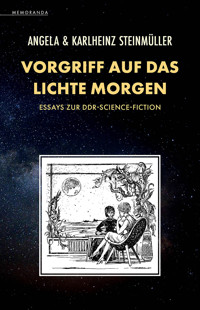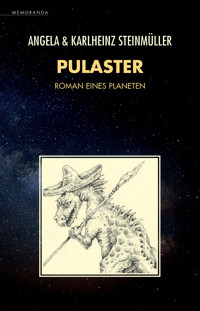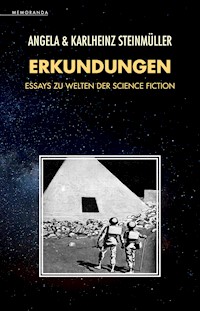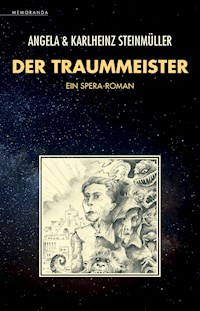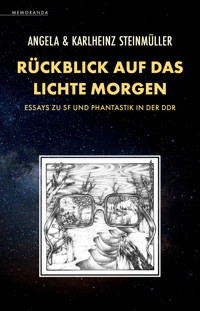
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nachdem im vorhergehenden Band "Vorgriff auf das Lichte Morgen" die DDR-Science-Fiction der fünfziger und sechziger Jahre im Mittelpunkt stand, präsentiert der vorliegende Band einzelne Essays zu verschiedenen Einzelthemen im Kontext der SF und Phantastik der DDR sowie zwei Artikel von Karlheinz Steinmüller, die für DDR-Publikationen entstanden und damals aktuelle Diskussionen aufnahmen. Sieben Rezensionen behandeln vor und nach der Wende erschienene Bücher von DDR-SF-Autoren. Persönlich gefärbte Rückblicke auf die DDR-SF sowie ein Gedankenexperiment eröffnen und schließen den Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Angela und Karlheinz Steinmüller
Rückblick auf das Lichte Morgen
Essays zu SF und Phantastik in der DDR
Angela und Karlheinz Steinmüller
Werke in Einzelausgaben. Essays Band 4
Herausgegeben von
Erik Simon
Impressum
Angela und Karlheinz Steinmüller: Rückblick auf das Lichte Morgen.
Essays zu SF und Phantastik in der DDR
(Werke in Einzelausgaben. Essays Band 4)
Herausgegeben von Erik Simon
Titelgrafik: Kersti Arnold
Originalausgabe
Erste Auflage 2025
© 1996, 2025 Angela & Karlheinz Steinmüller (für »Die befohlene Zukunft: DDR-Science-Fiction und Zensur«)
© 2023 Angela Steinmüller (für das Vorwort)
© 2025 Angela Steinmüller (für »Anstelle eines Vorworts: War da nur Dominik?«)
© 2025 Gundula Sell, E. Simon, A. & K. Steinmüller (für »Lichter. Ein Experiment«)
© 1980–2009, 2025 Karlheinz Steinmüller (für die übrigen Essays und Rezensionen und die Vorbemerkung)
Die Daten der Erstpublikationen sind der »Publikationsgeschichte« am Ende des Bandes zu entnehmen.
© 2025 Erik Simon und Memoranda Verlag (für die Zusammenstellung dieser Ausgabe)
© dieser Ausgabe 2025 by Memoranda Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Erik Simon
Korrektur: Steffi Herrmann
Gestaltung: Hardy Kettlitz & s.BENeš [www.benswerk.wordpress.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
ISBN: 978-3-911391-08-5 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-911391-09-2 (E-Book)
Inhalt
Impressum
Inhalt
Vorbemerkung
Von Karlheinz Steinmüller
Anstelle eines Vorworts: War da nur Dominik?
Von Angela Steinmüller
Von Birnen, falschen Männern im Mond und transsolaren Geschenken
Ein Rückblick auf die DDR-SF in den Apollo-Jahren
Die biologische Zukunft des Menschen im Spiegel der Phantastik
Der Mensch aus der literarischen Retorte
Die Positionsbestimmung der Seesternwesen
Zu Problemen des Realismus in der Science-Fiction-Literatur
Die befohlene Zukunft: DDR-Science-Fiction und Zensur
Phantastische Literatur in der DDR
Vortrag auf dem Zweiten Kongreß der Phantasie 1988 in Passau
Mit den Digedags in den Weltraum
Zukunftsbild und Realität im Mosaik von Hannes Hegen
Rezensionen
Wenn Grenzen und Köpfe sich öffnen
Die SF der DDR vor und nach der Revolution
Lichter. Ein Experiment
Von einem Autorenkollektiv
Ein Dankeschön, verbunden mit einem Ausblick
Publikationsgeschichte
Abbildungsverzeichnis
Bücher bei MEMORANDA
Vorbemerkung
Von Karlheinz Steinmüller
Nach dem Vorgriff auf das Lichte Morgen wagen wir nun einen Rückblick auf das Lichte Morgen. Dabei sollen die unterschiedlichsten Aspekte der Science Fiction der DDR zur Sprache kommen: Unter welchen Bedingungen entstand sie? Wie wurde damals über die SF nachgedacht? Welche Rolle spielten Zensur und Selbstzensur? Welche Querverbindungen gab es zur phantastischen Literatur und zum Comic? Rezensionen ergänzen unseren Rückblick, denn am einzelnen Werk läßt sich durchbuchstabieren, was für die Autoren wichtig war und wie sie vorgingen. Der Band schließt mit einem nicht ganz ernstgemeinten Experiment: Wie könnte heutzutage eine Anthologie mit einer Auswahl der besten SF-Erzählungen der DDR aussehen?
Neben Texten jüngeren Datums haben wir in diesen Band auch Essays aufgenommen, die in der DDR entstanden sind. Ich habe sie damals aus meinen bisherigen Erfahrungen mit der SF heraus geschrieben, mit ihnen bezog ich Stellung in Diskussionen um die SF: Was kann sie, wozu taugt sie? Wie steht sie zur Wissenschaft? Wo transportiert sie Mythen? Seither ist fast ein halbes Jahrhundert vergangen. Da verschieben sich im Detail die Sichtweisen und die Wertungen, ganz zu schweigen davon, daß ich heute manches anders formulieren würde.
Vor allem den beiden ältesten Essays »Die biologische Zukunft des Menschen« und »Die Positionsbestimmung der Seesternwesen« merkt man ihre Entstehungszeit an. Das drückt sich in der Wortwahl aus, aber unterschwellig auch in den Argumentationsmustern. Zurücknehmen muß ich nichts. Aber wenn ich meine Texte von damals jetzt lese, fällt mir doch auf, daß ich eigentlich stets zwei Gruppen von Lesern oder vielmehr Adressaten im Kopf hatte. Selbstverständlich habe ich die Essays für die Leser in der DDR und speziell für das SF-Publikum geschrieben, für Leute also, die sich begierig auf jedes Buch stürzten, daß als »utopische Literatur«, »wissenschaftlich-phantastische Erzählung« oder »Zukunftsroman« angepriesen wurde. Ein großer Teil der meist jüngeren Leser kannte fast ausschließlich das, was in der DDR erschienen war. In den 1980er Jahren war das gar nicht so wenig, und neben zahlreichen Autoren aus dem sozialistischen Ausland waren auch einige international bekannte Namen und viele Klassiker der SF darunter. Für diese Leser wollte ich mich vorwiegend auf Beispiele aus der einheimischen Produktion beziehen. Natürlich gab es nicht wenige SF-Freunde, die sich (wie wir) Bücher aus dem Westen einschmuggeln ließen oder die Antiquariate nach alter SF durchforsteten. Einmal erhielten wir sogar von einer freundlichen Antiquariatsdame zwei, drei Dutzend englischsprachige SF-Taschenbücher aus dem Hinterzimmer. Was für ein Glücksfall! Danach waren wir erst einmal blank …
Die zweite Menschengruppe, mit der ich zu tun hatte, waren Lektoren in den Verlagen, Redakteure und Rezensenten, also Leute, die sich professionell mit Literatur befaßten und die meist ein Studium in Literatur- oder Gesellschaftswissenschaften oder auch in Physik absolviert hatten. Da konnte ich mitreden. Als Philosoph, der über erkenntnistheoretische Probleme der modernen Biologie gearbeitet hatte, beherrschte ich ihre Sprache. Selbstverständlich kannte ich auch ihre Weise, sich die Dinge im Rahmen der offiziellen Ideologie zurechtzulegen, gegebenenfalls Spielräume auszunutzen oder einzuengen oder sogar Geschmacksurteile zu Grundsatzfragen zu stilisieren. Schlimme Verbiegungen mußte ich in meinen Essays ihretwegen nicht machen, es genügte, daß ich sozusagen im sprachlichen Mainstream mitschwamm.
Manche Lehrmeinung war durchaus nützlich: Insbesondere übernahm ich – in »Positionsbestimmung« – gern das Konzept der Verfremdung, das Bertolt Brecht im Rahmen seines epischen Theaters entwickelt hatte. Von Darko Suvins Anwendung der Brechtschen Theorie auf die SF, von seiner Konzeption des Novums, hatte ich zwar schon gelesen, seine Poetik der Science Fiction (deutsche Kompilation 1979) besaß ich, als ich den Essay schrieb, noch nicht. Brecht aber war die perfekte Wahl: Mit der von mir etwas willkürlich umgedeuteten Verfremdungslehre bewegte ich mich im Rahmen der damaligen Literaturdiskussionen und konnte zeigen, daß die SF als erkenntnisorientierte Literaturform durchaus respektabel ist. Sehr viel weiter gekommen ist die SF-Theorie mit ihren Aufhebungsfunktoren ja seither auch nicht.
Heute fällt mir auf, wie locker ich damals mit ideologisch aufgeladenen Begriffen umging, beispielsweise mit dem Wörtchen »bürgerlich«. Das stand in offizieller Lesart als Synonym für »zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung gehörend«, »veraltet«, »westlich« und als Gegensatz zu »sozialistisch«, »fortschrittlich«. Ich übernahm solche als selbstverständlich vorausgesetzten Einordnungen und Etiketten. Im Kontext der Diskussionen in der DDR konnte ich mich damit verständlich machen – und merkte bisweilen nicht einmal selbst, daß ich damit die herrschende Ideologie bediente. Heute bin ich mit dergleichen Begriffen sehr viel vorsichtiger, beispielsweise würde ich nicht einfach die SF »entkolonialisieren« wollen.
Bei Rezensionen, die ich damals für Franz Rottensteiners Quarber Merkur schrieb, hatte ich ein anderes Publikum und paßte entsprechend meine Beispiele an. Aber ich schrieb in solchen Beiträgen auch von »unserer SF«, wenn ich die der DDR meinte; ich nahm keine gesamtdeutsche Perspektive ein. Es hätte gewiß distanziert, vielleicht hochnäsig geklungen, wenn ich mich sprachlich durch »die ostdeutsche SF« von den Kollegen abgesetzt hätte. Dem Zeitgeist entkommt man nicht, nicht einmal dann, wenn man einer herrschenden Ideologie kritisch gegenübersteht. – »Ideologie« ist auch ein Wort von damals; heute sprechen wir von »Narrativen«. Hilft das zu besseren Analysen?
Eine gewisse Sonderstellung nimmt der Zeitungartikel »Wenn Grenzen und Köpfe sich öffnen« ein, der im März 1990 veröffentlicht wurde. Für mich war es bereits ein leiser Abschied von der DDR-SF, ein erster Rückblick auf das Lichte Morgen, in dem ich festhalten konnte, was mir an der DDR-SF gefiel und was mir an ihr nicht gefiel, und zugleich wagte ich einen leicht hoffnungsvollen Ausblick auf die nächste Zukunft. Daß ich dabei Themen anschnitt, die an anderer Stelle ausführlicher behandelt werden, versteht sich bei einem solchen Text. Mit dem letzten Absatz bin ich allerdings überhaupt nicht mehr zufrieden. Ich behauptete da, daß es im letzten Jahrzehnt der DDR-SF kaum noch verheißungsvolle Debüts gegeben hätte. Welche Tomaten hatte ich dabei auf den Augen? Da der Artikel eine Art Zeitdokument darstellt, verbietet sich eine nachträgliche Korrektur.
Bei den älteren Texten aus DDR-Zeiten haben wir bisweilen Schreibweisen behutsam angeglichen: etwa »Science-fiction« durch »Science Fiction« ersetzt (obwohl die Schreibung mit Bindestrich wohl korrekter ist), außer natürlich in Zitaten. Kurze Einleitungen oder Nachbemerkungen dienen dazu, den jeweiligen Entstehungszusammenhang zu erklären. An wenigen Stellen haben wir die Texte geringfügig redaktionell geglättet. Was wir erst vor wenigen Jahren geschrieben haben, haben wir – wenn nötig – gründlich überarbeitet, gegebenenfalls aktualisiert und ergänzt. Insbesondere hat unser gemeinsamer Essay über Zensur und Selbstzensur eine Vorgeschichte, die bis in die frühen 1990er Jahre zurückreicht. Wir haben ihn immer wieder überarbeitet und durch neues Material erweitert. Bei den älteren Texten war eine Aktualisierung naturgemäß nicht möglich; sie hätte ein völliges Neuschreiben bedeutet. Auch leben diese Texte durchaus von ihrer zeitgeschichtlichen Verhaftetheit. Insofern sind sie auch ein Stück von dem angeblich Lichten Morgen, auf das wir in diesem Band zurückblicken.
Anstelle eines Vorworts: War da nur Dominik?
Von Angela Steinmüller
Schaut man in geschichtliche Darstellungen zur DDR-SF, scheint es so, als hätte es nur eine allmächtige Traditionslinie gegeben, aus der heraus die utopische Literatur der DDR entstand: die Linie von Hans Dominik und von vergleichbaren Autoren technisch-phantastischer Abenteuerromane. Zumindest in meinen Fall kann ich das nicht bestätigen.
Im gewissen Sinne war ich das, was man heute einen Quereinsteiger nennt. Während Karlheinz sozusagen von Kindesbeinen an ausgehend von Jules Verne auf die SF zusteuerte, nahm ich utopische Literatur nur per Zufall in die Hand. Wenn man es ganz vereinfacht ausdrücken will, kam ich durch Karl May zur SF – was ja wohl kein ganz ungewöhnlicher Weg ist.
In meiner Kindheit um 1950 waren Leihbüchereien noch weit verbreitet, fast so sehr wie Kneipen. In jedem dritten oder vierten Häuserblock gab es eine, wenigstens da, wo ich wohnte, in Berlin-Prenzlauer Berg. Ursprünglich hatte auch das Genossenschaftshaus, in dem ich aufwuchs, eine Leihbücherei, aber die war in der Nachkriegszeit geschlossen worden.
Regelmäßig besorgte mein älterer Bruder unsere Lektüre von drei Straßen weiter. In meiner Erinnerung schleppte er bis zu vier Bücher pro Woche an, jedenfalls eine Menge Lesestoff. Als kleine Schwester bekam ich die Schwarten, oft abgewetzte, fleckige Bände, meist noch aus der Vorkriegszeit, erst dann in die Hand, wenn mein Bruder sie ausgelesen hatte: allesamt Abenteuerromane, mit oder ohne Indianer, auf dem Land oder (seltener) zur See – und ab und zu auch einen Roman von Jules Verne. Viel »Utopisches« kann nicht darunter gewesen sein, denn die Werke von Kurd Laßwitz waren schon unter den Nazis aussortiert worden, und die nicht allzu umfangreiche SF-Produktion im Dritten Reich war großenteils bald nach dem Krieg ausgesondert worden. Jedenfalls erinnere ich mich nicht an einen einzigen Band von Hans Dominik! Aber Zane Greys Western, wohl Lieblingslektüre meines Bruders, stehen mir noch deutlich vor Augen.
So einfach war das mit dem Lesen allerdings nicht. Meine Eltern löschten abends das Licht im gemeinsamen Schlafzimmer der gesamten Familie. Ich kroch, ausgestattet mit dem Buch und meiner kleinen, funzligen Taschenlampe, unter die Bettdecke. – Und dann ritt ich durch Wüsten und über Prärien, deckte Geheimnisse auf, stieß mit Halunken zusammen, wurde in Schießereien verwickelt, das Wasser wurde knapp – und mir wurde unter der Bettdecke ohne verräterisches Loch ins Freie die Luft knapp. Aber ich wollte das Buch unbedingt durchgelesen haben, bevor mein Bruder es zurückgeben mußte!
An Details oder Personen bei Zane Grey erinnere ich mich nur nebelhaft, karge Westmänner in karger Landschaft. Ganz anders bei Karl May! Winnetou, Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi und der Hadschi mit dem langen Namen, den ich damals bis zum letzten Vorfahren auswendig kannte, prägten sich mir ein, wohl auch, weil die vertrauten Gestalten in mehreren Bänden immer wieder auftauchten. Inzwischen steht eine vielbändige Ausgabe bei uns im Schrank. – Ich bekomme direkt Lust, wieder zu einem Band zu greifen …
Bei Karl May erlebte ich das, was heute oft hochgestochen sense of wonder heißt: Einblicke in fremdartige, in sich faszinierende Kulturen vor dem Panorama exotischer Landschaften – entweder tief in den Weiten des amerikanischen Kontinents oder eben, wenn es durch das wilde Kurdistan ging. In puncto world building hat Karl May Maßstäbe gesetzt! Dazu gab es edle, prinzipienfeste Identifikationsfiguren und fiese prinzipienlose Schurken, obendrein eine dramatische, bisweilen melodramatische Handlung.
Außer Karl May schleppte mein Bruder beispielsweise Dr. Uhlebuhles Abenteuerbuch von Bruno H. Bürgel an, nicht eben übermäßig aufregend (kein Karl May), aber voller phantastischer Ideen und für mich eine angenehme Lektüre. Noch etwas älter als Bürgels harmlose Abenteuer waren Manfred Kybers Tiergeschichten (Unter Tieren, 1912): Da sah ich die Welt einmal nicht aus der Perspektive der Menschen, sondern aus der der fühlenden, leidenden Kreaturen rings um uns.
Einmal kaufte mein Bruder ein dünnes broschürtes Buch: S. Beljajews Der zehnte Planet, 1948 im SWA-Verlag erschienen. Ich fand das so spannend, daß ich es dreimal las. Dabei ist der Roman von Sergej Beljajew (nicht zu verwechseln mit Alexander Beljajew) nicht eben ein Höhepunkt der Gattung, im Grunde etwas Astronomie gemischt mit einer brutalen Abrechnung mit den Nazis: Auf besagtem zehnten Planeten, einer Gegen-Erde, werden die irdischen Raumfahrer mit kannibalischen Affenmenschen konfrontiert – zum Glück nur in einem historischen 3-D-Film. Denn diese absolut bösen Wesen sind inzwischen von den fortschrittlichen, humanistischen Gutmenschen ausgerottet worden. Eine heftige Warnung!
Natürlich las ich wie fast alle aus meiner Generation Saint-Exupérys Der kleine Prinz; einen noch größeren Eindruck hinterließ bei mir jedoch ein heute nur noch als Kinderbuch (oft in einer durch Kürzungen verharmlosten Fassung) vermarkteter Roman Die Zauberlaterne (ursprünglich Das Märchen vom Rasierzeug oder Die Zauberlaterne, 1937) von Wolfheinrich von der Mülbe. Das Buch war 1953 vom Verlag der Nation neu herausgebracht worden, und es faszinierte mich in vielerlei Hinsicht: Von der Mülbe vermengt auf lockere, unprätentiöse Weise Modern-Alltägliches mit Motiven aus der Tradition der Rittergeschichten und Märchen, das ganze gewürzt mit Humor und trefflichen Szenen (ein Mathematiker scheitert daran, daß Frauen unberechenbar sind). Von Kapitel zu Kapitel erlebt Held Kunibert immer neue, teils verrückte, fast surreale Abenteuer zu Lande und auf See, im Gebirge und in Lappalien, dem Traumland der Bürokraten, wo alles seine Genehmigung braucht, es aber monatelanger Wege bedarf, die nötigen Papiere zu erlangen. Kunibert trinkt mit einem Drachen Kakao, wird von Seeräubern gefangen und verkauft, und er begegnet immer wieder neuen Gestalten mit merkwürdigen Eigenschaften und Fähigkeiten und vielen Schrullen oder Ticks, so etwa einem Mann Komma der alle Sätze mit korrekter Komma stets auffälliger Interpunktion spricht Punkt
Heute klassifiziert man Die Zauberlaterne gern als frühe Vorwegnahme von Fantasy, und man verbreitet die Suchfahrt nach dem sich nie abnutzenden Rasierzeug als weichgespültes Hörspiel. Ohne die tiefe Ironie, ohne die hier und da aufflammende Bitterkeit, ohne den surrealen Touch. Nun wohl, jedes Zeitalter bekommt die Zauberlaterne, die es verdient.
Vielleicht hat mich der Ritter Kunibert dazu gebracht, daß ich die Grenzfälle von Science Fiction und Fantasy besonders spannend finde. Auf jeden Fall würde es sich lohnen, diese vielgestaltigen und magischen Gefilde näher auszuleuchten. Einen Anfang dazu hat Karlheinz mit seinem Vortrag zur phantastischen Literatur in der DDR gemacht. Mit den Digedags dagegen habe ich mich im Gegensatz zu ihm nie wirklich angefreundet. Als Hannes Hegen das Mosaik startete, war ich aus dem Bildergeschichten-Alter schon heraus und verschlang weiter vorwiegend Abenteuerbücher.
Die biologische Zukunft des Menschen im Spiegel der Phantastik
Der Mensch aus der literarischen Retorte
»Unsere Art wird per Knopfdruck produziert. Typengerecht! Fachwissenschaftler zum Denken, Muskelpakete zum Arbeiten, die weiblichsten Weibchen fürs Bettvergnügen. Versandfertig, nach Katalog und mit zwei Jahren Garantie!«
Peter Lorenz in Homunkuli
Die wissenschaftliche Phantastik spielt mit Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, Verwirklichbarem und Unwirklichem – auch mit künstlichen Menschen. Sie besiedeln im Zukunftsroman ganze Welten. Ein bloßes Spiel mit Biologie und Technik, nötig vielleicht als exotischer, futuristischer Hintergrund für eine bieder-spannende Handlung? Oder zielt die literarische Provokation, Menschen wie Autos oder Stopfgarn herzustellen, auf mehr ab und berührt uns Unproduzierte mehr als die geläufigen Spaziergänge auf fremden Planeten?
Die Erfolge der modernen Biowissenschaften haben Anlaß zum Nachdenken gegeben. Als es James Watson und Francis Crick 1953 gelang, die stereochemische Struktur der Erbsubstanz, des DNS-Moleküls, zu ermitteln, war noch nicht abzusehen, daß knapp drei Jahrzehnte später den Molekularbiologen im besten Sinne Phantastisches möglich sein würde: In Bakterienzellen wird mit Hilfe von Phagen eine neue genetische Information eingebracht. Die informationstragenden DNS-Stücke gelangen in den Zellkern und werden in die bestehende Erbsubstanz inkorporiert. Bei jeder Zellteilung wird diese »trojanische« Information an die Tochterzellen weitergegeben, die sie entschlüsseln und wie befohlen Insulin produzieren, denn genau diese Information hat ihnen der Mensch untergeschoben. Genetische Manipulation in industrieller Anwendung 1979! Der Millionen-Investitionen und Millionen Ideen erfordernde Weg dahin führte über die Erkenntnis des Mechanismus der Proteinsynthese und des genetischen Codes, über die Erforschung der molekularen Regulationsphänomene, die mühsame chemische Analyse der Nukleotidsequenzen, die durch alle Zeitungen gegangene »Vollsynthese eines Gens« zur zunehmenden Beherrschung der Rekombinationsprozesse, ebenjener Prozesse, mit deren Hilfe man Bakterien überlisten und dazu zwingen kann, Stoffe zu produzieren, die nicht sie, wohl aber die Menschen brauchen.
Viele andere Experimente ließen aufhorchen: Daniel Petruccis mißglückte Versuche, menschliche Embryonen außerhalb des Mutterleibes in künstlichen Uteren aufzuziehen (Ektogenese), künstliche Befruchtung (Reagenzglasbabys) und die Verpflanzung von Embryonen … Am Modelltier Frosch gelang die mikrochirurgische Übertragung von kompletten Zellkernen. Damit ist eine Voraussetzung für das sogenannte Klonen gegeben, für die Produktion praktisch beliebig großer Serien genetisch identischer Individuen, eineiiger Zwillinge – sogar aus beliebigen Zellen des Körpers.
Wo die Wissenschaft noch schweigt, darf die Phantastik das Wort ergreifen und weit über das Erwiesene hinaus spekulieren. Sie hat seit ihrer Entstehung offene Fragen und ferne Perspektiven der Wissenschaft aufgegriffen, Atomkraft, Computer, Raumfahrt gehören längst in ihr Repertoire. Mit der vielleicht leiseren, aber nicht minder folgenschweren biologischen Revolution wird nun auch diese zum Gegenstand. Die Phantastik tastet wissenschaftliche, technische und soziale Zukunftsmöglichkeiten ab und bewertet sie: Was könnte eine genetische Manipulation des Menschen bewirken? Wem nützt sie?
Illustration zu Homunkuli von Peter Lorenz
In der wissenschaftlich-phantastischen Literatur der DDR gibt es bislang nur wenige Werke, die die genetische Manipulation zum Gegenstand haben. Zu ihnen zählt das Erstlingswerk von Peter Lorenz Homunkuli (1978), dem das Eingangszitat entnommen ist. In diesem in der nahen Zukunft spielenden Roman werden unter Rückgriff auf die heute modernsten Ergebnisse der Molekulargenetik genormte Typenmenschen wissenschaftlich entworfen und in geheimen Werken des militärisch-industriellen Komplexes massenhaft hergestellt. Die zumindest im ersten Teil angenehm vom Klischee abweichende Handlung schildert den komplizierten Weg einer in den Mißbrauch der Wissenschaft verstrickten Genetikerin und – mehr auf der Königsebene der Konzernchefs und politischen Gremien – die Produktion der Homunkuli, ihre Vorbereitung auf einen Einsatz nach dem geplanten Kernwaffenkrieg sowie deren Selbstbefreiung.
Unschwer erkennt man tradierte Motive der wissenschaftlichen Phantastik, auf die Lorenz zurückgreift. Die Supermänner unter den Homunkuli heißen »Alphaten« – fast so wie die »Alphas« in Aldous Huxleys klassischer Anti-Utopie Schöne neue Welt (1932), und Lorenz produziert »per Knopfdruck«, wo sich Huxley der Fordschen Technologie des Fließbandes bediente.
Die Traditionslinie kann weiter zurückverfolgt werden, vielleicht nicht unbedingt bis Mary Shelleys Frankenstein (1818), aber doch mindestens bis zu Karel Čapeks Schauspiel RUR (1920), der Geburtsurkunde der Roboter, der nächsten Verwandten der Kunstmenschen, die bei Čapek nicht etwa plumpe, dampfbetriebene oder elektronische Blechgesellen waren, sondern aus Fleisch und Blut, wenn auch aus weniger beseeltem, gefühllosem. Das Aufgreifen derartiger tradierter Motive ist in der wissenschaftlichen Phantastik nicht nur legitim, sondern die Regel. Wer heute in utopischen Romanen Raumschiffe verwendet, läuft kaum Gefahr, des Plagiats von Cyrano de Bergerac bezichtigt zu werden, der 1656 in seiner Schrift Die Reise zu den Mondstaaten und Sonnenreichen zum ersten Male das Raketenprinzip benutzte.
Die wissenschaftliche Phantastik besitzt einen bei grober Betrachtungsweise nicht sehr umfassenden Grundkanon an Motiven und Themen, ja sogar an Fabeltypen und literarischen Tricks, auf den praktisch sämtliche Autoren zurückgreifen. Zeitmaschinen gibt es seit Wells, Weltraumstationen seit Laßwitz, Roboter seit Čapek und Fließbandmenschen seit Huxley. Wer letztere verwendet, setzt sich folglich einem Vergleich mit Huxley aus. Grundlegende Neuerungen an technischen Einfällen, Ergänzungen des Grundkanons hat es seit den 1950er Jahren kaum gegeben. Da die wissenschaftlich-technischen Motive meist altbekannt sind, kommt es heute darauf an, ihnen neue Seiten abzugewinnen, sie in neuer Weise einzusetzen und das Interesse mehr und mehr den entworfenen menschlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zuzuwenden. Kernfragen neuerer wissenschaftlicher Phantastik sind insofern Fragen des Menschenbildes, des Lebensstils, Fragen der Anwendung der Wissenschaft und der Gestaltung einer zukünftigen Gesellschaft.
Die Alphas, Betas … Epsilons Huxleys, die Homunkuli Lorenz’ sind Zweckmenschen. Sie werden hergestellt, damit sie bestimmte Funktionen erfüllen: Liftboy auf Lebenszeit oder Ersatzmensch für eine radioaktiv verseuchte Erde. Die Kriterien, nach denen produziert wird, sind klar, es geht nicht um die Erzeugung irgendwie idealer Menschen, sondern um die Herstellung normgerechter, optimal an den künftigen Verwendungszweck angepaßter Arbeitskräfte. Was sich bei Huxley nur aus Nebenbemerkungen und in der Interpretation erschließen läßt, wird bei Lorenz fast zu vordergründig und klar ausgesagt: Der alte Kapitalistentraum von der zweckgerechten und nie aufsässigen, nie ausbeutungsunwilligen Arbeitskraft wird hier verwirklicht. Dabei handelt es sich keineswegs um einen schon bei Čapek zu findenden »gedanklichen Fundamentalfehler«, den Heinz Entner in der Annahme sieht, daß imperialistische Machthaber »individualitäts- und willenlose Kunstmenschen für leichter beherrschbar und daher wünschbarer halten« [S. 157] als den derzeitigen irregulären Menschentyp. Denn Macht verlöre ihren Reiz, wenn auf jeden Befehl nichts als gehorsame Ausführung erfolgte. Jedoch sind die Gesetze des Kapitalismus nicht an individuelle Schrullen wie Lust oder Reizgefühle gebunden, sie setzen sich auch hinter dem Rücken der Ausbeuter durch.
Hier ist Huxley beizupflichten, bei dem das Grundproblem herrschender Klassen die Stabilisierung ihrer Herrschaft – gemäß dem Motto des Weltstaates: Kommunität, Identität, Stabilität – als gelöst betrachtet wird: »Gelöst durch Standardgammas, unveränderliche Deltas, Einheitsepsilons. Millionen identischer Zwillinge. Das Prinzip der Massenproduktion endlich angewandt auf die Biologie.« [S. 9]
Die für die Science Fiction typische Symbolik, das Transponieren realer gesellschaftlicher Verhältnisse, realer Probleme, Gefahren, Widersprüche in wissenschaftliche, technische Beziehungen, am auffälligsten vielleicht als Ummünzen der Furcht vor einem imperialistischen Krieg in die Furcht vor einer Invasion aus dem All, einem Krieg der Welten, findet auch hier statt. Das Fließband produziert den Menschentyp, der ihm entspricht: bei Huxley im wörtlichen Sinne, biologisch, technisch. Unter den Bedingungen des realen Kapitalismus geschieht dies im übertragenen Sinne. Jahrzehntelange Arbeit am Fließband deformiert den Menschen, beraubt ihn seiner Interessen, Fähigkeiten. Schuld des Fließbandes? Wohl eher die Schuld einer unmenschlichen Arbeitsorganisation. Es wäre zu einfach, hier die Technik als Instrument der Unterjochung des Menschen zu verdammen. Daß sie in der bürgerlichen Science Fiction oft genug so dargestellt wird, liegt auf der Hand: Was man der Gesellschaft nicht anlasten kann oder will, schiebt man auf die Technologie. Die technologische Gleichheit der Arbeitsaufgaben erzwingt die Uniformität der Produzierenden.
»Sechsundneunzig identische Zwillinge bedienen sechsundneunzig identische Maschinen« [S. 9] schreibt Huxley, der sich eines Bokanowskisierung genannten biologischen Verfahrens bedient, um die gewünschte Identität zu erreichen.
Lorenz ist genau um vier Jahrzehnte Biologie weiter. Zellinformationen werden molekulargenetisch entschlüsselt und vervielfältigt, in künstlichen Gebärmüttern wachsen Embryonen zu biologisch identischen Homunkuli heran – in beliebig großen Serien.