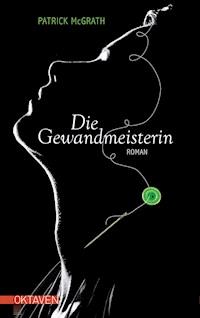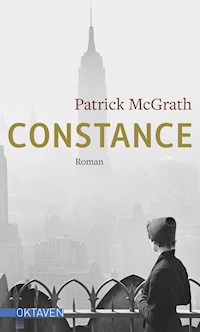
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Oktaven
- Sprache: Deutsch
Eine rätselhafte Aura umgibt die schmale junge Frau, der Sidney bei einer Buchpräsentation in New York begegnet. Constance zieht ihn erotisch an und weckt seinen Beschützerinstinkt. Dass sie unter einem Trauma leidet, lässt ihn nicht unberührt. Wo bleiben echte Nähe und Liebe in ihrer Ehe, frei von Verdächtigung und Rollenzwang? In zarten Momenten deutet sich so etwas an. Virtuos lässt Patrick McGrath im Wechsel Constance und Sidney erzählen, ihre gegenseitige Wahrnehmung und die dramatischen Ereignisse in Constances Familie vor Augen führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick McGrath
Constance
Roman
Aus dem Englischen von Brigitte Walitzek
OKTAVEN
Für meine Schwester Judy und, wie immer, für Maria
1
Ich heiße Constance Schuyler Klein. Die Geschichte meines Lebens beginnt an dem Tag, an dem ich einen Engländer namens Sidney Klein heiratete und mich für immer von Ravenswood und Daddy und allem verabschiedete, was vorher war. Ich habe nun einen Ehemann, dachte ich, einen neuen Daddy, und ich war entschlossen, eine eigenständige Person zu werden. Ich wollte, ach, ich wollte so viel. Ich sah mich als neugeboren. Ein für alle Mal Schluss mit der Stimme der Verachtung und der Missbilligung, der nörglerischen, missmutigen Stimme, so unerschütterlich in ihrer Überzeugung von meiner Wertlosigkeit, nein, schlimmer noch, Nutzlosigkeit. Sidney hielt mich nicht für nutzlos, und er war ein Mann von Welt, der seinen Shakespeare in- und auswendig kannte. Er sagte, er liebe mich, und als ich ihn fragte, warum, antwortete er: «Genauso gut könntest du fragen, warum der Himmel blau ist.» Von da an war alles anders. Hatte ich mich zuvor mit den zaghaften Schritten einer Fremden durch New York City bewegt, frohlockte ich jetzt über alles, was mich vor noch so kurzer Zeit beunruhigt hatte – die Menschenmengen, die Hektik, den Lärm, die Stimmen.
Andere sahen die Veränderung in mir. Die Cheflektorin erriet mein Geheimnis auf der Stelle und konstatierte, ich sei verliebt. Ich versuchte, es abzustreiten, da ich selbst noch gar nicht auf den Gedanken gekommen war, das könne geschehen sein, aber sie blieb dabei. Sie müsse schließlich wissen, wie Verliebtsein aussehe, sagte sie, und ich fragte, wie denn. «So wie Sie», antwortete sie und ging mit einem unergründlichen Lächeln davon. Ein anderes Mal fragte sie mich, ob ich in meiner Arbeit Erfüllung fände, und ich bejahte. «Dann halten Sie daran fest», sagte sie. Ich nahm an, sie meine, ich könne Sidney Klein und meine Arbeit nicht gleichzeitig lieben, und betonte, doch, das könne ich. Ellen Taussig besaß die Fähigkeit, mit einem winzigen Hochziehen einer Augenbraue mehr auszudrücken, als tausend Worte es konnten. «Aber es stimmt», protestierte ich mit leiser Stimme. «Wieso sollte ich es nicht können?» «Viele sind berufen», sagte sie und sah mich über den Rand ihrer Brille hinweg an. Es ist ein vielsagender Hinweis auf meine damaligen Empfindungen, dass mein Selbstvertrauen nicht einmal durch die Fülle von Skepsis in jener hochgezogenen, gezupften Augenbraue erschüttert wurde.
Dann kam die Hochzeit.
Erst hinterher, nach dem Mittagessen in einem Restaurant, bei dem meine Schwester Iris sich danebenbenahm und Daddy so verärgert war, fragte ich mich, was ich mir bloß gedacht hatte. Für wen hielt ich mich? Für eine eigenständige Person? Die neue Welt schrumpfte in sich zusammen wie ein zusammengeknülltes, ins Feuer geworfenes Stück Papier, und alles, was mir blieb, waren ein paar verkohlte Schnipsel und ein bisschen Asche. In meiner Herabsetzung und Demütigung musste ich an Sidneys Mutter denken, eine kleine, vom Rheuma verkrümmte Verrückte, die ganz in Schwarz gekleidet zu unserer Hochzeit erschienen war. Ich war genauso verschrumpelt wie sie. Ich war Sidneys Mutter. Aber als ich ihm zu erklären versuchte, was geschehen war, wollte er es nicht hören, weil es nicht seiner Vorstellung von mir entsprach. Es war das erste Mal, dass ich das alles klar und deutlich sah, und als ich es sah, erkannte ich, wie töricht es von mir gewesen war, auch nur einen Augenblick lang zu glauben, ich würde geliebt –
Sidneys Wohnung war groß und dunkel und voller Bücher. Ich mochte sie nicht, vielmehr fand ich sie einschüchternd. Alles darin schien mir zu sagen, dass hier ein kluger Mensch lebte, ein selbstbestimmter Mensch. Ich hatte das Gefühl, jeden Augenblick als unbefugter Eindringling entlarvt und vor die Tür gesetzt zu werden. Die Wohnung lag in einem oberen Stockwerk eines Vorkriegsgebäudes in der Upper West Side, und nachts war es dort immer sehr laut. Alles verändere sich, sagte Sidney, da die alteingesessenen Bewohner nach und nach in die Vororte abwanderten und die Armen einzogen, die Schwarzen, die Puerto Ricaner, die Einwanderer, die Neuankömmlinge. Auf den Straßen hörte man harsche, grobschlächtige fremdländische Stimmen, und ich hatte das verstörende Gefühl, gleichzeitig in zwei Welten zu leben und keiner davon anzugehören, an keiner einen Anteil zu haben.
Sidney hatte die Wohnung während seiner ersten Ehe erworben, die mit einer Scheidung geendet hatte. Aus dieser Ehe gab es ein Kind, einen Jungen namens Howard, der bei seiner Mutter in Atlantic City lebte. Sidney fuhr oft hin, um sie zu besuchen, und hatte den Jungen unverkennbar gern, ich jedoch empfand nicht den Wunsch, ihn kennenzulernen, und hätte es vorgezogen, wenn Sidney nicht über ihn gesprochen hätte. Howard hatte bereits eine Mutter. Gleichzeitig machte mir die Frage, wieso Sidney ausgerechnet mich zur Frau genommen hatte, immer mehr zu schaffen. Als ich ihn fragte, antwortete er im Scherz, ich habe auf der Buchpräsentation am Sutton Place so verunsichert ausgesehen, dass er das Gefühl gehabt habe, mich retten zu müssen, bevor ich anfinge zu schreien.
Danach war ich eine Zeit lang glücklich, zumindest so glücklich, wie ich es unter den Umständen sein konnte. Sidney nahm die Ränder meiner Tage ein. Er war der Mann, neben dem ich morgens aufwachte, zu dem ich abends nach der Arbeit zurückkehrte und mit dem zusammen ich später zu Bett ging. Aber ich hatte keinen inneren Frieden mehr und fühlte mich zunehmend unwohl mit den von ihm festgelegten Bedingungen der Ehe. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, und ich versuchte, mich nicht allzu sehr in die Sache hineinzusteigern, aber allmählich fing ich an zu denken, ich hätte einen Fehler gemacht und dass nichts von all dem für mich bestimmt sei, sondern für jemand anderen. Zu den Schwierigkeiten, die ich vorausgesehen hatte, als Sidney mir seinen Antrag machte, gehörte, dass er so viel mehr wusste als ich, was nach einer Weile unerquicklich wurde. Der arme Sidney, er liebte es, mich zu belehren. Er wollte mir sein ganzes Wissen vermitteln und reagierte ungehalten, wenn seine Großzügigkeit nicht geschätzt wurde und ich sagte, ich habe selbst eine Bildung genossen.
«Ha!», rief er und beugte sich vor. Seine Augen sprühten vor Verachtung. «Hast du? Tatsächlich?»
Das war gehässig und kränkte mich. Genau so etwas hätte auch Daddy sagen können. Sidney umgab sich am liebsten mit Studenten, die nach einem gewissen Maß an anfänglichem Widerspruch klein beigaben, aber dieses Mal spielte ich nicht mit, ich war es leid, derart behandelt zu werden. Es war unser erster richtiger Streit, und ich erschrak selbst vor dem, was ich ihm entgegenschleuderte. Zum Beispiel sagte ich, er sei alt und zu fett, und es sei grausam von ihm gewesen, mich dazu zu bringen, ihn zu heiraten. Später im Bett klammerte ich mich an ihn, entsetzt über das, was ich gesagt hatte. Er tröstete mich und sagte, mein Bedürfnis, ihm die Stirn zu bieten, sei in Wahrheit Ausdruck meiner Liebe. Ich eignete mir diese Erklärung nur allzu gerne an, erkannte aber später, dass ich nicht daran glaubte. Das behielt ich für mich, es bestätigte jedoch meinen Verdacht, dass ihn nicht wirklich interessierte, wer ich war, sondern nur, inwieweit ich dem Bild entsprach, das er sich von mir gemacht hatte. Manchmal fühlte ich mich in jener Wohnung wie ein Geist.
Ein anderes Mal fragte er mich, ob ich ein paar Druckfahnen für ihn lesen würde.
«Meinst du vielleicht, ich habe nicht genug eigene Arbeit?», fragte ich zurück.
«Ich bezahle dich dafür.»
Ich bezahle dich dafür. Allmählich verstand ich, wieso ich mich bereit erklärt hatte, ihn zu heiraten. Daddy hatte mir nie gegeben, was ich brauchte, und ich hatte das Gefühl gehabt, das sei meine Schuld. Kinder fühlen sich verantwortlich für alles, was ihnen widerfährt, gleich ob gut oder schlecht. In meinem Fall schlecht. Seit meiner ersten Begegnung mit Sidney hatte ich ihn als Daddy gewollt, damit ich einen Neuanfang machen konnte. Aber das ist unmöglich! Allein die Vorstellung ist im Grunde genommen absurd. Wie hatte ich nur so dumm sein können, zu glauben, es könne anders sein. Aber als ich das erkannte, war es zu spät, ich war bereits Mrs Klein. Beziehungsweise Mrs Schuyler Klein.
Ein weiteres Problem war Sidneys Annahme, ich hätte es genauso eilig wie er, eine Familie zu gründen. Ich weiß nicht, wieso ich so wenig davon hielt. Die meisten Frauen wollen Kinder, wieso nicht ich? Vielleicht hatte es etwas mit seinen sexuellen Ansprüchen zu tun. Ich war nicht vehement gegen die Idee, ich meine, ein Kind zu bekommen, aber inzwischen denke ich, die Kinderfrage war ein weiterer Ausdruck des Machtkampfs, der zu einem steten, misstönenden Wispern im Hintergrund unserer Ehe wurde. Sidney schrieb, unterrichtete und nahm oft an auswärtigen Konferenzen teil: Er war ein vielbeschäftigter, vielgefragter Mann. Was wäre, gäbe es ein Kind in der Wohnung? Ich wusste, was wäre. Ich würde meine Arbeit aufgeben müssen, und dazu war ich nicht bereit. Ich weiß noch, dass ich ihn fragte, ob sein Vater sich zu Hause engagiert habe. Er sagte, nein, sein Vater habe alle häuslichen Angelegenheiten den Frauen überlassen. Wieso also sollte er selbst anders sein?
«Ich habe alles durchdacht», sagte er.
Das tat er immer. Gelegentlich zermürbte er mich mit seiner Denkerei. Er besaß einen präzisen, logischen Verstand, der mit beeindruckender Schnelligkeit funktionierte, aber er war nicht kreativ. Zum Beispiel hätte er nie ein Gedicht schreiben können. Er konnte es kritischen Analysen unterziehen, aber damit hatte es sich auch schon. Ihm fehlte die Vorstellungskraft.
Damals liebte er es, seine Studenten nach Hause einzuladen, und es gab oft beängstigend laute Debatten im Wohnzimmer. Weil die Wohnung groß war und wir es diesbezüglich nicht allzu genau nahmen, herrschte ein Zustand chronischer Unordnung. Nur Gladys bewahrte uns davor, in absolutem Chaos zu versinken. Gladys, Sidneys Haushälterin, war eine gute Christin aus Atlanta, Georgia, wie er gerne sagte. Und auch wenn ich immer zu müde war, um mich an den Diskussionen zu beteiligen, die er in seiner Wohnung organisierte, erhob ich nie Einwände dagegen. Ich zog mich einfach ins Schlafzimmer zurück, wo ich mich aber gestört fühlte von den gedämpften Gesprächen und dem lauten Gelächter. Nie beklagte ich mich darüber. Aber ich konnte mich eben auch nicht beteiligen. Anders als meine Schwester fühlte ich mich unter vielen Menschen nicht wohl.
Wie die pflichtbewusste Tochter, die zu sein ich vorgab, rief ich Daddy jede Woche an, um zu hören, ob in Ravenswood alles in Ordnung war. Er mochte keine langen Telefongespräche und gab den Hörer immer schnellstmöglich an Mildred Knapp weiter. Seit Harriets Tod lebte sie im Turm und putzte und kochte für ihn. Iris meinte, dass sie noch mehr für ihn tat. Ich sah geradezu, wie sie mit dem Hörer am Ohr dastand, während Daddy ihr soufflierte. Sie konnte nicht frei sprechen, was jedoch nicht wirklich eine Rolle spielte. Sie und ich hatten uns nie nahegestanden. Aber von ihr erfuhr ich Neuigkeiten über Iris, so zum Beispiel, dass sie nach ihrem Collegeabschluss in die Stadt ziehen wolle. Die Vorstellung einer in New York lebenden Iris beunruhigte mich und muss auch Daddy beunruhigt haben. Daher war ich nicht überrascht, als er vorschlug, sie solle zu mir und Sidney ziehen, damit ich wieder die Mutterrolle bei ihr übernehmen könne, wie damals in ihrer Teenagerzeit nach dem Tod von Harriet. Sidney war nicht abgeneigt, ich dagegen war es. Nur über meine Leiche, sagte ich.
Zum Glück wollte Iris aber sowieso lieber in Downtown leben, wodurch es mir erspart blieb, ihr die Aufnahme bei uns zu verweigern. Wenn es um Iris ging, war nichts je einfach. Immer gab es Dramen, Gefühlsausbrüche, Chaos. Während ihrer Collegezeit hatte sie mich mehrmals besucht, und ich war nie unglücklich gewesen, wenn ich sie anschließend wieder in den Zug setzen konnte. Sie war viel schwieriger als an der Highschool, und die kurzen Zeiten, die ich mit ihr verbrachte, erschöpften mich. Sie war nicht schön, nicht in irgendeinem konventionellen Sinn. Ihr Gesicht war zu mollig und ihre Zähne standen nicht gerade, allerdings hatte sie schöne dunkle Augen und eine samtige Haut. Sie war so groß wie ich, hatte aber eine viel üppigere Figur. Männer fanden sie entschieden attraktiv.
Ihre Haare waren blond, aber nicht so hell wie meine, sondern von einem eher schmutzigen Blond, und sie hatte Unmengen davon, wenn man bedenkt, wie wenig sie sie pflegte. Ich hatte sie oft mit tränenüberströmtem Gesicht und mit feucht im Gesicht klebenden Haaren erlebt – was absolut verboten aussah. Ein unmögliches Mädchen. Aber binnen einer Woche nach ihrer Ankunft hatte sie eine Durchgangswohnung über einem Nudelrestaurant in Chinatown gefunden. Wie sie einen chinesischen Vermieter dazu gebracht hatte, ausgerechnet an sie zu vermieten, ist mir bis heute ein Rätsel. Alle sagten, man müsse Kantonesisch sprechen, um in Chinatown unterzukommen, wobei ich fairerweise hinzufügen muss, dass die Wohnung eigentlich schon fast in der Bowery lag. Außerdem fand sie einen Job in einem Hotel. Sidney war beeindruckt. Iris amüsierte ihn, und er billigte ihr ehrgeiziges Ziel, Ärztin zu werden. Er war überzeugt, sie würde eine gute Ärztin abgeben, wenn sie erst einmal zu sich selbst gefunden hätte. Seiner Meinung nach besaß sie eine robuste Persönlichkeit, wie er es ausdrückte, aber auch eine chaotische Vitalität. Damit meinte er, dass sie laut war und Gelüste hatte, und damit meinte er, dass sie gerne trank und sich gerne mit Männern abgab. Sie zog ältere Männer an, und es war ihr ganz egal, ob sie verheiratet waren oder nicht. Das wusste ich, denn wenn wir in irgendeiner Kellerbar in Greenwich Village saßen, wo sie sich wie zu Hause fühlte, erzählte sie mir bei zahlreichen Cocktails nur allzu gern von ihrem Liebesleben.
Ich habe freizügigen Gesprächen über Sexualität noch nie viel abgewinnen können. Iris jedoch liebte es, sich darüber auszulassen. Ein Glas Martini in der einen und eine Zigarette in der anderen Hand, ein Funkeln in den Augen, die Haare wild zerzaust, machte sie sich darüber lustig, wie schockiert ich reagierte, wenn sie derart unverblümt über ihre Affären redete. Sie verhielt sich, als gehöre ich einer anderen Generation an, was in gewisser Weise auch stimmte, und sagte, ich habe zu früh geheiratet.
«Ich mag Sidney», sagte sie, «aber in New York wimmelt es von klugen Männern, falls es das ist, was du willst.»
«Ich habe genug von klugen Männern», antwortete ich.
«Genug?», rief sie. «Constance, es gibt kein genug. Sondern immer mehr.»
«Iris, wo hast du bloß so reden gelernt?»
Inzwischen hatte Sidney beschlossen, eine Dinnerparty zu veranstalten, um einigen unserer Freunde diese chaotische Beatnik-Braut vorzustellen. Sie brauche Freunde in der Stadt, sagte Sidney. Ich entgegnete, Iris sei mehr als fähig, eigene Freunde zu finden, aber da sie meine Schwester war, erklärte ich mich einverstanden. Ich besuchte sie nach der Arbeit und erzählte ihr von der geplanten Dinnerparty. Sie freute sich unbändig.
«Noch nie hat jemand mir zu Ehren eine Dinnerparty veranstaltet», rief sie.
Ich sagte, sie müsse sich aber unbedingt benehmen, und erinnerte sie daran, was auf unserer Hochzeit passiert war.
«Ich war doch noch ein halbes Kind!»
Am Abend der Party, vor der mir graute, war es warm, alle Fenster in der Wohnung standen offen. Als die Gäste eintrudelten, mixte Sidney, der eine Zigarre rauchte, einen Krug Martinis. Ed Kaplan wollte wissen, wo meine famose Schwester denn sei.
«Sie kommt sicher bald», sagte ich.
Wir standen in einem großen, vertäfelten Raum mit einem guten Perserteppich und zwei ochsenblutroten Chesterfields zu beiden Seiten eines niedrigen Tischs vor dem Kamin, alles sehr maskulin. Außerdem gab es eine Bücherwand mit einer Bibliotheksleiter auf Rollen und einen Getränketisch. Im Sommer wurde es in diesem Raum sehr heiß. Die Martinis verschwanden im Eiltempo. Die Gäste unterhielten sich laut. Alle rauchten. Ed Kaplan erzählte überall herum, Iris existiere überhaupt nicht. Wir sollten lieber mit der Vorstellung von Iris essen, dann sei die Gefahr einer Enttäuschung nicht so groß. Alles sehr witzig, aber die Gäste wurden allmählich betrunken, und immer noch keine Iris. Ich nahm Sidney beiseite.
«Ich trage jetzt das Essen auf», sagte ich. «Sorg dafür, dass sie Platz nehmen.»
Wir waren bereits im Esszimmer und hatten uns gesetzt, als wir sie an der Tür hörten. Ich bat Ed, sie hereinzulassen. Dann hörten wir ihre hohen Absätze eilig durch den Flur klappern. Überrascht starrte sie die versammelten Gäste an.
«Oh mein Gott, komme ich zu spät?», rief sie mit heiserer Stimme. Dann wurden ihre Augen riesig. «Es hat ein Feuer gegeben!», fügte sie hinzu.
Sie trug ein tief ausgeschnittenes rotes Cocktailkleid, das sich eng an ihre üppige Figur schmiegte, und mit ihrer hoch auf dem Kopf aufgetürmten blonden Mähne, aus der sich ein paar Strähnchen gelöst hatten, und den hohen Absätzen wirkte sie, als wäre sie über einen Meter achtzig groß. Sie arbeitete sich um den Tisch herum, beugte sich vor, um jedem einzelnen Gast die Hand zu schütteln, und gewährte dabei tiefe Einblicke in ihr Dekolleté. Die so spröde Ellen Taussig warf mir einen Blick zu, aber Iris war der personifizierte Charme, als sie bei ihr anlangte. Sie habe so viel über sie gehört, sagte sie.
«Meine Liebe», sagte Ellen, «Sie haben doch nicht etwa selbst Feuer gefangen, oder?»
Iris – sie war wirklich noch sehr jung – starrte sie an, und ein, zwei Sekunden herrschte eine eigenartige Stille im Esszimmer. Irgendwo auf der Straße brüllte ein Mann etwas Obszönes. Dann ging Iris plötzlich auf, dass diese elegante, würdevolle Frau einen Witz gemacht hatte. Sie hob den Kopf und gab ein schrilles Lachen von sich, das in meinen Ohren klang wie leere Flaschen, die in einen Kamin geschmettert wurden. Alle fielen ein, sogar Ellen ließ sich von diesem Lachen anstecken. Es war eine fast hysterische Stimmung. Iris war ein voller Erfolg.
Ich weiß nicht, warum ich an diesem Abend an Harriets Tod denken musste. Es war immer schmerzlich, mich an ihre letzten Monate zu erinnern. Ich war zwölf, als sie krank wurde, und sie war im Grunde genommen gar nicht so alt, erst siebenunddreißig. Ich erinnere mich, dass ich wütend auf sie war, gleichzeitig aber auch wusste, dass ich mir das nicht anmerken lassen durfte. Ich glaube, sie verstand. Daddy kam mit ihrer Krankheit weniger gut zurecht als ich. Er war Arzt. Er kannte sich mit Krebs aus und hatte keine Illusionen über den Ausgang der Geschichte. «Krebs ist Krebs», sagte er einmal, und zwar mit derart kalter Endgültigkeit, dass mir ein Schauder über den Rücken lief. Es gab keine Remission. Sie hatte einen Knoten in der Lunge und musste schon eine ganze Weile Schmerzen gehabt haben, ehe sie irgendjemandem davon erzählte. Arme Harriet. Sie sei sehr gefasst, sagte Daddy. In den Augen des Kindes, das ich damals war, wurde sie zu einem ätherischen Wesen; es gab damals nur wenig, was ich nicht romantisieren konnte. Ich versuchte, in ihrem Beisein nicht traurig zu sein, das war das Schwerste. Aber wenn ich traurig war, verschaffte ich ihr zumindest die Befriedigung, mich trösten zu können. Ich glaube, das brauchte sie. Ich bot ihr immerhin die Möglichkeit, sich nützlich zu fühlen.
Es ging ihr gegen den Strich, sich von anderen versorgen lassen zu müssen. Im Krankenhaus wirkte sie immer kleiner und kränker als zu Hause, wo sie zumindest einen gewissen Einfluss auf die Abläufe hatte. Mildred Knapp kam jeden Tag, und die beiden besprachen häusliche Angelegenheiten.
Die Beerdigung war grauenhaft. Hätte ich mich nicht um Iris kümmern müssen, wäre ich zusammengebrochen. Daddy brach zusammen, innerlich. Hinterher war das Haus voller Leute. Mildred hatte Sandwiches gemacht. Es gab Getränke. Ich war sehr verstört. Aber die Erwachsenen schienen das Ganze für eine Art Cocktailparty zu halten. Einmal hörte ich eine der Nachbarinnen zu einer anderen sagen: «Der arme Doktor wusste nicht, wie ihm geschah.» Meine Reaktion auf diese Worte war extrem, ich musste das Zimmer verlassen. Unter der Vordertreppe gab es eine muffige kleine Toilette mit geräuschvollen Rohren. Dorthin zog ich mich oft bei abgeschlossener Tür zurück, um zu lesen oder einfach nur nachzudenken. An diesem Tag übergab ich mich und hörte es noch einmal: Er wusste nicht, wie ihm geschah. Ich hatte die Worte schon einmal gehört, vielleicht in einem Traum. Den Kopf in den Händen vergraben, blieb ich lange dort sitzen.
Dann jedoch war es vorbei. Ich erholte mich, mehr oder weniger, und das Leben ging weiter. Als es das nächste Mal passierte, dachte ich, jemand rede mit mir, aber es war niemand im Zimmer. Die Erkenntnis, dass sich das alles nur in meinem Kopf abspielte, war ein Schock. Ich erzählte niemandem davon. Aber ich glaubte nie, dass ich verrückt wurde. Es war einfach nur eine böse Erinnerung.
Eines Abends in New York fragte Iris mich, ob ich mich an den Tag erinnern könne, an dem Harriet starb. Es war keine einfache Frage. Ich hatte meine Erinnerungen an jene letzten Wochen in eine Schachtel gepackt und in einem Raum in meinem Kopf verstaut, den ich nie betrat, wenn es sich vermeiden ließ. Ich wusste, dass ich Harriets Sterben miterlebt hatte, und einmal hatte ich Daddy gefragt, wann es so weit wäre. Ich weiß noch, wie klinisch er klang, wie absolut kalt.
«In ein paar Tagen», sagte er. «Sehr wenigen Tagen.»
Mir war nicht klar gewesen, dass es so schnell gehen würde. Es brach mir das Herz. Man musste kein empfindsames junges Mädchen mit blühender Fantasie sein, um vor dem randvollen Becher Pathos dieser Worte zurückzuschrecken. Ich fing an, mir ein Ende ihres Leidens herbeizuwünschen. Ich wollte, dass sie starb, und fühlte mich deswegen schuldig. Aber wie gnädig es doch wäre, könnte sie einfach davongleiten, oder würde ich ihr Leben in aller Stille beenden, ihr einfach ein Kopfkissen aufs Gesicht legen und fünf Minuten fest zudrücken. Ich bezweifelte nicht, dass sie das wollte. Es war mir unerträglich, wie dünn sie geworden war, nur noch Haut und Knochen, und wie ihre trüben, morphiumverschleierten Augen mich ansahen. Und immer hing dieser entsetzlich süße Geruch nach Fäulnis in der Luft. Und dann ihre klauenähnliche Hand, die sich von der Decke hob und nach mir griff, wenn ich in ihre Nähe kam –
Das alles konnte ich nicht zu Iris sagen. Sie war wie Harriet, sie hatte ein großes Herz, war wie ein offenes Buch. Niemand dachte, sie sei keine eigenständige Person. Ich weiß noch, dass ich ihr von der Traurigkeit jener Tage erzählte, und davon, dass Daddy gesagt hatte, der Tod sei etwas Gutes, wenn er Leiden beendete. Nur eine Art Schlaf, hatte er gesagt. Kein Wort über ein Leben nach dem Tod. Er war seit jeher ein gottloser Mann.
«Weißt du noch, Constance, dass alle immer gedacht haben, sie sei allein gewesen, als sie starb?», fragte Iris.
Ich jedenfalls hatte es gedacht. Es gab Zeiten, da niemand bei ihr war, und genau da geschah es. Daddy ging ein paar Minuten später in ihr Zimmer und fand sie tot auf. Ich weiß noch, dass Mildred Knapp irgendwann an diesem Tag, als Iris und ich in der Küche saßen und in unsere Teetassen starrten, zu uns sagte, Harriet sei bewusst erst gegangen, als sie allein war. Ihr Mann, Walter, habe es auch so gemacht. Dann schlug sie die Hand vor den Mund.
Ich habe nie vergessen, wie Mildred die Hand vor den Mund schlug, nachdem sie den Namen ihres verstorbenen Mannes ausgesprochen hatte. Walter. Walter Knapp. Sie hatte ihn vorher noch nie erwähnt. Wir hatten nicht einmal gewusst, dass die sauertöpfische Mildred einen Ehemann gehabt hatte. Es hinterließ auch bei Iris einen starken Eindruck.
«Man kann es sich aussuchen?», flüsterte sie.
«Manchmal», sagte Mildred. «Wenn man Glück hat.»
Letztendlich war Harriets Tod eine Erleichterung, aber Daddy brauchte lange, um darüber hinwegzukommen. Später erkannte ich, dass er sich schlecht fühlte, weil er nicht bei ihr gewesen war, um ihr den Schmerz des Gehens zu erleichtern. Das alles schoss mir durch den Kopf, als Iris sagte, Harriet sei nicht allein gewesen.
«Was sagst du da?»
«Ich war bei ihr.»
Ich war schockiert. Sie sagte, sie sei ins Schlafzimmer gegangen, und Harriet habe schwer geatmet, als bekäme sie nicht genug Luft. Eigentlich hatte Iris vor, Daddy zu holen, aber Harriet wollte, dass sie bei ihr blieb. Also legte sie sich zu ihr ins Bett und hielt ihre Hand. Dann starb sie.
«Woran hast du es gemerkt?»
«Ihre Finger wurden ganz schlaff, und alles war auf einmal sehr still.»
«Was hast du dann gemacht?»
«Nach einer Weile bin ich gegangen.»
«Wieso hast du niemandem was gesagt?»
«Weil ich dachte, ich würde Ärger bekommen.»
Eine Sekunde lang starrten wir uns an. Dann fingen wir an zu lachen. Und wie wir lachten, wir konnten uns kaum halten, konnten einfach nicht aufhören. Iris hatte es nie jemandem gesagt, bis sie es mir erzählte, so nah standen wir uns. Gleichzeitig war ich aber auch verärgert. Eigentlich hätte ich am Ende bei ihr sein müssen.
Nachdem Iris bei dem Abendessen, zu dem Sidney ihr zu Ehren eingeladen hatte, ein derart großer Erfolg gewesen war, bat ich sie, mir das Hotel zu zeigen, in dem sie arbeitete. Ich versuchte, auf sie aufzupassen. Harriet hätte gewollt, dass ich das tat, soweit ich wusste, war das der Wunsch sterbender Mütter. Es dämmerte, wir standen auf dem Bürgersteig vor einem Sandsteingebäude an der Ecke West Thirty-third Street, nicht weit von der Penn Station entfernt. Am Himmel über Jersey waren ein paar Schmierstreifen eines rostroten Sonnenuntergangs zu sehen. Schwarze Wolken hingen über uns. Mir war unbehaglich zumute. Das letzte Licht ließ die Fenster der gegenüberliegenden Gebäude aufleuchten und die Feuerleitern gleißen. Ein Stück die Straße hinunter umgab ein Maschendrahtzaun ein brach liegendes Grundstück. Mehrere junge Männer lungerten rauchend davor herum und starrten zu uns herüber. Das Ganze gefiel mir nicht. Iris meinte, drinnen sei es gar nicht so übel.
«Was du nicht sagst.»
Eine breite Steintreppe mit Messinggeländer führte zu einer Tür, über der sich eine Markise mit dem Wappen des Hotels spannte. Tauben hockten auf dem Sims darüber. Als wir die Treppe hinaufgingen, flogen sie auf und flatterten in die Dämmerung davon. Ein Schwarzer in einer abgetragenen grauen Livree mit scharlachroten Litzen hieß uns im Dunmore Hotel willkommen und begrüßte Iris mit Namen.
«Hi, Simon», antwortete sie. «Das hier ist meine große Schwester.»
Dann zog sie eine Brille mit klobigem schwarzem Gestell aus der Tasche und setzte sie auf. Das veränderte sie total. Sie sah wie eine Intellektuelle aus.
«Guck nicht so», sagte sie. «Ich brauche sie.»
Wir betraten eine Lobby mit gefliestem Fußboden und Kübeln mit staubigen Farnen. Alte lederbezogene Sessel und Couches umgaben niedrige Tische. Alles machte einen schäbigen Eindruck, dennoch hielt sich auch ein Rest von Vornehmheit, und ich stellte mir einsame Handlungsreisende vor, die mit ihren Musterkoffern eincheckten und dann hinausschlüpften, um sich ein Tröpfchen Whiskey oder was auch immer zu besorgen. Neben der Rezeption führte eine breite, mit Teppich ausgelegte Treppe in die oberen Stockwerke. In diesem Moment merkte ich, denn ich hörte ihn, dass sich das Dunmore einen Pianisten leistete. Anscheinend spielte er jeden Abend in der Cocktailbar. Er hieß Eddie Castrol, und Iris wollte unbedingt, dass ich ihn kennenlernte. Ich fragte, wieso.
«Bist du dann sauer auf mich?»
«Kommt darauf an, was du sagst.»
Das Herz wurde mir bereits schwer. Dann erzählte sie mir, sie habe sich mit diesem Mann eingelassen. Deshalb wolle sie, dass ich ihn kennenlernte. Ich sagte, ich würde sofort nach Hause gehen, wenn sie mir nicht sage, wer er sei. In diesem Punkt war ich sehr bestimmt. Also setzten wir uns eine halbe Stunde in die Lobby, und sie vertraute mir an, dieses Mal sei es das Wahre.
«Ach, tatsächlich?»
Sie führte mich nach hinten in die Bar, einen großen, dämmrigen Raum mit zwanglos verteilten Tischen, einer kleinen Tanzfläche und einer Theke. Die wenigen Gäste saßen entweder für sich allein oder steckten als Paare die Köpfe zusammen und flüsterten miteinander. Lampen mit bogenförmig eingefassten Schirmen verbreiteten ein gedämpftes gelbliches Licht. Die Atmosphäre war seltsam und traurig und irgendwie traumartig, was durch den Mann in dem schäbigen Smoking verstärkt wurde, der, eine Zigarette im Mundwinkel, auf der anderen Seite des Raums am Flügel saß. Er spielte ein Stück, das ich nicht identifizieren konnte. Es war eigenartig abgehackt, irgendwie sperrig, synkopiert. Ich bin sehr empfindsam, wenn es um Musik geht, extrem empfindsam in Bezug auf alle Geräusche.
«Erinnert er dich auch an Daddy?», flüsterte Iris.
Absolut nicht! Es war beunruhigend, dass Iris das fand. Sie führte mich zu einer Sitznische, winkte der Kellnerin, blieb einen Moment stehen und betrachtete Eddie Castrol durch ihre lächerliche Brille. Er grinste zu uns herüber. Dann ging Iris davon. Ich bestellte mir einen Martini und sah erneut zu dem Mann hinüber, der meine Schwester an Daddy erinnerte. Seine Haut war wie Pergament und wirkte im Scheinwerferlicht wie ausgebleicht, aber ich musste ihm zugestehen, dass er spielen konnte.
Er spürte, dass ich ihn musterte. Die Zigarette im Mundwinkel, den Kopf gesenkt, beugte er sich tiefer, hackte auf die Tasten ein wie ein Vogel, der nach Würmern pickt, und ging ausgerechnet zu Moon River über. Außer mir schien niemand zuzuhören. Er spielte das Stück sehr langsam und stimmungsvoll. Zu sentimental für meinen Geschmack.
Ich verlor mich im Fantasieren und sah meine Schwester in den Armen dieses schwer fassbaren Mannes, stellte mir vor, wie er sich über ihren üppigen, weichen, schweren Körper hermachte wie ein Tier. Es war ein beunruhigender Gedanke. Er beendete das Set, bevor Iris zurückkam, stand abrupt auf und durchquerte den Raum, begleitet von spärlichem Applaus. Inzwischen besaß er meine volle Aufmerksamkeit. Ich zündete mir eine Zigarette an, es war einer von diesen Abenden. Er glitt geschmeidig neben mich in die Nische, stellte sich vor und drehte sich zur Bar um.
«Wo ist dieses Mädchen denn jetzt schon wieder hin?»
Er meinte die Kellnerin. Über seine Zigarette hinweg grinste er mich an, machte anschließend kurzen Prozess mit einem großen Gin und rief nach dem nächsten. «Säufer», dachte ich. Er kippte den Gin, als wäre es Wasser. Dann beugte er sich näher.
Ich wandte mich ab.
«Bringen Sie mich nicht in Verlegenheit», sagte ich.
Ich behandelte ihn kühl, denn ich empfand nichts als Verachtung für diesen zwielichtigen Mann und die lausige Bruchbude, in der meine Schwester arbeitete. Wäre sie nicht gewesen, wäre ich auf der Stelle gegangen. Eddie hob die Hände, wie um zu sagen: «Worüber sollen wir uns denn unterhalten?». Und ich dachte: «Ja, worüber bloß?»
«Iris sagt, Sie komponieren auch?»
Ich versuchte nur, Konversation zu machen. Er spitzte die Lippen, als wolle er etwas küssen, zog die Augenbrauen hoch und starrte in seinen Gin. War die Frage so kompliziert?
«Ja, ich schreibe Sachen», sagte er nach einer Weile.
«Sachen?», fragte ich und griff nach der nächsten Zigarette. Ich fühlte mich alles andere als wohl. Meine Vermutung lautete, dass das abgehackte Stück, das er gespielt hatte, als wir hereinkamen, zu seinen Sachen gehörte.
«Ich lektoriere Sachen», sagte ich. «Sachen, die andere schreiben. Was meinen Sie? Sind Ihre Sachen wie meine, oder sind meine Sachen etwas völlig anderes?»
Er gab mir Feuer und senkte den Blick, aber da war es, ich sah es noch einmal, das schiefe Grinsen, das er an sich hatte. Ich hatte ihn amüsiert. Das war zwar nicht meine Absicht gewesen, es freute mich aber trotzdem.
«Möchten Sie darüber reden?», fragte ich.
Er kam aus Miami. Sein Vater hatte ihn in die Kammermusik eingeführt, als er sieben war. Er war am Juillard Konservatorium angenommen worden, aber nicht lange geblieben. Ich fragte, wieso, und er sagte, allein sei er schneller vorangekommen. Ich lachte leise auf, denn ich glaubte ihm kein Wort.
«Würden Sie mir etwas sagen?», fragte ich.
«Sicher.»
«Was machen Sie in dieser Bruchbude?»
Damit hatte er nicht gerechnet. Er reagierte mit einem bellenden Lachen und legte die Hände flach auf den Tisch. Er hatte die dünnsten, spinnenartigsten Finger, die ich je gesehen hatte, die Kuppen gelblich verfärbt. Vielleicht erinnerte er Iris deshalb an Daddy.
«Bruchbude ist der richtige Ausdruck. Ich bin nur wegen Ihrer Schwester hier.»
Er wusste genauso gut wie ich, dass das nicht stimmte. Er brauchte das Geld, so armselig es zweifellos war. Aber ich spielte mit.
«Das würden Sie für Iris tun? Sie ist nur wegen Ihnen hier.»
«Sie glaubt, wir haben eine Zukunft.»
Er sah mir in die Augen, während er sich eine neue Zigarette ansteckte.
«Sie nicht?»
«Ach kommen Sie, Darling. Sie wissen, wie meine Situation aussieht.»
«Ich weiß, dass Sie verheiratet sind, Darling.»
Er war kein bisschen verlegen. Ganz offensichtlich hatte er entschieden, dass es keinen Sinn hatte, mir gegenüber nicht offen zu sein. Er kippte seinen Gin und beugte sich näher, und jetzt lag etwas von einem Hai in seinem Gesichtsausdruck.
«Und Sie?», fragte er.
Er hatte beide Ellbogen auf den Tisch gestützt und grinste. Mein Glas war leer. Er war ein schlaksiger Mann mit geschmeidigen Gliedmaßen, und seine Haare glänzten ölig. Von den Winkeln seiner schmalen, schwarzen Augen zog sich ein Netz winziger Falten über seine Wangenknochen. Ich sah mich nach der Kellnerin um, und nach Iris, die zurückkommen müsste. Ich hatte sie ganz vergessen gehabt. Mir war ein bisschen übel. Ja, sagte ich, ich sei verheiratet.
«Läuft es gut?»
«Kein Kommentar.»
Erneut gab er dieses bellende Lachen von sich und stand auf, und eine Spannung, deren ich mir kaum bewusst gewesen war, legte sich. Später gingen wir zu dritt in eine andere Bar. An diesem Abend war ich das Publikum der beiden. Was für ein Paar sie abgaben – er in seinem alten Smoking und sie in diesem Cocktailkleid aus zweiter Hand, aus dem ihre Brüste geradezu hervorquollen, einen billigen Pelz um die Schultern geschlungen. Arm in Arm zogen wir durch die Straßen von Greenwich Village, drei fein gemachte Nachtschwärmer auf Kneipentour. Harriet wäre stolz auf uns gewesen.
Als ich am nächsten Tag mit Iris sprach, erwähnte sie den letzten Teil des Abends nicht. Der Laden, in den wir gingen, war heiß und verraucht. Es gab Jazz. Irgendwann nach Mitternacht saßen Iris und ich auf Barhockern, während Eddie Castrol, der seine Jacke ausgezogen und sein Hemd aufgeknöpft hatte, zwischen uns mit dem Rücken am Tresen lehnte, die ewige Zigarette im Mund. Stellenweise war sein Hemd durchgeschwitzt. Er schien jeden zu kennen. Alle kamen, um «Hi» zu sagen und ihm in die Hand zu klatschen. Ich fragte Iris, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellte. Ich hätte es besser wissen müssen.
«Eddie?», wandte sie sich an ihn.
«Liebes?»
«Meine Schwester möchte wissen, wie deine Absichten aussehen. Willst du mit mir Schluss machen?»
Die Hand auf die Brust gelegt, sang sie die Zeile aus Louis Armstrongs und Ella Fitzgeralds Song in einem tiefen, bebenden, tonlosen Bass: But ooooh, if we call the whole thing off, then we must part –
Eddie zog sie an sich, wobei er Gin über ihr Kleid vergoss, was sie aber nicht bekümmerte. Glücklich wie ein Kind überließ sie sich diesem langfingrigen Klavierspieler aus Miami, der sie an Daddy erinnerte. Einen Arm lose herabhängend, legte sie den Kopf an seine Schulter, und er streichelte ihre Haare. Sie hob den Kopf, und er küsste sie auf die Lippen. Dabei beobachtete er mich. Meine Vorhersage: Er würde ihr das Herz brechen. Es machte sicher Spaß, mit ihr zusammen zu sein, aber sie war noch ein Kind. Er war zu alt für sie. Zu alt. Zu zynisch. Zu verheiratet.
Ein paar Abende später ging ich noch einmal ins Dunmore. Iris sagte ich nichts davon, ich wusste, wie es für sie aussehen würde. Als würden die Erwachsenen hinter ihrem Rücken darüber reden, was das Beste für sie war. Sie wäre wütend. Es war das zweite Mal. Er sah mich gleich, als ich hereinkam, spielte ein paar Takte von Moon River und setzte sich dann zu mir in die Nische. Er fragte, womit er die Ehre dieses Mal verdient habe, und ich sagte, ich wolle ihm danken. Er wusste, was ich meinte.
«Wie geht es ihr?»
«Im Augenblick leidet sie», sagte ich. «Aber sie wird darüber hinwegkommen. Was haben Sie ihr gesagt?»
Er hatte ihr gesagt, was ich vor einigen Tagen vorgeschlagen hatte. Ich war ins Hotel gegangen und hatte ihm klar gemacht, dass er die Finger von Iris lassen musste. Sie sei noch sehr jung, er würde ihr nur schaden. Er hatte nicht protestiert. Dann hatten wir über seine Familie geredet und uns im Guten voneinander verabschiedet.
Jetzt runzelte er die Stirn, starrte den Tisch an und tippte mit dem Finger gegen den Rand seines Glases. Dann sah er mich an und schüttelte den Kopf.
«Was?», fragte ich.
Er stützte den Ellbogen auf den Tisch und legte die Finger an die Stirn. An diesem Abend herrschte in der Bar viel Betrieb. Frauen blieben am Tisch stehen, um ihn zu begrüßen. Er war charmant zu jeder von ihnen.
«Ach Gott», seufzte er.
«Sagen Sie mir nicht, dass Sie sie lieben.»
«Liebe ich sie denn?»
Er sah mich mit schmerzerfüllten Augen an. Was für ein Schauspieler! Dann plötzlich hellte sich seine Stimmung auf. Die Wolken teilten sich, er beugte sich vor und berührte meine Hand, plötzlich sanft.
«Es könnte anders sein», sagte er, «aber ich muss an das Kind denken.»
«Kinder überleben Scheidungen.»
«Nicht meine Francie.»
Ich musste mich entschuldigen und zur Toilette gehen, wo ich in einer der Kabinen sitzen blieb, bis ich mich wieder ruhiger fühlte. Kinder überleben Scheidungen. Hatte Sidneys Sohn die Scheidung überlebt?
Ungefähr um diese Zeit herum kam Sidney von einem Besuch bei seiner Ex-Frau in New Jersey zurück und sagte, er müsse mich um einen großen Gefallen bitten. Ich arbeitete an diesem Tag am Küchentisch und lektorierte ein schlecht geschriebenes Manuskript, das mir keinerlei Freude machte, aber Ellen Taussig hatte mich gebeten, diese besondere Aufgabe zu übernehmen. Sidney wollte wissen, ob es mir recht sei, wenn Howard für ein paar Tage zu uns käme, seine Mutter müsse ins Krankenhaus. Ich fragte, was von mir erwartet werde.
«Sei einfach höflich.»
Gladys würde für ihn kochen, und da er ein stiller Junge sei, würde er mich abends nicht stören. Wir würden kaum merken, dass er in der Wohnung sei. Er könne sonst nirgends hin.
Als ich am nächsten Tag nach Hause kam, saß ein magerer, ernster Junge vor einem Teller mit Würstchen in Sidneys Küche. Ein Vorhang aus Haaren von der Farbe hellen Strohs fiel ihm in die Stirn, seine Arme und Beine wirkten wie die einer Gliederpuppe, und seine Finger waren die eines Geigers. Anscheinend hatte ich damals nichts als Musiker im Kopf. Howard besaß nur wenig Ähnlichkeit mit Sidney, der groß und schwer gebaut war und eine rötliche Gesichtsfarbe und winzige Hände und Füße hatte.
Der Junge stand auf, als ich in die Küche kam, und ich dachte: «Oh, ein richtiger kleiner Gentleman.»
«Hallo, Howard Klein», sagte ich.
«Hallo, Mrs Klein.»
«Setz dich wieder. Möchtest du Senf für die Würstchen?»
«Nein danke.»
«Ketchup?»
«Nein danke.»
Er setzte sich, und mir ging auf, dass er kein Problem sein würde. Ich weiß noch, dass ich dachte, dass ich in seinem Alter genau wie er gewesen war, immer auf Höflichkeit bedacht, um mein inneres Leben vor den Erwachsenen zu schützen. Deshalb schlug ich Sidney am nächsten Tag vor, übers Wochenende wegzufahren. Er war mit seinem Buch beschäftigt und wollte nicht unterbrochen werden. Ich sagte, es gehe nicht um mich, sondern um Howard, dem das bestimmt gefallen würde.
«Du hast recht», sagte er. «Wir könnten deinen Vater besuchen.»
«Ich habe mir eher etwas anderes vorgestellt.»
Ich hatte nämlich genug von Daddy, den wir am Labor Day besucht hatten, und so fuhren wir nach Long Island und verbrachten das Wochenende in Montauk. Es tat gut, wegzukommen. Zum Schwimmen war es zu kalt, aber wir unternahmen lange, windumpeitschte Spaziergänge am Strand, wo es Dünen gab, Treibholz, Anhäufungen von großen, flachen Steinen und Stellen voller glänzender Seetangbüschel, die von den Herbstfluten angeschwemmt worden waren. Ich beobachtete Howard und seinen Vater, die im nassen Sand knieten und eine tote Meeresschildkröte inspizierten. Sidney drehte sie mit einem Stock um, und Howard kreischte entzückt auf, als Dutzende winziger schwarzer Krebse hervorschwärmten. Anschließend gingen wir zum Essen in ein Fischrestaurant. Der Wind hatte Farbe in Howards Gesicht gebracht und rote Flecken auf seine Wangenknochen gezeichnet. Auf meine auch. Sidney war erfreut. Er wollte, dass Howard und ich Freunde wurden, und fand, es sei gut für mich. Die Mutter zu spielen würde mich von meinem Vater ablenken, sagte er.
Etwa um diese Zeit herum musste ich mich für eine Party an Sidneys Fakultät zurechtmachen, auf die ich gern verzichtet hätte. Ich war im Schlafzimmer und hatte vor, mein graues Seidenkleid anzuziehen, als Sidney hereinkam, um seine Uhr zu suchen. Er sorgte sich wegen der Zeit. Ich hatte keine Lust, nett zu ihm zu sein, weil er nicht sehr mitfühlend gewesen war, als ich ihm erzählt hatte, Iris habe Liebeskummer und sei sehr deprimiert. Wo das Problem sei, hatte er darauf nur gesagt. Sie müsse nur mit Trinken aufhören und zum Psychiater gehen.
«Du machst mich nervös», sagte ich. «Kannst du nicht Zeitung lesen oder was auch immer?»
Ich beobachtete ihn im Spiegel. Er saß mit gerunzelter Stirn auf dem Bett und starrte seine Hände an, während ich Papiertücher auf mein Gesicht drückte, damit es bei der Hitze nicht glänzte.
Ich wählte einen Lippenstift. Die arme Iris. Ich hatte sie an diesem Morgen besucht. Ich fand es furchtbar, wie sie lebte, in einer Wohnung im dritten Stock eines Gebäudes