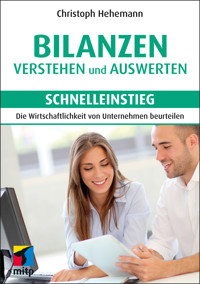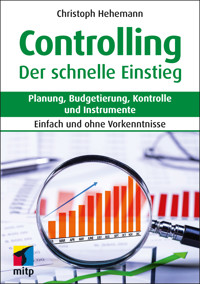
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MITP
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: mitp Schnelleinstieg
- Sprache: Deutsch
- Komplexe Controlling-Themen leicht verständlich erklärt
- Von den Grundlagen über Prozesse bis hin zu strategischen und operativen Instrumenten
- Mit Beispielen und Werkzeugen für die Praxis
Einstieg in die Welt des Controllings
Mit diesem Buch erhalten Sie einen verständlichen und praxisnahen Einstieg in die Welt des Controllings. Ob Grundlagen, Prozesse oder praktische Instrumente; hier erfahren Sie alles, was Sie über Planung, Kontrolle und Steuerung in Unternehmen wissen müssen.
Controlling-Instrumente kennenlernen
Mit einem Mix aus Theorie und anwendungsnahen Beispielen erklärt Christoph Hehemann zentrale Begriffe wie Kostenrechnung, Budgetierung oder strategische Analysen. Sie lernen operative und strategische Controlling-Instrumente kennen, von der Balanced Scorecard bis zur Break-Even-Analyse.
Von Finanz- bis Marketingcontrolling
Der Autor behandelt nicht nur die Grundlagen, sondern geht auch auf die Digitalisierung des Controllings und funktionale Bereiche wie Finanz-, Vertriebs- oder IT-Controlling ein. Perfekt für Einsteiger und alle, die fundiertes Wissen kompakt und leicht nachvollziehbar aufbereitet suchen!
- Grundlagen des Controllings verstehen
- Aufgaben, Ziele und Ablauf
- Zentrale vs. dezentrale Controlling-Strukturen
- Strategisches, taktisches und operatives Controlling
- Planung, Budgetierung und Kontrolle
- Abweichungsanalysen und Forecasts
- Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kennzahlen und Kennzahlensysteme einsetzen
- Operative und strategische Controlling-Instrumente
- Anwendungsfelder: von Finanz- bis Marketingcontrolling
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Impressum
Einleitung
Was erwartet Sie?
An wen richtet sich das Buch?
Wie ist das Buch aufgebaut?
Teil 1: Controllinggrundlagen
Kapitel 1: Was ist Controlling?
1.1 Ein erstes Grundverständnis
1.2 Controlling, Controller, Controllership
1.2.1 Controlling
1.2.2 Controller
1.2.3 Controllership
1.3 Aufgaben des Controllings
1.3.1 Planung
1.3.2 Steuerung
1.3.3 Koordination
1.3.4 Kontrolle
1.3.5 Informationsversorgung
1.3.6 Beratung
1.3.7 Risikoanalyse
1.4 Controllingprozess
Kapitel 2: Organisation des Controllings
2.1 Zentrales Controlling
2.2 Dezentrales Controlling
2.3 Kriterien zur Entscheidung zwischen zentralem und dezentralem Controlling
2.4 Controlling in der Aufbauorganisation
2.4.1 Controlling in der funktionalen Organisation
2.4.2 Controlling in der divisionalen Organisation
2.4.3 Controlling als Linien- oder Stabsfunktion
Kapitel 3: Strategisches und operatives Controlling
3.1 Strategisches Controlling
3.1.1 Was ist eine Unternehmensstrategie?
3.1.2 Strategisches Management und Controlling
3.1.3 Aufgaben des strategischen Controllings
3.2 Operatives Controlling
3.2.1 Operative Planung, Steuerung und Kontrolle
3.2.2 Aufgaben des operativen Controllings
Teil 2: Controllingprozess
Kapitel 4: Planung
4.1 Ziele als Grundlage der Planung
4.2 Strategische und operative Planung
4.2.1 Strategische Planung
4.2.2 Operative Planung
4.3 Planungsprozess und Vorgehen
4.3.1 Planungsprozess
4.3.2 Top-down vs. Bottom-up
4.4 Teilpläne
4.4.1 Absatzplanung
4.4.2 Produktionsplanung
4.4.3 Beschaffungsplanung
4.4.4 Personalplanung
4.4.5 Investitionsplanung
4.5 Aggregation zu einem Gesamtplan
Kapitel 5: Kontrolle
5.1 Soll-Ist-Vergleich
5.2 Abweichungsanalyse
5.3 Gegenmaßnahmen
5.3.1 Arten von Gegenmaßnahmen
Teil 3: Informationsversorgung
Kapitel 6: Kosten- und Leistungsrechnung
6.1 Kostenrechnung vs. Finanzbuchhaltung
6.2 Kostenbegriff
6.2.1 Kosten vs. Aufwand
6.2.2 Weitere Kostenbegriffe
6.3 Kostenartenrechnung
6.4 Kostenstellenrechnung
6.4.1 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
6.4.2 Kostenstellenrechnung im Betriebsabrechnungsbogen
6.5 Kostenträgerrechnung
6.5.1 Aufgaben der Kostenträgerrechnung
6.5.2 Prinzipien der Zurechnung von Kosten
6.5.3 Kalkulationsverfahren der Kostenträgerstückrechnung
6.6 Voll- und Teilkosten
6.6.1 Buchtechnische Methode
6.6.2 Minimax-Verfahren
6.6.3 Lineare Regression
Kapitel 7: Verrechnungspreise
7.1 Was sind Verrechnungspreise?
7.2 Aufgaben von Verrechnungspreisen
7.2.1 Aufgaben im Unternehmen
7.2.2 Nach außen gerichtete Aufgaben
7.3 Ermittlungsmethoden für Verrechnungspreise
7.3.1 Transaktionsbezogene Methoden
7.3.2 Gewinnbezogene Methoden
7.4 Arten von Verrechnungspreisen
7.4.1 Marktorientierte Verrechnungspreise
7.4.2 Kostenorientierte Verrechnungspreise
7.4.3 Verhandlungsbasierte Verrechnungspreise
Kapitel 8: Kennzahlen und Kennzahlensysteme
8.1 Was sind Kennzahlen?
8.1.1 Anforderungen an Kennzahlen und Kennzahlensysteme
8.2 Finanzkennzahlen
8.2.1 Anlagendeckungsgrad I
8.2.2 Anlagendeckungsgrad II
8.2.3 Liquidität 1. Grades
8.2.4 Liquidität 2. Grades
8.2.5 Liquidität 3. Grades
8.3 Renditekennzahlen
8.3.1 Eigenkapitalrendite
8.3.2 Gesamtkapitalrendite
8.3.3 Umsatzrentabilität
8.4 Leistungskennzahlen
8.4.1 Anteil Neuprodukte
8.4.2 Durchschnittlicher Bestellwert
8.4.3 Produktivität
8.4.4 Auftragsreichweite
8.5 Kennzahlensysteme
8.5.1 DuPont-Kennzahlensystem
Teil 4: Controllinginstrumente
Kapitel 9: Strategische Controllinginstrumente
9.1 SWOT-Analyse
9.1.1 Unternehmensanalyse
9.1.2 Umweltanalyse
9.2 Portfolioanalysen
9.2.1 BCG-Matrix
9.3 Balanced Scorecard
9.3.1 Finanzperspektive
9.3.2 Kundenperspektive
9.3.3 Prozessperspektive
9.3.4 Lern- und Entwicklungsperspektive
9.4 Investitionsrechnung
9.4.1 Statische Verfahren
9.4.2 Dynamische Verfahren
9.5 Target Costing
9.5.1 Kostensenkungsmaßnahmen
9.6 Benchmarking
9.6.1 Internes Benchmarking
9.6.2 Externes Benchmarking
9.6.3 Branchenexternes Benchmarking
9.6.4 Ablauf des Benchmarkings
9.7 Kostenmanagement
Kapitel 10: Operative Controllinginstrumente
10.1 Optimierung der Budgetierung
10.1.1 Beyond Budgeting
10.1.2 Better Budgeting
10.1.3 Zero-Base-Budgeting
10.2 Berichtswesen
10.2.1 Standardberichte
10.2.2 Abweichungsberichte
10.2.3 Bedarfsberichte
10.3 Deckungsbeitragsrechnung
10.3.1 Einstufige Deckungsbeitragsrechnung
10.3.2 Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
10.4 Break-even-Analyse
10.5 ABC-Analyse
10.5.1 Weitere Einsatzgebiete der ABC-Analyse
10.6 Systeme der Plankostenrechnung
10.6.1 Starre Plankostenrechnung
10.6.2 Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis
10.6.3 Grenzplankostenrechnung
10.7 Prozesskostenrechnung
10.8 Make-or-Buy-Entscheidungen
Kapitel 11: Digitalisierung im Controlling
11.1 Digitales Controlling
11.1.1 Big Data und Business Analytics
11.1.2 Künstliche Intelligenz
11.1.3 Cloud-Computing
11.1.4 Robotic Process Automation
11.2 Bedeutung für das Controlling
Teil 5: Funktionales Controlling
Kapitel 12: Beschaffungscontrolling
12.1 Portfolioanalyse im Einkauf
12.1.1 Standardstrategien auf Basis der Portfolioanalyse
12.2 Lieferantenbewertung
12.3 ABC- und XYZ-Analyse
12.4 Einkaufsleistung und Einkaufsergebnis
12.5 Logistik-Kostenrechnung
Kapitel 13: Produktionscontrolling
13.1 Wichtige Themen des Produktionscontrollings
13.2 Strategisches Produktionscontrolling
13.3 Operatives Produktionscontrolling
13.4 Industrie 4.0
Kapitel 14: Marketing- und Vertriebscontrolling
14.1 Strategisches Marketingcontrolling
14.2 Customer Lifetime Value
14.3 Absatzsegmentrechnung
Kapitel 15: IT-Controlling
15.1 Portfolioanalysen in der IT
15.2 IT-Balanced Scorecard
15.3 Kosten- und Leistungsrechnung in der IT
Kapitel 16: Personalcontrolling
16.1 Dimensionen der Personalarbeit
16.2 Portfolioanalysen im Personalbereich
16.2.1 Mitarbeiter-Portfolio
16.2.2 Humanressourcen-Portfolio
16.3 HR-Balanced Scorecard
Schlussbemerkungen
Danksagungen
Christoph Hehemann
Controlling
Der schnelle Einstieg
Planung, Budgetierung, Kontrolle und Instrumente
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de/opac.htm abrufbar.
ISBN 978-3-7475-0978-4
1. Auflage 2025
www.mitp.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 7953 / 7189 - 079
Telefax: +49 7953 / 7189 - 082
© 2025 mitp Verlags GmbH & Co. KG, Augustinusstr. 9a, DE 50226 Frechen
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Dieses E-Book verwendet das EPUB-Format und ist optimiert für die Nutzung mit Apple Books auf dem iPad von Apple. Bei der Verwendung von anderen Readern kann es zu Darstellungsproblemen kommen.
Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des E-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine E-Books vr Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die E-Books mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen E-Book-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Lektorat: Katja Völpel
Sprachkorrektorat: Jürgen Benvenuti
Covergestaltung: Christian Kalkert
Bildnachweis: © gopixa / stock.adobe.com
electronic publication: Petra Kleinwegen
Einleitung
Herzlich willkommen bei Controlling – Der schnelle Einstieg! Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu mir und zu diesem Buch gefunden haben. Ihr Interesse daran, was Controlling überhaupt ist, wie es funktioniert und welchen Mehrwert es für ein Unternehmen bringen kann, hat Sie wahrscheinlich zu diesem Buch greifen lassen. Eine gute Wahl!
Die Bedeutung des Controllings in mittleren und großen Unternehmen hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Der Controller selbst konnte seinen Aufgabenbereich von einem rein zahlenorientierten Aufgabenspektrum hin zu einer eher beratenden Tätigkeit für die Unternehmensführung erweitern. Controlling ist ein spannendes Feld, bei dem sich eine nähere Beschäftigung lohnt.
Ich selbst bin für das Controlling und den Finanzbereich eines mittelständischen Unternehmens verantwortlich. In den letzten 18 Jahren habe ich mich mit allen Finanzthemen beschäftigt, die Unternehmen interessieren. Während meiner Tätigkeit bei einer der größten Investmentbanken der Welt habe ich vor allem die strategische Sichtweise der Unternehmensentwicklung kennengelernt und mich mit langfristigen strategischen Investitionsentscheidungen großer Konzerne beschäftigt. Als strategischer Unternehmensberater tauchte ich tiefer in die operativen Themen im Finanzbereich ein und beschäftigte mich vor allem mit Aspekten der nachhaltigen Kostensenkung und Effizienzsteigerung in ganz unterschiedlichen Unternehmen. Seit nunmehr gut fünf Jahren bin ich selbst für die Finanzen eines größeren Unternehmens verantwortlich und habe dadurch noch einmal einen ganz anderen Blick auf alle Finanzthemen in der heutigen Unternehmenswelt erhalten. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich durch diese vielfältigen unterschiedlichen Perspektiven eine ganz eigene Sichtweise auf alle Finanzthemen in Unternehmen gewonnen habe.
Deshalb habe ich versucht, all meine Erfahrungen und mein vielfältiges Wissen zum Thema Controlling in diesem Buch zusammenzufassen. Sie erhalten hier einen vollständigen Überblick über alle Themen, die das Controlling betreffen und berühren.
Was erwartet Sie?
Dieses Buch ist als Einführung in das Thema Controlling gedacht. Es soll Sie an die Hand nehmen und Sie möglichst einfach und verständlich in dieses spannende Finanzthema einführen. Dabei geht es mir vor allem um Verständlichkeit. Sie sollen durch dieses Buch in die Lage versetzt werden, ein Grundverständnis für die Controllingfunktion in Unternehmen zu entwickeln.
Dabei möchte ich Ihnen einen Überblick über alle relevanten Controllingthemen geben. Betrachten Sie die folgenden Ausführungen als eine leicht verständliche und hoffentlich spannende Einführung in das Thema Controlling. Ich möchte Sie an die Hand nehmen und gemeinsam mit Ihnen ein Grundverständnis für das Controlling in Unternehmen entwickeln. Sie sollen die wirklich wichtigen Themen auf einfache und verständliche Weise kennenlernen.
Insofern ist dieses Buch nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einem besseren Verständnis von Controlling. Ich möchte Ihnen einen guten Ausgangspunkt geben, um sich einen Überblick über das gesamte Thema Controlling zu verschaffen. Sie sollten nach der Lektüre in der Lage sein, mit den meisten Controllingthemen vertraut zu sein. Dies ist ein erster Schritt, um sich über die Lektüre dieses Buches hinaus in der Praxis selbstständig mit den Themen zu beschäftigen, die Sie interessieren und betreffen.
An wen richtet sich das Buch?
Dieses Buch richtet sich nicht in erster Linie an Controller. Ich möchte kein Ausbildungsbuch für junge Controller schaffen.
Vielmehr wende ich mich in erster Linie an interessierte Führungskräfte, die sich außerhalb des Finanzbereichs bewegen. Für Führungskräfte ist Controlling eines der wichtigsten Instrumente, um ihre Führungsarbeit effizienter und zielgerichteter zum Erfolg zu führen. Jede Führungskraft hat im Unternehmen Berührungspunkte mit Controllingthemen. Teilweise werden Controllingaufgaben sogar von Führungskräften selbst wahrgenommen. Daher halte ich es für äußerst sinnvoll, dass sich nahezu jede Führungskraft intensiver mit dem Thema Controlling auseinandersetzt. Auch wenn die Führungskraft selbst keine Controllingaufgaben wahrnimmt, so hat sie doch täglich mit Controllern zu tun und sollte sich mit ihnen über Controllingthemen austauschen können. Das vorliegende Buch soll daher Führungskräfte in die Lage versetzen, die wesentlichen Themen des Controllings zu kennen und somit die »Sprache« der Controller mit diesen sprechen zu können.
Darüber hinaus eignet sich dieses Buch auch hervorragend für Studenten und Auszubildende, um sich einen ersten Überblick über das Thema Controlling zu verschaffen. In der Ausbildung kommt es häufig nicht darauf an, alle Details eines Themas zu beherrschen, sondern ein übergreifendes Grundverständnis zu erhalten.
Aber auch Personen, die sich grundsätzlich für das Thema Controlling interessieren und täglich mit Controllern zu tun haben, können von der Lektüre des Buches profitieren. Schnittstellenmitarbeiter sollten in der Lage sein, die Arbeitsergebnisse des Controllings zu verstehen und zu nutzen. Darüber hinaus sind viele Mitarbeiter in Unternehmen auch außerhalb des Controllingbereichs mit Controllingaufgaben betraut und sollten diese korrekt ausführen können. Ein besseres Verständnis der Gesamtfunktion des Controllings hilft, einzelne kleine Aufgaben in einen größeren Zusammenhang einordnen zu können.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Das vorliegende Buch ist in fünf Teile gegliedert, die jeweils einen eigenständigen Schwerpunkt haben.
Der erste Teil dieses Buches widmet sich den absoluten Grundlagen des Controllings. In Kapitel 1 wird der Frage nachgegangen, was Controlling eigentlich ist, welche Aufgaben es erfüllt und wie der grundlegende Controllingprozess funktioniert. Kapitel 2 widmet sich dann der Organisation des Controllings im Unternehmen. Dabei wird auf die wichtige Unterscheidung zwischen zentralem und dezentralem Controlling eingegangen. Darüber hinaus werden wir das Controlling in der Aufbauorganisation eines Unternehmens verorten und verschiedene Möglichkeiten der organisatorischen Einbindung des Controllings beleuchten. In Kapitel 3 widmen wir uns dann der Unterscheidung zwischen strategischem und operativem Controlling. Sie werden erfahren, dass das strategische Controlling eher langfristig ausgerichtet ist, während das operative Controlling den Fokus auf das Tagesgeschäft im Unternehmen legt.
Im zweiten Teil des Buches werden wir uns dann intensiver mit dem Controllingprozess beschäftigen. Dazu werden wir uns in Kapitel 4 mit dem wichtigen Thema der Planung befassen. Wir werden lernen, dass Ziele die absolute Grundlage für die Planung in Unternehmen sind. Außerdem werden wir die Unterscheidung zwischen strategischer und operativer Planung kennenlernen und uns mit dem Planungsprozess und der Vorgehensweise bei der Erstellung von Plänen in Unternehmen beschäftigen. Eine detaillierte Diskussion der verschiedenen Teilpläne in Unternehmen wird das Verständnis für die wichtige Funktion der Planung im Unternehmen weiter vertiefen. In Kapitel 5 widmen wir uns dann dem wichtigen Thema der Kontrolle. Die Kontrolle ist eine der zentralen Aufgaben des Controllings und soll sicherstellen, dass die zuvor erstellten Pläne auch tatsächlich in die Realität umgesetzt werden. Eine der wichtigsten Diskussionen in diesem Kapitel ist daher die Erläuterung des sogenannten Soll-Ist-Vergleichs. Auf Basis der so identifizierten Planabweichungen kann dann eine Abweichungsanalyse durchgeführt werden, um die Ursachen dahinter zu identifizieren. Schließlich werden wir uns auch mit dem Ergreifen von Gegenmaßnahmen befassen, die dazu dienen sollen, im Falle von Abweichungen wieder zum ursprünglichen Plan zurückkehren zu können.
Der dritte Teil dieses Buches beschäftigt sich dann mit dem Thema der Informationsversorgung im Unternehmen. In Kapitel 6 werden wir uns daher einem der zentralsten Themen des Controllings überhaupt widmen: der Kosten- und Leistungsrechnung. Wir werden uns intensiv damit auseinandersetzen, wie sich die Kosten- und Leistungsrechnung von der Finanzbuchhaltung unterscheidet und was unter »Kosten« überhaupt zu verstehen ist. Anschließend lernen wir die drei zentralen Bereiche der Kostenrechnung kennen, nämlich die Kostenartenrechnung, die Kostenstellenrechnung und die Kostenträgerrechnung. Außerdem wird in diesem Kapitel auf die Unterscheidung zwischen Voll- und Teilkosten eingegangen. In Kapitel 7 beschäftigen wir uns mit Verrechnungspreisen: Wir gehen darauf ein, was Verrechnungspreise überhaupt sind und welche Aufgaben sie in großen Konzernen erfüllen. Außerdem werden wir die verschiedenen Methoden zur Ermittlung von Verrechnungspreisen diskutieren und uns mit den diversen Arten von Verrechnungspreisen auseinandersetzen. In Kapitel 8 werden wir uns dann mit Kennzahlen und Kennzahlensystemen beschäftigen. Wir werden diskutieren, was unter Kennzahlen überhaupt zu verstehen ist und welche Anforderungen an Kennzahlen und Kennzahlensysteme gestellt werden. Anschließend werden die wichtigsten Finanzkennzahlen, Renditekennzahlen und Leistungskennzahlen vorgestellt und erläutert. Abschließend gehen wir auf Kennzahlensysteme ein und stellen mit dem DuPont-System eines der bekanntesten Kennzahlensysteme vor.
Im vierten Teil dieses Buches beschäftigen wir uns dann mit den verschiedenen Instrumenten, auf die das Controlling zurückgreifen kann. Dazu werden wir uns in Kapitel 9 mit den strategischen Controllinginstrumenten beschäftigen, zu denen beispielsweise die bekannte SWOT-Analyse, die Portfolio-Analyse, die Balanced Scorecard, die Investitionsrechnung, das Target Costing, das Benchmarking und das strategisch orientierte Kostenmanagement gehören. Kapitel 10 beschäftigt sich dann mit den operativen Controllinginstrumenten. Dazu gehören verschiedene Ansätze zur Optimierung der Budgetierung, das Berichtswesen, die Deckungsbeitragsrechnung, die Break-even-Analyse, die ABC-Analyse, das System der Plankostenrechnung, die Prozesskostenrechnung und Make-or-Buy-Entscheidungen. In Kapitel 11 werden wir uns dann mit der Digitalisierung im Controlling beschäftigen. Wir werden das digitale Controlling kennenlernen und die verschiedenen Entwicklungen der Digitalisierung mit Auswirkungen auf das Controlling diskutieren. Darüber hinaus wird beleuchtet, welche Bedeutung das Thema Digitalisierung für das Controlling insgesamt hat.
Im fünften und letzten Teil dieses Buches werden wir uns mit dem Bereichscontrolling beschäftigen. Denn Controlling kann nicht nur mit Fokus auf das Gesamtunternehmen durchgeführt werden, sondern sich auch explizit auf einzelne Funktionen und Bereiche im Unternehmen konzentrieren. Dazu werden wir in Kapitel 12 das Beschaffungscontrolling näher kennenlernen und uns mit den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Portfolioanalyse im Einkauf, der Lieferantenbewertung, der ABC- und XYZ-Analyse, der Einkaufserfolgsrechnung sowie der Logistikkostenrechnung beschäftigen. Kapitel 13 wird uns dann das Thema Produktionscontrolling näherbringen. Hier werden wir uns mit der strategischen Sichtweise des Produktionscontrollings sowie der alternativen operativen Sichtweise befassen. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Thema Industrie 4.0. Im 14. Kapitel werden wir uns dann mit dem Thema Marketingcontrolling auseinandersetzen. Wir werden eine strategische Sichtweise des Marketingcontrollings kennenlernen und uns mit den wichtigen Themen Customer Lifetime Value und Absatzsegmentrechnung beschäftigen. In Kapitel 15 werden wir uns dann das IT-Controlling ansehen. Wir werden lernen, wie sich das Controlling auf den IT-Bereich eines Unternehmens konzentrieren kann. Dazu diskutieren wir den Einsatz von Portfolio-Analysen in der IT, analysieren den Einsatz der Balanced Scorecard mit Fokus auf die IT und besprechen den Einsatz der Kosten- und Leistungsrechnung für den IT-Bereich. Kapitel 16 widmet sich dann dem Thema Personalcontrolling. Wir werden erfahren, wie das Controlling die Arbeit des Personalbereichs unterstützen kann. Beispielsweise können auch im Personalbereich Portfolioanalysen durchgeführt werden, um Mitarbeiter und Personalressourcen gezielter steuern zu können. Darüber hinaus kann auch im Personalbereich eine eigenständige Balanced Scorecard eingeführt werden, um die Strategieumsetzung für diesen Bereich zu steuern.
Sie sehen also, wir haben hier eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Themen zu diskutieren. Dieses Buch ist vollgepackt mit einer umfassenden Diskussion aller aktuellen und relevanten Controllingthemen. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Buch hilft, den ersten Schritt zu einer intensiveren Beschäftigung mit diesem spannenden Thema zu gehen. Ich wünsche Ihnen viele Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse und viel Freude beim Lesen.
Christoph Hehemann
Poing im März 2025
Teil 1Controllinggrundlagen
1 Was ist Controlling?
2 Organisation des Controllings
3 Strategisches und operatives Controlling
Kapitel 1Was ist Controlling?
Controlling ist ein Begriff, den jeder von uns schon einmal gehört hat und von dem wir alle eine gewisse Vorstellung haben. Aber was ist Controlling genau? Gibt es eine eindeutige Definition? Welche Aufgaben nimmt Controlling in einem Unternehmen wahr? Und wie läuft die Arbeit des Controllings ab?
Genau um diese Fragen möchten wir uns in diesem einleitenden Kapitel kümmern. Es soll ein grobes Bild des Controllings entwerfen, in das wir nach und nach im Verlauf dieses Buches weitere Details einarbeiten werden. Am Ende haben wir dann ein solides Grundverständnis für Controlling.
1.1 Ein erstes Grundverständnis
Den Begriff Controlling zu definieren, fällt alles andere als leicht. Obwohl man sich seit Jahrzehnten mit diesem Konzept in Wissenschaft und Praxis beschäftigt, ist es bisher nicht gelungen, eine einheitliche Definition von Controlling zu erarbeiten, auf die man sich einigen könnte. Dennoch gibt es gewisse Überschneidungen und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Definitionsansätzen.
Controlling lässt sich relativ treffend mit dem Navigationssystem in einem Auto vergleichen. Das Navigationssystem hilft dem Autofahrer dabei, sich durch den Verkehr zu bewegen und das angestrebte Ziel seiner Reise zu erreichen. Controlling ist für ein Unternehmen sehr ähnlich.
Das Controlling in einem Unternehmen hilft dabei, ein Ziel zu erreichen, indem es dabei unterstützt, die verschiedenen großen und kleinen Herausforderungen »am Wegesrand« zu meistern. Bei einem »Stau« oder »Unfall« unterwegs hilft es dem Unternehmen dabei, eine »neue Route« einzuschlagen, die es ebenfalls zum gewünschten Ziel bringt.
Dabei geht es um viel mehr als nur um Kontrolle, womit der Begriff »Controlling« häufig fälschlicherweise übersetzt wird. Es geht um Steuerung, Analyse, Entscheidungsvorbereitung und noch viel mehr. Das Ziel des Controllings ist es, das Unternehmen möglichst effizient und wirtschaftlich an sein Ziel zu bringen. Mithilfe des Controllings kann die Unternehmensführung Entscheidungen mit einem größeren Maß an Sicherheit und Überzeugung treffen.
Controlling wird in vielen Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Gründen betrieben.
Ganz oben steht dabei die Zielerreichung des Unternehmens. Controlling hilft dabei, Ziele zu definieren und umsetzbar auszuarbeiten. Während der Umsetzung hilft das Controlling dabei, die Zielerreichung sicherzustellen und das Unternehmen auf dem richtigen Weg zu halten.
Im täglichen Geschäftsbetrieb verliert man sich schnell in Details und entscheidet aus dem Impuls heraus. Controlling hilft dabei, einen Schritt zurückzutreten und die vielfältigen Entscheidungen in einem Unternehmen aus einer Gesamtperspektive zu betrachten. Dabei unterstützt das Controlling dabei, mithilfe von fundierten Informationen bessere Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen werden nicht impulsiv aus dem Moment heraus getroffen, sondern sind eingebettet in ein Gesamtsystem, das auf die Zielerreichung ausgerichtet ist.
Alle Unternehmen haben mit dem Umstand zu kämpfen, dass ihre Möglichkeiten und Ressourcen endlich sind. Kein Unternehmen hat unendlich viel Geld, Arbeitskraft, verfügbare Materialien, kaufbereite Kunden oder Ideen. Unternehmerisches Handeln ist geprägt vom Umgang mit knappen Ressourcen. Erfolgreich sind vor allem die Unternehmen, denen es gelingt, die vorhandenen Ressourcen so einzusetzen, dass der größtmögliche Mehrwert für das Unternehmen und seine Stakeholder entsteht. Controlling hilft dabei, diese wertvolle Verwendung von knappen Ressourcen zu erreichen. Durch Berechnungsmodelle und die verschiedenen Controllingwerkzeuge soll erreicht werden, dass eine Ressource den größtmöglichen Mehrwert erzeugt und vor allem Verschwendung und Ineffizienzen auf ein Minimum reduziert werden.
In der heutigen Zeit stehen viele Unternehmen vor großen Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Globalisierung der letzten Jahrzehnte ergeben haben. Wettbewerb passiert inzwischen nicht mehr nur lokal und regional, sondern mindestens national, wenn nicht sogar in den allermeisten Branchen international. Nicht Verfügbarkeit von Dienstleistungen und Produkten bestimmt die Entscheidung von Kunden für oder gegen ein Unternehmen, sondern die Qualität der Angebote, deren Preise und weitere relevante Rahmenbedingungen. Das Unternehmen, welches das beste Gesamtangebot an den Markt bringen kann, hat deutliche Wettbewerbsvorteile gegenüber Unternehmen, die in diesen Aspekten nicht auf Augenhöhe mit ihrer Konkurrenz wirtschaften. Das Controlling hilft dabei, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen immer weiter zu steigern. Die Kosten eines Unternehmens werden laufend analysiert und auf mögliches Senkungspotenzial überprüft. Preise werden genau beobachtet und auf das Niveau gesetzt, welches das höchste Gesamtergebnis für das Unternehmen erzeugt. Strategien werden fortlaufend überwacht und bei Bedarf angepasst, um im konstanten Wettbewerb bestmöglich positioniert zu sein.
Den Kosten eines Unternehmens kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Denn der Bereich der Ausgaben eines Unternehmens kann deutlich stärker kontrolliert und beeinflusst werden als der Bereich der Umsätze und Einnahmen. Daher kommt der Kostenkontrolle und dem Kostenmanagement eine besondere Aufmerksamkeit im Controlling zu. Die verschiedenen Arten von Kosten im Unternehmen werden intensiv analysiert. Die Kosten von Abteilungen und Unternehmensbereichen stehen ständig auf dem Prüfstand und ihre Sinnhaftigkeit wird hinterfragt. Die Kosten von Produkten und Dienstleistungen stehen unter ständiger Beobachtung und man versucht, das bestmögliche Angebot zu den geringstmöglichen Kosten auf die Beine zu stellen. Das enge Kostenmanagement zielt darauf ab, die geringstmöglichen Kosten bei dem höchstmöglichen Ergebnis zu erreichen und somit die Rentabilität des Unternehmens zu steigern.
Ein weiterer Grund, aus dem Unternehmen Controlling betreiben, betrifft die Liquiditätssicherung. Unternehmen müssen zu jeder Zeit in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen vollständig und zum richtigen Zeitpunkt nachkommen zu können. Das Finanzcontrolling übernimmt daher die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen des Unternehmens zu überwachen und zu planen. Dabei soll vor allem kurzfristig sichergestellt werden, dass es zu keinen Zahlungsengpässen kommt und die Anforderung der jederzeitigen Zahlungsbereitschaft erhalten bleibt. Langfristig soll das Unternehmen so in die Lage versetzt werden, über ausreichende Liquidität zu verfügen, um Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit und in Wachstum tätigen zu können.
In großen Unternehmen werden Aufgaben immer mehr und mehr verteilt und unabhängig voneinander durchgeführt. Hier ist vor allem Koordination gefragt, damit alle Bereiche an einem Strang ziehen und sämtliche Aktivitäten auf das definierte Unternehmensziel ausgerichtet werden. Controlling übernimmt hier eine zentrale Aufgabe der Koordination und Steuerung. Die Ausrichtung sämtlicher Tätigkeiten auf das gewünschte Ziel und eine effiziente Zusammenarbeit sollen mit dem Controlling des Unternehmens erreicht werden.
1.2 Controlling, Controller, Controllership
Nachdem wir uns ein Grundverständnis von Controlling erarbeitet haben, kümmern wir uns um einige zentrale Begrifflichkeiten. Insbesondere die Begriffe Controlling, Controller und Controllership sollten voneinander abgegrenzt werden. Das hilft dabei, das Verständnis für Controlling zu verbessern und verdeutlicht erneut, warum einheitliche Definitionen des Begriffs so schwerfallen.
1.2.1 Controlling
Spricht man von Controlling, so ist damit vor allem die Funktion im Unternehmen gemeint. Controlling ist eine funktionale Aufgabe, die ähnlich dem Einkauf oder der Produktion übergreifende und unterstützende Aufgaben übernimmt.
Die Controllingfunktion kann dabei vor allem dem Management zugeordnet werden. Denn sie hilft dem Management dabei, die Unternehmensziele zu erreichen.
Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass Controlling in einem sich ständig wiederholenden Prozess abläuft. In sämtlichen Bereichen, in denen Controlling eingesetzt wird, lässt sich der Prozess als eine Abfolge von Planung, Steuerung, Kontrolle und Gegensteuern verstehen.
1.2.2 Controller
Mit dem Begriff des Controllers ist vor allem die Rolle im Unternehmen gemeint. Die Person, welche Controllingaufgaben ausführt, wird als Controller bezeichnet. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Controller nicht zwangsläufig im Controllingbereich eines Unternehmens anzusiedeln sind. Jede Person im Unternehmen, welche Controllingaufgaben durchführt, kann in dieser Rolle als Controller bezeichnet werden. Es ist auch nicht erforderlich, dass diese Personen ausschließlich Controllingaufgaben wahrnehmen. Der Controllinganteil an den Gesamtaufgaben des Mitarbeiters kann auch eine untergeordnete Rolle spielen. So ist es in vielen Unternehmen üblich, dass Führungskräfte in der Produktion sehr häufig Controllingaufgaben für die Überwachung ihrer Fertigungssysteme wahrnehmen und im Rahmen dieser Aufgaben die Rolle eines Controllers übernehmen.
Ganz gleich, wo ein Controller im Unternehmen eingesetzt wird, kann man ihn als einen internen Berater ansehen, der das Management berät und unterstützt. Analysen und Empfehlungen spielen bei dieser Beraterrolle eine große Rolle.
Um die Controllerrolle ausfüllen zu können, ist eine Vielzahl an verschiedenen Kompetenzen erforderlich, was die Komplexität der Rolle noch einmal unterstreicht. Neben spezifischen fachlichen Kenntnissen sind vor allem Kenntnisse im Bereich der Finanzbuchhaltung, Planung, Entscheidungsfindung und des Reportings hilfreich, um die Rolle des Controllers angemessen ausfüllen zu können.
Controllerrollen
Die Rolle des Controllers lässt sich außerdem in verschiedene Unterrollen aufgliedern, welche die diversen Aspekte der Aufgabe verdeutlichen.
Als »Steward« und »Wächter« eines Unternehmens obliegt es dem Controller vor allem, die Vermögenswerte des Unternehmens zu erhalten und nach Möglichkeit weiter zu steigern. Durch den Einsatz von Controlling soll erreicht werden, dass die Substanz des Unternehmens erhalten bleibt und auch in der Zukunft bestmöglich eingesetzt werden kann.
Als »Operator« sorgen Controller dafür, dass das Unternehmen sich immer weiter verbessert. Neue Fähigkeiten sollen im Unternehmen entstehen, die bestehende Angebote optimieren oder die Möglichkeiten für neue Angebote eröffnen. Kosten sollen auf das niedrigste mögliche Niveau gesenkt werden, während gleichzeitig das Serviceniveau weiter gesteigert wird.
Als »Catalyst« sorgen Controller dafür, dass neue strategische Initiativen auf den Weg gebracht werden und erfolgreich zur Umsetzung kommen. Controller sorgen dafür, dass aus guten Ideen real existierende Angebote, gesteigerte Marktanteile, erfolgreiche Marketingkampagnen oder effizientere Produktionsabläufe werden.
Als »Strategist« arbeiten Controller eng mit dem Management zusammen und entwickeln übergreifende Visionen und Strategien für die Zukunft des Unternehmens. Bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie sind Controller maßgeblich durch hilfreiche Analysen und Beratung beteiligt und tragen einen erheblichen Anteil an der Strategieentwicklung des Unternehmens.
Die Controllerrolle hat dabei im Laufe der Jahrzehnte eine beeindruckende Entwicklung genommen. So waren die ersten Controller anfangs in Unternehmen reine Zahlenexperten, die sich ausschließlich auf die Finanzdaten des Unternehmens konzentriert haben, um so Probleme zu identifizieren. Im Laufe der Zeit wurde das Aufgabengebiet der Controller immer weiter ausgeweitet und der Controller kann heute als ein interner strategischer Berater angesehen werden, der theoretisch in jedem Bereich des Unternehmens eingesetzt werden kann, um die Leistungsfähigkeit zu steigern und neue Erfolgspotenziale zu eröffnen.
1.2.3 Controllership
Zu guter Letzt wird unter Controllership die Gesamtheit aller Controllingaufgaben verstanden. Dabei ist es nicht entscheidend, ob diese Aufgaben in der Controllingabteilung des Unternehmens wahrgenommen werden oder in anderen Bereichen stattfinden. Wie bereits bei der Controllerrolle angesprochen, übernehmen auch Personen außerhalb der Controllingabteilung in den meisten Unternehmen Controllingaufgaben.
1.3 Aufgaben des Controllings
Was aber genau sind die Controllingaufgaben, die von Controllern in der Controllingabteilung, aber auch in anderen Bereichen eines Unternehmens durchgeführt werden? Es lassen sich hier vor allem sieben Hauptaufgaben definieren:
PlanungSteuerungKoordinationKontrolleInformationsversorgungBeratungRisikoanalyseSehen wir uns diese Aufgaben des Controllings einmal der Reihe nach an. Später im Buch werden wir noch wesentlich detaillierter auf diese Aufgaben eingehen und verschiedene Instrumente kennenlernen, mit denen sie wahrgenommen werden.
1.3.1 Planung
Eine der elementarsten Aufgaben des Controllings betrifft die Planung. In einem Unternehmen werden eine Vielzahl unterschiedlichster Pläne entwickelt. Das reicht von einem Gesamtplan, der sich auf das ganze Unternehmen bezieht, bis hin zu Teilplänen, die nur bestimmte Bereiche des Unternehmens in den Fokus nehmen.
Allen Plänen ist gemein, dass sie darauf ausgerichtet sind, das Unternehmensziel zu unterstützen. Mithilfe von Plänen soll durchdacht werden, welche Ergebnisse, Zwischenziele und Aufgaben erledigt und erreicht werden müssen, damit das große Unternehmensziel Wirklichkeit wird.
Um die Planung so hilfreich wie nur möglich zu gestalten, werden Pläne üblicherweise für verschiedene zeitliche Horizonte entwickelt. Sehr langfristige Pläne sind darauf ausgerichtet, übergreifende Vorhaben im Blick zu behalten und darauf hinzuarbeiten. Üblicherweise beziehen sich die langfristigen Pläne auf einen Zeithorizont von fünf oder mehr Jahren.
Daneben sind mittelfristige Pläne eher für einen Zeitraum von einem bis fünf Jahren gedacht. Hier versucht ein Unternehmen, die langfristigen Vorhaben weiter herunterzubrechen und die Ergebnisse für die kommenden fünf Jahre zu definieren, welche erreicht werden müssen, um die langfristigen Ziele zu erreichen.
Kurzfristige Pläne werden wiederum meist nur für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr angelegt. Hierbei geht es dann um konkrete Umsetzungsvorhaben, Aufgaben und gezielte Projekte. Was konkret muss das Unternehmen umsetzen, um die mittel- und langfristigen Pläne verwirklichen zu können?
Mithilfe dieser zeitlichen Staffelung ist es möglich, langfristige Vorhaben so weit herunterzubrechen, dass selbst im Tagesgeschäft klar ist, was auf täglicher Basis zu erledigen ist, um die langfristigen Ziele des Unternehmens erreichen zu können. Über die zeitliche Staffelung der Pläne können große Vorhaben handhabbar gestaltet werden und die operative Umsetzung wird vereinfacht.
Sehr häufig lassen sich die zeitlich verschieden gestaffelten Pläne mit den Begriffen strategisch, taktisch und operativ kombinieren.
Strategische Pläne sind meist sehr langfristig orientiert und zielen darauf ab, das Unternehmen auf lange Sicht in eine gute Wettbewerbsposition zu bringen. Häufig gehen damit größere Vorhaben einher, wie die Entwicklung eines neuen Angebotsprogramms, die Etablierung neuer Vertriebskanäle oder das Entwickeln neuer Wettbewerbspotenziale.
Taktische Pläne sind hingegen meist mittelfristig orientiert. Hier werden die häufig eher abstrakten strategischen Vorhaben in konkrete Ergebnisse und Projekte übersetzt. Es geht dabei um die Beantwortung der Frage, was das Unternehmen konkret erreichen muss, damit die entwickelte Strategie Wirklichkeit wird.
Bei der operativen Planung konzentriert man sich dann auf die Umsetzungsarbeit auf kurze Sicht. Es geht hierbei um konkrete Aufgaben, Projektpläne und die tägliche Arbeit im Unternehmen.
Wir werden uns noch deutlich detaillierter mit der Planung in Kapitel 4 beschäftigen.
1.3.2 Steuerung
Die Aufgabe der Steuerung bezieht sich vor allem auf die Zielerreichung. Controlling hilft der Unternehmensführung dabei, dass alle definierten Aufgaben und Projekte umgesetzt werden. Dazu gehört es, geplante Projekte zu initiieren, Ressourcen zusammenzuziehen und die Umsetzung zu begleiten. Steuernde Aufgaben unterstützen dabei, dass die gesetzte Unternehmensstrategie Wirklichkeit wird.
1.3.3 Koordination
Der Aufgabe der Koordination kommt vor allem in größeren Unternehmen eine besondere Bedeutung zu. Es soll sichergestellt werden, dass sämtliche Aktivitäten in Abteilungen, Prozessen und Funktionen untereinander abgestimmt sind und auf das gleiche Ziel ausgerichtet werden. Sehr häufig passiert es, dass Aktivitäten einander behindern oder gegeneinanderlaufen. Koordination soll verhindern, dass gegenläufige Aktivitäten die Erreichung der Unternehmensziele gefährden.
1.3.4 Kontrolle
Die Kontrolle ist eine originäre Controllingaufgabe. Im Kern geht es dabei darum, einen geplanten Zustand mit dem erreichten zu vergleichen. Man spricht auch häufig von einem Soll-Ist-Vergleich. Das geplante Soll wird mit dem erreichten Ist verglichen. In den seltensten Fällen wird exakt das geplante Soll erreicht. Meist weicht das erreichte Ist positiv oder negativ vom geplanten Soll ab. Für das Controlling ist bei Abweichungen daher besonders interessant, woher diese Abweichungen rühren. Es geht bei der Kontrolle also auch darum, die Ursachen hinter Abweichungen zu identifizieren und zu analysieren. Das hilft dabei, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um so doch noch das geplante Ziel zu erreichen. Außerdem können Erkenntnisse zu Abweichungen dafür genutzt werden, um in Zukunft bessere Pläne zu entwickeln, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch Wirklichkeit werden zu können. Wir werden uns in Kapitel 5 noch intensiver mit der Kontrolle auseinandersetzen.
1.3.5 Informationsversorgung
Eine Kernaufgabe des Controllings ist es, alle Bereiche des Unternehmens mit entscheidungsrelevanten Informationen zu versorgen. Insbesondere das Management ist angewiesen auf umfassende Informationen in hoher Qualität, um belastbare Entscheidungen treffen zu können. Nur durch fundierte Informationen lassen sich mit hoher Gewissheit Entscheidungen treffen, welche den Erfolg des Unternehmens beeinflussen.
Das Controlling hat daher die Aufgabe, sämtliche benötigten Daten zu sammeln, zu aggregieren, zu analysieren und zu entscheidungsrelevanten Informationen aufzubereiten.
Dabei geht es ganz bewusst nicht nur um rein finanzielle Daten. Auch nicht-finanzielle Informationen sind in der heutigen Zeit erfolgsentscheidend und können den nötigen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz bedeuten.
1.3.6 Beratung
In der jüngeren Zeit hat sich die Beratung zu einer wichtigen Controllingaufgabe entwickelt. Controller sind heute nicht mehr nur reine Zahlenexperten, sondern nehmen mehr und mehr auch wichtige strategische Aufgaben wahr. Bei der Aufgabe der Beratung geht es darum, das Management in seiner Führungsaufgabe zu unterstützen. Betriebswirtschaftliche Analysen helfen dabei, Handlungsoptionen zu verstehen und gegeneinander einzuordnen. Durch Analysen soll das Controlling Entscheidungsgrundlagen erarbeiten. Auf Analysen gestützte Handlungsempfehlungen zeigen dem Management verschiedene Handlungsoptionen auf und helfen dabei, der Komplexität Herr zu werden und trotz Unsicherheit größtenteils gute Entscheidungen zu treffen. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass das Controlling hier nicht die Entscheidungen selbst trifft, sondern die Verantwortung nach wie vor beim Management liegt. Durch vorbereitende Arbeit hat das Controlling dennoch einen erheblichen Einfluss auf Entscheidungssituationen und sollte daher mit entsprechender Sorgfalt in Analyse und Interpretation vorgehen, um das bestmögliche Ergebnis für das Unternehmen zu erreichen.
1.3.7 Risikoanalyse
Beim Controlling geht es nicht nur darum, sich mit dem Status quo und beabsichtigten Plänen zu beschäftigen. Es geht auch darum, das Erreichte abzusichern und negative Entwicklungen in der Zukunft zu vermeiden. Daher kommt auch der Aufgabe der Risikoanalyse eine besondere Bedeutung zu.
Zunächst muss sehr breit geschaut werden, um alle erdenklichen möglichen Risiken für das Unternehmen identifizieren zu können.
Sind sämtliche potenziellen Risiken identifiziert, müssen diese analysiert und bewertet werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Risiko eintritt? Und welche Auswirkungen kann ein Risiko bei Eintritt auf das Unternehmen entfalten? Es soll ein tiefes Verständnis für die möglichen Risiken entwickelt werden, um diesen bestmöglich begegnen zu können.
Nachdem die Risiken verstanden wurden, müssen Gegenmaßnahmen entwickelt werden, um den negativen Einfluss auf das Unternehmen möglichst gering zu halten oder gar ganz zu vermeiden.
Somit hilft die Risikoanalyse dabei, die langfristige Stabilität des Unternehmens zu sichern.
1.4 Controllingprozess
Abb. 1.1: Controllingprozess
Ganz unabhängig von der inhaltlichen Zielsetzung und dem zu betreuenden Bereich kann das Controlling im Sinne eines sich ständig wiederholenden zirkulären Prozesses beschrieben werden. Dabei greifen Planung, Umsetzung, Kontrolle und das Ergreifen von Gegenmaßnahmen ineinander und sorgen so dafür, dass mithilfe des Einsatzes von Controlling das bestmögliche Ergebnis für das Unternehmen erreicht wird.
Der Prozess beginnt mit der Aufgabe der Planung. Dabei werden strategische, taktische und operative Ziele in lang-, mittel- und kurzfristigen Plänen ausgearbeitet. Wir werden uns noch detailliert mit der Planung in Kapitel 4 beschäftigen.
Nachdem die Pläne ausgearbeitet sind, kann es an die Umsetzung gehen. Controlling unterstützt dabei durch Steuerung und Koordination, um zu erreichen, dass sämtliche Aktivitäten im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind, sich nicht gegenseitig behindern und alle auf die Erreichung der gesetzten Ziele hinarbeiten.
Treten die ersten Ergebnisse ein, so greift der Prozessschritt der Kontrolle. Hier werden die erreichten Ergebnisse mit den aufgestellten Plänen verglichen. Sollten die Ergebnisse vom Plan abweichen, müssen weitere Schritte unternommen werden. Abweichungen können sowohl positiv als auch negativ sein.
Insbesondere bei negativen Abweichungen muss eine detaillierte Analyse stattfinden. Deren Ziel sollte es sein, die Hauptursachen für die Abweichungen zu identifizieren. Kennt man die Ursachen der Abweichungen, kann dann entschieden werden, wie man damit umgeht.
Meist wird das Unternehmen versuchen, die ursprünglich gesetzten Ziele doch noch zu erreichen. Geeignete Gegenmaßnahmen müssen daher entwickelt werden, um das Unternehmen auf seinen ursprünglichen Pfad zu den gesetzten Zielen zu führen. Nicht immer wird das möglich sein und Unternehmen können es allenfalls schaffen, durch konkrete Maßnahmen die Abweichung zu minimieren. In einigen Fällen wird aber selbst das nicht möglich sein, und so ist es Aufgabe des Controllings, zusammen mit dem Management zu entscheiden, ob die ursprünglich entwickelten Ziele und die darüberstehende Strategie einer Überarbeitung bedürfen.
Dieser Controllingkernprozess wird begleitet durch gezielte flankierende Informationen. An allen Stellen des Prozesses ist es hilfreich, auf aktuelle und hochqualitative Daten Zugriff zu haben, um ein möglichst exaktes Bild der Situation zu erhalten. Nur so sind Management und Controlling in der Lage, fundierte Entscheidungen treffen zu können, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken.
Der Controllingprozess wird ebenfalls begleitet durch kontinuierliches Lernen und Verbesserung. Aus den Abweichungsanalysen können Erkenntnisse gewonnen werden, die zukünftige Prozessschleifen verbessern und zu realistischeren Plänen und damit zu einer höheren Zielerreichung führen können. Es ist also immer von Bedeutung, die Erkenntnisse, die gewonnen werden, für das Unternehmen langfristig nutzbar zu machen und darauf basierend alle Werkzeuge, Prozesse, Strategien und Taktiken immer weiter zu optimieren.
Die Kernaussagen des Kapitels
Controlling ist eine Unterstützungsfunktion des Managements, die hilft, definierte Ziele zu erreichen.Dabei zielt Controlling darauf ab, bessere Entscheidungen zu treffen, knappe Ressourcen möglichst wertschöpfend einzusetzen, Wettbewerbsvorteile zu sichern und auszubauen, Kosten zu minimieren, Liquidität zu sichern und alle Aktivitäten im Unternehmen auf das gleiche Ziel auszurichten.Dabei bezeichnet Controlling die betriebliche Funktion im Unternehmen, Controller die Rolle, die Controllingaufgaben wahrnimmt, und Controllership die Gesamtheit aller Controllingaufgaben im Unternehmen.Die wichtigsten Controllingaufgaben sind Planung, Steuerung, Koordination, Kontrolle, Informationsversorgung, Beratung und Risikoanalyse.Controlling findet in einem zirkulären Prozess statt, der aus den Phasen Planung, Umsetzung und Kontrolle besteht und von einer kontinuierlichen Informationsversorgung begleitet wird.Kapitel 2Organisation des Controllings
Nachdem wir uns im vorangegangenen Kapitel ein Grundverständnis für das Controlling erarbeitet haben, sollten wir uns nun der organisatorischen Aufhängung der Controllingfunktion in Unternehmen widmen. Dabei kann grundsätzlich zwischen zentralem und dezentralem Controlling unterschieden werden. Nachdem diese grundsätzliche Unterscheidung des Controllings geklärt wurde, können wir uns dann der Einbindung des Controllings in die Aufbauorganisation eines Unternehmens zuwenden.
2.1 Zentrales Controlling
Beim zentralen Controlling werden die Controllingaufgaben primär von einer zentralen Stelle des Unternehmens aus für alle Bereiche und Abteilungen wahrgenommen. Sehr häufig ist die Controllingfunktion sehr eng an das Topmanagement des Unternehmens gebunden. Das bringt es mit sich, dass so ein hoher Grad an Kontrolle über die verschiedenen Tätigkeiten im Unternehmen ausgeübt werden kann. Sämtliche wichtigen Entscheidungen liegen so in der Hand der obersten Führung.
Der große Vorteil von zentralem Controlling ist, dass sämtliche strategischen Entscheidungen an zentraler Stelle getroffen werden und daher ein hohes Maß an Verbindlichkeit für die strategische Richtung des Unternehmens erzielt werden kann. Es entsteht eine durchweg konsistente Steuerung im Unternehmen, die einheitlich auf die gleiche Unternehmensstrategie ausgerichtet werden kann.
Darüber hinaus kann durch ein zentrales Controlling eine höhere Effizienz erreicht werden. An zentraler Stelle existiert ein detailliertes Verständnis für die Kostensituation des gesamten Unternehmens und unnötige Redundanzen können weitestgehend vermieden werden. Es lässt sich über ein zentrales Controlling eine stärkere Kostenkontrolle im Unternehmen etablieren.
Allerdings bedeutet die zentrale Wahrnehmung von Controllingaufgaben auch einen hohen Abstimmungsaufwand im Unternehmen. Informationen müssen erst aufwendig im gesamten Unternehmen eingeholt werden, um dann an zentraler Stelle verdichtet, analysiert und aufbereitet zu werden. Dies führt zwangsläufig zu längeren Entscheidungsfristen und kann Unternehmen gerade in agilen und wettbewerbsintensiven Märkten schnell lähmen und ausbremsen.
Darüber hinaus ergibt sich gerade bei breit aufgestellten Unternehmen mit zahlreichen verschiedenen Geschäftsmodellen eine starre Struktur. In sehr unterschiedlichen Märkten ist es allerdings erforderlich, auf die spezifischen Anforderungen der Märkte und Regionen eingehen zu können. Dieses Maß an hoher Flexibilität kann unter Umständen nur schwer mit einem rein zentralen Controlling erreicht werden.
2.2 Dezentrales Controlling
Das Gegenstück zum zentralen Controlling stellt das dezentrale Controlling dar. Hier werden die Controllingaufgaben an den Orten im Unternehmen wahrgenommen, auf die sie sich beziehen. Insbesondere bei großen Unternehmen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle kann ein dezentrales Controlling seine Stärken voll ausspielen.
So ist es beispielsweise durch dezentrales Controlling möglich, sehr schnell auf Änderungen in lokalen Märkten oder bestimmten Regionen reagieren zu können. Das dezentrale Controlling ist nah am Ort des Geschehens und hat ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse vor Ort.
Somit können auch ganz spezifische Herausforderungen in bestimmten Regionen oder Märkten mitberücksichtigt werden, die bei zentraler Steuerung eher eine untergeordnete Bedeutung einnehmen und daher nicht vollumfänglich in die Entscheidungsfindung einfließen würden.
Darüber hinaus wird bei einem dezentralen Controlling auch der Vorteil erreicht, dass die Controller meist fachspezifische Expertise besitzen, die sich zum Beispiel auf den Geschäftsbereich bezieht, den die Controller betreuen. Somit kann der lokale Controller mit dem lokalen Management auf Augenhöhe sprechen und dabei die Besonderheiten des Geschäfts mit in seine Analysen und Beratungen einfließen lassen.
Ein dezentrales Controlling bietet also den Vorteil der besseren Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Bedürfnisse der betreuten Bereiche.
Das bringt gleichzeitig eine deutlich höhere Motivation beim Controller mit sich. Er hat mehr Entscheidungsspielraum als ein zentraler Controller, um in der Lage zu sein, den spezifischen Bedürfnissen begegnen zu können. Gleichzeitig trägt das dezentrale Controlling auch viel mehr Verantwortung für die Ergebnisse und den Erfolg der betreuten Bereiche. Man sitzt mit dem jeweiligen Management im selben Boot und hat großen Anteil an den erzielten Ergebnissen.
Allerdings bietet ein dezentrales Controlling nicht nur Vorteile. So ist die übergreifende Kontrolle des Gesamtunternehmens mit dezentralen Controllingeinheiten deutlich erschwert. Die Bedürfnisse der verschiedenen Unternehmensbereiche können zwar perfekt abgebildet werden, müssen aber nicht zwangsläufig zu einem idealen übergreifenden Bild zusammenfinden.
Es besteht die große Gefahr, dass unterschiedliche Strategien in Teilen der Organisation verfolgt werden, die nicht kompatibel zur Gesamtstrategie sind oder sogar gegenläufig zu anderen Strategien im Unternehmen sind. Daraus ergibt sich ein deutlich höherer Koordinationsaufwand im Vergleich zum zentralen Controlling, um sicherzustellen, dass sämtliche Bereiche an einem Strang ziehen und auf die gleichen Unternehmensziele ausgerichtet sind.
Dezentrales Controlling geht außerdem einher mit einer verringerten Effizienz im Unternehmen. Funktionen werden in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens mehrfach ausgeführt und Redundanzen ergeben sich. Diese kostentechnischen Nachteile sollten bewusst über verbesserte Ergebnisse in Kauf genommen werden, damit sich dezentrale Controllingeinheiten auch gesamthaft lohnen.
2.3 Kriterien zur Entscheidung zwischen zentralem und dezentralem Controlling
Welche Organisationsform des Controllings ist aber nun die richtige? Sollte sich ein Unternehmen eher für ein zentrales Controlling entscheiden, um kostengünstig ein höheres Maß an Zielausrichtung zu erreichen? Oder ist es besser, ein dezentrales Controlling mit erhöhtem Aufwand, aber dafür deutlich flexibleren Lösungen für einzelne Bereiche zu wählen?
Die Antwort auf diese Frage fällt in der Praxis tatsächlich nicht leicht und ist keineswegs eindeutig zu beantworten. Vielmehr gilt hier, genau abzuwägen, welche Bedürfnisse für ein Unternehmen besonders wichtig sind und welche Herangehensweise an das Controlling dafür am besten geeignet ist.
Insbesondere drei Kriterien helfen, um die Entscheidung zwischen zentralem und dezentralem Controlling fundierter treffen zu können:
Zunächst einmal spielt vor allem die Größe des Unternehmens eine wichtige Rolle. Je größer ein Unternehmen ist und je verteilter dadurch seine Aktivitäten sind, umso eher kommt ein dezentrales Controlling infrage. Dezentrale Organisation erfordert eine gewisse Größe, um überhaupt sinnvoll die Vorteile ausspielen zu können. Bei kleinen mittelständischen Unternehmen ist die Organisation nicht so komplex, als dass es unbedingt dezentraler Controller bedarf, um den jeweiligen Anforderungen einzelner Funktionen und Bereiche gerecht werden zu können. Allerdings kann bei einem sehr großen Unternehmen mit vielen Produktionsstätten und international verbreiteten Vertriebsaktivitäten der Aufbau dezentraler Controllingeinheiten sehr sinnvoll sein, um die spezifischen Anforderungen lokaler Bereiche mitberücksichtigen zu können und um insgesamt schnellere und individuellere Entscheidungen zu treffen.
Darüber hinaus spielt es ebenfalls eine große Rolle, wie stark ein Unternehmen strategisch geprägt ist. Je stärker ein Unternehmen seine Tätigkeiten von einer übergreifenden Gesamtstrategie ableitet und gezielt seine Entwicklung in eine bestimmte Richtung vorantreiben möchte, umso mehr ergibt vor allem ein zentrales Controlling Sinn. Je stärker die strategische Ausrichtung ist, umso stärker muss auch deren Umsetzung von zentraler Stelle aus gesteuert und koordiniert werden. Dezentrale Einheiten laufen einer solch starken strategischen Ausrichtung zuwider und können nur mit einem erheblichen Koordinationsaufwand auf eine Linie gebracht werden.
Zu guter Letzt spielt auch die Komplexität des Geschäftsmodells eine entscheidende Rolle. Wenn ein Unternehmen auf vielen unterschiedlichen Märkten aktiv ist und ein sehr breites und diverses Leistungsangebot erstellt, wird eine dezentrale Unterstützung der verschiedenen Einheiten hilfreich sein, um der hohen Komplexität begegnen zu können. Aber auch bei einem einzigen Geschäftsmodell kann sich durch die Vielzahl an Tätigkeiten die Notwendigkeit eines dezentralen Controllings ergeben. Sind auf allen Kontinenten der Erde Produktionsstätten angesiedelt und werden die Leistungen auf regional stark unterschiedlichen Märkten angeboten, kann eine Spezialisierung des Controllings in dezentraler Form angebracht sein, um lokalen Erfordernissen besser begegnen zu können.
In Summe lässt sich also festhalten, dass die Wahl zwischen zentralem und dezentralem Controlling nicht eindeutig zu treffen ist. Vielmehr muss ganz individuell betrachtet werden, was das jeweilige Unternehmen benötigt, um mithilfe von Controlling bestmöglich gesteuert und koordiniert zu werden.
2.4 Controlling in der Aufbauorganisation
Unternehmen sind häufig sehr unterschiedlich organisatorisch aufgebaut. Je nach gewählter Organisationsform kann es sinnvoll sein, die Funktion des Controllings anders aufzuhängen. Grundsätzlich kann man zwischen der funktionalen und der divisionalen Organisation bei Unternehmen unterscheiden.
2.4.1 Controlling in der funktionalen Organisation
Bei einer funktionalen Organisationsform wird das Unternehmen anhand der verschiedenen betrieblichen Funktionen organisiert. Es gibt beispielsweise eine Entwicklungsabteilung, eine Produktion, eine Personalabteilung und eine Finanzabteilung.
Abb. 2.1: Controlling in der funktionalen Organisation
Bei einer solchen Organisationsform ist es meist angebracht, die Controllingfunktion an zentraler Stelle einzurichten. So kommt es häufig vor, dass die Controllingabteilung direkt der Geschäftsführung untergeordnet ist und somit zu dieser auch eine große Nähe aufweist. Alternativ findet sich bei funktionaler Organisation die Controllingabteilung im Finanzbereich wieder.
Eine solch zentrale Aufhängung bringt ein hohes Maß an Kontrolle für die Geschäftsführung mit sich. Entwicklungen im Unternehmen können genau beobachtet werden und eine gesamthafte Steuerung und Koordination der Aktivitäten fällt so deutlich leichter.
Allerdings kann es für ein so aufgehängtes Controlling schwierig sein, bei anderen Funktionen direkt durchzugreifen. Man muss sich kontinuierlich der Macht der Geschäftsführung bedienen, um auch im gesamten Unternehmen steuernd und koordinierend einwirken zu können.
Bei Aufhängung des Controllings im Bereich der Finanzorganisation besteht zudem die Gefahr, dass der Fokus auf rein finanzielle Steuerungsinformationen gelegt wird und so die Potenziale einer umfassenderen Informationsnutzung nicht ausreichend genutzt werden. Gerade strategische Komponenten im Aufgabengebiet des Controllings können unter einer derartigen organisatorischen Aufhängung leiden.
2.4.2 Controlling in der divisionalen Organisation
Abb. 2.2: Controlling in der divisionalen Organisation
Eine divisionale Organisation findet sich vor allem bei sehr großen Unternehmen und Konzernen wieder. Bei Unternehmen wie beispielsweise Siemens ist das Leistungsangebot so unterschiedlich, dass einzelne Segmente/Divisionen wie eigenständige Unternehmen im Konzern geführt werden. Gerade wenn die verschiedenen Geschäfte nichts miteinander gemein haben, kann eine autonome Führung der Divisionen sinnvoll sein.
In einer solchen Organisationsform wird zunächst nach Divisionen unterteilt und innerhalb der Division finden sich dann wiederum die einzelnen betrieblichen Funktionen der Division wieder. Jede Division hat also eine eigene Personalabteilung, eine eigene Finanzabteilung und auch ein eigenes Controlling.
Der Vorteil der Aufhängung des Controllings innerhalb der Division ist die größere Nähe zu den spezifischen Bedürfnissen des Geschäfts. Das Ergebnis ist eine deutlich höhere Akzeptanz des Controllings und der damit einhergehenden Entscheidungsunterstützung und Beratung.
Allerdings ergibt sich so auch die Notwendigkeit einer höheren Koordination auf Ebene des gesamten Konzerns. Daher findet man häufig in solchen Organisationsformen dezentrale Controllingabteilungen in den einzelnen Divisionen, die sich ausschließlich um die spezifischen Bedürfnisse der Segmente kümmern. Darüber steht auf der Ebene des Konzerns ein übergreifendes Konzerncontrolling, das vor allem eine koordinierende Aufgabe wahrnimmt und dafür sorgt, dass die Segmentstrategien und eine übergreifende Konzernstrategie in die gleiche Richtung gehen und sich nicht gegenseitig behindern.
Controlling im Shared Service Center
In jüngeren Jahren haben Unternehmen verstärkte Anstrengungen unternommen, um die Kosten ihrer zentralen Stellen zu senken und mögliche Effizienzen zu heben.
Ein Trend, der dabei eine Rolle spielt, ist die Verwendung von Shared Service Centern. Dabei werden bestimmte Dienstleistungen gebündelt und von einer eigenständigen Organisation wahrgenommen und an zentraler Stelle durchgeführt. So ist es in großen Unternehmen üblich, dass Teile der Buchhaltung von Shared Service Centern insbesondere in Niedriglohnländern wahrgenommen werden. Über eine Bündelung der Aufgaben an einem Ort verspricht man sich ein höheres Maß an Standardisierung und damit geringere Kosten sowie eine Erhöhung der Qualität der Dienstleistungen insgesamt.
Von diesem Trend kann sich auch das Controlling nicht ausnehmen. Vor allem die repetitiven Aufgaben wie das Berichtswesen oder die Kosten- und Leistungsrechnung (siehe Kapitel 6) werden oft über Shared Service Center erbracht.
Mit dem Trend hin zu Shared Service Centern eng verbunden ist auch das Outsourcing, bei dem man bestimmte Dienstleistungen nicht nur von eigenen (internen) Einheiten zentral erbringen lässt, sondern sogar an externe Partner übergibt. Hier möchte man sich der Aufgaben entledigen, die nicht zur eigenen Kernkompetenz gehören, und man verspricht sich auch so Kosteneinsparungen, da ein spezialisierter externer Dienstleister Services effizienter und daher zu günstigeren Konditionen anbieten kann.
Es empfiehlt sich für das Controlling allerdings, hier – wenn überhaupt – nur Teile der Aufgaben an externe Einheiten auszulagern. Die im Controlling verarbeiteten Daten sind meist von sensibler Natur und können einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen. Derartige Informationen gibt man nicht aus den eigenen Händen und verlässt sich auf einen externen Partner, den man nie vollständig kontrollieren kann.
2.4.3 Controlling als Linien- oder Stabsfunktion
Bei der Diskussion der organisatorischen Ausgestaltung des Controllings kann auch die Frage aufkommen, ob es sich beim Controlling um eine Stabs- oder Linienfunktion handelt.
Der Unterschied liegt vor allem in der Verantwortung für Entscheidungen. Linienfunktionen übernehmen in Unternehmen Verantwortung für ihre Entscheidungen und treffen diese eigenständig. Die daraus entstehenden Ergebnisse werden von den Linienfunktionen verantwortet. Darüber hinaus haben Linienfunktionen in aller Regel eine disziplinarische Verantwortung für untergeordnete Abteilungen und Mitarbeiter.
Stabsfunktionen hingegen treffen keine eigenen Entscheidungen, sondern haben eher beratenden Charakter. Sie sind gegenüber anderen Bereichen nicht weisungsbefugt und verantworten daher auch nicht die Ergebnisse der getroffenen Entscheidungen.
Controlling lässt sich tatsächlich nicht eindeutig als Stabs- oder Linienfunktion charakterisieren. Vielmehr weist Controlling Eigenschaften von beiden Arten von Funktionen auf. So berät das Controlling Führungskräfte primär bei der Entscheidungsfindung und fungiert somit als Stabsfunktion. Allerdings trägt das Controlling auch ein erhebliches Maß an Verantwortung für die Strategie und deren Umsetzung und somit auch für die erzielten Ergebnisse. Mit der entsprechenden Macht ausgestattet, ist das Controlling zudem in bestimmten Bereichen weisungsbefugt gegenüber anderen Abteilungen im Unternehmen. Somit agiert es auch als Linienfunktion mit entsprechender Verantwortung.
Die Kernaussagen des Kapitels
Ein zentrales Controlling hat den großen Vorteil der strategischen Durchdringung aller Unternehmensbereiche.Dezentrales Controlling kann dagegen besser auf die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Aktivitäten im Unternehmen eingehen.