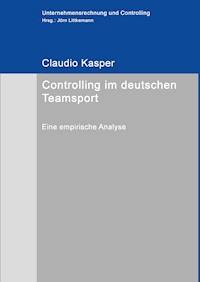
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Unternehmensrechnung und Controlling
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch hat sich zum Ziel gesetzt, den aktuellen Entwicklungsstand des Controllings im professionellen Teamsport zu untersuchen. Auf Basis einer ausführlichen Analyse der Teamsportbranche, werden die wichtigsten Akteure im Umfeld der Clubs beschrieben und Einflussfaktoren für das Controlling im Teamsport abgeleitet. Anschließend werden die Besonderheiten der Controllertätigkeit in den Clubs herausgearbeitet. Das Buch bietet dabei einen tiefen Einblick in die Arbeit der Controller in den Clubs und liefert einen reichen Fundus an teamsportspezifischen Lösungen und Instrumenten. Im empirischen Teil der Untersuchung wurden 50 Clubs der 1., 2. und 3. Liga im Fußball sowie der obersten Spielklasse im Basketball, Eishockey und Handball zum Entwicklungsstand ihrer Controllingsysteme befragt. Neben einer Vielzahl deskriptiver Erkenntnisse zur Controllerarbeit im Sport, liefert die Arbeit eine Reihe interessanter kausalanalytische Befunde zum Zusammenhang zwischen Kontext, Ausgestaltung des Controllingsystems und dem Erfolg der Vereine. Damit ist es zum ersten Mal gelungen, einen tiefen Einblick in das betriebswirtschaftliche Steuerungssystem der Teamsportbranche in Deutschland zu erlangen. Auf Grund seiner praxisnahen Forschungsausrichtung liefert das vorliegende Buch für Wissenschaft und Praxis einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen der Controllerarbeit in professionellen Teamsportorganisationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 851
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchreihe
In der vorliegenden Buchreihe werden die zentralen Forschungsergebnisse (vor allem Promotionen und Habilitationen) des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Unternehmensrechnung und Controlling an der FernUniversität in Hagen veröffentlicht. Dabei sind die Forschungsprojekte überwiegend empirisch ausgerichtet. Im Vordergrund steht die theoriegeleitete Hypothesenprüfung praxisrelevanter Forschungsfragen in den – zumeist großzahligen – Erhebungen. Zudem wird in den Forschungsarbeiten Wert auf die Berücksichtigung wissenschaftlich hochrangiger Publikationen und die Anwendung anspruchsvoller statistischer Verfahren gelegt. Daneben werden Einzelprojekte in Kooperation mit der Unternehmenspraxis durchgeführt. Ziel ist dabei, problemorientierte Controllingkonzepte zu entwickeln und entsprechende Controllinginstrumente in die Praxis zu transferieren. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten werden überdies laufend auf wissenschaftlichen Konferenzen bzw. Fachtagungen vorgestellt und darüber hinaus in den regelmäßig erscheinenden Tätigkeitsberichten des Lehrstuhls dokumentiert.
Herausgeber
Univ.-Prof. Dr. Jörn Littkemann
Jörn Littkemann ist Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling an der FernUniversität in Hagen. Davor war er als Wissenschaftlicher Assistent und anschließend als Akademischer Rat am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisation, Personal und Innovation an der Westfälischen Wilhems-Universität in Münster tätig. Nach einer Ausbildung zum Fachangestellten in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel promovierte er zum Dr. sc. pol. mit der Arbeit „Rechnungswesen und Innovationsmanagement“. Anschließend erfolgte die Habilitation im Fach Betriebswirtschaftslehre mit der Schrift „Organisation des Beteiligungscontrolling“.
Prof. Dr. Littkemann ist Autor einer Vielzahl von Büchern und Aufsätzen in inund ausländischen Fachzeitschriften. Die Schwerpunkte seiner Forschung konzentrieren sich auf folgende Gebiete: Gestaltung von Controllinginstrumenten und -systemen, Beteiligungs- und Konzerncontrolling, Projekt- und Innovationscontrolling, Sportmanagement und -controlling sowie ausgewählte Aspekte zur Organisation und Unternehmensführung. Ferner ist er Studienleiter der VWA Hellweg-Sauerland in Arnsberg, Gesellschafter des Beratungsunternehmens BSLS + Partner in Münster, Mitglied des Aufsichtsrats der VR-Bank Kreis Steinfurt in Rheine sowie als Gutachter u. a. für die Studienstiftung des deutschen Volkes, für die Einführung von Bachelor/Masterstudiengängen an deutschen Hochschulen, für mehrere namhafte Fachzeitschriften und für die Unternehmenspraxis tätig. In der universitären Weiterbildung engagiert er sich vor allem bei den Hagener Instituten für Managementstudien (HIMS) und für wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Weiterbildung (IWW).
Korrespondenzanschrift:
FernUniversität in Hagen
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Unternehmensrechnung und Controlling
Universitätsstraße 41 (ESG)
D-58084 Hagen
Fon: +49-2331-987-4753
Fax: +49-2331-987-4865
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.fernuni-hagen.de/littkemann
Geleitwort
Herr Kasper untersucht in seiner Dissertationsschrift den Aufbau und die Gestaltung von Controllingsystemen im deutschen Teamsport. Dabei legt er den Schwerpunkt auf die Erklärung der auf das Controlling bezogenen Zusammenhänge zwischen Gestaltung, Kontext und Erfolg und prüft seine theoretischen Ausführungen anhand der empirischen Analyse in den deutschen (Herren-)Teamsportarten Basketball, Eishockey, Fußball und Handball. Konkret widmet er sich der Beantwortung der folgenden Forschungsfragen:
Welche Kontextfaktoren haben einen Einfluss auf den Entwicklungsstand der Controllingsysteme im Teamsport?
Wie ist der momentane Entwicklungsstand der Controllingsysteme im professionellen Teamsport? Gibt es Unterschiede aufgrund der individuellen Rahmenbedingungen der Fußball-Clubs?
Welche teamsportspezifischen Elemente sollte das Controlling im Teamsport umfassen und werden diese aktuell im ausreichenden Maß eingebaut?
Lässt sich ein Einfluss des Entwicklungsstands des Controllings auf den Erfolg der Teamsportorganisation nachweisen?
Die Forschungsarbeit ist schwerpunktmäßig in die Teildisziplin des Controllings einzuordnen, wobei – wie für das Controlling als fächerübergreifende Querschnittsdisziplin typisch – an vielen Stellen auf Ansätze, Theorien und Methoden aus anderen betriebswirtschaftlichen Fachgebieten zurückgegriffen wird. So befasst sich Herr Kasper im Rahmen der Darlegung der theoretischen Grundlagen seiner Arbeit mit verschiedenen Theorien der neuen Institutionenökonomik. Bei der Aufstellung seines empirischen Untersuchungsmodells bedient er sich der Kontingenztheorie, die u. a. in der Teildisziplin Organisation eine bedeutende Rolle spielt. Letztendlich verortet sich Herr Kasper durch die Wahl seines Untersuchungsobjekts Teamsport auch in der Sportökonomie.
Anhand einer Online-Befragung von für das Controlling verantwortlichen Aufgabenträgern aus 50 professionellen Teamsportorganisationen aus den Bereichen Basketball, Eishockey, Fußball und Handball arbeitet Herr Kasper eine Fülle hochinteressanter Befunde heraus, von denen die wichtigsten hier kurz genannt sein:
Kontextfaktoren: Die Stichprobe ist in Bezug auf die Verteilung der Sportarten in der Grundgesamtheit als annährend repräsentativ zu bezeichnen; der Fußball ist leicht über- und das Eishockey demgegenüber leicht unterrepräsentiert. Die teilnehmenden Clubs beschäftigen zwischen 30 und 75 Mitarbeiter. Die Erreichung sportlicher Ziele besitzt oberste Dominanz, dahinter folgen die Zielsetzungen der Liquiditätssicherung und der Förderung des Jugendsports. Zwei Drittel der Clubs bezeichnen sich als unabhängig von einem Sponsor und bevorzugen ein partizipatives Führungsverhalten.
Planungssystem: Die meisten Clubs sind in ihrer Planrechnung liquiditätsgetrieben. Basis hierfür ist eine gut entwickelte operative Planung. Potenziale für die Verbesserung des Planungssystems liegen in der Integration und der Abstimmung der einzelnen Planungselemente, im Ausbau der strategischen Planung und der Verknüpfung der Planung mit konkreten Maßnahmen.
Personalcontrolling: Das Controlling der laufenden Personalkosten ist in der Regel bei den befragten Clubs hoch entwickelt, wobei diese selbst noch Entwicklungsbedarf in ihrer Szenariofähigkeit hinsichtlich unterschiedlicher sportlicher Saisonverläufe sehen. Demgegenüber ist das im Hinblick auf Personalentscheidungen bezogene (Des)-Investitionscontrolling etwas weniger stark ausgebaut.
Spielstättencontrolling: Lediglich 16 % der befragten Clubs geben an, dass die Spielstätte ihnen unmittelbar bzw. mittelbar über ein Tochterunternehmen gehört. Ein weiteres Viertel mietet die Spielstätte und fungiert zumindest noch als Betreiber, während sich der Rest der Befragten ausschließlich in der Mieterrolle befindet. Das operative Kostencontrolling ist laut den Befragten auch in diesem speziellen Controllingfeld des Teamsports gut entwickelt. Untersuchungen zum Auslastungsgrad der Spielstätte werden im Gegensatz zur Ticketpreisfindung mittel Kundenverhaltensanalysen regelmäßig vorgenommen. Ein Investitionscontrolling der Spielstätte findet bei den befragten Clubs hingegen kaum statt.
Sponsoringcontrolling: Über die Hälfte der befragten Clubs setzt auf die Eigenvermarktung, während sich lediglich ein Drittel komplett über eine beauftragte Agentur fremdvermarkten lässt. Nahezu alle der untersuchten Clubs geben an, dass ihre Teamsportorganisation über ein klar strukturiertes Leistungsangebot im Sponsoring verfügt. Mit einer Preisfindung auf Basis des Kundenverhaltens und Kennzahlen zum Auslastungsgrad beschäftigen sich die meisten Clubs. Vergleichsweise unterentwickelt sind die Analyse des Nutzens der Sponsoringleistung über die Werbewirkung sowie die Analyse der Kostenstrukturen des Sponsorings.
Institutionalisierung des Controllings: Die Aufgaben des Controllings werden in den untersuchten Clubs häufig als Nebentätigkeit entweder von der Geschäftsführung oder von der Abteilung Rechnungswesen wahrgenommen. Lediglich 38 % der Befragten geben an, dass eine Stelle oder Abteilung mit der Bezeichnung Controlling existiert.
Insgesamt gesehen hat Herr Kasper eine sehr gute Forschungsarbeit vorlegt, die sich insbesondere durch folgende Punkte auszeichnet:
Sie betritt weitgehend Neuland in dem Forschungsbereich des Controllings in professionellen Teamsportorganisationen und leistet hier sowohl in theoretischer als auch in methodischer Hinsicht einen wertvollen Beitrag.
Aus wissenschaftlicher Sicht liegt der Erkenntnisgewinn der Arbeit – abgesehen von den vorgelegten Befunden – vor allem in der Theorieherleitung durch die Aufstellung des spezifischen Untersuchungsmodells und in der (Neu)-Konstruktbildung durch die jeweilige Variablenoperationalisierung.
Für die teamsportbezogene Controllingpraxis dürften insbesondere das durch die empirischen Ergebnisse deutlich gewordene Fehlen von Controllingmaßnahmen bzw. -instrumenten und deren Lösungsmöglichkeiten in den betreffenden Controllingfeldern von großem Interesse sein.
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der FernUniversität in Hagen hat diese Arbeit im Jahre 2016 als Dissertation angenommen.
Hagen, im September 2016Jörn Littkemann
Für Sandra, Lotta und Ole
Vorwort
„10 Millionen sind heute kein Geld mehr – dafür kaufen die Engländer den Platzwart!“
Franz Beckenbauer
Der professionelle Teamsport in Deutschland hat sich in den letzten zwanzig Jahren stark gewandelt. Ich erinnere mich an Besuche von Fußballspielen mit meinem Vater und Bruder in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts, bei denen man im Stadion auf einem Grashügel, mit der Bratwurst in der Hand versuchte die Spieler zu identifizieren, die gefühlt meilenweit weg gegen den Ball traten. Besuche von Handball- und Basketballspielen versprühten damals den Charme einer schulischen Pflichtveranstaltung. Besucht man heute ein Bundesligaspiel im Basketball, Eishockey, Fußball oder Handball, so werden diese in eigens dafür geschaffenen Stadien und Multifunktionsarenen präsentiert, die mit dem neusten Stand der Unterhaltungstechnik ausgestattet sind. Die Spiele sind zum Event für unterschiedlichste Zielgruppen geworden. Um den Sport hat sich eine Vielzahl weiterer Produkte entwickelt, die dazu geführt haben, dass der Umsatz im professionellen deutschen Teamsport längst die 3-Milliarden-Euro-Grenze überschritten hat. Das Management der Clubs steht angesichts des rasanten Wachstums und des intensiven Wettbewerbs vor der Herausforderungen den Wandel erfolgreich zu gestalten. Seit einiger Zeit wird diesbezüglich die Einführung eines Controllings gefordert. Die vorliegende Arbeit hat sich der Herausforderung gestellt, den aktuellen Stand des Controllings im Teamsport zu dokumentieren, um hieraus wesentliche Erkenntnisse für Wissenschaft und Praxis abzuleiten.
Natürlich kann eine solche Herausforderung nicht allein bewältigt werden, sondern sie ist nur durch die Unterstützung einer Vielzahl von Menschen zu meistern. Besonderer Dank gebührt dabei Herrn Univ.-Prof. Dr. Jörn Littkemann, der sich meiner Person und des Themas als Doktorvater angenommen und das Forschungsprojekt in allen Phasen intensiv unterstützt und begleitet hat. Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerrit Brösel danke ich für die Übernahme des Zweitgutachtens, seine konstruktive Kritik und wertvollen Hinweise.
Besonderer Dank gebührt natürlich den 50 Teilnehmern aus den Ligen des professionellen Teamsports, die ihre wertvolle Zeit in die Beantwortung des Fragebogens investiert haben. Ich hoffe, dass das Ergebnis der Arbeit ihren Einsatz rechtfertigt!
Weiterer Dank gilt den internen und externen Kollegen am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling an der FernUniversität in Hagen. Durch Eure Anmerkungen und Kritik im Rahmen der Doktorandenseminare habt Ihr die Arbeit entscheidend vorangebracht. In diesem Zusammenhang möchte ich Herrn Prof. Dr. Klaus Schulte, Herrn Dr. Klaus Derfuß, Herrn Dr. Axel Fietz, Herrn Dr. Michael Holtrup, Herrn Dr. Philipp Reinbacher, Herrn Dr. Axel Schröder, Herrn Dr. TimFronholt, Frau Sheareh Shalchi, Frau Sarah Maïzi, Herrn Stefan Höppe, Herrn Florian Oldenburg-Tietjen, Herrn Thomas Hahn, Frau Sonia Schwarzer, Herrn Stephan Körner, Herrn Marcel Naber, Herrn Carsten Baums, Frau Janina Matern, Herrn Daniel Sauer, Frau Christine Stockey sowie Frau Antje Tramm danken. Weiterer Dank gebührt Herrn Dr. Maik Ebersoll, der sich die Mühe gemacht hat, den statistischen Teil der Arbeit zu lesen und mit seinen Anmerkungen voranzubringen.
Als externer Promovierender konnte ich den Vorteil genießen, täglich mit meinem Forschungsthema praktisch in Berührung zu kommen. Der Austausch über Fragen der Steuerung und des Controllings von Teamsportorganisationen mit den Kollegen beim 1. FC Kaiserslautern e. V. und dem FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V. hat hoffentlich dazu geführt, dass die Arbeit auch für Praktiker lesenswert ist. Besonders hervorheben möchte ich hierbei Herrn Jens König (1. FCK), Herrn Peter Peters und Frau Christina Rühl-Hamers (Schalke 04), die mir den Einstieg in den Teamsport ermöglicht haben. Aus dem Kollegenkreis ist für die Entstehung dieser Arbeit besonders Herrn Christian Damms und Herrn Michael Scharold zu danken, die mit intensiven und konstruktiven Diskussionen zur Thematik meinen Blick auf neue Aspekte gerichtet haben.
Die Basis für all das wurde in einer glücklichen Kindheit gelegt. Diese habe ich meinen Eltern Ingrid und Roland Kasper zu verdanken, die meine Geschwister und mich immer in allen Lebenslagen bedingungslos – im besten Sinne des Wortes – unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Bei meinen Geschwistern Diana und Nico und ihren Familien konnte ich stets die notwendige Ablenkung von der Dissertation erfahren. Bei Euch habe ich immer das Vertrauen in das Gelingen der Arbeit gespürt. Letztlich geht die Idee zu dieser Arbeit auf den kreativen Kopf meines Bruders zurück, womit er sich ein besonderes Dankeschön verdient hat. Weiterer Dank gebührt meinen Schwiegereltern Anneliese und Heinz, die mit ihrem Einsatz dafür gesorgt haben, mir Zeit zum Schreiben zu verschaffen.
Widmen möchte ich diese Arbeit meiner Frau Sandra sowie unseren Kindern Lotta und Ole. Ihr habt die letzten Jahre zu einem besonderen Abenteuer gemacht! Vielen Dank für Euer Verständnis, die aufmunternden Worte, kleinen Anekdoten und gelegentlichen Besuche am Schreibtisch, die mein Leben reicher machen. Es macht einfach Spaß, Zeit mit Euch zu verbringen. Ganz besonderer Dank gebührt Dir, Sandra. Mit Deinem Einfühlungsvermögen ist es Dir wunderbar gelungen, mir die notwendigen Freiräume für das Schreiben zu eröffnen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt wieder aus den Büchern auftauchen konnte, um unsere Kinder beim Aufwachsen zu begleiten.
Billerbeck, im Semptember 2016Claudio Kasper
Inhaltsübersicht
Herausgeber
Geleitwort
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A Einleitung
B Theoretische Grundlagen
C Das Branchenmodell des Teamsports
D Controlling im Teamsport
E Hypothesenbildung und Operationalisierung
F Empirischer Teil
G Zusammenfassung und Implikationen für den Teamsport
H Anhang
I Literaturverzeichnis
Buchreihe Unternehmensrechnung und Controlling
Inhaltsverzeichnis
Herausgeber
Geleitwort
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A Einleitung
1 Problemstellung
2 Zielsetzung und Abgrenzung der Untersuchung
3 Methodik und Vorgehensweise der Untersuchung
B Theoretische Grundlagen
1 Ziele des Abschnitts
2 Begriffliche Grundlagen des Teamsports
3 Grundlagen der Kontingenztheorie
4 Neue Institutionenökonomik
4.1 Überblick
4.2 Theorie der Verfügungsrechte (Property-Rights-Ansatz)
4.3 Transaktionskostentheorie
4.4 Prinzipal-Agenten-Theorie
5 Theoretische Grundlagen des Controllings
5.1 Controllingursprung und Stand der Forschung in Deutschland
5.2 Grundmodell und Begriffsverständnis
5.3 Ausgestaltung des Controllingsystems
5.3.1 Funktionale Perspektive des Controllings
5.3.2 Controlling als Institution
5.3.3 Controlling als Prozess
5.3.4 Instrumentelle Perspektive des Controllings
5.4 Der Erfolgsbeitrag des Controllings
6 Zusammenfassung
C Das Branchenmodell des Teamsports
1 Ziele des Abschnitts
2 Grundstruktur eines Branchenmodells des Teamsports
3 Makroumwelt
3.1 Globales wirtschaftliches Umfeld
3.2 Soziokulturelles Umfeld
3.3 Technologischer Fortschritt
3.4 Politisch-rechtliches Umfeld
4 Mikroumwelt
4.1 Lieferanten
4.1.1 Vorbemerkungen
4.1.2 Personal
4.1.3 Finanzen
4.1.4 Infrastruktur
4.1.5 Regelwerke und Lizenzen
4.2 Nachfrager
4.2.1 Vorbemerkungen
4.2.2 Absatzmittler/-veredler
4.2.3 Endkunden
4.3 Potenzielle Konkurrenten
4.4 Substitutionsprodukte der Unterhaltungsindustrie
4.5 Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern
4.5.1 Vorbemerkungen
4.5.2 Wettbewerb zwischen den Teamsportarten in Deutschland
4.5.3 Wettbewerb innerhalb der Teamsportart
5 Die professionelle Teamsportorganisation
5.1 Vorbemerkungen
5.2 Zielsystem der TSO
5.2.1 Vorbemerkungen
5.2.2 Sportliche Ziele
5.2.3 Wirtschaftliche Ziele
5.2.4 Soziale Ziele
5.2.5 Zielbeziehungen
5.3 Produkte des Teamsports
5.4 Determinanten der Nachfrage nach dem Produkt Teamsport
5.5 Der mehrstufige Produktionsprozess im Teamsport
6 Zusammenfassung und Ableitung von Kontextfaktoren
D Controlling im Teamsport
1 Ziele des Abschnitts
2 Besonderheiten des Teamsportcontrollings
2.1 Funktionale Perspektive
2.2 Institutionelle Besonderheiten des Controllings im Teamsport
2.3 Prozessuale Perspektive des Teamsportcontrollings
2.4 Instrumente des Controllings im Teamsport
2.5 Der Erfolgsbeitrag des Controllings im Teamsport
3 Ausgewählte Handlungsfelder des Teamsportcontrollings
3.1 Überblick
3.2 Planungs-und Kontrollsystem von TSO
3.2.1 Vorbemerkungen
3.2.2 Strategische Planung und Kontrolle
3.2.3 Operative Planung und Kontrolle
3.2.4 Liquiditätsplanung und -kontrolle
3.3 Personalcontrolling
3.3.1 Funktionale Perspektive
3.3.2 Institutionelle Perspektive
3.3.3 Instrumentelle Perspektive
3.4 Spielstättencontrolling
3.4.1 Funktionale Perspektive
3.4.2 Institutionelle Perspektive
3.4.3 Instrumentelle Perspektive
3.5 Sponsoringcontrolling
3.5.1 Funktionale Perspektive
3.5.2 Institutionelle Perspektive
3.5.3 Instrumentelle Perspektive
4 Empirische Untersuchungen zum Controlling im Teamsport
5 Zusammenfassung
E Hypothesenbildung und Operationalisierung
1 Ziele des Abschnitts
2 Hypothesenbildung
2.1 Vorbemerkungen
2.2 Hypothesen zum Zusammenhang von Kontextfaktoren und Controllingsystemgestaltung
2.3 Hypothesen zum Wirkungszusammenhang der Kontextfaktoren und des Erfolgs der TSO
2.4 Hypothesen zu den Beziehungen innerhalb des Controllingsystems der TSO
2.5 Hypothesen zum Entwicklungsstand des Controllingsystems und des Erfolgs der TSO
3 Operationalisierung der Variablen des Untersuchungsmodells
3.1 Vorbemerkungen
3.2 Operationalisierung der Kontextfaktoren
3.2.1 Teamsportart
3.2.2 Ligazugehörigkeit
3.2.3 Größe
3.2.4 Zielsystem
3.2.5 Abhängigkeit
3.2.6 Führungsstil
3.2.7 Spielphilosophie und Scouting
3.2.8 Spielstättensituation
3.2.9 Vermarktungssituation
3.3 Operationalisierung des Controllingsystems
3.3.1 Vorbemerkungen
3.3.2 Entwicklungsstand des Planungssystems
3.3.3 Entwicklungsstand des Personalcontrollings
3.3.4 Entwicklungsstand des Spielstättencontrollings
3.3.5 Entwicklungsstand des Sponsoringcontrollings
3.3.6 Institutionalisierung des Controllings
3.4 Operationalisierung des Erfolgs der TSO
4 Zusammenfassung
F Empirischer Teil
1 Ziele des Abschnitts
2 Methodik der Datengewinnung
2.1 Wahl der Erhebungsmethode
2.2 Auswahl der Befragungsteilnehmer
3 Eingesetzte statistische Untersuchungsmethoden
3.1 Übersicht
3.2 Angewendete uni- und bivariate Methoden
3.3 Regressionsanalyse
4 Rücklaufstatistik
5 Soziodemografische Charakteristika der Befragungsteilnehmer
5.1 Vorbemerkungen
5.2 Alter und Geschlecht
5.3 Bildung und Position
5.4 Nonresponse Bias
5.5 Key Informant Bias
5.6 Missing Values
6 Deskriptive Befunde
6.1 Vorbemerkungen
6.2 Kontextfaktoren
6.2.1 Teamsportart und Ligazugehörigkeit
6.2.2 Größe
6.2.3 Zielsystem
6.2.4 Abhängigkeit
6.2.5 Führungsstil
6.3 Planung
6.3.1 Entwicklungsstand des Planungssystems
6.3.2 Instrumente der Planung
6.3.3 Institutionalisierung der Planung
6.3.4 Bewertung des Planungssystems
6.4 Personalcontrolling
6.4.1 Rahmenbedingungen des Personalcontrollings
6.4.2 Entwicklungsstand des Personalcontrollings
6.4.3 Instrumente des Personalcontrollings
6.4.4 Ressourcenzugang des Personalcontrollings
6.4.5 Institutionalisierung des Personalcontrollings
6.4.6 Bewertung des Personalcontrollings
6.5 Spielstättencontrolling
6.5.1 Rahmenbedingungen des Spielstättencontrollings
6.5.2 Entwicklungsstand des Spielstättencontrollings
6.5.3 Instrumente des Spielstättencontrollings
6.5.4 Ressourcenzugang des Spielstättencontrollings
6.5.5 Institutionalisierung des Spielstättencontrollings
6.5.6 Bewertung des Spielstättencontrollings
6.6 Sponsoringcontrolling
6.6.1 Rahmenbedingungen des Sponsoringcontrollings
6.6.2 Entwicklungsstand des Sponsoringcontrollings
6.6.3 Instrumente des Sponsoringcontrollings
6.6.4 Ressourcenzugang des Sponsoringcontrollings
6.6.5 Institutionalisierung des Sponsoringcontrollings
6.6.6 Bewertung des Sponsoringcontrollings
6.7 Institutionalisierung des Controllings
6.7.1 Institutionalisierungsgrad des Controllings
6.7.2 Alter der Controllerstelle
6.7.3 Organisatorische Verankerung der Controllerstelle
6.7.4 Ressourcen der Controllerstelle
6.8 Controllingerfolg
6.8.1 Sportlicher Erfolg der Clubs
6.8.2 Wirtschaftlicher Erfolg der Clubs
6.8.3 Zusammenhang zwischen den Erfolgskomponenten
7 Kausalanalytische Befunde
7.1 Vorbemerkungen
7.2 Beziehungen zwischen den Kontextfaktoren
7.3 Beziehungen zwischen Kontextfaktoren und Entwicklungsstand des Controllings
7.3.1 Teamsportart
7.3.2 Ligazugehörigkeit
7.3.3 Größe
7.3.4 Zielsystem
7.3.5 Abhängigkeit
7.3.6 Führungsstil
7.3.7 Spielphilosophie und Scouting
7.3.8 Spielstättensituation
7.3.9 Vermarktungssituation
7.4 Beziehungen zwischen Kontextfaktoren und dem Cluberfolg
7.4.1 Vorbemerkungen
7.4.2 Beziehungen zwischen Kontextfaktoren und sportlichem Erfolg
7.4.3 Beziehungen zwischen Kontextfaktoren und wirtschaftlichem Erfolg
7.5 Beziehungen zwischen Institutionalisierung und Entwicklungsstand des Controllings
7.6 Beziehungen zwischen Entwicklungsstand des Controllings und Erfolg der TSO
7.6.1 Vorbemerkungen
7.6.2 Entwicklungsstand des Controllings und Erfolg der TSO
7.6.3 Controllinginstitution und Erfolg der TSO
8 Zusammenfassung
G Zusammenfassung und Implikationen für den Teamsport
1 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung
2 Implikationen für das Controlling in Teamsportorganisationen.
3 Limitationen und weiterer Forschungsbedarf
H Anhang
1 Finanzplan einer TSO nach der Methode der direkten Cash-Flow-Rechnung
2 Überblick Skalenniveaus
3 Fragebogen
4 Regressionsanalysen
4.1 Regressionsanalyse Kontextfaktoren und sportlicher Erfolg
4.2 Regressionsanalyse Kontextfaktoren und wirtschaftlicher Erfolg
4.3 Regressionsanalyse Entwicklungsstand des Controllingsystems und sportlicher Erfolg
4.4 Regressionsanalyse Entwicklungsstand des Controllingsystems und wirtschaftlicher Erfolg
I Literaturverzeichnis
Buchreihe Unternehmensrechnung und Controlling
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:Zielsystem der Unstersuchung
Abbildung 2:Gang der Untersuchung
Abbildung 3:Grundstruktur einer Prinzipal-Agenten-Beziehung
Abbildung 4:Grundmodellstruktur des Kontingenzansatzes des Behavioral Accounting
Abbildung 5:Gestaltungsfelder der Controllingorganisation
Abbildung 6:Phasenschema des Führungsprozesses in Anlehnung an Hahn
Abbildung 7:Ablauf von Führungsprozessaktivitäten und organisatorische Zuordnung
Abbildung 8:„Werkzeugkasten“ des Controllers
Abbildung 9:Branchenmodell des deutschen Teamsports
Abbildung 10:Entwicklung der Transferausgaben/ -einnahmen der Clubs der Fußballbundesliga
Abbildung 11:Ausgewählte Optionen der Kapitalbeschaffung für TSO
Abbildung 12:Formen der Kooperation zwischen TSO und Vermarktungsagenturen
Abbildung 13:Prognose zum Investitionsvolumen auf dem deutschen Sponsoringmarkt 2012 bis 2014
Abbildung 14:Beliebteste Sportarten in Deutschland nach Interesse der Bevölkerang 2014 und 2015
Abbildung 15:Institutionelle Struktur des professionellen Basketballs in Deutschland
Abbildung 16:Institutionelle Struktur des professionellen Eishockeys in Deutschland
Abbildung 17:Institutionelle Struktur des professionellen Fußballs in Deutschland
Abbildung 18:Institutionelle Struktur des professionellen Handballs in Deutschland
Abbildung 19:Interdependenzrelationen zwischen sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg
Abbildung 20:Produkte des Teamsports
Abbildung 21:Determinanten der Nachfrage nach Sportereignissen
Abbildung 22:Produktionsprozess im Teamsport
Abbildung 23:Ausgewählte Kontextfaktoren des Controllings im Teamsport
Abbildung 24:Idealisierte Phasen der Institutionalisierung der Controllingfunktion in TSO
Abbildung 25:Beispiel für eine Controllingorganisation mit zentralem und dezentralem Controlling in großen TSO
Abbildung 26:Bewertung der Handlungsfelder des Teamsportcontrollings
Abbildung 27:Träger, Prozess und Gegenstände der strategischen Führung in TSO
Abbildung 28:Grundschema der operativen Planung in TSO
Abbildung 29:Schematischer Liquiditätsverlauf eines Fußballbundesligaclubs
Abbildung 30:Schematische Darstellung einer Liquiditätsplanung im Teamsport
Abbildung 31:Liquiditätsberechnungsschema der Fußballbundesliga vor einer Spielzeit
Abbildung 32:Idealtypische Entlohnungssystemgestaltung im Teamsport
Abbildung 33:Personalportfolio einer TSO und Normstrategien
Abbildung 34:Beispiel Vertragslaufzeitenstruktur Lizenzspielerkader
Abbildung 35:Verfahren der Investitionsrechnung
Abbildung 36:Beispiel VoFi für eine Spielerinvestition
Abbildung 37:Schematische Darstellung einer Spieltagserfolgsrechnung
Abbildung 38:Fiktives Veranstaltungsportfolio für eine Spielstätte im Teamsport
Abbildung 39:Beispiel Strukturanalyse des Sponsorenpools
Abbildung 40:Fiktives Rechteinventar mit Kennzahlen zur Auslastung und zur Preisgestaltung
Abbildung 41:Elemente des Controllingsystems und Erfolg
Abbildung 42:Untersuchungsmodell des kausalanalytischen Teils der Untersuchung
Abbildung 43:Phasenmodell einer Regressionsanalyse
Abbildung 44:Alter der Befragungsteilnehmer
Abbildung 45:Verteilung der Teamsportart in der Stichprobe und der Grundgesamtheit
Abbildung 46:Verteilung der Ligazugehörigkeit in der Stichprobe und der Grundgesamtheit
Abbildung 47:Antwortverhalten bezogen auf den Kontextfaktor Größe
Abbildung 48:
Tabellen Verzeichnis
Tabelle 1:Entwicklung des Personalaufwands in den professionellen Teamsportligen in den Spielzeiten 2009/2010 bis 2013/2014
Tabelle 2:Personalaufwandsquoten des professionellen Teamsports in Deutschland, Spielzeit 2013/2014
Tabelle 3:Kapazitäten der Spielstätten im deutschen Teamsport in der Spielzeit 2014/2015
Tabelle 4:Entwicklung der Kennzahl Zuschauer pro Spiel 2008/2009 bis 2013/2014
Tabelle 5:Umsatzentwicklung des professionellen Teamsports in Deutschland von 2008/2009 bis 2013/2014
Tabelle 6:Umsatzverteilung BBL 2013/2014
Tabelle 7:Umsatzverteilung DEL 2013/2014
Tabelle 8:Umsatzverteilung professioneller Fußball 2013/2014
Tabelle 9:Umsatzverteilung HBL 2013/2014
Tabelle 10:Ausgewählte Verfahren der Wirkungsmessung im Sportsponsoring
Tabelle 11:Studien zum Controlling im deutschen Teamsport
Tabelle 12:Operationalisierung des Kontextfaktors Teamsportart
Tabelle 13:Operationalisierung des Kontextfaktors Ligazugehörigkeit
Tabelle 14:Operationalisierung des Kontextfaktors Größe
Tabelle 15:Operationalisierung des Kontextfaktors Zielsystem
Tabelle 16:Operationalisierung des Kontextfaktors Abhängigkeit
Tabelle 17:Operationalisierung des Kontextfaktors Führungsstil
Tabelle 18:Operationalisierung der Kontextfaktoren Spielphilosophie und Scouting
Tabelle 19:Operationalisierung des Kontextfaktors Spielstättensituation
Tabelle 20:Operationalisierung des Kontextfaktors Vermarktungssituation
Tabelle 21:Operationalisierung des Entwicklungsstands des Planungssystems
Tabelle 22:Operationalisierung des Instrumenteneinsatzes im Planungssystem
Tabelle 23:Operationalisierung des Entwicklungsstands des Personalcontrollings
Tabelle 24:Operationalisierung des Ressourcenzugangs des Personalcontrollings
Tabelle 25:Operationalisierung des Entwicklungsstands des Spielstättencontrollings
Tabelle 26:Operationalisierung des Ressourcenzugangs des Spielstättencontrollings
Tabelle 27:Operationalisierung des Entwicklungsstands des Sponsoringcontrollings
Tabelle 28:Operationalisierung des Ressourcenzugangs des Sponsoringcontrollings
Tabelle 29:Operationalisierung der latenten Variablen zur Institutionalisierung des Controllings in TSO
Tabelle 30:Operationalisierung der latenten Variablen zum Erfolg der TSO
Tabelle 31:Interpretation des Korrelationskoeffizienten r
Tabelle 32:Übersicht bivariater Korrelationen
Tabelle 33:Rücklaufstatistik Befragung Controlling im Teamsport
Tabelle 34:Statistische Maße bezogen auf den Kontextfaktor Größe
Tabelle 35:Antwortverhalten bezogen auf den Kontextfaktor Zielsystem
Tabelle 36:Antwortverhalten bezogen auf den Kontextfaktor Führungsstil
Tabelle 37:Antwortverhalten bezogen auf den Entwicklungsstand des Planungssystems
Tabelle 38:Antwortverhalten bezogen auf die Instrumente der Planung
Tabelle 39:Antwortverhalten bezogen auf die Institutionalisierung der Planung
Tabelle 40:Antwortverhalten bezogen auf die Bewertung des Planungssystems
Tabelle 41:Antwortverhalten bezogen auf die Rahmenbedingungen des Personalcontrollings
Tabelle 42:Antwortverhalten bezogen auf den Entwicklungsstand des Personalcontrollings
Tabelle 43:Antwortverhalten bezogen auf die Instrumente des Personalcontrollings
Tabelle 44:Antwortverhalten bezogen auf den Ressourcenzugang des Personalcontrollings
Tabelle 45:Antwortverhalten bezogen auf die Institutionalisierung des Personalcontrollings
Tabelle 46:Antwortverhalten bezogen auf die Bewertung des Personalcontrollings
Tabelle 47:Antwortverhalten bezogen auf den Entwicklungsstand des Spielstättencontrollings
Tabelle 48:Antwortverhalten bezogen auf die Instrumente des Spielstättencontrollings
Tabelle 49:Antwortverhalten bezogen auf den Ressourcenzugang des Spielstättencontrollings
Tabelle 50:Antwortverhalten bezogen auf die Institutionalisierung des Spielstättencontrollings
Tabelle 51:Antwortverhalten bezogen auf die Bewertung des Spielstättencontrollings
Tabelle 52:Antwortverhalten bezogen auf den Entwicklungsstand des Sponsoringcontrollings
Tabelle 53:Antwortverhalten bezogen auf die Instrumente des Sponsoringcontrollings
Tabelle 54:Antwortverhalten bezogen auf den Ressourcenzugang des Sponsoringcontrollings
Tabelle 55:Antwortverhalten bezogen auf die Institutionalisierung des Sponsoringcontrollings
Tabelle 56:Antwortverhalten bezogen auf die Bewertung des Sponsoringcontrollings
Tabelle 57:Antwortverhalten bezogen auf die Ressourcenausstattung der Controllerstelle
Tabelle 58:Antwortverhalten bezüglich des sportlichen Erfolgs der Clubs
Tabelle 59:Antwortverhalten bezogen auf die Konkretisierung des sportlichen Erfolgs
Tabelle 60:Antwortverhalten bezogen auf den wirtschaftlichen Erfolg
Tabelle 61:Zusammenhang sportlicher und wirtschaftlicher Erfolg
Tabelle 62:H-Test nach Kruskal/Wallis Teamsportart und Kontextfaktoren
Tabelle 63:Mittelwertvergleich Sportart und durchschnittliche Größe und Scouting
Tabelle 64:Kreuztabelle Sportart und Spielstättensituation
Tabelle 65:Kreuztabelle Sportart und Vermarktungssituation
Tabelle 66:Korrelationsmatrix Kontextfaktoren des Teamsports
Tabelle 67:Ergebnisse des H-Tests nach Kruskal/Wallis Teamsportart und Entwicklungsstand des Controllings
Tabelle 68:Mittelwertvergleich Teamsportart und Entwicklungsstand des operativen Spielstättencontrollings
Tabelle 69:Kreuztabelle Teamsportart und Institutionalisierung des Controllings
Tabelle 70:Kreuztabelle Liga und Institutionalisierung des Controllings
Tabelle 71:Kreuztabelle zum Zusammenhang zwischen Größe des Clubs und Institutionalisierung des Controllings
Tabelle 72:Korrelationsmatrix Zielkategorien und Entwicklungsstand des Controllings
Tabelle 73:Ergebnisse der Regressionsanalyse Zielkategorie „Wirtschaftliche Ziele – Liquidität“ mit ausgewählten Entwicklungsstandsvariablen des Controllings
Tabelle 74:Ergebnisse der Regressionsanalyse Zielkategorie „Soziale Ziele – Förderung der Jugend“ mit dem Entwicklungsstand der strategischen Planung
Tabelle 75:Korrelationsmatrix Abhängigkeit des Clubs und Entwicklungsstand des Controllings
Tabelle 76:Ergebnisse der Regressionsanalyse Abhängigkeitssituation mit dem Entwicklungsstand der operativen Planung sowie dem Sponsoringcontrolling
Tabelle 77:Korrelationsmatrix Führungsstil und Entwicklungsstand des Controllings
Tabelle 78:Korrelationsmatrix Spielphilosophie und Entwicklungsstand des Personalcontrollings
Tabelle 79:Korrelationsmatrix Scouting und Entwicklungsstand des Personalcontrollings
Tabelle 80:Korrelationsmatrix Rahmenbedingungen und Entwicklungsstand des Spielstättencontrollings
Tabelle 81:Ergebnisse der Regressionsanalyse Spielstättensituation mit dem Entwicklungsstand des Investitionscontrollings der Spielstätte
Tabelle 82:Korrelationsmatrix Vermarktungssituation und Entwicklungsstand des Sponsoringcontrollings
Tabelle 83:Kreuztabelle Vermarktungssituation und Institutionalisierung des Sponsoringcontrollings
Tabelle 84:Modellübersicht Regressionsanalyse Kontextfaktoren und sportlicher Erfolg (Auszug)
Tabelle 85:ANOVA Regressionsanalyse Kontextfaktoren und sportlicher Erfolg (Auszug)
Tabelle 86:Übersicht Koeffizienten zur Regressionsanalyse Kontextfaktoren und sportlicher Erfolg (Auszug)
Tabelle 87:Modellübersicht Regressionsanalyse Kontextfaktoren und wirtschaftlicher Erfolg (Auszug)
Tabelle 88:
Abkürzungsverzeichnis
Abs.
Absatz
ANOVA
analysis of variance
AOL
America Online, amerikanischer Medienkonzern
Art.
Artikel
BBL
Beko Basketball Bundesliga
BSC
Balanced Scorecard
BVB
Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund
bzw.
beziehungsweise
c. p.
ceteris paribus
ca.
circa
CEO
Chief Executive Officer
d.h.
das heißt
DBB
Deutscher Basketball Bund e. V.
DBV
Deutscher Basketball Verband
DDR
Deutsche Demokratische Republik
DEB
Deutscher Eishockey Bund e. V.
DEL
Deutsche Eishockey Liga
DFB
Deutscher Fußball-Bund e. V.
DFL
Deutsche Fußball Liga GmbH
DHB
Deutscher Handballbund
DM
Deutsche Mark
DOSB
Deutscher Olympischer Sportbund
e.V.
eingetragener Verein
EHF
European Handball Federation
ERP
Enterprise-Resource-Planning
ESBG
Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH
et al.
et alii/und andere
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EUR
Euro
FA
Football Association
FC
Fußballclub
FIBA
Fédération Internationale de Basketball
FIBB
Fédération Internationale de Basket Ball
FIFA
Fédération Internationale de Football Association
FSV
Fussball- und Sportverein
ggf.
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
HBL
DKB Handball-Bundesliga
HBVM
Handball-Bundesliga-Vereinigung der Männer e. V.
Hg.
Herausgeber
IAHF
International Amateur Handball Federation
IfD
Institut für Demoskopie
IHF
International Handball Federation
IIHF
International Ice Hockey Federation
IPO
Initial Public Offering
IT
Informationstechnologie
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KKR
Kohlberg Krāvis Roberts & Co.
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
LED
Licht-emittierende Diode/light-emitting diode
LO
Lizenzierungsordnung
LOS
Lizenzordnung Spieler
MLB
Major League Baseball
Mio.
Millionen
Mrd.
Milliarden
MTV
Männerturnverein
NBA
National Basketball Association
NFL
National Football League
NHL
National Hockey League
Nr.
Nummer
o. a.
oben angeführt
o. J.
ohne Jahr
o. V.
ohne Verfasser
PR
Public Relations
PWC
PricewaterhouseCoopers
RB
RasenBallsport
S.
Seite
SpOL
Spielordnung Ligaverband
SPSS
Statistical Package for the Social Sciences
SWOT
Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats
TEUR
Tausend Euro
THW
Turnverein Hassee-Winterbek e. V. von 1904
Tsd.
Tausend
TSG
Turn- und Sportgemeinschaft
TSO
Teamsportorganisation
TV
Television
TZ
Teilziel(e)
u. a.
unter anderem
UEFA
Union of European Football Associations/Union des Associations Européennes de Football
ULEB
Union des Ligues Européennes de Basketball
VfB
Verein für Bewegungsspiele
vgl.
vergleiche
VIP
Very Important Person
VoFi
Vollständiger Finanzplan
vs.
versus
Y.M.C.A.
Christlicher Verein junger Männer
ZAW
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e. V.
z.B.
zum Beispiel
A Einleitung
1Problemstellung
Der professionelle Teamsport in Deutschland boomt!1 Zwischen den Spielzeiten 2008/2009 und 2013/2014 konnten die Clubs2 der obersten Spielklassen im Basketball, Eishockey, Handball sowie der obersten drei Ligen im Fußball ihre Umsatzerlöse von 2,2 Mrd. EUR auf 3,2 Mrd. EUR steigern.3 Der Teamsport ist damit eine treibende Kraft des Wirtschaftsfaktors Sport, der mittlerweile ca. 3,7 % zum gesamten Bruttoinlandsprodukt in Deutschland beiträgt und damit einen ähnlichen Beitrag liefert wie das Versicherungsgewerbe.4 „König Fußball“ stellt dabei die anderen Teamsportarten weit in den Schatten. Insbesondere die vermeldeten Zahlen der beiden Fußballbundesligen sind beeindruckend:
57 % der Deutschen interessieren sich für Fußball. 99 % der Deutschen kennen die Fußballbundesliga. Im Vergleich hierzu verfügt die UEFA Champions League über einen Bekanntheitsgrad von 84 %.
5
In der Saison 2013/2014 konnten erneut Rekorderträge vermeldet werden. 2,45 Mrd. EUR Gesamterlös erwirtschaftete die 1. Fußballbundesliga, das entspricht einem prozentualem Wachstum im Vergleich zur Vorsaison von knapp 12,9 %.
6
Derzeit sind ca. 48.830 Beschäftigte im Umfeld der 1. und 2. Bundesliga tätig.
7
Diese Zahlen verstellen derzeit ein wenig den Blick auf die Schattenseiten der Teamsportbranche. So konnten 5 von 18 Fußballbundesligisten in der Saison 2013/2014 kein positives Jahresergebnis nach Steuern erwirtschaften.8 Finanzielle Krisen bei Clubs der hier betrachteten Teamsportarten sind keine Seltenheit und werden medial ausführlich diskutiert.9
Der professionelle Teamsport hat sich neben Theater, Musik, Kunst und verschiedenen Fernsehformaten zu einem Produkt der Unterhaltungsindustrie gewandelt.10 Im Zentrum steht zunehmend das Entertainment der Zuschauer.11 Fragt man nach den Ursachen für diese Transformation, so muss zunächst auf den gesellschaftlichen Wandel zur Freizeitgesellschaft verwiesen werden.12 Die Einwohner der entwickelten Industriestaaten verfügen in zunehmendem Maß über freie Zeit, die durch Unterhaltungsangebote gefüllt werden will. Der professionelle Teamsport konkurriert dementsprechend auf dem Markt für Unterhaltungsprodukte um die Kaufkraft und die Zeitressourcen der Konsumenten. Eine weitere wesentliche Ursache für den Transformationsprozess ist die Entwicklung zur Informationsgesellschaft. Die Medien haben bei der Wandlung des Teamsports zur Unterhaltungsware die wesentliche Katalysatorfunktion übernommen.13 Ohne den technischen Fortschritt in der Medienlandschaft wäre ein Bundesliga-Fußballspiel heute immer noch eine eher regionale Veranstaltung und kein nationales und teilweise sogar internationales Sport-Event der Extraklasse.
Die Folge sind eine fortschreitende Kommerzialisierung und Professionalisierung des Sports im Allgemeinen und des Teamsports im Besonderen.14 Das Management der Club-Marke, die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, der Ausbau der Spielstätten zu Erlebnisarealen und Konferenzzentren, die Wahl einer neuen Rechtsform, der Launch neuer Merchandisingprodukte etc. bestimmen heute den Alltag in den Vorstandsetagen der Sportclubs.15
Auch wenn das hier gezeichnete Bild ein wenig überzeichnet sein mag, zeigt es doch eines ganz deutlich: Die Proficlubs im Fußball, Basketball, Eishockey und im Handball haben sich zu Organisationen gewandelt, die gemeinsam mit den jeweiligen Ligaorganisationen als Kernprodukt ein spannungsgeladenes, emotionales (Premium-)Dienstleistungsprodukt erstellen.16
Diese Entwicklung stellt die Führung professioneller Teamsportorganisationen (TSO) vor neue (ökonomische) Herausforderungen – insbesondere im Hinblick auf das professionelle Managen des Wandels –, die in diesem Ausmaß vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Der häufig in Presse und Literatur geäußerte Verdacht einer mangelnden Professionalität im Management der Clubs deutet an, dass in diesem Bereich noch ein erhebliches Weiterentwicklungspotenzial existiert. 17
Die Forderung nach professionellen Managementstrukturen inklusive eines leistungsfähigen Controllings erscheint in diesem Zusammenhang folgerichtig.18 Dabei muss ein Controllingsystem den spezifischen Anforderungen gerecht werden, denen die Clubs auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten gegenüberstehen.19 Diese Anforderungen ergeben sich im Wesentlichen aus der einzigartigen Situation und den Kontextfaktoren, die das Handeln der Organisationen des professionellen Teamsports bestimmen. Die individuelle Konfiguration des Controllingsystems sollte letztlich so erfolgen, dass es einen Beitrag zur Erreichung der Organisationsziele leisten kann.
Um die Jahrtausendwende begann in der Literatur eine intensive Diskussion der Einführung moderner Management- und Controllinginstrumente im Teamsport und hier vor allem im Fußball. Dabei fokussierten die beiden deutschsprachigen Pionierarbeiten zum Controlling in professionellen Teamsportorganisationen von Dörnemann und Haas20 aus dem Jahre 2002 vor allem den Aspekt der instrumentellen Ausgestaltung des Controllingsystems. Insbesondere gilt dies für die Arbeit von Haas, der ausgehend von einer kurzen Darstellung der Stakeholderbeziehungen professioneller Fußballclubs die Koordination der einzelnen Führungsteilsysteme mittels geeigneter Controllinginstrumente umfassend untersucht.21 Besondere Innovationskraft entwickelt er bei der Adaption klassischer Controllinginstrumente auf die Spezifika professioneller Fußballclubs.22
Aufbauend auf der Argumentationslinie, dass es ohne eingehende Kenntnis der Umwelt und der Branche des Teamsports unmöglich ist, ein geeignetes Controllingsystem für professionelle Teamsportorganisationen aufzubauen, stellt Dörnemann seiner Arbeit eine grundlegende theoretische Analyse der Branchenstruktur voran. Das hier zum ersten Mal explizierte Branchenmodell des professionellen Teamsports basiert auf einer Reihe von Fallstudien und Experteninterviews mit Vertretern und Branchenteilnehmern rund um die beiden deutschen Fußballbundesligen.23 Hinsichtlich der Ausgestaltung des Controllingsystems kommt Dörnemann zu ähnlichen Ergebnissen wie Haas. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Ein Controlling von professionellen Teamsportorganisationen kann nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, den optimalen Fit zwischen den das Controlling und die Organisation beeinflussenden Umwelt- und Situationsfaktoren und der Ausgestaltung des Controllingsystems zu realisieren. Gelingt es, eine optimale Konfiguration zwischen Kontext und Controllingsystem zu erreichen, so können damit positive Effekte auf die Erreichung der Organisationsziele erzielt werden. Folglich muss sich das Controlling den Besonderheiten des Teamsportgeschäfts anpassen.
24
Als zentrale Aufgabe wird dem Controlling durch beide Autoren die Koordinationsfunktion zwischen den einzelnen Führungsteilsystemen zugeordnet. Wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung dieser Funktion ist die Schaffung von Transparenz durch Beschaffung, Analyse und Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen.
25
Hinsichtlich der Institutionalisierung des Controllings wird die Schaffung einer Stabstelle, die direkt dem Vorstand bzw. der Geschäftsleitung unterstellt ist, empfohlen.
26
Neben traditionellen Controllinginstrumenten sollten zur Berücksichtigung der Besonderheiten des Teamsports teamsportspezifische Controllinginstrumente zum Einsatz gelangen.
Die anhand der Fußballbundesligen entwickelten Controllingkonzepte können prinzipiell auch auf andere Teamsportarten (Basketball, Eishockey und Handball) übertragen werden.
27
Trotz des Umstands, dass mittlerweile mehr als eine Dekade ins Land gegangen ist, fehlt es bisher an einer umfassenden empirischen Überprüfung der Annahmen der Pionierarbeiten und ihrer Nachfolger. Die wenigen vorhandenen empirischen Forschungsergebnisse aus den deutschen Fußballbundesligen lassen den Schluss zu, dass mittlerweile in nahezu allen Clubs Controllingstrukturen geschaffen wurden. Für die anderen Teamsportarten fehlt eine entsprechende empirische Bestandsaufnahme nahezu vollständig. Hinzu kommt, dass die wenigen existierenden Studien in ihrem Umfang stark begrenzt sind und, wie später noch zu zeigen sein wird, inhaltlich zu wenig auf die Spezifika des Teamsportcontrollings eingehen.28
Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag leisten, die identifizierte Forschungslücke zu schließen. Im Mittelpunkt sollen dabei die folgenden Forschungsfragen stehen:
Welche Kontextfaktoren haben einen Einfluss auf den Entwicklungsstand der Controllingsysteme im Teamsport?
Wie ist der momentane Entwicklungsstand der Controllingsysteme im professionellen Teamsport? Gibt es Unterschiede aufgrund der individuellen Rahmenbedingungen der Clubs?
Welche teamsportspezifischen Elemente sollte das Controlling im Teamsport umfassen und werden diese aktuell im ausreichenden Maß eingebaut?
Lässt sich ein Einfluss des Entwicklungsstands des Controllings auf den Erfolg der Teamsportorganisation nachweisen?
1Im Rahmen dieser Arbeit werden unter der professionellen Teamsportbranche die 1. Bundesligen im Basketball, Eishockey und Handball sowie die obersten drei Ligen im Fußball subsumiert. Zur Begründung dieser Auswahl vgl. Kapitel B2.
2Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe Verein, Club und Teamsportorganisation rechtsformunabhängig für die Organisationen im Teamsport verwendet. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da es einerseits üblich ist, die Institutionen auf Clubebene – trotz ggf. mittlerweile anderer Rechtsformen – aufgrund ihrer Wurzeln im Vereinsumfeld als Vereine zu bezeichnen und andererseits die Differenzierung der unterschiedlichen Rechtsformen für die Arbeit eine untergeordnete Rolle spielt.
3Es handelt sich hierbei um eine eigene Berechnung. Die Daten wurden entnommen aus DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hg.) 2014, S. 26 und 36, DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hg.) 2015, S. 26 und 34 sowie Deloitte (Hg.) 2014, S. 8. Die Umsatzerlöse wurden ohne Transfererlöse angegeben.
4Vgl. hierzu den Überblick über entsprechende Studien bei Breuer, Mutter 2013, S. 14–18.
5Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hg.) 2015, S. 20–21; ähnlich Sportfive (Hg.) 2004, S. 7.
6Vgl. ebenda, S. 7.
7Vgl. ebenda, S. 13.
8Vgl. ebenda, S. 6.
9Vgl. hierzu exemplarisch die Diskussion in der Presse über die Insolvenz des Basketballclubs Köln 99ers sowie die Insolvenzgefahr bei den Clubs Gießen 46ers und Bayer Giants Leverkusen, o. V. 22.01.2008. Für die Eishockeybundesliga Pöttinger 2002, S. 84–85.
10Vgl. hierzu Klein 2004, S. 14, Schellhaaß 2002, S. 27 sowie Franck 1995, S. 7.
11Vgl. hierzu das anschauliche Beispiel David Beckhams, der zum Schluss seiner Karriere eher durch seine Werbewirkung als durch seine sportlichen Leistungen überzeugte. Vgl. Littkemann, Fietz, Krechel 2006, S. 136.
12Vgl. hierzu Heinemann 1995, S. 231 und Mohr, Bohl 2002, S. 96–97.
13Vgl. Schabelon 2004, S. 53–55.
14Vgl. hierzu u. a. Kipker 2002, S. 1, Wehrle, Heinzelmann 2004, S. 349 sowie kritisch zum Begriff der Kommerzialisierung Heinemann 1995, S. 171–172.
15Vgl. hierzu Dörnemann, Kopp 2000, S. 484.
16Vgl. hierzu Schellhaaß 2002, S. 48 sowie Galli, Wagner 2002, S. 197.
17Vgl. hierzu Dörnemann 1999, S. 1, Dörnemann, Kopp 2000, S. 485 sowie Galli, Wagner 2002, S. 187.
18Vgl. hierzu Keller, Langner et al. 2006, S. 44.
19Vgl. hierzu Dörnemann 2002a, S. 87, S. 89 sowie die Abbildung des Controllingbezugsrahmens S. 114, Dörnemann, Kopp 2000, S. 487 sowie Haas 2006, S. 1.
20Die 1. Auflage der Publikation von Haas ist 2002 erschienen. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts beziehen sich die Seitenangaben auf die 2. Auflage, die 2006 aufgelegt wurde.
21Vgl. Haas 2006, S. 5–40.
22Vgl. ebenda, S. 106–130 sowie S. 210–212.
23Vgl. hierzu Dörnemann 2002a, S. 51–86.
24Vgl. hierzu Dörnemann 2002a, S. 87, S. 89 sowie die Abbildung des Controllingbezugsrahmens S. 114, Dörnemann, Kopp 2000, S. 487 sowie Haas 2006, S. 1.
25Vgl. hierzu Haas 2006, S. 59–60 sowie Dörnemann 2002a, S. 23.
26Vgl. hierzu Dörnemann 2002a, S. 180. Die Ergebnisse der Studie von Keller, Langner et al. 2006, S. 44 zeigen, dass zumindest in den Fußballbundesligen dieser Empfehlung mehrheitlich gefolgt wird.
27Vgl. hierzu Haas 2006, S. 4 sowie Dörnemann 2002a, S. 6.
28Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel D4.
2Zielsetzung und Abgrenzung der Untersuchung
Aus der identifizierten Forschungslücke lässt sich das Oberziel des Forschungsprojekts wie folgt formulieren:
Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über den Entwicklungsstand des Controllings im professionellen deutschen Teamsport zu erlangen. Die empirische Analyse erfolgt dabei unter besonderer Berücksichtigung der Kontextfaktoren des Teamsportcontrollings, der Einbindung teamsportspezifischer Elemente und Instrumente in das Controllingsystem sowie des Einflusses des Controllings auf den Erfolg der Teamsportorganisationen.
Hieraus leiten sich folgende Teilziele (TZ) der Untersuchung ab:
TZ 1: Detaillierte Analyse der Teamsportbranche in Deutschland als Basis für die Ableitung teamsportspezifischer Kontextfaktoren
TZ 2: Analyse des Forschungsstands zum Controlling im Teamsport unter besonderer Berücksichtigung teamsportspezifischer Handlungsfelder
TZ 3: Empirische Analyse und Dokumentation des Entwicklungsstandes des Controllings im professionellen Teamsport
TZ 4: Ableitung von Implikationen aus den Ergebnissen der empirischen Untersuchung für das Controlling von Teamsportorganisationen
Um zu gewährleisten, dass diese Untersuchung hinreichend zielgerichtet und damit erfolgreich durchgeführt werden kann, muss eine Abgrenzung des Problemfeldes erfolgen. Die folgenden Grenzen sollen dabei der Analyse als Leitplanken dienen:
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Analyse des professionellen (Herren-)Teamsports. Forschungsergebnisse aus dem Breiten- und Freizeitsport sollen nur insoweit einbezogen werden, wie sie für das Forschungsprojekt relevant sind.
Das Forschungsprojekt fokussiert auf den deutschen Teamsport. Relevante und übertragbare Erkenntnisse aus der internationalen Teamsportforschung und anderen Sportarten sollen insoweit einbezogen werden, wie es für die Argumentationslinie dieses Forschungsprojekts zweckmäßig ist.
Abbildung 1: Zielsystem der Unstersuchung29
Die Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausgestaltung der Controllingsysteme in Teamsportorganisationen zu beschreiben. Dabei soll versucht werden, Rückschlüsse auf den Kontext, den Entwicklungsstand des Controllings sowie dessen Erfolgsbeitrag zu ziehen. Das Forschungsprojekt verbindet somit hauptsächlich Erkenntnisse aus dem Bereich der Kontingenztheorie mit denen des Controllings. Beiträge anderer betriebswirtschaftlicher bzw. sonstiger wissenschaftlicher Fachdisziplinen sollen insoweit einbezogen werden, wie sie für die hier untersuchten Fragestellungen relevant sind.
Die Arbeit baut in wesentlichen Teilbereichen auf den Pionierarbeiten zum Controlling im professionellen Teamsport von
Haas
und
Dörnemann
auf. Grundlagen des Controllings sollen dabei nur insoweit behandelt werden, wie sie für das Verständnis der Arbeit notwendig sind. Ansonsten wird ein grundsätzliches Verständnis für Controlling- und betriebswirtschaftliche Sachverhalte vorausgesetzt.
Gelingt es, das angestrebte Forschungsziel zu erreichen, so gewinnt das Forschungsprojekt seine innovative Kraft durch die Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes auf die gesamte Teamsportbranche. Es verlässt somit den engen Fokus des Fußballs. Hinzu kommt, dass hier erstmals der Versuch unternommen werden soll, einen umfassenden Blick auf die Gestaltung von Controllingsystemen im Teamsport zu erlangen, ausgehend von teamsportspezifischen Rahmenbedingungen über die Konfiguration der Systemelemente des Controllings bis hin zum Einfluss des Controllings auf die Erreichung der Organisationsziele.
Eine Grundannahme des Forschungsprojektes besteht darin, dass sich der betriebswirtschaftliche Professionalisierungsgrad und damit die Ausgestaltung der Controllingsysteme der Sportclubs innerhalb der eigenen Sportart, aber auch zwischen den verschiedenen Sportarten unterscheiden. Folglich lassen sich durch den Vergleich der einzelnen Sportarten sowie der individuellen Rahmenbedingungen der Clubs ggf. Rückschlüsse auf den Zusammenhang zwischen der Ausgestaltung der Controllingsysteme und dem wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg der Clubs ziehen. Da unterstellt wird, dass die Vereine der Fußballbundesliga sowohl im Hinblick auf die Managementprofessionalisierung als auch auf den wirtschaftlichen Erfolg als führend anzusehen sind, lassen sich durch den Vergleich der verschiedenen Sportarten ggf. evolutionäre Tendenzen ableiten, die für die Weiterentwicklung der Clubs in der Basketball-, Eishockey- und Handball-Bundesliga, aber auch für die Entwicklung der Clubs der jeweiligen untergeordneten Bundesligen von praktischem Nutzen sein könnten.
Um das gesamte Potenzial der hier aufgeworfenen Fragestellung nutzbar machen zu können, ist eine dezidierte methodische Vorbereitung und Vorgehensweise essenziell für die Erreichung der Forschungsziele. Im Folgenden wird deshalb die Methodik des Forschungsprojekts vorgestellt.
29Eigene Darstellung.
3Methodik und Vorgehensweise der Untersuchung
Um die formulierte Zielsetzung zu verwirklichen, ist die vorliegende Arbeit wie folgt aufgebaut:
Zunächst erfolgt im Teil B die Diskussion der theoretischen Grundlagen der Untersuchung. Dazu werden vorab die zentralen Begriffe der Arbeit aus dem Bereich des Teamsports definiert. Anschließend werden die Grundlagen der Kontingenztheorie erörtert. Im Rahmen der Arbeit dient die Neue Institutionenökonomik als theoretische Basis zur Analyse des Verhaltens der Akteure im Teamsport. Diese unterteilt sich wiederum in die Ansätze der Verfügungsrechtetheorie, Transaktionskostentheorie sowie der Prinzipal-Agenten-Theorie. Das Kapitel schließt mit der Darlegung des Controllingverständnisses dieser Arbeit.
Mit Hilfe dieses theoretischen Rüstzeugs erfolgt im Teil C der Untersuchung eine umfassende Analyse der Teamsportbranche. Dabei wird einerseits auf das grundlegende Modell des Branchenwettbewerbs von Porter und andererseits auf das bereits von Dörnemann vorgelegte Branchenmodell des Teamsports aufgebaut. Das Modell von Dörnemann wird dabei erweitert um die auf die Berücksichtigung des ligainternen Wettbewerbs, des Wettbewerbs zwischen den Teamsportarten sowie der Gefahr durch Substitutionsprodukte und potenzielle Konkurrenten. Dieser Teil der Untersuchung beinhaltet eine eingehende Analyse der professionellen Teamsportorganisation. Im Mittelpunkt stehen dabei die Besonderheiten des Zielsystems sowie die Teamsportproduktion. Abschließend werden auf Basis der Branchenanalyse die wesentlichen Kontextfaktoren abgeleitet. Am Ende dieses Abschnitts ist Teilziel 1 des Forschungsprojekts erreicht.
Im anschließenden Teil der Untersuchung steht das Controlling im Teamsport im Mittelpunkt. Zunächst werden hierzu auf Basis des Controllingverständnisses die Besonderheiten des Teamsportcontrollings herausgearbeitet. Im Zentrum dieses Untersuchungsteils steht die Definition und eingehende Analyse teamsportspezifischer Handlungsfelder. Neben den allgemeinen Aufgaben der strategischen, operativen und Liquiditätsplanung zählen hierzu das Personalcontrolling, das Spielstättencontrolling sowie das Controlling der Vermarktungsaktivitäten der Clubs. Dieser Teil schließt mit einem Überblick über bereits existierende empirische Studien zum Controlling im Teamsport. Gelingt es die Besonderheiten des Controllings im Teamsport herauszuarbeiten so kann Teilziel 2 der Untersuchung als erreicht angesehen werden.
Auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen werden im Teil E der Arbeit die Hypothesen zum Controlling im Teamsport gebildet. Im Zentrum stehen dabei Hypothesen zur Wirkung der Kontextfaktoren auf den Entwicklungsstand des Controllingsystems einerseits sowie zur Beziehung zwischen dem Entwicklungsstand der Controllingsysteme und dem Erfolg der TSO andererseits. Ergänzt wird das Untersuchungsmodell durch Hypothesen zur Beziehung zwischen Kontextfaktoren und dem Erfolg der TSO sowie zu den Wirkungszusammenhängen innerhalb des Controllingsystems. Anschließend folgt die Operationalisierung der Variablen des Untersuchungsmodells.
Im nachfolgenden Untersuchungsteil erfolgt die empirische Analyse. Hierzu wird zunächst das Vorgehen im Rahmen der empirischen Studie beschrieben. Anschließend werden die im Rahmen der empirischen Analyse eingesetzten statistischen Verfahren skizziert. Die Darstellung der Rücklaufstatistik sowie der soziodemografischen Ergebnisse der Befragung schließt daran an. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in zwei Teilbereichen: Zunächst werden die deskriptiven Befunde ausführlich dargestellt und diskutiert. Im kausalanalytischen Abschnitt werden die Ergebnisse der Hypothesentests mittels unterschiedlicher Verfahren aufgezeigt und diskutiert. Teil F schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Gelingt auf diese Weise eine umfassende Dokumentation des Entwicklungsstandes des Teamsportcontrollings, kann Teilziel 3 der Arbeit als erreicht angesehen werden.
Im abschließenden Teil der Untersuchung erfolgt zunächst eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Forschungsprojekts. Anschließend werden aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen Implikationen für das Controlling im Teamsport abgeleitet. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Limitationen des Forschungsprojekts und Ansätzen für die weitere Forschungsarbeit im gewählten Themenfeld. Inhaltlich entspricht dies der Verwirklichung von Teilziel 4 des vorliegenden Forschungsprojekts. Die nachfolgende Abbildung fasst den Gang der Untersuchung noch einmal zusammen.
Abbildung 2: Gang der Untersuchung30
30Eigene Darstellung.
B Theoretische Grundlagen
1Ziele des Abschnitts
Im Rahmen dieser Arbeit legen die folgenden Kapitel die theoretische Basis für die anschließende Analyse des Controllings im Teamsport. Dabei werden mit den Ausführungen die folgenden Ziele verfolgt:
Definition der wichtigsten Begriffe der Arbeit,
Aufbau eines konsistenten Theorierahmens, der in der Folge als Grundlage für die Analyse dient, sowie
insbesondere Explizierung der verfolgten Controllingkonzeption.
Dazu werden zunächst die wesentlichen Begriffe aus dem Bereich des Teamsports definiert. Anschließend werden die Grundlagen der Kontingenztheorie und der Neuen Institutionenökonomik dargelegt. Danach erfolgt die Diskussion des Controllingverständnisses dieser Arbeit.
2Begriffliche Grundlagen des Teamsports
Der Versuch, das kulturelle Phänomen Sport in seiner gesamten Fülle und seinen Erscheinungsformen begrifflich zu fassen, stößt schnell an Grenzen, die den Rahmen einer sinnvollen Definition sprengen.31 In der Literatur wird deshalb entweder ganz auf die Definition des Begriffs verzichtet und es somit dem Leser selbst überlassen, was er unter „Sport“ subsumiert, oder es werden – zwangsläufig – relativ allgemeine Definitionen verwendet.32
Nach Volkamer lässt sich Sport wie folgt definieren:
„Sport besteht in der Schaffung von willkürlichen Hindernissen, Problemen oder Konflikten, die vorwiegend mit körperlichen Mitteln gelöst werden, wobei die Beteiligten sich darüber verständigen, welche Lösungswege erlaubt oder nicht erlaubt sein sollen. Die Handlungen führen nicht unmittelbar zu materiellen Veränderungen.“33
Um solche und ähnlich allgemein gehaltene Definitionen zu konkretisieren, werden in der Literatur Kriterien aufgestellt, anhand derer alltägliche Bewegungen und Handlungen von sportlicher Betätigung abgegrenzt werden können.34 Aus der oben aufgeführten Definition und anderen Publikationen lassen sich die folgenden konstitutiven Merkmale des Sports ableiten:
körperliche Leistung und Bewegung,
Wettkampf, bei dem zu Beginn die Teilnehmer dieselbe Ausgangsbasis erhalten und am Ende eine Rangfolge entsprechend dem erzielten Ergebnis gebildet wird,
sportartenspezifisches Regelwerk,
Unproduktivität, da sportliche Handlungen in der Regel nicht darauf abzielen, Produkte zu erstellen oder ein (Kunst-)Werk zu schaffen.
35
Anhand dieser Elemente lassen sich nun die verschiedenen Erscheinungsformen des Sports und Begriffsschöpfungen der Sportliteratur kategorisieren und einordnen, wie z. B. Breitensport, Leistungssport, Extremsport, Berufssport, Amateursport oder Showsport.
Insbesondere die Differenzierung zwischen Hochleistungssport und Leistungssport ist für die weitere Untersuchung relevant. Hortleder definiert:
„Hochleistungssport ist der auf Bundesligaebene betriebene Sport, der in der Regel unter professionellen oder semi-professionellen Bedingungen geplant und durchgeführt wird. Im Unterschied hierzu wird Leistungssport ausgeübt mit dem Ziel, eine persönliche Höchstleistung unter nicht-professionellen Bedingungen zu erreichen.“36
Für das hier angestrebte Forschungsziel ist weiterhin die Klärung der Begriffe Profi- bzw. Berufssport von Bedeutung. In eher soziologisch orientierten Abhandlungen zur Sportwissenschaft wird hierfür auch der Begriff „Showsport“ verwendet.37 Dieser Begriff rührt daher, dass der professionell betriebene, publikumswirksame Sport zur Unterhaltungsindustrie gezählt wird.38Das Merkmal der Unproduktivität gilt für diese Erscheinungsform des Sports nicht mehr, da es ein wesentliches Ziel sowohl der Organisatoren dieser Wettkämpfe bzw. Wettkampfserien als auch der Sportler ist, ein attraktives, vermarktbares (Unterhaltungs-)Produkt zu produzieren. Die aus dem Verkauf der Produkte erzeugten Rückflüsse dienen den Veranstaltern und den Sportlern zur Sicherung ihrer Existenz, wodurch die sportliche Betätigung zum (Haupt-)Beruf der am Produktionsprozess maßgeblich Beteiligten wird.39
In diesem Zusammenhang wird immer wieder das Begriffspaar „Kommerzialisierung“ und „Professionalisierung“ als Indikator für die Entwicklung zum Berufssport diskutiert.40 Nach Schumann lässt sich „Kommerzialisierung“ wie folgt definieren:
„Im ökonomischen Sinne ist die Kommerzialisierung des Sports die nach dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip erfolgende fortschreitende Vermarktung bzw. Verwertung von Sportwaren (sportbezogene Leistungen).“41
Wesentlich ist dabei der Aspekt, dass im Zuge einer fortschreitenden Kommerzialisierung die ideellen Beweggründe des Sporttreibens – wie z. B. Gesunderhaltung von Körper und Geist – zugunsten wirtschaftlicher Gesichtspunkte sukzessive in den Hintergrund gedrängt werden.42
Der Prozess der Kommerzialisierung ist Voraussetzung für eine Professionalisierung der am Produktionsprozess Beteiligten. Hortleder versteht unter Professionalisierung43 den Prozess „der ‚Verberuflichung‘ des Hochleistungssports und der Verwissenschaftlichung des gesamten Sports“44. Konstitutiv aus seiner Sicht ist dabei der Umstand, dass der Prozess systematisch geplant und institutionell gelenkt wird mit dem Ziel, eine Steigerung im Qualifikationsprofil der Beteiligten herbeizuführen.45
Wesentliches Ergebnis der Professionalisierung ist die Entwicklung differenzierter Rollen- und Berufsbilder.46Pöttinger unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen Primärprofessionalisierung, worunter er die Entwicklung von Berufssportlern fasst, und Umfeld- bzw. Sekundärprofessionalisierung, worunter die Verberuflichung der im Umfeld des Sportlers Tätigen (z. B. Trainer, Vereinsführung, Berater) zu verstehen ist.47
Können mit einer Sportart genügend Rückflüsse erwirtschaftet werden, entwickelt sich der Sportlertypus des Berufssportlers oder umgangssprachlich Profis. Im Gegensatz zum Amateur kann der Profi zumindest für eine gewisse Zeit seinen Lebensunterhalt hauptsächlich aus seiner sportlichen Tätigkeit bestreiten.
Auch der Begriff „Profi“ kann die Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen des professionellen Sportlers in der Realität nur unzureichend fassen. Fischer unterscheidet beispielsweise in Berufssportler im engeren Sinne, „die wiederum ihre Existenz ganz auf die zu erbringende [sportliche] Leistung ausgerichtet haben.“48 Kennzeichnend für diese Sportler ist, dass ihre Tätigkeit als Beruf anerkannt wird und sie hieraus solch hohe Erträge generieren können, dass von einer „kontinuierlichen Erwerbs- und Versorgungschance“49 aus der sportlichen Tätigkeit, auch über die eigentliche sportliche Karriere hinaus, gesprochen werden kann.
Außerdem identifiziert Fischer als Berufssportler Sportler, die er als „professionalisierte Amateure“ bezeichnet. Charakteristisch für diese Gruppe von Sportlern ist, dass sie neben dem Sport eine Ausbildung, einen Beruf oder ein Studium absolvieren. Diese Tätigkeit bildet allerdings nicht die Basis ihrer Existenzsicherung. Ihre sportliche Betätigung ist nicht als Beruf anerkannt; dennoch erzielen sie mit dem Sport überdurchschnittliche Einnahmen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können.50
Als dritte Gruppe sieht er Sportler, die „es durch zeitliche Freistellung und finanzielle Unterstützung ermöglicht bekommen, ihren aufwendigen Trainingsund Wettkampfverpflichtungen beim Hochleistungssport nachzukommen.“51 Kennzeichnend für diese Sportler ist, dass sie in der Regel lediglich ein durchschnittliches Entgelt für das Bestreiten ihres Lebensunterhaltes erhalten.52 Unter diese Kategorie fallen beispielsweise die Soldaten in den Sportfördergruppen der Bundeswehr.53
Für die Abgrenzung des Untersuchungsobjektes ist weiterhin die Unterscheidung von Individualsport und Mannschafts- oder Teamsport wichtig. Im Gegensatz zum Individualsport zeichnen sich Mannschaftssportarten „dadurch aus, daß sie von der Handlungsidee her sinnvoll nur dadurch ausgeübt werden können, daß durch regelgerechte Zusammenfassungen mehrerer einzelner Sportler (bei Ballsportarten ‚Spieler‘) Mannschaften gebildet werden, die – meist unter dem Dach einer rahmengebenden ‚Liga‘ – gegeneinander antreten.“54
Das daraus resultierende Spiel ist das Ergebnis einer Teamproduktion, genauer das Ergebnis eines konkurrierenden Aufeinandertreffens zweier Teams. Auch die Bildung einer Liga ist wiederum das Resultat der gemeinsamen Produktion verschiedener Teams. Folglich ist im Teamsport die individuelle, unabhängige Erbringung der sportlichen Leistung per definitionem unmöglich. Um Mannschaftssport auf einem qualitativ hohen Niveau anbieten zu können, sind folglich bestimmte institutionelle und organisatorische Voraussetzungen zu schaffen.55
Die oben aufgeführte Terminologie ist die Voraussetzung, um das zentrale Untersuchungsobjekt dieser Forschungsarbeit genauer abgrenzen zu können: die professionelle Teamsportorganisation:
Im Rahmen dieser Arbeit sollen unter professionellen Teamsportorganisationen (TSO) Organisationen (Vereine oder Clubs mit anderen Rechtsformen) verstanden werden, die ein qualitativ hochwertiges Unterhaltungsprodukt aus dem Hochleistungsteamsport und daraus abgeleitete Produkte anbieten mit der Absicht, den maximalen sportlichen Erfolg56 zu erzielen. Hierzu setzen sie als wesentliche Produktionsfaktoren Berufssportler ein. Außerdem weisen diese Unternehmen zur Sicherung der Qualität des Teamprodukts einen relativ hohen Grad an Sekundärprofessionalisierung im Umfeld der Berufssportler auf.57
Im Rahmen dieser Arbeit werden zur Branche des professionellen Teamsports in Deutschlands die Clubs der BBL, HBL, DEL sowie der ersten drei Ligen im Fußball gezählt. Diese Abgrenzung wurde aus den folgenden Gründen gewählt:
Das vorliegende Datenmaterial lässt den Schluss zu, dass die Clubs in diesen Ligen über die notwendige Ertragskraft verfügen, um Hochleistungssport im Sinne der hier verwendeten Definition zu betreiben.
58
Gleichzeitig steht zu vermuten, dass dies beispielsweise für die Clubs in den 2. Bundesligen des Basketballs, Eishockeys, Handballs und der Regionalliga im Fußball nicht uneingeschränkt zutrifft.
Insbesondere ist davon auszugehen, dass die Spieler flächendeckend nur in den hier betrachteten Ligen ein entsprechendes Einkommen erzielen, um als Berufssportler charakterisiert werden zu können.
59
Außerdem ist davon auszugehen, dass TSO in den hier nicht betrachteten unteren Ligen nicht die notwendige Komplexität und Größe erreichen. Damit ist der Grad der Sekundärprofessionalisierung als gering einzustufen.
Im Übrigen deckt sich die hier gewählte Abgrenzung mit Analysen zum Teamsport in Deutschland.
60
31Vgl. Heinemann 2007, S. 53–54 und Schumann 2005, S. 13. Zu den teilweise konkurrierenden Sinnmustern des modernen Sports Grupe 2000, S. 13.
32Vgl. Benner 1992, S. 3, Heinemann 2007, S. 54–55 sowie Hortleder 1978, S. 11.
33Volkamer 1984, S. 196. Vgl. zur sprachgeschichtlichen Entwicklung des Begriffs „Sport“ Schumann 2005, S. 13, der darauf hinweist, dass sich der Terminus wahrscheinlich aus dem altlateinischen deportare und isportus (vergnügen, amüsieren, ablenken) ableitet, woraus sich im Französischen der Begriff desport (Erholung, Entspannung) und im Englischen der Begriff sport (Spaß, Spiel, Zeitvertreib) entwickelte. Durch den Fürsten Pückler wurde das Wort „Sport“ 1828 erstmals in die deutsche Sprache eingeführt.
34Vgl. Dörnemann 2002, S. 21.
35Vgl. Heinemann 2007, S. 56 sowie Benner 1992, S. 4–6, der anstelle von Unproduktivität das Merkmal „unmittelbare Folgenlosigkeit“ nutzt, was inhaltlich allerdings als synonym angesehen werden kann.
36Hortleder 1978, S. 23.
37Vgl. exemplarisch Heinemann 2007, S. 58 und Hortleder 1978, S. 23, der wie folgt definiert: „Showsport ist technisch-wissenschaftlich fundierte, arbeitsmäßig vorbereitete, in der Regel als Beruf ausgeübte und als Show präsentierte Unterhaltung. Showsport wird vor einem Massenpublikum im Stadion oder auf der Rennstrecke regelmäßig ausgeübt und gleichzeitig oder zeitversetzt im Massenmedium Fernsehen ausgestrahlt. Je nach Gesellschaftssystem dient der Showsport dem Heroenkult zu individuellen oder kollektiven Zielen.“
38Vgl. Hortleder 1978, S. 23.
39Vgl. Fischer 1986, S. 55 und Benner 1992, S. 19.
40Vgl. ausführlich Hortleder 1978, S. 29, der neben den beiden aufgeführten Indikatoren noch die Instrumentalisierung, Internationalisierung und Visualisierung nennt.
41Schumann 2005, S. 9.
42Vgl. Brandmaier, Schimany 1998, S. 20.
43Vgl. ausführlich zur etymologischen Herleitung der Begriffe „Professionalisierung“ und „Profession“ Pöttinger 1989, S. 20–27 und Fischer 1986, S. 1–12.
44Hortleder 1978, S. 29.
45Vgl. Hortleder 1978, S. 33.
46Vgl. Fischer 1986, S. 13.
47Vgl. Pöttinger 1989, S. 26–27.
48Fischer 1986, S. 59–60.
49Ebenda, S. 60.
50Vgl. ebenda.
51Fischer 1986, S. 60.
52Vgl. ebenda, S. 60–61.
53Für die hier verfolgten Forschungsziele sind insbesondere die beiden ersten Berufssportlertypen von Interesse. Hierzu bedarf es im weiteren Fortgang der Untersuchung weiterer Konkretisierungen und Differenzierungen, die in einem späteren Teil der Arbeit vorgenommen werden sollen. Vgl. exemplarisch hierzu zunächst Lang 2008, S. 49.
54Benner 1992, S. 24.
55Vgl. ausführlich zum Produktionsprozess im Teamsport die Ausführungen in C5.5.
56Die Dominanz der sportlichen Zieldimension wird hier zunächst unterstellt, ohne diese eingehender zu diskutieren. Eine ausführliche Diskussion über die Ziele der Teamsportunternehmen erfolgt in Kapitel C5.2.
57Vgl. ähnliche Definitionen bei Dörnemann 1999, S. 14–15 und Dörnemann 2002, S. 21–24.
58Vgl. hierzu ausführlich C4.5.3.
59Vgl. hierzu die Ausführungen unter C4.1.2.2.
60
3Grundlagen der Kontingenztheorie
Die Entwicklung der Kontingenztheorie61 reicht bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück.62 Den Ausgangspunkt bildete die Kritik an früheren Ansätzen der Organisationsforschung, insbesondere des Bürokratiemodells nach Max Weber.63
Zentrales Element der Arbeiten des Soziologen Weber war die Untersuchung des Prozesses der Rationalisierung auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen.64 Neben der Rationalisierung auf Ebene der Weltbilder bzw. Religionen65 und der praktischen Lebensführung66 analysierte er auch die Rationalisierung auf der Ebene der Institutionen. Hierzu entwickelte er drei Idealtypen der Herrschaft.67 Im Fall der legalen Herrschaft ist die effizienteste Organisationsform die der Bürokratie.68 Diese von Weber als Idealtyp konzipierte, maschinenmäßig funktionierende, von allen menschlichen Einflüssen befreite Organisationsform hat in der Folge eine ungeheure Faszination auf Theorie und Praxis ausgeübt.69
Erst die enttäuschenden Ergebnisse der empirischen Überprüfung des Bürokratiemodells und die daraus resultierende Erkenntnis, dass für Organisationen ein unterschiedlicher Grad an Bürokratisierung und Arbeitsteilung effizient sein kann, führten zu einem Umdenken in der Organisationsforschung.70 Die Suche nach dem „one fits all“-Modell wurde zugunsten einer differenzierteren Sichtweise auf Organisationen aufgegeben.71 Wesentlich vorangetrieben wurde dieser konzeptionelle Wandel durch die Vertreter der Kontingenztheorie.72
Die wesentliche Innovation der Kontingenztheorie bestand darin, dass von der Vorstellung einer Organisationsstruktur, die unter allen vorstellbaren Bedingungen optimal ist, abgerückt wurde.73 Damit öffnete sich der Organisationsforschung ein weites Betätigungsfeld. Die Kontingenztheorie erklärt die existierende Organisationsvielfalt mit der Notwendigkeit, dass eine Organisation sich an ihre jeweils spezifische Situation anpassen muss, um ihren Erfolg bzw. ihr Überleben zu gewährleisten.74 Anders formuliert kann ein Unternehmen nur erfolgreich sein, wenn seine Organisationsstruktur an der jeweiligen Unternehmensumwelt optimal ausgerichtet ist.75 Der Begriff der Kontingenz wird hierbei verstanden als Abhängigkeit von spezifischen Situationsfaktoren.76 Diese relativ einfache Grundphilosophie basiert auf einer Vielzahl impliziter und expliziter Annahmen:
Unternehmen als offene Systeme: Der situative Ansatz baut auf der systemtheoretischen Sicht auf. Unternehmen sind offene, soziotechnische Systeme, die selbst Bestandteil übergeordneter Systeme sind bzw. wiederum aus Subsystemen bestehen und in einer Vielzahl von Austauschbeziehungen mit ihrer Umwelt agieren.
77
Fit-Konzept: Prinzipiell wird unterstellt, dass Unternehmen, die eine höhere Kongruenz, einen höheren Fit zwischen der Organisationsstruktur und dem Unternehmenskontext aufweisen, erfolgreicher sind. Dabei wird Erfolg in der Regel über finanzielle Größen wie Umsatz, Gewinn oder Return on Investment operationalisiert.
78
Vollständige Rationalität: Die Kontingenztheorie geht implizit davon aus, dass die Entscheidungsträger innerhalb der Organisation immer vollständig rational im Sinne der Unternehmensziele agieren. Rationalitätsdefizite der Akteure werden in der Regel nicht thematisiert.
79
Situativer Determinismus: In seiner restriktivsten Auslegung billigt der situative Ansatz dem Management keine Handlungsoptionen zu. Entweder wird das Unternehmen der Situation angepasst oder es geht unter. Die Möglichkeit der aktiven Beeinflussung der Umwelt durch Handlungen des Managements im Sinne der Organisationsziele wird damit ausgeblendet.
80
Lineare Kausalbeziehungen: Die Vertreter der Kontingenztheorie unterstellen häufig einfache, einseitige, lineare Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den unabhängigen Variablen des Kontextes und abhängigen Variablen der Organisationsstruktur sowie zwischen Struktur und Unternehmenserfolg. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Kontextvariablen bzw. Strukturvariablen werden in der Regel nicht thematisiert.
81
Das Forschungsprogramm des situativen Ansatzes kann mittels dreier Fragestellungen umrissen werden:
Wie lassen sich bestehende Organisationsstrukturen beschreiben bzw. messbar machen?
Wie lässt sich die Situation des Unternehmens operationalisieren und welche Kontextfaktoren erklären eventuell festgestellte Unterschiede zwischen Organisationsstrukturen?
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Kontext, Struktur, Verhalten der Organisationsmitglieder und Erfolg der Organisation?
82
Um diese Fragenkomplexe beantworten zu können, mussten die Vertreter der Kontingenztheorie folgende Voraussetzungen schaffen:
eine operationalisierbare Konzeption der Organisationsstruktur,
die Entwicklung einer Konzeption des Kontextes,
eine operationalisierte Konzeption des Mitgliederverhaltens und der Organisationseffizienz sowie
die Entwicklung von Arbeitshypothesen über den Zusammenhang zwischen Situation, Struktur, Verhalten und Organisationserfolg.
83
Die Konzeption der Organisationsstruktur wurde hauptsächlich entlang der oben aufgeführten Prinzipien des Bürokratiemodells von Weber entwickelt.84 Nichtsdestotrotz variieren die gewählten Dimensionen zwischen den verschiedenen empirischen Arbeiten.85Breilmann identifizierte auf Basis von 29 empirischen Studien zum situativen Ansatz die folgenden sechs Strukturdimensionen, die als empirisch abgesichert gelten können:
Spezialisierung: als Grad der Arbeitsteilung in einer Organisation





























