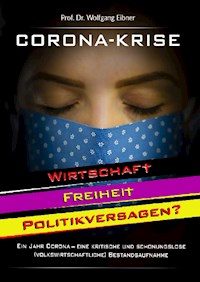
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Unser Leben wird seit über einem Jahr beherrscht von Lockdowns und Beschränkungen unseres ökonomischen wie sozialen Lebens und unserer Grundrechte, die bislang in einer freien, demokratischen Gesellschaft undenkbar waren. Rezession und Massenarbeitslosigkeit werden möglicherweise die langfristigen Folgen sein. Damit ergeben sich generelle Fragen: Wie wird unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft die aktuelle Pandemie überstehen? Was sollte sich nach der Pandemie ändern, gesellschaftlich und ökonomisch? Hat die Globalisierung in ihrer bisherigen Form noch eine Zukunft? Trifft die Politik richtige Entscheidungen auf Basis von Wissen und Denken? Es stellen sich aber auch viele konkrete Fragen, auf die dieses Buch wissenschaftlich aufwändig und überprüfbar recherchiert Antworten sucht: Warum führt die aktuelle Pandemie weltweit und auch in entwickelten Industriestaaten zu so harten staatlichen Reaktionen? Warum fürchten sich auch Länder wie Deutschland vor einem exponentiellen Mortalitätsanstieg? Ist die Ursache hierfür eine tödliche Pandemie oder liegt der Grund evtl. vielmehr in einem neoliberal kostenminimierend geführten Gesundheitssystem, das bis zum Tod spart? Ist das Augenmaß bei all den tief in unsere gesellschaftlichen Freiheitsrechte eingreifenden Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gegeben? Was werden die zentralen ökonomischen Kosten des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lockdowns sein? Wird nicht vielleicht mit den bisherigen Maßnahmen sogar Europa generell geschwächt, im Vergleich zu z. B. China? Ist die deutsche Politik der großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderung dieser Pandemie gewachsen oder liegt hier Politikversagen vor? Sind die bisherigen Maßnahmen überhaupt wissenschaftlich epidemiologisch unterlegt und insofern zielführend oder nur primär angstbasiert und damit von dramatischer Konsequenz für unsere Wirtschaft, für unsere Bürgerrechte und unsere freie Gesellschaft – also verheerend für unsere Zukunft?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Eibner
Professor für VWL und Wirtschaftspolitik an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Diplom-Volkswirt, Universität zu Köln; Dr. rer. pol., Universität Passau
CORONA-KRISE
Wirtschaft
Freiheit
Politikversagen
Ein Jahr Corona – eine kritische und schonungslose
(volkswirtschaftliche) Bestandsaufnahme
Copyright: Prof. Dr. Wolfgang Eibner
epubli, holtzbrinck Publishing Group, Berlin, Stuttgart 2021
Das Buch ist urheberrechtlich geschützt.
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks bzw. der Kopie wie auch der digitalen Weitergabe, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Zitierungen in wissenschaftlichen Publikationen sind erwünscht.
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
die gegenwärtige Corona-Krise stellt die Gesellschaft vor viele Fragen, auf die wir, zumindest aktuell, nur wenig Antworten haben.
Entsprechend bewegen die Herausforderungen der aktuellen Pandemie nicht nur Studierende an unserer Hochschule nachhaltig.
Ein für die Lehrgebiete Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik berufener Professor ist damit Ansprechpartner für die vielfältigsten Fragen ökonomischer und wirtschaftspolitischer Konsequenzen dieser Pandemie.
Bei der Beschäftigung mit den ökonomischen Implikationen dieser Krise wird aber sehr schnell deutlich, dass hier nicht nur rein medizinische und rein ökonomische Fragestellungen relevant sind, denen sich der mündige Bürger stellen muss – vielmehr stellen sich massive gesellschaftspolitische Fragen.
Hinzu kommt, dass auch im universitären Umfeld ein teilweise erschreckendes Unwissen über Fakten oder darüber, wie man selbst seriös recherchiert, herrscht. Zudem grassieren im Bereich der Corona-Politik extreme Verschwörungstheorien, so dass hier eine wissenschaftsbasierte Darstellung hilfreich sein kann.
Die Volkswirtschaftslehre als Wissensgebiet hat ihr historisches Fundament in den sog. „Staatswissenschaften“ – damit ist es traditionell Aufgabe eines Volkswirts, sich mit allen Aspekten staatlicher volkswirtschaftlicher Entwicklungen zu befassen – und nicht nur mit engen Theoriemodellen, die in der Realität meist ohnehin nicht eins zu eins umsetzbar sind.
Entsprechend habe ich mich entschlossen, einen Beitrag zur aktuellen Corona-Krise zu schreiben, der im Sinne der guten alten Tradition der Volkswirtschaftslehre als „Staatswissenschaften“ nicht nur rein ökomische Aspekte betrachtet (wobei Letzteres faktenbezogen recht einfach wäre, da die coronabedingte Rezession uns alle national wie international noch viele Jahre belasten wird), sondern versuchen will,
Fragen zu stellen, die zum einen viel stärker in eine philosophisch angehauchte Richtung gehen, und zum anderen
die Pandemie auch als massive Krise – nicht nur unserer Ökonomie – zu betrachten, aus der sich vielfältige Gefahren für unser Staatswesen und letztlich auch für unsere demokratische Grundordnung ergeben.
Im Folgenden soll daher eine Vielfalt von Fragestellungen untersucht werden, die aus volkswirtschaftlich-staatswissenschaftlicher Sicht Antworten suchen.
Kapitel 1
wird sich der Frage widmen, mit welchen eher wirtschaftsphilosophischen Themen uns die Corona-Krise konfrontiert und was sich grundlegend ändern müsste, um unser Wirtschaftssystem nach der Krise nachhaltiger und krisenfester aufzustellen.
In den Kapiteln 2 bis 7 werden sechs zentrale und ganz konkrete, sich aus der Corona-Krise ergebende Fragestellungen näher betrachtet unter Aspekten, wie die Corona-Krise volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch hinsichtlich ihrer Konsequenzen, Kosten und Perspektiven zu beurteilen ist.
Dies unter besonderer Berücksichtigung der Konsequenzen des Lockdowns auf
unsere Wirtschaft auch in langfristiger Perspektive,
unsere Freiheit auf Basis der Grundrechte des Grundgesetzes und
unsere Politik: inwieweit staatliche Stellen und Entscheidungen unsere Gesellschaft bislang strategisch kompetent durch die Krise führen konnten.
Kapitel 2:
Warum führt die aktuelle Pandemie weltweit und auch in entwickelten Industriestaaten zu so harten staatlichen Reaktionen? Warum fürchten sich auch Länder wie Deutschland vor einem exponentiellen Mortalitätsanstieg? Ist die Ursache hierfür eine tödliche Pandemie oder liegt der Grund evtl. vielmehr in einem neoliberal induzierten Niedergang leistungsfähiger Gesundheitssysteme?
Kapitel 3:
Ist das rechte Augenmaß bei all den tief in unsere gesellschaftlichen Freiheitsrechte eingreifenden Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gegeben?
Kapitel 4:
Was werden die zentralen ökonomischen Kosten des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lockdowns sein?
Kapitel 5:
Ist die deutsche Politik der großen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und medizinischen Herausforderung dieser Pandemie national wie auch z. B. innerhalb der Europäischen Union gewachsen oder liegt hier letztlich tendenzielles Politikversagen vor?
Kapitel 6:
Wie werden sich weltweit die ökonomischen und damit auch politischen Kräfteverhältnisse infolge der Corona-Pandemie verändern – beschleunigen die Auswirkungen und Konsequenzen dieser Pandemie den Aufstieg Chinas zur beherrschenden Macht des 21. Jahrhunderts?
Kapitel 7:
Und last, but not least: Welches Fazit kann aus wissenschaftlicher Sicht gezogen werden aus den bisherigen Bemühungen, die Pandemie angemessen zu beurteilen und hierauf adäquat im Sinne einer optimierten Kosten-Nutzen-Betrachtung – unter Beachtung des „(Über-)Lebens“ als höchster Wert –zu reagieren?
Zu jedem dieser sieben Themenbereiche kann problemlos ein eigenes Sach- oder Lehrbuch geschrieben werden.
Die Intention der nachfolgenden Betrachtungen ist es insofern lediglich, dem Leser diverse Informationen und Denkanstöße zu geben, einige der folgenden Ausführungen weiterzuverfolgen oder sich – insbesondere bei den Fragen zur weiteren Gestaltung unseres Gesundheitssystems wie auch des Umganges mit Freiheitsrechten in Zeiten großer externer Herausforderungen – der akademischen Diskussion von These und Antithese zu stellen.
Jena, April 2021
Wolfgang Eibner
1. Die Corona-Krise als Bedrohung der Globalisierung
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen und eine zentrale Frage dabei ist: Wie geht es weiter nach der Krise? Oder eher:
Wie
sollte
es weitergehen nach der Krise?
{1}
1.1 Die Verantwortung neoliberalen Denkens für die aktuelle Situation
Insbesondere unsere westlichen Gesellschaften mit den USA an der Spitze der „neoliberalen ökonomischen Evolution“, aber auch China mit einem verdeckten, aber umso radikaleren System der wirtschaftlich globalisierten Ausbeutung unseres Planeten, verfolgen seit spätestens den frühen 80er und 90er Jahren einen globalisierungskapitalistischen Weg, der nicht nur unseren Planeten, sondern auch uns Bürger überfordert.
Der Neoliberalismus entmündigt weltweit den Bürger zugunsten immer höherer Profite für immer weniger Globalisierungsgewinner, immer fragilerer Sozialsysteme und immer globalisierterer Liefer- und damit auch Versorgungsketten.
Das Problem einer Kritik am neoliberalen Kapitalismusbild ist, dass diese Wirtschaftsordnung eine im historischen Vergleich nie dagewesene, immer weiter steigende materielle Güterversorgung der Welt und daraus resultierendes Wachstum und oft auch Wohlstand generieren konnte.
Die Schattenseite dieser unbestreitbaren materiellen Erfolgsbilanz aber umfasst
zum einen ein „Leben jenseits aller Ressourcen“ im Sinne einer zunehmenden Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten durch Vernichtung von deren letzten Lebensräumen, Abholzung der letzten Primärwälder insbesondere am Amazonas, in Indonesien und Zentralafrika, einschließlich der u. a. hierdurch mitverursachten Klimaveränderungen,
zum anderen vor allem aber auch die zunehmenden sozialen Verwerfungen infolge einer Umverteilung der Wohlstandsgewinne von „unten“ nach „oben“.
Mein Kollege Thomas PIKETTY hat in seinen zwei wegweisenden Werken{2}, {3} ganz klar und unwiderlegbar herausgearbeitet, dass wir uns seit Beginn der „neoliberalen Revolution“ durch die sog. Monetaristen in Wissenschaft (Milton FRIEDMAN) und Politik (Ronald REAGAN und Margaret THATCHER in der Vergangenheit oder insbesondere auch solche Leute wie TRUMP, BOLSONARO und DUTERTE aktuell) einer dramatischen und jede Nachhaltigkeit ignorierenden Umverteilung von Einkommen und vor allem aber von Vermögen an das oberste Dezil (10 %) beim Einkommen oder gar Perzentil (1 %) beim Vermögen der Bevölkerung gegenübersehen.
Das heißt im Klartext: Die großen ökonomischen Gewinne aus der Globalisierung gehen an der großen Masse der Bevölkerung nicht nur vorbei, sondern die große Masse der Bevölkerung wird immer ärmer und lebt in einem immer prekäreren ökonomischen Umfeld: statt lebenslanger beruflicher Sicherheit fragwürdige, befristete Arbeitsverträge, marode Gesundheitssysteme, überforderte Altersversorgung, kinderfeindliche Lebens- und Arbeitsbedingungen, sich verschlechternde Umweltsituation usw.
Was wir als Bürger und Gesellschaft in den letzten Jahren nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten, ist folgender dramatischer Wandel, der die (keynesianische) Ordnung der 50er, 60er und 70er Jahre so grundlegend unterscheidet von der sich spätestens seit Anfang der 80er Jahre immer stärker neoliberal ausrichtenden Wirtschaftsstruktur:
Die Wirtschaft, die Ökonomie, war für den Menschen da;
jetzt
ist der Mensch für die Wirtschaft da.
Alle Produktionsfaktoren – und dazu gehört auch der Mensch – müssen um jeden Preis kostenminimiert, rationalisiert, jederzeit schnell substituierbar „verwendet“ werden, nur dann ist das Unternehmen wettbewerbsfähig und kann überhaupt noch Arbeitsplätze bereitstellen.
Und genau das ist das Dilemma: Kein Unternehmen, auch keine einzelne Gesellschaft (Staat, Regierung, Bevölkerung) kann sich dieser „Ausbeutungsoptimierung“ entziehen, ohne völlig aus dem ökonomischen Kreislauf zu fallen.
Dabei nimmt diese Fokussierung auf eine Kostenminimierung um jeden Preis auch nicht das Gesundheitssystem aus:
Ganz im Gegenteil werden hier seit spätestens Anfang der 90er Jahre Krankenhäuser (ebenso wie Pflegeeinrichtungen) zunehmend nicht mehr versorgungsorientiert geführt,sondern gewinnorientiert. Staatliche Krankenhäuser werden zunehmend privatisiert und damit immer offener „kostenverantwortlich“ geführt – was nichts anderes heißt, als massiv Personal einzusparen und immer weniger Ressourcen (für Unwägbarkeiten und zur Krisenvorsorge) vorzuhalten. So verwundert es wenig, dass die Todesfälle im Rahmen der Corona-Pandemie dort am stärksten sind, wo die Gesundheitssysteme durch zu geringe Investitionen marode sind und/oder mit zu wenig Personal (kompetentes, ausgebildetes Pflegepersonal) geführt werden. Unrentable Krankenhäuser werden geschlossen – und erhöhen damit potentielle Versorgungsengpässe oder gar -lücken in Zeiten wie diesen (Pandemien).
Damit sind wir bei der Eingangsfrage dieser Überlegungen:
Die Corona-Krise zeigt in aller Härte auf, dass die Globalisierung, die die Welt wie ein Spinnennetz umfasst, zukünftig nicht mehr akzeptable Risiken birgt:
Wir stellen zum ersten Mal fest, dass unser Konsum und die vermeintlich dauerhafte Versorgungssicherheit im Güter- wie im Gesundheitsbereich doch extrem fragil sind: Vorprodukte, Waren jeder Art, Lebensmittel etc. kommen aus fernen Regionen wie China und Afrika, Medikamente sehr häufig aus Indien oder China.
Wir erkennen, dass globale Lieferketten anfällig sind in einem Ausmaß, das wir bis zur Corona-Krise ignorieren konnten: „Es wird schon nichts passieren.“ Jetzt aber ist offensichtlich, dass diese globalisierte Versorgung existentiell anfällig ist. Nur ein kleines, fast banales Beispiel: Natürlich gibt es in Deutschland und der Europäischen Union genug Milch, keiner wird hieran Mangel leiden. Was aber ggf. fehlt, weil es beispielsweise nicht mehr aus China geliefert wird, sind die Verpackungen für die Milch – und plötzlich steht möglicherweise doch keine Milch mehr im Ladenregal.
1.2 Was sich ändern muss: verantwortungsvolles Wirtschaften und nachhaltigerer Konsum
Wir – Unternehmen wie Konsumenten – werden wieder regionaler denken und agieren müssen: Viele Produkte müssen im Land oder im engeren Umfeld (EU) hergestellt werden, auch wenn dies teurer wird, als die Waren aus Asien, Lateinamerika oder Afrika zu beziehen (wobei die Produkte dort u. a. deshalb so günstig sind, weil Umwelt- und Sozialdumping wie auch Kinderarbeit feste Bestandteile dieser Ökonomien sind – ebenso wie eine Entlohnung im sogenannten „Ausbeutungsgleichgewicht“ einer bei Lohnsenkungen ansteigenden Arbeitsnachfrage seitens der Arbeitnehmer{4}).
Unternehmen müssen wieder verstärkt den Stakeholder (Kunden, Mitarbeiter) in den Fokus ihrer Geschäftspolitik stellen und weniger den Shareholder (Aktionär), notfalls „motiviert“ durch regulatorische oder steuerliche Rahmenbedingungen.
Der Bürger muss sich bewusst machen, dass er durch eine „Geiz ist geil“-Mentalität seinen regionalen Arbeitsplatz selbst vernichtet und dass er seine staatliche Altersversorgung und Gesundheitssicherung verspielt, wenn er nur das Billigste kauft.
Wir alle müssen erkennen, dass weniger mehr sein kann:
Wir brauchen weniger, wenn wir unsere Bedürfnisse hinterfragen und nur das kaufen, was wir wirklich benötigen, wenn wir nachhaltig denken und kaufen: Ein doppelt so teures Produkt, das dreimal so lange hält oder dreimal so viele Vitalstoffe enthält, ist das günstigere Produkt.
Warum werden allein in Deutschland pro Jahr 20 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen (= 250 kg pro Person)? Wo ist die Wertschätzung z. B. für „Lebens“-Mittel?
Warum arbeitet „niemand“ im Agrarsektor? Warum müssen ca. 300.000 ausländische Landarbeiter{5} für uns Deutsche die Felder bestellen und ernten (bei Millionen von Hartz-IV-Beziehern oder beschäftigungslosen Migranten)?
Was, wenn – krisenbedingt – diese Wanderarbeiter nicht mehr kommen (können), um unsere Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten? Ist dieser Sektor irrelevant, nur weil er in Deutschland weniger als 1 % der Wertschöpfung ausmacht – vielleicht aber genau dieses eine Prozent über Leben und Tod entscheidet?
Was ist also die Konsequenz?
Wir brauchen eine neue Verantwortung für unser Leben und unsere Gesellschaft: bewusster, nachhaltiger Konsum
{6}
und damit auch nachhaltige Produktion.
Letztlich wird so produziert, wie es der Kunde will. Und durch gerechte Entlohnung statt globalisierter Ausbeutung{7} kann sich der Bürger dann auch höherwertige Güter leisten. Für den Ökonomen ist gerechte Entlohnung recht einfach: Entlohnung gemäß der Grenzproduktivität der Produktionsfaktoren Arbeit (Mensch) und Kapital (Zinsen und Maschinen){8}. Das aber ist nur möglich bei gleich starken Marktseiten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer: Solange dem Arbeitnehmer mit „Globalisierung“ gedroht werden kann („Arbeite für weniger Lohn, sonst ist dein Job weg!“), wird Entlohnung nicht gerecht sein können.
Wie wir dem entgehen können: Rückbesinnung auf die Region (für uns sind das Deutschland und die EU) mit eigenen geeigneten und europäisch koordinierten regulierenden Maßnahmen zu einer Abgrenzung von weiterhin neoliberal agierenden Weltregionen.
Die im Vergleich zu vergangenen Zeiten heute sehr hohe Produktivität im Sinne sehr hoher Güterproduktion bei vergleichsweise geringem Arbeitseinsatz zumindest in den sog. entwickelten Volkswirtschaften Nordamerikas, Europas und Japans würde uns eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Werte des Lebens ermöglichen, die – wenn der Corona-Pandemie überhaupt ein Wert zugemessen werden kann – uns durch ebendiese Krise bewusster werden sollten:
Der große Ökonom Lord John Maynard KEYNES hatte bereits 1928 seine zwei Jahre später als „Economic Possibilities for our Grandchildren“{9} („Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder“) publizierten Gedanken zur Zukunft der Arbeitswelt formuliert und prognostiziert,
dass der Mensch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse aufgrund des seinerzeit sich immer stärker beschleunigenden technologischen Fortschritts im Jahre 2028 (also quasi jetzt)
nurmehr 15 Stunden pro Woche arbeiten
müsse, um seinen Bedarf an Grund- und Luxusgütern vollumfänglich decken zu können.
Von den „drückenden wirtschaftlichen Sorgen“ sei die Menschheit bis dahin erlöst und unser größtes Problem werde dann die Frage sein, wie wir unsere ganze freie Zeit sinnvoll würden füllen können.
KEYNES hatte Recht bzw. den folgenden technologischen Wandel sogar noch unterschätzt. Noch stärker unterschätzt hatte er aber, dass wir sehr wohl eine Lösung gefunden haben, wie wir unsere „freie Zeit“ nutzen können: über von natürlichen Bedürfnissen zunehmend losgelösten Massenkonsum in einer „Wegwerfgesellschaft“.
Wenn wir also heute statt dieser 15 Stunden immer noch knapp 40 Stunden pro Woche arbeiten (und z. B. Geringqualifizierte aufgrund zu geringer Entlohnung wie auch Fachkräfte aufgrund zu geringer Verfügbarkeit teilweise noch viel länger), so liegt dies primär an zwei Gründen:
zum einen an den oben genannten massiven
Verteilungsproblemen
dergestalt, dass aufgrund von Marktversagen bzw. einseitiger Marktmacht der Produktionsfaktor Arbeit (weltweit) nicht entsprechend seiner Grenzproduktivität der Wertschöpfung entlohnt wird (also ausgebeutet wird), und





























