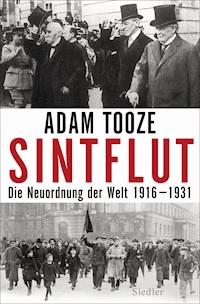8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Alles über die Finanzkrise und ihre dramatischen Folgen für Europa und die Welt
Als die US-Großbank Lehman Brothers im September 2008 zusammenbrach, war dies der Tiefpunkt der Banken- und Finanzkrise. Und obwohl der totale Kollaps der Weltwirtschaft damals verhindert wurde, ist die Finanzkrise noch lange nicht Geschichte, wie der britische Historiker Adam Tooze zeigt. Er schildert, wie es zu dieser Krise der Finanzmärkte kam und welche dramatischen Folgen sie bis heute hat. Denn durch die Finanzkrise ist nicht nur die Stabilität Europas ins Wanken geraten, sie hat auch das Vertrauen in die Kraft der globalen Wirtschaftsordnung erschüttert – und so zum Aufstieg der Populisten beigetragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1373
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Als die US-Großbank Lehman Brothers im September 2008 zusammenbrach, war dies der Tiefpunkt der Banken- und Finanzkrise. Und obwohl der totale Kollaps der Weltwirtschaft damals verhindert wurde, ist die Finanzkrise noch lange nicht Geschichte, wie der britische Historiker Adam Tooze zeigt. Er schildert, wie es zu dieser Krise der Finanzmärkte kam und welche dramatischen Folgen sie bis heute hat. Denn nicht nur ist durch die Finanzkrise die Stabilität Europas ins Wanken geraten, sie hat auch das Vertrauen in die Kraft der globalen Wirtschaftsordnung erschüttert – und so zum Aufstieg der Populisten beigetragen.
Zum Autor
Adam Tooze, geboren 1967, ist Professor für Zeitgeschichte und Direktor des European Institute an der Columbia University in New York. Nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre in Cambridge und an der Freien Universität Berlin sowie einer Promotion in Wirtschaftsgeschichte an der London School of Economics lehrte Tooze viele Jahre in Cambridge und Yale. Er ist Autor zahlreicher Studien zur (Wirtschafts-)Geschichte, seine Arbeiten sind vielfach preisgekrönt. Bei Siedler erschien von ihm »Die Ökonomie der Zerstörung« (2007) sowie zuletzt »Sintflut« (2015).
Adam Tooze
Crashed
Wie die Finanzkrise die Welt verändert hat
Aus dem Englischen von
Norbert Juraschitz, Karsten Petersen
und Thorsten Schmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe ist 2018 unter dem Titel»Crashed. How a Decade of Financial Crises Changed the World«bei Allen Lane, London, erschienen.
Copyright © by Adam Tooze, 2018
© 2018 für die deutsche Ausgabe by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München
Redaktion: Dunja Reulein
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-19277-8V005
www.siedler-verlag.de
Für Dana
Inhalt
Einleitung
Die erste Krise eines globalen Zeitalters
Teil I
Ein Sturm zieht auf
Kapitel 1: Die»falsche Krise«
Kapitel 2: Subprime
Kapitel 3: Transatlantische Finanzgeschäfte
Kapitel 4: Eurozone
Kapitel 5: Eine multipolare Weltordnung
Teil II
Die globale Krise
Kapitel 6: »Die schlimmste Finanzkrise aller Zeiten«
Kapitel 7: Bailouts
Kapitel 8: »The Big Thing«: Globale Liquidität
Kapitel 9: Europas vergessene Krise: Osteuropa
Kapitel 10: Der Wind aus dem Osten: China
Kapitel 11: G20
Kapitel 12: Stimulus
Kapitel 13: Finanzmarktregulierung
Teil III
Eurozone
Kapitel 14: Griechenland 2010: So tun als ob
Kapitel 15: Ein Zeitalter der Schulden
Kapitel 16: G-Null-Welt
Kapitel 17: Doom Loop
Kapitel 18: »Whatever it takes«
Teil IV
Nachbeben
Kapitel 19: American Gothic
Kapitel 20: Taper Tantrum
Kapitel 21: »F*** the EU«: Die Ukraine-Krise
Kapitel 22: #THISISACOUP
Kapitel 23: Die Projekte der Angst
Kapitel 24: Trump
Kapitel 25: Ein Blick in die Zukunft
Dank
Anmerkungen
Einleitung
Die erste Krise eines globalen Zeitalters
Dienstag, der 16. September 2008, war der »Tag nach Lehman«. Es war der Tag, an dem die globalen Geldmärkte einfroren. Im geldpolitischen Ausschuss der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, in Washington, D.C., begann der 16. September mit Notfallplänen, um Hunderte Milliarden Dollar in die Zentralbanken Europas und Asiens zu spülen. An der Wall Street schauten alle auf AIG, die American International Group. Überlebte der globale Verssicherungsgigant diesen Tag, oder folgte er der Investmentbank Lehman Brothers in den Abgrund? Die Schockwelle zog immer größere Kreise. Binnen weniger Wochen sollten die Fabrikhallen und Werften, die Finanzmärkte und Warenbörsen auf der ganzen Welt ihre Auswirkungen zu spüren bekommen. Unterdessen wurde am 16. September 2008 im Zentrum von Manhattan die 63. Sitzungsperiode der UNO-Vollversammlung eröffnet.
Das Gebäude der Vereinten Nationen an der East 42nd Street ist nicht der Mittelpunkt der Finanzmacht in New York. Und die Redner auf der Plenarsitzung, die am Morgen des 23. September begann, gingen auch nicht auf die näheren Details der Bankenkrise ein. Allerdings bestanden sie darauf, über deren größere Bedeutung zu diskutieren. Als erster Regierungschef sprach Präsident Lula da Silva aus Brasilien, der die Selbstsüchtigkeit und das Spekulationschaos scharf kritisierte, welche die Krise ausgelöst hatten.1 Der Gegensatz zu Präsident George W. Bush, der nach ihm ans Rednerpult trat, war bestürzend. Bush erweckte weniger den Eindruck eines am Ende seiner Regierungsperiode eher machtlosen Politikers, einer »lahmen Ente«, als den eines Mannes, der jeden Bezug zur Realität verloren hatte und dem die gescheiterte Agenda seiner achtjährigen Amtszeit keine Ruhe ließ.2 Die erste Hälfte seiner Rede drehte sich geradezu zwanghaft um das Schreckgespenst des globalen Terrorismus. Dann tröstete er sich mit dem Lieblingsthema der Neokonservativen, dem Fortschritt der Demokratie, dessen Höhepunkt er in den »bunten Revolutionen« in der Ukraine und Georgien gekommen sah. Doch das war anno 2003/04 gewesen. Der verheerenden Finanzkrise, die einen Fußmarsch entfernt an der Wall Street grassierte, widmete der Präsident lediglich zwei kurze Absätze am Ende seiner Rede. Die »Turbulenz«, ließ Bush verlauten, war eine amerikanische Herausforderung, die allein von der amerikanischen Regierung gemeistert werden musste, sie war keine Angelegenheit für multilaterales Handeln.
Andere konnten dem nicht zustimmen. Gloria Macapagal-Arroyo, die Präsidentin der Philippinen, sprach davon, dass Amerikas Finanzkrise einen »furchtbaren Tsunami« der Unsicherheit ausgelöst habe. Er breite sich auf dem ganzen Erdball aus, »nicht nur hier in Manhattan«. Seit den ersten Schockwellen auf den Finanzmärkten im Jahr 2007 habe sich die Welt mehrfach eingeredet, dass »das Schlimmste vorbei sei«. Doch »das Licht am Ende des Tunnels« habe sich immer wieder »als heranrasender Zug entpuppt, der dem globalen Finanzsystem einen neuen Stoß versetzte«.3 Welche Anstrengungen die Vereinigten Staaten auch zur Stabilisierung unternommen haben mochten, sie zeigten keine Wirkung.
Ein Redner nach dem anderen verknüpfte die Krise mit der Frage der globalen Führung und letztlich mit der Stellung Amerikas als dominante Weltmacht. Cristina Fernández de Kirchner aus Argentinien sprach im Namen eines Landes, das unlängst selbst eine verheerende Finanzkrise durchgemacht hatte, und machte keinen Hehl aus ihrer Schadenfreude. Auf jeden Fall konnte man für diese Krise nicht die Randstaaten der Weltwirtschaft verantwortlich machen. Die Krise ging von der »ersten Volkswirtschaft der Welt« aus. Jahrzehntelang habe sich Lateinamerika anhören müssen, dass »der Markt alles regeln« werde. Nunmehr versage die Wall Street, und Präsident Bush verspreche prompt, das amerikanische Finanzministerium werde zu Hilfe eilen. Aber waren die Vereinigten Staaten überhaupt in der Lage zu reagieren? »Die derzeitige Intervention«, führte de Kirchner aus, sei nicht nur »die größte seit Menschengedenken«, sie werde zudem »von einem Staat mit einem unvorstellbaren Handels- und Haushaltsdefizit durchgeführt.«4 Wenn es dabei bleiben sollte, dann sei der »Washingtoner Konsens« einer Haushalts- und Währungsdisziplin, dem ein so großer Teil der Schwellenländer unterworfen war, eindeutig erledigt. »Das ist eine historische Chance, das Verhalten und die Politik zu überdenken.« Nicht nur von lateinamerikanischer Seite wurden Ressentiments zur Schau gestellt. Die Europäer stießen ins gleiche Horn. »Die Welt ist keine unipolare Welt mit einer Supermacht mehr, und sie ist auch keine bipolare Welt mit dem Osten und dem Westen. Inzwischen ist sie eine multipolare Welt«, tönte Nicolas Sarkozy, der sowohl als französischer Präsident wie auch als EU-Ratspräsident sprach.5 »Die Welt des 21. Jahrhunderts« könne nicht »mit den Einrichtungen des 20. Jahrhunderts regiert« werden. Der Sicherheitsrat und die G8 müssten erweitert werden. Die Welt brauche eine neue Struktur, eine G13 oder G14.6
Es war nicht das erste Mal, dass die Frage der globalen Führung und der Rolle Amerikas im neuen Jahrtausend vor den Vereinten Nationen zur Sprache gebracht wurde. Als sich der französische Präsident vor den Vereinten Nationen gegen ein unilaterales amerikanisches Vorgehen aussprach, konnte niemand den Nachhall von 2003 der Auseinandersetzung über den desaströsen Irakkrieg überhören. Das war ein Moment, der Europa und Amerika, Regierungen und Bürger tief gespalten hatte.7 Der Irakkrieg hatte eine alarmierende Kluft in der politischen Kultur zwischen den beiden Kontinenten aufgedeckt. Aufgeklärte Bürger rund um die Welt taten sich schwer, mit Bush und seinen Helfershelfern vom rechten Flügel der Republikaner zurechtzukommen.8 Bei all ihrem Gerede vom Voranschreiten der Demokratie war nicht einmal sicher, dass die Republikaner die Wahl, mit der sie im Jahr 2000 an die Macht gekommen waren, wirklich gewonnen hatten. Gemeinsam mit Tony Blair hatten sie die Welt über Massenvernichtungswaffen in die Irre geführt. Mit ihren unverfrorenen Appellen an göttliche Eingebung und mit dem kreuzfahrerischen Eifer bewiesen sie überdeutlich ihre Missachtung für das Konzept der Moderne, in das sich die EU und die UNO gerne hüllten: aufgeklärt, transparent, liberal, kosmopolitisch. Selbstverständlich war das wiederum deren Version der Schönfärberei, deren eigene Symbolpolitik. Aber Symbole sind wichtig. Sie sind wesentliche Zutaten für die Sinnstiftung und die Konstruktion von Hegemonie.
Im Jahr 2008 hatte die Regierung Bush diese Schlacht verloren. Und mit der Finanzkrise war das Bild des Fiaskos komplett. Es war ein ernüchterndes historisches Fazit. Innerhalb von nur fünf Jahren hatten sowohl die außen- als auch die wirtschaftspolitische Elite der Vereinigten Staaten, des mächtigsten Staats der Welt, ein demütigendes Scheitern erlebt. Als wollte die amerikanische Demokratie dem Prozess der Delegitimierung die Krone aufsetzen, machte sie sich im August 2008 auch noch selbst zum Gespött. Als der Welt eine Finanzkrise von globalen Ausmaßen drohte, wählten die Republikaner zur Vizepräsidentschaftskandidatin für John McCain die absolut unqualifizierte Gouverneurin von Alaska Sarah Palin, die sich mit ihrer kindlichen Sichtweise der internationalen Politik selbst zur Witzfigur machte. Und das Schlimmste an der Sache war, dass ein großer Teil der amerikanischen Wählerschaft den Witz gar nicht verstand. Sie liebten Palin.9 Nachdem jahrelang die Rede davon war, arabische Diktatoren zu stürzen, fragte sich die globale Öffentlichkeit allmählich, wessen Regime sich eigentlich veränderte. Als Bush Junior von der politischen Bühne abtrat, brach die Weltordnung, die ihm von seinem Vater vermacht worden war, rings um ihn zusammen.
Wenige Wochen vor der Eröffnung der Vollversammlung in New York hatte die Welt an zwei Beispielen vorgeführt bekommen, wie real die Multipolarität tatsächlich war. Auf der einen Seite ließ Chinas beeindruckende Inszenierung der Olympischen Spiele alles verblassen, was jemals im Westen geboten worden war, allen voran die jämmerlichen Spiele von Atlanta 1996, die ein Rohrbombenanschlag eines rechten Fanatikers unterbrochen hatte.10 Wenn Brot und Spiele die Basis einer breiten Legitimierung beim Volk sind, so zog das chinesische Regime, von der Welle der boomenden Wirtschaft getragen, eine beeindruckende Show ab. Während in Beijing das Feuerwerk abbrannte, hatte das russische Militär Georgien, einem winzigen Anwärter auf die Mitgliedschaft in der NATO, eine drastische Lektion erteilt.11 Sarkozy war direkt von Waffenstillstandsgesprächen an der Ostgrenze Europas nach New York gekommen. Das sollte der erste einer Reihe mehr oder weniger offener Zusammenstöße zwischen Russland und dem Westen werden, die in der gewaltsamen Zerstückelung der Ukraine, eines weiteren NATO-Kandidaten, und in fieberhaften Spekulationen bezüglich der Beeinflussung der amerikanischen Präsidentschaftswahl von 2016 durch Russland kulminierten.
Die Finanzkrise von 2008 schien ein weiteres Zeichen für die schwindende Vorherrschaft Amerikas zu sein. Und diese Sichtweise wird nur allzu leicht bestätigt, wenn wir mit dem Abstand eines Jahrzehnts auf die Krise zurückblicken, nach der Wahl Donald Trumps, des Erben von Palin, zum US-Präsidenten. Heutzutage fällt es schwer, die Reden von 2008 und ihre Kritik am amerikanischen Unilateralismus zu lesen, ohne dass einem die kämpferische Antrittsrede Trumps vom 20. Januar 2017 in den Ohren klingt. An jenem bewölkten Freitag beschwor der 45. Präsident auf den Stufen des Kapitols das Bild eines Amerikas in der Krise herauf. In den Städten herrsche ein Chaos, das internationale Ansehen sei im Sinken. Dieses »Gemetzel«, erklärte er, müsse beendet werden. Wie? Trump schmetterte seine Antwort: Er und seine Anhänger würden noch am selben Tag ein Dekret verabschieden, »das man an jedem Ort, in jeder fremden Hauptstadt und in jedem Machtzentrum hören soll. Vom heutigen Tag an wird eine neue Vision unser Land regieren. Vom heutigen Tag an wird es nur noch heißen: Amerika zuerst, Amerika zuerst.«12 Wenn Amerika wirklich in einer tiefen Krise steckte, wenn es nicht länger an erster Stelle stand, wenn man es erst »wieder groß« machen musste – Wahrheiten, die für Trump selbstverständlich waren –, dann würde es zumindest per »Dekret« seine eigenen Bedingungen für den Umgang mit der Welt festlegen. So lautete die Antwort des rechten Flügels in der amerikanischen Politik auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Die Ereignisse von 2003, 2008 und 2017 sind allesamt zweifellos prägende Momente der jüngsten Weltgeschichte. Aber in welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Wirtschaftskrise von 2008, der geopolitischen Katastrophe von 2003 und der politischen Krise Amerikas nach der Wahl vom November 2016? Welche historische Bahn stecken diese drei Punkte ab? Welche Bedeutung haben sie für Europa, für Asien? In welchem Verhältnis steht diese amerikanische Entwicklung zu der kleineren, aber nicht weniger erschütternden Entwicklung, die Großbritannien vom Irakkrieg bis zur Krise der Londoner City und dem Brexit im Jahr 2016 nahm?
These des vorliegenden Buchs ist, dass die Redner auf der UN-Vollversammlung im September 2008 recht hatten. Die Finanzkrise und die ökonomischen, politischen und geopolitischen Reaktionen darauf sind unerlässlich für das Verständnis der heutigen Welt. Um ihre volle Bedeutung zu erfassen, sind jedoch zwei Dinge erforderlich. Die Bankenkrise muss in einen größeren politischen und geopolitischen Kontext eingeordnet werden. Und gleichzeitig müssen wir den Ablauf der Krise von innen her entschlüsseln. Wir müssen das tun, wozu die UN-Vollversammlung im September 2008 nicht imstande war. Wir müssen uns mit der Ökonomie des Finanzsystems auseinandersetzen. Das ist zwangsläufig eine technische und hier und da vielleicht kaltherzige Angelegenheit. Einem Großteil der Quellen, mit denen sich dieses Buch befasst, haftet eine beklemmende Distanziertheit an. Dieser Ansatz ist bewusst gewählt. Der Versuch, die Denkweise von Davos zu rekonstruieren, ist keineswegs der einzige Weg, um zu verstehen, wie die Gebieter über Macht und Geld im Lauf der Krise vorgingen. Man kann auch versuchen, ihre Logik aus den Stiefelabdrücken zu rekonstruieren, die sie bei den Betroffenen hinterließen, oder der konformistischen und widersprüchlichen marktorientierten Kultur nachzuspüren, die sie prägten.13 Aber die notwendige Ergänzung zu diesen eher griffigen Wiedergaben ist die hier vorgelegte Form der Darstellung, die von innen aufzuzeigen versucht, wie der Kreislauf von Macht und Geld funktionierte – oder auch nicht. Und es lohnt sich, diese spezielle Black Box zu öffnen, denn die schlichte Vorstellung – jene Vorstellung, die anno 2008 vorherrschte –, dass es sich im Wesentlichen um eine amerikanische oder auch angelsächsische Krise handelte und sie insofern ein Schlüsselmoment beim Niedergang der unipolaren Macht Amerikas war, ist, wie dieses Buch zeigen wird, in Wirklichkeit absolut irreführend.
Das eifrig von allen Seiten – von Amerikanern ebenso wie von Kommentatoren auf der ganzen Welt – aufgegriffene Konzept einer »rein amerikanischen Krise« verschleiert die Realität der tief greifenden Verknüpfung.14 Und damit lenkt es auch die Kritik und berechtigte Wut in eine falsche Richtung. In Wirklichkeit handelte es sich nicht um eine rein amerikanische, sondern um eine globale Krise, und vor allem war sie ihrem Ursprung nach nordatlantisch. Auf eine umstrittene und problematische Weise hatte sie zudem den Effekt, die weltweite Finanzwirtschaft erneut auf die Vereinigten Staaten auszurichten, weil sie der einzige Staat waren, der imstande war, auf die Herausforderung der Krise angemessen zu reagieren.15 Diese Fähigkeit ist teils strukturell bedingt: Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land, das Dollars erzeugen kann. Aber es ist auch eine Frage der Handlungsweise, der politischen Entscheidungen: positiv im Fall Amerikas, katastrophal negativ im Fall Europas. Den Grad dieser gegenseitigen Abhängigkeit und letztlich die Abhängigkeit des globalen Finanzsystems vom Dollar zu bestimmen ist nicht nur eine Frage von historischer Bedeutung. Es wirft ein neues Licht auf die gefährliche Situation, die dadurch geschaffen wurde, dass sich die Regierung Trump für unabhängig von einer miteinander verknüpften und multipolaren Welt erklärte.
I
Die Versuchung war groß, die Krise von 2008 als eine im Grunde amerikanische Episode zu betrachten. Immerhin hatte sie dort angefangen. Außerdem gefiel Menschen auf der ganzen Welt die Vorstellung, dass die Hypermacht endlich die wohlverdiente Strafe bekam. Die Tatsache, dass gleichzeitig auch die Londoner City implodierte, verstärkte nur noch die Süße des Augenblicks. Für die Europäer war es bequem, die Verantwortung über den Ärmelkanal und weiter über den Atlantik von sich zu schieben. In Wirklichkeit war es ein voreilig geschriebenes Drehbuch. Wie im ersten Abschnitt dieses Buchs gezeigt wird, hatten Ökonomen inner- und außerhalb Amerikas, die Bushs Präsidentschaft kritisch gegenüberstanden, darunter etliche führende Makroökonomen, schon im vorab ein Drehbuch für die Katastrophe verfasst. Im Mittelpunkt standen Amerikas »twin deficits« – das Haushaltsdefizit und das Handelsdefizit – und die sich daraus ergebende Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern. Die von der Bush-Administration angehäuften Schulden waren die Zeitbombe, von der man erwartete, dass sie früher oder später losgehen würde. Und die Vorstellung, die Krise von 2008 sei eine spezifisch angloamerikanische gewesen, wurde 18 Monate später indirekt bestätigt, als Europa seine eigene Krise erlebte, die scheinbar einem völlig anderen Skript folgte und sich in erster Linie um die Politik und die Verfassung der Eurozone drehte. Somit schien sich die historische Darstellung fein säuberlich in zwei Teile aufzuspalten: eine europäische Krise im Anschluss an eine amerikanische Krise, jeweils mit eigener ökonomischer und politischer Logik.
Wer die Bedeutung der Krise von 2008 zuerst in Amerika und in den Folgen für dessen Volkswirtschaft sieht, der, so die These dieses Buchs, versteht ihre wirtschaftliche und historische Bedeutung jedoch grundlegend falsch und unterschätzt sie. Der Ausgangspunkt war zweifelsohne der amerikanische Immobilienmarkt. Millionen amerikanischer Haushalte waren unter denen, die es als Erste und am härtesten traf. Aber diese Katastrophe war nicht die Krise, die schon vor 2008 viele erwartet hatten, nämlich eine Krise der amerikanischen staatlichen und öffentlichen Finanzen. Die Gefahr einer chinesisch-amerikanischen Kernschmelze, die so viele fürchteten, wurde eingedämmt. Stattdessen sollte eine vom herkömmlichen amerikanischen Immobilienmarkt ausgelöste Finanzkrise weltweite Auswirkungen haben. Sie erschütterte die Finanzsysteme der fortschrittlichsten Volkswirtschaften auf der Welt: die Londoner City, Ostasien, Osteuropa und Russland. Und sie wirkte noch lange nach. Entgegen der auf beiden Seiten des Atlantiks verbreiteten Version ist die Krise der Eurozone kein separates und eigenes Ereignis, sondern eine direkte Folge des Schocks von 2008. Die Neudefinition der Krise in Europa als interne Krise der Eurozone, mit den öffentlichen Schulden im Zentrum, war an sich bereits ein politischer Akt. In den Jahren nach 2010 sollte dies der Gegenstand einer Art transatlantischen Kulturkampfs in der Wirtschaftspolitik werden – ein Minenfeld, in dem jede Geschichte dieser Epoche sorgsam navigieren muss.
Die erste Aufgabe dieses Buchs ist es, dieses Missverständnis offenzulegen, indem die globale Finanzkrise ausgehend von ihrer zentralen Achse im Nordatlantik skizziert und die Kontinuität zwischen 2008 und 2012 aufgezeigt wird. Die zweite besteht darin zu erklären, wie Staaten auf die Sturmflut reagierten beziehungsweise nicht reagierten. Die Krise wirkte sich nicht überall gleich stark aus, hatte jedoch eine globale Reichweite, und mit der Heftigkeit ihrer wirtschaftspolitischen Reaktionen bestätigten die Schwellenländer auf geradezu spektakuläre Weise die Realität der multipolaren Welt. Die Krisen der 1990er-Jahre in den Schwellenländern – Mexiko (1995); Korea, Thailand, Indonesien (1997); Russland (1998) und Argentinien (2001) – hatten gezeigt, wie leicht die staatliche Souveränität abhandenkommen kann. Diese Lektion hatte man gelernt. Nach einem Jahrzehnt gezielter »Selbststärkung« war im Jahr 2008 kein einziges Opfer der Asienkrise der 1990er-Jahre gezwungen, sich an den Internationalen Währungsfonds zu wenden. Chinas Reaktion auf die Finanzkrise, die das Land aus dem Westen importierte, war von welthistorischem Ausmaß und beschleunigte dramatisch die Verschiebung des Gleichgewichts globaler wirtschaftlicher Aktivität nach Ostasien.
Man könnte zu der Schlussfolgerung gelangen, die Krise der Globalisierung habe die unverzichtbare Rolle des Nationalstaats und das Aufkommen einer neuen Form des Staatskapitalismus bestätigt. Ebendieses Argument sollte in den folgenden Jahren, als die Gegenreaktion der Politik einsetzte, immer mehr an Bedeutung gewinnen.16 Aber wenn man nicht die Peripherie, sondern den Kern der Krise von 2008 genau betrachtet, wird deutlich, dass diese Diagnose bestenfalls die halbe Wahrheit ist. Unter den Schwellenländern zählten Russland und Südkorea zu den beiden, die von der Krise am schwersten getroffen wurden. Was sie abgesehen von den boomenden Exporten miteinander gemein hatten, war die tiefe finanzielle Verflechtung mit Europa und den Vereinigten Staaten. Das sollte sich als der Schlüssel erweisen. Sie erlebten nicht einfach nur einen Kollaps der Exporte, sondern einen schlagartigen Einbruch bei der Finanzierung ihres Banksektors, einen sogenannten »sudden stop«.17 Als Folge machten Länder mit Handelsüberschüssen und großen Währungsreserven – dem Vernehmen nach die unverzichtbaren Garanten für die nationale wirtschaftliche Eigenständigkeit – eine akute Währungskrise durch. In weit größerem Ausmaß passierte genau das auch zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Unterhalb des Radars und in der Öffentlichkeit kaum diskutiert, wurde die Stabilität der nordatlantischen Wirtschaft im Herbst 2008 durch eine gigantische Deckungslücke bei der Dollarfinanzierung der überdimensionierten Banken Europas gefährdet. Und in diesem Fall hieß eine Deckungslücke nicht zehn oder gar hundert Milliarden, sondern Billionen Dollar. Es war das Gegenteil der Krise, die vorhergesagt worden war. Keine Dollarschwemme, sondern ein akuter Mangel an Dollarkrediten. Der Dollarkurs fiel nicht, er stieg.
Will man die Dynamik dieses unvorhergesehenen Sturms verstehen, so muss man über den vertrauten Erkenntnisrahmen der Makroökonomik hinausblicken, den wir aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geerbt haben. Die im Zuge des Ersten und Zweiten Weltkriegs entstandene makroökonomische Sichtweise der Weltwirtschaft fußt auf Nationalstaaten, nationalen Produktionssystemen und den von ihnen geschaffenen Handelsungleichgewichten.18 Diese Sichtweise der Wirtschaft wird für immer mit John Maynard Keynes identifiziert werden. Wie zu erwarten, rief der Beginn der Krise von 2008 Erinnerungen an die 1930er-Jahre hervor und ließ manche eine Rückkehr des »Meisters« fordern.19 Und die keynesianische Wirtschaftslehre ist in der Tat unverzichtbar, um die Dynamik des einbrechenden Konsums und der Investitionen, den Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Optionen für die Währungs- und Finanzpolitik nach 2009 zu verstehen.20 Wenn es um die Analyse des Beginns der Finanzkrise in einem Zeitalter der tief greifenden Globalisierung geht, stößt der Ansatz allerdings an seine Grenzen. In Diskussionen über den internationalen Handel wird mittlerweile allgemein akzeptiert, dass nicht mehr die nationalen Volkswirtschaften den Ausschlag geben. Nicht die Beziehungen zwischen nationalen Volkswirtschaften treiben den globalen Handel an, sondern die Beziehungen zwischen multinationalen Konzernen, die weit gespannte »Wertschöpfungsketten« koordinieren.21 Das gilt auch für das globale Geldgeschäft. Um die Spannungen innerhalb des globalen Finanzsystems, das im Jahr 2008 zusammenbrach, zu verstehen, müssen wir über die keynesianische Wirtschaftslehre und ihren bekannten Apparat der nationalen Wirtschaftsstatistik hinausgehen. Wie Hyun Song Shin, der Chefökonom an der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und einer der fähigsten Denker der neuen Wissenschaft der »Makrofinanz«, einmal sagte, dürfen wir die Weltwirtschaft nicht nach dem Vorbild eines »Inselmodells« der internationalen wirtschaftlichen Interaktionen – von Volkswirtschaft zu Volkswirtschaft – analysieren, sondern müssen dies mithilfe der »ineinandergreifenden Matrix« der Konzernbilanzen tun – von Bank zu Bank.22 Wie sowohl die globale Finanzkrise von 2007 bis 2009 als auch die Krise in der Eurozone nach 2010 zeigen sollten, sind Haushaltsdefizite und aktuelle Leistungsbilanzungleichgewichte schlechte Indikatoren für die Macht und Geschwindigkeit, mit der heutige Finanzkrisen zuschlagen können.23 Um das zu begreifen, müssen wir unser Augenmerk auf die verblüffenden Anpassungen richten, die innerhalb dieser Matrix stattfinden können. Bei allem Druck, den klassische »makroökonomische Ungleichgewichte« – im Haushalt und Handel – auszuüben imstande sind, ein heutiger globaler Bank Run bewegt weit mehr Geld, und das viel abrupter.24
Was die Europäer, die Amerikaner, die Russen und die Südkoreaner 2008 und die Europäer nach 2010 dann noch einmal erlebten, war eine Implosion des Kreditverkehrs zwischen Banken, des Interbanken-Kreditmarkts. Solange der eigene Finanzsektor relativ bescheiden dimensioniert war, konnten große nationale Währungsreserven einem Land über den Berg helfen. Das rettete Russland. Aber Südkorea hatte zu kämpfen, und in Europa gab es nicht nur keine Reserven, sondern die Größe der Banken und ihres in Dollar ausgeschriebenen Geschäfts machte jeden Versuch einer Selbststabilisierung aus eigener Kraft undenkbar. Keine einzige führende Zentralbank hatte das Risiko im Vorfeld richtig eingeschätzt. Sie sahen nicht voraus, wie die globalisierte Finanzwelt mit dem amerikanischen Hypothekenboom zusammenhängen könnte. Die Federal Reserve und das US-Finanzministerium schätzten das Ausmaß der Nebenwirkungen, welche die Insolvenz von Lehman am 15. September auslösen sollte, falsch ein. Nie zuvor, nicht einmal in den 1930er-Jahren, hatte ein so umfangreiches und miteinander verflochtenes System so kurz vor dem völligen Zusammenbruch gestanden. Aber sobald das Ausmaß der Gefahr ersichtlich war, drückten die US-Behörden aufs Tempo. Wie wir in Teil II sehen werden, retteten die Europäer und Amerikaner nicht nur ihre angeschlagenen Banken auf nationaler Ebene. Die US-Notenbank führte eine wahrhaft spektakuläre Neuerung ein. In letzter Minute übernahm sie die Rolle des Liquiditätsbeschaffers für das globale Bankensystem. Sie lieferte allen Bittstellern in New York Dollars, gleich, ob es eine amerikanische Bank war oder nicht. Außerdem gestattete die Fed einer handverlesenen Gruppe wichtiger Zentralbanken, über sogenannte Swap-Linien, also Devisen-Tauschgeschäfte, bei Bedarf Dollarkredite auszugeben. In einem gewaltigen Ausbruch transatlantischer Aktivität, wobei die Europäische Zentralbank (EZB) die Führung übernahm, pumpten sie Billionen Dollar in das europäische Bankwesen.
Diese Reaktion war nicht nur wegen des Ausmaßes erstaunlich, sondern auch, weil sie dem herkömmlichen Narrativ der Wirtschaftsgeschichte seit den 1970er-Jahren widersprach. Die Jahrzehnte vor der Krise waren von der Vorstellung einer »Marktrevolution« und des Zurückdrängens staatlicher Interventionen dominiert.25 Es wurde nach wie vor regiert und reguliert, aber diese Funktionen wurden an »unabhängige« Behörden delegiert, symbolhaft an die »unabhängigen Zentralbanken«, deren Aufgabe es war, für Disziplin, Ordnung und Vorhersagbarkeit zu sorgen. Politik und Ermessensentscheidungen waren die Feinde des guten Regierens. Das Kräftegleichgewicht war fest mit der Normalität des neuen Regimes der deflationären Globalisierung verdrahtet, die Ben Bernanke euphemistisch als die »great moderation« – »große Mäßigung« – bezeichnete.26 Die Frage, die über der »neoliberalen« Ordnung schwebte, war, ob für jeden die gleichen Regeln galten oder ob es in Wahrheit für die einen Regeln, für andere hingegen Ermessen gab.27 Die Ereignisse von 2008 bestätigten eindrücklich das Misstrauen, das Amerikas selektive Interventionen in den Schwellenmarktkrisen der 1990er-Jahre und der anschließenden Dotcom-Krise Anfang der 2000er-Jahre bereits erregt hatten. Tatsächlich funktionierte das neoliberale Regime der Zurückhaltung und Disziplin unter einem Vorbehalt. Beim Eintreten einer großen Finanzkrise, welche »systemische« Interessen bedrohte, wurde offensichtlich, dass wir in einem Zeitalter nicht der staatlichen Zurückhaltung, sondern des »großen« Regierens lebten, einem Zeitalter massiver Aktivitäten der Exekutive, eines Interventionismus, der in seiner Logik eher militärischen Operationen oder medizinischer Nothilfe glich als gesetzmäßiger Regierungsarbeit. Und das enthüllte wiederum eine wesentliche, aber beunruhigende Wahrheit, deren Unterdrückung die gesamte Linie der Wirtschaftspolitik seit den 1970er-Jahren geprägt hatte. Die Grundlagen des heutigen Währungssystems sind unabänderlich politischer Natur.
Zweifellos übt die Politik auf alle Waren Einfluss aus. Aber Geld und Kredite und das Finanzwesen, das auf ihnen basiert, werden von politischer Macht, gesellschaftlichen Konventionen und rechtlichen Normen auf eine Weise beeinflusst, wie es bei Turnschuhen, Smartphones oder Fässern voller Erdöl nicht der Fall ist. Die Spitze der heutigen Geldpyramide ist das Fiatgeld.28 Dieses von Staaten ins Leben gerufene und akzeptierte Rechengeld hat keine »Deckung« außer seinem Status als gesetzmäßiges Zahlungsmittel. Diese unheimliche Tatsache wurde zum ersten Mal in den Jahren 1971 bis 1973 offensichtlich, als das Bretton-Woods-System zusammenbrach. Nach dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 war der Dollar als Anker des weltweiten Währungssystems an den Goldstandard gebunden. Das war seinerseits, selbstverständlich, nicht mehr als eine Übereinkunft. Als es den Vereinigten Staaten schwerfiel, sich an die Übereinkunft zu halten – das hätte eine Deflation erfordert –, hob Präsident Richard Nixon sie am 15. August 1971 auf. Das war eine historische Zäsur. Zum ersten Mal seit der Erfindung des Geldes basierte keine Währung auf der ganzen Welt mehr auf einem metallischen Standard. Potenziell verschaffte dieser Schritt der Währungspolitik freie Hand, welche die Produktion von Geld und die Kreditschöpfung wie nie zuvor regulierte. Aber wie viel Freiheit hatten die politischen Entscheidungsträger wirklich, nachdem sie die »goldenen Fesseln« abgeschüttelt hatten? Die gesellschaftlichen und ökonomischen Kräfte, die den Goldstandard selbst für die Vereinigten Staaten untragbar gemacht hatten, waren mächtig: im eigenen Land der Verteilungskampf der Anspruchsgesellschaft, nach außen die Liberalisierung des Dollarhandels in London in den 1960er-Jahren. Als diese Kräfte in den 1970ern ohne monetären Anker entfesselt wurden, hatte das zur Folge, dass die Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften auf 20 Prozent schnellte – in Friedenszeiten hatte es das noch nie gegeben. Aber statt von der Liberalisierung Abstand zu nehmen, wurden Anfang der 1980er-Jahre sämtliche Beschränkungen auf globale Kapitalströme aufgehoben. Eben zu dem Zweck, die »Kräfte der Disziplinlosigkeit«, die vom Ende des an den Goldstandard gebundenen Geldes entfesselt worden waren, zu zähmen, wurden die Marktrevolution und die neue neoliberale »Disziplin« ausgerufen.29 Bis Mitte der 1980er-Jahre hatte der Vorsitzende der Fed Paul Volcker die Inflation mit einer dramatischen Zinserhöhung wieder in den Griff bekommen. Die einzigen Preise, die in der Phase der »großen Mäßigung« stiegen, waren die für Wertpapiere und Immobilien. Als die Blase im Jahr 2008 platzte und der Welt nicht eine Inflation, sondern eine Deflation drohte, warfen die maßgeblichen Zentralbanken die sich selbst auferlegten Ketten ab. Sie würden alles Erforderliche tun, um einen Zusammenbruch des Kreditwesens zu verhindern. Sie würden mit allen Mitteln das Finanzsystem in Gang halten. Und weil das heutige Bankwesen zugleich global und auf den Dollar gestützt ist, hieß das eine beispiellose transnationale Aktivität des amerikanischen Staats.
Die Liquiditätsbeschaffung über die Fed war sensationell. Sie hatte historische und dauerhafte Bedeutung. Unter Fachleuten ist man sich weitgehend einig, dass die Swap-Linien, mit denen die amerikanische Notenbank Dollars in die Weltwirtschaft pumpte, womöglich die entscheidenden Neuerungen der Krise waren.30 Doch im öffentlichen Diskurs sind diese Aktivitäten weit unter dem Radar geblieben. Sie waren von den Kontroversen im Zusammenhang mit den Rettungen einzelner Banken und anschließenden Wellen der Intervention seitens der Zentralbank, die unter dem Begriff Quantitative Easing liefen, aus der Diskussion verdrängt worden. Selbst in den Erinnerungen von Ben Bernanke werden etwa die transatlantischen Liquiditätsmaßnahmen von 2008, verglichen mit der nervenaufreibenden Übernahme von AIG oder der Ablösung der Hypothekendarlehen, allenfalls beiläufig erwähnt.31
Die technischen und administrativen Komplexitäten der Aktionen der Fed tragen zweifellos dazu bei, dass sie für Uneingeweihte undurchschaubar sind. Doch die Politik geht noch darüber hinaus. Die Rettung der Banken von 2008 provozierte lang anhaltende und bittere Schuldzuweisungen, und das aus gutem Grund. Hunderte Milliarden Steuergelder wurden aufs Spiel gesetzt, um habgierige Banken zu retten. Manche Interventionen zahlten sich aus, andere jedoch nicht. Viele Entscheidungen, die im Lauf der Rettungsaktion getroffen wurden, waren höchst umstritten. In den Vereinigten Staaten sollten sie einen tiefen Graben innerhalb der Partei der Republikaner reißen, der acht Jahre später dramatische Konsequenzen hatte. Doch das Problem liegt keineswegs allein bei individuellen Entscheidungen und parteipolitischen Programmen; es betrifft die Art und Weise, wie wir über die Struktur der heutigen Volkswirtschaft reden und denken. Tatsächlich geht es direkt auf die analytische Agenda des Umdenkens der Weltwirtschaft zurück, das uns von der Krise aufgezwungen und von den Fürsprechern des makrofinanziellen Ansatzes propagiert wurde. Nach dem vertrauten Insel-Modell der internationalen wirtschaftlichen Interaktionen aus dem 20. Jahrhundert waren die Basiseinheiten Volkswirtschaften, die miteinander Handel trieben, Handelsüberschüsse und -defizite erzielten und nationale Ansprüche und Verpflichtungen anhäuften. Diesen Einheiten wurde von Wirtschaftsexperten mit statistischen Daten zu Arbeitslosigkeit, Inflation und Bruttoinlandsprodukt eine empirische Realität verliehen. Und um diese Angaben entwickelte sich ein ganzes Konzept der nationalen Politik.32 Eine gute Wirtschaftspolitik war eine Politik, die für das Wachstum des BIP gut war. Fragen der Verteilung – der Ansatz des »Wer wem?« – konnten gegen das allgemeine Interesse, »den Kuchen zu vergrößern«, aufgewogen werden. Im Gegensatz dazu schafft die neue makrofinanzielle Wirtschaftslehre mit ihrem unbarmherzigen Fokus auf die »ineinandergreifende Matrix« der Unternehmensbilanzen sämtliche tröstenden Euphemismen ab. Nationale volkswirtschaftliche Größen werden ersetzt durch den Fokus auf die Bilanzen, wo sich die eigentliche Aktivität im Finanzsystem abspielt. Das ist außerordentlich erhellend. Es verleiht der Wirtschaftspolitik einen viel stärkeren Einfluss. Aber es deckt auch etwas auf, das aus politischer Sicht absolut unverdaulich ist. Das Finanzsystem besteht eigentlich nicht aus »nationalen Geldströmen«. Es wird auch nicht aus einer Masse winziger, anonymer, mikroskopischer Firmen gebildet – das Ideal des »perfekten Wettbewerbs« und die ökonomische Analogie zum individuellen Bürger. Die überwältigende Mehrheit der privaten Kreditschöpfung wird von einer eng miteinander verflochtenen Unternehmensoligarchie erledigt – den Schlüsselzellen in Shins Matrix. Auf globaler Ebene haben 20 bis 30 Banken das Sagen. Berücksichtigt man auf nationaler Ebene wichtige Banken, so liegt die Zahl weltweit bei vielleicht 100 großen Finanzinstituten. Methoden zur Erkennung und Überwachung der sogenannten systemrelevanten Finanzinstitutionen (kurz: SIFI) – auch makroprudenzielle Überwachung genannt – zählen zu den wesentlichen staatlichen Innovationen aufgrund der Krise und ihres Nachspiels. Ebendiese Banken und die Leute, die sie leiten, zählen auch zu den Hauptakteuren im Drama dieses Buchs.
Die nackte Wahrheit an Ben Bernankes »historischer« Politik der globalen Liquiditätsbeschaffung war, dass das hieß, jener Clique aus Banken, ihren Aktionären und den dreist absahnenden Führungsleuten Kredite in Höhe von Billionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich lässt sich, wie wir sehen werden, genau aufschlüsseln, wer was bekommen hat. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ging mindestens die Hälfte der zur Verfügung gestellten Hilfsmittel, obwohl die Federal Reserve eine nationale Zentralbank ist, an Banken, die ihren Sitz nicht in den Vereinigten Staaten, sondern überwiegend in Europa haben. Wenn die Krise aus theoretischer Sicht eine Krise der makroökonomischen Wirtschaftslehre war, wenn sie praktisch betrachtet eine Krise der herkömmlichen Instrumente der Geldpolitik war, so war sie ebenso eine tiefe Krise der modernen nationalstaatlich verfassten Politik. Wie beispiellos und wirkungsvoll die Aktionen der Fed auch gewesen sein mochten, wollten doch selbst Politiker, die unerschütterlich weiterhin die Globalisierung befürworteten, die praktischen Implikationen kaum ansprechen. Es ist zwar alles andere als ein Geheimnis, dass wir in einer Welt leben, die von Oligopolen der Wirtschaft dominiert wird, doch während der Krise und im Anschluss daran trat diese Realität samt all ihren Implikationen für die Prioritäten der Regierungen unverblümt zutage. Das ist eine Kröte mit geradezu explosivem Potenzial, an welcher sich die demokratische Politik auf beiden Seiten des Atlantiks verschluckt hat.
II
In Anbetracht des Gesagten dürfte es niemanden wundern, dass die Europäer nur zu gern die Verwicklung ihrer weltweit agierenden Banken in die transatlantische Krise verdrängten. Im Jahr 2008 mussten die Briten ihre eigene nationale Katastrophe verdauen. In der Eurozone, mit Frankreich und Deutschland an der Spitze, ist die Finanzkrise von 2008 in einer Gedächtnislücke verschwunden, die von der »Staatsschuldenkrise« von 2010 und den Folgejahren überdeckt wurde.33 Die Bereitschaft, die Abhängigkeit von der US Federal Reserve anzuerkennen, hält sich in Grenzen, und das Gefühl einer Verpflichtung oder gar Ehrerbietung ebenfalls. Auch in dieser Hinsicht haben die Amerikaner ihre Autorität verloren. Nur zu gern kritisierten die Europäer das amerikanische Krisenmanagement der Jahre 2008 und 2009 als weiteres Beispiel für ebenjene Improvisation und Disziplinlosigkeit, die die Welt erst in Schwierigkeiten gebracht hatten. Daraus entwickelte sich die erste Phase in einem transatlantischen Kulturkampf um die Wirtschaftspolitik, der in der gehässigen Debatte um die Krise der Eurozone gipfelte, die in Teil III dieses Buchs in den Mittelpunkt rückt.
Wenn man bedenkt, dass es sich im Wesentlichen um miteinander zusammenhängende Krisen handelt und die erste in ihrem Ausmaß weit größer und ihrem Tempo dramatischer war, ist der Kontrast zwischen der relativ wirksamen Eindämmung der globalen Kernschmelze von 2008, die in Teil II beschrieben wird, und der eskalierenden Katastrophe der Eurozone, beschrieben in Teil III, äußerst schmerzlich. Um die griechischen Schulden konstruierten die Europäer ihre eigene Krise mit ihrem eigenen Narrativ. Im Kern ging es um die Politik der Staatsschulden. Wie hohe Wirtschaftsvertreter in der EU inzwischen einräumen, gibt es für diese Auslegung der Krise der Eurozone in der Volkswirtschaftslehre keinen Grund.34 Die Nachhaltigkeit öffentlicher Schulden kann langfristig ein Problem sein. Griechenland insbesondere war zahlungsunfähig. Aber überhöhte öffentliche Schulden waren nicht der gemeinsame Nenner der allgemeineren Krise der Eurozone. Der gemeinsame Nenner war die gefährliche Anfälligkeit eines aufgeblähten Finanzsystems, das allzu sehr auf kurzfristige, marktgestützte Finanzierung angewiesen war. Die Krise der Eurozone war ein schweres Nachbeben der Erschütterung des nordatlantischen Finanzsystems von 2008, das sich mit zeitlicher Verzögerung durch das Labyrinth des politischen Systems der EU ausbreitete.35 Ein führender EU-Experte, der mit den Rettungsprogrammen zu tun hatte, formuliert es so: »Hätten wir damals [2008] schon die Banken zentral beaufsichtigt, hätten wir das Problem gleich gelöst.«36 Stattdessen weitete sich die Krise der Eurozone zu einem Teufelskreis privater und öffentlicher Kredite und zu einer Krise des europäischen Projekts insgesamt aus.
Wie lässt sich der merkwürdige Wandel einer Krise der Banken im Jahr 2008 zu einer Krise des staatlichen Kredits nach 2010 erklären? Der Gedanke an einen Taschenspielertrick drängt sich geradezu auf. Während Europas Steuerzahler in die Mangel genommen wurden, wurden die Banken und andere Geldgeber mit Geld ausgezahlt, das man in die zu rettenden Länder gepumpt hatte. Von hier ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der Schlussfolgerung, dass die versteckte Logik der Eurokrise nach 2010 eine Wiederholung der Bankenrettungen von 2008 war, nur diesmal getarnt. Für einen scharfzüngigen Kritiker war dies das größte »Ablenkungsmanöver der modernen Geschichte«.37 Das Merkwürdige daran ist jedoch, dass man, wenn das zutraf, wenn die Ereignisse in der Eurozone tatsächlich eine verschleierte Wiederholung von 2008 waren, zumindest ähnliche Resultate wie in Amerika erwarten sollte. Wie die Protagonisten nur zu gut wussten, wies das amerikanische Krisenmanagement ein eklatantes Ungleichgewicht auf.38 Sozialhilfeempfänger hielten sich mit Müh und Not über Wasser, während Banker weiter ein angenehmes Leben führten. Aber auch wenn die Verteilung der Kosten und Nutzen empörend war, so funktionierte das Krisenmanagement immerhin. Seit 2009 ist die amerikanische Wirtschaft kontinuierlich gewachsen und nähert sich, zumindest amtlichen Statistiken zufolge, derzeit einer Vollbeschäftigung. Im Gegensatz dazu trieben die Verantwortlichen der Eurozone durch mutwillige Entscheidungen Millionen Bürger in eine mit den 1930er-Jahren vergleichbare Depression. Das war eine der schwersten selbst verschuldeten wirtschaftspolitischen Katastrophen der Geschichte. Dass ausgerechnet das winzige Griechenland mit einer Volkswirtschaft, die 1 bis 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU ausmacht, zum Dreh- und Angelpunkt für diese Katastrophe gemacht werden sollte, lässt die europäische Geschichte zu einer bitteren Karikatur erstarren.
Dieses tragische Schauspiel reizt zur Empörung. Millionen haben ohne vernünftigen Grund gelitten. Aber bei aller Entrüstung sollten wir dieser Aussage ihre volle Bedeutung zukommen lassen. Die entscheidenden Worte sind »ohne vernünftigen Grund«.39 Eine klare Logik beherrschte die Antwort auf die Finanzkrise von 2008/09. Zugegeben, es war eine klassenorientierte Logik – »Schützt die Wall Street zuerst, um Otto Normalverbraucher kümmern wir uns später« –, aber sie hatte zumindest ein klares Grundprinzip, noch dazu eines, das im Großen und Ganzen funktionierte. Die gleiche Logik dem Management der Eurozone zu unterstellen wäre zu viel der Ehre für Europas Entscheidungsträger, allen voran der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble. Hier wird nicht die Geschichte eines politischen Taschenspielertricks erzählt, mit dem die EU-Eliten geschickt ihre Bemühungen verschleierten, die Interessen der europäischen Konzerne zu schützen. Vielmehr handelt es sich hier um die Geschichte eines Zugunglücks, eines Wirrwarrs widersprüchlicher Visionen, eines entmutigenden Dramas der verpassten Gelegenheiten, des Versagens der Führung und des Versagens kollektiver Aktionen. Wenn es überhaupt Gruppen gibt, die davon profitierten – einige wenige Pfandbriefinhaber, die ihr Geld bekamen; eine Bank, die einer schmerzlichen Neuordnung entging –, so hatten sie allenfalls geringe Gewinne, die in keinem Verhältnis zu den enormen Kosten standen. Das soll nicht heißen, dass die einzelnen Akteure in dem Drama – Deutschland, Frankreich, der IWF – nicht nach einer gewissen Logik handelten. Doch sie mussten gemeinsam handeln, und das Gesamtergebnis war eine Katastrophe. Sie richteten einen sozialen und politischen Schaden an, von dem sich das Projekt der Europäischen Union womöglich nie wieder erholen wird. Doch bei all der Empörung, die dieses Versagen hervorrufen sollte, gerät leicht eine weitere langfristige Folgeerscheinung in Vergessenheit. Das stümperhafte Management der Krise in der Eurozone, die der transatlantischen Finanzkrise von 2008/2009 auf dem Fuß folgte, schadete nicht nur Millionen Bürgern Europas. Es hatte auch für die europäische Wirtschaft dramatische Konsequenzen, auf die ebendiese Bürger, ob sie es wollen oder nicht, mit Blick auf Arbeitsplätze und Löhne angewiesen sind.
Die Wirtschaft war alles andere als der Nutznießer des Krisenmanagements durch die EU, sondern zählte zu den Geschädigten, allen voran die europäischen Banken. Seit 2008 stellt nicht nur der Aufstieg Asiens die globale Konzernhierarchie auf den Kopf, sondern auch der überstürzte Niedergang Europas.40 Für Europäer, die ständig von dem Handelsüberschuss Deutschlands hören, mag das merkwürdig klingen. Aber wie fachkundige Wirtschaftsexperten Deutschlands selbst einräumen, sind diese Überschüsse ebenso sehr das Resultat unterdrückter Importe wie großartiger Exporterfolge.41 Das unaufhaltsame Abrutschen europäischer Konzerne im globalen Ranking ist nicht zu übersehen. Auch wenn wir uns etwas anderes wünschen würden, wird die Weltwirtschaft nicht von »Mittelstands«-Unternehmern geleitet, sondern von ein paar Tausend riesigen Konzernen mit ineinander verflochtenen Eigentumsverhältnissen, die von einer winzigen Gruppe von Anlageverwaltern kontrolliert werden. Im Wettbewerb der Konzerne bescherten die Krisen von 2008 bis 2013 dem europäischen Kapital eine historische Niederlage. Hier spielen zweifellos mehrere Faktoren hinein, aber ein ganz wichtiger ist der Zustand des europäischen Markts. Exporte spielen sicher eine große Rolle beim Firmenerfolg, aber wie China und die Vereinigten Staaten beide zeigen, gibt es keinen Ersatz für einen gewinnbringenden Binnenmarkt. Sollten wir uns auf den zynischen Standpunkt stellen, dass es nicht die Hauptaufgabe der Eurozone war, den eigenen Bürgern zu dienen, sondern dem europäischen Kapital ein Feld für die Steigerung der einheimischen Gewinne zu bieten, würden wir um folgendes Fazit nicht herumkommen: Zwischen 2010 und 2013 scheiterte sie spektakulär. Und das ist nicht zuallererst eine Folge fehlender Institutionen in der Eurozone, sondern das Ergebnis von Entscheidungen, die von verantwortungslosen Unternehmenschefs, dogmatischen Zentralbankern und konservativ gesinnten Politikern getroffen wurden.
Es mag sein, dass wir eine Welt, die nach diesem Prinzip organisiert ist, nicht gutheißen. Die Europäer mögen sich für das Schauspiel der Europäischen Kommission begeistern, die globale Monopolisten wie Google aufs Korn nimmt und von Apple Steuern einfordert.42 Doch die dem Silicon Valley abgetrotzten Beträge sind nur ein winziger Anteil der Mittel dieser Firmen. Eine deutlich andere Sichtweise des Kräftegleichgewichts wird von jenen Momenten im Jahr 2016 nahegelegt, als die Finanzwelt mit angehaltenem Atem die Bekanntgabe der Summe erwartete, die das amerikanische Justizministerium von der Deutschen Bank wegen dubioser Hypothekengeschäfte forderte. Viele hielten die finanzielle Verfassung der Deutschen Bank für so anfällig, dass die US-Behörde über deren Schicksal entschied.43 Eine Bank, die über ein Jahrhundert lang der Motor der deutschen Wirtschaft war, war den Vereinigten Staaten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Nach der jüngsten Krise war sie die letzte europäische Investmentbank, die noch eine gewisse globale Präsenz behauptete.
Die Europäer mögen sich vielleicht aus diesem Ringen um unternehmerische Dominanz verabschieden. Sie hoffen womöglich sogar, dass sie auf diese Weise größere Freiheiten für demokratische Politik erreichen könnten. Was aufgrund der Stagnation der Eurozone droht, ist eine wachsende Abhängigkeit, einerseits von importierten Technologien, andererseits von der Nachfrage anderer, schnell wachsender Wirtschaften. Statt seine Autonomie zu behaupten, läuft Europa Gefahr, zum Objekt des kapitalistischen Korporatismus anderer Staaten zu werden. Was die internationale Finanzwelt angeht, so sind die Würfel bereits gefallen. Im Zuge der Doppelkrise ist Europa aus dem Rennen. Die künftige Entwicklung wird unter den Überlebenden der Krise in den Vereinigten Staaten und den Neulingen aus Asien entschieden werden.44 Vielleicht beschließen sie, sich in der Londoner City niederzulassen, aber nach dem Brexit ist nicht einmal das sicher. Es ist damit zu rechnen, dass die Wall Street, Hongkong und Schanghai Europa schlicht links liegen lassen.
Wenn es sich nur um ein Drama der selbst verschuldeten Wunden Europas handeln würde, so wäre das schon schlimm genug. Doch die Geschichte der Eurokrise als rein europäische Angelegenheit zu schreiben wäre ebenso irreführend wie die Krise von 2008 als rein amerikanische. Tatsächlich weitete sich die Eurokrise aus, und das mehrfach. Mindestens drei Mal – im Frühjahr 2010, im Herbst 2011 und noch einmal im Sommer 2012 – stand die Eurozone kurz vor einem ungeordneten Zerfall, mit der eindeutigen Option, dass das zur Staatsschuldenkrise mutierte Desaster Billionen Dollar an öffentlichen Schulden verschlingen würde. Die Vorstellung, dass Deutschland oder ein anderes Land dagegen immun wäre, war töricht. Es folgte eine geradezu spektakuläre Umkehrung der Fronten. Im Jahr 2008 hatten noch die weltgewandten Europäer die realitätsfremde Bush-Administration aufgefordert, sich den Fakten einer globalen Weltordnung zu stellen. 18 Monate später flehte die Obama-Administration die Entscheidungsträger der Eurozone an, ihr Finanzsystem angesichts des hartnäckigen und verantwortungslosen Widerstands seitens der Konservativen in Berlin und Frankfurt zu stabilisieren. Bereits im April 2010 war nach der Einschätzung der übrigen G20-Staaten und anderer die Krise der Eurozone so gefährlich und die Europäer zudem so inkompetent, dass man es auf keinen Fall ihnen überlassen durfte, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. Um zu verhindern, dass Griechenland »ein weiterer Lehman« wurde, mobilisierten die Amerikaner den IWF, das sinnbildliche Geschöpf des klassischen Globalismus der Nachkriegszeit, um das Europa des 21. Jahrhunderts zu retten. Diese Rettung im Mai 2010 stoppte zwar eine weitere Eskalation der Krise, aber sie verband Europa, den IWF und die Vereinigten Staaten als Helfershelfer in einer albtraumhaften Verflechtung, aus der sie sich sieben Jahre später immer noch nicht befreit haben. Zudem dämmte der Schritt keineswegs die Panik auf den Finanzmärkten ein. Noch im Sommer 2012 bedrohte die Aussicht einer umfassenden Finanzkrise in Europa die Vereinigten Staaten und den Rest der Weltwirtschaft. Erst im Juli 2012 stabilisierte sich Europa, auf hartnäckiges Drängen seitens Washingtons und der übrigen G20 hin, und zwar mithilfe einer nachträglichen »Amerikanisierung« der EZB, wie man die Maßnahmen gemeinhin einschätzte.45
III
Wenn man im Herbst 2012 die Uhr angehalten hätte, wäre der Unterschied zum Schauplatz vier Jahre zuvor in New York bemerkenswert gewesen. Ungeachtet des wenig versprechenden Starts lässt sich kaum leugnen, dass sich der amerikanische Liberalismus, wie er von der Obama-Administration verkörpert wurde, wieder einmal durchgesetzt hatte. Wenn unsereiner den Eindruck hat, dass die Finanzkrise ein Ende hatte, dass an einem Punkt in der nicht allzu fernen Vergangenheit die Normalität wiederhergestellt wurde, so liegt das daran, dass wir auf den Herbst 2012 zurückblicken. In diesem Moment wurde die akute Gefahr einer umfassenden Krise endlich abgewendet. Und ein Zeichen für die Wiederherstellung der Normalität war der Umstand, dass Amerika nicht entthront worden war. Obamas Wiederwahl im November 2012 bekräftigte dies noch. Palin und ihresgleichen war die Puste ausgegangen. International gesehen, boomten die Märkte der Schwellenländer, unterstützt von der großzügigen Dollarspritze durch die Fed. Europa hatte Aufholbedarf. Während sich Obama 2008 von den Bush-Cheney-Jahren distanziert hatte, indem er einen Ton der Mäßigung und Zurückhaltung anschlug, kehrte er 2012 wieder zum klassischen Narrativ des »American exceptionalism« zurück: Amerika war »unverzichtbar«. Diese in der Clinton-Ära geprägte Wendung bekam neuen Auftrieb.46 Auch das außenpolitische Denken im großen Rahmen erlebte ein Revival. Die neue Front waren die »Handelsabkommen« TTIP und TPP, in Wirklichkeit gigantische Projekte einer kommerziellen, finanziellen, technischen und gesetzlichen Integration mit geopolitischen Zielen. Insoweit die erste Amtszeit von Obama enttäuschend verlaufen war, konnte man das der konservativen Opposition anlasten. Das war zwar deprimierend, aber absehbar. Die Moderne und der globale Kapitalismus, dem sie einen so großen Teil ihrer Dynamik verdankt, sind anspruchsvolle Tempomacher; Verzögerungstaktiken seitens der Konservativen sind zu erwarten. Doch am Ende geht die Geschichte weiter. Selbst in Europa setzte sich letztlich ein pragmatisches Krisenmanagement gegenüber der konservativen Glaubenslehre durch.
Wenn wir die vergangenen zehn Jahre aus historischer Sicht verstehen wollen, müssen wir diesen Moment einer neuerlichen Selbstgefälligkeit ernst nehmen. In Anbetracht der folgenden Ereignisse wird unser Rückblick leicht von einer Mischung aus Wut, Empörung und Angst getrübt. Doch damals war der Eindruck eines wiederhergestellten Selbstvertrauens sehr real und hinterließ ein intellektuelles Vermächtnis. Das war der Moment, als die ersten Untersuchungen der Krise geschrieben wurden. Die optimistischsten Analysen meinten schlicht: »the system worked« (das System funktionierte).47 Eine andere Studie erklärte 2008 zu einer Status-quo-Krise.48 Nichts hatte sich grundlegend geändert. Die pessimistischere Version argumentierte, wir würden in einem »Spiegelkabinett« leben.49 Gerade weil die Krise so frühzeitig und effektiv eingedämmt worden sei, habe sie ein falsches Gefühl der Stabilität hervorgerufen. Und das habe wiederum die Energie abgezogen, die für grundlegende Reformen nötig gewesen wäre. Folglich bestehe immer noch eine akute Gefahr einer Wiederholung. Doch eine Wiederholung ist nicht das Gleiche wie eine Fortsetzung oder Ausweitung. Was all diese Lesarten für selbstverständlich hielten – die pessimistischeren ebenso wie die optimistischeren Versionen –, war die Tatsache, dass die Krise von 2008 bis 2012 vorüber war. Das war auch die Ausgangsbasis, mit der dieses Buch in Angriff genommen wurde. Es sollte ein Rückblick auf eine Krise sein, die abgeschlossen war. Folgende Aufgaben schienen im Jahr 2013 am dringendsten: die miteinander verflochtene Geschichte der Wall Street und der Eurokrise erläutern; dem transnationalen Charakter der Krise – ihrer Auswirkungen auf Ost- und Westeuropa und Asien – gerecht werden; die wahrhaft unverzichtbare Rolle der Vereinigten Staaten klarstellen, da sie die Reaktion auf die Krise sowie die neuen Instrumente, welche die Fed eingesetzt hatte, verankerten; die schmerzliche und verschleppte Unzulänglichkeit der europäischen Antwort aufzeigen; und eine intensive, aber zu wenig wertgeschätzte Phase transatlantischer Finanzdiplomatie ins Rampenlicht stellen. Dies alles ist gewiss immer noch der Mühe wert. Aber es hat mittlerweile eine neue und unheilvollere Bedeutung bekommen. Denn wir können die Risiken, die in Trumps Präsidentschaft lauern, nur dann erkennen, wenn wir die innere Funktionsweise des auf dem Dollar basierenden Finanzsystems und dessen Anfälligkeit begreifen. Wenn Trumps Präsidentschaft den Tiefpunkt der politischen Autorität Amerikas markiert, so ist das desto beunruhigender in Anbetracht der tiefen funktionalen Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, die nicht nur 2008, sondern auch in der Eurokrise zutage trat.
Inzwischen müssen wir darauf gefasst sein, dass die Krise, entgegen der grundlegenden Annahme von 2012/13, in Wirklichkeit noch nicht vorüber ist. Womit wir es inzwischen zu tun haben, ist keine Wiederholung, sondern eine Mutation und Metastasen. Wie in Teil IV des Buchs erklärt wird, wandelte sich die finanzielle und wirtschaftliche Krise von 2007 bis 2012 zwischen 2013 und 2017 zu einer umfassenden politischen und geopolitischen Krise der Weltordnung nach dem Kalten Krieg. Und man sollte sich nicht vor den offensichtlichen politischen Implikationen drücken. Der Konservatismus hätte als Doktrin für die Krisenbekämpfung womöglich verheerende Folgen gehabt, doch die Ereignisse seit 2012 legen die Vermutung nahe, dass der Jubel der liberalen Krisenmanager ebenfalls zu früh war.50 Wie die bemerkenswerte Eskalation der Debatte um Ungleichheit in den Vereinigten Staaten unmissverständlich aufgedeckt hat, hat die politische Mitte große Mühe, überzeugende Antworten auf die langfristigen Probleme einer modernen kapitalistischen Demokratie zu geben. Die Krise kam zu den bereits bestehenden Spannungen einer wachsenden Ungleichheit und Entmündigung noch hinzu; und die dramatischen Maßnahmen zur Krisenbekämpfung, die seit 2008 durchgeführt wurden, haben, bei aller kurzfristigen Effektivität, ihrerseits massive Nebenwirkungen. In dieser Hinsicht hatten die Konservativen nicht unrecht. Unterdessen sind die geopolitischen Herausforderungen, die nicht von den gewaltsamen Unruhen im Nahen Osten oder der »russischen« Rückständigkeit, sondern vom erfolgreichen Vormarsch der Globalisierung aufgeworfen wurden, keineswegs verschwunden. Sie haben sich verstärkt. Und auch wenn die »westliche Allianz« noch existiert, so mangelt es zunehmend an der Koordination untereinander. Im Jahr 2014 taumelte Japan in eine Auseinandersetzung mit China. Und die EU – jener Koloss, der »keine Geopolitik betreibt« – »schlafwandelte« in einen Konflikt mit Russland um die Ukraine. Im Zuge des stümperhaften Umgangs mit der Eurokrise erlebte Europa unterdessen eine dramatische Mobilisierung der Linken ebenso wie der Rechten. Aber statt die neue politische Lage als Ausdruck der Vitalität der europäischen Demokratie angesichts eines beklagenswerten Versagens der Regierungen zu werten, wurden die neuen Strömungen der Postkrisen-Phase als »Populismus« verunglimpft, mit dem Makel der 1930er-Jahre versehen oder auf den boshaften Einfluss Russlands zurückgeführt. Die in der Eurogruppe versammelten Kräfte des Status quo schickten sich an, die linken Regierungen, die in Griechenland und Portugal 2015 gewählt wurden, in Schach zu halten und anschließend zu neutralisieren. Mit der Rückendeckung der neuerdings gesteigerten Befugnisse der voll aktivierten EZB ließen diese Schritte keinen Zweifel an der Robustheit der Eurozone. Desto dringender stellten sich die Fragen nach den Grenzen der Demokratie in der EU und nach ihrer Einseitigkeit. Gegen die Linke erreichte, indem deren vernünftige Einstellung ausgenutzt wurde, die brutale Taktik der Eindämmung ihr Ziel. Gegen die Rechte hatte sie hingegen weniger Erfolg, wie der Brexit, Polen und Ungarn beweisen sollten.
IV
Zeitlicher Abstand ist, wie Historiker sich gerne einreden, ein Allheilmittel. Er gestattet die Distanz und die Perspektive, die gemeinhin als die Tugenden dieser Disziplin gerühmt werden. Das hängt jedoch davon ab, wohin der Verlauf der Zeit einen führt. Die Geschichtsschreibung kann der Geschichte nicht entkommen, die sie zu rekonstruieren versucht. Sachdienlich ist nicht die Frage, wie viel Zeit vergangen sein muss, ehe man Geschichte schreiben kann, sondern was in der Zwischenzeit passiert ist und welche Ereignisse zum Zeitpunkt des Verfassens als Nächste zu erwarten sind. Das vorliegende Buch wäre etwa einfacher zu schreiben gewesen und hätte womöglich klarere Schlussfolgerungen enthalten, wenn man es noch näher an den Ereignissen beendet hätte, von denen es ausgeht. Unter Umständen wird es leichter fallen, in weiteren zehn Jahren ein vergleichbares Buch zu schreiben, allerdings wäre das in Anbetracht des derzeitigen Laufs der Dinge allzu optimistisch. Gewiss ist der zehnte Jahrestag der Krise von 2008 kein angenehmer Ausgangspunkt für einen linksliberalen Historiker, dessen persönliche Loyalitäten zwischen England, Deutschland, der »Insel Manhattan« und der EU geteilt sind. Es hätte allerdings auch noch schlimmer kommen können. Ein Buch zum zehnjährigen Jubiläum des Börsenkrachs von 1929 wäre im Jahr 1939 erschienen. So weit sind wir noch nicht. Aber wir befinden uns zweifellos an einem unbequemeren und besorgniserregenderen Punkt, als wir uns vor Ausbruch der Krise hätten träumen lassen.
Zu den vielen Symptomen der Unruhe und Krise, mit denen wir es im Zuge des Sieges von Donald Trump zu tun haben, zählt die außerordentlich ungehobelte Variante der postfaktischen Politik, die er personifiziert. Er sagt nicht die Wahrheit. Er sagt nichts Vernünftiges. Er redet nicht einmal zusammenhängend. Die Regierungsmacht scheint losgelöst von den Grundwerten der Vernunft, logischen Konsequenz und faktischer Evidenz. Was hat diesen Niedergang ausgelöst? Man kann dafür einen ganzen Komplex an Faktoren ausmachen. Mit Sicherheit spielen skrupellose Demagogie, der Verfall der Massenkultur und die in sich geschlossene Welt des Kabelfernsehens und der sozialen Medien eine wichtige Rolle, genau wie Trumps Charakter. Unseren derzeitigen Zustand eines postfaktischen Umfelds allein auf Trump und seine Helfershelfer zurückzuführen hieße jedoch, einem weiteren Irrglauben zu erliegen.51 Wie das vorliegende Buch zeigt, weist die Geschichte der Krise tief verwurzelte und dauerhafte Schwierigkeiten auf, sich »faktisch« mit unserer derzeitigen Lage auseinanderzusetzen. Nicht nur diejenigen, die als Populisten verunglimpft werden, haben ein Problem mit der Wahrheit. Das reicht viel weiter und geht tiefer, es betrifft die Mitte ebenso wie die Ränder des politischen Mainstreams. Wir brauchen gar nicht bis zu dem notorisch falschen und inkohärenten Plädoyer für den Irakkrieg und der kriecherischen Berichterstattung in den Medien zurückzugehen. Der derzeitige Präsident der Europäischen Kommission erklärte selbst im Frühjahr 2011: »Wenn es ernst wird, muss man lügen.«52 Immerhin, könnte man zu seiner Rechtfertigung sagen, weiß er, was er tut. Wenn wir Jean-Claude Juncker glauben, so ist ein postfaktisches Herangehen an den öffentlichen Diskurs schlicht das, was die politische Steuerung des Kapitalismus derzeit erfordert.
Der Glaubwürdigkeitsverlust ist offensichtlich und umfassend. Der angerichtete Schaden sitzt tief. Einfach zu sagen, dass sich die Liberalen »lediglich zusammenreißen, den Staub abklopfen und neu anfangen« müssen, wie es in einem Lied zur Weltwirtschaftskrise heißt, dass wir, wenn Amerika gescheitert ist, nur einen jugendlich wirkenden französischen Präsidenten oder die gnadenlos zuverlässige Kanzlerin aus Deutschland zum Anführer küren müssen, ist entweder einfältig oder unaufrichtig. Das wird dem Ausmaß der Katastrophen von 2008 nicht gerecht, geschweige denn dem Versäumnis der einseitigen Politik, die sowohl in Europa als auch in Amerika vorherrscht, eine adäquate Antwort auf die Krise zu präsentieren. Es wird dem Ausmaß unserer politischen Sackgasse nicht gerecht, wo die Mitte und die Rechten gescheitert sind und die Linke massiv blockiert ist und sich selbst im Weg steht. Außerdem erkennt diese Haltung nicht an, dass manche Verluste irreparabel sind und die angemessene Antwort manchmal nicht darin besteht, einfach immer weiterzumachen, sondern eine Zeit lang innezuhalten, die Trümmer unserer Erwartungen zu inspizieren und die zerschlagenen Identifikationen und Enttäuschungen aufzuzählen. So ein Bestreben der Rekonstruktion ist mit einer gewissen Unbeweglichkeit verbunden. Aber selbst während wir zurückblicken, können wir uns darauf verlassen, dass die ruhelose Dynamik des globalen Kapitalismus uns vorantreiben wird. Er zieht und zerrt schon. Wie im letzten Kapitel gezeigt wird, haben uns die nächsten Phasen wirtschaftlicher Herausforderungen und Krisen bereits eingeholt, nicht in Amerika oder Europa, aber in Asien und den Schwellenmärkten. Ein Rückblick ist kein Akt der Verweigerung. Es ist einfach ein Beitrag zu der notwendigen kollektiven Anstrengung, mit der Vergangenheit klarzukommen und herauszufinden, was schiefging. Bei diesem Bestreben führt kein Weg daran vorbei, tief in die Funktionsweise des Finanzapparats einzutauchen. Ebendort werden wir sowohl den Mechanismus, der die Welt in Stücke riss, als auch den Grund dafür entdecken, dass dieser Zusammenbruch so überraschend kam.
Teil I
Ein Sturm zieht auf
Kapitel 1
Die »falsche Krise«
Am 5. April 2006 verabschiedete sich der junge Senator aus Illinois Barack Obama von einer Diskussion um ein Atomabkommen mit Indien auf dem Kapitol, um an der Eröffnung eines neuen Thinktanks bei Brookings teilzunehmen.1 Die Brookings Institution gilt gemeinhin als einflussreichstes politikberatendes Forschungszentrum der Welt. Obamas Auftritt dort war eine Art Vorsprechen, das seine Präsidentschaft prägen sollte.2 In seiner Rede sprach er sich vor allem für eine neue Initiative, das Hamilton Project, aus, das Robert Rubin ins Leben gerufen hatte, einer der Königsmacher der Demokraten. Rubin personifizierte die Verbindung, die in den 1990er-Jahren zwischen gemäßigten Demokraten und global denkenden Bankern geschmiedet worden war und die amerikanische Wirtschaftspolitik neu prägte. Im Jahr 1993 hatte Rubin seine Spitzenposition an der Wall Street als Ko-Vorsitzender bei Goldman Sachs verlassen, um den Nationalen Wirtschaftsrat zu leiten, den Bill Clinton als Gegenstück zum Nationalen Sicherheitsrat erstmals gegründet hatte. Zwei Jahre später wurde Rubin zum Finanzminister ernannt. Neben Rubin führte auf der Brookings-Konferenz im April 2006 auch ein junger Wirtschaftsexperte namens Peter Orszag den Vorsitz. Er war ebenfalls ein Veteran der Clinton-Administration, der in der Folge zu Obamas Direktor des Office of Management and Budget aufstieg. Unter den Veteranen von Rubins Finanzministerium rekrutierte Obama im Jahr 2008 dann praktisch sein ganzes Wirtschaftsteam. Zwölf Monate vor der Finanzkrise und zweieinhalb Jahre vor Obamas Amtsantritt stand der Start des Hamilton Project stellvertretend für die Weltanschauung einiger der einflussreichsten Berater im Mikrokosmos des Weißen Hauses. Das sagt viel darüber aus, was sie vorhersehen konnten und was nicht.
I
Seit seiner Rückkehr in die Geschäftswelt im Jahr 1999 machte sich Rubin wegen der in Washington vorherrschenden Tendenzen Sorgen. Die Globalisierung war die zentrale Herausforderung der 1990er-Jahre gewesen. Im neuen Jahrtausend galt dies umso mehr. Aber zwei Jahre nach dem Beginn der zweiten Amtszeit Bushs brachte die Politik der republikanischen Regierung die Vereinigten Staaten von Amerika in Gefahr. Statt den Druck des globalen Wettbewerbs zu lindern, spaltete sie die amerikanische Gesellschaft. Damit bestand sowohl das Risiko, eine Gegenbewegung gegen die Globalisierung zu initiieren, als auch eine katastrophale Finanzkrise auszulösen, welche die Geldstabilität des Landes und die globale Stellung des Dollars gefährden würde.
Nicht, dass es Rubin und seinem Kreis in einer Welt der Globalisierung schlecht ergangen wäre. Nach dem Finanzministerium hatte er sich auf einem einflussreichen Posten als Aufsichtsratsmitglied bei der Citigroup zur Ruhe gesetzt. Orszag, der am Anfang seiner Karriere zwischen Lehre, Regierung und Beratung hin und her gewechselt war, landete zu gegebener Zeit ebenfalls bei der Citigroup. Für den Durchschnittsamerikaner sah die Sache jedoch anders aus. Es hatte gute Phasen gegeben. Die Clinton-Leute feierten immer noch die 1990er-Jahre und den Doppelboom der Technologiewerte und der Wall Street. Aber seit den 1970ern hatten die Löhne nicht mit der Produktivität Schritt gehalten. Für die Meritokraten des Hamilton Project lag auf der Hand, wer die Verantwortung dafür trug. Amerikas Schulen vermittelten den jungen Leuten nicht die Ausbildung, die unerlässlich war, um weiterhin der Konkurrenz voraus zu sein. Die ersten vom Hamilton Project veröffentlichten Berichte wimmelten vor Vorschlägen, um die Anwerbung von Lehrern zu verbessern und die Sommerferien der Kinder effektiver zu nutzen.3 Das war der klassische praxisorientierte, »evidenzbasierte«, nichtideologische Ansatz zur Steigerung der Produktivität, der die wirtschaftspolitische Diskussion jener Zeit prägte. Die eigentliche Absicht war jedoch höchst politisch. Obama drückte es in seiner Rede so aus: