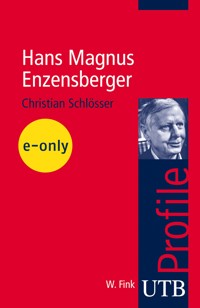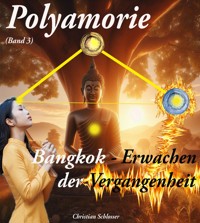4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Matthias erfüllt sich einen Jugendtraum und reist mit dem Motorrad durch Peru. Bei einer Klettertour, hoch oben in fast 2800 Meter Höhe, findet er fast den Tod, trifft wenig später auf einen Landsmann und verbringt dort einige Tage. Marianna, eine Indiofrau aus Kolumbien und ihr Mann Peter gewähren ihm Gastfreundschaft der ganz besonderen Art, welche man in dieser gottverlassenen Gegend niemals vermutet hätte. Daraus entwickelt sich eine tiefe Freundschaft und führt bei dem Paar wenig später zu drastischen Veränderungen. Auf der Rückfahrt nach Lima verfällt Matthias Isabella, der schönen Schwester von Antonio. Oder sie ihm? Jedenfalls nimmt die Affäre eine unerwartete Wende. Wenig später, kommt es zu weiteren einschneidenden Veränderungen, als Matthias einer Einladung folgt, einen Abstecher nach Kolumbien zu einem weitgehend noch isoliert lebenden Indiostamm unternimmt. Nicht nur ein betrügerischer und seine Patientinnen erpressender Arzt, ein Flugzeugabsturz sowie eine feindliche Firmenübernahme, sorgen am Ende der Geschichte für heftige Turbulenzen. Aus all diesen Ereignissen entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft zu dem Ehepaar und eine besondere Beziehung zu Isabella. Wie in allen Büchern des Autors, wird erst allmählich nach einer detaillierten Beschreibung des Umfeldes und der vorkommenden Personen, die eigentliche Handlung aufgebaut. Auch dieses Buch ist absolut UNZENSIERT und nimmt kein Blatt vor den Mund!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ein verrückter Plan und schräger Freund
Start der Reise ins Land der alten Inkas
Erste Tage im Land der Inkas
Knapp am Tod vorbei
Unerwartete Begegnung
Peters Hazienda
Marianna
Ungewöhnliches Angebot
Ein unbeschreiblicher Abend
Kräuterkur der besonderen Art
Bleihaltige Demonstrationen
Gefälschtes Horoskop
Isabella
Letzte Stunden
Überraschender Flug
Menschenfischer
Folgenreiche Begegnung
Brisante Informationen
Nächtliche Offenbarung
Neue Nachrichten
Wiedersehen mit Isabella
Gewagte Pläne
Inmitten der grünen Hölle
Zurück auf der Hazienda
Teuflische Pläne
Nächster Auftrag im Land der Inkas
Zurück in Lima
Letzter Flug zu Peters Hazienda
Götter, die heilige Jungfrau und ein Geheimnis
Impressum
Vorwort
Wer hier eine der üblichen realitätsfernen billigen pornografischen Geschichte erwartet, möge sich bitte anderweitig umsehen. Bei diesem Roman handelt es sich genau genommen um einen Reisebericht und Abenteuerroman gleichermaßen mit reichlich erotischen Elementen.
Basierend auf tatsächlichen Ereignissen Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, beschreibt, versehen mit einigen notwendigen literarischen Ergänzungen, diese Geschichte das unerwartete Zusammentreffen vollkommen unterschiedlicher Menschen im Zuge einer Abenteuerreise durch Südamerika. Menschen, welche sich unter normalen Umständen niemals im Leben begegnet wären.
Genau dieser Sachverhalt hat es in sich – erregt und berührt zugleich, offenbart menschliche Dramen und gewährt dem Leser Einblicke in eine fremde Kultur.
Freunde von Reiseberichten, Abenteuerromanen und Erotik gleichermaßen, werden also keinesfalls nach dem allmählichen Einstieg in die teilweise dramatischen Vorgänge auf den folgenden Seiten enttäuscht.
Aufgrund der expliziten Beschreibung sexueller Handlungen erfolgt im Handel die Einordnung in FSK 18.
Ein verrückter Plan und schräger Freund
Peru, ebenso wie Mexiko, war schon immer einer meiner Lebensträume, welchen ich mir erst jetzt, jenseits der 40, realisieren konnte. Neben asiatischen Kulturen, faszinierte mich die Mayas, Inkas und Azteken bereits seit meiner Kindheit und dieses Interesse, gepaart mit meiner Vorliebe für die Flora des Kontinents, speziell der Sukkulenten, war der eigentliche Auslöser für diese Reise. Pauschalreise waren mir seit jeher ein Gräuel, sind viel zu teuer, engen die Bewegungsfreiheit ein, binden an Verträge und nicht selten auch an seltsame Mitreisende, weshalb ich Alleinreisen mit dem Motorrad favorisiere.
Mexiko auf der Liste meiner Wünsche hatte ich vor wenigen Jahren bereits verwirklicht, erlebte dort nicht nur die Faszination des Landes, sondern auch ein erotisches Abenteuer, so erschien es mir damals, welches scheinbar durch nichts übertroffen werden konnte. Zur Vorbereitung der Tausende Kilometer umfassenden Tour durch Mexiko, verfügte ich vor Ort über langjährige Freunde, welche als Insider die Expedition durch ihre zahlreichen Kontakte und Ortskenntnisse überhaupt erst ermöglichten.
Erotische Abenteuer standen bei keiner meiner zahlreichen Touren rund um den Globus auf meinem Programm; entweder ergibt sich etwas, oder eben nicht. Mexiko zwang mir ein solches regelrecht auf und dieses führte zu einer bis heute anhaltenden Freundschaft. Dergleichen war für Peru war nicht zu erwarten. Zum einen führte die Expedition vorwiegend durch Indiogebiete, welche bekanntlich „Langnasen“ und „Gringos“ nicht unbedingt freundlich gesinnt sind, zum anderen gelten peruanische Frauen sexuell nicht gerade als aufgeschlossen; ist die Andenrepublik kein Ziel für Sextouristen.
Mein einziger Kontakt in Peru war ein ehemaliger Student und der taugte bedingt, schon wegen seiner tapsig unbeholfenen Art, gerade mal als Einkäufer für die Ausrüstung. Auf den Punkt gebracht – weder verfügte ich über Helfer bei auftretenden Notsituationen, noch über anderweitig nützliche Kontakte, handelte es sich um eine „Fahrt ins Blaue“ wie man so schön sagt. Genau betrachtet gab es eigentlich nur Antonio – und der Kerl war eine Marke für sich. Studierte in den 80er Jahren in Deutschland und gehört seit dieser Zeit zu meinem Freundeskreis. Antonios Familie stammte aus einem auf keiner Karte verzeichneten Dorf aus der Umgebung von Cusco, der andere Zweig der Sippe, der des Vaters, vom Titicacasee.
Seine Vorfahren schafften es vor rund hundert Jahren nach Lima zu kommen, begannen dort mit Altmetall und Werkzeugen zu handeln. Nicht nur, dass Antonios Vater elf Kinder in die Welt setzte, drei Mädchen und acht Jungs, zog er später zusammen mit einem seiner zahlreichen Brüder einen gut laufenden Handel mit Werkzeugmaschinen jeder Art hoch. Bald reichte das Geld von Antonios Eltern für den Erwerb eines großen Hauses am Rande des historischen Stadtzentrums.
Seine elf Kinder verstreuten sich über ganz Lima, eröffneten Geschäfte der verschiedensten Art. Armut wie früher gab es nicht mehr. Kam es doch einmal zu Engpässen, half jeder jedem. Studiert oder einen Beruf erlernt hat, bis auf Antonio und eine seiner Schwestern, nach seinen Angaben keiner in der Familie und die enormen Kosten des Studiums wurden von der gesamten Sippe getragen. Während die älteste Schwester Ärztin wurde, interessierte Antonio, außer dem Maschinenbau eigentlich fast nichts. Rasch wurde die Ärztin zum Geheimtipp, zudem vermögend; ihr tapsiger Bruder hüpfte hingegen von Auftrag zu Auftrag, von einer Phase der Arbeitslosigkeit zur nächsten. Vor Monaten, als ich ihn wegen meines Vorhabens anrief, sagte er ohne zu zögern zu, tat mir aus alter Freundschaft den Gefallen. Erhoffte sich dabei, damals wieder einmal arbeitslos, wohl einen gewissen Zuverdienst. Akademiker und Theoretiker durch und durch, schreckte er vor Werkzeug zurück, hielt es mehr mit dem Reißbrett und Formeln. Ausgestattet mit zwei linken Händen, an denen auch noch die Daumen jeweils falsch angeschraubt waren, konnte er dafür endlos lange und beeindruckend dozieren.
Zeigte sich in der Praxis nicht in der Lage, einen normalen Nagel in die Wand zu bekommen, ohne bereits während der Vorbereitungen des Vorhabens beim nächsten Notarzt zu landen. Körperlich entsprach er mit der dicken schwarzen Hornbrille, nicht vorhandenen Muskeln und dem schmächtigen Körperbau, eher dem Klischee des schusseligen Professors aus einem Spielfilm der 1940er Jahre. Rauchte nicht, laberte nach einem Glas Rotwein endlos Stuss, fiel nach drei Schnäpsen unter den Tisch, ließ selbst Wasser in der Küche anbrennen und paarungsbereite Frauen verschreckten ihn zutiefst. Schwul war er aber nicht, pflegte aber, aus welchen Gründen auch immer, ein schwer gestörtes Verhältnis zum anderen Geschlecht. Seltsamerweise, er gehörte im gewissen Maße zur Oberschicht und die Familie galt als vermögend, hatte Grundstücke und Immobilien, schienen auch sämtliche Frauen Limas einen weiten Bogen um ihn zu machen.
Ungewöhnlich, denn normal zieht Geld die Frauen an, es reichte jedoch das Wort Geld im Zusammenhang mit dem Namen Antonio und die Frauen zogen lieber ein Leben im Kloster vor. Ungeachtet seiner 44 Jahre, traf die Bezeichnung „männliche Jungfrau“ mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf ihn zu.
Schlüpfrige Witze in geselliger Runde reichten bei ihm aus, um augenblicklich einen roten Kopf zu bekommen, das Aussehen eines Streichholzes anzunehmen und die Flucht zu ergreifen. An der Universität bekam er den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Lama“ verpasst, welcher unter anderem auch seiner nicht selten feuchten Aussprache geschuldet war. Trotzdem – Antonio war zuverlässig und ein äußerst liebenswerter Kerl. Dies als Einleitung zu einem der größten Abenteuer meines Lebens, welches, der Chaos-Theorie folgend, einen gänzlich anderen Verlauf nahm, als eigentlich geplant. Doch nun der Reihe nach. Beginnen wir mit dem Flug nach Südamerika und landen zum Start der Geschichte in Lima, der Hauptstadt des Landes.
Start der Reise ins Land der alten Inkas
Nach einem endlos lang erscheinenden, wackeligen und nervenaufreibenden Flug von mehr als 18 Stunden mit einer Zwischenlandung, wurde ich in Lima von Antonio in Empfang genommen. Unterkunft für die erste Nacht stellte ein preiswertes Hotel mit null Service dar. Gekostet hat es nur 7 Dollar, doch war ich felsenfest davon überzeugt, dass ein Peruaner das heruntergekommene Zimmer für weniger als die Hälfte bekommen hätte. Vorstellbar auch, dass Antonio die Hälfte der Summe bereits als Provision kassierte?
Morgens gegen 3 Uhr schüttelte mich eines der häufigen kleinen Erdbeben aus dem Schlaf. Schwarmbeben kannte ich bereits, doch dieses war ungleich stärker. Putz rieselte aufs Bett und ich überlegte, das Zimmer besser zu verlassen, rief vorsichtshalber Antonio an. Ungehalten wegen der frühen Störung knurrte er etwas von „ist doch normal. Schlaf weiter. Ich hole dich nachher ab“. Stunden später, nicht gerade ausgeschlafen, mit leichten Kopfschmerzen, traf ich mich mit ihm am Eingang des Hotels, fuhr mit ihm im Taxi zu seiner Wohnung. Weder besaß er ein eigenes Fahrzeug, noch eine Fahrerlaubnis.
Ähnlich desolat wie das Hotelzimmer hinsichtlich seiner abgewohnten Einrichtung zeigte sich auch das Innere des Taxis mit dessen Fahrer. Nur herrschte in meinem Zimmer Schweigen, während man den Taxifahrer gleich in zwei Särgen beerdigen müsste. Einen Sarg für den hageren Körper, den zweiten, bitte extra groß, für das Mundwerk, welches nie länger als zehn Sekunden schwieg. Ungeachtet der halsbrecherischen Fahrweise kamen wir nach einer halben Stunde Fahrt unbeschadet am Ziel an.
Preisverhandlung wegen des fehlenden Taxameters begannen und diese verschlangen noch einmal fast die gleiche Zeit. Man wurde sich einig, Fahrer verabschiedete sich wortreich und nun ging es durch eine schmale Gasse hin zu Antonios Haus. Hervorgeholt aus einem abschließbaren Unterstand im Hinterhof, präsentierte mir Antonio ein Motorrad der Marke „Honda Selbstgestrickt de luxe“. Unübersehbar das Werk eines ambitionierten Bastlers, verfügte jedoch über eine Zulassung. Kaum etwas daran schien noch nicht umgebaut worden zu sein. Machte jedoch einen robusten Eindruck, besaß stabile Seitengepäckträger, nagelneue Reifen, sogar Spiegel, was hier alles anderen als selbstverständlich zu sein scheint.
Oben erwartet mich die nächste Überraschung, denn mein Freund wohnte nicht allein, wie er immer betont hatte, sondern zusammen mit der betagten Mutter und der geschiedenen jüngsten Schwester. Letztere sah nicht nur äußerst attraktiv aus, hörte zudem noch auf den blumigen Namen Isabella–Maria. Isabella–Maria hatte nicht die typische Physiognomie der Indios, erweckte mehr den Eindruck einer rassigen Latina.
Verpackt in knallenge kurze Jeans, mit oben genau einer Handvoll Brust unter einer stramm gespannten hellen Bluse, zog sie meinen Blick an wie ein Magnet. Lange Haare, vor allem schwarze, mag ich und sie trug ihre Hüftlang. Natürlich bemerkte das Biest meine Blicke, gab sich alle Mühe, sich im möglichst besten Blickwinkel zu präsentieren, mal die obere und dann die untere Körperhälfte hervorstreckte. Kokett mit den Augen zwinkerte und ständig provozierend mit dem Po wackelte. Während die Mutter seit Jahren nach einem Schlaganfall fast ertaubt war, nur wenig und undeutlich redete, überschüttete mich die Schwester mit Fragen am laufenden Band. Eilfertig kochte sie Kaffee, brachte Süßigkeiten an den Tisch.
Süß für die Süßigkeiten war weit untertrieben – extrem süß traf es besser. Jedes Stück klebte wie Kleister erst an den Fingern, dann den Lippen, schlussendlich am Gaumen und ich konnte es mir vorstellen, dass die Darmzoten auch Mühe haben dürften, den Weg zum Hinterausgang von der Nascherei freizuhalten. Kaffee entpuppte sich ebenfalls mehr als Sirup mit Kaffeegeschmack. Isabella, wie ich die Schönheit abgekürzt nennen durfte, fand zunehmend genauso Gefallen an mir wie ich an ihr und das machte Antonio nervös. Neugierig begann ich dann auch noch höflich der Schönheit Fragen zu stellen, was ihn endgültig aus dem Konzept und ins Stottern bracht. Lustig klang Isabellas Geschichte nicht, denn die Scheidung hatte einen wirklich unschönen Hintergrund. Nein, nicht etwa, dass sie mehr Männer als Haare auf dem Kopf hatte und permanent fremd ging. Sündhaft teuer und pompös verlief die Hochzeitsfeier, doch Nachwuchs blieb aus. Untersuchungen brachten zutage, dass sie überhaupt keine Kinder bekommen konnte. Grund für den eitlen Gockel sich umgehen von ihr zu trennen und schon fiel ihr der Bruder ins Wort.
Einzelheiten zu diesem Teil der Familiengeschichte wurden mir von meinem Freund aus unerfindlichen Gründen auf Deutsch übermittelt, was der rassigen Andenblüte missfiel, da sie nichts von der Unterhaltung, außer ihrem Namen, verstand.
Wissend um meine Sprachkenntnisse, zog sie immer wieder das Gespräch an sich und es dauerte nicht lange, bis mir Isabella eindeutige Avancen, für ein abendliches Ausgehen machte, von mir eingeladen und zum Tanzen ausgeführt werden wollte. Antonio hingegen hatte nur den Abschluss der Aktion im Kopf. Ohne Zeugen. Offenbar war wohl etwas mit dem Waffenkauf nicht ganz so legal, wollte die geschwätzige Schwester nicht als Zeugin dabei haben, obwohl jede Person in Peru eine Waffe besitzen darf. Mutter wurde in ihrem Rollstuhl in ein anderes Zimmer geschoben, schwadronierte dabei von ihrer Tochter und dass ich sie heiraten könne. Immerhin, was nicht der Wahrheit entsprach, wäre diese hoch studiert, steinreich und könne sogar meine Sprache sprechen. Bildhübsch sei sie außerdem, was ich nicht abstreiten konnte. Mit Zahlen hatte es die Dame auch nicht mehr so ganz. Einmal war die Tochter knapp 40, dann wieder 32, dann nur 17 Jahre und wenig später zarte 25. Kaum war sie hinter der Tür verschwunden, kam Isabella zurück, klebte, schlimmer als vorher der Kuchen an meinem Gaumen, an mir. Rückte mir kaum noch von der Pelle, fragte mir Löcher in den Bauch. Antonio wurde laut, wollte sie ebenfalls loswerden.
Gehorsam gegenüber Männern von Frauen geht in Peru normal anders und so benötigte es seine Zeit und reichlich Worte, um die sture und neugierige Schwester in das Zimmer der Mutter als Aufpasserin zu „delegieren.“ Endlich, Isabella war raus, er schloss hinter ihr einfach ab. Vorsichtig landete, eingewickelt in eine Einkaufstüte und einer Lage Ölpapier, eine Handfeuerwaffe inklusive 100 Schuss Munition auf dem Tisch. Großspurig, wie ein Vater dem Sohn das erste Fahrrad, erklärte er sie mir in allen Details, verhaspelte sich dabei ständig. Weder war Antonio jemals beim Militär gewesen, noch hatte er in seinen Leben auch nur einen einzigen Schuss abgefeuert. Es brauchte seine Zeit, bis er begriff, dass ich nicht nur schießen, sondern auch Waffen zerlegen und selbst das Reinigen derselben beherrschte und das brachte ihn zum Staunen. Antonio verwies mit entschuldigendem Grinsen darauf, dass dieser Typ nicht selten Ladehemmungen hat. Habe er vom Verkäufer in Erfahrung gebracht. Hinsichtlich der Zielgenauigkeit, jedenfalls über zehn Meter hinaus, sollte man besser keine Wunder erwarten.
Wäre normal bei diesem Modell, welches er einmal nach Italien, dann in die USA und dann wieder nach China als Herkunftsland verortete. Schießen würde sie aber garantiert, was er mir inmitten des Wohngebietes natürlich nicht demonstrieren könne.
Müsste ich ihm einfach glauben, denn um die Waffe zu testen, wäre es notwendig weit außerhalb zu fahren und dafür hätte er als Akademiker einfach keine Zeit. Sorgfältig wickelte er die geladene Bleispritze wieder in das Ölpapier ein, schob sie über den Tisch. Selbstredend entsichert und mit der Mündung zu mir zeigend …
Weiter ging es mit einem Ein–Mann–Zelt, Messer, Kompass, Wasserkanister, zwei Filter, Erste–Hilfe–Kasten, drei Bewegungsmeldern, Desinfektionsmittel, Kletterausrüstung, Schlafsack, Taschenlampe und andere nützliche Dinge, welche man auf so einer Tour benötigt. Kartenmaterial hatte ich aus Deutschland mitgebracht, denn diese sollen, laut Angaben von Antonio, angeblich wesentlich genauer sein. Trotzdem nahm ich die von ihm besorgten Karten als Ergänzung mit. Man konnte nie wissen. Testfahrt mit Antonio als Sozius war angesagt. Schließlich kannte er nach eigenen Aussagen jede Straße und jede Gasse in Lima. Abgesehen von der Tatsache, dass mein Freund höllische Angst vorm Motorradfahren hat, zeigte sich meine zweirädrige Neuerwerbung nicht gerade von der besten Seite. Vieles an dem Ding war zudem für mich ungewohnt. Gangschaltung bockte und einiges mehr. Hinter mir trug angesichts der Mängel der nervöse zappelnde Antonio auch nicht sonderlich zur Hebung meiner Laune bei, ließ ihn immer wieder mal Straßennamen vergessen, uns im Kreis fahren.
Knapp eine halbe Stunde nach Beginn der Testfahrt in dem mörderischen Verkehr brach ich schon wegen des überängstlichen Sozius ab. Zurück ging es, um diverse Änderungen vorzunehmen und diese verschlangen den ganzen Vormittag. Danach Testfahrt allein und ich war zufrieden. Jedenfalls kam ich zu der Überzeugung, dass ich mit dem Ding arrangieren kann und nach einigen Kilometern gut zurechtkommen würde. Zurück ging es in seine Wohnung. Zahltag war angesagt. Alles in allem landeten 1500 Dollar auf dem Tisch des Hauses. Fünfhundert Dollar wäre „Pfand“ für das Fahrzeug, welches ich am Ende der Reise zurückgeben würde. Unmittelbar darauf erfolgte eine „Schulung“ zu den Problemen Perus und derer hatte es wirklich reichlich. Antonio kannte sich als Abkömmling eines Indiostamms bestens aus, hatte einen großen Teil der Kindheit in den Bergen um Cusco und des Titicacasees verbracht. Kaum etwas, was er nicht zu kennen schien. Praktisch stand der Expedition, bis auf die üblichen Gefahren, nichts mehr im Wege. Mittagessen fiel aus, reichlich starker Kaffee ersetzte dieses.
Abends gingen wir zusammen mit der Schwester in der Altstadt essen und auch bei diesem, rumpelte es unter den Füßen. Breites Grinsen und Schulterzucken, mehr hatte Antonio und Isabella für das Minibeben nicht übrig. Gleichgültig futterte er weiter, Isabella–Maria, welche ich nur noch Isabella nennen solle, schwatzte von den letzten Einkäufen und wie toll Deutschland wohl sei. Immerhin gibt es dort alles, zumindest ihrer Meinung nach, umsonst und schon viele ihrer Freunde und Freundinnen wären schon dort. Ob sie denn bei mir auch mal Urlaub machen könne, flötete sie fragend und diese Frage hatte mit Sicherheit nur einen Hintergedanken, welchen ich mir nicht weiter ausmalen wollte. Derzeit galt meine Hauptsorge jedoch mehr meinen Kopf und den wacklig erscheinenden Dachziegeln über diesem. Befürchtete bei jedem rumpeln der Erde und zwischen jedem Happen, ein paar der dicken rotbraunen Dinger auf das Denkzentrum zu bekommen, wähnte gar überängstlich ganze Hauswände auf mich stürzen, sah mich, unfachmännisch zerlegt, schmerzhaft unter Trümmern das Leben auszuhauchen. Neben mir flötete Isabella weiter davon, was sie eigentlich für eine gute Ehe–und Hausfrau sei. Einzig sexuelle Präferenzen und Bettkünste kamen nicht zur Sprache. Anspielungen darauf hingegen schon. Nervös rutschte Antonio bei Worten dieser Art auf seinem Stuhl herum. Rückte sich immer wieder die Brille gerade; war ihm doch das Gespräch sichtlich unangenehm, verschwand bereits kurz nach 22 Uhr. Nicht ohne seine Schwester vorher noch scheel und strafend von der Seite anzusehen.
Warnte vorher sauer in meine Richtung: „Meine Schwester hat es hinter den Ohren.“
Da Deutsch, verstand sie nichts und ich musste innerlich grinsen. Isabella bezirzte mich weiter nach allen Regeln der Kunst, spielte dabei verträumt mit meinen Fingern. Tanzen redete ich ihr mit Hinweis auf die morgige Tour aus, versuchte sie mit Drinks auf andere Gedanken zu bringen. Ohne Erfolg, denn weder der zweite noch der dritte, oder gar der fünfte, zeigten bei ihr auch nur den Hauch einer Wirkung. Antonio hingegen, das kannte ich aus der Vergangenheit, wäre spätestens nach drei Gläsern sturzbesoffen unter den Tisch gefallen, hatte sich geschickt mit seinem Abgang der Peinlichkeit entzogen. Isabella hatte bereits acht Gläser intus und zeigte immer noch keine Ausfallerscheinungen, was mich erstaunte. Vielmehr zeichnete sich von Drink zu Drink zunehmend deutlicher der typische Ausdruck von „Fick–mich–endlich“ in ihrem Gesicht ab; verstärkte sich nach den nächsten zwei Gläsern noch weiter.
Zehn Gläser, ich fiel vom Glauben! Ihre Leber schien aus einem einzigen Loch zur Aufnahme von Alkohol zu bestehen. Deutlicher werdend, die brüderliche Kontrolle als Aufpasser und Beschützer ihrer nicht mehr vorhandenen Unschuld fehlte mit seinem Abgang, offerierte sie mir unmissverständlich ihre Vorstellungen von einem Abschluss des Abends in einem Stundenhotel. Präzisierte endlich enthemmt und ungestört vom Bruder, auf welche Praktiken sie steht, welches mich wegen ihrer Offenheit nun doch leicht zum Erröten brachte. Im Haus bei ihr, erklärte sie wispernd an meinem Ohr, würde es nicht gehen, vielmehr mit Sicherheit zu Verwerfungen führen; machte auch deutlich, warum dem so sei.
„Weißt du“, flüsterte sie leise kichernd, „ich schlafe mit Mutter in einem Zimmer, denn diese Woche hat die Pflegerin Urlaub. Mama ist zwar taub, aber was sie nicht hören soll, das versteht sie immer und glaube mir, ich bin nicht nur stürmisch, sondern auch laut.“
Verständlich, dass unter diesen Umständen ein Hotel zum Ausleben ihrer Lust notwendig ist. Hat sie nur halb so viel Chili im Körper, wie ihre Avancen erahnen ließen, schien es sogar angebracht zu sein, in ein besseres Hotel mit dickeren Wänden auszuweichen, bevor sie das ganze Haus bei einem Orgasmus zusammenschreit. Isabella wurde immer direkter, rückte dichter und dichter an mich heran. Rot lackierte Fingernägel, angewachsen an zarten Fingerspitzen, trippelten spielerisch über meine Finger, meine Hände, tänzelten über die Unterarme und von dort aus weiter hoch bis zum Hals.
Warme Lippen näherten sich meinen Wangen, hauchten mir Isabells warmen Atem an die Ohren, ließen mich von Kopf bis Fuß vor wohliger Lust erschauern. „He, ausziehen und ficken“ kreischte das männliche Denkzentrum zwischen den Beinen unter mir, Gänsehaut raste über den ganzen Körper. Blumige Worte, genau von diesen wunderschönen Lippen geformt und in meine Gehörgänge transportiert, verliehen, zusammen mit unglaublich erotischen Blicken der tiefschwarzen Augen, der Erwartung Ausdruck, dass ich hoffentlich länger als ein Peruaner durchhalten könne. Deren Durchhaltevermögen war mir nicht bekannt, fragte auch nicht nach, um keine weiteren Begehrlichkeiten zu befeuern und den Abend nicht länger als nötig in die Länge zu ziehen. Unter anderen Umständen hätte ich ihr Angebot niemals ausgeschlagen, doch morgen ging es auf die Piste und ich wollte wenigstens etwas schlafen. Mit ihr in einem Zimmer? Heilige Jungfrau Maria hilf!
Mir brach der Schweiß aus, keine Sekunde würde ich in den Schlaf finden, wenn auch nur 1 Prozent ihrer Verheißungen zutreffen sollte. Schon ihr „Hunger“ nach mir, überhaupt einem Mann, wäre der Garant totale Erschöpfung bis zu meiner Abfahrt. Sexuell ausgehungerte Frauen ihrer Art durfte ich schon erleben. Regelmäßig endeten diese Nächte am Morgen in fast komatösen Zuständen. Nicht selten gepaart mit Migräne ähnlichen Ausfällen. Allmählich sah sie es wohl ein, dass mir nicht nach einem Abenteuer ihrer Vorstellung zumute war. Leicht enttäuscht wegen meiner Standhaftigkeit brachte sie mich zurück zum Hotel. Kuschelte sich im Taxi an mich, ließ ihre Finger an erogenen Körperstellen tänzeln, bis mir, ungeachtet der auf die Stellung „Feinfrost“ eingestellten Klimaanlage, erneut der Schweiß ausbrach. Leise stöhnend zwang sie meine Hand in ihre enge Hose, dort wieder in den Slip, welcher sich alles andere als trocken präsentierte. Kaum vor dem Hotel angekommen, ergriff sie die letztmalig an dem Abend die Initiative, holte sich wenigstens einen Teil dessen, was ihr die ganze Zeit im Kopf herumspukte. Nichts konnte sie mehr davon abhalten, deutsche Tonsillen hinsichtlich ihrer Lage und medizinischen Beschaffenheit eingehend mit der Zunge zu untersuchen, bis mir bei dieser Aktivität die Luft ausging. Verdammt noch mal – Küssen konnte das Biest und den Rest wollte ich mir nicht erst vorstellen. Schlagartig kochte mir abermals das Blut in den Adern, drohte ich, vor mir selbst schwach werden zu wollen.
„Morgen treffen wir uns wieder und dann haben wir mehr Zeit füreinander“, schnurrte sie mir wie eine Katze zum Abschied ins Ohr und mir stellten sich vor Geilheit erneut die Nackenhaare auf. „Keine Sekunde mit mir wirst du bereuen“, versprach sie abschließend, was verlockend und drohend zugleich klang.
Regelrecht erleichtert flüchtete ich mich in das Zimmer, wobei leider die Nacht ähnlich unruhig verlief wie die am ersten Tag. Zum einen lag das an weiteren leichten Beben und zum zweiten, geisterte mir Isabella durch den Kopf. Hoffte für mich, dass ich sie vor der Abreise noch einmal sehen könnte und sollte sie dann erneut so rollig sein, gäbe es für mich wahrscheinlich keinerlei Halten mehr – Planänderung inklusive.
Morgens holte mich Antonio wieder ab. Isabella war mit der Mutter glücklicherweise auf dem Markt zum Einkauf. Unser gemeinsames Frühstück dehnte ich nicht weiter aus.
Zum einen wollte ich los, zum anderen befürchtete ich, dass Isabella mit anderen Mitteln der weiblichen Verführung mich doch herumbekommen würde. Ich unbeabsichtigt den Start der Reise deswegen um einen ganzen Tag, oder gar zwei oder drei, verschieben müsste. Einige Stunden holprige Straßen mit dem rassigen Weib im Bett tauschen war ungeheuer verlockend, doch würde dies meinen Zeitplan erheblich durcheinander bringen. Keine Ahnung, ob es dann wirklich bei nur einem Tag Verzögerung bleiben wird.
Frühstück war durch und Antonio erschien mir, ungeachtet des gespielt gleichmütigen Gesichtsausdrucks, um einiges nachdenklicher als sonst.
„Verrückt bist du“, meinte er ironisch und besorgt nachdenklich zugleich. „Peruaner würden eine solche Tour ohne triftigen Grund nicht unternehmen. Logisch betrachtet, gibt es für deine Reise keinen Anlass, ist blanker Wahnsinn und Unsinn zugleich. Möge die heilige Maria dich beschützen“, schlug dabei ein Kreuz.
Überzeugt schien er nicht von deren Schutz zu sein, denn er selbst bezeichnete sich immer als gläubigen Atheisten. Trug aber auf der Brust ein dickes Kreuz aus Silber und in seinem Zimmer hing eine kitschige Madonna im vergoldeten Plastikrahmen. Sicher hergestellt in China. Grund für eine Reise nach Cusco wäre für einen Peruaner aus Lima lediglich ein Trauerfall, eine Hochzeit oder vergleichbares an Festen. Natürlich mit einem der hoffnungslos überladenen Überlandbusse, welche neben den Passagieren nicht selten ganze Hausstände und reichlich Tiere transportieren. Dass diese meist betagten und schrottreifen Gefährte nicht selten ihre Fracht hunderte Meter tief in Schluchten, statt an das eigentliche Ziel befördern, nimmt man ungerührt in Kauf. Hauptsache billig gefahren und geschieht ein Unfall, war es eben der Wille der Götter und man hat wieder einen Todesfall zu „feiern“. Nächste Reise, nächster Versuch, nächstes Glück. Zeitungen und Fernsehen brachten täglich derartige Horrormeldungen.
Zusammen packten wir die Ausrüstung auf das Motorrad, was fast eine Stunde Zeit kostete. Eine lange Stunde, wo ich innerlich am Zittern war, zu allen Inkagöttern und Heiligen betete, dass nicht Isabella mit ihrem verliebt schmachtenden Blick um die Ecke kommt, mich zum Mittagessen einlädt, denn dann wäre es mit meiner Beherrschung mit Sicherheit vorbei.
Götter wie Heilige hatten ein Einsehen, hielten die fleischliche Versuchung in Form von rund 50 Kilogramm Lebendgewicht, mit Traumfigur und garantiert von einer gewissen Ausscheidung durchweichtem Zwickel fern. Dessen ungeachtet beschlossen alle Hormone und eine Unterabteilung des Gehirns, auf der Rückfahrt bei Antonio anzulegen, der Verlockung des Weibes hemmungslos über ein, zwei oder mehr Nächte nachzugeben. Ohnehin musste ich das Fahrzeug zurückbringen und der Rest, um die sexuelle Gier dieser Frau zu befriedigen, wäre ein Kinderspiel. Hoffte ich zumindest. Einzig Isabella müsste ihre Abwesenheit zu Hause begründen. Jäh, wurde ich aus meinen sündigen Gedanken gerissen. Antonio wollte unerwartet weg, hatte angeblich noch einen Termin.
„Arbeit, wichtige Arbeit, du weißt, ich bin Ingenieur und sehr gefragt“, wie er ohne rot zu werden schamlos log.
Schulterklopfen und ein fester Händedruck zum Abschied. Meinerseits gewohnt hart und männlich, Antonio kniete augenblicklich fast vor mir, grinste verlegen, rieb sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand.
Mein Abenteuer Peru konnte beginnen, dessen Ausgang ebenso ungewiss war, wie unterwegs das Wetter. Unter mir, die Maschine war ungewohnt, kein Vergleich mit meiner zu Hause, jedoch funktionierte die Schaltung korrekt. An den Rest ihrer Macken und peruanischen „Besonderheiten“ würde und müsste ich mich unterwegs gewöhnen.
Raus aus der Einfahrt, winken. Beladen war sie noch schwerer zu lenken und der chaotische Verkehr in der Metropole machte mir die ersten Kilometer nicht einfach. Gut drei Stunden Fahrt brauchte es, um aus dem Chaos der Stadt herauszukommen.
Erste Tage im Land der Inkas
Aufatmend stand ich am Rand der ersten Fernstraße, rauchte eine, sah mich um. Lima, der Moloch an der Küste und Hauptstadt von Peru, lag hinter mir.
Plan Nummer 1, von 4 möglichen, führte mich von Lima aus in Richtung Süden, immer die Panamericana entlang. Übertragen auf die Nummern des Straßennetzes ging es also von der S1 über die S30A auf die 3S mit Endziel Cusco und Machu Picchu. Wollte diese beiden Orte am Ende der Reise auf den jeweils letzten rund einhundert Kilometern querfeldein durchs Gelände ansteuern. Auch so war beabsichtigt, immer wieder ins Gelände, sprich in die „Pampas“ auszuweichen, um Land und Leute besser kennenzulernen. Entlang der Hauptstraßen hatte es mehr das kommerzielle Peru mit angepasstem Essen, überzogenen Preisen und hoher Kriminalität, bis hin zu bewaffneten Überfällen und Entführungen. Zwar weit abseits liegend, stand noch ein Besuch der Nazca–Linien mit auf dem Programm. Perfektionist, wie es meine Art ist, hatte ich, um für möglichst alle Eventualitäten gewappnet zu sein, mir, wie bereits erwähnt, vier Varianten ausgedacht, diese gestern ausgiebig beim ersten Kaffee mit Antonio diskutiert.
Wenn sich einer auskannte, dann er als Einheimischer. Angefangen vom Wetter bis hin zu Demonstrationen und Aufständen, musste alles Denkbare und auch eigentlich unmöglich scheinendes berücksichtigt werden. Innenpolitisch brodelt es schon seit langem in dem Andenstaat. In abgelegenen Gebieten, in den Bergen und im Dschungel, treibt sich zum Beispiel das maoistisch und marxistisch–leninistisch geprägte rote Gesindel „Leuchtender Pfad“ herum, welche, ungeachtet ihrer Entwaffnung, noch für Terror, Schrecken und Tote sorgen. Antonio riet mir für den Fall einer Begegnung zum Selbstmord. Wäre allemal besser, bevor die Hand an mich legen. Derart fatalistisch konnte ich als Kämpfer die Sache nicht betrachten, vertraute einfach auf mein Glück, auf mein Bauchgefühl, welche mich ständig warnte, mir nicht selten Entscheidungen abnahm. Plötzlich schoss Antonio ein „genialer“ Gedanke durch den Kopf. Scheinbar für ihn die Lösung aller Lösungen.
„He, du hast die Pistole und 100 Schuss“, laberte er sinnbefreit los. „Sind es nur zwei oder drei, schieß schnell und mit etwas Glück, ist das Problem erledigt“, stellte er mit einem mehr irren Blick fest, in dem das Wort „Angst“ auf dem ersten Platz rangierte.
Augenscheinlich meinte er es damals ernst damit, denn er verzog keine Miene, stopfte sich den nächsten Happen in den Mund. Indios pflegen bekanntlich eine äußerst merkwürdige Einstellung zum Tod. Manche seiner Gedanken stellten sich für uns Deutsche, gelinde ausgedrückt, etwas skurril dar, und das hatte ich bereits mehrfach in Deutschland bemerkt. An besagten Abend beschloss ich die Bemerkung einfach zu ignorieren. Wichtiger war für mich jetzt den selbst auferlegten Zeitplan pro Tag zu schaffen, hatte andere Sorgen, als eher unwahrscheinliche Überfälle. Bis in das Operationsgebiet besagter roter Gangster war es noch weit. Sehr weit, und ich hatte nicht die Absicht, mit denen am Lagerfeuer die „Internationale“ zu singen; überhaupt deren Gebiet zu tangieren.
Bereits am zweiten Tag meiner Reise wich ich oft von der Hauptstraße ab, fuhr lieber über Schotter– und Lehmpisten durch die Dörfer, denn Zeit hatte ich mehr als genug. Passte den Körper, streckenweise führte die Route bis in 4500 Meter Höhe, allmählich auf die extreme Höhenlage an. Kuscheltouren für Weicheier unter sachkundiger Führung auf ohnehin weitestgehend sicheren Strecken sind nichts für mich. Habe ich schon einmal die Möglichkeit, reize ich diese bis auf den letzten Punkt aus. Gefahren ziehen mich an wie ein Magnet und ich genieße, sehr zum Leidwesen meiner Angetrauten, die Extraportion Adrenalin wie einen Morgenkaffee. Hier, weitab der sogenannten Zivilisation, gab es für mich wesentlich mehr zu sehen.
Einheimische, bis auf die Verkäufer von touristischem Tand in den entsprechenden Gebieten, mieden weitestgehend meine Gegenwart. Zu sehr haftete mir aufgrund meiner Hautfarbe der Makel des „Gringo“ an, galt ich als willkommene Beute für Händler jeder Art. Einladungen gab es nicht. Gespräche, zum Beispiel auf die Nachfrage nach dem Weg oder nach bestimmten Einkaufmöglichkeiten, beschränkten sich auf das Notwendigste. Kein Wort zu viel wurde gesagt. Wie bereits erwähnt, rangierte ich wegen meiner ethnischen Herkunft unter dem verächtlichen Begriff „Gringo“, welcher allenthalben für Amerikaner benutzt wird und diese können sie aus vielerlei Gründen nicht ab. Lediglich deren Geld mögen sie und das überaus gern. „Gringo“ wird hier gleich inflationär benutzt wie „Farang“ in Thailand und hier wie dort, findet keiner etwas dabei, wohingegen es damals in meiner Heimat gerade damit begann, Dinge nicht mehr beim Namen nennen zu dürfen, ohne erhebliche Konsequenzen dafür tragen zu müssen …
Positiv an der Strecke war des Weiteren die Tatsache, dass ich mich abseits der offiziellen Routen, wesentlich preiswerter mit Lebensmittel eindecken konnte, das Essen in den Gaststätten nicht Touristen angepasst wird. Überwiegend landestypisch. Geschmacklich ging es von gewöhnungsbedürftig über würzig, exotisch, von reichlich süß, bis hin zu extrem scharf. Keinesfalls so scharf wie in Mexiko und man ist gut beraten, nicht genau nach den verwendeten Zutaten zu fragen. Zu schnell könnte einem der Appetit vergehen. Gern schlug man beim Kassieren auf, verlangte grinsend „Ausländerpreis“, nur hielt sich dieser in Grenzen. Normales Prozedere in allen ärmeren Ländern. Allein die Anwesenheit des Ausländers demonstrierte für die Einheimischen dessen „Reichtum“, „berechtigt“ sie quasi zu diesem Verhalten. Diskussionen sinnlos.
Erinnerte mich an einen Vorfall im Jahre 1994 in Asien, wo mir im Brustton der Überzeugung von der Tochter eines höheren (kommunistischen) Beamten lautstark unter dem Beifall der Umstehenden ihre „Logik“ unter die Nase gerieben wurde:
„Ihr Deutschen müsst uns alle von eurem Reichtum abgeben“, tönte sie mit überschnappender Stimme und mir blieb, ob der Frechheit, der Mund offen stehen.
Ausgerechnet die Deutschen in der DDR hatten enorme Summen für dieses schmale Land gespendet, Krankenhäuser gebaut und dergleichen mehr, was man zu dieser Zeit eben unter der auch noch zu bezahlenden „Deutsch–Vietnamesische–Freundschaft“ verstand. Freunde hat man, bezahlt diese aber nicht wie eine Prostituierte oder eine Geldstrafe! Dass ich in den Dörfern Perus beim Essen in der Regel allein am Tisch saß, aufmerksam von unzähligen dunklen Augenpaaren beobachtet wurde, störte mich nicht weiter. Studierte meinerseits ebenso genau die Leute, machte mir meine Gedanken. Anerkennend wurde lediglich registriert, dass ich weder Hände noch Füße oder ein Wörterbuch bei der Bestellung des Essens und bei Fragen jeder Art benötigte. Trotzdem schien es kein Grund zu sein, sich mit mir aus eigenem Antrieb unterhalten zu wollen. Was sich in Lima anders zeigte. Kaum wurde ich als Ausländer erkannt, mein „Fremdländisch“ gehört, wurde geschwatzt wie auf dem Markt. Abends in der Gaststätte mit Isabella und Antonio zum Beispiel geschehen. Hemmungen kannte man nicht, fragte mir Löcher über das Land, in den Bauch, wo angeblich „Milch und Honig“ für alle Armen, Bedürftige und Kriminellen dieser Welt fließen.
Fotos von der ärmlichen „Idylle“ zu machen unterließ ich weitestgehend, vor allem, wenn Leute in der Nähe waren. Konzentrierte mich mehr auf interessante Gebäude, Tiere und Pflanzen, denn schon am zweiten Tag hatte ich bemerkt, dass das die Leute in der Regel nicht so gern sahen, manche gar Geld für Fotos haben wollten. Waren viele Indios zugegen, wurde die Atmosphäre nicht selten abweisend, eigentlich schon feindselig, um im nächsten Dorf wieder in das krasse Gegenteil, nämlich verhaltene Neugier und Freundlichkeit, umzuschlagen. Jeder Kilometer mehr, welcher zwischen Lima und den Bergen mit seiner zumeist indigenen Bevölkerung lag, offenbarte die eigentliche Armut des Landes und dessen innerer Zerrissenheit, brachte mich näher an das reale Leben heran. Asphaltierte Straßen wichen Lehm– und Schotterpisten. Lamas und Maultiere als Lastenträger ersetzten Pick–ups und LKWs.
Primitive Behausungen, mehrheitlich umzäunt oder hinter bröckligen Lehmmauern versteckt, bildetet die Ortschaften. Lebendige Zäune in Form von Hecken aus Kakteen waren mehr und mehr zu sehen, bildeten reizvolle Motive. Baumaterial war offensichtlich knapp. Massive Häuser sah man immer weniger. Hütten aus Lehmziegeln, meist mit Ziegel, Palmblättern oder Stroh gedeckt, dominierten. Wellblechdächer sah man nur selten. Ortsschilder fehlten komplett, genauso wie Straßen, welche den Namen verdienen. Wusste man nicht genau, wo man sich befand, verrieten die Karten keine Ortsnamen, half nur fragen. Menschenverachtend, dass diese Armut in Reiseberichten und Reisekatalogen, in der Regel als „malerisch“ oder „ursprünglich“ definiert wird. Getrost darf man davon ausgehen, dass das die Leute vor Ort gänzlich anders sehen. Weitab der großen Städte und von Lima, zeigten sich die Menschen verhalten neugierig, Kinder ausgenommen. Weder kannten sie Hemmungen noch Angst. Fremde wie mich, betrachtete man im einfachen Volk nicht mehr ausschließlich als wandelnde Brieftasche mit unbegrenztem Volumen, lehnte mich nicht sofort kategorisch ab. Wahrten jedoch deutliche Distanz; ließen mich den ersten Schritt der Kontaktaufnahme machen.
Kaum erfuhr man von meiner tatsächlichen Herkunft, war der Makel des bösen „Gringo“ wie von Geisterhand von mir genommen, wurden es freundlich, teilweise sogar herzlich. Einladungen gab es nicht, dafür war ich beim Essen in diesen Gegenden nun seltener allein. Man erzählte über die Besonderheiten des jeweiligen Landstriches, gab mir Tipps und Sicherheitshinweise.
Länger als eine Woche war ich bereits unterwegs, hatte Puerto de Lomas passiert, welches sich rund 530 Kilometer von Lima entfernt befindet. Hauptstraße verlassen hieß es und ich bog links hoch in die Berge, bis auf fast 4500 Meter Höhe. Um den Kreislauf nicht zu überlasten, nahm ich mir Zeit, passte den Körper auf die dünne Luft an, Motorrad war für diese Höhenlagen „umgestrickt“, funktioniert tadellos.
Heute fuhr ich auf der Straße 30 B, zog dann quer durch das Gelände Richtung der 32 A. Mehr und mehr wurde die Landschaft in ihrer surrealen Schönheit zu einer Herausforderung für mich unangepasste Langnase. Immer öfters musste ich Pausen einlegen, doch die Strapazen wurden mit unglaublichen Eindrücken belohnt. Kaum noch, dass man Häuser und Menschen antraf. Gefahren wurde nur nach Kompass und Karte.
Bestenfalls hatte es noch Trampelpfade, wo ich mich täglich aufs Neue fragte, wer diese getreten hat. Nutzte diese als zusätzliche Orientierung, denn sie führten zwangsläufig zu Menschen. Endlich hatte ich die Straße 32 A erreicht, schlug weitab von ihr wieder ein Lager auf. Nachts war es sehr unruhig.
Menschen und Tiere schienen in der Nähe zu sein, denn die Bewegungsmelder schlugen Alarm, ohne dass ich die Quelle der Störung ausmachen konnte. Übermüdet ging es am nächsten Morgen weiter. Endlich tauchten wieder Dörfer auf. Keines davon war auf meinen Karten verzeichnet, die Menschen verhielten sich scheu und distanziert. Man konnte oder wollte kein Spanisch können, zeigte sich abweisend. Zweifellos handelte es sich um Indigene. Verständigung ausgeschlossen, man sprach eine andere Sprache. Weiter ging die Fahrt, die nächsten Ansiedlungen waren größer, man unterhielt sich wieder mit mir, staunte über den verrückten Deutschen. Übernachtet habe ich weitab der Dörfer und der Hauptstraße, wo allein schon diese Bezeichnung eine Beleidigung für diesen Straßentyp darstellte. Schotter–Lehmpiste traf es eher. Mochte es mir nicht vorstellen, wie diese nach einem Regenguss ausschaut. Außer Karren mit Maultieren hatte ich über gut hundert Kilometer kein anderes Fahrzeug mehr gesehen.
Heute Morgen hatte ich ein Dorf verlassen, mich dort mit Trinkwasser und Proviant versorgt. Übernachtet wurde weit außerhalb im Freien, denn auf den letzten rund dreihundert Kilometern querfeldein, hatte ich weder ein Gästehaus, noch ein Hotel zu Gesicht bekommen.
Vor mir lag eine Strecke, welche zumindest ähnlich sein dürfte. Nichts war mit Herbergen und einer Dusche, vermisste ich die aus Mexiko von mir belächelten „Rio grande“. Besser so ein Rinnsal, als Staub. Langsam näherte ich mich den für mich interessanten Gebieten, kam kaum noch nach mit Fotos machen.
Trotz der Höhenlage von über 2800 Metern war es heiß, wobei es in den Anden eine trockene Hitze ist. Nicht so ekelhaft feucht wie in Asien. Nachts wurde es hingegen empfindlich kühl. Unvermittelt tauchten genau die Pflanzen auf, nach welchen ich seit Tagen gesucht hatte. Wunderschöne Kakteen von teils enormer Größe prägten die karge und felsige Landschaft, wo Wasser reinster Luxus ist. Stopp war angesagt, denn ich hatte genau die richtigen Motive gefunden. Ein Blick auf die Karte offenbarte weder eine Straße noch einen Ort in der Nähe.
Außer Felsen, Geröll, vertrockneten Sträucher und Bäumen, war nichts, außer eben besagten Kakteen, zu sehen. Glühend heiß fegte über die öde Landschaft der Wind. Glaubte man den Karten beider Länder, der peruanischen oder der deutschen, lag die nächste Ortschaft in rund 25 Kilometer Entfernung, wobei diese kaum größer als ein Flecken sein konnte. Viele der Ortsnamen klingen für Ausländer hochtrabend und überaus wichtig, vermitteln die Illusion einer großen Stadt. Meinen bisherigen Erfahrungen nach dürften, wenn überhaupt, diese Orte über kaum mehr als 200 Einwohner verfügen. Vermutlich gab es dort mehr Lamas für den Warentransport und Meerschweinchen für den Grill, als denn Einwohner. Prüfend besah ich mir in der Rauchpause meine Maschine. Reservetanks waren voll, gleiches galt für das Wasser. Dosenfutter steckte genügend in den Seitenkoffern. Damit käme ich noch gut und gerne mindestens eine Woche hin. Essen genehmigte ich mir ohnehin am Tag nur mittags und abends am Lagerfeuer.
Kippe flog achtlos weg, fertig, mein Blick wanderte von der Karte wieder zu den Pflanzen. Rastete dort Sekunden später voller Bewunderung und wie angenagelt an einem Punkt ein. Unglaublich! Angetan hatte es mir aus der Menge der dornigen Gesellen eine ganz besondere Pflanze. Gewachsen wie aus einem Lehrbuch für Botanik, scheinbar nur dazu bestimmt und gewachsen, Augen und Sinne des Fremdlings zu erfreuen.
Wie heißt es doch so schön und zutreffend? „Jeder Kaktus ist eine Sukkulente, doch nicht jede Sukkulente ist ein Kaktus.“ Dieser Spruch verblüfft immer wieder Laien, welche mit dem botanischen Begriff „wasserspeichernde Pflanzen“ eigentlich nichts anzufangen wissen, selbst Wolfsmilchgewächse mit Kakteen verquirlen, gewöhnlich die Urheimat der Kakteen nach Afrika in die Sahara verlegen.
Wo dann im Schatten der Pyramiden kurz vor Sonnenuntergang der Pharao mit der Gießkanne loszog, schwitzend wässerte, um der Nachwelt diese wundervollen Pflanzen zu erhalten. Gut, könnte ebenso auch gewesen sein, die Pharaonin hat gegossen, er sie nur beaufsichtigt, damit sie keinen falschen Fehler macht? Spaß beiseite – nichts ist mit Pharao, Pyramiden und Sahara! Kakteen stammen vom amerikanischen Kontinent, wurden erst später in die halbe Welt verschleppt. Wie die Kartoffel, Tomaten usw.
Im Nachhinein betrachtet, hat diese einzeln stehende Pflanze den Verlauf der gesamten Reise drastisch verändert, kaum vorstellbare Dinge ermöglicht, eine lebenslange Freundschaft geschaffen, zahlreiche Weichen in meinem Leben gestellt und ich fragte mich, wer eigens für meine Wenigkeit das Ding dorthin gestellt hat?
Wer war es? Ein Inkaherrscher vor 200 Jahren? Gab es da überhaupt noch welche? Eher nicht, denn meines Wissens nach, nannte sich der letzte Herrscher Túpac Amaru und diese wurde 1572 von den Spaniern zu seinen Ahnen geschickt, um die eher zutreffenden Worte „ermordet“ und „enthauptet“ zu vermeiden. War es ein peruanischer Bauernlümmel? Oder hat ein Vogel den Samen aus seinem Hintereingang beim Defäkieren dort platziert? Scheißegal! Vor mir erhob sich jedenfalls ein botanischer Traum! Majestätisch, einzeln, fast ganz oben stehend wie ein König, welcher huldvoll vom Balkon im Burghof sich seine Untertanen beschaut und deren Ovationen entgegennimmt, präsentierte sich der Favorit des Tages. Browningia candelaris lautete dessen lateinischer Name, das Ziel der Stunde. Präsentierte sich wie gemalt, eigens nur für mich dort hingestellt, vollkommen symmetrisch gewachsen, blühend, zumindest aus der Entfernung makellos erscheinend, gut 6 Meter groß, ein Anblick, worum mich jeder promovierte Botaniker an seinem Schreibtisch und hinter dicken Büchern verschanzt, beneiden würde.
Dummerweise stand dieses aus einem Lehrbuch für Botanik entfleuchte Prachtexemplar gut 30 bis 40 Meter über mir an einem steilen Hang, dort wieder ganz kurz vor der Kuppe, wo es der Hitze und Trockenheit trotzend, sein kärgliches Dasein fristete. Prüfend sah ich nach oben. Kein Weg, kein Trampelpfad war auszumachen. Logisch, denn selbst meine „Anfahrtsstraße“ war auf den Karten beider Länder nicht existent. Schotter und Geröll – mehr gab es nicht. Steiles Gelände, aber nach oben zu klettern, traute ich mir ohne weiteres zu. Bis zum Ziel meiner Begierde hatte es genügend Felsvorsprünge, wo man im Bedarfsfall verschnaufen konnte. Kaum anzunehmen, dass sich noch einmal eine derartige Gelegenheit oder ein so makelloses Motiv bieten würde. Damit stand die Entscheidung fest. Vorwärts Genossen, nicht dem Abgrund, sondern luftigen Höhen entgegen! Kurz entschlossen wurde die Kletterausrüstung aus dem Seitenkoffer geholt, zog ich mich wenig später, angestrengt keuchend, Meter für Meter, dem Ziel entgegen. Klettern, fixieren, hochziehen, fixieren, klettern. Kleiner und kleiner wurde unter mir das Motorrad, verschmolz nach 20 Meter in der flirrenden Hitze mit der Umgebung und dem steinigen Weg. Erschöpft, vielleicht 4 oder 5 Meter vor dem Ziel, legte ich eine letzte kurze Pause ein, atmete siegessicher tief durch.
Knapp am Tod vorbei
Gleich, geschafft, redete ich mir zu. Unerwartet hörte ich das charakteristische Rasseln einer Klapperschlange, welches mir vor Schreck fast das Blut in den Adern gerinnen ließ und in der nächsten Sekunde erblickte ich sie auch schon. Zwar hatten mich Antonio und einige Einheimische vor einer bestimmten Art Klapperschlange gewarnt, doch wer konnte schon ahnen, dass hier, so kurz vor dem Ziel, ausgerechnet eines dieser hochgiftigen Exemplare, dieses schmale Territorium vor der Pflanze als das ihre beanspruchte? Vor meinem inneren Auge lief eine Dia–Show aller hier heimischen Giftschlangen ab, blieb entsetzt bei dem Bild der „Schauer–Klapperschlange“ stehen.
Eher selten in Peru, was das Reptil jedoch nicht daran hinderte, ausgerechnet an dieser Stelle meinen Weg zu kreuzen. Schlangen vermehren sich nicht mit Luft, demzufolge gab es hier noch mehr davon und diese Tatsache, überführte das Wort „selten“ augenblicklich ad absurdum. Schlimmer konnte es kaum kommen. Wie aus dem Nichts aufgetaucht, lauerte sie auf dem winzigen Felsvorsprung, wartete auf die geringste falsche Bewegung von mir. Gehandicapt durch das Seil und der Fotoausrüstung, welche schwer vor dem Bauch baumelte, hatte ich nur eine Hand frei. Schnell abseilen würde mit Sicherheit einen Absturz zur Folge haben, mir im „Idealfall“ die Hände bis auf den Knochen zerschneiden.
Abgesehen davon, würde mich das Biest erwischen, bevor ich auch nur die zweite Hand am Seil hätte. Stellt sich die Frage: Tod durch Absturz, oder Tod durch Schlangengift? Beide Varianten keine besonders prickelnden Aussichten sein Leben vor der Zeit auszuhauchen. Abseits der üblichen Routen mich zu finden, mein Anfahrtsweg stand nicht auf der Karte, wäre riesiges Glück. Wahrscheinlicher, dass mich Archäologen in ferner Zukunft als exotische Mumie mit zertrümmerten Knochen ohne Poncho bergen, staunen, was der Verblichene für seltsame Gegenstände bei sich trug. Angstschweiß angesichts des unvermeidlich erscheinenden Todes brach mir aus. Kämpfen, schrie etwas in mir, ruhig bleiben hämmerte es im Kopf. Zentimeter für Zentimeter tastete ich so langsam wie möglich zu der Pistole, welche rechts im Gürtel steckte. Zentimeter für Zentimeter tastete ich so langsam wie möglich zu der Pistole, welche rechts im Gürtel steckte. Prompt interpretierte die Schlange dies als Angriff, rückte näher, das Rasseln wurde extrem laut, schmerzte in den Ohren.
Endlich hatte ich die Waffe gezogen, halbwegs sicher in der Hand, peilte den Kopf der Schlange an. Kam mir dabei vor, wie einer der Kandidaten, der bereits vor Jahren eingemotteten Fernsehshow „Der goldene Schuss“ mit Vico Torriani. Links, rechts, vor, zurück, drehen, links und rechts ging es. Hoffte inständig, dass die Waffe eine höhere Treffsicherheit aufweist als von Antonio angegeben, denn es war weniger als 5 Meter. Schweiß tropfte mir in die Augen, behinderte die Sicht, brannte, ließ die Augen tränen. Zitternd krümmte sich der Zeigefinger am Abzug. Nichts geschah, das Ding klemmte. Kalt wurde mir vor Angst. Unerwartet knallte es, ließ meine Trommelfelle klirren wie zerspringendes Glas. Warum auch immer, hatte sich noch ein Schuss gelöst. Nach dem Knall hatte das Vieh keinen Kopf mehr. Allerdings riss mir der Rückstoß die Feuerwaffe aus der Hand. Unbarmherzig der Schwerkraft folgend, metallisch klappernd alle Steine und Vorsprünge abzählend, fiel sie nach unten Richtung Motorrad. Keuchend zog ich mich weiter an den scharfkantigen Steinen hoch, rutschte immer wieder ab, erreichte die Kante. Schweißgebadet, fertig mit den Nerven eine Zeitlang liegen bleibend, nach Luft ringend, schaute ich nach unten. Unter mir wand sich der Schlangenkörper auf dem Vorsprung, zuckte und zappelte, folgte dann der Flugbahn der Pistole nach unten auf den Weg; allerdings ohne metallisch dabei zu klappern. Klang eher so, als platscht ein Kloß in der Küche auf den Boden. Erschöpft stand ich auf, sah mich um, mich an.
Knöchel der Hand waren leicht aufgeschürft, die Sonne brannte vom Himmel, sämtliche Nerven im Arsch, jeder Knochen tat mir weh; in Summe Zeichen dafür, dass ich noch lebte. Somit hatte die Schlange den Weg zu den Göttern der Inkas angetreten und nicht ich. Vor mir lag eine kleine Ebene, von der ein schmaler Trampelpfad genau zu meinem Standort führte. Ganz weit unten zeigte sich ein Dorf, umsäumt von wenig Grün aus Palmen, mickrigen Bäumen, mehr gelben als grünen Bananenstauden am Wegesrand. Nichts dergleichen war in den Karten verzeichnet. Demzufolge durfte es den Flecken überhaupt nicht geben. Sofern keine Fata Morgana, existierte er eben doch. Klettertour, wenn auch gespickt mit Widrigkeiten, war geschafft. Zeit, um Fotos zu machen. Erhebendes Gefühl neben so einem Wunderwerk der Natur zu stehen. Sicher zwei– bis dreihundert Jahre alt, was allein schon den Aufbau des Stativs für eine Aufnahme rechtfertigte. Europäer oder „Gringos“ standen hier mit Sicherheit noch nicht, Indios aus dem nahen Dorf hingegen bestimmt und damit war wohl nichts mit „Entdecker“. Wenig später sollte sich die Vermutung mit dem „Gringo“ auch noch als Irrtum erweisen …
Unerwartete Begegnung
Kaum war alles bereit, hatte ich mich mit „Blend–a–med–Grinsen“ in Position gestellt, tauchte ein Mann vor mir auf. Vom Aussehen her der typische Indio wie aus dem Reiseprospekt in bunter Kleidung, auf dem schmalen Kopf mit tief eingefallenen Wangen saß ein breitkrempiger Hut, Machete steckte im Gürtel. Über der Schulter trug er eine dunkle Tasche aus grob gewebten Stoff mit farbigen bunten Mustern. Fehlte nur noch der Schnauzbart, ein breiter Patronengurt und eine alte Flinte, um das Filmklischee eines Mexikaners aus amerikanischen Western zu bedienen.
„Guten Tag, Amigo“, grüßte er freundlich, betrachtete interessiert mein Tun.
Auslöser drücken und ich grüßte ebenso freundlich zurück. Langsam kam er näher.
„Woher kommst du?“, seine Hand deutete fragend auf das Seil, „etwa von da unten?“
Spöttisches Lächeln zeigte sich in seinem vernarbten und sonnenverbrannten Gesicht. Bescheuert kam ich mir nach der in einem ironischen Ton gestellten Frage vor, denn er hatte sich mit Sicherheit nicht derart abgemüht wie ich, um jetzt hier zu stehen. Mir wurde mit dem nächsten Satz auch klar, dass ich mir durchaus blöd vorkommen durfte.
„Amigo, unten die Straße, weniger als eine Meile weiter, dann nach links den Berg hoch und du wärst hier gewesen“, grinste er allwissend und der offene Mund zeigte einen geradezu katastrophalen Zahnstatus. „Wäre sicherlich einfacher gewesen, statt mühsam zu klettern, oder?“, stellte er ironisch fest, was leider den Tatsachen entsprach.
Interessant zu wissen, nur half es mir nun nicht mehr weiter. Kaum merklich den Kopf schüttelnd setzte er sich bedächtig hin und öffnete seine Tasche.
„Hast du vorhin geschossen?“, fragte er, legte den Kopf schräg, lauerte irgendwie, „hatte einen Schuss gehört. Klang nicht wie ein Gewehr“, stellte er sachkundig fest.
„Klapperschlange“, versuchte ich so gleichgültig wie möglich zu antworten.
„Klapperschlangen gibt es hier“, stellte er fest, „sehr giftige sogar! Man sollte aufpassen, wohin man tritt. Hat schon Tote gegeben im Dorf. Arzt haben wir hier nicht.“
Erwähnte dies so beiläufig, als erzähle er, dass es gelegentlich in der Gegend regnen würde. Nur wüsste eben keiner genau, wann. Eigentlich fast „no importa“, ob es Regen oder Sonnenschein gibt. Letzteres überwiegt in der Gegend ohnehin.
„Essen wir zusammen?“, fragte er, legte ohne eine Antwort abzuwarten ein flaches Stoffbündel aus grauem Tuch auf einen Stein, setzte sich daneben.
„Gerne, mein Freund. Danke für den Hinweis. Leider ist mein Proviant da unten. Sonst würde ich dir auch etwas anbieten“, vielsagend deutete ich auf den Abgrund.
Schweigend betrachtete er mich, lächelten breit und wickelte das Bündel auf. Maisfladen, dünn und hellgelb ausgebacken, kamen zum Vorschein. Des Weiteren offenbarte die Tasche noch ein kleines Stück Trockenfleisch und eine große, mit Ziegenfell überzogene Wasserflasche, welche zuerst die Runde machte. Schweigend zog er ein Messer aus dem Hosenbund, legte es neben das Fleisch. Gemeinsam tasteten wir uns mit Blicken ab. Seiner prüfend und abschätzend, unübersehbar mit einer Spur Spott darin, meine mehr neugierig. Gemächlich schnitt er zwei hauchdünne Scheiben von dem fast schwarzen Fleisch ab, schob eine davon mit der Messerspitze zu mir rüber.
„Tourist?“, fragte er, schien bei der Frage das Wort „Gringo“ vermeiden zu wollen.
„Wollte mir die Kakteen und Ruinen der alten Kulturen in Peru ansehen. Tourist stimmt nicht ganz“, antwortete ich vorsichtig, „Touristen sind für mich dumm und fast immer nur Angeber. Ich will Land und Leute kennenlernen.“
Harte Behauptung, welche zwar jeglicher Grundlage entbehrte, bei Indios aber immer gut ankam. Erstaunt sah er mich bei dem Wort „dumm“ an, begann breit zu grinsen. Oben hatte es Zahnlücken. Beidseitig waren die 5er–Zähne gezogen. Von selbst ausgefallen, erschien mir dabei weniger wahrscheinlich.
„Stimmt, meinen, mit ihrem Geld das ganze Land kaufen zu können. Sind immer vornehm, denken, sie sind etwas Besseres als wir.“
Heißer Wind pfiff über die Felskante, wir schwiegen eine Runde, grinsten uns weiter an und das seinige wurde immer breiter. Wir schienen einer Meinung zu sein.
Zumindest schien ich, wie beabsichtigt, mir mit der abfälligen Bemerkung über Touristen, bei ihm eine gewisse Sympathie erworben zu haben.
„Deine Sprache klingt so hart wie das von drüben“, damit schob er mir erneut ein Stück des Maisfladens hin, „bitte, mein Freund. Von meiner Frau gemacht.“
Mit „von drüben“ schien er Spanien zu meinen, hatte damit sogar recht, denn mein Spanisch hatte ich in den Grundzügen tatsächlich von einem Bekannten aus Spanien gelernt. Zwingend erforderlich, um von Dolmetschern in Südamerika unabhängig zu sein. Mexiko spricht wieder ein anderes Spanisch, nur hatte die kurze Zeit meines Aufenthaltes nicht ausgereicht, um den dortigen Dialekt unhörbar für jede Gegend aufzunehmen. Wortlos aßen wir von den Maisfladen, kauten zähes Fleisch, spülten mit Wasser runter. Erneut wanderten seine Blicke zu mir, tasteten mich ab wie ein Radar und überlegte etwas.
„Amigo, unten im Dorf gibt es eine Hazienda. Zwei Fremde wohnen dort. Der Mann ist ähnlich wie du. Genauso groß“, stellte er fest und setzte damit die ins Stocken geratene Unterhaltung fort. „Kein Amerikaner. Wie ich gehört habe, kommt die Frau aus Kolumbien. Wirklich hübsch die Frau“, setzte bedeutungsvoll hinzu und schnalzte anerkennend mit der Zunge, „sehr klein wie eine Indiofrau und hat auch lange Haare. Lang wie die meiner Frau, nur bindet meine Frau die immer hoch.“
Zwar konnte ich mit der Information nichts weiter anfangen, nickte jedoch höflich. Wusste damit immerhin, dass die Kolumbianerin ihre Haare offen trug, seine nicht.
„Wo kommst du her?“, fragte er verhalten neugierig. „Ich komme von dort“, seine Hand wies auf den Flecken hinter ihm, „dort bin ich auch geboren. Ohne Arzt, unsere Frauen sind nicht so verweichlicht wie die in der Stadt, können ihre Kinder noch ohne Krankenhaus und teure Ärzte bekommen.“
Andächtig nickte er mit dem Kopf, schien weiter nachzudenken, machte große Augen, als ich es ihm meine Herkunft verriet.
„Alemannia? Oh, dann kommt der Mann aus deiner Heimat“, stellte er fest, nahm einen Schluck Wasser und reichte die Flasche herüber.
„Hat er jedenfalls gesagt, dass er von dort kommt“, und mit seinem nachfolgendem kurzen Schweigen schien er den Wahrheitsgehalt seiner Worte bestätigen zu wollen.
„Vielleicht willst du ihn mal besuchen?“, fragte er, „dort hinten liegt seine Hazienda.“
Dabei zeichnete sich auf seinem Gesicht ein breites Lächeln ab und die Hand zeigte ins Nirgendwo der staubigen Ebene. Schlecht war die Idee nicht. Erwägenswert den Abstecher zu wagen, denn Deutsche wachsen in Peru nicht an Bäumen. Jeder von uns hatte einen Maisfladen gegessen, hatte Wasser getrunken, der Gastfreundschaft damit Genüge getan. Langsam griff er unter seinen Poncho und zog eine zerknitterte Zigarettenschachtel hervor, hielt sie zu mir hin. Dankend lehnte ich ab. Hell flammte ein Streichholz auf. Genüsslich rauchte er einen der Glimmstängel bis zur Hälfte, drückte ihn auf einem Stein aus und steckte den Stumpen in die Schachtel zurück. Gemächlich und ohne eine Antwort betreffs des Deutschen von mir abzuwarten, erhob er sich, faltete das Tuch über den restlichen Maisfladen zusammen, zeigte runter auf den Weg zum Ort.
„Jeder im Dorf zeigt dir den Weg zu ihm. Auf Wiedersehen“, damit verabschiedete er sich, lief gleichmütigen Gesichtes mit leicht schwankenden Schrittes in Richtung Tal.
Wenig später verschwand er aus meinem Blickfeld in einer Bodensenke. Schnell machte ich meine Fotos fertig, packte zusammen. Jetzt nach unten zu laufen hatte ich keine Lust, der Unbekannte sprach von gut einer Meile Weg, dazu müsste ich noch eine Meile rechnen. In der Hitze ins Ungewisse stolpern? Lieber nicht. Vorsichtig ließ ich mich Stück für Stück mit dem Seil wieder ab. Aufmerksam dabei nach der Pistole Ausschau haltend, wurde ich unten nur wenige Meter vor dem Motorrad fündig. Mit ihr schien alles in Ordnung zu sein; sie zeigte keinen Kratzer. Kaum zwei Meter daneben lag der Schlangenkörper, welcher nicht mehr zuckte. Blutspritzer waren auf den Steinen zu sehen.
Normal hätte ich die Schlange am Abend im Lagerfeuer gegrillt, doch lockte der ominöse Deutsche und damit eine relative Sicherheit, heute noch besseres als Dosenfutter zwischen die Zähne zu bekommen. Theoretisch jedenfalls. Seil einpacken, losfahren und den beschriebenen Weg zur Anhöhe suchen, welcher nach den Angaben der Bauern in das Dorf führen soll. Einen Landsmann in der nicht kartografierten Einöde zu treffen, wollte ich mir nicht entgehen lassen.
Mehr als mich hinauswerfen, wenn ihm mein Besuch nicht passte, konnte er nicht. Genau wie beschrieben und ebenso wenig wie das Dorf kartografiert, stieß ich linker Hand auf besagten Geröllweg. Mehr zu erahnen, als dass er wirklich zu sehen war. Einzig reelle Spur war ein wenig in der glühenden Sonne getrockneter Dung von Maultieren. Unwillig aufheulend quälte sich die Maschine nach oben, denn die Steigung hatte es in sich, stellte sicherlich auch für Maulesel und Lamas eine gewisse Hürde dar. Steine schleuderten unter den zeitweise durchdrehenden Rändern hoch. Keine drei Minuten später bergauf, stand ich erneut an meinem Fotoobjekt, stellte die Maschine davor und machte noch einige Bilder. Wennschon, dennschon und dann richtig zünftig. Scheiße, hätte es sein können mit den Fotos. Vorsichtig fuhr ich auf dem schmalen Trampelpfad nach unten Richtung Dorf, was sich als nicht ganz so einfach erwies.
Ständig brachte das lockere Geröll die schwer bepackte Maschine ins Rutschen. Allmählich wurde der Weg besser. Ärmliche Häuser, in zwei Zeilen neben dem staubigen Weg angeordnet, rückten näher. Begrüßt wurde ich wie in jedem Dorf von zahlreichen räudigen Hunde, welche meine Ankunft durch lautes Bellen verkündeten. Dorf zu der Ansammlung ärmlicher Häuser zu sagen wäre weit übertrieben. Immerhin hatte es einen Dorfplatz mit Brunnen und in östlicher Richtung so etwas Ähnliches wie eine Kirche. Zumindest deutete dies das über der Tür angebrachte weiße Kreuz an. Opuntien wie auch Säulenkakteen um die Grundstücke herum dienten als lebende Hecken. Bäume und Palmen gab es nur wenige. Allesamt mit einer dichten Staubschicht überzogen und nach Wasser dürstend. Mickrige Bananenpflanzen standen an den Häusern, zeigten mehr gelbe als grüne Blätter und wirkten fast abgestorben. Keine Menschenseele war im Staub der Straße oder vor den Häusern zu sehen. Demonstrativ stellte ich das Motorrad am Brunnen ab, zog die Jacke ein Stück herunter, um mit ihr die Pistole zu verdecken und ging zum nächsten Haus, vor dessen Eingang eine Frau hockte und Maiskörner verlas.
Misstrauisch wurde mein Gruß von ihr erwidert. Schwer zu schätzen wie alt sie war, auf jeden Fall schon über sechzig. Meine Frage nach den Fremden wurde nicht beantwortet. Stattdessen stand sie brüsk auf, rief nach ihrem Mann, welcher Augenblicke später hinter ihr erschien. Verstanden habe ich nichts von dem, worüber sich die beiden unterhielten. Möglicherweise war es Quechua oder Aymara. Ohne mich weiter eines Blickes zu würdigen, verschwand die Frau im Haus.
„Gringo?“, fragte der Mann, ebenfalls ohne meinen Gruß zu erwidern, mit dem gleichen misstrauischen Augenausdruck wie vorher seine Frau, „was willst du hier? Wir haben nichts, was dich interessieren könnte.“
Immerhin unterstellte er mir als Gringo Grundkenntnisse der Landessprache. Ist ein Indio der Meinung, dass sich die Unterhaltung wegen der Sprachbarriere nicht lohnt, dreht er sich einfach weg und geht. Hatte ich unterwegs in einigen wenigen Dörfern gehabt, wo man kaum verständliches Spanisch, sondern nur indianische Sprachen sprach.
Vereinzelt wurde die Stimmung bei meinem Auftauchen derart aggressiv, dass ich sofort das Weite suchte. Durchaus verständlich deren Verhalten, denn weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, haben bestimmte Ureinwohner gute Erfahrungen mit Europäern gemacht. Mit wenigen Worten erklärte ich meine Herkunft. Dämpfte anfangs allerdings sein Misstrauen nur wenig und ich wiederholte es noch einmal. Langsam dämmerte es ihm und ich erwähnte noch den Zweck meines Besuches im Dorf. Wollte einfach nur den Weg zu dem Deutschen wissen und jetzt wurde er beinahe schon freundlich als er es kapiert hatte.
„Señor, das sind wirklich gute Leute auf der Hazienda“, stellte er fest und sein Finger deutete hinter mir ins Nirgendwo.
Dann sprach auch er von einer Indiofrau, dass er ab und an dort arbeiten würde, der Deutsche gut bezahlt. Begann dann unbeholfen den Weg zu beschreiben, aus dessen Angaben ich nicht schlau wurde.
Meine Verwirrung bemerkend, zeichnete er mit dem Finger im Staub vor der Tür eine Skizze. Demnach war es noch gut eine Meile bis zu dem Haus, aber dieses wäre aufgrund seiner enormen Größe nicht zu verfehlen. Wäre ich einmal am Friedhof des Dorfes, seien es höchstens noch zwei Minuten. Vorausgesetzt, man hält sich an die Himmelsrichtung, denn der Weg würde sich auf ungefähr der Hälfte der Strecke, gleich nach dem Friedhof, gabeln. Nach Westen ginge es zur Farm, nach Osten käme man wohl wieder in Richtung der 32 A. Freundlich bedankte ich mich, bat noch um eine Schale Wasser, welche ich umgehend erhielt. Weitere Fragen zu dem Deutschen konnte oder wollte er nicht beantworten. Weg wusste ich schon einmal, fuhr nach einem Gruß einfach los.
Der beschriebene Weg war besser als die Schotterstraße von vorhin, wechselte dann mehr und mehr in eine festgefahrene sandige Lehmpiste über und es ging zügig vorwärts. Sofern die Beschreibung des Dorfbewohners stimmt und ich alles richtig verstanden hatte, würde ich vom Dorf bis zur Hazienda des Deutschen kaum länger zehn Minuten bis zum Ziel benötigen. Peruanischen Angaben von Zeiten und Entfernungen sollte man keinesfalls Glauben schenken, denn diese weichen von der Realität erheblich ab.
Nicht selten ist es auch der Fall, dass man irgendwas sagt, um nicht unhöflich oder gar, was viel schlimmer für den Gefragten wäre, unwissend zu erscheinen. Vor einigen Jahren in Mexiko bin ich genau dieser „Besonderheit“ einige Male aufgesessen, stundenlang im Kreis gefahren oder eben immer am Ziel vorbei.