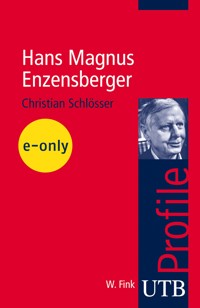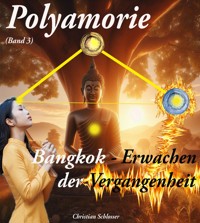5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei einer nächtlichen routinemäßigen Polizeikontrolle im Zentrum der Stadt, entdeckten zwei Streifenbeamte eine männliche Leiche, welche direkt am Eingang des Zwickauer Doms saß. Mehr schlecht als recht verdeckt durch ein Werbeschild. Dem ersten äußeren Anschein nach wurde der Mann offenbar erschossen. Weder gab es Zeugen, noch trug der Tote Papiere bei sich. Routinemäßig übernimmt Kommissar Tritschler die Ermittlungen und bereits nach wenigen Tagen zeigte sich, dass der erste Eindruck der Todesursache trog, denn der Unbekannte wurde nicht erschossen! Erst die Ergebnisse der Pathologie offenbaren die Identität des Toten. Klarheit wurde jedoch keinesfalls geschaffen, denn der Fall beginnt jetzt erst richtig verworren zu werden. Erste Spuren führen nach Duisburg, in die Niederlande, Belgien, Bulgarien und bis nach Kolumbien. Sandra Eismann, eine Zwickauer Pathologin, halb Deutsche, halb Kolumbianerin und spätere Ehefrau des Ermittlers Tritschler, entpuppt sich als Schlüssel in dem Fall, weiß mehr, als sie anfänglich zugibt. Schnell kristallisiert sich heraus, dass der Tote in Geschäfte mit Drogen, Waffen, Mord, Landraub und Mädchenhandel mit der indigenen Bevölkerung verstrickt war. Im Zuge einer humanitären Aktion kamen die Eltern von Sara vor Jahrzehnten in Kolumbien um und die Pathologin hat, neben ihrer Liebe zu ihrem Ehemann, nur noch einen Gedanken – Rache!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Tod einer Familie
Rückkehr ins Leben
Der Tote am Dom (Freitag, 1. Dezember, 22.48 Uhr)
Rückblicke um Mitternacht
Wochenenddienst (Samstag und Sonntag)
Pathologie (Montag, 4. Dezember, 9.15 Uhr)
Konfrontation (10.40 Uhr)
Aufschlussreiche Begegnung (16 Uhr)
Ein ungewöhnlicher Abend (18 Uhr)
Breuerstraße (Dienstag, 5. Dezember, 9.35 Uhr)
Nächster Schritt in die Zukunft (19 Uhr)
Fortgang der Ermittlungen (Dienstag, 12. Dezember, 9 Uhr)
Neue Erkenntnisse (10 bis 17 Uhr)
Unterbrechung am Abend (21.03 Uhr)
Fundort Leiche Gerd Fröhlich (21.30 Uhr)
Puzzelspiele und ein weiterer Tatort (Mittwoch, 13. Dezember)
Rätsel und weitere Informationen (19 Uhr)
Vorläufige Ergebnisse (Donnerstag, 14. Dezember)
Instruktionen und Informationen (Freitag, 15. Dezember, 9 Uhr)
Zwischenspiel
Erfolgloser Zugriff (Montag, 18. Dezember, 5 Uhr)
Obduktion Gomez und Ruiz (Mittwoch, 20. Dezember)
Verwerfungen und Erkenntnisse (Freitag, 22. Dezember
Informationen aus Köln (Mittwoch, 27. Dezember)
Wohnungsauflösung mit Überraschungen (15 Uhr)
Meerane (Donnerstag, 28. Dezember)
Obduktion Ahmed (Freitag, 29. Dezember)
Zwischenspiele in Ost und West (Samstag, 30.12.)
Neujahrsbesuch (Montag, 1. Januar 2018, 14 Uhr)
Bindung (Mittwoch, 3. Januar 2018)
Krankenbesuch (Montag, 8. Januar 2018)
Kolumbien (6. bis 20. Februar 2018)
Zwischenspiele in Zwickau
Dienstbeginn (Montag, 26. Februar 2018)
Veränderungen (Dienstag, 27. Februar)
Wieder vereint (Mittwoch, 28. Februar 2018)
Impressum
Vorwort
Dieser ungewöhnlich umfangreiche Kriminalroman beginnt nicht, wie üblich, mit einem Mord in einer deutschen Stadt, ersatzweise könnte es natürlich jede beliebige andere Stadt auf der Welt sein, wo sich dann ein Kommissar zusammen mit seinen Kollegen über dessen Aufklärung stürzt. Diesen, völlig realitätsfremd, möglichst über Nacht, oder binnen eines Tages, aufklärt. Hier liegt der Fall gänzlich anders.
Jedes Verbrechen, jeder Mord, hat eine Ursache, hat Hintergründe und genau damit, beginnt dieser Kriminalroman. Abweichend vom sonst gewohnten Schema nicht in einer deutschen Stadt, nicht in einer beliebigen Stadt auf dieser Welt, sondern in den fernen Dschungelgebieten von Kolumbien. Fernab dessen, was wir Deutschen gern als Zivilisation bezeichnen.
Die Ursache für den im Buch beschriebenen ersten Mord auf deutschem Territorium, findet sich in Südamerika, zieht in Deutschland weitere Morde nach sich. Was nur nicht sofort erkenntlich wird. Die Spur des in Deutschland gesuchten Mörders reicht von Südamerika, über das Ruhrgebiet nach Sachsen, die Niederlande und Bulgarien.
Keinesfalls oberflächlich, Charaktere genauestens beleuchtend, Hintergründe, und menschliche Verbindungen erklärend, verknüpft sich hier Fiktion mit tatsächlichen Geschehnissen. Möglicherweise lohnt sich dieser von „Schema F“ abweichende Kriminalroman für den interessierten Leser.
Tod einer Familie
Unbarmherzig peitschten Zweige dem Mann schmerzhaft ins Gesicht, hinterließen rote Striemen. Bedornte Äste rissen blutige Wunden in dessen Oberkörper, Blätter klatschten darauf, wischten das Blut breit und das verunstaltete ihn, ließ ihn aussehen, wie eines der blutverschmierten und für den Normalsterblichen abartig grausamen „Kunstwerke“ von Hermann Nitsch. Hastig eine spärlich bekleidete Frau mit nackten Brüsten und ihrem kleinen Kind, sicher kaum älter als ein Jahr, entweder vor sich herschiebend oder hinter sich her zerrend, bahnte er sich seinen Weg durch den dichten Dschungel. Rauch lag in der Luft. Rauch von in Brand gesetzten Hütten, rund zwanzig an der Zahl. Meterhoch loderten Flammen in den Himmel, versengten das sie umgebende scheinbar ewige Grün. Strebten nach oben zu der gleißend hell scheinenden Sonne, taten gerade so, als wollten sie mit ihrer lächerlichen Hitze, dem lebenspendenden Stern mit seinen unglaublich hohen Temperaturen, Konkurrenz bieten. Stimmen und Schreie in mindestens drei verschiedenen Sprachen waren zu hören. Unterbrochen und überlagert von kurzen Feuerstößen aus automatischen Waffen, Pistolenschüssen und dem drohenden Zischen von Pfeilen.
Geworfene Speere erzeugten mehr ein fauchendes Geräusch in der Luft. Schaden anrichtet, einen der Angreifer verletzt oder gar getötet, hat von ihnen keiner. Um vernichtend zu treffen, müsste viel man näher an den Feind heran, doch dazwischen hatte es einen unüberwindbaren regelrechten Vorhang aus Kugeln, welche alles was ihnen im Weg stand zerfetzten, es gnadenlos töteten. Explosionen waren zu hören, geringfügig gedämpft durch das Blätterwerk, doch immer noch ohrenbetäubend laut und diese stammten allesamt von Handgranaten. Immer wieder stolperte die Frau, schützte im Fallen ihr Kind, wurde von dem Mann, bevor sie auf dem Boden aufschlagen konnte, wieder nach oben gerissen, vorwärts gezogen, weg von dem Inferno, aus welchen es schon theoretisch kaum kein Entkommen geben dürfte. Zweimal stolperte und fiel das Paar über tote Männer in Tarnkleidung, welche im Gesicht ganz anders aussahen als die Indios. Braungebrannt, ähnlich in der Hautfarbe wie die Indios, doch eben sichtlich keine von ihnen, denn es waren Weiße. Pfeile steckten in den leblosen Körpern.
Schüsse aus einer automatischen Waffe peitschten ganz in der Nähe. Ließen sie getroffen zusammenzucken, an der Hand des Mannes kurzzeitig erst niederknien. Blut tropfte aus drei kleinen Löchern ihrer Brust. Blut tropfte, zusammen mit einer wässrigen Flüssigkeit, aus drei weiteren Schussverletzungen des Unterleibs, welcher mit seiner Wölbung jedem Betrachter deutlich anzeigte, bereits seit sechs oder sieben Monaten wieder neues Leben in sich zu tragen. Nicht verstehend und fragend schaute die Frau den Mann an, kein Anzeichen von Schmerz zeigend, mehr war es Verwunderung und dann erlosch, während sie zu Boden sank, ihr Blick, welcher wohl noch vor dem Aufprall auf den Boden eine andere Realität oder das, was Buddhisten als Nichts bezeichnen, sah. Möglicherweise auch einen vom Menschen geschaffenen oder tatsächlichen Gott oder den großen Geist des Dschungels. Entsetzt stehenbleibend sah der Mann hilflos ihrem Fall zu, sah, wie weitere Kugeln auch das von der Frau auf dem Rücken getragene Kind trafen, blutige Löcher in es rissen, es augenscheinlich sofort töteten. Dann traf es ihn. Mehrfach. Wie oft, konnte er in diesem Augenblick nicht sagen. Heftige Schmerzen durchfluteten ihn, am Oberschenkel, am rechten Arm, am Kopf. Überall. Unerträgliche Schmerzen raubten ihm für lange Momente den Atem. Beschädigte und irritierte Nerven verhinderten jegliche Gegenwehr, ließen ihn hilflos wie ein Kind knien, zusammensacken, auf den Rücken fallen.
Dunkler und dunkler wurde die Welt um ihn herum, ein flimmerndes gelbliches Licht erschien vor seinen Augen, umhüllte ihn wie eine Aura, erweckte den Anschein, ihn in eine andere Sphäre des Seins bringen zu wollen. Doch es geschah nicht. Jedenfalls noch nicht. Oder doch schon? Welche Farbe hat eigentlich der Tod, fragte er sich für den Bruchteil einer Sekunde. War dies überhaupt der Tod, oder nur das Ende eines bis vor wenigen Minuten noch harmonischen Lebens fernab jedweder westlichen Kultur? Stöhnend vor Schmerzen, hilflos und seiner Kräfte beraubt, lag er neben der Frau und dem Kind am Boden. Fand keine Antwort mehr auf diese Frage. Dunkelheit hüllte ihn ein. wie ein undurchdringlicher Nebel. Sein Bewusstsein schwebte Richtung grünes Blattwerk, durchdrang es Richtung blauer Himmel. Schwebte in Richtung des Nichts, strebte zur tiefschwarzen Nacht, löste immerhin den unerträglichen Schmerz im Hier und Jetzt allmählich ab, ließen ihn und das Jetzt stufenweise verblassen.
Ähnlich wie die Endsequenz alter Filme, wo stufenweise, jedoch gleitend genug, das menschliche Auge geschickt täuschend, abgeblendet wurde, bevor das Worte „Ende“ über die Leinwand flimmerte. Rechnet man das Ungeborene mit hinzu, sanken vier von Kugeln sinnlos ausgelöschte Leben auf die dünne Schichte Terra Preta des Dschungels. Bereit, freiwillig oder nicht, nach dem Tod Teil von ihr zu werden. Asche und verkohltes Holz der Hütten als Grundbausteine für diese rätselhafte und unglaublich fruchtbare Erde hatte es in der Umgebung heute zur Genüge. Vier Leben erloschen? Stimmt die Zahl? Oder zeigten sich die Götter des Dschungels gnädig, gaukelten dem unbedarften Beobachter sie nur vor? Ein Bewusstsein von vier wollte sich nicht damit abfinden, kämpfte und verlor dann doch den Kampf. Finsternis umfing den Mann und bevor diese sein Bewusstsein und damit die unerträglichen Schmerzen auslöschte, umfasste er die bereits leblose und noch warme Hand seiner Gefährtin. Vereinte sich ein letztes Mal mit ihr. Finsternis umhüllte ihn. Stille umfing ihn, ließ den Lärm des Todes verstummen. Aus. Ende. Ende?
Mühsam öffnete der Mann die Augen, stritt wortlos mit der Dunkelheit, kämpfte hartnäckig gegen sie an, welche dann den geradezu unmenschlichen Anstrengungen des Mannes wich, unwillig die Welt wieder in sein Bewusstsein projizierte. Über ihm befand sich grünes Blätterdach. Unweit daneben, nur Zentimeter außerhalb der Griffweite seiner Arme, brannte ein nur schwach rauchendes Feuer. Gedämpfte Stimmen waren zu hören. Stimmen in einer Sprache, welche er sich erst vor wenigen Jahren angeeignet hat, nicht seine Muttersprache war. Eine Frau neben ihm wurde auf sein Erwachen aufmerksam, reichte hastig Wasser aus einem zusammengefalteten Blatt zu ihm. Trüb und lehmig sah die lebensspendende Flüssigkeit aus, was ihn mit seinen ausgetrockneten Lippen und dem Mund, welcher sich in seinem Inneren anfühlte wie eine Wüste, nicht interessierte. Dankbar nahm er Tropfen für Tropfen in sich auf. Stille herrschte in dem Lager. Richtige Stille war es natürlich nicht, denn die Stimmen des Waldes waren allgegenwärtig. Allerlei Tiere sorgten für die entsprechende Geräuschkulisse und jedes davon, hätte er namentlich mit den Worten der Einheimischen benennen können.
Verschwunden, im Vergleich zu seinen letzten Erinnerungen, war lediglich das bedrohliche Zischen der Pfeile, verschwunden auch das bösartige Fauchen der Speere, verstummt die Todesschreie und Schmerzenslaute, die gebrüllten Kommandos auf Spanisch und Englisch. Verstummt, die Schüsse auf Wehrlose. Schüsse brachten dem Dorf den Tod, denn man verfügte dort über keine Schusswaffen des weißen Mannes, um adäquat antworten zu können. Zischend und fauchend die Luft zerteilende Pfeile im Umkreis des Dorfes brachten hingegen Nahrung für alle. Selten brachten diese auch den Tod für andere Menschen, nämlich dann, wenn man sich gegen angreifende Nachbarstämme erwehren musste, welche ihr Gebiet erweitern wollten, oder einfach nur Frauen raubten. Hatte er in seiner bisher etwas mehr als drei Jahre dauernden Zeit im Dorf glücklicherweise nur einmal erlebt, sich, ohne darüber nachzudenken, am Kampf ums Überleben des Stammes beteiligt. Vehement und unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel seine damals mit dem ersten Kind schwangere Gefährtin beschützt. Getötet hat er, ja – aus Notwehr und zur Selbstverteidigung. Zwei, konnten auch drei oder vier Angreifer gewesen sein. Wusste er nicht mehr, denn die Zeit hat die genaue Zahl der von ihm Getöteten in ihm ausgelöscht, der Dschungel mit seiner Tier– und Insektenwelt, sich deren sterblichen Überreste zur Umwandlung zu neuen Lebensbausteinen einverleibt. Gemeinsam als Familie überleben war für ihn wichtiger als eine Zahl, als ein mehr oder weniger getöteter Angreifer.
Rasende Kopfschmerzen, Schmerzen im Arm und im Oberschenkel überrollten den Mann wie eine Welle, raubten ihm lange Sekunden den Verstand, doch zum Schreien fehlte ihm die Kraft. Begleitet von heftigen Fieberschüben, fiel der Mann in tiefen Schlaf. Schlaf, der kleine Bruder des Todes. Wochen später, der Stamm hatte mehrfach seinen Standort gewechselt, konnte der Mann wieder laufen. Behutsam, vorsichtig, denn eine Kugel der Mörder steckte noch in seinem Oberschenkel. Bremste seine Beweglichkeit mit unglaublich stechenden Schmerzen. Hingegen entpuppten sich seine Kopfschmerzen, resultierend von zwei Streifschüssen am Kopf, als nicht gefährlich. Sagte zumindest der Medizinmann, welcher das Massaker unbeschadet überstanden hat, seine Frau und vier Kinder dabei verlor. Dem Stamm waren mit seiner Naturmedizin enge Grenzen hinsichtlich der medizinischen Behandlung gesetzt.
Pfeile konnte man herausziehen, Schnittwunden mit Dornen zusammenfügen, Entzündungen ausbrennen, pressen, mit Kräuterauflagen behandeln, mit Blättern und weichgeklopften oder ausgekauten Lianen „verbinden.“ Tief sitzende Kugeln blieben dort, wo sie waren, sorgten bei den Verletzten in der Regel für ein schmerzhaftes und langsames Sterben. Mit viel Glück kapselten sich derartige Projektile ein; verursachten dann „nur“ gesundheitliche Probleme und lebenslanges Siechtum. Steckschüsse zu behandeln, oder gar notwendige Operationen durchzuführen, lag weit außerhalb der Macht des Medizinmannes.
Betrachtete man sich den verletzten Mann genauer, fiel schnell auf, dass dieser ebenfalls ein Weißer war, nur hatte dieser sein Leben in der Zivilisation schon seit langer Zeit weit hinter sich gelassen. Beschlossen, eine Indigene zur Frau zu nehmen und sein Leben mit ihr fernab seiner Heimat zu verbringen, war das bis an diesem verhängnisvollen Tag auch kein Problem gewesen. Man wich den weißen Teufeln, wie die Eindringlinge genannt wurden, aus. Wusste genau um deren Waffentechnische Überlegenheit. Zumeist handelte es sich um Goldsucher, seltener um Holzdiebe, noch seltener raubten man Land, um dort Plantage für die geradezu unersättlichen weißen Heuschrecken zu errichten. Geschickt verhielt man sich unauffällig, verwischte Spuren. Trotzdem wurden sie entdeckt, unbemerkt eingekreist. Erstaunlich bei den vielen aufgestellten Wachen, welche der unter ihnen lebende weiße Mann vorsorglich veranlasst hatte, denn er kannte sich aus mit seinen Artgenossen, kannte ihre raffinierten und brutalen Methoden und deren Technik.
Die Angreifer und Eindringlinge hatten den Überfall perfekt geplant, wahrscheinlich über längere Zeit alles mit Drohnen aus der Luft ausspioniert und es gab nur wenige Möglichkeiten zur Flucht für die Dorfbevölkerung. Lanzen, Messer, Pfeile, neben selbst hergestellten Wurfbeilen aus Stein und eingetauschten kleinen Äxten aus Eisen von einem Nachbarstamm – mehr hatten der Stamm, neben seinem Mut, nicht zu seiner Verteidigung aufzuweisen. Nicht genug, wie es sich, leider zu spät, zeigte, um dem Tod und der Vernichtung auszuweichen. Mehr als die Hälfte der Dorfbewohner verlor bei dem Überfall ihr Leben und die Heimat dazu.
Zeit verrann. Wie viel Zeit, wusste keiner. Zeit war eigentlich unwichtig; zumindest fast, denn man konnte sie nicht so messen, wie der ständig hektische weiße Mann. Zeit, vorgegeben von Sonne und Mond, war unter anderem nur insofern von Bedeutung, um zu wissen, wann bestimmte Früchte im Dschungel wuchsen, die Regenzeit oder Trockenzeit kam; es Mittag war. Sonne und Mond wiesen mit ihrem Stand zusätzlich auf die wenigen Festtage des Stammes hin.
Allmählich hielt der Alltag, der Kampf ums tägliche Überleben und die Nahrungssuche, wieder Einzug bei den Überlebenden. Vergessen war nichts, doch es musste weitergehen. Gänzlich anders sah es bei dem verletzten weißen Stammesmitglied aus. Wortkarg, beinahe bösartig geworden war er. Wenn man nur versuchte, ihn tröstend anzusprechen, reagierte er aggressiv und wütend. Eine Zeitlang tolerierte man mehr oder weniger verstehend seine Ausbrüche, doch dann unternahm die Gruppe auf Anraten des Medizinmannes den Versuch, dem Verbitterten eine neue Lebensgefährtin zu vermitteln. Versprach sich davon, ihn wieder ins seelische Gleichgewicht zu bringen, seinen beschädigten Geist und den wahrscheinlich wütenden Geist seiner getöteten Gefährtin und die Geister der Kinder gnädig zu stimmen. Junge Mädchen hatten mehr als die heroisch kämpfenden Männer überlebt, doch er lehnte das Angebot nach einer neuen Gefährtin vehement ab. Schrie immer wieder nur einen Namen, welcher die Stammesmitglieder erschrocken zusammenzucken und ängstlich in die Runde blicken ließ. Beschwörungen gegen böse Geister stiegen dann zu den Göttern und Geistern in den Himmel nach oben. Lediglich nach Rache stand dem Verletzten der Sinn nach Rache, war sich aber seiner derzeitigen Ohnmacht bewusst. Nichts war mit modernen Waffen und Ortungssystemen. Hier herrschte fast noch Steinzeit.
Eines Tages, man hatte einen neuen Führer der Gemeinschaft gewählt, denn der bisherige Anführer wurde bereits bei der ersten Angriffswelle, welche die meisten Opfer kostete, getötet, sprach der fremde Mann mit diesem, kündigte sein Fortgehen an und das erstaunte die Gruppe. Über Stunden zog sich ein Palaver der wenigen verbliebenen Ältesten hin, man zeigte sich wohl oder übel einverstanden mit seiner Entscheidung, sorgte sich jedoch um dessen Sicherheit.
Einzig einen Kompass hatte der Weiße aus seiner Welt in die Abgeschiedenheit des Dorfes mitgebracht und mit dessen Hilfe, fand er mit seinen bewaffneten Begleitern nach tagelangem Fußmarsch zu einer Missionsstation, wo er ohne große Nachfragen, allein schon wegen seiner Verletzungen, einfach aufgenommen wurde. Freundete sich schnell mit den zwei Padres an, zeigte sich dabei tief gläubig und man vertraute ihm bereits nach wenigen Wochen. Obwohl perfekt und akzentfrei die Sprache beherrschend, sprach der Unbekannte kaum ein Wort, zeigte sich verbittert und oft verzweifelt. Sprach in den Nächten im Traum häufig von einer imaginären Ia–ti–na–a, konnte aber nicht erklären, wer das sein sollte; wich allen Fragen aus, schlug sich bei dem Namen mit den Fäusten den Kopf, ohne dass die vollständige Erinnerung in ihm auftauchte. Vielleicht wollte er den Namen auch absichtlich durch die Schläge nicht mehr in sein Bewusstsein lassen, um den Schmerz der Erinnerung nicht auch noch ertragen zu müssen?
Nach außen hin, was man auf die Kopfverletzungen und den Schock schob, gab er sich verbittert gegenüber dem weißen Mann, akzeptierte nur die Patres als deren anständige Vertreter. Sprach man mit ihm über etwas anderes als Gott, zeigte er deutliche Anzeichen eine Amnesie. Sprach viel mit sich selbst, flehte zum Allmächtigen um Hilfe. Sein Spanisch war perfekt, nur klang da ab und an, wenn man genauer und länger hinhörte, ein fremder Akzent durch, der keinem Land zugeordnet werden konnte. Ebenso gut könnte man den anderen Klang dem Dialekt eines abgeschiedenen Dorfes zuordnen. Man machte sich keine Gedanken weiter darum, die Belange der Station hatten Vorrang. Er war einfach ein Fremder, welcher Hilfe bedurfte, obendrein, neben Spanisch, noch einige regionale Indiosprachen beherrschte und diese ohne jeglichen Akzent. Allein diese Eigenschaft machte ihn wertvoll als Dolmetscher, wenn neue Fremde, allesamt Indigene, eintrafen und davon wurden im Laufe der Monate immer mehr. Fremde überfielen ein Dorf nach dem anderen im weiten Umkreis, brannten nieder, was Menschen als Heimstatt diente, massakrierte die Bevölkerung, entführte junge Mädchen. Raubten Land. Immer an dieser Aktionen beteiligt war ein geheimnisvoller „weißer Vogel“, groß wie zwei Hütten, welcher mit brüllender Stimme aus den Wolken kam und allen Indios den Tod brachte, Bäume absterben, das scheinbar undurchdringliche Grün verwüstete, es schwarz werden ließ. Ähnlich wie den Pflanzen und Tieren erging es den Menschen.
Kam man, gleich ob jung oder alt, Mann oder Frau, mit den „Tränen“ des „weißen Vogels“ in Berührung, entwickelten die Betroffenen fürchterliche Blasen am ganzen Körper, erbrachen Blut, starben nur wenige Tage danach. Keiner überlebte es. Weder der Medizinmann noch dessen Medizin, auch nicht Beschwörungstänze gegen die bösen Geister des Dschungels – nichts half, keiner wusste, woraus die „Tränen“ bestanden.
Etwas mehr als 10 Monate waren vergangen, alle Verletzungen des Neuankömmlings waren auskuriert, der Mann nannte sich auf Vorschlag der Patres nun Don Diego de Jardín. Eigenen Angaben zufolge konnte er nicht mehr an seinen richtigen Namen erinnern, was keiner der beiden Padres so richtig glaubte, es milde lächelnd ignorierte. Handicap blieb eine mittlere Gehbehinderung durch einen Steckschuss. Über die Vermittlung seiner Helfer kam er nach Bogotá, wurde in einem Krankenhaus behandelt, wo man die Kugel im Oberschenkel entfernte und die Rechnung bezahlten die beiden Geistlichen mit Gold. Mühselig und über Wochen, aus Flüssen im Dschungel gewaschen. Schneller als von den Ärzten gedacht, stellte sich bei Don Diego de Jardín die alte Beweglichkeit wieder ein. Mit dem Tag, als die Kugel aus ihm entfernt wurde, begann für ihn ein neues Leben. Was blieb, war die nach außen hin gezeigte Amnesie und nur er allein wusste, dass diese zu keiner Sekunde bestanden hatte, er ein Spiel spielte.
Sein Gedächtnis war komplett wiedergekehrt, keine Sekunde vergessen. Ohne dass es sein Umfeld auch nur im Ansatz ahnte, begann für ihn ein neues Leben und dieses war geprägt von unglaublich brutalen Rachegedanken, welche ihn des Nachts mit ihrer blutrünstigen Grausamkeit aus dem Schlaf rissen. Don Diego de Jardín entwickelte über unzählige Nächte hinweg einen Plan, wollte diesen bis zur letzten Konsequenz in die Tat umzusetzen. Sein eigenes Leben spielte bei der Umsetzung des Vorhabens keine Rolle, denn er hatte den Rest seiner irdischen Tage diesem Gedanken verschrieben.
Rückkehr ins Leben
Während die Patres nach wenigen Tagen erneut im Dschungel zu ihrer Missionsstation verschwanden, suchte er Arbeit in der Stadt und es fiel ihm relativ leicht, die Gruppe der Gesetzlosen auszumachen, welche sein Dorf niedergebrannt, dessen Bewohner, seine Frau und Kinder getötet hatten. Zwei Kinder hatte er mit Ia–ti–na–a, denn er rechnete das Ungeborene mit hinzu. Wortkarg und hartnäckig zugleich drang er zum Chef der Gruppe vor, prügelte sich praktisch einen Weg durch dessen Leibwächter, tötete einen davon und das beeindruckte. Schaffte es, bei diesem in Lohn und Brot zu kommen. Verantwortlich für Sicherheitstechnik und die Wartung von Computern, machte er sich bei den Verbrechern schnell einen Namen, kassierte guten Lohn und freundete sich über Monate hinweg allmählich sogar mit dem Chef der Gruppe an. Scheinbar zumindest. Nachdem er einige „Spezialaufträge“ abgewickelt hatte, wohl bemerkend, dass diese als Test gedacht waren, sie, hätte er versagt, sein Leben gekostet hätten, stieg er in der Leiter in der Hierarchie weiter nach oben, gewann noch mehr Vertrauen, bekam mehr Freiraum. Genau dieser Freiraum war enorm wichtig für seine weiteren Pläne. Zwei lange Jahre vergingen, in deren Verlauf er nach außen hin unübersehbar fester Bestandteil der kriminellen Organisation wurde, die Polizei gleichzeitig wegen seiner an den Tag gelegten Raffinesse auf ihn aufmerksam wurde, ihm aber weder etwas nachweisen, noch verhaften konnte. Statistisch gesehen sind 40 % aller Kolumbianer Weiße und er gehörte dazu, konnte nicht ausgewiesen werden.
Eines Abends streifte er wieder einmal scheinbar ziellos durch die Hauptstadt, verschwand immer wieder in dunklen Seitenstraßen. Tauchte aus diesen in immer neuen Verkleidungen wieder auf und als er sich nach fast drei Stunden sicher war, nicht mehr verfolgt zu werden, betrat er eine Gaststätte. Gaststätte war zu viel gesagt, selbst die abschätzige Bezeichnung „üble Spelunke“, würde das Haus über alle Maßen adeln. Still mit Bier in einer Ecke sitzend beobachtete er den Besucherverkehr, welcher aus Weißen, Mestizen und Indios annähernd gleichermaßen bestand, trank. Brabbelte mit sich selbst, wirkte zunehmend angetrunkener und wirr, torkelte dann irgendwann einmal nach vorn zum schmuddeligen Tresen. Verlangte nach einem Telefon. Handy, so gab er lallend zu verstehen, habe er im Suff wohl verloren.
Geklaut könnte es auch sein. Wüsste er nicht so genau. Grinsend sah man ihn an, schob ihn in einen winzigen Nebenraum, dessen Mobiliar aus einem Stuhl, einem wacklig aussehenden Tisch und einem rostigen Spind bestand. Auf dem Tisch stand ein Telefon aus längst vergangener Zeit. Nicht die modernen Dinger mit Tipptasten, sondern eines mit herkömmlicher Wählscheibe. Kaum saß er an diesem, wurde sein Blick wach, schloss er die Zimmertüre. Fummelte hastig ein kleines Gerät aus der Jackentasche, nur wenig größer als ein Zigarettenetui, steckte das Telefon aus und verband die Schachtel mit einem kurzen Kabel mit der Telefonsteckdose. Setzte sich mit dem Rücken zur Tür und stelle einen Taschenspiegel vor sich hin. Hatte damit die Tür ständig vor Augen. Wählte, ständig in den Spiegel blicken und nach draußen lauschend, eine Nummer. Wenig später meldete sich der Teilnehmer.
„Hallo?“, fragte seltsam quäkend am anderen Ende der Leitung eine männliche Stimme.
„Ernesto und das bitte schnell“, verlangte der Mann und seine Stimme klang nun alles andere als betrunken.
„Wer ist am Apparat?“, wollte die Gegenseite misstrauisch wissen.
„Der Freund seiner Schwester“, antwortete er, „sage es deinem Chef.“
„Moment, Señior“, klackend landete der Hörer auf einem Möbelstück, die Stimme rief laut nach dem Verlangten und wenig später waren Schritte zu hören.
„Ja, bitte? Sag nur, du lebst noch?“, wurde von einer heiser klingenden Stimme gefragt.
„Hör genau zu. In genau 24 Stunden brauche ich meinen Pass“, erklärte Don Diego de Jardín, ohne dabei auf die Frage einzugehen.
„Ist das klar? Keine Verzögerung! Buche auf übermorgen Abend einen Flug nach New York auf meinen Namen“, die Stimme hatte an Schärfe zugenommen. „Packe 5000 Euro in gebrauchten Scheinen dazu. Isabella soll mir das Ticket am Airport geben. Sage ihr, sie soll sich die rote Jacke anziehen, sie weiß schon welche. So finde ich sie schneller.“
„Richte ich ihr aus. Mit dem Geld, das geht natürlich klar. Wann bekomme ich mehr Informationen?“, die Stimme war ungeduldig geworden, klang aber ein wenig besorgt.
„Später, die Zeit ist um“, Don Diego legte auf, entfernte das Gerät, holte tief Luft und torkelte, plötzlich wieder vollkommen betrunken wirkend, nach draußen.
Zahlte die Rechnung und das Telefongespräch, griff sich noch eine Flasche billigen Fusel und verschwand wankend in der Dunkelheit, aus welcher gekommen war. Verschwand wieder in dunklen Gassen, tauchte an mehreren Stellen des verwinkelten Viertels erneut in verschiedenen Verkleidungen wieder auf. Wiederholte praktisch das gleiche Spiel, wie auf dem Hinweg zu der Spelunke.
Tags darauf rief ihn der Chef zu sich. Kurz zuckte der Gerufene zusammen, Angst schoss in ihm hoch, beruhigte sich sofort, war sich sicher, nicht beobachtet worden zu sein.
„Hast du alles vorbereitet?“, befehlend und rau klang die Stimme des Chefs.
„Sicher“, de Jardín zeigte sich erstaunt, „hast du etwa Zweifel?“
„Kann man dir vertrauen? Kann man überhaupt einem Menschen vertrauen?“ bekam er als Antwort und de Jardín lief ein Kälteschauer den Rücken herunter.
Mehrfach hatte er die Frage schon gehört, sehen müssen, wenn bei der falschen Antwort, der geringsten Spur von Unsicherheit, ein Zögern bei den Befragten, ein Revolver losging, Menschen im Bruchteil einer Sekunde ihr Leben ausgehaucht hatten. Innerlich zitternd, nach außen hin den Starken und von sich Überzeugten spielend, machte er einfach weiter mit seiner Rede.
„Programmierung passt, habe alles mehrfach durchgespielt. Hier, schau her“, Don Diego zeigte auf den Bildschirm, welcher in verschiedene Bilder eingeteilt war. „Hier seht ihr alles aus der Luft. Glaube mir, die braunen Affen merken nichts. Hier sind die Anmarschwege verzeichnet. Haltet euch daran und dem Erfolg des Unternehmens steht nichts mehr im Weg. Dafür verbürge ich mich.“
„Möchte ich auch hoffen“, knurrte sein Chef. „Wenn nicht, du weißt schon …“
„Dein Auftraggeber wird zufrieden sein“, unterbrach ihn Don Diego, fügte absichtlich und deutlich betont das vielsagende Wort „Auftraggeber“ hinzu, spielte damit darauf an, dass auch sein Chef nur eine Nummer in einem noch größeren Spiel war.
„Unser Chef“, fügte der Mann hinzu, wich dem Wort aus, „braucht Frischfleisch. Sind zu viele von den Chicas abgekratzt oder getürmt. Bist du dir sicher, dass wir an der Stelle mit keinerlei weiteren Widerstand zu rechnen haben?“
„Ganz sicher“, Don Diego schien überzeugt von seiner Arbeit zu sein, „ringsum, schau her, im Umkreis von gut 50 Meilen, sind keine weiteren Ansiedlungen zu sehen. Keine einzige Hütte. Freie Fahrt und freies Schussfeld für euch also. Überzeuge dich doch selbst, wenn du mir nicht glaubst!“, es klang ein wenig beleidigt.
Er blendete mit einigen Tasten eine Karte ein und diese zeigte nur eine kleine Ansiedlung in dem beobachteten Bereich. Genau genommen hatte Don Diego untertrieben, denn der als menschenleer ausgewiesene Raum war sogar bedeutend größer als nur 50 Meilen.
„Wenn das braune Gesindel weg ist“, der Chef brannte sich eine Zigarette an, „kommt der erste Trupp und bereitet den Holzeinschlag vor. In wenigen Wochen steht dort kein Baum mehr und unsere Kasse klingelt. Hast dir deinen Anteil dann redlich verdient.“
„Geld braucht man immer“, Don Diego grinste, „habe gerade eine neue Braut am Laufen und die Puppe kostet Geld. Viel Geld, ist es aber auch wert.“
„Bild dabei?“, fragte sein Chef neugierig, grinste anzüglich.
„Klar doch“, sein Mitarbeiter zog seine Brieftasche aus der Gesäßtasche, fummelte dort einige Bilder heraus, wovon er eines über den Tisch zu seinem Chef schob.
„Mit der habe ich heute Abend ein Treffen. Mal schauen“, scherzte de Jardín, „ob sie wirklich so hart ist, wie sie sich gibt. Denke mir, sie spielt nur die eiserne Jungfrau.“
Beide Männer lachten, fordernd hielt der Chef seine Hand zu Don Diego de Jardín hin und der verstand, was er wollte. Sichtlich stolz drückte er ihm die Fotos in die Hand, schien sich über dessen verblüfften Gesichtsausdruck zu freuen.
„Taugt die was im Bett?“, fragte der Betrachter misstrauisch.
„Stelle ich hoffentlich heute Nacht fest“, grinste Don Diego süffisant. „Ewig wird die sich nicht zieren, die Schenkel zusammenkneifen“, diese Bemerkung ließ den Chef einen kontrollierten Lachanfall bekommen, denn wahre Gefühle zeigte er nie.
Nachdem er die Fotos einer länger dauernden eingehenden Musterung unterzogen hatte, die Abgebildete unter Garantie hinsichtlich ihrer Tauglichkeit als Gespielin im Bett abwog, verschwand er. Schien es aus unerfindlichen Gründen eilig zu haben.
Prüfend schaute sich Don Diego um, startete ein weiteres Programm, nahm dort einige Einstellungen vor, prüfte kritisch die Korrekturen. Wenig später verschwand das Programm von der Festplatte, wurde mehrfach überschrieben. Turnusmäßig leitete Don Diego die Datensicherung ein. Ging danach nach Hause und legte sich schlafen. Wie immer mit einer Pistole unter dem Kopfkissen und einer neben dem Bett auf dem Hocker mit drei Beinen.
Pünktlich wie vereinbart, stand Don Diego anderntags am Airport, hielt Ausschau nach einer Frau in roter Jacke und wurde Minuten später fündig. Kaum stand er ihr gegenüber, umarmte er sie, zog sie fest an sich heran und während dieser intimen Geste, wanderte das georderte Geld und der Pass unter sein Hemd.
Man löste sich voneinander, nahm sich an die Hände, lief entspannt und scheinbar in ein anregendes Gespräch vertieft in ein Restaurant des Airports im Erdgeschoss. Dort betrat Don Diego mit seiner Umhängetasche zuerst die Toilette, kam entspannt lächelnd an den Tisch zurück. Kleinigkeiten zum Knabbern wurden bestellt und zwei Kaffee dazu. In einem Umschlag bekam er die Ausdrucke des Tickets über den Tisch geschoben. Jeder unbedarfte Beobachter wäre zweifellos zu dem Schluss gekommen, dass sich hier ein Liebespaar voneinander verabschiedet und den fröhlich wirkenden Gesichtern nach zu urteilen, dürfte die Trennung nur wenige Tage dauern. Während er sie fest umschlungen hielt, schob seine Hand einen kleinen Zettel in ihren Ausschnitt, atmete tief durch. Offenbar verlief alles nach Plan.
„Gehe 12 Uhr ins Internet, warte, bis die Bewegungsmelder ein Signal geben. Kommt dieses, heißt es aufpassen. Genau eine Minute nach dem Signal, startet ein Zähler, welchen du im roten Abfragefenster bestätigst. Ist die Meldung ‚Verbindung aufbauen‘. Hat alles funktioniert, wird das Fenster grün. Verstanden?“
„Glaubst du, ich bin von vorgestern?“, Isabella lachte leise.
„Weiter also. Sofort beginnt ein Count–Down Zähler. Läuft er, sofort das Programm beenden. Festplatte soll Ernesto ausbauen, vernichten. Er weiß genau, wie das geht. Computer umgehend im Müll entsorgen. Weit weg von deinem Wohnort. Verstanden?“
„Sicher“, hauchte sie leise, senkte den Blick scheinbar keusch zu Boden, kuschelte sich wie ein verliebtes Mädchen an ihn heran.
„Du weißt, wie es dann weitergeht?“, fragte er und sie nickte bestätigend. „Nichts darf übrig bleiben. Haben wir schon einmal hinter uns. Erinnerst du dich? Keiner hat, dank unserer perfekten Arbeit, etwas bemerkt. Gleiche Vorgehensweise wie immer und gehabt. Rest ist meine Angelegenheit und das Ergebnis erfahrt ihr aus den Medien“, Don Diego zwinkerte, griff nach seiner Tasche und erhob sich. „Mädchen, ich muss jetzt. Bleibe mir gesund und grüße ganz herzlich Ernesto von mir! Man sieht sich wieder. Irgendwann, kann nur nicht sagen, wann“, fügte er nachdenklich hinzu.
„Triffst du ‚el General‘, sag?“, fragte leise flüsternd die junge Frau, hielt seine Hand fest.
„Unseren Wohltäter und Retter?“, Don Diego schaut sie überrascht an, „keiner kennt ihn außer seiner Familie, wenn er denn überhaupt eine hat!“
„Sicher ist er schon alt und seine Eltern längst tot“, vermutete Isabella, „Brüder und Schwestern? Glaube ich auch nicht. Sicher alle tot, für unsere Sache gestorben. Oder er hatte keine?“, sinnierte sie weiter, „verheiratet ist er bestimmt auch nicht.“
„Unter Garantie nicht, denn wäre er es, ist er erpressbar, wenn die“, er machte eine bedeutungsvolle Pause, ballte die rechte Hand, „seiner Frau habhaft werden.“
„Glaube ich auch, meine, dass er keine Frau hat“, zeigte sich Isabella überzeugt.
„Hier“, Don Diego fummelte einen schmalen Papierstreifen aus dem Hemd, strich diesen sorgsam glatt, „schau, ich habe eine Nachricht von ihm bekommen“, sein Blick wirkte, als halte er eine Reliquie in der Hand und das als Einziger einer unüberschaubar großen Gemeinde von Gläubigen.
„Lass sehen, was sagt er da?“, Isabella wurde neugierig und in ihren Augen zeigte sich ein geradezu fanatischer Glanz.
„Mein lieber Sohn“, las Don Diego vor, schien Schwierigkeiten beim Lesen zu haben, sortierte Buchstaben, formte diese zu Worten, „Vater hat deine Medizin bekommen und ist auf dem Weg zur Besserung. Kommt morgen aus dem Krankenhaus. Tante Marta feiert ihren 80. Geburtstag und du musst unbedingt kommen.“
„Klingt nach nichts Besonderen, einfach eine Mitteilung der Familie“, zeigte sich die junge Frau sichtlich enttäuscht, „erkläre es mir. Ist verschlüsselt, wie immer, oder?“
„Krankenhaus bedeutet, dass morgen die nächste Truppe angreifen wird, er sie aber mit unserer Hilfe beseitigt, alle Feinde getötet werden. Und der 80. Geburtstag besagt, dass ich nach meiner Ankunft um 20 Uhr von einer alten Frau abgeholt, von ihr dann zu ihm gebracht werde. Wohin, weiß ich jedoch nicht.“
„Wahnsinn!“, jubelte Isabella unterdrückt kurz auf, schlug sich verlegen die Hand vor den Mund. „Du triffst tatsächlich ‚el General‘, unser aller Retter? Glaube ich fast nicht! Mein lieber Freund, du musst mir alles erzählen nach deiner Rückkehr. Jedes Wort, was er gesagt hat, sonst erwürge ich dich! Gift wäre aber besser …“, sie leckte sich die Lippen, grinste teuflisch und das machte sie noch anziehender, als ohnehin schon.
„Mache ich schon“, Don Diego schien zu überlegen, „ob unser ‚el General‘ groß ist? Habe keinerlei Vorstellung von ihm, kann ihn mir überhaupt nicht vorstellen. Ihr kennt ja auch nur seine Stimme und die klingt hart und gütig zugleich.“
„Wann bist du drüben?“, Isabella ignorierte die Frage, musterte ihn nachdenklich und es war ihr anzusehen, dass sie wohl mehr für ihn empfand, als er bereit war, ihr zu geben.
„Dauert ein wenig. Ich melde mich schon“, abermals umarmte er sie, küsste sie auf die Stirn und lief zielstrebig Richtung Check–In, verschwand aus ihrem Blickfeld.
Vierzig Minuten später startete der Flug nach New York, brachte Don Diego in die USA. Was Isabella nicht wusste und niemals erfahren würde, allein schon aus Gründen der Sicherheit für sie. New York war nur eine Station seiner Reise, welche sich über zwei Wochen über insgesamt 14 Städte hinziehen würde. Eigentliches Ziel der Reise von Don Diegos Reise lautete Frankfurt am Main, was nur er allein wusste.
Während Don Diego de Jardín von New York aus bereits die zweite Station seiner Reise ansteuerte, schaltete Isabella in Bogotá ihren Computer ein, startete ein Programm und wartete ungeduldig. Fast eine Stunde später erschienen die Abfrage und wenig später dann der Zähler auf dem Bildschirm. „Enter“ wurde gedrückt. Auftrag erledigt. Hastig fuhr die junge Frau den Computer herunter, rief nach Ernesto. Dreißig Minuten später war alles, exakt so wie von Don Diego gefordert, erledigt, der Computer zerlegt und im Schrott. Vor dem Haus fuhr ein Lieferwagen vor. Sah aus wie einer von den Unzähligen, welche normal Pizzas zu Kunden brachten. Nur war es keiner von diesen, denn die Werbung für Pizza fehlte. Waren, nur wenig größer als Schuhkartons, wurden von Ernesto und Isabella in Empfang genommen. Konnten Geschenke oder auch Speisen sein, und die beiden gingen mit drei kleinen Kartons ins Haus zurück.
Genaueres konnten Zeugen später nicht mehr aussagen. Übereinstimmend war man lediglich in dem Punkt, dass es sich nicht um einen Pizzaservice gehandelt hat. Laut und hektisch wie immer verlief das Leben in der Straße weiter wie jeden Tag. Nichts deutete auf eine Katastrophe hin. Zwei Stunden später bekam die Feuerwehr eine Meldung. Brand und drei mittlere Explosionen in der Carrera 12F hieß es. Zu retten war nichts mehr, das Haus war bereits bei Eintreffen der Feuerwehr bis auf die Grundmauern zerstört. Tags darauf fand man bei den Aufräumarbeiten zwei bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leichen im Kellerbereich. Identifizierung absolut unmöglich, denn durch die Hitze des Brandes, war eine fast perfekte Kremierung erfolgt. Behördlich ging man davon aus, dass es sich um die Bewohner des Hauses gehandelt haben musste, machte nicht viel weiteres Aufsehen darum.
Warum unnötige Arbeit, wenn in dem Haus ohnehin nur zwei als mehr oder weniger skurril angesehene Personen, Onkel und Nichte, wie die Nachbarn erzählten, gewohnt haben? Schwamm drüber, das Leben geht weiter. Bogota hat andere Probleme. Wie in den Medien heutzutage üblich, wiegt ein Menschenleben bestenfalls 30 Sekunden Filmbeitrag. Wird danach sofort überblendet von aggressiver Werbung, Nichtigkeiten, Klatsch und Tratsch, versinkt im kollektiven Gedächtnis auf der untersten Stufe, verschwindet und verstaubt wenig später als dünne Akte bei der Polizei. Isabella und Ernesto hatten keine den Behörden bekannten noch lebenden Verwandten und wurden deshalb anonym auf Staatskosten in Bogota auf dem Cementerio El Apogeo beigesetzt.
Zum Zeitpunkt des Fundes der Leichen befand sich Don Diego de Jardín sichtlich gut gelaunt mit einem Inlandflug Richtung Wilkes-Barre/Scranton International Airport. Allerdings nannte er sich jetzt laut Pass William Eric Winter und war amerikanischer Staatsbürger.
Eine lange Zeit verging. Lange auf der Erde, wo deren Bewohner diese am Umlauf um ihre Sonne festmachten. Unbedeutend, vermutlich nicht einmal messbar, im Zeitlauf des Universums, welches nach Meinung einiger Wissenschaftler 13,8 Milliarden Jahre auf dem Buckel hat. Was bedeuten darin schon eine Sekunde, eine Minute, Stunde, Tag oder ein Jahr? Irdisch gerechnet war es der 22. November 2005 nach Christi Geburt und der Tag, als eine sorgsam von der Politik im Hintergrund vorbereitete weibliche Figur mit deutlich narzisstischen Zügen, ein menschlicher Eisblock, bar jeglicher Emotionen und Empathie, bereits damals sichtlich zu Übergewicht neigend, die Regierungsgewalt in Deutschland übernahm und sich über lange Jahre hinweg zu einer Despotin entwickelte.
Politisch dabei jeden brutal aus dem Weg räumte, welche ihr nicht Speichellecker oder nützlich genug im Spiel ihrer ständig zunehmenden Macht war. Beseitigte selbst die, welche sie dereinst an die Macht gehievt hatten. Nur ahnte es zu dem Zeitpunkt noch keiner. Gleichzeitig mit dem Amtsantritt zog diese Frau anfangs kaum merklich mit ihrer Politik das Land, die Wirtschaft in den Abgrund. Ließ oftmals Recht und Gesetz in vielen Punkten zur blanken Willkür und zum Wechselbalg von Paragrafen verkommen, um ihre Ziele zu erreichen.
Im gleichen Schicksalsjahr 2005, nur wenige Wochen nach Amtsantritt dieser Frau, wurde zufällig Kommissar Jochen Tritschler, zum Leiter der MUK in Zwickau berufen. Genau an dem Tag als Tritschler zum Leiter der MUK avancierte, landete auch ein gewisser Gerd Beyer in auf dem Airport in Frankfurt am Mai. Beyer war nur ein Passagier von Tausenden an diesem Tag und mit relativer Sicherheit nicht wichtig für den weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Gerd Beyer war nur ein Name, eine Nummer auf einer Passagierliste, dessen Flug aus Mallorca kam. Bekleidet war er mit brauner Hose, braunem Sakko, braunen Schuhen, weißem Hemd mit schwarzer Krawatte. Über der Schulter trug er eine dunkle Tasche, wie sie zum Transport von Laptops verwendet werden. Schwer schien sie zu sein, also befand sich wahrscheinlich auch ein Computer darin. Beyers Aussehen und das lässige Auftreten ließen vermuten, dass er Vielflieger und Geschäftsreisender war.
Wache, dunkelblaue Augen unter einem dichten, dunkelblonden Haarschopf, das kantige Gesicht „modern“ verschandelt mit einem Dreitagebart, sondierten die Beamten der Immigration in ihren Glaskästen, suchten zugleich unauffällig die überall offen und versteckt hängenden Überwachungskameras. Gelangweilt wirkend ob der Länge der Warteschlange, betrachtete er sich ungeniert die anderen Reisenden. Zeigte dabei unverhohlen besonderes Interesse an den weiblichen Passagieren. Endlich war er an der Reihe, zog aus der Brusttasche seinen Pass, hielt diesen hoch und der Beamte in seinem Glaskasten winkte ihn einfach durch. Befand es wohl aufgrund der vor ihm sich aufstauenden Flut der Abzufertigenden und seines dem mehr eines Norddeutschen entsprechenden Erscheinungsbildes für nicht nötig, das Dokument zu scannen, überhaupt einen Blick hineinzuwerfen. Brauner Pass mit Adler darauf ist gleich Deutschland und damit gab er sich zufrieden. Gerd Beyer holte sein Gepäck, welches nur aus einem mittelgroßen braunen Koffer bestand. Lief damit, freundlich zu den Zollbeamten nickend, durch den grünen Ausgang am Zoll vorbei nach draußen, tauchte Minuten später auf einem Ferngleis des Bahnhofs wieder auf, wurde Bruchteil von seinen täglich rund dreißigtausend Passagieren und verschwand mit einem Zug Richtung der Millionenstadt Köln. Überwachungskameras auf dem Bahnhof zeigten dort die Person Gerd Beyer ein letztes Mal, bevor dieser schlaksigen Schrittes das Gebäude verließ.
Seltsamerweise nun ohne jegliches Gepäckstück, strebte der Mann einem Imbissstand zu, holte sich eine Grillwurst und begann diese sichtlich mit Genuss zu verspeisen. Warf danach den Pappdeckel und seine Serviette ordentlich in den neben dem Stand befindlichen Mülleimer, verschwand Sekunden später im Gewühl der Menschenmassen auf dem Bahnhofsvorplatz.
Die Uhr am Kölner Bahnhof zeigte zu diesem Zeitpunkt 14.13 Uhr, es war Montag, der 12. Dezember 2005. Keiner wusste es, keiner konnte es ahnen. Dieser Montag würde an einem Punkt der Welt deren Ablauf verändern. Freilich nicht sofort, nicht um 14.23 Uhr. Weder würde die Erde stehenbleiben, noch würde sie von einem Asteroiden getroffen werden oder gar explodieren, wegen der Tat einer einzelnen Person, wie in einem teuren und realitätsfremden Schinken aus „Hollywood“. Bastler von Bomben für Attentate verändern auch nicht sofort spürbar, zum Beispiel mit dem Kauf des ersten Drahtes, des ersten Chips, einem Rohr, der ersten scheinbar harmlosen Chemikalie, einer Skizze usw., den Lauf der Geschichte. Bemerkbar für das Umfeld wird dies erst oft Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre später.
Gerd Beyer hatte an diesem 15. Dezember 2005 nicht die Welt verändert, auch nicht einen oder zwei Tage später. Unter vielfach wechselnden Namen und Aussehen, unbemerkt von seinem Umfeld, sorgte er ohne Kontrolle und Genehmigung von durch und durch korrupten und verlogenen Regierungen für Veränderungen, setzte seine Vorstellungen von Gerechtigkeit um. Bejubelt von den Einen, gejagt von den Anderen. Den Tod kümmern nicht von Menschen gegebene Namen. Sein System ist, Platz für neues Leben zu schaffen und dabei zeigt er sich mit seinen Methoden nicht wählerisch. Krankheiten, Unfälle, Morde – tot ist tot, Ziel erreicht. Trauern gewöhnlich zumindest einige Menschen um den Tod eines Menschen, jubeln andere hingegen über dessen Dahinscheiden. Letzteres ist vor allem bei Politikern der Fall, was natürlich nicht oder nur selten gezeigt wird. Gevatter Tod hatte sich, wie vielfach zuvor auch schon, nur ein zusätzliches Werkzeug aus Deutschland für seine Arbeit geschaffen, es reimportiert, weil er selbst zu bequem war, mit dem biologischen Faktor Zeit zu arbeiten, es eiliger mit seiner Ernte hatte.
Der Tote am Dom (Freitag, 1. Dezember, 22.48 Uhr)
Heute schrieb man den 1. Dezember 2017, ein Freitag, wie er hätte langweiliger nicht sein können. Verändert hat dieses Datum jedoch sehr wohl die Geschichte, nur eben nicht sofort ersichtlich; veränderte die Historie der Stadt und einzelner ihrer Bewohner, stellte Weichen zwischen Menschen, welche bis zu diesem Tag unsichtbar waren. Menschen wie Ereignisse. Tod und Leben, jedes davon untrennbar miteinander verknüpft und von realitätsfernen Menschen gleichzeitig gern aus Angst vor Ersteren verdrängt, begannen ihr Spiel miteinander zu spielen.
Kalt pfiff der Wind um die Ecken. Stramm auf Mitternacht zugehend, ließ sich um diese Zeit gewöhnlicherweise kein Mensch auf der Straße mehr sehen. Leer und verwaist, wirkte die Innenstadt um den ehrwürdigen Dom. Gaststätten hatten nur noch sehr wenige geöffnet. Weihnachtliche Beleuchtung und Weihnachtsschmuck mit Schwibbögen und Pyramiden in den Fenstern zeigten deutlich und gesetzlich gleichzeitig unverfänglich darauf hin, dass die Zwickauer ihre alten erzgebirgischen Traditionen noch lange nicht vergessen hatten. „Oksisch“ (ochsig), wie es im Zwickauer Dialekt so schön heißt, zudem noch auf „Weihnachtsmarkt“, statt „Lichterfest“ bestanden. Zwickauer knickten eben (noch) nicht, wie in zahlreichen Großstädten bereits üblich, ein. „Lichterfest“ ist eine für schlichte Naturen relativ gut verkappt Umschreibung der politisch inszenierten Auflösung einer 600–jährigen Tradition von Weihnachtsmärkten. Zahlreiche Zwickauer trotzen mit dieser scheinbaren Kleinigkeit als Form zivilen Ungehorsams der angeblich neuen und „modernen“ Zeit, wo nur wenige Jahre später, sich ein von der Wirklichkeit weit entfernter und abgehobener Bundespräsident einmal erfrechen wird zu behaupten, es wäre das „besten Deutschland, das wir je hatten“.
Direkt hinter dem Dom am Altmarkt wurde vor Tagen der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Unübersehbar zeigte sich dieser, im Vergleich zu früheren Jahren, nur noch als Schatten seiner selbst. Locker sitzt den Menschen das Geld schon lange nicht mehr. Immer höhere Abgaben, unsinnige, sowie ungerechte Steuern, welche prinzipiell die Falschen trafen, sorgten für einen deutlichen Rückgang des Kaufverhaltens auch zur Weihnachtszeit, wo sich der Bürger normal spendabler zeigt; für sich selbst und die Familie einkauft.
Mit steigender Armut fiel auch die Kurve der Kaufkraft steil ab. Man sparte für noch härtere Zeiten und diese, davon war der Großteil der Bürger überzeugt, würden kommen. Kaum stand der Markt, wurde dieser selbstredend bejubelt und beklatscht von den Machthabern und ihren kaum noch zählbaren Speichelleckern. Letztendlich wirkte der Markt nach seiner Fertigstellung für Besucher und aufmerksame Einheimische, welche die Vergangenheit eben nicht vergessen hatten, Märkte dieser Art aus früheren Zeiten kannten, mit seinen Sperren und schwer bewaffneten Polizeiaufgebot, mehr wie ein Bollwerk gegen vorsätzlich importierte Terroristen. Horrormeldungen aus Köln, erst unterdrückt, wenig später dann doch kleinlaut zugegeben zum Jahreswechsel 2015/2016 und der entsetzliche Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, zogen als unheilvolle Vorboten einer neuen Ära ihre Spuren bis ins ferne Sachsen. Begannen ganz Deutschland wie das Myzel eines tödlich wirkenden Pilzes zu durchsetzen. Weihnachtsmärkte, einst Zentrum christlichen Brauchtums, verloren mehr und mehr ihrer ursprünglichen Bedeutung, machten dem Kommerz Platz. Angst, statt Vorfreude, wurde vielerorts zum ständigen Begleiter. Wobei das „christlich“ in der Komponente des Namens, welches seit Jahrzehnten mehr und mehr durch diverse kirchliche Skandale Schlagzeilen machte, und ohnehin stark im Niedergang begriffen war. Fallende Mitgliedszahlen in den Amtskirchen legen davon beredtes Zeugnis ab und ein Ende zeichnete sich nicht ab.
Doch das war nicht alles. Neben drastisch schrumpfenden Einwohnerzahlen verfiel die Stadt an der Mulde in den letzten Jahren mehr und mehr. Verfall „juckt“ in den Augen, ist sichtbarer und steingewordener Beweis für Unfähigkeit und so wird abgerissen. Beseitigt man mit Baggern und Abrissbirnen, geschickt und stümperhaft zugleich, den offen sichtbaren Niedergang der Stadt. Unelegante und hochwirksame Methode, sich der Historie zu entledigen und unter den roten Bonzen der DDR–Zeit bereits gang und gäbe. Öffentlicher Protest blieb damals in der Regel aus. Sofern man keine Valuta damit verdienen, oder das Prestige der Partei und des Landes aufmotzen konnte, wurde abgerissen, was das Zeug hielt. Heute wichtig, um gleichzeitig Bürger ohne viel Aufwand zu vertreiben, um Platz zu schaffen für Konsumtempel und Spekulanten aus allen Himmelsrichtungen. Wurde dies praktiziert, ging es nicht nur um die Tilgung der Geschichte, vielfach einfach auch um Einsparung teurer Sanierungsmaßnahmen.
Problemlos und unter wehenden roten und DDR–Fahnen und mit lebensfremden Parolen garniert, wurde so in den 1970er und 1980er Jahren die historische Altstadt Zwickaus komplett eliminiert, diese durch standardisierte Plattenbauten ersetzt. Verächtlich von der Bevölkerung als „Arbeiterschließfächer“ bezeichnet, welche, ungeachtet dessen, bei der Wohnungsnot hoch begehrt waren, schlecht ausgestatteten und sanierungsbedürftigen Altbauwohnungen vorgezogen wurden. Baumaterial stand ohnehin kaum zur Verfügung. Die Nachfolger der SED seit der Wende und die Parteien aus dem Westteil Deutschland, zeigten sich in den letzten Jahrzehnten keinen Deut besser, der Stadt weiter ihre über 900–jährige Geschichte zu rauben.
Zwickau entwickelte sich nicht nur zur Stadt der Abrissbirnen, wo so ganz nebenher noch viele soziale Einrichtungen dem Rotstift zum Opfer fielen, sondern auch die innere Sicherheit ging, heftig von den Machthabern verleugnet, steil bergab. Bestimmte Orte entwickelten sich zu „No–Go–Areas“, wie es auf „neudeutsch“ heißt. Natürlich zeigten die Behörden in der Regel eine gänzlich andere Sichtweise auf die Dinge, als der normale Bürger, welcher damit leben muss. Trotzdem, im Vergleich mit anderen Städten im Bundesland Sachsen, bundesweit ohnehin, war Zwickau als relativ sichere Stadt einzustufen. Man „muss“ eben, nach Meinung der Regierenden in der Muldestadt, in der heutigen „modernen“ Zeit damit leben, dass plötzlich Regionen im Stadtgebiet existieren, wo man spätestens nach Einbruch der Dunkelheit gut beraten ist, seine Wohnung, außer in dringenden Fällen, nicht zu verlassen. Tut man es doch, dann auf jeden Fall in Begleitung. Ungewollter Preis für eine scheinbare Freiheit, welche in Wahrheit von einer Diktatur in die nächste mit hauchdünnem demokratischem Anstrich glitt.
Kaum hörbar, eigentlich war in der Stille der Nacht auf der Straße nur das schmatzende Rollgeräusch der Reifen zu vernehmen, bog ein Polizeifahrzeug, von der Marienstraße her kommend, in den Domhof ein. Jens Laube und Jörg Trommer befanden sich auf nächtlicher Streife, welche in dieser Nacht jedoch gänzlich anders verlaufen sollte, als unzählige Male vorher. Nur wusste dies zu diesem Zeitpunkt noch keiner der beiden Beamten. Leise unterhielten sie sich, der letzte Urlaub von Jens Laube mit seiner Freundin in Thailand beherrschte das Thema. Gerade fuhren sie am Haupteingang des Doms vorbei, als Jörg Trommer etwas auffiel, er aufgeregt seinen Kollegen anstieß.
„Weiterfahren, weiter hinter bis zur ‚Galerie‘, drehen und Richtung Dom stehen bleiben. Scheinwerfer dann aus“, sagte er leise zu seinem Kollegen.
„He, was ist los?“, fragte der erstaunt, fuhr aber augenblicklich langsamer.
„Hier stimmt was nicht!“, leise sprach Trommer, sehr leise und man gewann fast den Eindruck, als fürchte er, gehört zu werden. „Jens, hast du nichts bemerkt?“, er zeigte zum Haupteingang der Kirche, wirkte ungewöhnlich aufgeregt.
„Sollte ich?“, fragte Laube halb spöttisch zurück, „hast du eine heiße Braut gesehen?“
„Knallkopp, blöder! Kein Spaß jetzt! Los, fahr zu und halte dann an.“
Zehn Jahre bildeten die Beamten schon ein Team, konnten sich aufeinander in jeder Situation verlassen und Laube wurde sofort klar, dass es wirklich ernst ist. Kaum hatte der Wagen Richtung Dom gewendet und stand, schubste ihn Trommer an.
„Da! Schau genau hin. Da drüben! Fällt dir nichts auf?“, seine Hand wies in die Dunkelheit auf einen imaginären Punkt vor dem Wagen.
„Nein, sehe nichts. Nachtblind bin ich mit Sicherheit nicht, aber heute schwer von Begriff. Sage mir einfach, was ich sehen soll.“
„Vor zwei Stunden stand dort das Werbeschild, da, der Dreibock“, Trommers Hand wies in Richtung Brauttor des Doms. „Jetzt ist es weg, steht im Eingang. Nicht am Brauttor, sondern am Haupteingang des Domes.“
„Wird halt einer rübergetragen haben. Vielleicht der Pfarrer?“, mutmaßte Laube, fand nichts Besonderes an der Beobachtung seines Kollegen. „Werbung machen die höchstens für einen Kirchentag, nicht für Konsumartikel oder irgendwelche Parteien.“
„Klar, die Paffen haben nichts weiter zu tun, als mit städtischem Werbeeigentum den Eingang des Doms zu verbarrikadieren. Und das auch noch zur nachtschlafenden Zeit, wo jeder normale Mensch an der Matratze horcht“, Trommer musterte gespannt weiter die nur schwach beleuchtetet Dunkelheit vor dem Gotteshaus.
„Hast recht, sehe das Schild. Steht irgendwie schief, so nach vorn geneigt“, stellte Laube nachdenklich fest, „warum das?“
„Möglicherweise sitzt einer dahinter, benutzt es als Deckung? Wind und Scheiß Graupel hat es wirklich mehr als genug“, bekam er als Antwort.
„Wo soll wer sitzen?“, fragte Laube irritiert, „ich sehe nichts.“
„Genau im Eingang. Schau mal ganz genau hin. Rührt sich nicht und das ist schon mehr als komisch. Wäre es ein Penner, hätte der längst die Biege gemacht.“
„Außer Rolf! Ist es vielleicht Rolf?“, rätselte Laube, wurde noch langsamer.
„Rolf? Niemals, der wäre schon längst bei uns und würde sich eine Kippe schnorren.“
Rolf war ein stadtbekannter Obdachloser. Harmlos, nett, gebildet, nur hatte er meistens zu viel getrunken, bettelte dann offen die Leute an. Gab man ihm eine Zigarette, besser noch einen Pott Kaffee und eine Zigarette, konnte man wunderbar mit ihm plaudern. Private Gespräche waren natürlich den Beamten im Dienst untersagt, doch auch diese haben ab und an Freizeit und treffen oft auf den sympathischen Kerl. Polizeimeister Laube hatte ihn sogar schon an einem Wochenende zu sich zum Essen nach Hause geholt; konnte danach nur Gutes von dem Treffen berichten. Schwärmte geradezu von dessen Bildung und Manieren. Mit einem Ruck stand das Fahrzeug.
„Hast recht. Komisch, wir haben heute noch keinen unserer Kunden gesehen“, Laube schnallte sich ab. „Fahre mal noch ein paar Meter vor, raus, schauen wir nach.“
Laube kannte seinen Kollegen seit Jahren, wusste, dass er ein gutes Gespür für Leute und Situationen hatte. Ruhig fuhr der Wagen einige Meter weiter bis zu der von Trommer gewünschten Position, hielt erneut. Scheinwerfer blendeten für Sekunden auf, ließen tatsächlich hinter dem Schild die Silhouette eines Menschen im Eingang des Gotteshauses erahnen. Bedeutungsvoll sahen sich die beiden Männer an, griffen automatisch zu den Dienstwaffen, rückten sie zurecht. Beide wussten, wie gefährlich die an sich friedliche Muldestadt seit der Wende sein konnte.
Vor allem am Neumarkt trieb sich allerlei gewaltbereites Gesindel herum und das Duo hatte dort schon genügend brenzlige Situationen erlebt. Angst zu haben ist jedoch etwas, was die Polizisten nicht kannten, nicht Teil ihrer Ausbildung gewesen ist. Füße in brenzligen Situationen in die Hand zu nehmen, passt nicht zum Beruf.
Die Wagentüren öffneten sich und die Gesetzeshüter nahmen ihre Stabtaschenlampen. Mütze aufsetzen und raus. Grellweiße Lichtkegel durchschnitten die Dunkelheit wie Messer, hüpften im Rhythmus ihrer Schritte vor den Polizisten her, tauchten Bereiche des Weges in helles Licht. Einander sorgfältig sichernd, liefen die Beamten auf die hinter dem Schild sitzende Gestalt zu. Schneegraupel setzte ein und es frischte böig auf. Fast hatten die Polizisten hatten ihr Ziel erreicht, befanden sich nur noch 10 Meter vom Eingang des Domes entfernt, als Trommer Laube ein Zeichen gab zu halten.
Nervös schwebte seine Hand über dem Pistolenholster. Jederzeit griffbereit, um bei Gefahr schnell zu reagieren. Sicher ist sicher und beide hatten Familie. Zu viel hatten die beiden seit dem Jahr 2015 erlebt, als dass sie sich leichtsinnig in Gefahr begaben. Körperkameras, wie die bekanntlich oftmals recht schießwütigen Kollegen in den USA, hatten die Beamten nicht. Als Ersatz dafür, zog Trommer das Handy aus der Tasche, schaltet den Video–Modus ein. Aufnahme lief und er nickte zu Laube hin. Signal für den, jetzt zu handeln.
„Erst das Schild weg“, flüsterte er halblaut zu seinem Kollegen hin und der nickte.
Laube trat seitlich an den Werbeträger heran, drehte diesen mit einem beherzten Ruck zur Seite. Nichts geschah. Dafür hatten die Beamten nun freien Blick. Tatsächlich saß dort eine an das Gitter des Eingangs angelehnte reglose Gestalt, welche nach wie vor kein Lebenszeichen von sich gab. Mit dem Rücken an das Gitter des Einganges gelehnt, gerade eben noch von vorn gestützt durch das Werbeschild, begann sich diese allmählich zu neigen. Jens Laube hielt sie an der Schulter fest, leuchtete die Person an. Keine Reaktion auf das Licht folgte. Trommer nahm die Hände vom Pistolenholster, griff helfend zu. Zweifellos handelte es sich um einen Mann. Auf dem nach unten geneigten Kopf trug er einen braunen Hut, der graue Mantel mit Fellkragen stammte mit Sicherheit nicht aus dem Fundus des Roten Kreuz, zeigte sich hochwertig.
Weniger als 600 €, hatte dieser nicht im Handel gekostet. Allerdings, das fiel den Beamten sofort auf, schien er um mindestens zwei Nummern zu klein zu sein, denn der Mann erwies sich ausgesprochen korpulent. Gerade einmal zwei Knöpfe waren geschlossen. Die Füße des Unbekannten steckten in dunkelbraunen Lackschuhen und deren Farbe passte exakt zu der der Hose. Farblich passten die Schuhe zu der Hose, nur keinesfalls zum Wetter. Einzig Verrückte würden am Fuße des Erzgebirges mit derartig rutschigen und unpassenden Schuhwerk vor die Tür gehen. Beide Hände trugen braune Lederhandschuhe und diese harmonierten farblich mit der Hose und den Schuhen. Fragend sahen sich die Polizisten an, Trommer nickte zu Laube hin, signalisierte, dass er weiter Obacht gab.
„Guten Abend, Polizei“, stellte sich Laube vor, „Personenkontrolle. Geht es ihnen gut? Warum sitzen sie hier? Können wir ihnen helfen? Hallo?“
Abermals erfolgte keine Reaktion. Schneeflocken, bereits beim Anflug auf Zwickau dem Tode geweiht durch die für eine durchgehende Schneedecke viel zu hohen Temperaturen, wehten in den Eingang herein, blieben auf der Kleidung und dem Hut des Mannes liegen, zerschmolzen rasch, hinterließen winzige Tropfen Nässe.
„Hallo?“, fragte Laube noch einmal. „Hallo?“, der Polizist ließ den Mann los, welcher sich augenblicklich wieder in Zeitlupe zur Seite neigte und dann einfach steif umfiel, regungslos liegenblieb.
Normalerweise ist ein Mensch locker, irgendwie in sich weich, auch wenn er sich, aus welchem Grund auch immer, steif macht, bleibt die Elastizität erhalten, ungeachtet des normalen Muskelwiderstandes, bleibt er mehr oder weniger entspannt. Dieser schweigende Mensch hingegen fiel um wie eine Puppe aus Holz, zeigte sich starr und steif. Beine und Unterkörper bildeten einen Winkel von beinahe 90 Grad und dieser Winkel blieb während des Falls erhalten. Gleiches traf auf die Arme zu, welche sich hölzern und steif wie Stöcke zeigten. Wäre nicht die unheimliche und gefährlich wirkende Situation gewesen, könnte es beinahe grotesk wirken. Bei der Fallbewegung rutschte dem Mann den Hut vom Kopf, fiel nach unten, blieb mit der Öffnung nach oben auf dem Boden liegen. Bettler stellen so ihre Hüte zum Einsammeln von Spenden hin.
Schütteres graues, fast silbriges Haar, zweifellos früher einmal durchgehend blond gewesen, kam unter dem Hut zum Vorschein und dieses, reichte fast bis zur Schulter. Jetzt erst sah man, dass der Unbekannte einen ebenso silbergrauen Bart trug. Gepflegt sah er aus, war sicher an die zehn Zentimeter lang. Starr blickten zwei hellgraue Augen ins Nirgendwo und dieser Blick weilte augenscheinlich nicht mehr in dieser Welt. Zeigte dem aufmerksamen Betrachter Angst, Schmerzen, Wut und blankes Entsetzen. Möglicherweise war es auch nur das ungläubige Staunen bei der Überschreitung der Schwelle vom Leben zum Tod? Was auch immer, eine Antwort auf diese Frage könnte nur noch der Tote liefern und wird sie den Lebenden mit Sicherheit, selbst bei einem scharfen Verhör, nicht mehr beantworten können.
„Scheiße“, schimpfte Trommer leise, „was ist mit dem los? Sag mir jetzt ja nicht, dass der sich ins Jenseits verabschiedet hat. He, der ist doch tot, oder?“, fragte er.
Laube gab keine Antwort darauf. Beide Polizisten untersuchten den Mann kurz näher. Trommer schüttelte den Kopf, gab damit eindeutig zu verstehen, dass hier nichts mehr zu machen war, holte tief Luft.
„Tot, ja, sogar mausetot. Erfroren sein kann der jedoch keinesfalls“, meinte Laube leicht verunsichert. „Schau, wir haben gerade mal um die knapp unter null Grad. Gefroren ist es auch nicht. Bocksteif, wie in der Kühltruhe, friert bei den Temperaturen keiner durch. Alter, das hier ist Leichenstarre und die ist sicher seit Stunden voll ausgeprägt. Deswegen ist der auch gerade so komisch weggekippt.“
„Scheiße, schau mal da“, Laube wies mit der rechten Hand auf den Mantel, auf welchen sich drei deutlich sichtbare Löcher zeigten.
Grell beleuchtete das Licht der Lampen die Löcher auf der Brust. Deutlich war jetzt zu erkennen, dass das mittlere der beiden, einen dunklen Ring hatte. Blut schien aus allen Löchern ausgetreten und nach unten gelaufen zu sein. Auf dem Rücken hatte es hingegen zwei Einschüsse, einer links, einer rechts und diese ziemlich jeweils genau in der Mitte der Lungen. Der vordere Einschuss lag genau in der Herzgegend.
Verglich man die Menge des Blutes der drei Einschüsse, war es bei allen Löchern annähernd gleich.
„Getrocknetes Blut! Zweifellos“, stellte Laube fest und wurde weiß im Gesicht, „he, das ist doch Blut, oder was sagst du? Sag schon was, Alter!“
„Lass mal sehen“, Trommer drängte näher heran, „Scheiße, hast recht, tatsächlich Blut.“
„Niemals nicht, ist das ein Penner“, stellte Laube fest. „Schau mal, schon wie der angezogen ist. Und hier“, er leuchte auf das mittlere Loch im Mantel, „hat mächtig was abbekommen. Aufgesetzter oder Nahschuss, Schmauchspuren. Wenigstens schaut es so aus“, er leuchte für Trommer noch besser die Stelle an. „Schnell, mach mal Fotos.“
Leise klickt das Gerät, bannte Bilder auf den Chip. Laube öffnete die zwei Knöpfe des Mantels. Strikt gegen die Vorschrift, was ihm in der Aufregung jedoch nicht bewusst wurde, denn er veränderte damit genau genommen die Auffindesituation. Auch auf dem Hemd waren im Brustbereich Blut und Löcher von Einschüssen zu sehen. Fassungslos wich er zurück, holte tief Luft.
„Du, den haben die tatsächlich abgeknallt und das in Zwickau!“, stammelte er entsetzt.
„Hast recht. Ab jetzt Dienst nach Vorschrift“, Laubes Stimme zitterte. „Jens, kannst sagen, was du willst, das ist nicht mehr unsere Baustelle, ich mache Meldung und du filmst noch den Scheiß eine Minute“, hastig lief er zum Streifenwagen zurück.
Kaum eine halbe Stunde später herrschte Hochbetrieb auf dem sonst auch am Tag mehr ruhigen Domplatz. Rot–weiße Flatterbänder mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ flatterten im rauen Wind. Flutlichter gingen an, beleuchteten die Fundstelle und tauchten diese in grell weißes Licht. Polizisten standen fröstelnd an den Zufahrtswegen. Blaulichter blitzen durch die Dunkelheit, rissen diese in blaue und weiße Fetzen. Fast lautlos näherte sich dem Dom ein Fahrzeug der Spurensicherung, blieb rund 10 Meter und quer von dessen Eingang entfernt stehen. Von der Marienstraße her kommend vernahm man ein Martinshorn, wenig später bog ein Rettungswagen zum Fundort ein.
Hektisch sprang ein korpulenter Mann mit Arzttasche heraus, eilte, mit dem Handy am Ohr telefonierend, an den Fundort, schaute sich suchend um, fragte dann barsch die Beamten nach dem Einsatzleiter und man wies auf eine Person.
„Suchen sie mich?“, fragte der Gesuchte, schlug fröstelnd den Mantelkragen hoch.
„Sind sie der Einsatzleiter?“, forschte der Arzt noch einmal nach.
„Stimmt haargenau. Tritschler, Kommissar. Guten Abend erst einmal, sofern man überhaupt noch davon sprechen kann“, stellte sich der leicht untersetzt und kräftig wirkende Mann vor, reichte dem Doktor die Hand. „Unser Toter liegt dort“, seine Hand zeigte zu der am Boden liegenden Leiche.
„Seid ihr von allen guten Geistern verlassen?“, schimpfte der Notarzt, „Leute, heute ist der Teufel los im Revier. Wir kommen kaum nach und ihr ruft einen Notarzt zu einer Leiche?“, vielsagend tippte er sich an die Stirn, schüttelte den Kopf. „Leute, Leute, habe kaum 50 Meter vor dem Ziel erst erfahren, dass ich zu einer Leiche beordert werde, welche allem Anschein nach schon seit Stunden in der Gegend herumliegt. Seid ihr echt von allen guten Geistern verlassen?“, wiederholte er seine Eingangsworte noch einmal.
„Ruhig Blut“, beschwichtigend hob Kommissar Tritschler die Hände, „schauen sie erst einmal hin und dann reden wir weiter. Schließlich sind sie schon einmal da.“
Vernichtende Blicke trafen Tritschler. Blicke, welche hätten töten können, nur lag Töten normal nicht im Naturell eines Arztes.
„Ihnen ist aber trotzdem schon klar, dass wir der Rettungsdienst sind und mit Leichen nichts zu tun haben?“, bellte der Arzt giftig zurück und Tritschler nickte, bemüht, dabei weiter freundlich zu bleiben.
Ihm wurde der Fund einer Leiche gemeldet und warum die Zentrale dann einen Notarzt an den Fundort beorderte, ergab auch für ihn keinen Sinn. Viel mehr als entspannt tuend lächeln, blieb ihm in der Situation auch nicht übrig. Augenblicke später war der Arzt mit der Inaugenscheinnahme des Toten fertig.