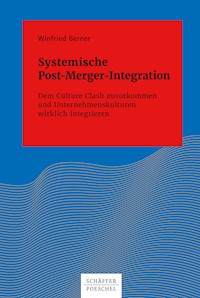Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemisches Management
- Sprache: Deutsch
Je vergleichbarer Produkte und Dienstleistungen werden, desto mehr entscheidet die Unternehmenskultur über den Markterfolg. Gleichzeitig zählen Kulturveränderungen zu den schwersten Change-Vorhaben überhaupt. Winfried Berner zeigt in seinem Buch, wie dies dennoch mit praxisbewährten Management-Methoden gelingen kann. Change-Manager finden hier ein bewährtes Instrumentarium und viele anschauliche Beispiele. In der 2. Auflage überarbeitet und um aktuelle Themen erweitert. Darunter: - Kulturveränderungsprojekte "top-down" oder "bottom-up" unter Einsatz von Großgruppen entwickeln - Interne und externe Kundenorientierung - Nachhaltigkeit und Kulturveränderung im internationalen Kontext
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 840
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumWas ist neu? – Vorwort zur Neuauflage1 Einführung: Weshalb Unternehmenskultur einen Unterschied macht1.1 Kultur beeinflusst Kosten und Profitabilität1.2 Wettbewerbsfaktor Unternehmenskultur1.3 Kostenfaktor Unternehmenskultur1.4 Kultur versus Strukturen, Prozesse und Systeme1.5 Kulturveränderung als strategische Anpassung – die Perspektive dieses BuchsTeil ITeil I: Was Unternehmenskultur ist, wie sie entsteht und wie sie sich auswirkt2 Was ist das überhaupt: Unternehmenskultur?2.1 Eine schrittweise Annäherung2.2 Kernelemente von „Unternehmenskultur“2.3 Kultur gibt Orientierung und Sicherheit – manchmal zu viel2.4 Lebenszyklen, Lebensabschnitte und Kulturbrüche2.5 Was gestern noch richtig war, kann heute falsch sein2.6 Die Notwendigkeit zur Überprüfung von Gewohnheiten3 Das Sein und das Bewusstsein – Wie Unternehmenskulturen entstehen3.1 Die Logik hinter scheinbaren Marotten3.2 Wie unterschiedliche Branchenkulturen entstehen3.3 Andere Geschäfte – andere Sitten3.4 Auswirkungen auf das Change Management3.5 Die persönliche Kulturkompatibilität4 Subkulturen in Abteilungen, Bereichen und Standorten4.1 Unterschiedliche Rollen, Interessen und Weltbilder4.2 Lagerbildung und neuzeitliche Stammesfehden4.3 Interkulturelle Konfliktpotenziale5 Kulturdiagnose – Den »Charakter« eines Unternehmens erfassen5.1 Das Bedürfnis nach Selbsterkenntnis5.2 Die Problematik von Standardinstrumenten5.3 Die Alternative: eine qualitative Kulturdiagnose5.4 Kritische Selbstreflexion5.5 Reibungsverluste und ihre QuantifizierungTeil IITeil II: Logik und Methodik der Kulturveränderung6 Kann man Unternehmenskultur überhaupt ändern?6.1 Es geht primär um Verhalten, nicht um Überzeugungen6.2 Wo mit der Veränderung ansetzen – und wo besser nicht7 Weshalb viele Anläufe zur Kulturveränderung scheitern7.1 Einordnung in die Typologie der Veränderungsprozesse7.2 Die Veränderung von Gewohnheiten ist mühsam7.3 Magisches Denken im Management7.4 Programmsätze sind Projektionsflächen7.5 Die Druckmaschine ist der Tod der Kulturveränderung7.6 Von oben übergestülpte Programme7.7 Abwertung der bestehenden Unternehmenskultur7.8 Delegation der Kulturveränderung7.9 Unterschätzung der Machtfrage7.10 Inkonsequenz und fehlende Beharrlichkeit7.11 Ausnahmen für Leistungsträger7.12 Keine ausreichend starke Energiequelle7.13 Gegenläufiges reales Handeln und inkonsistente Beförderungen7.14 Uneinigkeit auf höchster Ebene7.15 Wechsel im Top-Management8 Wie Kulturveränderung funktioniert8.1 Erreichen und Überschreiten der „kritischen Masse“8.2 Logische Konsequenz veränderter Rahmenbedingungen8.3 Kulturveränderung „aus Versehen“8.4 Das „Grundgesetz der Kulturveränderung“8.5 Die innere Logik des heutigen Verhaltens8.6 Veränderung der Rahmenbedingungen des Handelns8.7 Die Machtfrage – und ihre Beantwortung8.8 Schlüsselfrage geschäftlicher Nutzen8.9 Der Zeitbedarf von Kulturveränderungen8.10 Den Sieg nicht zu früh verkünden9 Veränderungsbedarf und Veränderungsziele sorgfältig bestimmen9.1 Einen belastbaren Zielkonsens im Management herbeiführen9.2 Vorsicht vor voreiligen Zielfestlegungen!9.3 Über eine SWOT-Analyse zur Zielklärung9.4 Problem mangelnde Akzeptanz9.5 Bewahrungs-, Veränderungs- und Vermeidungsziele9.6 Culture Follows Strategy – Von der Strategie zur Kultur9.7 Mut zu ehrlichen Aussagen9.8 Praktisches Vorgehen zur Herleitung der Sollkultur9.9 Von der Arbeits- zur Führungskultur9.10 Ethisch-moralische Werte und Kulturziele9.11 Wie einheitlich kann, soll und muss eine Kultur sein?10 Partizipativ oder »top-down«? Die Grundlogik des Vorgehens festlegen10.1 Voraussetzungen für einen partizipativen Prozess10.2 Die Alternative: Kulturveränderung von oben10.3 Wo Partizipation sinnvoll ist und wo nicht10.4 Partizipation bei großen Mitarbeiterzahlen10.5 Partizipation via Großgruppen10.6 Ist die Geschäftsleitung wirklich bereit?11 Kulturprojekte richtig aufsetzen11.1 Intensiver Dialog mit dem Projektteam11.2 Auswahl des Projektleiters11.3 Bunt gemischte Zusammensetzung des Projektteams11.4 Einbeziehung des Betriebsrats11.5 Doppelte Aufgabenstellung11.6 Festlegung des Vorgehens und der Projektstruktur11.6.1 „Prolog im Himmel“: Vorstandsworkshop11.6.2 Phase 1: Bestandsaufnahme und Entwurf der Sollkultur11.6.3 Phase 2: Entscheidung und Kommunikation11.6.4 Phase 3: Entwicklung Veränderungskonzept11.6.5 Phase 4: Kommunikation, Umsetzung und Controlling11.6.6 Der Projektabschluss12 Der Klassiker: Partizipative Bestandsaufnahme12.1 Wertschätzender Umgang mit der bestehenden Kultur12.2 Zum Aufwärmen: die eigene Kultur von außen betrachten12.3 Gestaltung einer breit angelegten Zielediskussion13 Großgruppenkonferenzen: Beschleuniger der Kulturveränderung13.1 Enge Verzahnung mit Projektarbeit und Umsetzung13.2 Das richtige Konferenzformat wählen13.3 Bewusste Entscheidung des Top-Managements13.4 Sorgfältige Vorbereitung mit einer „Spurgruppe“13.5 Die Räumlichkeiten sind wichtiger, als viele denken13.6 Den Übergang in die Projektarbeit nicht vermasseln13.7 Folgekonferenzen im World-Café-Format14 Top-down-Kulturveränderung: Bewusster tun, was Sie sowieso tun14.1 Den Blick für ungewollte Nebeneffekte schärfen14.2 Wie das Top-Management Einfluss auf die Kultur nimmt14.3 Den eigenen Einfluss bewusster und gezielter nutzen14.4 Top-down-Festlegung der Sollkultur14.5 Einbeziehung in die operative Ausgestaltung14.6 Top-down-Festlegung von Veränderungsschwerpunkten14.7 Die Macht einer entschiedenen Führung14.8 Der Haken: Man muss es durchziehen15 Kulturanalyse: Die innere Logik der herrschenden Gewohnheiten verstehen15.1 Entscheidung über eine vertiefende Kulturanalyse15.2 Die Methodik der Kulturanalyse15.3 Die Interviewtechnik der Kulturanalyse15.4 Die Interviewreihe als Lernprozess15.5 Workshops statt Einzelinterviews15.6 Den Auftraggeber im Erkenntnisprozess „mitnehmen“16 Ein Veränderungskonzept entwickeln16.1 Der Wucht der Erkenntnis standhalten16.2 Einflussfaktoren auf das Verhalten von Mitarbeitern16.3 Die eigenen Einflussmöglichkeiten bündeln16.4 Beurteilungs- und Controllingsysteme neu ausrichten16.5 Wie lange muss die Kultur nachgehalten werden?17 Schlüsselfaktor Führungskultur17.1 Führungsverhalten prägt Mitarbeiterverhalten17.2 Bestimmung der benötigten Führungskultur17.3 Umsetzung der Führungskultur17.4 Elemente eines Umsetzungscontrollings17.5 Eine maßgeschneiderte Vorgesetztenbeurteilung17.6 Ein Regelkreis – zugeschnitten auf die Soll-Führungskultur18 Der Personalbereich – Koordinator der Kulturveränderung18.1 Nicht Treiber, sondern Garant18.2 Mitbestimmung als Chance nutzen18.3 Drehscheibe für Organisation und Koordination18.4 Synchronisierung der Personalprozesse und -systeme18.5 Führungskräfte und Mitarbeiter beim Umlernen unterstützenTeil IIITeil III: Spezielle Themen der Kulturveränderung19 Unternehmensethik: Anreize zu unlauterem Handeln erkennen und korrigieren19.1 Ableitungen für das Geschäftsleben19.2 Drei Ansatzpunkte für Unternehmen19.3 Ein wirksames Steuerungssystem aufbauen20 Kundenorientierung zwischen Floskel und Programm20.1 Machtverschiebung von den Verkäufern zu den Käufern20.2 Orientierung statt beschwörender Leerformeln20.3 Kundenorientierung konkret20.4 Die interne Kundenorientierung als Schlüssel zur externen20.5 Vorgehen zur Verbesserung der internen Kundenorientierung21 Nachhaltigkeit – Wahrung und Mehrung der Substanz21.1 „Nachhaltigkeit“ contra Nachhaltigkeit21.2 Ein prinzipielles Dilemma21.3 Ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit21.4 Nachhaltigkeitsprojekte praktisch22 Fragen und Antworten zu Unternehmenskultur und Kulturveränderung23 LiteraturverzeichnisOnline-BonusmaterialOnline-Bonusmaterial24 Kulturgestaltung – Die Kultur eines neuen Unternehmens formen25 Kulturelle Integration bei Fusionen und Übernahmen26 Interkulturelles (Change) Management: Erschwerte Zusammenarbeit zwischen Kulturkreisen27 Innere Konkurrenz – Maximierung der Reibungsverluste28 Streitkultur: Kultivierung des respektvollen Streitens29 Fehlerkultur – Umgang mit der menschlichen Unvollkommenheit30 Der Kraftakt, verwöhnte Kulturen zu verändernDer AutorStichwortverzeichnismybookHinweis zum Urheberrecht
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH, Stuttgart
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2019 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht [email protected]
Umschlagentwurf: Goldener Westen, Berlin Umschlaggestaltung: Kienle gestaltet, Stuttgart Lektorat: Barbara Buchter, extratour, Freiburg Satz: Claudia Wild, Konstanz
Februar 2019
Schäffer-Poeschel Verlag StuttgartEin Unternehmen der Haufe Group
Was ist neu? – Vorwort zur Neuauflage
Ein Buch zu überarbeiten, das man vor ein paar Jahren geschrieben hat, konfrontiert einen zwangsläufig mit der Frage, ob und wie sehr sich die eigene Sichtweise seither weiterentwickelt hat: Kann man das, was man damals gesagt hat, einfach so stehen lassen, reichen einige Ergänzungen oder ist eine grundlegende Überarbeitung erforderlich?[2]
Und da freue ich mich, feststellen zu können: Ich habe doch noch einiges dazugelernt. Zwar muss ich aus heutiger Sicht nichts von Grund auf korrigieren – wer die erste Auflage besitzt, braucht das Buch also nicht wegzuwerfen. Aber ich kann heute einiges noch klarer und präziser formulieren, habe die entscheidenden Hebel für eine Kulturveränderung noch besser verstanden und bin infolgedessen auch mutiger geworden, ganz andere Wege zur Kulturveränderung zu beschreiten als sie üblicherweise gegangen werden.
Damit entfernt sich mein Herangehen an Kulturveränderungen noch weiter vom Mainstream, der mir zunehmend wie eine säkularisierte Geisterbeschwörung vorkommt: Allzu oft wird da mit wohlgesetzten Worten ein Idealbild beschrieben, das keinerlei Bezug zur heutigen Unternehmensrealität hat, dann werden magische Rituale in Gestalt von Großveranstaltungen, Workshops und Events vollzogen, und es werden symbolische Opfergaben in Form von Hochglanzbroschüren, Erinnerungskärtchen und Accessoires gebracht – und dann warten alle darauf, dass die anderen endlich zu besseren Menschen werden. Weil aber kaum einer am eigenen Verhalten etwas ändert, schlagen die hochgesteckten Erwartungen nach einiger Zeit vorhersagbar in Enttäuschung, Frustration und Zynismus um.
Und weil immer mehr Mitarbeiter und Führungskräfte das so oder so ähnlich schon einige Male erlebt haben, macht sich ein zunehmender Überdruss und Widerwillen gegen derartige Kulturprogramme breit.[3]
Unterschiede zu herkömmlichen Ansätzen
Wie unterscheidet sich die hier vorgestellte Methodik zur Kulturveränderung von den gängigen Ansätzen?
Durch einen wertschätzenden Umgang mit der bestehenden Kultur sowie mit denen, die sie repräsentieren, also den langjährigen Mitarbeitern und Führungskräften.
Durch eine Entmystifizierung der Unternehmenskultur, die sowohl eine Kultur insgesamt als auch das typische Verhalten ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte als eine sinnvolle Anpassung an ihr jeweiliges „Biotop“ versteht, sprich, an ihr Markt- und Wettbewerbsumfeld sowie ihre internen Gegebenheiten.
Durch einen konsequenten strategischen Fokus, der den Beitrag der Kultur zum Geschäftserfolg in den Mittelpunkt der Zielbestimmung stellt und Schluss damit macht, die Sollkultur zum „Wünsch dir was“ für forsche Vorstände und idealistische Projektteams zu machen.
Durch die Aufnahme auch jener Aspekte in die Sollkultur, die nicht so herzerwärmend klingen wie die Klassiker Wertschätzung und Vertrauen, aber dennoch unverzichtbar sind, um das Geschäft in der gewünschten Weise voranzubringen. Wenn beispielsweise in einem kostengetriebenen Geschäft die Aspekte Effizienz und Produktivität nicht benannt werden, ist die Beschreibung der Sollkultur nicht nur unvollständig, sondern irreführend und damit eher schädlich.
Durch die konsequente Operationalisierung der Sollkultur, weil in abstrakte Leitsätze Beliebiges hineingedeutet werden kann und erst die Angabe beobachtbarer Indikatoren nachprüfbar macht, was für ein Verhalten künftig erwartet bzw. nicht mehr geduldet wird.[4]
Durch den konsequenten Fokus auf Verhalten und Ergebnisse statt auf Einstellungen und Überzeugungen („Mindsets“), die erstens kaum beeinflusst werden können und zweitens nur lose mit dem realen Verhalten korrelieren.
Durch die Trennung von Arbeits- und Führungskultur, weil das zwei ganz verschiedene Felder sind, die man um der größeren Klarheit willen besser separat beschreibt. Vorrang hat dabei die Arbeitskultur, bei der es um die direkte Wertschöpfung für den Kunden geht. Die Führungskultur steht nach meinem Verständnis im Dienst der Arbeitskultur und hat die Aufgabe, sie bestmöglich zu voranzubringen.
Durch die Überzeugung, dass das heute im Unternehmen vorherrschende Verhalten, auch wenn es noch so dysfunktional sein mag, weder ein Missverständnis noch ein Missgeschick ist, sondern ein aus subjektiver Sicht sinnvolles Handeln, um unter den gegebenen Umständen die eigenen Ziele zu erreichen. Deshalb kann eine Kulturanalyse nützlich sein, um zu erkennen, welche der bestehenden Rahmenbedingungen, Anreize und Sanktionen dieses heutige Verhalten subjektiv sinnvoll machen. Daraus lässt sich dann ableiten, wie etwa die Führungskultur, die Beurteilungs- und Controllingsysteme und die sonstigen Rahmenbedingungen verändert werden müssen, damit ein anderes Verhalten für die Adressaten sinnvoll und möglich wird.
Durch die Ausrichtung aller HR-Instrumente von den Einstellungskriterien über Leistungsbeurteilungen und variable Vergütung bis hin zu den Beförderungskriterien auf die Sollkultur, um sie in Einklang mit der Sollkultur zu bringen und zu verhindern, dass von ihnen gegenläufige oder störende Anreize ausgehen.[5]
Durch das konsequente Nachhalten der Sollkultur, das heißt durch ein geeignetes Controlling, weil in hierarchischen Strukturen nur ernst genommen wird, was systematisch nachgehalten und „gemessen“ wird.
Und schließlich durch ein differenziertes Verhältnis zu Partizipation und breiter Beteiligung, die nach unserer Erfahrung keineswegs der einzige mögliche Weg zu einer Kulturveränderung ist, sondern nur eine mögliche Option zur Gestaltung des Vorgehens – und nicht immer die beste.
So, im Grunde wissen Sie damit schon (fast) alles – der Rest sind hauptsächlich Empfehlungen zum Vorgehen. Das Schöne ist, dass Kulturveränderung nach dieser Methodik ziemlich zuverlässig funktioniert. Das heißt nicht, dass man dann nichts mehr falsch machen kann, aber wenn man diesen Leitgedanken folgt, wird es tatsächlich schwieriger, einen Kulturprozess völlig vor die Wand zu fahren.
Änderungen gegenüber der ersten Auflage
Was konkret hat sich gegenüber der ersten Auflage geändert, außer, dass das Buch dicker geworden ist?
Der größere Umfang rührt in erster Linie daher, dass wir in den dritten Teil des Buchs einige weitere wichtige Anwendungsfälle der Kulturveränderung aufgenommen haben: etwa den Abbau von Verwöhnung und das immer wichtiger werdende Thema Nachhaltigkeit, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt.[6]
Zwei wichtige Erweiterungen hat auch Teil II „Logik und Methodik der Kulturveränderung“ erfahren, nämlich die beiden neuen Kapitel „Kulturveränderung von oben“ und die Nutzung von „Großgruppenkonferenzen als Beschleuniger der Kulturveränderung“.
Was die Kulturveränderung von oben betrifft, ist mir wichtig zu betonen, dass dies keine an den Zeitgeist angebiederte „Gegenreformation“ zurück zu alten autoritären Zeiten ist. Deshalb handelt es sich dabei gerade nicht um eine selbstgefällig-autoritäre „Kulturveränderung auf Ansage“, wie mir als vermeintlich peppigerer Titel für einen Artikel vorgeschlagen wurde (Berner 2017b). Vielmehr trägt dieses Vorgehen erstens der Tatsache Rechnung, dass eine breite Beteiligung in vielen Fällen, die nach einer Kulturveränderung verlangen, gar nicht möglich ist, weil die Aufmerksamkeit der Belegschaft durch brisantere Themen in Beschlag genommen ist. Zudem wecken partizipative Prozesse zwar hohe Erwartungen, tragen aber nur sehr begrenzt dazu bei, dass die Beteiligten ihr eigenes Verhalten ändern.
Was den Einsatz von Großgruppenkonferenzen bei Kulturprozessen betrifft, habe ich in den letzten Jahren einige sehr ermutigende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit meinem Freund und Kollegen Paul Krummenacher gemacht, einem der erfahrensten „Großgrüppler“ im deutschen Sprachraum. Seither betrachte ich Großgruppen als „Turbolader der Kulturveränderung“, das heißt als ein Instrument, das bei geeigneter Ausgangslage erheblich zur Beschleunigung und Intensivierung von Kulturentwicklungsprozessen beitragen kann – und nebenbei auch zur Senkung von deren Kosten.[7]
Entscheidend ist dabei eine enge Verzahnung von Großgruppen und operativer Projektarbeit, denn wenn im Anschluss an die erste Konferenz und die durch sie geweckten hohen Erwartungen nichts oder zu wenig geschieht, kippen diese Erwartungen nach einer Weile in Enttäuschung und Frustration um. Großgruppen verlangen dem Top-Management einiges an Mut und Standing ab, aber sie belohnen dafür dank der gemeinschaftlichen Erlebnisintensität mit ungleich mehr Dynamik und zugleich mehr Verbindlichkeit als jedes andere mir bekannte Verfahren.
Aber gleich welche Vorgehensweise man wählt, man sollte sich dabei von einem gesunden Respekt vor der bestehenden Kultur leiten lassen. Denn bei allen Eigenwilligkeiten und Marotten, die sich eine Firma gönnt, sie hat es geschafft, sich über viele Jahre hinweg in ihrem Geschäft zu behaupten. Und zwar in den meisten Fällen wohl nicht trotz ihrer Kultur, sondern wegen ihrer Kultur: Sie hat ihren Beitrag zum bisherigen Erfolg geleistet. Um dies noch deutlicher zu machen, wurde im Kapitel 12 ein Abschnitt „Wertschätzender Umgang mit der bestehenden Kultur“ eingefügt.
Um zu unterstreichen, wie wichtig die Unternehmenskultur für den Geschäftserfolg ist, habe ich schließlich im Kapitel 5 über die Kulturdiagnose einen Abschnitt „Reibungsverluste und ihre Quantifizierung“ eingefügt. Während die Prozesse ansonsten oft buchstäblich bis auf die Knochen optimiert sind, leisten sich viele Firmen unglaubliche Ineffizienzen und Konflikte sowohl in der internen Zusammenarbeit als auch im Geschäftsverkehr mit Kunden und Lieferanten.[8]
Diese Reibungsverluste stellen in meinen Augen eines der letzten großen Rationalisierungspotenziale dar, doch um die entsprechenden Kostenersparnisse zu erschließen, muss man diese Verluste erst einmal im Rahmen der Kulturdiagnose bestimmen und idealerweise quantifizieren. Darauf lässt sich dann mit gezielten Kulturentwicklungsprogrammen aufbauen. Besonders bieten sich hierfür Programme wie „Konstruktive Streitkultur“ (s. Kapitel 28) und „Interne Kundenorientierung“ (s. Kapitel 20) an.
Kurze Gebrauchsanleitung
Das Buch ist so aufgebaut, dass es Ihnen ein effizientes, systematisches Lesen erleichtert: Am Ende eines jeden Kapitels finden Sie auf einer knappen Seite eine kompakte Zusammenfassung der Kernaussagen dieses Kapitels und am Ende jedes Abschnitts – meist in wenigen Zeilen – eine Zusammenfassung der Kernaussagen dieses Abschnitts.
Da das hier vertretene Verständnis zur Unternehmenskultur wie auch der Ansatz zu ihre Veränderung (noch) etwas ungewöhnlich ist, empfehle ich Ihnen, zumindest die ersten beiden Teile des Buchs komplett durchzuarbeiten: Das hilft Ihnen, die Kultur Ihres Unternehmens wie auch das Verhalten seiner Mitarbeiter und Führungskräfte zu entmystifizieren und sie als sinnvolle Anpassung an ihr jeweiliges „Biotop“ zu verstehen.[9]
Aber auch dann beginnen Sie wahrscheinlich am besten mit den Zusammenfassungen: Danach haben Sie schon mal einen groben Überblick über die wesentlichen Inhalte des Buchs und seine logische Struktur. Das hilft Ihnen, die Einzelheiten besser einzuordnen und dabei die Übersicht zu behalten.
Wenn Ihr Interesse in erster Linie der Frage gilt, wie Sie eine bestehende Unternehmenskultur in eine bestimmte, gezielte Richtung weiterentwickeln können, beispielsweise in Richtung auf eine Fehlerkultur (s. Kapitel 29) oder in Richtung auf mehr Nachhaltigkeit (s. Kapitel 21), dann spricht auch nichts dagegen, dass Sie gleich zu dem jeweiligen Kapitel springen. Wahrscheinlich werden Sie danach noch einen Blick in den zweiten Teil des Buchs machen müssen, um sich mit der Logik und Methodik der Kulturveränderung besser vertraut zu machen. Denn die haben wir sozusagen vor die Klammer gezogen, weil sie für (fast) alle Kulturveränderungen in ähnlicher Weise gilt.
Und nun wünsche ich Ihnen eine angenehme und erkenntnisreiche Lektüre!
Mitterfels, Juli 2018
Winfried Berner
1 Einführung: Weshalb Unternehmenskultur einen Unterschied macht
Ein namhaftes Universitätsklinikum stand in dem Ruf, auf medizinischem Gebiet exzellent zu sein, aber das Klima eines Kühlhauses zu haben. Ob das der Wahrheit entsprach oder eine maßlose Übertreibung war, ist in unserem Zusammenhang gar nicht entscheidend – so oder so hatte dieser zwiespältige Ruf Folgen: Wenn jemand eine heikle Operation oder Behandlung vor sich hatte, begab er sich, sofern er die Wahl hatte, in der Regel trotzdem in das Uni-Klinikum, doch viele von denen, die keine so kritische Behandlung vor sich hatten, ließen sich lieber in einem der Provinzkrankenhäuser der Umgebung behandeln.[10]
Diese Beobachtung ist in doppelter Hinsicht bedeutsam: Erstens, weil man annehmen würde, dass die meisten Menschen bei einem so existenziellen Thema wie ihrer Gesundheit einzig und allein auf die medizinische Qualität Wert legten. Stattdessen ziehen sie in vielen Fällen eine freundliche Atmosphäre der fachlichen Perfektion vor – vielleicht aus einer Ahnung, dass für ihre Genesung nicht nur die Ärzte wichtig sind, sondern auch das Klima, in dem sie die Tage und Wochen nach der Behandlung verbringen.
1.1 Kultur beeinflusst Kosten und Profitabilität
Zweitens ist es bemerkenswert, weil es zeigt, dass es bei Unternehmenskultur nicht nur um so weiche Faktoren wie Betriebsklima und Mitarbeiterzufriedenheit geht, sondern um harte Zahlen. In vielen Branchen hat Kultur – das heißt, die Art, wie die Mitarbeiter miteinander und mit den Kunden umgehen – einen unmittelbaren Einfluss auf den Geschäftserfolg: Sie beeinflusst das Verhalten der Kunden und damit unmittelbar die Erlöse und die Profitabilität.
Der Zusammenhang ist so direkt, dass er sich messen lässt – sofern sich jemand die Mühe macht, es zu tun. Im Falle unseres Klinikums müsste man dazu nur – beispielsweise durch die Befragung von Patienten oder niedergelassenen Ärzten (den sogenannten „Einweisern“) – quantifizieren, wie viele Patienten sich zusätzlich für das Uni-Klinikum entschieden hätten, wenn dessen Ruf nicht ganz so abschreckend wäre. Als Plausibilitätstest könnte man Daten heranziehen, wie sich die Patienten in vergleichbaren Regionen auf Universitäts- und Regionalkrankenhäuser verteilen.[11]
Schon geringe Differenzen können hier gravierende Folgen haben. Denn in Kliniken und anderen fixkostenintensiven Branchen hat die Auslastung einen durchschlagenden Einfluss auf die Ertragslage: Weniger Patienten bedeuten nicht bloß schlechtere Ergebnisse, sondern dramatisch schlechtere Ergebnisse. Wegen der hohen Fixkosten (also der Kosten, die unabhängig von der Auslastung anfallen) schlägt sich eine geringere Auslastung weit überproportional in den Erträgen nieder: 2 Prozent weniger Patienten können so zu 10 Prozent schlechteren Ergebnissen (bzw. 10 Prozent höheren Verlusten) führen.
Denn die ganze Infrastruktur eines Krankenhauses muss ja unabhängig von dessen Auslastung vorgehalten werden: nicht nur Bauten und Betten, sondern auch Ärzte, Schwestern und Pfleger, ja selbst Küchen- und Verwaltungspersonal, ganz zu schweigen von den teuren Geräten und dem kostenintensiven Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Im Gegensatz zu einem Produktionsbetrieb kann man die Nachtschicht ja nicht ausfallen lassen, weil eine Station nur zur Hälfte belegt ist; ebenso wenig kann man kurzfristig die Zahl der Operationssäle und deren technische Ausstattung an die Patientenzahlen anpassen – die allermeisten Kosten laufen einfach weiter. Und bei zu schwacher Auslastung hängen sie dem Betreiber bald wie ein Mühlstein am Hals.[12]
Wenn es in einer solchen Situation gelingt, die Auslastung nur um ein oder zwei Prozentpunkte zu verbessern, entspannt das den Kostendruck erheblich. Um das zu erreichen, müsste der Ruf der Patientenbetreuung gar nicht exzellent sein, denn davon sind auch die Wettbewerber weit entfernt – es wäre schon viel erreicht, wenn er auf vergleichbarem Niveau wäre wie anderswo.
Lassen wir für den Moment noch außer Acht, wie das erreicht werden könnte, und blicken zunächst nur auf die Auswirkungen: Schon durch einen leichten Anstieg der Auslastung verwandeln sich die drückenden roten Zahlen in schwarze. Noch ein oder zwei Prozentpunkte mehr würden die Lage ausgesprochen komfortabel gestalten: Dann könnte man sogar über zusätzliches Personal und einige andere Dinge nachdenken, die bislang den verzweifelten Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen waren.
Offensichtlich ist das ein Teufelskreis: Wenn das Klima schlecht ist, leiden nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Patienten. Wenn die aber anfangen, sich andere Kliniken zu suchen, nachdem sich der schlechte Ruf herumgesprochen hat, steigt sofort der Kostendruck.
In Fixkostengeschäften gehen Einsparungen rasch an die Substanz. Klar, man kann Stationen und Operationssäle stilllegen; dann braucht man sie nicht beheizen – doch der Einsparungseffekt, der sich so erzielen lässt, ist, bezogen auf die Gesamtkosten, minimal. Also wird unter wachsendem Kostendruck früher oder später auch dort eingespart, wo es nicht geht, ohne die Leistung zu verschlechtern, vor allem am Personal und den Arbeitsbedingungen. Also steigt der Stress, und das Klima verschlechtert sich, was alsbald auch die Patienten zu spüren bekommen. Was sie natürlich gegenüber allen beklagen, die sie besuchen oder nach ihren Krankenhauserfahrungen fragen …[13]
Jammern hilft nichts. Man muss aus solchen Teufelskreisen ausbrechen, solange man dazu noch Zeit und Kraft hat. Oder, noch besser, erst gar nicht in sie hineingeraten. Dafür aber ist wichtig zu verstehen: Unternehmenskultur ist heute in den meisten Branchen kein Luxusthema mehr für Unternehmen, denen es zu gut geht, sie ist zu einer zentralen Komponente der Wettbewerbsfähigkeit geworden.
Je vergleichbarer Produkte und Dienstleistungen sind, desto mehr wird die Kultur zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor – und zwar in doppelter Hinsicht: zum einen durch die Art, wie die Leistungen gegenüber dem Kunden erbracht werden, zum anderen durch die Reibungslosigkeit und Effizienz der internen Zusammenarbeit.
1.2 Wettbewerbsfaktor Unternehmenskultur
Wenn Sie ein extrem gefragtes Produkt haben – gleich ob es Eintrittskarten für ein singuläres Ereignis sind, das neueste Hyper-Smartphone oder ein neues, hochwirksames Medikament für eine schwere Krankheit –, tritt die Bedeutung Ihrer Unternehmenskultur in den Hintergrund: Dann erdulden die Kunden ziemlich viel, um das heiß begehrte Produkt zu bekommen. Dann bilden sie schon am ersten Verkaufstag lange Schlangen vor Ihren Geschäften, manche übernachten vielleicht sogar auf der Straße davor. Sie schlucken schikanöse Geschäftsbedingungen ebenso wie unfreundliche Behandlung, Arroganz und Schlamperei. Und die meisten kommen sogar wieder – nicht wegen,[14] sondern trotz Ihrer Unternehmenskultur, allein wegen Ihres Produkts.
Falls Ihre Produkte bei ehrlicher Betrachtung aber nicht zu denen zählen, die so einzigartige Wettbewerbsvorteile haben, dass sie Ihnen von den Kunden aus den Händen gerissen werden, dann muss Sie das Thema Unternehmenskultur interessieren. Denn dann hat Ihre Kultur mit ziemlicher Sicherheit Einfluss darauf, ob die Kunden bei Ihnen kaufen oder bei der Konkurrenz.
Machen Sie gern die Probe aufs Exempel, und zwar im „Selbstversuch“: Listen Sie einmal die Gaststätten und Restaurants auf, die Sie bevorzugt besuchen. Und machen Sie parallel dazu eine zweite Spalte mit all den Gaststätten und Restaurants, die Sie nur im äußersten Notfall wieder betreten würden. Bewerten Sie dann für jedes Lokal mit Schulnoten sowohl (a) Ihren Gesamteindruck als auch (b) die Qualität der Küche sowie (c) die Atmosphäre und den Service. Danach analysieren Sie sich das entstandene Bild.
Selbst wenn Sie ein ausgesprochener Feinschmecker sind, ist unwahrscheinlich, dass Ihre Gesamtbewertung allein von der Qualität der Küche bestimmt ist. Zwar spielt sie sicherlich eine Rolle, doch wenn die Atmosphäre unangenehm und der Service unfreundlich oder nachlässig ist, hilft die beste Küche nichts. Manche Lokale besuchen Sie möglicherweise sogar primär wegen der Atmosphäre und dem Service, auch wenn die Küche nur durchschnittlich ist.[15]
Aber das hat Grenzen: Eine miserable Küche lässt sich auch durch eine angenehme Atmosphäre und einen äußerst zuvorkommenden Service nicht ausgleichen. Sie mögen helfen, über einige Schwächen der Küche hinwegzusehen, aber wenn der Fisch streng riecht und im Salat Tierchen sind, wird Sie auch der charmanteste Service nicht zu einer baldigen Rückkehr veranlassen.
Das lässt sich verallgemeinern, und es lassen sich daraus einige allgemeine Gesetzmäßigkeiten für all die Fälle ableiten, in denen der Kunde mit der Kultur einer Firma in Berührung kommt:
Am besten ist natürlich, wenn sowohl die Produkte als auch Atmosphäre und Service stimmen.
Wenn beide nahezu perfekt sind, sind viele Kunden bereit, dafür auch etwas mehr zu bezahlen. Das heißt, solche Anbieter können eine Preisprämie erzielen.
Ein schlechter Service kann einem den Spaß an den besten Produkten verderben. Umgekehrt kann selbst der beste Service ein unzulängliches Produkt nicht retten. Beide müssen ein gewisses Mindestniveau haben, um akzeptiert zu werden.
Wo immer die Angebote aus Kundensicht auf vergleichbarem Niveau sind, macht die Art, wie die Leistungen erbracht werden, den Unterschied. Das gilt auch in den zahlreichen Fällen, wo der Kunde die Qualität der Produkte nicht beurteilen kann – also etwa bei vielen technischen Produkten, aber auch bei Finanzdienstleistungen.[16]
Nur wenn ein Produkt für die Kunden außergewöhnlich attraktiv ist, tritt die Art, wie die Leistung erbracht wird, in den Hintergrund: Dann werden auch Unfreundlichkeit, schlechter Service etc. von der Attraktivität des Produktes „überstrahlt“. Aber das kann sich später rächen, wenn die Produkte eines Tages ihre Sonderstellung verloren haben.
Unternehmenskultur ist kein Ersatz für gute Produkte oder Leistungen, sondern deren notwendige Ergänzung. Bei vergleichbaren Produkten oder Dienstleistungen macht Kultur den Unterschied.
1.3 Kostenfaktor Unternehmenskultur
Doch Unternehmenskultur hat nicht nur Einfluss auf den Erfolg im Markt, sondern auch auf die Kosten: Sie bestimmt maßgeblich den „Wirkungsgrad“ eines Unternehmens mit, also die Frage, welcher Teil der aufgewandten und bezahlten Arbeitszeit in Wertschöpfung umgesetzt wird und welcher Teil als nutzlose „Abwärme“ durch den Kamin geht. Wobei Wertschöpfung letztlich nur das ist, wofür der Kunde Geld zu bezahlen bereit ist.
Ein Wirkungsgrad von 100 Prozent ist vermutlich, genau wie in der Technik, unerreichbar: Ein bisschen Abwärme hat man immer. Doch ist es ein gewaltiger Unterschied, ob die Reibungsverluste bei 20, 50 oder 80 Prozent liegen: Im ersten Fall braucht man 125 Prozent Aufwand, um eine Wertschöpfung von 100 Prozent zu erzielen, im zweiten Fall 200 und im dritten 500 Prozent.
„Reibungsverluste“ (oder „Verschwendung“ im Sinne des Lean Management) sind letzten Endes alle Aktivitäten, die dem Kunden keinen Nutzen bringen und für die er infolgedessen auch nicht zu bezahlen bereit ist – jedenfalls nicht, wenn er im Markt eine Alternative findet. Dazu zählen alle Aufwände, die nicht zwingend erforderlich sind, um das gewünschte Produkt herzustellen bzw. die in Auftrag gegebene Leistung zu erbringen, also letztlich alle unnötigen oder kontraproduktiven Aktivitäten, gleich ob sie in der Fabrik, in der Verwaltung oder im Management stattfinden.[17]
Im Einzelfall kann man zuweilen darüber streiten, welche Aufwände erforderlich sind und welche nicht. Ein gewisses Maß an Administration muss sicherlich sein, auch wenn es dem Kunden keinen direkten Nutzen bringt: Es ist notwendig, um einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, denn wenn ein Betrieb beispielsweise seine Kosten nicht nachhält, ist er auch nicht dazu in der Lage, sie aktiv zu managen. Das Gleiche gilt für Führungsaufwand, für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, für Marketing und Vertrieb, für Personalverwaltung und -entwicklung und letztlich für sämtliche Funktionen, die nur „indirekt produktiv“ sind, also dadurch, dass sie die Produktivität der direkt produktiven Funktionen steigern oder überhaupt erst ermöglichen.
Wo die Grenze zwischen notwendiger Administration und übertriebener Bürokratie liegt, lässt sich analytisch kaum bestimmen. Die Erfassung von Kosten ist sicherlich notwendig, doch je akribischer man sie betreibt, desto fraglicher ist, ob das noch einen Mehrwert für den Kunden hat. Ähnlich ist es mit der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Sie ist zwar nur indirekt wertschöpfend, aber dennoch zwingend erforderlich, um eine funktionierende Wertschöpfung zu gewährleisten. Aber was ist, wenn ständig neue Mitarbeiter eingearbeitet werden müssen, weil die Fluktuation so hoch ist?[18]
Letztlich entscheidet der Wettbewerb, wo die Grenze liegt: Sofern die Fluktuation bei den Wettbewerbern auch so hoch ist, weil bislang niemand in dieser Branche einen Weg gefunden hat, sie einzudämmen, dann wird der Kunde die Kosten dafür wohl oder übel tragen müssen, wenn er das Produkt oder die Leistung haben möchte. Wenn aber auch nur ein einziger Anbieter geringere Einarbeitungskosten hat, etwa weil bei ihm die Arbeitsbedingungen oder das Betriebsklima besser sind, dann haben seine Konkurrenten kaum noch die Möglichkeit, ihre Mehrkosten auf den Kunden abzuwälzen, weil der eine günstigere Alternative hat. Sie bleiben also bei den Unternehmen hängen und mindern ihre Profitabilität.
Nicht nur auf die Attraktivität für die Kunden hat die Unternehmenskultur Einfluss, sondern auch auf den „Wirkungsgrad“ eines Unternehmens und damit auf seine Kostenposition. Interne Reibungsverluste übersetzen sich direkt in Kostennachteile; eine besonders produktiv zusammenarbeitende Kultur schlägt sich unmittelbar in einem höheren Wirkungsgrad und damit in höheren Erträgen nieder.
1.4 Kultur versus Strukturen, Prozesse und Systeme
Natürlich ist die Unternehmenskultur nicht das Einzige, was Einfluss auf den Wirkungsgrad und damit auf die Produktivität hat. Eine zentrale Rolle spielen auch Prozesse, Systeme und Strukturen: etwa, ob die Aufbauorganisation Komplexität reduziert und frei von unnötigen Schnittstellen ist, ob die Abläufe effizient sind und keine unnötigen Arbeitsschritte enthalten und ob sie dort, wo es sinnvoll ist, von IT und anderen technischen Systemen unterstützt werden. Doch die Prozesse und Strukturen sind heute in den meisten Unternehmen optimiert, deshalb ist die Unternehmenskultur das letzte große Potenzial für Produktivitätssteigerungen.[19]
Zugleich hat die Kultur einigen Einfluss darauf, ob Systeme und Prozesse wirklich funktionieren. Denn der bestdurchdachte Prozess nützt nicht viel, wenn ihn die Mitarbeiter eher als unverbindliche Anregung verstehen denn als verpflichtende Vorgabe. Und die schönste Kundendatenbank und das tollste CRM-System sind nutzlos, wenn die Mitarbeiter dort nur das Allernötigste eingeben und die Daten nicht auf dem neuesten Stand halten.
Offenbar besteht also zwischen den Systemen und Prozessen auf der einen Seite und der Unternehmenskultur auf der anderen eine Wechselbeziehung: Die optimierten Systeme und Prozesse erbringen ihren vollen Nutzen nur dann, wenn sie „von der Kultur angenommen“ und ernst genommen werden. Umgekehrt kann eine engagierte, zupackende Kultur zuweilen das Schlimmste verhindern, wenn Prozesse instabil sind und die Systeme nicht so funktionieren, wie sie sollen.[20]
Ähnliches gilt auch für die Organisationsstruktur: Zuweilen funktionieren Unternehmen nicht wegen, sondern trotz ihrer Strukturen, und zwar deshalb, weil engagierte Mitarbeiter auf dem kleinen Dienstweg kurzfristig zuwege bringen, was auf dem offiziellen Weg entweder gar nicht möglich wäre oder Wochen dauern würde. Andererseits können Strukturen auch an der Kultur scheitern – etwa, wenn in einer bislang ausgeprägt dezentralen Organisation versucht wird, die Steuerung des Geschäfts auf die Zentrale zu verlagern. Dann finden sich die neuerdings der Zentrale unterstellten Mitarbeiter zwar zu Meetings und Videokonferenzen mit der Zentrale ein und nehmen dort ihre Direktiven entgegen, richten sich in der Praxis aber weiterhin nach dem, was ihr alter Chef vor Ort sagt.
In vielen Fällen kann man förmlich dabei zuschauen, wie dysfunktionale Verhaltensmuster die Reibungsverluste nach oben treiben. Wenn zum Beispiel Fehler vertuscht werden, steigen die Folgekosten mit jedem Schritt an, den das fehlerhafte Produkt unerkannt weiterbearbeitet wird, bis sie schließlich ein Vielfaches des ursprünglichen Schadens ausmachen (s. Kapitel 29).
Kultur ist der letzte verbleibende Hebel zur Produktivitätssteigerung, wenn Strukturen, Prozesse und Systeme optimiert sind. Sie entscheidet darüber, ob Prozesse und Strukturen „gelebt“ oder umgangen werden, bestimmt aber auch, wie eine Organisation funktioniert, wenn Strukturen und/oder Prozesse nicht optimal sind.
Kulturveränderung versus Kulturwandel
[21]Der Begriff „Kulturwandel“ wird häufig gleichbedeutend mit Kulturveränderung verwendet: „Die Deutsche Bank/VW/Siemens braucht einen grundlegenden Kulturwandel.“ Das kann man so machen, schließlich haben Begriffe keine wahre oder falsche Bedeutung, sondern einfach die, die man ihnen zuschreibt.
Ich halte es jedoch für zweckmäßiger, die Begriffe zu unterscheiden. „Wandel“ nenne ich Entwicklungen, die sich unbeabsichtigt, ungeplant und ungesteuert (wenn auch nicht ohne unser Zutun) ergeben: Wertewandel, Klimawandel etc. Den Begriff „Veränderung“ hingegen verwende ich für Entwicklungen, die beabsichtigt und (mehr oder weniger) gesteuert zustande kommen (was wiederum nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie genau so verlaufen sind, wie sie beabsichtigt waren, denn das kommt in sozialen Systemen eher selten vor).
Der entscheidende Unterschied liegt in der Intentionalität, also in der Frage, ob die eingetretenen Entwicklungen gewollt und beabsichtigt waren. Kulturen verändern sich ständig; das gilt sowohl für Unternehmen und Verwaltungen wie auch für ganze Gesellschaften und ihre Subkulturen. Aber die allermeisten dieser Entwicklungen sind weder beabsichtigt noch die Folge gezielter Interventionen. Zuweilen sind sie jedoch die ungewollte Nebenwirkung von Interventionen, die eigentlich ganz anderen Zwecken dienen sollten – wie wir in Kapitel 8 am Beispiel der Hartz-IV-Gesetze sehen werden.
In diesem Buch interessiert uns in erster Linie die gewollte Kulturveränderung, also die Frage, wie man eine Unternehmenskultur gezielt und systematisch in die gewünschte Richtung weiterentwickeln kann. Weil man aber aus unbeabsichtigten Veränderungen viel über die wirklichen Treiber einer Kulturveränderung lernen kann, schauen wir uns den „Kulturwandel aus Versehen“ im Abschnitt 8.3 genauer an.[22]
Paradoxerweise gelingen Kulturveränderungen häufiger ungewollt als mit Absicht: Allzu häufig scheitern gewollte Veränderungen, während sich in anderen Fällen die Kultur verändert, obwohl dies gar nicht beabsichtigt war – wenn auch oft in die völlig falsche Richtung.
Streng genommen müsste man eine dritte Kategorie bilden, nämlich die der „folgenlosen Proklamationen“. In die fallen all jene Kulturveränderungen, die trotz hehrer Absichten und großer Ankündigungen niemals zustande kamen. Warum derartige Programme so häufig scheitern, verdient ebenfalls Aufmerksamkeit, schon um nicht in die gleiche(n) Falle(n) zu geraten. Denn manche Fehler wurden schon so häufig wiederholt, dass kein zusätzlicher Erprobungsbedarf besteht. Deshalb widmen wir dieser Frage das gesamte Kapitel 7.
1.5 Kulturveränderung als strategische Anpassung – die Perspektive dieses Buchs
Schwerpunkt dieses Buchs ist nicht die Betrachtung und Analyse von Unternehmenskultur, sondern deren Veränderung: Dem Thema Kulturveränderung ist nicht nur der umfangreiche zweite Teil – das Herzstück dieses Buches – gewidmet, sondern auch wesentliche Teile des dritten, der sich als „Besonderer Teil“ mit speziellen Fragen von Unternehmenskultur und Kulturveränderung befasst. Doch für jede Kulturveränderung braucht man ein solides Grundverständnis, was Unternehmenskultur ist und wie sie funktioniert, und darum geht es in den vier Kapiteln des ersten Teils.[23]
Mein übergeordnetes Anliegen ist, Unternehmenskultur und Kulturveränderung aus der Aura des Geheimnisvollen, Rätselhaften, geradezu Mystischen herauszuholen. Ich will in diesem Buch zeigen, dass man Kultur und Kulturveränderung sowohl rational als auch intuitiv gut verstehen kann, wenn man sich ihnen aus der richtigen Perspektive nähert.
Diese „richtige Perspektive“ ist nach meiner Überzeugung, Unternehmenskultur im verhaltensökologischen Sinn als Anpassung zu verstehen, und zwar im doppelten Sinne: Zum einen als die Anpassung des Unternehmens an die „ökologische Nische“, die es in seinem jeweiligen Markt einnimmt; zum anderen als Anpassung der Organisationsmitglieder, vom Werker bis zum Vorstand, an das „Biotop“, das ihr Unternehmen für sie darstellt.
Dieses Verständnis von Unternehmenskultur als Anpassungsleistung liefert auch den Schlüssel zur Kulturveränderung: Wenn die Bedingungen eines „Lebensraums“ sich ändern, passen die Lebewesen, die ihn bewohnen, ihr Verhalten relativ schnell an diese veränderten Bedingungen an. Wer eine Kultur verändern möchte, muss daher im Grunde „nur“ die Bedingungen verändern, unter denen die Organisationsmitglieder ihre jeweiligen Ziele erreichen.
Anpassung an sich ändernde Bedingungen
Damit eine Kulturveränderung jedoch eine bessere Anpassung bewirkt, darf ihre Richtung nicht willkürlich sein, sondern muss sich an den Anforderungen von Markt und Wettbewerb und an den Erfolgsfaktoren der eigenen ökologischen Nische ausrichten.[24]
Das heißt in der Konsequenz: Kulturveränderung muss von einer strategischen Perspektive geleitet sein. Weder das Entwerfen idyllischer Idealbilder durch idealistische Projektgruppen noch die Dekretierung ihrer Wunschkultur durch neue Vorstände bietet die Gewähr für eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Aber wenn Unternehmenskultur ohnehin eine Anpassung an die ökologische Nische ist, die ein Unternehmen in seinem Markt einnimmt, warum kann dann überhaupt eine Kulturveränderung erforderlich werden?
Weil Märkte und Wettbewerbsbedingungen sich zuweilen schneller wandeln als Unternehmenskulturen, gerade wenn es stolze, erfolgreiche Kulturen sind. Je länger ein Unternehmen mit seiner Art, das Geschäft zu betreiben, erfolgreich war, desto schwerer tut es sich, seine fest verwurzelten Annahmen und Überzeugungen infrage zu stellen. So kann im Laufe der Zeit eine wachsende Diskrepanz zwischen Marktanforderungen und kulturbedingten Einstellungen und Gewohnheiten entstehen, die das Unternehmen angreifbar macht durch besser angepasste Wettbewerber.
Die Kräfte von Mutation und Selektion wirken auch in der Wirtschaft und sorgen dafür, dass sich die jeweils am besten angepassten Varianten durchsetzen. Durch eine intelligente Kulturveränderung, die sich an den aktuellen Markt- und Wettbewerbsbedingungen ausrichtet, können Unternehmen sich sozusagen „aktiv mutieren“ und auf diese Weise kulturell verjüngen. So können sie verhindern, von der Selektion des Marktes als obsoletes Modell aussortiert zu werden, und aktiv dafür sorgen, eine erfolgreiche Vergangenheit durch intelligente Anpassung in eine erfolgreiche Zukunft fortzuschreiben.[25]
In diesem Buch geht es in erster Linie um Kulturveränderung, und zwar um eine, die aus einer strategischen Perspektive aktiv für eine bessere Anpassung an die veränderten Bedingungen von Markt und Wettbewerb sorgt.
Resümee
Je ähnlicher sich Produkte und Dienstleistungen werden, desto wichtiger wird die Kultur eines Unternehmens für dessen Erfolg: Zum einen bestimmt sie maßgeblich mit, wo es die Kunden vorziehen zu kaufen, zum anderen hat sie erheblichen Einfluss auf die interne Effizienz eines Unternehmens und damit auf dessen Kostenposition. Nachdem Strukturen und Prozesse inzwischen in vielen Unternehmen optimiert sind, bietet die Kultur das letzte große Potenzial sowohl für Produktivitätssteigerungen als auch für das Erringen von Wettbewerbsvorteilen.
Der Fokus dieses Buches liegt nicht bei der Betrachtung und Analyse von Unternehmenskultur, sondern bei deren gezielter Veränderung. Sie muss sich konsequent an den Anforderungen von Markt und Wettbewerb ausrichten, also einen klaren strategischen Fokus haben.
Teil I
Teil I: Was Unternehmenskultur ist, wie sie entsteht und wie sie sich auswirkt
Vorschau
In diesem ersten Teil geht es noch nicht darum, Unternehmenskultur zu verändern, sondern zunächst darum, sie zu verstehen. Denn für das Verändern einer Kultur ist es ausgesprochen nützlich, wenn man erkannt hat, dass das Verhalten ihrer Mitglieder nicht so irrational und rätselhaft ist, wie es manchmal scheint, sondern seinen Sinn und seine Logik hat – und sich an veränderte Rahmenbedingungen anpasst. Wir holen die Kultur aus der Aura des Geheimnisvollen heraus und sehen uns an, weshalb unterschiedliche Branchen ganz unterschiedliche Kulturen haben, wie sich Kulturen im Laufe ihres Lebenszyklus verändern und welche Rolle Kulturbrüche dabei spielen, aber auch, weshalb jedes Unternehmen aus zahlreichen Subkulturen besteht und welche Konfliktpotenziale sich zwischen ihnen ergeben. Und schließlich beschäftigen wir uns damit, wie eine umfassende Kulturdiagnose aussehen kann.[26]
2 Was ist das überhaupt: Unternehmenskultur?
Jeder hat irgendwie eine Vorstellung davon, was mit „Unternehmenskultur“1 gemeint ist – aber es ist gar nicht so einfach, dieses „Irgendwie“ in klare Worte zu fassen. Zu vielfältig und letztlich zu schwammig sind die Verwendungen dieses Begriffs, zumal die unterschiedlichsten Interpretationen und Ausdeutungen kursieren und immer neue „Bindestrich-Kulturen“ erfunden oder doch zumindest postuliert werden.
Da wird nicht nur eine Qualitätskultur, eine Streitkultur, eine Vertrauenskultur und eine Leistungskultur gefordert, sondern neuerdings auch noch eine Willkommenskultur, eine Dialogkultur, ja sogar eine „Trennungs-Kultur“ (samt Bindestrich; Andrzejewski 2002).[27]
Mit dem Thema Unternehmenskultur kann es einem ergehen wie mit manchen anderen abstrakten Begriffen: Man glaubt, eine klare Vorstellung davon zu haben, aber je mehr man sich müht, sie präzise zu fassen, desto mehr zerfließen sie einem zwischen den Fingern. Für die praktische Arbeit ist es aber notwendig, zu wissen, wovon man spricht, was Unternehmenskultur eigentlich ist und wie sie funktioniert, zumal unterschiedliche Verständnisse von Kultur auch Konsequenzen für das Vorgehen zu deren Veränderung haben.
Dabei geht es nicht in erster Linie um eine Definition, sondern vor allem darum, das Wesen und die innere Logik von Unternehmenskultur zu erfassen. Definitionen sind ja primär eine akademische Übung: Sie helfen, Begriffe sprachlich einzugrenzen und voneinander abzugrenzen, aber sie helfen nicht, Dinge zu verstehen, geschweige denn, ein Gefühl für sie zu bekommen und ihren Kern zu erfassen. Deshalb erschließen sich Definitionen meist nur denjenigen, die mit dem definierten Gegenstand schon vertraut sind; die anderen sind nach der Definition so schlau wie vorher. Sparen wir uns eine praxisorientierte Definition also noch etwas auf und denken erst einmal darüber nach, wie wir Unternehmenskultur in der Praxis eigentlich erfahren und erleben.
2.1 Eine schrittweise Annäherung
Wenn Unternehmenskultur tatsächlich geschäftsrelevant ist, dann kann sie nicht bloß aus so wolkigen Dingen wie „Betriebsklima“, „tief verwurzelten Normen und Werten“ oder „den Geschichten, die man sich erzählt“ bestehen, vielmehr muss sie sich handfest im Alltag bemerkbar machen. Und genau das tut sie auch, und zwar sowohl für diejenigen, die in einem Unternehmen (oder einer Non-Profit-Organisation) arbeiten, als auch für die, die es als Kunden oder Lieferanten von außen erleben.[28]
Also stellt sich die Frage: Wie macht sich Unternehmenskultur im täglichen Leben bemerkbar? Woran spüren Interne wie Externe die Unternehmenskultur und welche praktischen Auswirkungen hat das für sie?
Unternehmenskultur ist,
wenn Sie als Gast in einem Restaurant sofort freundlich begrüßt und von allen Mitarbeitern aufmerksam und zuvorkommend behandelt werden;
wenn Ihnen die Hotline bei einer Reklamation als Erstes erklärt, was Sie falsch gemacht haben und warum der Fehler bei Ihnen liegt;
wenn Sie bei einer Elektronikmarktkette zwar jederzeit Zubehör und Ersatzteile bestellen können, aber von diesen Bestellungen nie wieder etwas hören und auch auf Nachfragen nur hinhaltende Auskünfte erhalten: „Sie werden dann automatisch benachrichtigt!“ (was auf Deutsch so viel heißt wie: „Hör bitte auf, mich zu nerven!“);
wenn Sie in Lautsprecheransagen mit nichtssagenden Begründungen („wegen einer betriebsbedingten Störung“) um Verständnis für Verspätungen oder andere Widrigkeiten gebeten werden;
wenn Sie von einem Händler auch nach dem Kauf noch mit der gleichen Aufmerksamkeit und Sorgfalt betreut werden wie davor;
wenn Sie als Anrufer in einem Unternehmen wie weiland Karl Valentins Buchbinder Wanninger von einer unzuständigen Stelle zur nächsten unzuständigen Stelle weiterverbunden werden, bis Sie schließlich die Empfehlung erhalten, doch am anderen Tag oder im nächsten Jahr noch mal anzurufen;[29]
wenn Sie als Lieferant nach allen Regeln der Kunst geknechtet und geknebelt und dazu entwürdigend behandelt werden;
wenn Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung telefonisch nach den Öffnungszeiten fragen und die Auskunft erhalten: „Eigentlich haben wir in zehn Minuten Mittag, aber wenn Sie gleich noch vorbeikommen wollen, dann warte ich solange auf Sie!“
Doch nicht nur Kunden und Lieferanten bekommen die Unternehmenskultur zu spüren, sondern auch die Mitarbeiter, gleich ob sie kleine Angestellte sind oder in der Führungsetage sitzen. Für sie macht sich Unternehmenskultur zum Beispiel bemerkbar,
wenn alle spürbar auf ein übergeordnetes Ziel hinarbeiten, wenn jeder auf seinem Platz das Notwendige tut und sich die Kollegen gegenseitig nach Kräften unterstützen;
wenn der Platz in der Ablage vorne und hinten nicht ausreicht, weil Mitarbeiter und Führungskräfte selbst die kleinsten Vorgänge akribisch dokumentieren und archivieren, damit ihnen nicht irgendwann irgendwer einen Strick daraus drehen kann, dass sie angeblich einen Fehler gemacht hätten oder sich ein Versäumnis zuschulden kommen ließen;
wenn hierarchie- und funktionsübergreifend temperamentvoll, aber sachbezogen um die beste Lösung gestritten wird – und wenn man sich darauf verlassen kann, dass alle Argumente auf den Tisch kommen und die getroffene Entscheidung hinterher mit vereinten Kräften in die Tat umgesetzt wird;[30]
wenn sich die Gruppenleiter- und Meisterebene keine Kritik an der Arbeit ihrer Mitarbeiter auszusprechen traut, weil sie Angst hat, dass die Mitarbeiter sich sofort beim Betriebsrat beschweren und sie bei der daran anschließenden Auseinandersetzung von ihren Chefs im Regen stehen gelassen werden;
wenn die mittleren Führungsebenen den Entscheidungen des Top-Managements selbst dann nicht widersprechen, wenn sie offenkundig falsch sind und gravierende Probleme nach sich ziehen werden;
wenn das Top-Management regelmäßig die Absicherungsmentalität im Hause beklagt und mehr Risikobereitschaft fordert, aber äußerst unwirsch auf Fehler reagiert;
wenn zwischen zwei Ressorts oder Abteilungen ein anhaltender Stellungskrieg stattfindet und jede Seite versucht, zulasten der „Bremser und Blockierer“ auf der anderen Seite vollendete Tatsachen zu schaffen;
wenn jeder Mitarbeiter weiß, was sein Vorgesetzter, seine Kollegen und seine internen Kunden von ihm erwarten, und ein klares Bild hat, wo er in Bezug auf diese Erwartungen steht;
wenn spontane Hilfsbereitschaft quer über Ressort- und Abteilungsgrenzen hinweg die Regel ist und nicht die Ausnahme;
wenn bei Problemen nicht nach einer Lösung gesucht wird, sondern nach dem Schuldigen.
Die Beispiele zeigen: Unternehmenskultur hat weit mehr als nur atmosphärische Auswirkungen: Kunden werden, wo immer sie eine Wahl haben, Anbieter bevorzugen, die freundlich, kooperativ und professionell sind. Ähnliches gilt für Lieferanten – besonders für solche, die wegen ihrer starken Marktposition nicht auf jeden Auftrag angewiesen sind.[31]
Talentierte Mitarbeiter werden sich entweder, wenn sie genügend Einblick haben, von vornherein für eine konstruktive, leistungsorientierte Kultur entscheiden, oder sie werden früher oder später abwandern und sich ein Umfeld suchen, in dem sie ihre Fähigkeiten entfalten können, statt sich in internen Machtkämpfen und Ränkespielen zu verzehren.
Und schließlich wird der „Output“ einer kooperativ-leistungsorientierten Kultur sowohl quantitativ als auch qualitativ deutlich höher sein als der einer Firma, in der Absicherung und Risikovermeidung das oberste Gebot ist. Das heißt in der Konsequenz: Eine „gute“ Kultur ist ein Wettbewerbsvorteil, und zwar einer, der, wie man es in der Strategie nennt, „verteidigungsfähig“ ist, weil Wettbewerber ihn nicht ohne Weiteres kopieren können.
Spürbar und erlebbar wird Unternehmenskultur einfach darin, wie ein Unternehmen sich gegenüber Kunden, Lieferanten, der Öffentlichkeit und gegenüber den eigenen Mitarbeitern verhält: Ob es ihnen freundlich oder desinteressiert gegenübertritt, ob es kooperativ oder hauptsächlich auf den eigenen Vorteil bedacht ist und vieles andere mehr. Eine „gute“ Kultur ist ein verteidigungsfähiger Wettbewerbsvorteil.
2.2 Kernelemente von „Unternehmenskultur“
Jetzt, wo wir ein Gefühl für die Auswirkungen von Unternehmenskultur haben, können wir uns an eine Definition wagen. Eine gute Definition soll zweierlei leisten: Erstens soll sie abgrenzen, das heißt, sie soll unterscheiden, was unter den Begriff fällt und was nicht, und zweitens soll sie erklären, das heißt sie soll Wesensmerkmale des Definierten benennen und ein Erfassen und Akzeptieren der Definition ermöglichen.[32]
Hier drei Definitionsangebote, die nach meinem Verständnis nicht konkurrieren, sondern sich ergänzen:
Edgar H. Schein, der Nestor der amerikanischen Organisationskulturforschung, definiert: „Kultur ist die Summe aller gemeinsamen und selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe im Laufe ihrer Geschichte erlernt hat. Sie ist der Niederschlag des Erfolgs“ (Schein, 2003).
Der deutsche Kulturberater Michael Löhner, ein langjähriger Schüler des Philosophen Rupert Lay S. J., definiert Kultur knapp und beinahe flapsig: „Kultur ist die Summe der Gewohnheiten einer Organisation.“
Mein eigenes Definitionsangebot lautet: „Kultur ist die ‚Persönlichkeit’ eines sozialen Systems, das heißt die Art, wie es auf die großen und kleinen Fragen des Lebens antwortet. Sie ist das Resultat der Entscheidungen, die dieses System im Laufe seiner Entwicklung in Reaktion auf kritische Erfahrungen getroffen hat.“
Nimmt man diese drei Komponenten zusammen, kristallisieren sich drei Elemente heraus, die für das Verständnis von Unternehmenskultur zentral sind:
Geschichte/Erfahrung;
Lernen/Entscheidungen;
Überzeugungen/Gewohnheiten/„Charakter“.[33]
Wenn wir verstanden haben, wie diese drei Elemente zusammenwirken, sind wir dem Wesen der Unternehmenskultur ein ganzes Stück näher.
Der Zusammenhang ist so: Im Laufe seiner Geschichte macht ein soziales System – gleich ob es ein Wirtschaftsunternehmen, eine Behörde oder eine soziale oder politische Organisation ist – vielfältige Erfahrungen. Insbesondere erlebt es, welche Aktionen positive und welche negative Konsequenzen nach sich ziehen. Aus diesen Erfahrungen lernt es.
Das ist jedoch kein passives Lernen im Sinne einer bloßen Konditionierung, vielmehr findet – zuweilen unter heftigen Debatten – eine gemeinsame Interpretation und Bewertung der gemachten Erfahrungen statt. Auf Basis dieser Bewertungen trifft die Organisation Entscheidungen, wie sie künftig handeln und was sie vermeiden will („Nie wieder machen wir Geschäfte auf der Basis von XY!“).
Diese Entscheidungen können sehr bewusst und explizit getroffen werden, aber auch unausgesprochen und weitgehend unbewusst sein. So oder so münden sie in bestimmte Grundannahmen und Überzeugungen, die das Verhalten des Unternehmens prägen: Das ist mit Gewohnheiten gemeint. Deren Gesamtheit macht die Persönlichkeit oder den Charakter des sozialen Systems aus, also die Art, wie es auf die großen und kleinen Fragen des Lebens antwortet.
Auf den ersten Blick klingt Michael Löhners „Summe der Gewohnheiten“ recht unscharf und willkürlich. Unscharf, weil es viele Gewohnheiten gibt, die nicht allzu viel über eine Unternehmenskultur aussagen, wie zum Beispiel die Gewohnheit, an Schreibtischen zu sitzen oder Telefone zu benutzen. Von daher ist es genauer, die Definition auf Kosten ihrer Prägnanz etwas zu präzisieren: „... die Menge der Gewohnheiten, in denen sich ein Unternehmen von seiner Umgebung unterscheidet.“[34]
Als zu eng und willkürlich könnte man Löhners Definition empfinden, weil Gewohnheiten ja nicht zufällig zustande kommen, sondern ihre tieferen Ursachen haben: Annahmen, Einstellungen, Überzeugungen, Werte, eine „Philosophie“, ein Menschenbild oder was auch immer.
Aber das steht überhaupt nicht im Widerspruch zu dieser Definition. Natürlich haben die herrschenden Gewohnheiten Gründe, Hintergründe und vor allem eine Vorgeschichte, aus der sie entstanden sind. Dennoch ist es im Geschäftsverkehr allein das Verhalten, das den Unterschied macht, und nicht, welche Gründe dahinterstehen oder dafür vorgebracht werden. Und „Gewohnheiten“ sind ja letztlich nichts anderes als ein regelmäßig auftretendes Verhalten.
Dieses typische Verhalten bestimmt, welche Emotionen, Bewertungen und Reaktionen ein Unternehmen auslöst: wie es von außen wahrgenommen wird und wie es sich von innen anfühlt. Zugleich bestimmt dieses Verhalten auch, welches „soziale Echo“ es bewirkt und welche neuen Erfahrungen das Unternehmen macht. Wenn sie positiv sind, wirken sie als Bestätigung, dass man die Realität richtig sieht und in optimaler Weise agiert; unerwartete oder unerwünschte Reaktionen können neue Lernprozesse in Gang setzen, neue Entscheidungen auslösen und die Kultur so in die eine oder die andere Richtung weiterentwickeln.[35]
Unternehmenskultur lässt sich definieren als die Menge der Gewohnheiten, in denen sich ein Unternehmen von seiner Umgebung unterscheidet. Dahinter steht die gesamte Lerngeschichte des Unternehmens, das heißt die Erfahrungen, die es gesammelt, und die Entscheidungen, die es daraufhin getroffen hat, sowie die Grundannahmen, die ihm daraus in Fleisch und Blut übergegangen sind: Sie verdichten sich zu der „Persönlichkeit“ oder dem „Charakter“ eines Unternehmens.
Das Drei-Ebenen-Modell der Unternehmenskultur von Ed Schein
Das bekannteste Kultur-Modell stammt von dem amerikanischen Psychologen Edgar H. Schein, dem Nestor der Unternehmenskultur-Forschung. Er unterscheidet drei Ebenen, wie sich Unternehmenskultur äußert: Die oberste Ebene ist die der Artefakte („artifacts“), darunter liegt die der erklärten Überzeugungen und Werte („espoused beliefs and values“) und ganz zuunterst die Ebene der zugrunde liegenden Grundannahmen („basic underlying assumptions“).
Am leichtesten zu erkennen und beobachten sind die Artefakte. Das sind die Ausdrucksmerkmale einer Kultur, die man als Beobachter unmittelbar wahrnehmen und erleben kann: etwa das Mobiliar, das Erscheinungsbild von Gebäuden, Arbeits- und Repräsentationsräumen und Kantinen, aber auch der Umgang der Mitglieder einer Kultur sowohl untereinander als auch mit Außenstehenden, ihre Arbeitsweise, ihre Strukturen und Prozesse. Das Problem mit den Artefakten ist nur: Man kann sie zwar leicht sehen, aber nicht ohne Weiteres verstehen. So gut man sie beobachten kann, so schwer sind sie zu interpretieren.[36]
Die erklärten Überzeugungen und Werte spiegeln sich sowohl in offiziellen Dokumenten wie Visionen, Strategien, Leitbildern und Führungsgrundsätzen als auch in den ungeschriebenen Merksätzen und informellen Regeln, in denen sich die Lebenserfahrung des sozialen Systems niedergeschlagen hat: „Ober sticht Unter.“ – „Gehe nie zu deinem Fürst/wenn du nicht gerufen wirst.“ – „Gieße nie einen Eimer nach oben aus!“, aber auch in regelmäßig wiederkehrenden Fragen und Ermahnungen wie: „Ist diese Vorlage abgestimmt?“ Nach Schein helfen diese Werte und Regeln, Unsicherheit zu reduzieren und Orientierung zu geben. Das Problem mit ihnen ist nur: Man kann sich nie sicher sein, ob sie tatsächlich handlungsleitend sind oder ob sie nur gepredigt werden.
Bei den Grundannahmen ist es genau umgekehrt wie bei den Artefakten: Sie erklären alles, aber man kommt ausgesprochen schwer an sie heran. Denn sie sind den Mitgliedern einer Kultur zum Großteil selbst nicht bewusst, weil sie im Laufe der Zeit zu unreflektierten Selbstverständlichkeiten abgesunken sind. Das sind die unausgesprochenen Axiome einer Kultur, die nicht diskutiert und auch kaum artikuliert werden, weil sich darüber zu reden nicht lohnt: „So ist es einfach, was soll man da lange erklären.“ Da sie integraler Bestandteil des Welt- und Menschenbildes sind, sind sie überaus schwierig zu verändern, lehrt Schein – womit er höchstwahrscheinlich recht hat.[37]
Scheins Drei-Ebenen-Modell ist erkennbar von der Kulturanthropologie geprägt: So könnte man sich einem neu entdeckten Naturvolk nähern, dessen Sitten und Gebräuche man nicht kennt und dessen Welt- und Menschenbild einem völlig fremd ist. Wie bei den Hinterlassenschaften der Inkas würden wir staunend die „Artefakte“ besichtigen, ohne ihren Sinn und Nutzen zu verstehen (und sie dann ebenso hilflos wie erkenntnisfrei als „Kultgegenstand“ einstufen). Wenn wir mit diesen Menschen sprechen könnten, würden wir beeindruckt ihren Werten und Überzeugungen lauschen, hätten aber größte Mühe, zu ihren Grundannahmen und ihrem wirklichen Welt- und Menschenbild vorzudringen.
Hier setzt auch die Kritik an Scheins Modell an: Es macht Unternehmenskulturen rätselhafter, als es sein müsste. Denn die Kulturen, mit denen wir es zu tun haben, gehören ja nicht zu Wesen von einem anderen Stern. Es sind Angehörige unserer eigenen Kultur, in die wir uns sehr viel besser eindenken und einfühlen können als in einen Amazonas-Stamm, der noch nie Kontakt mit der westlichen Zivilisation hatte.
Wir können die innere Logik ihres Denkens und Handelns sehr wohl verstehen, wenn wir einfach dem Leitgedanken folgen, dass ihr Handeln aus ihrer subjektiven Sicht Sinn ergibt. Dann können wir aus ihrem Handeln sowohl erschließen, welche Ziele sie verfolgen, als auch, von welchen Grundannahmen über die Welt und über andere Menschen sie auszugehen scheinen.[38]
2.3 Kultur gibt Orientierung und Sicherheit – manchmal zu viel
Daraus ergibt sich im Übrigen auch, dass eine Unternehmenskultur kein starrer Zustand ist, der unabänderlich in eine Firma eingraviert ist. Jede Kultur ist – wenigstens im Prinzip – ständig in Bewegung, wenn auch in einer langsamen. Denn ein Unternehmen macht ja immer wieder neue Erfahrungen, die Lernprozesse auslösen und in neue Schlussfolgerungen münden können. Ständig werden Erkenntnisse und Erfahrungen ausgewertet, und es werden Ableitungen für das künftige Handeln vorgenommen, die in die bestehenden Gewohnheiten integriert werden: Die Kultur entwickelt sich weiter.
Kommt ein Unternehmen aufgrund neuer Erfahrungen zu dem Schluss, dass sein Vorgehen nicht zum angestrebten Ziel führt, kann es daraus Lehren ziehen. So entstehen neue Einstellungen und Gewohnheiten. Hat es hingegen über längere Zeit Erfolg und kann es sich in seinen Märkten etablieren, Marktanteile gewinnen oder gar eine dominierende Position erringen, trägt dies zur Verfestigung der bestehenden Denk- und Verhaltensgewohnheiten bei.
Im Laufe der Jahre entsteht so ein gemeinsamer Sockel von Grundüberzeugungen, wie das Geschäft funktioniert und wie man, um erfolgreich zu sein, mit dem Markt und den Wettbewerbern, den Kunden und Lieferanten und nicht zuletzt mit den eigenen Leuten umgehen muss.
Dieses gemeinsame Weltbild hat einen dreifachen Nutzen: Erstens liefert es Orientierung, wie man sich in den zahllosen Entscheidungssituationen des Alltags zu verhalten hat. Man muss also nicht jede Situation von Grund auf neu analysieren und bewerten, sondern besitzt effiziente Routinen: Man weiß die unterschiedlichsten Anforderungen zu beurteilen und mit ihnen umzugehen.[39]
Zweitens sorgt es für ein gemeinsames Verständnis im Denken und Handeln, was das Zusammenspiel ungemein erleichtert – man versteht sich sozusagen blind und weiß, was die Kollegen tun werden, ohne sich eigens abgesprochen zu haben. Und drittens – diese Funktion ist am wenigsten offensichtlich – gibt dieses gemeinsame Weltbild den Beteiligten Sicherheit: Man weiß, wie die Welt funktioniert, und hat sein (Geschäfts-)Leben im Griff.
„Der Niederschlag des Erfolgs“
Weshalb die spezifische Kultur so tief in sozialen Systemen verwurzelt ist, deutet Ed Scheins unscheinbarer Nachsatz an: „Sie ist der Niederschlag des Erfolgs.“ In der Tat existieren auf der Welt ja nur Unternehmen (und andere Organisationen), die mit ihrer bestehenden Kultur erfolgreich waren oder zumindest überlebt haben. Infolgedessen ist fast jede Firma davon überzeugt, dass ihre Art, das Geschäft zu betreiben, richtig sein muss – und im Grunde die einzig richtige und mögliche. Man kann sie zwar behutsam weiterentwickeln, darf sie aber nicht grundlegend infrage stellen. Denn „wenn wir unser Geschäft nicht verstehen würden, dann gäbe es uns ja schon längst nicht mehr“.
Das klingt einleuchtend, doch bei genauerer Betrachtung ist es nicht so schlüssig, wie es klingt. Denn es unterstellt erstens, dass die Markt- und Wettbewerbsbedingungen unverändert gültig sind, und zweitens, dass sämtliche Einstellungen und Gewohnheiten gleichermaßen für den Erfolg wichtig waren.[40]
Doch so sicher es ist, dass erfolgreiche Unternehmen, die sich über viele Jahre hinweg gehalten haben, irgendetwas richtig gemacht haben müssen, so schwierig ist es zu bestimmen, was genau dieses „Etwas“ war.
Haben tatsächlich sämtliche Annahmen und Gewohnheiten gleichermaßen dazu beigetragen, dass das Unternehmen da steht, wo es heute steht? Oder war es möglicherweise erfolgreich trotz bestimmter Annahmen und Gewohnheiten, die zwar hinderlich sind, seinen Erfolg aber dennoch nicht verhindern (sondern nur einschränken) konnten?
Insofern darf man durchaus bezweifeln, ob alle Dinge, denen Unternehmen ihre Erfolge zuschreiben, tatsächlich so entscheidend waren. Und erst recht, ob die Erfolgsbedingungen der Vergangenheit allesamt auch heute noch gültig sind. Doch wir Menschen neigen dazu, voreilige Kausalitäten zu konstruieren, indem wir das, was zuerst geschehen ist, für die Ursachen dessen halten, was danach eingetreten ist. (Was lange vor der modernen Psychologie schon die alten Römer erkannt und auf die Formel „praeter ergo propter“ gebracht haben: „Vorher, also daher!“)
Gefahr der Realitätsverleugnung
Doch dieses Gefühl von Sicherheit, das uns gemeinsame Annahmen und Überzeugungen vermitteln, ist eine zweischneidige Angelegenheit. Seinetwegen stößt das Lernen aus Erfahrung an Grenzen, wenn die neuen Erfahrungen in allzu hartem Kontrast zu den bestehenden Überzeugungen und Gewohnheiten stehen.[41]
Wenn ein bislang erfolgreiches Unternehmen – zum Beispiel aufgrund veränderter Markt- und Wettbewerbsbedingungen – massive Rückschläge und Misserfolge erleidet, die mit seinen Überzeugungen überhaupt nicht erklärbar sind, dann führt dies oftmals gerade nicht zu einem Lernen und zu neuen Schlussfolgerungen. Vielmehr reagieren Firmen – genau wie Individuen – auf solche Rückschläge häufig mit Beharren, mit einer Verstärkung des bisherigen Erfolgsrezepts („Mehr von Demselben“) und einem Verleugnen der Realität. Denn „was immer richtig war, kann ja nicht auf einmal falsch sein“.
Hinter diesem Beharren auf den oft beinahe trotzig vorgetragenen Überzeugungen muss nicht immer ein übersteigertes Selbstvertrauen oder gar Arroganz stehen – vielmehr steckt dahinter oft die blanke Angst vor dem Orientierungsverlust, die sich einstellen würde, wenn die bisherigen Überzeugungen falsch wären. Denn ohne diese langjährigen Gewissheiten wäre man den Herausforderungen des veränderten Wettbewerbs orientierungslos ausgeliefert, was massive Gefühle von Angst, Hilflosigkeit und Ohnmacht auslösen würde. Deshalb klammern sich Individuen wie Gruppen und Organisationen oft auch dann noch an ihre Überzeugungen, wenn deren Unverträglichkeit mit der Realität eigentlich längst nicht mehr zu übersehen ist.
Oft bewirkt erst eine Krise den Zusammenbruch des bisherigen Weltbilds. Genau diese Weigerung, aus neuen Erfahrungen neue Schlüsse zu ziehen und neue Antworten auf veränderte Realitäten zu geben, ist es, die Unternehmen in existenzbedrohende Schwierigkeiten stürzen und schließlich zu Sanierungsfällen machen kann.[42]
Unternehmenskultur ist nicht statisch, sondern in ständiger, wenn auch langsamer Bewegung, weil immer wieder neue Erfahrungen gemacht, Erkenntnisse gewonnen und Entscheidungen getroffen werden. Doch dieses Lernen aus Erfahrungen stößt oft dann an Grenzen, wenn der Widerspruch zu den bisherigen Überzeugungen und Erfolgsmustern zu groß ist. Wenn dies ihr gesamtes Weltbild infrage stellen würde, neigen Organisationen genau wie Individuen dazu, sich dieser Bedrohlichkeit zu entziehen, indem sie sich auf pseudorationale Erklärungen zurückziehen. Das kann sie in wachsende Schwierigkeiten bringen und schließlich in existenzielle Krisen stürzen.
2.4 Lebenszyklen, Lebensabschnitte und Kulturbrüche
Wenn wir über die Kultur eines Unternehmens nachdenken, denken wir sie fast unweigerlich statisch: Eine Kultur ist wie sie ist. Welche Entwicklungen auch immer dazu geführt haben, dass sie heute so ist, jetzt ist sie jedenfalls so, und das wird, wenn nichts Einschneidendes passiert, auch morgen und nächstes Jahr so sein.
Wir Menschen sind nicht sonderlich gut darin, langsame, graduell verlaufende Entwicklungen wahrzunehmen. Wir sehen weder, wie unsere Kinder groß werden, noch wie sich Wälder und Landschaften über die Jahre verändern. Nur wenn uns Zäsuren zu Hilfe kommen, sind wir dazu in der Lage, langsam verlaufende Entwicklungen zu erkennen. Wenn wir etwa ein Kind oder einen Jugendlichen mit einigem zeitlichen Abstand wiedersehen, springt uns die Veränderung ins Auge: „Bist du aber groß geworden!“[43]