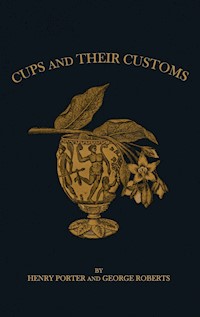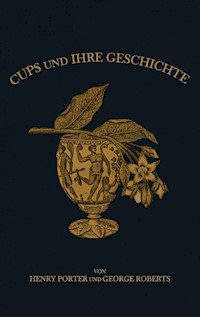
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Verfasser des Buches "Drinking Cups And Their Customs" (1869) waren keine allzu großen Freunde der modernen amerikanischen Trinkkultur; zu stark, zu undurchdacht und vor allem auch viel zu groß waren ihnen diese "Cocktails" von der anderen Seite des Atlantiks. Grund genug also, eine Gegenschrift zu dem sich abzeichnenden Trend zu verfassen und darin die guten alten "Cups" zu preisen und somit hoffentlich vor dem Untergang zu bewahren. Die Autoren Henry Porter und George Edwin Roberts erzählen denn auch recht herzerwärmend und mit viel Sinn für Poesie von den Ursprüngen der Cups. Das Buch enthält neben geschichtlichen Exkursen zudem einige Rezepturen zu handverlesenen Mixturen, die von den Autoren nach eigenem Bekunden mit äußerster Sorgfalt ausgewählt wurden, da diesen nicht nur eine besondere historische Bedeutung zukommt, sie außerdem als außerordentlich schmackhaft gelten. Die Frage, ob die Urheber Porter und Roberts ihr Ziel erreicht und den Cocktails erfolgreich den Kampf angesagt haben, kann jeder leicht selbst beantworten. Ihr Buch jedenfalls hat nun eine Wiederbelebung erfahren, und wer weiß - vielleicht verhilft es ja auch den Cups zu neuer Blüte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Originalausgabe wurde im Jahr 1869 unter dem Titel DRINKING CUPS AND THEIR CUSTOMS (Second Edition) von Henry Porter und George Edwin Roberts im Verlag John Van Voorst veröffentlicht
Bearbeitet und wiederveröffentlicht 2018 durch
Thomas Majhen, Brunnenstraße 42, 10115 Berlin
Umschlaggestaltung: Thomas Majhen
Übersetzung aus dem Englischen: Thomas Majhen
Alle Rechte vorbehalten
CUPS UND IHRE GESCHICHTE.
____________________
„Touch brim! touch foot! the wine is red,
And leaps to the lips of the free;
Our wassail true is quickly said, -
Comrade! I drink to thee!
„Touch foot! touch brim! who cares? who cares?
Brothers in sorrow or glee,
Glory or danger each gallantly shares:
Comrade! I drink to thee!
„Touch brim! touch foot! once again, old friend,
Though the present our last draught be;
We were boys–we are men–we’ll be true to the end:
Brother! I drink to thee!“1
_________________________
ZWEITE AUFLAGE.
LONDON:
JOHN VAN VOORST, PATERNOSTER ROW.
MDCCCLXIX.
PRINTED BY TAYLOR AND FRANCIS,
RED LION COURT, FLEET STREET.
Inhaltsverzeichnis
CUPS UND IHRE GESCHICHTE
HINWEISE ZUR ZUBEREITUNG VON CUPS
ALTE REZEPTUREN
Metheglin
Lamb’s Wool
The Wassail Bowl
MODERNE REZEPTUREN
Punch
Noyau Punch
Gin Punch
Whisky Punch
Milk Punch
Milk Punch, Nr. 2
Regent’s Punch
Cold Milk Punch (Deutsche Rezeptur)
WEIN CUPS
Claret Cup, Nr. 1
Claret Cup, Nr. 2
Claret Cup, Nr. 3
Claret Cup, Nr. 4
Mulled Claret
Burgundy Cup
Hock Cup, Nr. 1
Hock Cup, Nr. 2
Hock Cup, Nr. 3
Hock Cup, Nr. 4
Hock Cup, Nr. 5
Champagne Cup
Moselle Cup, Nr. 1
Moselle Cup, Nr. 2
Moselle Cup, Nr. 3
Moselle Cup, Nr. 4
Moselle Cup, Nr. 5
Cutler’s Moselle Cup
Mulled Port
Mulled Sherry
Sherry Cobbler
Cider Cup
Morgan’s Herefordshire Cup
Donaldson’s Cider Cup
The “Field” Cider Cup
White’s Club House Cup
Loving Cup
Djonka (ein russisches Getränk)
BIER CUPS
Hot Ale Cup
Copus Cup
Donaldson’s Beer Cup
Freemasons’ Cup
Egg Flip
LIKÖRE
Curaçao
Cherry Brandy
Brandy Bitters
Ginger Brandy
Hunting-flask
VORWORT.
__________
DER vornehmliche Zweck dieser Seiten besteht darin, eine Sammlung an Rezepturen zur Zubereitung von gemischten Getränken, in der Fachsprache „Cups“ genannt, darzubieten, welche allesamt unter bedingungsloser Achtung der gastronomischen Regeln und Tugenden vermittels wiederholter Versuche geprüft wurden. Wir sind geneigt unserer Überzeugung Ausdruck zu verschaffen, dass, wenn diese Rezepte allgemein größere Beachtung finden würden, ein großer Teil der heutzutage an Englands Festtafeln vorherrschenden stereotypen Trinkgewohnheiten aufgegeben würden. Dabei waren wir bestrebt die Angelegenheit soweit wie möglich zu vereinfachen, ihre Tauglichkeit auch dem Uneingeweihten durch Hinweise und Bemerkungen zu beweisen, während wir eine reichliche Anzahl moderner Zutaten als ungenießbar oder unwissenschaftlich verworfen haben. Da in diesem Zeitalter des Fortschritts fast alle Dinge zur Wissenschaft erhoben werden, sehen wir keinen Grund, weshalb Bacchanologie2, sofern diese Bezeichnung unseren Lesern gefällig erscheint, nicht ebenfalls ihren gebührenden Platz einnehmen und als deren Trank der Lobpreisung fungieren soll. Nun also haben wir im Zuge der Einführung einen oberflächlichen Blick auf die Gebräuche gewagt, die seit den frühesten Zeitaltern bis heute mit dem Trinken verbunden sind. Jedenfalls haben wir dies nicht als ausführliche Geschichtsschreibung dargelegt, sondern in Form von Schnipseln, wie sie von Zeit zu Zeit unseren Weg gekreuzt und uns dabei geholfen haben, eine Vorstellung der sozialen Gepflogenheiten vergangener Zeiten zu gewinnen.
Für unser Titelbild haben wir einen Zweig Borretsch gewählt, da dieses wohltuende Kraut zur Aromatisierung von Cups sehr von Nutzen ist. Andernorts als in England werden Pflanzen, die zur Aromatisierung dienen, als selten und wertvoll angesehen. Im Osten werden sie gar derart wertgeschätzt, dass sich ein anti-brahmanischer Schreiber, der die Zwecklosigkeit der hinduistischen Glaubensvorstellung darlegt, dazu veranlasst sah zu sagen, „Sie befehligen dir, lebenden und süßen Basilikum abzuschneiden, um damit einen toten Stein zu krönen.“ Unser Gebrauch von aromatischen Kräutern ist das Gegenteil dieses zu Recht verdammten Vorgehens, denn wir pflücken sie, auf dass sie die Herzen erwärmen und das Leben verlängern mögen. Und an dieser Stelle möchten wir bemerken, dass obwohl unsere Bestrebungen darauf gerichtet sind, bessere Zeiten wiederzubeleben als jene, in denen wir leben, Zeiten herzlicher Bräuche und freundlicher Gepflogenheiten, wir keine Wehklage erheben ob des Endes des goldenen Zeitalters, ganz im Geiste von Hoffmann von Fallersleben, der singt:-
„Wann einst die Flaschen größer werden
wann einst wohlfeiler wird der Wein,
dann findet sich vielleicht auf Erden
die goldene Zeit noch einmal ein.
Doch nicht für uns! uns ist geboten
in allen Dingen Nüchternheit –
die goldne Zeit gehört den Toten
und uns nur die papierne Zeit.
Ach! kleiner werden unsere Flaschen
und täglich teurer wird der Wein
und leerer wird's in unseren Taschen
Gar keine Zeit wird bald mehr sein.“
Dies ist weniger der Ruf jener, die leben um zu trinken, als vielmehr derjenige unseres weiseren Ichs, das trinkt um zu leben. In Wahrheit sind wir nicht unempfänglich für die Reize anderer Getränke, sofern sich der Genuss in Maßen hält. Dem Apfel etwa gehört ein Teil unserer Gunst, unserer Aufmerksamkeit auf dichterische Weise empfohlen von einem Poeten aus alter Zeit–
“Preisend und liebkosend, der melodische Phillip sang,
von berühmten Cidre, woraus der erste Lorbeer einst entsprang;“
Mit einem freundlichen Auge haben wir auch stets auf die schäumende Krone eines Porter-Kruges geblickt, unfreiwillig in der alten Strophe lebhaft zum Ausdruck gebracht
“Steige empor, meine Muse, damit die Welt erkennt
den mächtigen Charme dessen, das sich Porter nennt.“
Dabei verspüren wir nicht das kleinste bisschen Eifersucht, die etwa durch die erregende Gunst einer Muse hervorgerufen werden könnte, deren Wirken einzig der Menschheit vorbehalten ist; ein Trunk allerdings, klein und gut, wird aufgrund seiner sozialen und moralischen Qualitäten auf immer unserer größten Neigung gewiss sein.
Obwohl wir schließlich wissen, dass viele unserer Freunde erstklassige Kenner wohltuender Getränke sind, so glauben wird dennoch, dass nur wenige mit deren Entstehung oder Geschichte in vergangener Zeit sonderlich vertraut sind. Sollten daher einige der von uns eingeworfenen Hinweise zur Fröhlichkeit an den Festtafeln beitragen, so wird unser Gekritzel nicht vergeblich gewesen sein. Unser Anliegen ist es insbesondere, diese Nichtigkeiten all jenen guten Seelen zu widmen, die aus Erfahrung wissen, dass unbeirrtes Festhalten am „Schweinsleder“3 und ein ausgelassener Tanz zur Musik eines klingenden Horns oder der Melodie eines fröhlichen Haufens stets den besten Ansporn darstellen, um alle guten Dinge im Leben zu genießen, besonders guten Appetit, gute Kameradschaft und
GUTE GESUNDHEIT.
. . . . . . Und, obschon allein,
nehmen wir einen Schluck
in Gedenken an die vielen fröhlichen
Gelage der Vergangenheit.
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE.
______________
DIE zweite Auflage dieses Buches enthält reichlich zusätzliches Material, das sämtlich mit Hilfe von Notizen eines der ursprünglichen Autoren des Werkes zusammengetragen wurde, dessen vorzeitiger Tod zu betrauern ist und dessen warmherzige Gastfreundschaft von vielen Freunden in Erinnerung behalten werden wird. Der Editor ist davon überzeugt, dass die hinzugefügten Ergänzungen den Nutzen des Buches für alle Liebhaber von Cups außerordentlich zu vermehren imstande ist.
CUPS UND IHRE GESCHICHTE.
______________
. . . . . “Dereinst mögen unsere Namen,
ihren Mündern vertraut wie Worte des Alltags,
in ihren schäumenden Bechern frisch erinnert werden.”
_______________
In allen Ländern und zu allen Zeiten hatte das Trinken als notwendige Institution seinen Platz und so stellen wir fest, dass es ohne Ausnahme mit eigentümlichen Formen und Zeremonien einhergeht. Doch beim Bestreben diese nachzuzeichnen werden wir plötzlich von der Schwierigkeit bedrängt, einen Ausganspunkt zu bestimmen. Würden wir dazu neigen, dem Thema mit Übermut zu begegnen, so hätten wir in den zweifelhaften Machenschaften der Mythologie eine üppige Quelle vorgefertigter Überlieferungen zur Hand und könnten den Nektar der Götter als den allerersten Trank anführen; denn so wird uns gesagt
“Als Mars, der Gott des Krieges, zuerst über Venus nachgedacht,
er Helm und Schild beiseite lag, und sich einen Trunk gemacht.”
Allerdings ist es unsere Intention, auch auf die Gefahr hin, als pedantisch angesehen zu werden, die Gebräuche in mehr greifbarer und realer Form zu behandeln. Würden wir an die Existenz des Präadamiten4 glauben, so böten uns die Zeugnisse, die uns jener in Form von Flint- und Steinwerkzeugen hinterlassen hat, eine kaum brauchbare Lösung in Bezug auf die Trinkgewohnheiten und wären uns auch nicht dabei behilflich, eine Vorstellung seines Seelenlebens zu gewinnen. Wir müssen daher zu einer Zeit unserer Geschichte beginnen
. . . . . . “als Gott beschloss zu schaffen
seinen mächtigen Helden, stark und unvergleichlich,
dessen Trank nur vom klaren Bache stammte.”
Allerdings sehen wir uns nicht dazu veranlasst, hier länger zu verweilen um die Qualität dieses urtümlichen Trunkes zu erörtern, schließlich war „Adams Ale“5 stets ein weltweit anerkanntes Getränk, sogar noch bevor Trinkbrunnen erfunden wurden, und es wird bis zum Ende aller Zeiten die Grundlage jeder anderen trinkbaren Mixtur bleiben. Auch hielt es der Historiker nicht für notwendig, uns über das Gefäß eingehender aufzuklären, aus welchem unser großer Ahnherr seinen klaren Trank zu trinken pflegte, doch legt uns unser gesunder Menschenverstand nahe, dass seine hohle Hand als unmittelbarstes und wahrscheinlichstes Mittel hierfür gedient haben mag. Um den Ursprung von Trinkgefäßen ausfindig zu machen, auf die die Anwendung unseres modernen Wortes „Cup“ gerechtfertigt erscheint, müssen wir eine einzigartige historische Tatsache erörtern, wenngleich diese uns auf einen Umweg führt, obschon es unangemessen wäre, sie zu verschweigen. Wir müssen bis weit in die Antike zurückgehen um die Herkunft des Wortes zu entdecken, insofern seine keltischen Wurzeln bis in ein mythologisches Zeitalter zurückreichen, jedenfalls soweit es die geschriebene Geschichte der Kelten betrifft – aber der barbarische Brauch, von welchem die Bedeutung unserer Pokale oder Kelche herrührt (nämlich jener, Met aus dem Schädel eines erschlagenen Feindes zu trinken) wird durch Chroniken bis in das elfte Jahrhundert hinein belegt. Zu dieser Zeit wurde ein mit Alkohol gefüllter Pokal oder Kelch Skull oder Skoll genannt, wobei es sich um ein Stammwort handelt, das annähernd im isländischen Wort Skal, Skaal und Skylllde, dem deutschen Schale, dem dänischen Skaal und, um unsere eigenen Gestade zu berühren, dem kornischen Skala erhalten geblieben ist. Ale-Kelche wurden im Keltischen als Kalt-skaal bezeichnet; weiterhin besteht dieses Wort in abgewandelter Form als Skiel (ein Bottich) im Schottisch der Highlands fort und wird auf den Orkneys zur Bezeichnung einer Flasche gebraucht. Von dieser Wurzel ausgehend, doch direkter abgeleitet von Scutella, einem gewölbten Gefäß, über das italienische Scodella und das französische Ecuelle (einem Napf), ist unser heimisches Wort Skillet in England noch immer gebräuchlich. In alten Chroniken herrscht kein Mangel an veranschaulichenden Beispielen dieser überaus barbarischen Gewohnheit, den Schädel eines Feindes in einen Trinkbecher umzufunktionieren. Warnefried6 erzählt in seinem Werk „De Gestis Longobard“, “Albin erschlug Cuminum, nahm dessen Kopf und verwandelte ihn in ein Trinkgefäß von der nämlichen Sorte, die bei uns Schala genannt wird.“ Dasselbe wird auch von Livy über die Boii gesagt, von Herodotus über die Skythen, von Rufus Festus über die Scordisci, von Diodorus Siculus über die Gallier und von Silius Italicus über die Kelten. Und so ist es nicht überraschend, dass Ragnar Lodbrok7 sich selbst in seinem Todeslied tröstet, „Möge ich schon bald Ale aus hohlen Bechern gemacht aus Schädeln trinken.“
In etwas späteren Zeiten wie etwa dem Mittelalter finden sich historische Darstellungen für eine neue Verwendung des Wortes, wo Skoll eine andere, aber durchaus ähnliche Bedeutung erfährt. Folglich wird über einen der Anführer der Gowryan-Verschwörung gesagt, „Er trank seinen Skoll auf das Wohl des Herzogs”, was bedeutet, dass das Wohlergehen jenes Edelmanns verpfändet war. Weiterhin lesen wir in Zusammenhang mit einem Festgelage, dass der Scoll weitergereicht wurde; schließlich finden wir bei Calderwood8 eine noch bessere Veranschaulichung, denn er sagt, des Königs Skole zu trinken sei gleichbedeutend mit einer Ehrenbezeugung, wobei es sich um einen Vorgang handelt, der, wie er hinzufügt, stets im Stehen vollzogen werden sollte. In späteren Zeiten jedenfalls wurden Trinkpokale aus vielerlei Materialien gefertigt, welche allesamt, wenigstens in Bezug auf die ursprünglichen Exemplare, eine wünschenswertere und humanere Grundlage besaßen als diejenigen, von welchen wir den Begriff herleiten. Daher wurden über viele Jahrhunderte hinweg Gefäße aus Gold und Silber in jeder erdenklichen Form und Gestalt gebräuchlich, sowohl mit Deckel und Griff als auch ohne.
HANAP ist der Name eines kleinen Trinkbechers aus dem 15. und 16. Jahrhundert, der für gewöhnlich aus vergoldetem Silber gefertigt wurde und auf Füßen stand. Er wurde in Augsburg und Nürnberg hergestellt.