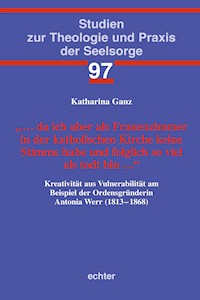
… da ich aber als Frauenzimmer in der katholischen Kirche keine Stimme habe und folglich so viel als todt bin … E-Book
Katharina Ganz
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge
- Sprache: Deutsch
Antonia Werr (1813-1868) gründete 1855 die Kongregation der Dienerinnen der hl. Kindheit Jesu im Kloster Oberzell bei Würzburg und setzte sich für strafentlassene Frauen ein. Indem sie marginalisierten Frauen zu neuen Anfängen verhalf und Rechtlosen eine Stimme gab, brachte sie ihre eigene Stimme in der von patriarchalen Strukturen geprägten Kirche zu Gehör. Im solidarisch-praktischen Handeln, das sich von einer kenotischen Spiritualität der Verwundbarkeit leiten lässt, liegen auch Chancen für eine geschlechtersensible Pastoral in der Gegenwart. Menschen, die sich von den Wunden und Verwundungen ihrer Zeit berühren lassen, werden auch heute Wege finden, trotz struktureller Hindernisse kreativ zu werden und Impulse zu setzen für eine emanzipatorische pastorale Praxis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 854
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katharina Ganz
„… da ich aber als Frauenzimmer in der katholischen Kirche keine Stimme habe und folglich so viel als todt bin …“
Herausgegeben von
Erich Garhammer und Hans Hobelsberger
in Verbindung mit
Martina Blasberg-Kuhnke und Johann Pock
Katharina Ganz
„…da ich aber als Frauenzimmer in der katholischen Kirche keine Stimme habe und folglich so viel als todt bin …“
Kreativität aus Vulnerabilität amBeispiel der OrdensgründerinAntonia Werr (1813 – 1868)
echter
Für Yasilege und alle Menschenkinder,
die – wie das göttliche Kind – am Wegrand geboren werden
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2016 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: ew-print-medien, Würzburg
Satz: Hain-Team (www.hain-team.de)
ISBN 978-3-429-03965-3 (Print)
978-3-429-04871-6 (PDF)
978-3-429-06290-3 (ePub)
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Vorwort
Lage und Zukunft katholischer Ordensgemeinschaften im deutschsprachigen Raum rücken in den letzten Jahren verstärkt ins Zentrum ordensinterner Reflexionen, aber auch pastoraltheologischer Forschung.1 Das ist nicht verwunderlich, verdichten sich die Transformationsphänomene und Übergangsprobleme der katholischen Kirche doch exemplarisch in den Orden.
Bindungsschwund und Mitgliederrückgang bis zur Existenzgefährdung sind unübersehbar: In Österreich etwa nahm die Zahl der Ordensfrauen von 13797 (1970) auf 3643 (2015) rasant ab, 2015 waren nur noch 4% der Ordensfrauen unter 40 Jahre alt. Andererseits sind aber auch religiöser Anspruch, existentielle Selbstverpflichtung und, seit neuestem, Innovationsbereitschaft in Ordensgemeinschaften oft stärker ausgeprägt als in der Breite der Kirche.
Es scheint da nahe zu liegen, die prägenden Gründerfiguren von Ordensgemeinschaften in den Blick zu nehmen, um nach dem Ursprungscharisma der eigenen Gemeinschaft und seiner eventuellen Relevanz für heute zu fragen. Doch liegt darin auch die Versuchung, die großen Gründungserzählungen unhistorisch zu reinszenieren.
Die vorliegende Studie von Sr. Katharina Ganz widersteht dieser Versuchung souverän, insofern sie konsequent von einer Forschungsfrage bestimmt wird, die den Bereich des eigenen Ordens, ja der Orden überhaupt übersteigt und eine zentrale Gegenwarts- und Zukunftsproblematik der katholischen Kirche betrifft. Es geht um die Vulnerabilität und Kreativität einer Frau innerhalb der patriarchalen Strukturen der katholischen Kirche, um daraus Perspektiven zu entwickeln für die Existenz von Frauen in der katholischen Kirche heute, einer, woran Sr. Katharina Ganz nie einen Zweifel lässt, nach wie vor patriarchal geprägten Kirche.
Diese Studie sucht am historischen Ort der Oberzeller Ordensgründerin Antonia Werr nach spirituellen Ressourcen und Impulsen für heutige Pastoral, in einer Zeit, da der Widerspruch hierarchischer Geschlechterstereotypen zu zentralen Inhalten der christlichen Botschaft wie zur zunehmend geschlechtergerechten Gegenwartsgesellschaft nicht mehr länger zu übersehen ist und von vielen Männern und Frauen in der Kirche existentiell empfunden wird. Der Autorin gelingt es dabei, die – relativen – Freiheitsspielräume zu würdigen, die Antonia Werr sich erarbeitete, und nach den Bedingungen zu fragen, die damals neue Modelle weiblicher Lebensgestaltung innerhalb der katholischen Kirche ermöglichten und möglicherweise auch heute ermöglichen.
Wie nicht resignieren als Frau in einer patriarchalen Kirche? Die von Antonia Werr inspirierte Antwort lautet: Wer an der Wunde des Patriarchats nicht verbluten will, braucht Kreativität, um mit den Paradoxien umzugehen, in denen er leben muss, und um die Möglichkeiten zu entdecken und Handlungspotentiale auszuschöpfen, die dennoch bestehen. Es geht darum, in Ohnmachtspositionen Autorität zu gewinnen. Dies, so eine bedeutungsvolle Einsicht der Verfasserin, gelingt gerade dann, wenn man nicht für sich, sondern für andere Ohnmächtige kämpft. Werrs politische Stärke und Durchsetzungsfähigkeit lagen, so Ganz, in der Intersektionalität ihres Vorgehens: Antonia Werr setzte sich durch, indem sie nicht für sich selber stritt, sondern die Verwundungserfahrungen anderer Frauen zum Thema und Gegenstand konkreter Initiativen machte.
Kreativität aus Vulnerabilität bedeutete für Werr daher, trotz oder gerade wegen der eigenen Verwundungen verletzbar zu bleiben und sich von den Armen verletzen zu lassen. Dies ermöglichte ihr politisch und strategisch stark zu agieren, die Verehrung des Jesuskindes, namensgebend für ihre Gründung, nicht als „Verschleierungskategorie“, sondern als „Eröffnungskategorie“ (Ganz) einzusetzen und allen Frauen ihre basale Gebürtlichkeit als Möglichkeit des Neuanfangs vor Augen zu stellen. Voraussetzung dafür war die vorbehaltlose Anerkennung der verletzenden Wirklichkeit des Patriarchats, die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuldgeschichte – Ganz verweist auf die Aufarbeitung der „schwarzen Pädagogik“, die es auch in der Werrschen Gemeinschaft weit bis ins 20. Jahrhundert gab – und die Bereitschaft, in konfliktreichen Prozessen unerschrocken Verantwortung zu übernehmen.
Die vorliegende Studie ist das gelungene Beispiel pastoraltheologischer Forschung am historischen Objekt und damit einer noch immer weitgehend ausstehenden historischen Pastoraltheologie mit Gegenwartsanspruch. Die methodisch komplexe doppelte Kontextualisierung der Schriften und des Lebens von Antonia Werr in deren Lebenszeit, dem frühen 19. Jahrhundert, wie in der Gegenwart des beginnenden 21. Jahrhunderts gelingt in dieser Studie beispielhaft. Ebenso gelingt es der Autorin, wiewohl selbst Angehörige der Oberzeller Kongregation und gegenwärtig sogar deren Generaloberin, die wissenschaftlich gebotene kritische Distanz zur Gründerin ihrer Gemeinschaft zu wahren und etwa deren zeittypischen Kulturpessimismus wie auch die problematischen Seiten ihres bisweilen recht autoritären pädagogischen Konzepts aus heutiger Perspektive ebenso klar zu benennen wie historisch einzuordnen.
Die Arbeit versteht es, eine der beeindruckenden Kongregationsgründerinnen des 19. Jahrhunderts jenseits der Versuchung zu katholisch-institutionalistischer Apologetik beziehungsweise ahistorischer feministischer Kritik differenziert auf eine heute relevante Fragestellung hin zu analysieren und daraus weiterführende Erkenntnisse zu entwickeln. Auch gelingt es Sr. Katharina Ganz eindrucksvoll, die Werrsche Kindheit-Jesu-Spiritualität in ihren kenotisch-in-karnatorischen Wurzeln freizulegen.
Die Frage nach der Möglichkeit selbstbewusster weiblicher Existenz in einer patriarchalen Kirche hat sich seit Werrs Zeiten nicht erledigt, sie ist vielmehr schärfer und drängender geworden. Die Ergebnisse dieser umfassenden Studie haben für Pastoral und Pastoraltheologie weiterführenden Charakter: Kreativität aus Verwundbarkeit entsteht, wo die eigene Situation nüchtern erkannt, der Kampf für Veränderung ebenso klug wie entschieden, in konkreten Bündnissen, vor allem aber für andere geführt wird, die unter gleicher oder ähnlicher Verwundung leiden.
Der kenotische Charakter einer Spiritualität der Gotteskindschaft ist dabei ebenso grundlegend für eine zukünftige Pastoral wie die Notwendigkeit, auf ihrer Basis wirksam Autorität aufzubauen in einer Kirche und Gesellschaft. Die auf dem völlig neu strukturierten Feld der Geschlechterverhältnisse dringend notwendige erneuerte symbolische Ordnung der katholischen Kirche, so zeigt sich, findet ihre Anregungen mitunter an ganz unerwarteten Orten – so bei der fränkischen Ordensgründerin Antonia Werr.
Rainer Bucher
Graz, September 20168
1 Vgl. exemplarisch die Habilitationsschrift von Ute Leimgruber, Avantgarde in der Krise.
Inhalt
Vorwort
1 Zugänge und Hinführung
1.1 Einleitung
1.1.1 Interessen und Methode
1.1.2 Forschungsstand
1.1.3 Quellen
1.1.3.1 Korrespondenz mit Maximilian von Pelkhoven
1.1.3.2 Vernichtete Selbstzeugnisse: Die gelben Blätter
1.1.3.3 Geistliche Schriften und Regeln
1.1.4 Zentrale Begriffe
1.1.5 Aufbau
1.2 Historische Kontexte: Aufbrüche, Umbrüche, Ausbrüche im 19. Jahrhundert
1.2.1 Erneuerung der Kirche durch traditionsbewusste Frauen
1.2.2 Voller Ambivalenzen: Der so genannte Frauenkongregationsfrühling
1.2.3 Französische Initiativen als Quelle der Inspiration
1.2.3.1 Pädagogik der Liebe: Die Schwestern vom Guten Hirten
1.2.3.2 Marie-Thérèse Carolina de Lamourous (1754–1836)
1.2.4 Fazit: (Ordens-)Frauen als Vorreiterinnen der Emanzipation
2 Antonia Werr (1813–1868): Biografie und Leben
2.1 Angesichts des Todes zum Leben gekommen
2.1.1 Vaterlos aufgewachsen mit enger Bindung an die Mutter
2.1.2 Tabuisierung eines familiären Makels?
2.1.3 Nach der Schule zur „Lehre“ im Ausland
2.1.4 Riskanter Einsatz der gesamten Existenz
2.1.5 Körperlich fragil – geistig vital
2.1.6 Fürsorglich strenge „Mutter“ und Frau von „männlicher Energie“
2.1.7 Fazit: Austarieren von Ambivalenzen in der eigenen Geschlechterrolle
2.2 Unterstützer und Förderer von Kreativität
2.2.1 Vorliberaler Denker: Johann Baptist Rorich
2.2.2 Einfühlsamer Wegbegleiter: Freiherr Maximilian von Pelkhoven
2.2.2.1 Biografie
2.2.2.2 Staatsmann und Vertrauter
2.2.2.3 Helfer und Fundraiser
2.2.2.4 Rezeptionsgeschichte: Vater, Mitbegründer, Wohltäter, Freund
2.2.2.5 Fazit: Verbündeter jenseits der Geschlechter- und Standeshierarchien
2.2.3 Loyaler Mitstreiter: Der Franziskaner-Minorit Pater Franz Ehrenburg
2.2.3.1 Biografie
2.2.3.2 Zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet
2.2.3.3 Mentorin für den unerfahrenen Seelsorger
2.2.3.4 Zankapfel Oberzell: Polarisierungen im Franziskaner-Konvent
2.2.3.5 Fazit: Geistliches „Cover“ und Garant für Kontinuität
2.3 Heilsam-schmerzhafte Bindung an Gott und Kirche
2.3.1 „Mutter Kirche“ als Heimat und Halt
2.3.2 Kirchenpolitisches Ränkespiel: Buhlen um die Gunst der „Väter“
2.3.2.1 Konkurrenz mit dem Elisabethenverein
2.3.2.2 Vorurteile gegenüber den Töchtern des Allerheiligsten Erlösers
2.3.3 Einblicke in die „geheimen Wunden“ anderer Institute
2.3.5 Loyalität zur Kirche als Zerreißprobe
2.3.5.1 Zwang zur Unterwerfung und Kirchentreue
2.3.5.2 Eine Frau ohne Stimme und Rechte verschafft sich Gehör
2.3.5.3 Prozesshafte Suche „nach einem wahren Glauben“
2.3.6 Fazit: Vom Anstaltsgehorsam zum Glaubensgehorsam
2.4 „Muth ein so großes Unternehmen zu wagen“: Die Gründung
2.4.1 Strafe oder Barmherzigkeit für so genannte gefallene Frauen?
2.4.2 Analyse der Zeitbedürfnisse
2.4.3 Klein wie Bethlehem: Der Anfang in Oberzell
2.4.4 Arm, aber kräftig, tüchtig und fromm: Die ersten Gefährtinnen
2.4.5 An der Seite der Stigmatisierten: Die Klientinnen
2.4.6 Zwischen Freiwilligkeit und Zwang: Die Regeln
2.4.7 Seelen retten: Der Gründungszweck und die Methoden
2.4.7.1 „Aus diesen Trümmern wieder […] ein Ganzes […] machen“
2.4.7.2 „Wunden, die wir […] schneiden, brennen und sondiren müssen“
2.4.7.3 „Vor dieser Mutterschaft würden sich Tausende bedanken“
2.4.8 Wahrheit und Wahrhaftigkeit: Leitbild und Grundprinzip
2.4.9 Fazit: Trümmerfrau und Hebamme der Menschwerdung
2.5 Ringen um Autonomie und Absicherung
2.5.1 Finanziell-materielle Unabhängigkeit
2.5.2 Diplomatie im Umgang mit der Obrigkeit
2.5.3 Kampf um pastorale Kompetenz in der Beichtvorbereitung
2.5.4 Unabhängig und an die Kirche angelehnt
2.5.4.1 Anschluss an den St. Johannisverein
2.5.4.2 Anschluss an den Regulierten Dritten Orden des hl. Franziskus
2.5.5 Der schwere Weg zur endgültigen Anerkennung
2.6 Fazit: Im Spannungsfeld von Macht, Ohnmacht und Autorität
3 Biblische, philosophische, psychologische und pastoraltheologische Analysen einer Spiritualität der Vulnerabilität
3.1 Das Konzept der Gotteskindschaft
3.1.1 Die hl. Familie als Vorbild für sozial-pastorales Engagement
3.1.2 Das Kenosismotiv: Gott steigt herab ins menschliche Fleisch
3.1.3 Der Bethlehemitische Weg: Die hl. Familie migriert
3.1.4 Das Jesuskind vor Augen: Weihnachtskrippe und Krippenkind
3.1.5 Demut, Armut, Liebe: Kenotische Haltungen des Statusverzichts
3.2 Inkarnation: Gott zeigt sich klein, verwundbar und nackt
3.2.1 Die Hautwerdung des Logos
3.2.2 Blutend und doch unverletzt? Anmerkungen zur Jungfrauengeburt
3.2.3 Weihnachten als Wagnis der Verwundbarkeit
3.2.4 Atypisches Role model: Das Jesuskind in Mt und Lk
3.2.4.1 Ein subversiver Gegenentwurf zur Augustuspropaganda: Lk 1–2
3.2.4.2 Magier, Stern und Träume als Wegweiser zum Kind: Mt 1–2
3.2.5 Fazit: Aus freiwilliger Erniedrigung zu den Erniedrigten
3.3 Zwischen Gefängnis und Rettungsanstalt
3.3.1 Michel Foucault: Heterotopien
3.3.2 Topografischer Wechsel: Von der Mitte an den Rand
3.3.3 Asyl als sicherer Ort
3.3.4 Claustrum: Abgeschlossen und doch bei den Menschen
3.3.5 Hospitium: Herberge der Menschwerdung
3.3.6 Krippe: Ort des (Neu-)Anfangs
3.3.7 Fazit: Vom kirchlichen Eigen-Ort zum Anders-Ort der Frauen
3.4 Gebürtlichkeit bei Hannah Arendt: Anfangen und verzeihen
3.4.1 Aus der Natalität Neues in Bewegung setzen
3.4.2 Vom Ursprung her zum Handeln ermächtigen
3.5 Vulnerabilität und Widerstandsfähigkeit
3.5.1 Traumata: Fragmentierungen der Seele
3.5.2 Förderung von Resilienz durch aktive Coping-Strategien
3.5.3 Arbeit mit dem so genannten Inneren Kind
3.5.4 Ego-States-Therapie: Vergegenwärtigung Innerer-Kind-Zustände
3.5.6 Hilfe durch Innere Teams und andere Wesen
3.5.7 Fazit: Lichtgestalten zum Schutz des Verwundeten
3.6 Pastoralgemeinschaft verwundeter und verwundbarer Menschen
3.6.1 Kenopraxis: Von sich selbst absehen können
3.6.2 Macht-in-Verwundbarkeit: Freiwillig von Gott abhängig sein
3.6.3 Fazit: Patriarchat – Verwundbarkeit – Parteilichkeit
4 Kapitel: Impulse für eine geschlechtergerechte Pastoral in einer patriarchalen Kirche
4.1 Wunden benennen und offen halten
4.2 Mut zur Gebrochenheit und zum Fragment
4.5 Macht und Autorität – Herrschaft oder Dienst?
4.6 Andere Orte gestalten oder aufsuchen
4.7 Als Mensch Kind sein und Kind Gottes werden
Literaturverzeichnis
Quellen
Literatur
Webseiten
Verwendete Abkürzungen und Zeitschriften
1 Zugänge und Hinführung
Menschliches Leben ist verletzlich. Es ist ein Existential des Menschseins, dass es verwundbar, hinfällig, vergänglich und sterblich ist. Die Vulnerabilität des Menschen bezieht sich auf seine leibliche wie auf seine psychische Existenz. Auch seine geistige oder spirituelle Gesundheit kann beeinträchtigt werden. Die Auslöser sind multipel und divers: Biologisch-genetische oder Umwelt-Faktoren, individuelle oder soziokulturelle Ursachen, strukturelle Mechanismen wie staatliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche oder religiös motivierte Repression können Individuen wie Gruppen direkt und indirekt bedrohen, gefährden und schädigen. Dabei führt nicht zwangsläufig jede Verwundung zu einer dauerhaften Traumatisierung. Während manche Menschen durch negative Einflüsse geschwächt werden, erkranken oder verzweifeln, bleiben andere stabil, resistent oder optimistisch. Wieder andere gehen sogar gestärkt aus einer Verwundungserfahrung hervor.
1.1 Einleitung
Diese Forschungsarbeit thematisiert die Vulnerabilität und Kreativität einer Frau innerhalb der patriarchalen Strukturen der katholischen Kirche, fragt nach ihren spirituellen Ressourcen und den Impulsen für die Pastoral in postmodernen Zeiten, die nach wie vor in die Geschlechter- und damit hierarchischen Kirchenstrukturen eingebettet sind. Nach der Darlegung des thematischen Kontextes, des Forschungsstandes und -interesses, der Quellenlage, des Aufbaus sowie der gewählten Methoden soll die Forschungsfrage an einem historischen Ort bearbeitet werden. Auch wenn androzentrisch geprägte theologische und philosophische Theorien die Unterwerfung der Frau unter den Mann jahrhundertelang als selbstverständlich, naturgegeben und gottgewollt konzipierten, reflektierten einzelne Frauen diese Situation der menschengemachten Unmündigkeit und fanden Alternativen zur Abhängigkeit von Vätern, Brüdern oder Ehemännern.1 Immerhin lassen sich Frauenbiografien finden, die trotz zahlreicher Hindernisse vom genormten bzw. gesellschaftlich und kirchlich vorgegebenen Lebensentwurf abwichen.2 Aus heutiger Sicht erscheint das kreative Potential solcher Frauen oftmals auf halbem Weg stecken geblieben, da es nur in relativer Unabhängigkeit endete. Wenn sich etwa eine Frau für ein jungfräuliches Leben entschied, war sie zwar losgelöst vom Zugriff des Paterfamilias, unterstand aber immer noch einem geistlichen Vater, Seelenführer oder Bischof. Umso mehr gilt es, diese relativen Freiheitseroberungen zu würdigen und nach den Bedingungen der Möglichkeiten zu fragen, die neue Initiativen begünstigten und zu erfolgreichen Modellen weiblicher Lebensgestaltung führten. Was ließ diese Frauen neue Wege gehen, statt sich mit dem Status quo abzufinden? Was hat sie befähigt, dem eigenen inneren Impetus zu folgen statt – was gegebenenfalls bequemer und honorierter gewesen wäre – in vorgegebenen Bahnen und Ordnungen zu verbleiben? Diesen Fragen soll exemplarisch anhand einer Frau nachgegangen werden, die im 19. Jahrhundert eine Frauengemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche ins Leben rief: Antonia Werr (1813–1868). Sie gründete 1855 zusammen mit Gleichgesinnten einen katholischen Jungfrauenverein und eine katholische[] Anstalt für Besserung verwahrloster Personen des weiblichen Geschlechts.3
1.1.1 Interessen und Methode
Das Interesse der Autorin an Antonia Werr ist durch die Mitgliedschaft in der auf sie zurückgehenden Kongregation begründet. Im Bewusstsein der möglicherweise persönlichen Befangenheit erhebt diese Arbeit nicht den Anspruch, die Gründerin ausschließlich in einer historisierenden Rückblende von ihrer Zeit und ihrem eigenen Selbstverständnis her zu begreifen. Das wäre anmaßend und schlechthin unmöglich. Weil es sich also um keine rein historische Arbeit handelt, wird auch die Einordnung Antonia Werrs in die (Kirchen-)Geschichte des 19. Jahrhunderts nur skizzenhaft erfolgen können. Im Mittelpunkt steht stattdessen eine thematische Fragestellung, die die historische Perspektive mit heutigen Fragen zusammenfügen soll.
Wie ist diese Frau Mitte des 19. Jahrhunderts mit Fragen der Vulnerabilität umgegangen, die auch heute noch Menschen bewegen, weil Verletzlichkeit nun einmal ein unhintergehbares Existential des Menschseins ist? Wie hat sie diese Phänomene im eigenen Leben und in ihrem Umfeld thematisiert, reflektiert und handelnd darauf reagiert? Auf welche spirituellen Ressourcen konnte sie zurückgreifen, die es ihr erlaubten, im Rahmen des Möglichen neue Wege zu gehen? Wie gelang es ihr angesichts erschwerender Bedingungen aufgrund der patriarchalen Strukturen, als Frau Neues zu wagen und sich Territorien zu erobern, die von relativer Freiheit, Autonomie, Autorität, Selbstverwirklichung und Handlungsspielräumen gekennzeichnet waren? Die Fragen und erkenntnisleitenden Interessen, die den Forschungsgang lenken, bewegen sich in den Zugängen der historischen Frauenforschung, Genderforschung, Pastoraltheologie und feministischen praktischen Theologie.4
Das Titelzitat dieser Dissertation bringt zum Ausdruck, was Werr reflektierend erkannte, dass sie nämlich als Frau in der Kirche keine Stimme hatte. Ihre Rechtlosigkeit bedeutete, dass sie nicht existierte und sich als tot empfand.5 Diese Aussage kann als feministisches Statement gewertet werden. Mit dieser Forschungsarbeit wird ein weiterer Versuch unternommen, in der Wissenschaft Werrs Stimme Gehör zu verschaffen, die sie in der Kirche und Welt des 19. Jahrhunderts durchaus vernehmbar zu Wort brachte, nicht in erster Linie durch ein umfangreiches schriftliches Werk, sondern durch ihre religiös motivierte, lebenspraktische Parteinahme für marginalisierte Frauen. Ziel ist es, anhand der Schriften Antonia Werrs eine Vertreterin unter den unzähligen Frauenkongregationsgründerinnen des 19. Jahrhunderts aus dem Schatten der Geschichte hervortreten zu lassen, sie somit dem Vergessen zu entziehen und ihr einen Ort innerhalb der feministisch-theologischen Biografieforschung zu verschaffen:
„Frauen, die bisher als gesellschaftlich und kirchlich als bedeutungslos galten, wird Bedeutung zugeschrieben, ihre Erfahrungen und Deutungen werden ernst genommen, sichtbar gemacht und in den theologischen Diskurs einbezogen.“6
Durch die biografische Erinnerung und Sichtbarmachung dieser Frauengestalt mit Hilfe ihrer eigenen Sprache bekommt sie Aufmerksamkeit in der Gegenwart. Mit der Offenlegung ihrer Gedanken, Gefühle sowie Aussagen über ihren Glauben und ihr Handeln kann die Tradition erhellt und im Rahmen der Frauengeschichtsforschung eine weitere Lücke geschlossen werden. Durch dieses methodische Vorgehen wird Antonia Werr als „Subjekt ihres Handelns“7 mit ihrer eigenen Lebensplanung und -gestaltung betrachtet:
„Sie tritt nicht nur als Opfer von Verhältnissen, Schicksalen oder Handlungen anderer, sondern auch als Subjekt von Schaffens-, Leidens- und Deutungsprozessen in Erscheinung.“8
Es wird ebenso nach den geprägten Mustern ihres Handelns und Erleidens, nach ihren Vorstellungen und Glaubensweisen, Entwicklungsprozessen, psychischen Strukturen und ihrem Rollenverständnis gefragt wie nach ihren Lebensfragen, ihrer Gottsuche und kritisch-gläubigen Positionierung innerhalb der Kirche und geforscht, welchen programmatischen Ortswechsel sie auf die damaligen Zeichen der Zeit vorgenommen hat.9 Historische Frauen(biografie)forschung ist also weit mehr als das bloße
„Dazuaddieren von Vergessenen. Mit dem kritischen Blick auf Frauen, ihre Lebensumstände und ihr Wirken in der Geschichte änderte sich vielmehr die gesamte Perspektive. Die herkömmliche Geschichtsschreibung wurde als eine androzentrische erkannt, die das hierarchische Verhältnis zwischen Männern und Frauen abbildete und damit reproduzierte. Der historischen Frauenforschung geht es im Gegensatz dazu nun darum, auf dem Hintergrund des traditionellen Geschlechterverhältnisses danach zu fragen, wie Frauen sich mit den gegebenen sozialen Verhältnissen arrangiert, sie verteidigt, gegen sie gekämpft, sie verändert, ihnen im Stillen Widerstand geleistet haben etc. Im Spiel von Anpassung und Widerspruch werden dabei historische Handlungsmöglichkeiten für Frauen sichtbar, die als historische Konkretionen dem Klischeebild ‚Frau‘ entgegen gestellt werden können. Die traditionellen Stereotypen erfahren dabei eine Dekonstruktion und Relativierung wie der Mythos der völlig unterdrückten Frau.“10
Darüberhinaus bewegt sich diese Arbeit im weiten Feld der Gender Studies, die generell das Geschlecht als Forschungskategorie berücksichtigen, ohne es vorher genau zu bestimmen, und Zusammenhänge und Deutungsmuster untersuchen.11 Gegenüber feministischen Ansätzen, denen es um eine gezielte Erforschung weiblicher Biografien geht, sind Männer und Männlichkeit ebenfalls Forschungsgegenstand der Geschlechterforschung. Gendertheorien unterscheiden das biologische (sex) vom sozialen Geschlecht (gender) und gehen davon aus, dass Geschlecht und Geschlechterrollen wesentlich sozial und kulturell konstruiert sind. Das Geschlecht in jedweder Forschung als Kategorie zu berücksichtigen, sensibilisiert für die sozial, kulturell und religiös unterlegten Konstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit. Es ermöglicht die Dekonstruktion von Geschlechter- und damit Herrschaftsverhältnissen und schafft die Basis für befreiende alternative Zuordnungen in einer plural und unübersichtlich gewordenen Welt.12
Indem diese Arbeit gezielt nach dem Befreiungspotential in den Schriften und im praktischen Handeln Werrs fragt, unterscheidet sie sich von der historischtheologischen Frauenbiografieforschung, die zwar das Geschlecht als Kategorie berücksichtigt, darüber hinaus aber keine emanzipatorischen Anliegen verfolgt. Durch die Kategorie des Patriarchats wird der hier zugrunde liegende feministisch-theologische Ansatz in der Fragestellung zugespitzt. Der Patriarchatsbegriff hilft,
„aus androzentrischen Texten und Überlieferungen und dem strukturellen patriarchalischen Hintergrund tatsächlich befreiende (d. h. für alle Menschen befreiende) Inhalte herauszufiltern und/oder diese Texte und Überlieferungen feministisch-kritisch zu analysieren und als menschen-feindlich abzulehnen.“13
Denn einerseits sind die Strukturen der katholischen Kirche bis in die Gegenwart hinein von Männerdominanz bestimmt, andererseits waren die Handlungsspielräume einer Katholikin im 19. Jahrhundert aufgrund der insgesamt monarchisch-hierarchisch gegliederten Gesellschaft weit umfänglicher begrenzt als in der gegenwärtigen Spätmoderne, in der sich die Strukturen immer mehr verflüssigen und sich die Geschlechterrollen massiv verändert haben.
Feministische Theologie deckt seit nunmehr fünf Jahrzehnten sexistische Strukturen auf und übt Kritik an der Diskriminierung von Frauen. Durch die gezielte Erforschung weiblicher Biografien sorgen TheologInnen seit einem halben Jahrhundert dafür, durch die komplementäre Sichtweise von Frauen bislang verschüttetes oder brach liegendes Wissen, Erfahrungen und Perspektiven einzubringen, die den theologischen Diskurs bereichern und verlebendigen.14
Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und näherhin mit der Pastoralkonstitution GS steht heute das analytische Instrumentarium zur Verfügung, um das pastorale Handeln Antonia Werrs an der Seite von sowohl sozial wie kirchlich exkludierten Frauen zu erschließen und Werrs grenzüberschreitende solidarische Praxis im ultramontanen Milieu ihrer Zeit als prophetisch-pastorales Handeln zu qualifizieren. Das unter einer pastoralen Gesamtkonzeption stehende Konzil hat erneut zu Bewusstsein gebracht, dass die Einsicht und geistliche Erfahrung der Gläubigen neben Schrift, Lehre und Tradition eine gleichrangige Ressource göttlicher Offenbarung darstellt (DV 8).
Feministische Theologie setzt u. a. bei der Lebens- und Glaubenserfahrung von Frauen an, um sie und ihre Perspektiven sichtbar zu machen und aus dem Verlies androzentrisch einseitiger Welt-, Gottes- und Gesellschaftsdeutung zu befreien. Erfahrungen zum Ausgangspunkt der Theologie zu machen, ruft nach wie vor Widerstand hervor. Diese Vorgehensweise wird als wenig objektiv, zu persönlich, willkürlich bewertet und damit abgewertet und diskriminiert.15
Feministische Theologie, Erkenntnistheorie und Sozialforschung haben diese Vorwürfe mit dem Hinweis auf den Erfahrungsbezug jeglicher Theologie bzw. Erkenntnisbemühung entschieden mit dem Argument zurückgewiesen, dass es überhaupt keinen neutralen oder objektiven epistemologischen Gewinn gibt, da jede Forschung von bestimmten subjektiven oder institutionellen Interessen geleitet ist. Die wissenschaftliches Arbeiten auszeichnenden Kriterien der Objektivität, Intersubjektivität und Validität ihrer Ergebnisse werden vielmehr durch das Offenlegen der Forschungshypothesen und Darlegung der im Forschungsprozess angewandten Methode sowie Überprüfbarkeit der Erkenntnisse garantiert. Erfahrungen von Frauen in den Mittelpunkt theologischer Reflexion und religiösen Handelns zu stellen bedeutet, sich auf die Suche zu machen, wie sich Gott im Erleben von Frauen zeigt, wie Frauen dies wahrnehmen, verarbeiten und auf dem Hintergrund ihres Kontextes wie ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, Geschichte, Kultur und Gesellschaft deuten.
Um die Erfahrungen von Frauen bewusst zu machen und in die Rede von Gott einzubeziehen, bedarf es einer eigenen Sprache, der Ausbildung frauenspezifischer Deutungskategorien bzw. der neuen Erschließung der überlieferten Symbole. Jenseits der determinierenden androzentrischen Sprache werden weibliche Lebens- und Glaubenserfahrungen als Ort der Theologie und Offenbarung Gottes beleuchtet.
Frauen haben etwas zu sagen, was Männer bzw. einseitig androzentrisches Denken nicht beachtet, abgespalten oder offen bekämpft haben. Trotz und gerade wegen der Auflösung des Denkens in der Zweigeschlechtlichkeit bleibt die Kategorie „Frau“ politisch notwendig, um die Erfahrungen von Frauen zu dechiffrieren, ohne dabei automatisch dem Trugschluss zu erliegen, daraus verallgemeinerbare, für alle Frauen ableitbare Erkenntnisse gewinnen zu können oder zu müssen.16 Diesem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, dass das Sprechen einer Frau, selbst wenn ihr Leben in der Vergangenheit liegt, Bedeutung haben kann für das In-der-Welt-Sein von Frauen heute:
„Die Auseinandersetzung darüber, was die Erfahrung einer Frau über das In-der-Welt-Sein und die Gottesliebe der Frauen mitteilt, führt wiederum zu einem Wissen über das Leben von Frauen in der Welt und über den Glauben an Gott. […] Denn im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott (Joh 1,1) und in dem Wort gründet sich die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Dies gilt auch für das Wort einer Frau und für deren Beziehung zu Gott, die sich in diesem Wort kundtut, so dass wir nicht unterscheiden können, wer spricht, weil beide gemeinsam sprechen: die Frau und durch sie Gott und Gott mit ihr und sie mit Gott.“17
1.1.2 Forschungsstand
Nach dem Zweiten Vatikanum setzten sich TheologInnen systematisch mit der Ordenstheologie seit dem Zweiten Vatikanum und insbesondere mit der Rolle apostolisch-tätiger Frauengemeinschaften auseinander. Zu den Standardwerken zählen etwa die Dissertationen von Anneliese Herzig (1991)18 und von Zoe Maria Isenring (1993), wobei Letztere sich auf die sich abzeichnenden Umbrüche fokussierte und auf der Grundlage der Konzilstheologie Perspektiven für die Erneuerung der Gemeinschaften aufzeigte.19
Am Beispiel Preußen untersuchte Relinde Meiwes in ihrer im Jahr 2000 erschienenen Dissertation die neuen Kongregationsgründungen im 19. Jahrhundert aus sozialwissenschaftlicher Sicht und beleuchtete diesen speziellen Lebensentwurf von Frauen im Verhältnis von Kirche und Staat, sozialer Frage und religiöser Motivation, gemeinschaftlichem Leben und gesellschaftlichem Handeln.20
Ausführlich beschäftigte sich der 2006 von Erwin Gatz herausgegebene Band VII in der Reihe „Geschichte des kirchlichen Lebens“ mit den Klöstern und Ordensgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts.21 Unter Berücksichtigung der Genderperspektive gibt Gisela Fleckenstein darin einen historischen Überblick über die alten Orden sowie Neugründungen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu den Kulturkämpfen.22 In ihrer vergleichenden Analyse religionspolitischer Diskurse zieht Esther Hornung im Rahmen ihrer konfessionsübergreifenden Geschlechterforschung beim Tragen von Schleier, Haube und Kopftuch als Beispiel für das Ringen um Kleidersouveränität von Frauen auf katholischer Seite den Briefwechsel der auf Antonia Werr zurückgehenden Kongregation der Dienerinnen der hl. Kindheit Jesu im Kulturkampf heran.23
Mit der Habilitation von Ute Leimgruber liegt seit 2011 eine pastoraltheologische Ortsbestimmung der Frauenorden24 vor, die die Primär- und Sekundärmotive für diese Lebensform aus der Perspektive von Frauen in den jeweiligen Epochen der Kirchengeschichte beschreibt und Optionen formuliert, wie die Frauengemeinschaften in den krisengeschüttelten kirchlichen Landschaften des 21. Jahrhunderts zur Avantgarde werden könnten.25
Antonia Werrs Biografie und ihr Lebenswerk sind – ausgenommen im Raum der Diözese Würzburg und im Zusammenhang mit der bis heute geleisteten Frauenarbeit der Kongregation – wenig bekannt. Als erste systematische Zusammenstellung der Geschichte der von Antonia Werr gegründeten Kongregation gilt das unveröffentlichte Werk von Thomas Gerber aus den Jahren 1929/1930.26 Anlässlich des 75. Jahrestages seit der Verfassung der Konstitutionen schrieb Johannes Schuck 1932 eine Abhandlung über die Geschichte der Gemeinschaft von ihren Anfängen bis zu seiner Zeit.27
Im Gegensatz zu den bedeutenden OrdensgründerInnen des Mittelalters oder der frühen Neuzeit stellte Barbara Albrecht in der Vorbemerkung ihrer Kleinschrift über das geistliche Vermächtnis Antonia Werrs Anfang der 1980er Jahre im Blick auf das 19. Jahrhundert „eine merkwürdige Bildungs- und Bindungslücke, ja gewisse Abwehr“28 fest. Pauschal habe man die Stifter und Stifterinnen als „spirituell recht ‚kleinkarierte Christen‘“29 abqualifiziert und ihre Gründungen auf „Genossenschaften für berufliche Sozialarbeit“30 reduziert:
„[I]m Inneren stickig, spirituell engbrüstig und darum nicht (mehr) anziehend für die theologisch, biblisch, liturgisch, pastoral und spirituell hochstehende Kirche unserer Tage [sei die, K. G.] Beschäftigung mit diesen Männern und Frauen des 19. Jahrhunderts […] allenfalls etwas für die Genossenschaften selbst, die sich mühten, ihren Gründer oder ihre Gründerin zu Heiligen aufzubauen.“31
In den letzten 20 Jahren wurde Antonia Werr in Arbeiten zur Diözesangeschichts-forschung berücksichtigt.32 Dazu gehört die 1995 erschienene Dissertation „Antonia Werr (1813–1868) und die Oberzeller Schwestern. Geistliches Profil und sozialer Auftrag einer Frauenkongregation des 19. Jahrhunderts von der Gründung bis zur Gegenwart“ von Barbara Schraut.33 In einem 2006 erschienenen Sammelband über das einstige Prämonstratenserstift Oberzell beschäftigen sich vier Beiträge aus kirchenhistorischer sowie pastoraltheologischer Sicht mit den aufblühenden Schwesternkongregationen in Bayern bzw. der Gründung durch Antonia Werr.34 Manfred Eder legte den Schwerpunkt auf die Entwicklung, Eigenart und sozialkaritative Bedeutung der katholischen Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert.35 Hubertus Lutterbach forschte, inwieweit Antonia Werr ihre mystische Spiritualität in den Dienst der Besserung weiblicher Strafgefangenen stellte.36 Erik Soder von Güldenstubbe gab einen Überblick von der Gründung der Dienerinnen der hl. Kindheit Jesu bis 2005.37 Erich Garhammer zitierte einige markante Stellen aus dem Briefwechsel Werr–Pelkhoven, stellte mit Blick auf die damaligen statistischen Zahlen die Frage, ob es in nächsten 20 Jahren zu einer Existenzkrise der Kongregation oder zu einem „refounding“ kommen werde, und veröffentlichte die im Schlussdokument des Generalkapitels 2001 festgehaltenen Ziele, die gesellschaftlichen Grenzen, Umbrüche und Schwellensituationen wahrzunehmen und die Gotteskindschaft aller Menschen in den Blick zu nehmen.38 Mit der Spiritualität der Kongregation befasste sich Stephan E. Müller, indem er Impulse zum Geheimnis der Menschwerdung vorlegte, die sich u. a. an den Schriften Werrs orientieren.39
Weniger als in der theologischen Forschung gab es in der pädagogischen Literatur ein Echo auf die Gründung durch Antonia Werr, obwohl sie in Deutschland eine Pionierin in der Resozialisierung haftentlassener Frauen war. Als Gründe wurden die „geringe Anzahl der von Antonia Werr betreuten Frauen und die lokale Begrenzung der Wirksamkeit auf Oberzell“ angeführt, sowie die Tatsache, dass sie „selbst keine pädagogischen Schriften veröffentlichte, die zur Auseinandersetzung mit ihrer Pädagogik anregten.“40 Bis heute ist Elselore Tillmanns unveröffentlichte Diplomarbeit (1980) der einzige Ansatz, um Werrs Beitrag zur Verwahrlostenpädagogik im 19. Jahrhundert wissenschaftlich aufzuarbeiten. Eine intensivere Erforschung aus erziehungswissenschaftlicher Sicht wäre durchaus wünschenswert.
Die Frauengeschichtsforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten überwiegend theologisch arbeitenden Frauen zugewandt, ihre Schriften in textkritischen Gesamtausgaben editiert und deren Wirkungsgeschichte erforscht.41 Ute Gause sah 2006 darüber hinaus einen Bedarf, Schriften laientheologisch arbeitender Frauen auszuwerten.42 Ihr zufolge wurden Frauen in der Diakonie übergangen,
„da diese dem Bereich der zustimmenden Rezeption von protestantischen Weiblichkeitsbildern der Selbstaufopferung und des Dienens zugeordnet werden. Da von ihnen keine befreiungstheologischen Impulse ausgegangen sind und sie auf den ersten Blick keine Identifikation für heutige Lebenskontexte anbieten, werden sie in der feministischen Forschung auch nicht berücksichtigt.“43
Da das Doing Gender44 bei karitativ tätigen Frauen im Katholizismus auf den ersten Blick nicht weniger rollenkonform erscheint, könnte dies auch ein Grund sein für den Forschungsbedarf zu den weiblichen Kongregationen, die im 19. Jahrhundert in der katholischen Kirche entstanden sind. Auch wenn sie in die Geschlechterverhältnisse streng hierarchisch ein- und damit untergeordnet waren, ist es einigen Frauen gelungen, sich teilweise beträchtliche Handlungsspielräume zu schaffen. Ute Gause konstatierte insbesondere in puncto Spiritualität einen großen Forschungsbedarf, denn sie ermöglichte es Frauen,
„Einfluss zu gewinnen und ihr Wirken zu rechtfertigen. […] Mit der existentiell erfahrenen Gottesnähe konnten Handlungsweisen legitimiert und durchgesetzt werden, die gerade nicht in Unterdrückungserfahrungen mündeten, sondern geradezu emanzipative Wirkungen zeigen konnten.“45
Vor dem Hintergrund des vielbeschworenen Cultural turn in den Geistes- und Geschichtswissenschaften erscheint seit 2013 eine neue Reihe mit Studien zur Kultur- und Sozialgeschichte des Christentums in Neuzeit und Moderne.46 Die zentralen Begriffe Religion, Kultur und Gesellschaft werden darin als „drei verschränkte und nicht exakt voneinander zu trennende Dimensionen menschlichen Lebens“47 verstanden. Die Herausgeber der neuen Reihe anerkennen Religion als zentrale Kategorie, der eine eigene „Dignität“48 in der Geschichte zukommt und die durch ihre „pluriformen Glaubenspraktiken“49 Teil der Kultur und Gesellschaft ist und selbst Kultur generiert. Damit soll Religion als Motor der sozialen Arbeit untersucht und die Forschungslücke in den „religiösen bzw. konfessionellen Wurzeln der ‚Wohlfahrtsstaatlichkeit‘“50 verkleinert werden. Die Publikation resultierte aus einem Trierer Sonderforschungsprojekt, das herausfand, dass „die karitativ-diakonische Praxis in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Marker konfessioneller Identität und sogar als Teil konfessioneller Identitätsbildung“51 betrachtet wurde.
Untersucht werden die christlich motivierten Initiativen zugunsten der Armen und Bedürftigen in ihrer Abgrenzung zu anderen ähnlich gearteten Unternehmungen innerhalb der eigenen und in anderen Konfessionen sowie im Unterschied zu staatlich organisierter Kranken- und Armenfürsorge und die Formen übergreifender Zusammenarbeit. Neben Beiträgen zum konfessionell motivierten „edlen Wettkampf der Liebe und Barmherzigkeit‘“52 gehen Michaela Sohn-Krohnthaler für den Katholizismus und Ute Gause für den Protestantismus der genderperspektivischen Frage nach, ob es in der sozialen Arbeit im deutschsprachigen Raum auch zu einem Wettkampf der Geschlechter kam.53 Weil die Genderperspektiven berücksichtigenden Forschungen noch in den Kinderschuhen stecken und zum jetzigen Zeitpunkt kein abschließendes Urteil zulassen,54 wird man den Blickwinkel zusätzlich weiten und schärfen müssen, um die Unterschiede innerhalb der Geschlechter nicht zu verwischen, sondern den feinen Differenzen und Differenzierungen etwa der von Frauen initiierten Unternehmungen gerecht zu werden. In dieser Hinsicht möchte die vorliegende Dissertation einen Beitrag leisten.
1.1.3 Quellen
Grundlage dieser Forschungsarbeit zu Antonia Werr sind die im Archiv des Klosters Oberzell aufbewahrten Ego-Dokumente55 der Gründerin. Dazu zählen ihre Briefe – in erster Linie die erhaltene Korrespondenz mit dem Münchner Staatsrat Freiherrn Maximilian von Pelkhoven (1796–1864) – und ein geistliches Tagebuch aus den 1840er Jahren. Weitere Quellen sind Werrs geistliche Schriften, Statuten, Satzungen, ihre Hausordnung sowie andere historische Dokumente aus der Anfangszeit der Kongregation wie Todesanzeigen, Nachrufe, Jahresberichte, Zeitungsartikel, Tagebücher und Protokollbücher, in denen Ereignisse chronologisch dokumentiert wurden, und Bücher aus Werrs Nachlass.
1.1.3.1 Korrespondenz mit Maximilian von Pelkhoven
Im Oktober 1853 hatte sich Antonia Werr nach München begeben, um im bayerischen Staatsministerium des Inneren das Gesuch einzureichen, eine katholische[] Anstalt für Besserung verwahrloster Personen des weiblichen Geschlechts56 zu gründen und zu diesem Anlass den in Unterfranken gelegenen Burkardusberg bei Marktheidenfeld mit der Ruine Homburg zu kaufen.57 Der für Homburg zuständige Pfarrer Valentin Kehrer hatte ihr geraten, sich an Maximilian von Pelkhoven zu wenden und ihr eine Referenz für den Staatsrat mitgegeben.58 Diese Begegnung zwischen den beiden Katholiken stellte den Beginn einer langjährigen Korrespondenz und „besonderen Freundschaft“59 dar. Der Briefwechsel erstreckte sich vom 8./9. November 1853 bis 6. September 1864,60 kurz vor Pelkhovens Tod.61 Er umfasst 205 Briefe, die zusammen mit den wichtigsten Anlagen in den 1990er Jahren aus der deutschen in die lateinische Schrift transkribiert wurden.62 Die computergestützte Erfassung von 1991 zählt 937 Seiten und wurde in sieben Bänden für den klosterinternen Gebrauch editiert.63
1.1.3.2 Vernichtete Selbstzeugnisse: Die gelben Blätter
Parallel zu ihren seitenlangen Briefen verfasste Werr für Pelkhoven sukzessive auf gelbem Papier ihre Autobiografie, um ihn teilhaben zu lassen an ihrem Werdegang und ihm ihre Motivation für die Gründung einer neuen religiösen Vereinigung darzulegen.64 In den Briefen erwähnte sie diese Extrapost. Die erste Sendung enthielt eine Zusammenfassung ihrer Kindheitserlebnisse und entstand zwischen der ersten Begegnung mit Pelkhoven im Oktober 1853 und Mai 1854.65 Mit dem Brief vom 3. Juli 1854 schickte Werr weitere autobiografische Aufzeichnungen auf gelbem Briefpapier nach München, die ihre Kindheits- und Jugenderlebnisse bis zu ihrem 16. Lebensjahr umfassten:66
„Was dieselben [die gelben Blätter, K. G.] Ihnen bis jetzt boten, ist nur ein kleiner Theil eines, an den verschiedensten Leiden, sehr reichen Lebens; denn zwischen 16 und 40 Jahren liegt noch ein sehr langer, langer Zeitraum, besonders wenn dieser in der Schule des Kreuzes durchlaufen worden ist. […] Sie werden am Ende der Beschreibung begreifen, woher mir der Muth gekommen, bei so schwierigen Zeitverhältnissen mich dennoch muthig an ein so großes Unternehmen zu wagen trotz dem ich nicht jene Triebfeder besitze, welche alles in Bewegung setzen kann;– Geld nämlich, um etwas aushalten zu können.“67
Offenbar sah Werr die vier Jahrzehnte ihres bisherigen Lebens als Leidensschule. Die nächste Sendung umfasste neun Seiten. Werr legte sie nach mehrmaligem Zögern dem Brief vom 15. September 1854 bei und brachte mit ihnen nach eigenem Bekunden einen ganzen Lebensabschnitt zu Ende.68 Ihre uneingeschränkte Offenheit, mit der sie sich Pelkhoven anvertraute, verglich Werr mit der Gewissenhaftigkeit bei einer Generalbeichte:69
„Hochgeborener Herr Staatsrath! Hier folgen endlich einmal die versprochenen gelben Blätter; es sind neun, und sie bilden den Schluß einer Lebens-Abtheilung. Die große Offenheit, die aus denselben spricht, werden Ew. Hochgeboren zu ermessen verstehen; denn ich schrieb in dem Geiste, als müßte ich eine Generalbeichte ablegen, wo man immer in solchem Falle etwas ängstlich ist, daß man nie Sündhaftes vergißt, oder beschönigt. Im Grunde genommen liegt mir auch eben so viel daran, von Ihnen recht erkannt zu werden, als wie von meinem Beichtvater […]. Doch wenn Sie beim Schlusse der überschickten Blätter gestehen müssen, daß ich viel erfahren habe und viel versucht worden bin, so muß ich, gleichsam als Motto für die Fortsetzung noch bemerken, daß das, was ich hier niederschrieb, nur das Vorspiel noch weit größerer Leiden und Trübsale war, die mich von der Zeit an trafen, wo ich mit der Welt, so zu sagen, Feindschaft angefangen habe.“70
Nachweislich zog sich das Motiv der „Leiden und Trübsale“ weiter durch Antonia Werrs Leben und sollte sich mit ihrem dezidierten Entschluss zu einem Leben der Nachfolge noch potenzieren. Mehrere Male kündigte Werr an, weitere gelbe Blätter schicken zu wollen bzw. bedauerte, dass es ihr noch nicht möglich war, ihre Autobiografie fortzusetzen.71 Pelkhoven war von den Aufzeichnungen Werrs beeindruckt, erkannte er doch darin ihr authentisches Streben nach Wahrheit und die Fügungen Gottes:
„Aber wie soll ich meinen Dank für Ihre VertrauensMittheilungen ausdrücken! […] Seyen Sie versichert, diese gelben Blätter sind mir ein Heiligthum, machen tiefen Eindruck auf mich, zeigen reichlich, wie ein gutes Saamenkorn sich durch das Erdreich durchwindet, allmählig in sich selbst erstirbt, um neugeboren durch Christus aufzukeimen und vielfältige Früchte zu bringen. Gott hat Sie unendlich lieb, er hat Ihre Natur mit einer Kraft ausgerüstet, welche, wenn sie zu ermüden drohte, stets neu aufgestachelt wurde. Das Streben nach Wahrheit, wenn es auch durch viele Irrwege, beruhend auf dem Gemische der inneren und der äußeren Welt, führt, aber als wahres Streben sich kund giebt, dringt zuletzt immer durch und erfaßt die ewige Wahrheit und bleibt dieser sodann um so treuer, je mühsamer und schmerzenreicher sie hiezu gelangte.– Einem solchen Gemüthe bleibt Täuschung der Empfindung – GefühlsWeichlichkeit – fremder als den in Wohllust der Sentimentalität schwimmenden Seelen.– Bleibt der Wille als solcher ernst und beharrlich, so kann das Unkraut des Irrthums den Keim des von Gott in des Menschen Herz gelegten guten Saamenkorns nicht ersticken“.72
Leider sind diese Selbstzeugnisse Werrs nicht mehr erhalten. Sie hätten ein tieferes Verständnis für Biografie und Leben Antonia Werrs, ihre persönlichen Überzeugungen, Erkenntnisse und handlungsleitende Motivation für ihr Lebenswerk eröffnen können. Immerhin lassen sich bisweilen Rückschlüsse auf die Inhalte ihrer Lebensmitteilungen aus den Reaktionen Pelkhovens sowie aus Werrs eigenen Kommentaren und Verweisen in ihren Briefen ziehen. So lässt sich rekonstruieren, dass die vernichteten Aufzeichnungen Pelkhoven Aufschluss gaben über ihr Ringen in religiösen Fragen sowie ihre Erfahrungen und Auseinandersetzungen im Spannungsfeld der katholischen Kirche. Werr teilte ihm persönliche Schicksalsschläge, enttäuschende Erlebnisse mit Vertretern der Kirche und des Minoritenordens genauso mit wie andere Anfeindungen, Leiden und Glaubenszweifel. Insbesondere scheint sie eine Zeit lang verunsichert gewesen zu sein, ob sie überhaupt in der katholischen Kirche bleiben könne; ein Beichtvater, bei dem sie Trost und Rat suchte, scheint sie zudem nicht verstanden zu haben.73
Was aber geschah mit diesen gelben Blättern nach dem Tod Pelkhovens? Zu seinen Lebzeiten hatte er sich gewünscht, dass ihre vertrauliche Korrespondenz nicht in andere Hände gelangen sollte:
„[H]insichtlich unserer Correspondenz erlaube ich mir die Bemerkung, dass es schade wäre, wenn sie je in andere Hände käme, da sie nur für uns ist. Hiefür bitte ich Sie, richtige Vorsorge zu trefen [sic!]. – Würde ich sterben vor Ihnen, so gelangt sie ungelesen von Dritten, da ich auf meine Erben mich ganz verlassen kann, in Ihre Hände zurück.– Ich überlasse es ganz Ihrem Ermessen, ob Sie vernichten, oder ausmustern, oder behalten und wir für den Todesfall sorgen wollen. Vieles ist im Laufe der Zeit überflüssig geworden, daher vielleicht zur Vernichtung geeignet.“74
Mit einer Sendung vom 27. September 1864 gelangten die Briefe Werrs einschließlich ihrer Lebensaufzeichnungen durch eine Nichte Freiherr von Pelkhovens, Minna Marc, nach Oberzell zurück.75 Bisher wurde in der Forschung vermutet, dass Antonia Werrs Beichtvater und der erste geistliche Direktor in Oberzell, Pater Franz Ehrenburg, die gelben Blätter vernichtet habe.76 Diese These lässt sich jedoch nicht halten. Nachweislich hat der Franziskaner-Minorit 1880 den übrigen Schriftwechsel Werr–Pelkhoven durchgesehen.77 Dabei zensierte er Stellen, die er als problematisch ansah, weil sie entweder Antonia Werr, Vertreter der kirchlichen Hierarchie – insbesondere den Würzburger Bischof Georg Anton von Stahl78 sowie Mitglieder des Ordinariats – oder Schwestern anderer geistlicher Gemeinschaften, wie etwa die aus dem Elsass stammenden Niederbronner Schwestern, in ein ungünstiges Licht stellten; manche Textpassagen oder Briefe vernichtete Ehrenburg gänzlich, wie sich aus dem Kontext erschließen lässt. Allerdings dokumentierte er seine Zensuren genau und fasste den Inhalt der vernichteten Briefe zusammen. Gleichzeitig fehlt jeder Hinweis von ihm, dass er auch die gelben Blätter beseitigt habe. Das muss verwundern. Bei der Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit, die Ehrenburg bei der Briefzensur an den Tag legte, wäre anzunehmen, dass er erst recht eine Notiz über die Vernichtung der autobiografischen Mitteilungen der Gründerin angefertigt hätte.
So liegt der Gedanke nahe, dass Antonia Werr eigenhändig ihre Schriften beseitigt hat, nachdem sie durch die Nichte Pelkhovens im Herbst 1864 in ihre Hände zurückgelangt waren. Da sie ja ausdrücklich nur für Pelkhoven bestimmt gewesen waren, wird sie selbst Sorge dafür getragen haben, dass sie nach ihrem eigenen Tod, den sie aufgrund ihrer schwachen Gesundheit immer vor Augen hatte, nicht der Nachwelt erhalten blieben.
1.1.3.3 Geistliche Schriften und Regeln
Eine wichtige Quelle ist das so genannte Gebet- und Betrachtungsbuch,79 das tagebuchähnliche Aufzeichnungen Werrs aus der Zeit vor der Gründung ihres Institutes enthält. Diese vermutlich während ihren Betrachtungszeiten zwischen den Jahren 1845 und 1848 geschriebenen Gebete und Meditationen gewähren „einen tiefen Einblick in das persönliche Verhältnis Antonie80 Werrs zu Gott und den Heiligen“.81 Die Originalität der Aufzeichnungen bestätigte Pater Franz Ehrenburg mit einer handschriftlichen Eintragung.82
Weitere Quellen sind die von der Gründerin 185483 verfassten und 1857 überarbeiteten Statuten bzw. Satzungen für die Rettungsanstalt bzw. den katholischen Jungfrauenverein zur hl. Kindheit Jesu. Sie wurden während ihrer Entstehungsphase von mehreren Autoren bearbeitet, korrigiert oder ergänzt und schließlich gedruckt.84
Nicht gedruckt, sondern nur für den Gebrauch in der Gemeinschaft bestimmt, war das 1854 in Anlehnung an die Karmelitin Margaretha von Beaune (1619–1648) vollendete Buch mit Gebete[n] und Betrachtungen zu Ehren der Kindheit Jesu.85 Zur Genese dieses Buches kam es durch ein privates Gelöbnis:
„Das Buch verdankt seine Entstehung vielen großen Leiden und Verfolgungen, welche im Jahr 1851 über mich herein brachen und folglich auch meinen Seelenführer berührten. Vor dem göttlichen Kinde […] und in Gegenwart des hl. Sakramentes gelobte mein Beichtvater und ich dasselbe zu schreiben […]. Wir gelobten es, als Schutz wider unsere Feinde, wider alle Gefahren und Versuchungen und um dadurch die Ehre Gottes zu befördern.“86
Außerdem verfasste Antonia Werr zwischen Juli 1857 und 1866 handschriftlich eine Hausordnung, die mehr als 332 eng beschriebene Seiten umfasst. Darin regelte sie minutiös das gesamte Alltags- und spirituelle Leben der Schwesterngemeinschaft sowie die zu erledigenden Aufgaben und Regeln im Umgang mit den Klientinnen.87 Das geistliche Vorwort zu diesem Regelwerk nannte sie auch ihr Testament.88
Bei all den genannten Quellen handelt es sich um völlig unterschiedliche Genres: Die Korrespondenz mit Pelkhoven und die Niederschriften ihrer geistlichen Erlebnisse sind vertrauliche biografische Zeugnisse der Gründerin. Sie waren nie dazu bestimmt, in andere Hände zu gelangen. Dagegen sollten die Statuten und Satzungen über die interne Zielgruppe der Mitarbeiterinnen hinaus eine möglichst breite Leserschaft und Öffentlichkeit erreichen, um ihr Unternehmen bekannt zu machen und die Wohltätigkeit zu fördern. Zu den Adressaten zählten zudem die zuständigen weltlichen und kirchlichen genehmigenden Behörden. Neben Rezensionen in Zeitschriften zählen gedruckte Vorträge oder Statuten genauso wie Lieder, Gebete, Gedichte, Beispielerzählungen oder Verkündigungstexte zu den Quellen des Armutsdiskurses im 19. Jahrhundert.89
1.1.4 Zentrale Begriffe
SoziologInnen haben bei dem Versuch, den Begriff Kreativität zu fassen, festgestellt, dass es sich um ein „Modewort“90 oder sogar ein „Heilswort“91 der Gegenwart handelt:
„Was auch immer das Problem ist, Kreativität verspricht die Lösung. Der Glaube an die schöpferischen Potenziale des Individuums ist die Zivilreligion des unternehmerischen Selbst.“92
Zunächst einmal hat das lateinische Ursprungswort creare, schaffen, einen genuin schöpferischen Sinn. Denn zur Wortsippe gehört crescere, wachsen, und die Partizip-Perfekt-Passiv-Konstruktion konkret (von lat. con-crescere).93 So ist Kreativität in sich ein polarer Begriff: Er bezeichnet einerseits Schaffenskraft, d. h. Potential zu aktivem gestalterischen Wirken; gleichzeitig beinhaltet er den passiven Aspekt des Wachsens und wachsen Lassens. Der aktive und passive Teil gehören untrennbar zusammen. Das, was geschaffen wird, und das, was wächst und geschieht, ergeben zusammen etwas Verdichtetes, Handfestes, Konkretes.94 Menschliche Kreativität ist nicht machbar, sie geschieht. Sie ist Inspiration, Eingebung und Geistesblitz, lässt sich nicht manipulieren, sondern ereignet sich frei. Sie ist geschenkt und – „theologisch gesprochen: ein Wunder.“95 Der Begriff umfasst die Polarität des problemlösenden Handelns im Sinne der „Invention und Innovation“96, die auf Herausforderung situativ antwortet, und das scheinbare Gegenteil davon, nämlich das Spiel als schöpferisches zweckfreies Handeln.97
Auch in der Biologie und Fortpflanzung ist Kreativität gebunden an Geben und Nehmen, Zeugung und Geburt. In dieser ganzen Spannbreite, Ambivalenz und Unfassbarkeit ist Kreativität in jedem Fall Quelle von etwas Neuem, selbst wenn sie oft genug auf etwas Altem oder Vorgegebenem aufbaut.98 Kreativität schenkt Fruchtbarkeit, eröffnet Zukunft, entdeckt Verborgenes, bereitet Wege, über sich hinaus, wagt Ungewohntes, erdenkt Lösungen, erobert Unbekanntes, erkämpft Freiheit, überschreitet Grenzen und stiftet Gemeinsames. Sie experimentiert und riskiert, probiert und scheitert, erreicht ein Ziel und geht weiter, sie gibt nicht auf und lässt immer wieder anfangen. Schließlich speist sich menschliche Kreativität „aus den Potentialen der Lust und Erotik, Sinnlichkeit und Leidenschaft“99:
„Was die Lust die Menschen in sinnlich-erotischer Hinsicht lehrt, hat auch Glaubens Kraft sowie politische Kraft. Sich den eigenen Wünschen und Sehnsüchten zu öffnen […] birgt nicht nur individuelle Veränderung, sondern schafft auch Neues in Kirche, Politik und Gesellschaft. Eroberungen in allen Belangen des Lebens zu erproben und sich dem hinzugeben, was das Leben bereithält, sind Akte, die Frauen und Männern Grenzüberschreitungen abverlangen, sie aber auch aus der Isolation ihres Daseins herausführen.“100
Grenzüberschreitungen sind die Bedingung der Möglichkeit von Kreativität. Nichts Neues entsteht ohne sie. Sie sind aber auch gefährlich, weil sie offen und verletzlich machen.
Kreativität – so lautet die zentrale These dieser Arbeit – ist ohne Vulnerabilität nicht zu haben, und Vulnerabilität wiederum fordert geradezu heraus, kreativ zu werden. In dem Versuch also, „etwas Brüchiges tragfähig“ (Gesa Ziemer) zu machen, entfaltet der Mensch Kreativität. Vulnerabilität ist ein weites Feld, auf dem derzeit intensiv geforscht wird.101 In der Theologie beschäftigen sich vor allem Ethik, Moraltheologie und die Pastoralpsychologie mit der Vergänglichkeit und Anfälligkeit menschlichen Lebens und suchen Antworten auf die Frage, wie die Würde des Menschen in allen Phasen geschützt werden kann.
Als Homo sapiens ist der Mensch in der Lage, seine Conditio humana als Homo patiens auszugleichen. Er muss erfinderisch bleiben, um auf neue Bedrohungen kreative Antworten zu finden, die sein Überleben ermöglichen. Die potentielle Verwundbarkeit ist sozusagen die Conditio sine qua non, die den Menschen zu Innovationen antreibt. Grenzen überschreiten heißt, in fremdes Gebiet eindringen. Eroberungen jedweder Art können helfen, Neuland zu entdecken, sie können aber auch Leben bedrohen und Integrität zerstören.102
Im Bereich der Theologie machen kreative Grenzüberschreitungen Hoffnung.103 Die Inkarnation Gottes in Jesus war ein solcher kreativer Akt der Selbstüberschreitung Gottes auf den Menschen hin. Dieses Menschsein Gottes ging nicht am Menschen vorbei, sondern durch eine Frau hindurch. Nach dem ersten Schöpfungsakt bei der Creatio ex nihilo verzichtete Gott sozusagen auf eine eigenmächtige und alleinige Handlungsform. Im Lauf der Heilsgeschichte verband sich die göttliche Inkarnation mit der menschlichen Con-creation. Die eine Seite der Vulnerabilität Gottes zeigte sich also darin, dass Gott sich verletzlich machte und sich dem JA Marias ausgeliefert hat, Mit-Schöpferin zu werden an seiner Inkarnation.104 Die zweite Seite seiner Vulnerabilität ist: Er wird selbst klein und nimmt im Kind Jesus die äußerste zerbrechliche menschliche Existenz an. Noch dazu gibt er sich selbst und damit sein Schicksal in die Hände der Menschen. Bis zur Einsetzung der Eucharistie und seinen Tod am Kreuz bleibt er sich in dieser Form der Totalhingabe und Auslieferung an die Menschen treu.
Dogmatisch und fundamentaltheologisch ist demnach die Vulnerabilität eine höchst brisante Angelegenheit. Immerhin ist das Credo, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, dass er also greifbar und leibhaftig mit Haut und Haar ein menschliches und damit verletzbares Leben geführt hat, ein unverrückbarer Glaubenssatz des Christentums, der von den Kirchenvätern gegen alle „Trojaner-Theorien“105 in den ersten Jahrhunderten erkämpft und verteidigt worden ist. Mit dem Bekenntnis zu Jesus Christus steht und fällt der Glaube an einen Gott, der in seinem Sohn die menschliche Natur nicht nur scheinbar, sondern wahrhaftig angenommen hat. Über diesen irdischen Jesus zu sprechen heißt, sich mit der Verwundbarkeit Gottes zu beschäftigen. In der Theologie hat die Vulnerabilität Gottes seit dem Holocaust im Zweiten Weltkrieg eine neue Plausibilität erhalten.106 Die Inkarnation, das Leiden und grausame Sterben Jesu durch Foltertod verhelfen der Theologie und Religionsphilosophie zu einem neuen Sprechen vom schwachen, passiven und verwundbaren Gottessohn, der Todesangst hatte, im Gegensatz zur androzentrisch geprägten Rede vom überlegenen, ewigen, allgegenwärtigen, omnipotenten, vollkommenen und gütigen Gott.107
Diese Arbeit untersucht am Beispiel Antonia Werrs, inwiefern ihr Glaube an den verwundbaren Gott sie sensibilisierte für die Nöte und Wunden der Menschen ihrer Zeit und wie sie ihnen kreativ handelnd begegnete bzw. welche Anregungen für die Pastoral daraus für heute entwickelt werden können.
1.1.5 Aufbau
Das epistemologische Interesse dieser Arbeit ist nicht in erster Linie ein historischer Erkenntnisgewinn, auch wenn der Ort, an dem die Fragestellung untersucht wird, in der Vergangenheit liegt. Vielmehr wird die Analyse an dem spezifischen geschichtlichen Ort von einem feministisch-pastoraltheologischen Interesse geleitet. Deshalb beschränkt sich auch die im Kapitel 1 erfolgende historische Einordnung Antonia Werrs als einer Gründerin weiblicher Frauengenossenschaften im 19. Jahrhundert auf einschlägige Werke und Literatur. Herausgegriffen aus diesem Kontext des so genannten Frauenkongregationsfrühlings werden zunächst allgemein einige Initiativen dargestellt, von denen Werr lernen sollte.
Kapitel 2 beschäftigt sich näherhin mit der Person der Gründerin, ihrem Lebenslauf, den Jahren ihrer inneren und äußeren Suche und schließlich den Anfängen in Oberzell. Unter Berücksichtigung der Genderperspektive werden die sie unterstützenden Zeitgenossen dargestellt und nun konkret untersucht, wie sich Werr von anderen Gründungen inspirieren ließ oder inwiefern eine Konkurrenz bestand. Zentral wird dargestellt, wie Werr mit den patriarchalen Gegebenheiten in der Gesellschaft und Kirche umging und was sie unternahm, um solidarisch an der Seite von Geschlechtsgenossinnen zu stehen, die noch weit mehr als sie selbst unter den Exklusionsmechanismen der damaligen Zeit zu leiden hatten.
In einschlägigen Monografien und Aufsätzen zu den Frauenkongregationen des 19. Jahrhunderts wurde den zahlreichen Gründerinnen einerseits unterstellt, die kleinliche Festlegung auf Teilaspekte christlicher Frömmigkeit bzw. „sekundäre Elemente des Christusgeheimnisses, der Marien- und Heiligenverehrung oder des christlichen Lebensvollzuges“108 hätten lediglich den Sinn und Zweck gehabt, deren „Selbstständigkeit gegenüber anderen Kongregationen zu demonstrieren [und ihre, K. G.] Eigenständigkeit zu legitimieren“.109 Andererseits wird großer Forschungsbedarf im Hinblick auf die Spiritualität und die Charismen der Kongregationen des 19. Jahrhunderts festgestellt:
„Es fehlt an Untersuchungen über die Spiritualität der Kongregationen sowie darüber, wie sie auf die Bedürfnisse ihrer Zeit eingingen und zur Emanzipation der Frau beitrugen.“110
Die spirituelle Vielfalt der religiösen Genossenschaften wissenschaftlich zu untersuchen und deren motivierende Kraft für die pastorale Praxis und das gemeinschaftliche Leben der Kongregationen zu erschließen, bleibt ein Feld, auf dem noch viel geforscht werden kann.111
Konsequenterweise wird Kapitel 3 nach den spirituellen Quellen gewagter Hingabe bei Antonia Werr und den Dienerinnen der hl. Kindheit Jesu gefragt: Welchen Sinn und Halt schöpften sie aus dem Bekenntnis, dass Gott in Jesus die Gestalt eines Kindes angenommen und eine Kindheit erlebt hat? Wozu eignete sich das betende und meditierende Nachgehen der zwölf Stationen seiner Kindheit? Welchen handlungsleitenden Impuls hatte die vom Geheimnis der Inkarnation geprägte Frömmigkeit für die Resozialisierung strafentlassener Frauen?
Methodisch wird zunächst zum Verständnis der christologischen Reflexion, ihrer spirituellen Ausgestaltung und Anweisungen für das sozial-pastoral Handeln der Schwestern, auf die Quellentexte Antonia Werrs zurückgegriffen. Anschließend werden die spirituellen Ressourcen Antonia Werrs in einen konstruktiven Dialog mit zeitgenössischen Ansätzen gebracht, in denen es analytische Bezugspunkte zu ihrem sozial-pastoralen Ansatz gibt. Biblische, philosophische, psychologische und pastoraltheologische Analysen einer Spiritualität der Verwundbarkeit werden mit Werrs geistlichen Übungen kontrastiert, so dass es zu neuen Erkenntnissen für beide Seiten kommen kann.
Antonia Werr fand religiös in der an Weihnachten konkret fassbaren Inkarnation Gottes im Jesuskind den Glauben an die unzerstörbare Menschenwürde und Gottebenbildlichkeit jedes Menschen, die sie allen Widerständen zum Trotz zu einem solidarischen Mitsein an der Seite von sozial wie kirchlich exkludierten Frauen befähigte. So liegt es nahe, sich mit den biblischen und in Ansätzen apokryphen Kindheitsgeschichten Jesu zu befassen und rückwirkend die Korrelation zwischen dem sich klein, schwach, arm und ohnmächtig offenbarenden Jesuskind und einer an der Gotteskindschaft sich orientierenden sozial-pastoralen Handlungspraxis einer Katholikin des 19. Jahrhunderts zu untersuchen.
Die Theorie der Heterotopien von Michel Foucault scheint als Kategorie geeignet, um zu analysieren, inwiefern das Gründungsprojekt Antonia Werrs als kreative Antwort auf den Strafvollzug im 19. Jahrhundert und die weitgehende Passivität der Kirche bei der Resozialisierung Haftentlassener als Anders-Ort verstanden werden kann.112 Nach der Explikation der Begrifflichkeit werden die Quellen befragt, inwiefern gerade das Aufspüren gesellschaftlicher Utopien Antonia Werr motivierte, innovativ zu werden und einen Heterotopos als Gegenmacht zu entwürdigenden Nicht-Orten zu schaffen. Zudem finden sich im philosophischen Denken Hannah Arendts mit der Natalität bzw. Gebürtlichkeit Begriffe, die die Spiritualität der Dienerinnen der hl. Kindheit Jesu und deren Bemühen um Gestaltung von Neuanfängen in scheinbar ausweglosen Situationen erhellen können.113
Als kontrastive Ergänzung zu den spirituellen Übungen Antonia Werrs wurde das aus der Jungschen Analytischen Psychologie stammende Konzept des so genannten Inneren Kindes sowie die Arbeit mit den so genannten Ego-States gewählt. Durch die Konfrontation mit diesen Therapieansätzen, die heute bei der Aufarbeitung traumatischer Erfahrungen hohe Anerkennung besitzen, soll geforscht werden, inwieweit die zur Verehrung des Jesuskindes verwandten spirituellen Praktiken Antonia Werrs mit den praktischen Übungen aus der Psychotherapie zu vergleichen sind und ob daraus neue Erkenntnisse gewonnen werden können.
Aus der Fülle möglicher systematisch-theologischer Zugriffe, die – ähnlich wie die franziskanische Spiritualität, in der Antonia Werr ihre Wahlheimat fand – das christologische Kenosismotiv zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen machen, wurden drei Ansätze ausgewählt, die handlungstheoretische Implikationen beinhalten und die Kenosis-Christologie Antonia Werrs im Zusammenhang mit ihrem sozial-pastoralen Handeln erschließen sollen. Während in den Christologien Sarah Coakleys und Hildegund Keuls zusätzlich die Vulnerabilität als zentrale Kategorie fungiert, zielt Ansgar Kreutzers Kenopraxis auf die bleibende Bedeutung eines spezifisch christlich motivierten solidarischen Handelns ab.
In Kapitel 4 schließlich wird der Ertrag aus den voran gegangenen Kapiteln in den pastoraltheologischen Diskurs der Gegenwart eingebracht. Angesichts einiger drängender Fragen wird mit Blick auf die Außenperspektive der Kirche (ecclesia ad extra) gefragt, was das Existential der Verwundbarkeit und des Verwundetseins für den pastoralen Auftrag der Kirche in der Spätmoderne bedeutet und welche Chancen des kreativen Umgangs unter dem Anspruch der Heil bringenden Botschaft Jesu Christi sich daraus ergeben.
Nach innen gewandt wird mit dem Blick auf die ecclesia ad intra sodann zu fragen sein: Wie kann Kirche auf die Wunden, die sie zum Teil selbst geschlagen hat, heute angemessen und das Evangelium glaubhaft verkündigend reagieren? Welche Möglichkeiten eröffnen sich Menschen – insbesondere Frauen – heute, mit den ihnen von der Kirche durch die anhaltenden strukturellen Hindernisse zugefügten Wunden umzugehen? Sind das Sich-Abwenden, Weggehen und der Kirchenaustritt die einzige Lösung?114 Oder könnten sich nicht gerade für Menschen, die sich trotz oder in ihrer Vulnerabilität für das Bleiben entscheiden, Möglichkeiten eröffnen, aus ihren Ohnmachtserfahrungen Autorität und Kreativität für ihr Handeln zu gewinnen?115
So darf Kapitel 4 als Versuch angesehen werden, aus der voran gegangenen Rekonstruktion der Fragestellung am historischen Ort und der mit Hilfe zeitgenössischer Zugriffe dekonstruierten Kenosis- und Menschwerdungstheologie Antonia Werrs einige responsive Skizzen in die Landschaft der gegenwärtigen Herausforderungen unserer Zeit zu zeichnen und damit Impulse zu geben für eine geschlechtersensible, inkarnatorische kirchliche Praxis.
1.2 Historische Kontexte: Aufbrüche, Umbrüche, Ausbrüche im 19. Jahrhundert
Antonia Werr als Forschungsgegenstand dieser Arbeit ist eine von vielen Frauen, die im so genannten langen 19. Jahrhundert eine neue religiöse Genossenschaft ins Leben rief.116 Um sie und ihre Initiative mit ihrer Spiritualität und ihrem spezifischen Apostolat in den Folgekapiteln besser darstellen und einordnen zu können, soll hier zunächst ein Überblick über die breit einsetzende weibliche Aufbruchsbewegung innerhalb der katholischen Kirche im europäischen Raum gegeben werden. Die Auswahl einiger Kongregationen und Projekte in diesem Kapitel geschieht mit dem Fokus auf deren Bedeutung für Antonia Werr. Sie werden hier zunächst allgemein vorgestellt, die konkreten Bezüge und Berührungspunkte sodann im Folgekapitel eingehender erläutert.
1.2.1 Erneuerung der Kirche durch traditionsbewusste Frauen
Das 19. Jahrhundert war – zumindest im europäischen Kontext – eine Epoche des Fortschritts. Die technische und maschinelle Entwicklung ermöglichte bahnbrechende Erfindungen, die den industriellen Aufschwung bewirkten. Während die einen von den Neuerungen profitierten und wirtschaftlichen Wohlstand und Bildungsmöglichkeiten genossen, wurden andere in neue Armut getrieben. Sie litten unter den Arbeitsbedingungen in den Fabriken und mangelnder Hygiene in den Armenvierteln der Städte. Den Idealen und Freiheiten der bürgerlichmännlichen Elite standen die Unfreiheit der lohnabhängigen Familien und insbesondere das Elend von Frauen und Kindern gegenüber.
In politischer und sozialer Hinsicht fanden gravierende Umwälzungen statt. Nach der Niederschlagung der französischen Aufstände kämpfte Napoleon europaweit um die Vorherrschaft. In kurzen zeitlichen Abständen wurden die Territorien von wechselnden Monarchen regiert oder tranchenweise anderen Herrschaftsgebieten zugeordnet. Gleichzeitig hielten die Revolutionen an. Die Opfer, die die Französische Revolution hinterließ, und die Neuordnung Kontinentaleuropas durch Napoleon brachten für die katholische Kirche Macht- und Bedeutungsverlust. Zwischen Revolution und Restauration war die katholische Kirche gespalten zwischen denen, die sich in die Wagenburg einer emotionalisierten Volksfrömmigkeit mit bewusst antiaufklärerischem Impetus flüchten wollten, und jenen, die versuchten, das Gedankengut der Aufklärung in ihre Lehre zu integrieren. Diesen Richtungskampf entschieden schließlich die ultramontanen, streng auf Rom hin ausgerichteten Kräfte 1869/70 auf dem Ersten Vatikanum endgültig für sich.117
Die Gründerinnen der neuen Kongregationen im 19. Jahrhundert standen in diesem Spannungsfeld. Nicht ohne kritischen Blick, aber auch teilweise mit Sympathien für manche Ideen der Aufklärung versuchten sie, neue Wege und Angebote für die Identifikation von und Tätigkeitsfelder für Frauen zu finden. Gestützt auf das Modell von sozialer Mutterschaft118 wurden sie durch ihre starke Ausrichtung auf ihre Sendung eher unbeabsichtigt zur „Avantgarde“ im kirchlich-pastoralen Handeln.119
Das mit Ordens- oder Frauenkongregationsfrühling 120betitelte Phänomen setzte flächendeckend ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ein.121 Wie der metaphorische Begriff bereits nahelegt, handelte es sich bei dem „Frühling“ um ein neues Aufblühen weiblicher Religiosengemeinschaften. Der Vergleich mit der ersten Jahreszeit veranschaulicht, dass dieses Ereignis nicht erst- und einmalig im 19. Jahrhundert auftrat, sondern in periodischer Wiederkehr in der Kirchen- und Ordensgeschichte mehrfach vorgekommen ist.122 Ähnlich wie beim Zyklus der vier Jahreszeiten erfolgten im Ordensleben nach einer Phase der Genese, des Erstarkens und der Konsolidierung123 Stagnation und Regression124 und teilweise der völlige Niedergang, bis schließlich andere Zeiten neue Initiativen hervorbrachten und das religiöse Leben in veränderter Form wieder erwachte.125
Als Beispiele für das „Frühlings-Phänomen“ seien die Armuts- und Beginenbewegung im 12./13. Jahrhundert angeführt126 oder die ersten Frauengemeinschaften, die sich in der Zeit der Gegenreformation im 16./17. Jahrhundert über die für Frauenorden geltenden strengen Klausurvorschriften hinwegsetzten127, um sich, wie etwa die Ursulinen oder die von Mary Ward gegründeten „Englischen Fräulein“128, der Mädchenbildung zu widmen.129 Neue Formen entstanden jeweils eingebettet in ihren geschichtlich-gesellschaftlichen Kontext:
„Sie entstanden, wenn die Gesellschaft neue spirituelle Bedürfnisse wachsen ließ, die alten Formen keine geeignete Antwort mehr darauf waren und die Gesamtkirche der pastoralen Herausforderung der entsprechenden Zeit (noch) nicht gewachsen war.“130
Im 19. Jahrhundert war das Aufblühen der Frauengemeinschaften so stark wie nie zuvor, ja es erlebte „einen geradezu explosiven Aufschwung“131. Weltweit wurden 571 Kongregationen päpstlich anerkannt.132 In Deutschland entstand im Schnitt ab den 1830er Jahren jedes halbe Jahr eine neue Schwesterngemeinschaft, so dass es bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 350 Mutter- und Provinzhäuser gab. In Bayern zählte man 40 Jahre nach der Säkularisation bereits wieder 75 Frauenklöster und Filialen mit 1093 Mitgliedern.133 In Preußen fand der größte Gründungsboom zwischen 1840 und 1860 statt.134 Diese Dynamik wurde ausgelöst und verstärkt durch die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse. Wie konnte es zu diesem enormen Boom kommen?
Ein Grund war, dass Männer und Frauen, die sich als überzeugte KatholikInnen verstanden, die Religionskritik radikaler AufklärerInnen und die Säkularisation als „kalten Wind“ wahrnahmen, der ihnen von außen entgegen blies. Ihr Anliegen war, dazu beizutragen, „die der hl. Kirche zugefügten Wunden zu heilen.“135 Aus der Bindung an und der Identifizierung mit der katholischen Kirche heraus wollten sie zu deren Erneuerung und Erstarken beitragen und die Gesellschaft (wieder) mit christlichem Gedankengut in Verbindung bringen. Als probates Mittel wählten sie dazu tatkräftiges, pragmatisches Handeln gegenüber Dogmatismus oder teilweise realitätsferner Engstirnigkeit mancher Vertreter der kirchlichen Hierarchie.136 Eindeutig gingen die Anstöße für den „konkreten Neuaufbau […] nicht vom Klerus und noch weniger von der Hierarchie aus […], sondern vielmehr von privaten Zusammenschlüssen in katholischen Kreisen.“137 Diese Aufbrüche schöpferischer Kraft kamen in der katholischen Kirche von der Basis und waren getragen von charismatischer „Erstintuition“.138 Da die Initiatorinnen des Frühlings der Kongregationen in der überwiegenden Mehrzahl Frauen waren, kann man von einer „Frauenkongregationsbewegung“139 sprechen.
Das Interesse jener Frauen galt nicht in erster Linie der Theologie als Wissenschaftsdisziplin, sondern der praktischen Religionsgestaltung und -ausübung.140 Im Unterschied zu den gewachsenen Genossenschaften war das primäre Anliegen dieser engagierten Katholikinnen im 19. Jahrhundert nicht allein „Selbstheiligung“, sondern verbunden damit Evangelisation141 oder „Seelenrettung“142. Für die Mitglieder der Frauenkongregationen führte der Weg zur Heiligkeit nicht direkt zu Gott am Nächsten vorbei, sondern gerade über die Hinwendung zu den Kleinen, Armen, Schwachen und Kranken.143
Durch ein Leben für Gott im Dienst an Notleidenden wollten jene Frauen deren innerweltliche Situation verbessern und gleichzeitig zu deren ewigem Heil beitragen. Dafür hofften sie letztlich selbst auf das ewige Leben als gerechten Lohn für ihre aufopferungsvolle Proexistenz. Diese Intention und altruistische Ausrichtung verliehen den neuen Gemeinschaften im Gegensatz zu den alten Orden „Vitalität und geistliche[n] Schwung“144. So kam es aus diesem geistiggeistlichen Impetus heraus zu einem „Frühling der Caritas“145. Ein freiwillig gewähltes Leben in Ehelosigkeit und in Gemeinschaft mit anderen Frauen schien eine gute Ausgangsbasis für das selbstlose Dasein-für-Andere.
Häufig waren die Initiativen lokal ausgerichtet und antworteten auf bestimmte Notstände.146 Das Entstehungsmuster der Gründungen ähnelte sich: Religiös motivierte Frauen schlossen sich zusammen, riefen Verwandte oder Wohlhabende zu Spenden auf, um mit dem Geld Kranke zu pflegen, Arme zu besuchen, Kinder zu unterrichten oder Suppenküchen einzurichten. Früher oder später bezogen sie ein Haus und lebten in Gütergemeinschaft. Sie verbanden aktive und kontemplative Elemente des Ordenslebens, nahmen Notleidende auf, gaben sich eine Tagesordnung und bemühten sich schließlich um kirchliche und/oder staatliche Anerkennung. Oft wurden sie in ihren Bemühungen von Priestern, Ordensmännern oder Laien unterstützt.147 Manche GründerInnen inspirierten sich gegenseitig148 oder profilierten sich durch Abgrenzung und Ausdifferenzierung ihres spirituellen Fundaments sowie ihrer apostolischen Zielsetzung.
1.2.2 Voller Ambivalenzen: Der so genannte Frauenkongregationsfrühling





























