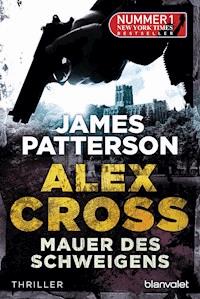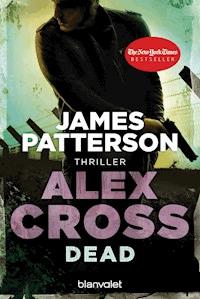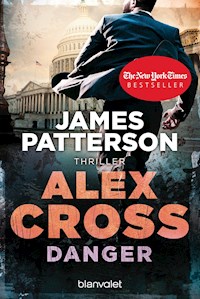
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Cross
- Sprache: Deutsch
Sechs Profikiller gegen Alex Cross – die Chancen stehen schlecht … für die Auftragsmörder!
***Jetzt verfilmt als Amazon Original Serie CROSS!***
Ganz Amerika betrauert den unerwarteten Tod von Präsidentin Catherine Grant. Fünf Tage später wird die US-Senatorin Elizabeth Walker von einem Attentäter erschossen – ein weiterer heftiger Stich ins Herz der Nation. Während die Polizei noch annimmt, dass die Politikerin von einem Fanatiker umgebracht wurde, ist Alex Cross überzeugt davon, dass hier ein Profi am Werk war. Der neue Präsident überträgt Cross die Leitung eines beispiellosen Ermittlungseinsatzes. Zusammen mit dem FBI und dem Secret Service macht er sich auf die Jagd nach dem Killer. Und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die die Vereinigten Staaten ins Chaos stürzen könnte.
Vom erfolgreichsten Autor der Welt: Der neue actiongeladene Thriller verspricht Nervenkitzel pur! Alle Alex-Cross-Thriller können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Ganz Amerika betrauert den unerwarteten Tod von Präsidentin Catherine Grant. Fünf Tage später wird die US-Senatorin Elizabeth Walker von einem Attentäter erschossen – ein weiterer heftiger Stich ins Herz der Nation. Während die Polizei noch annimmt, dass die Politikerin von einem Fanatiker umgebracht wurde, ist Alex Cross überzeugt davon, dass hier ein Profi am Werk war. Der neue Präsident überträgt Cross die Leitung eines beispiellosen Ermittlungseinsatzes. Zusammen mit dem FBI und dem Secret Service macht er sich auf die Jagd nach dem Killer. Und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die die Vereinigten Staaten ins Chaos stürzen könnte.
Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N. Y.
Die Titel der Alex-Cross-Reihe:
Hate Panic · Justice · Devil · Evil · Run · Dark · Cold · Storm · Heat · Fire · Dead · Blood · Ave Maria · Und erlöse uns von dem Bösen · Vor aller Augen · Mauer des Schweigens · Stunde der Rache
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Patterson
Danger
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Target Alex Cross« bei Little, Brown and Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by James Patterson
This edition arranged with Kaplan/DeFiore Rights through Paul & Peter Fritz AG.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Junede; My Agency; Orhan Cam)
JA · Herstellung: sam/er
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26674-5V001
www.blanvalet.de
Prolog
1
Es war kalt an diesem Morgen Ende Januar. Die Temperaturen waren bis auf vier Grad über null gefallen. Dennoch waren Hunderttausende gekommen, um der Prozession vom Capitol Hill bis zum Weißen Haus beizuwohnen.
Ich hatte mir zusammen mit meiner ganzen Familie einen Platz an der Ecke Constitution Avenue und Louisiana Avenue gesucht. Bree Stone, meine Ehefrau und Chief of Detectives des Metropolitan Police Department hier in Washington, stand in ihrer blauen Paradeuniform direkt vor mir.
Rechts neben mir befand sich mein zwanzigjähriger Sohn Damon, der am Vorabend aus North Carolina eingeflogen war. Er trug lange Unterwäsche, einen Anzug mit Krawatte sowie eine schwarze Daunenjacke. Nana Mama, meine Großmutter, hatte sich mit ihren weit über neunzig Lebensjahren sämtlichen Vernunftargumenten widersetzt und war mitgekommen, anstatt das Ganze im Fernsehen zu verfolgen. Sie hatte sich dick in Decken eingemummelt, trug eine wollene Skimütze, dazu sämtliche warmen Kleidungsstücke aus ihrem Besitz, und saß auf einem Campingstuhl zu meiner Linken. Meine Tochter Jannie, siebzehn, und mein Sohn Ali, neun, hatten sich ebenfalls auf arktische Temperaturen eingerichtet und standen trotzdem eng umschlungen hinter uns, um einander zu wärmen. Dazu stampften sie regelmäßig mit den Füßen.
»Wie lange dauert es denn noch, Dad?«, wollte Ali wissen. »Ich kann meine Zehen nicht mehr spüren.«
Über dem Raunen der Menge ertönten jetzt weiter oben auf dem Capitol Hill die vier Trommelwirbel und die Fanfarenklänge, die das »Hail to the Chief«, den offiziellen Salut für den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, ankündigten.
»Sie gehen jetzt am Capitol los«, erwiderte ich. »Es kann nicht mehr lange dauern.«
Die Hymne war zu Ende, und die frierende Menschenmenge wurde still.
Nun rief eine Männerstimme in lautem Kommandoton: »Präsentiert das Gewehr!«
Eine zweite Stimme wiederholte den Ruf, dann eine dritte. Die Soldaten, die in Fünfzig-Meter-Abständen von Ost nach West die Route säumten, befolgten einer nach dem anderen den Befehl, legten ihre Gewehre an die rechte Schulter und nahmen Habachtstellung ein.
Dann setzten die Trommeln ein. Gedämpft und düster drangen die langsamen Schläge aus der Entfernung zu uns herüber.
An der Spitze des Capitol Hill tauchten hundert Kadetten der West Point Militärakademie auf, in grauen Uniformen und im Gleichschritt, gefolgt von ähnlichen Formationen aus den Ausbildungsstützpunkten der US-Marine, der Luftwaffe sowie der Küstenwache. Alle marschierten mit erhobenen Köpfen und geradeaus gerichtetem Blick in höchster Präzision zum Fuß des Hügels und an uns vorbei.
Weiter oben schlugen die Trommeln ihren stetigen Takt. Sie näherten sich und wurden lauter. Ein Fahnenkommando mit unterschiedlichen Flaggen kam in den Blick.
Ich hörte Hufe klappern, dann verließen sieben blassgraue Pferde den Vorplatz des Capitols. Sechs von ihnen bildeten eine Formation aus drei hintereinander gruppierten Paaren, während das siebte Pferd den Trupp auf der linken Seite anführte.
Alle sieben waren gesattelt, aber nur die vier Tiere auf der linken Seite trugen je einen Reiter. Ihre Uniform wies sie als Angehörige der Old Guard aus, des für den Schutz des Oberbefehlshabers zuständigen Wachregiments der US-Streitkräfte. Die Sechserformation war vor den hundert Jahre alten, schwarzen Munitionswagen gespannt worden, auf dem sich ein mit einer US-Fahne bedeckter Sarg befand. Darin lag die verstorbene Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika.
2
Das langsame, gleichmäßige Klappern der Pferdehufe kam näher und näher und wurde allmählich lauter, genau wie der düstere Schlag der Trommeln.
Hinter dem Munitionswagen folgte ein schwarzes, reiterloses Pferd, geführt von einem weiteren Angehörigen der Old Guard. Es schüttelte den Kopf und tänzelte hin und her.
In den Steigbügeln waren die Reitstiefel der verstorbenen Präsidentin befestigt worden, und zwar rückwärts.
»Wieso haben Sie das denn gemacht?«, wollte Ali mit leiser Stimme wissen.
»Das ist eine militärische Tradition, zu Ehren des gefallenen Kommandanten«, flüsterte Nana ihm zu. »Genauso war es auch bei Präsident Kennedys Beerdigung vor fast sechzig Jahren.«
»Warst du damals auch dabei?«
»Ich habe genau da gestanden, wo du jetzt stehst, Schätzchen.« Nana wischte sich mit dem Taschentuch über die Augen. »Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und es war genau so tragisch wie heute.«
Zu der Zeit, als JFK Präsident war, war ich noch nicht einmal auf der Welt gewesen, aber Nana hatte mir erzählt, dass das junge Staatsoberhaupt große Hoffnung im ganzen Land geweckt hatte. Seine Ermordung hatte sich angefühlt wie ein Tritt in die Magengrube.
Genau so war es auch mir ergangen, als Bree mir am Telefon berichtet hatte, dass Catherine Grant im Oval Office tot zusammengebrochen sei. Sie war siebenundvierzig Jahre alt geworden und hatte einen Ehemann, zwei zehn Jahre alte Zwillingstöchter sowie eine erschütterte, trauernde Nation hinterlassen.
Präsidentin Grant hatte zu einer äußerst seltenen Spezies in der US-amerikanischen Politiklandschaft gehört. Sie war tatsächlich in der Lage gewesen, zum Wohle des Landes politische Gegner zusammenzubringen, und zwar aufgrund ihrer empathischen Persönlichkeit, ihrer überragenden Intelligenz und ihrer Fähigkeit zur Selbstironie.
Sie war als US-Senatorin von Texas in die Präsidentschaftswahl gegangen, und ihr überwältigender Wahlsieg hatte viel Optimismus im Land verbreitet, den Glauben, dass die Lähmung überwunden war, dass die Politiker auf beiden Seiten des Spektrums endlich ihre Differenzen beiseitelegen und sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen würden.
Und genau so war es gewesen, dreihundertachtundsechzig Tage lang.
Zweiundsiebzig Stunden nachdem Präsidentin Grant ihr erstes Amtsjahr gefeiert hatte, hatte sie während einer Besprechung mit ihren militärischen Beratern plötzlich über Schwindelgefühle geklagt und einen verwirrten Eindruck gemacht. Dann war sie hinter ihrem Schreibtisch zu Boden gesackt und wenige Augenblicke später verstorben.
Ihre Ärzte hatten fassungslos reagiert. Die Präsidentin war in hervorragender körperlicher Verfassung gewesen. Keine zwei Monate zuvor hatte sie eine umfassende körperliche Untersuchung mit fliegenden Fahnen bestanden.
Doch die Pathologen des Bethesda Naval Hospital hatten festgestellt, dass der Tod der Präsidentin auf einen schnell wachsenden Tumor zurückzuführen war, der sich um ihre innere Halsschlagader gelegt und dadurch die Blutzufuhr zu großen Teilen des Gehirns unterbrochen hatte. Niemand hätte sie retten können.
Am Tag ihrer Beerdigung lag daher ein Gefühl des Verlusts und der verlorenen Hoffnung auf dem ganzen Land. Während der Trauerzug näher kam, breitete sich eine niedergeschlagene Stille über der Constitution Avenue aus.
Damon half Nana Mama aufzustehen. Bree und ich nahmen Haltung an. Als Grants Sarg an uns vorbeirollte und das schwarze, reiterlose Pferd sich in der bitteren Kälte aufbäumte, musste ich gegen die aufwallenden Tränen ankämpfen.
Doch noch mehr traf mich der Anblick der Limousine hinter dem schwarzen Pferd. Die Fenster waren getönt, aber ich wusste, dass in diesem Fahrzeug der Mann und die Töchter der verstorbenen Präsidentin saßen.
Ich konnte mich noch gut daran erinnern, wie ich mich nach dem tragischen Tod meiner ersten Frau gefühlt hatte – verlassen, voller Wut und allein mit einem Säugling. Das waren die schlimmsten Tage meines Lebens gewesen. Damals hatte ich nicht geglaubt, dass ich je wieder glücklich sein könnte.
Der Anblick der Präsidentinnenfamilie brach mir das Herz. Ich blinzelte die Tränen weg und sah das Trommlerkorps vorbeiziehen, die Augen starr geradeaus gerichtet und mit dem immer gleichen Takt.
»Können wir jetzt gehen?«, quengelte Ali. »Ich kann meine Knie nicht mehr spüren.«
»Zuerst fassen wir uns an den Händen und sprechen ein Gebet für unser Land und für die Seele dieser Frau. Sie war ein guter Mensch«, erwiderte Nana Mama und streckte uns ihre Fausthandschuhe entgegen.
Erster Teil
Fünf Tage danach
1
Es schneite, als Sean Lawlor in eine schmale Gasse in Georgetown huschte. Unter dem grau melierten Bart und den zerzausten Haaren war sein gerötetes Gesicht zu erkennen. Er war dunkel gekleidet und trug Handschuhe sowie eine gefütterte Mütze mit heruntergeklappten Ohrenschützern. Während er tiefer in die Gasse eindrang, war ihm bewusst, dass er Spuren im Schnee hinterließ, aber das war ihm gleichgültig.
Der Wetterbericht hatte noch vor Anbruch der Dämmerung fünfzehn Zentimeter Neuschnee prophezeit, und er ging davon aus, dass er dann schon längst über alle Berge war.
Lawlor tapste zum hinteren Gartentor einer wunderschönen, alten Backsteinvilla, deren Vorderfront an der Thirty-Fifth Street lag. Nachdem er sich lange umgeschaut hatte, kletterte er über das Tor und ging quer über eine kleine Terrasse zu einer Tür, die er schon früher am Abend aufgebrochen hatte – gleich nachdem er die Alarmanlage lahmgelegt hatte.
Es war 4.15 Uhr. Er hatte noch mindestens eine halbe Stunde Zeit.
Behutsam zog Lawlor die Tür hinter sich ins Schloss. Einen Augenblick lang stand er regungslos da und lauschte angestrengt. Aber er hörte nichts, was ihn misstrauisch gemacht hätte. Er wischte sich den Schnee von den Schultern und wartete darauf, dass seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Dann streifte er blaue Plastiküberzieher über seine Stiefel und ging den Flur entlang in die Küche.
Er schob einen Stuhl beiseite und erzeugte ein deutlich hörbares Kratzen auf den Küchenfliesen. Das Geräusch störte ihn nicht. Es war niemand zu Hause. Die Hausbesitzer verbrachten den Winter in Palm Beach.
Lawlor öffnete eine Tür auf der anderen Seite der Küche und betrat eine steile Holztreppe. Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte, umhüllte ihn völlige Dunkelheit. Er machte die Augen zu und knipste das Licht an.
Erneut wartete er, bis seine Augen sich an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, und stieg dann in einen kleinen, muffigen Kellerraum hinunter. Überall standen Kisten und alte Möbel herum, doch das interessierte ihn nicht. Er ging zu einer Werkbank, über der ein Lochbrett mit verschiedenen Werkzeugen hing.
Er setzte seinen Rucksack ab, tauschte die Lederhandschuhe gegen solche aus Latex aus, öffnete den Rucksack und holte vier in Luftpolsterfolie eingewickelte Päckchen heraus.
Er schnitt die Folie auf und verstaute sie wieder im Rucksack. Anschließend ließ er den Blick voller Bewunderung über das VooDoo Innovations Ultra Lite gleiten, einen Gewehrlauf inklusive Verschlusssystem für 5,56x45-Millimeter-NATO-Munition. Ein echtes Kunstwerk, dachte er.
Er befestigte den Verschluss an einem minimalistischen, nur hundertvierzig Gramm schweren Gewehrkolben von Ace Precision und schraubte dann einen SureFire-Genesis-Schalldämpfer auf die Mündung des Laufs. Als er schließlich nach dem optischen Visier, einem Zeus 640, griff, dachte er: Das ist wahre Schönheit.
Mit einem Klick saß auch das Visier an Ort und Stelle. Alles in allem war er sehr zufrieden mit seinem Kauf. Die einzelnen Komponenten hatte er unter demselben falschen Namen bei verschiedenen Internethändlern in den USA bestellt und an vier verschiedene UPS-Abholstationen im und um den District of Columbia schicken lassen.
Vorgestern Abend war Lawlor mit einer Maschine aus Amsterdam auf dem Dulles International Airport gelandet und mit einem gefälschten britischen Pass eingereist. Gestern Vormittag hatte er die Waffenkomponenten abgeholt, und zwar mithilfe eines gefälschten Führerscheins aus Pennsylvania, den er sich ebenfalls online besorgt hatte. Gestern Nachmittag hatte er die Waffe dann in den Wäldern westlich von Maryland eingeschossen und kalibriert. Ihre Präzision war beinahe furchterregend.
Genau das richtige Werkzeug, sagte er sich. Absolut perfekt für diesen Auftrag.
2
Lawlor schwang sich den Rucksack über die Schulter, ging mit dem Gewehr in der Hand die Kellertreppe hinauf und machte das Licht aus, bevor er die Tür öffnete, die zurück in die dunkle Küche führte. Er richtete sich auf, drückte eine Taste an der Seite des Visiers und hob das Gewehr an die Schulter.
Das Zeus 640 war ein Infrarot-Zielfernrohr, mit dessen Hilfe der Schütze die Welt in Wärmebildern betrachten konnte. Das Innere des Hauses sah aus wie in blasses Tageslicht getaucht. Nur die Thermostate leuchteten sehr viel heller.
Das Zeus-Visier war für die Wildschweinjagd entwickelt worden und hatte über achttausend Dollar gekostet. Aber Lawlor fand, dass es jeden einzelnen Cent wert und jeder anderen Zieloptik, die er bis jetzt benutzt hatte, weit überlegen war.
Mit angelegtem Gewehr ging er die Treppe in den ersten Stock hinauf und betrat das große Schlafzimmer auf der Vorderseite des Hauses. Ohne die antiken Möbelstücke eines Blicks zu würdigen, ging er zum Fenster.
Er ließ das Gewehr sinken, schob das Fenster nach oben und schaute nach draußen, sah die Schatten der Eichenzweige über die schneebedeckte Straße zucken, nahm die Silhouetten der altehrwürdigen Stadtvillen auf der anderen Seite der Thirty-Fifth Street in den Blick.
Erneut legte er das Gewehr an und starrte durch das Zielfernrohr. Die schneebedeckte Straße und die Backsteinbürgersteige erschienen in stumpfem Schwarz.
Die beheizten Villen jedoch waren unglaublich detailreich zu erkennen, ganz besonders die eine zu seiner Rechten, ein Stück die Straße entlang. Der georgianische Backsteinbau leuchtete geradezu gleißend hell. Die Thermostate dort mussten mindestens auf vierundzwanzig Grad, vielleicht sogar auf sechsundzwanzig stehen.
Lawlor richtete sein Gewehr auf die Eingangstür des warmen Hauses und betrachtete die unmittelbare Umgebung. Wenn es darauf ankam, hatte er schätzungsweise vier Sekunden Zeit, vielleicht sogar etwas weniger. Dieses kleine Zeitfenster schreckte ihn nicht. Er beherrschte sein Metier und war an enge zeitliche Spielräume gewöhnt.
Lawlor steckte die Hand in die Innentasche seiner Jacke und holte einen Mikrochip heraus. Den schob er in den dazu passenden Schlitz an der Seite des Visiers, um seine Taten für die Nachwelt aufzuzeichnen. Dann entspannte er sich und wartete.
Nach zehn Minuten flammte in dem warmen Haus schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite ein Licht auf. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war 4.30 Uhr. Pünktlich auf die Minute. Diszipliniert.
Fünfzehn Minuten später kam ein schwarzer SUV, ein Chevrolet Suburban, die Straße entlanggerollt. Ebenfalls pünktlich auf die Minute.
Ein stürmischer Wind pfiff in Nord-Süd-Richtung durch die Thirty-Fifth Street. Die Kugel würde leicht abgelenkt werden, das musste er einkalkulieren.
Der Suburban hielt am gegenüberliegenden Straßenrand vor dem warmen Haus an. Lawlor entsicherte das Gewehr, brachte es in Anschlag und nahm die Eingangstür und die Eingangstreppe ins Visier.
Der Beifahrer, ein großer, kräftig gebauter Mann in einem dunklen Wintermantel, stieg aus, lief über die Straße und den Bürgersteig und ging die Treppenstufen hinauf bis zur Tür. Er klingelte, und eine Frau mit einem langen Mantel machte ihm auf.
Ihre Gesichtszüge oder ihr Alter konnte Lawlor auf dem Wärmebild nicht erkennen, und das wollte er auch gar nicht. Er hatte sich mehrere aktuelle Fotos von ihr angeschaut, aber durch das Zeus 640 war sie nichts weiter als eine blassweiße Gestalt in einer kalten, düsteren Welt, und das war ihm genau recht.
Alles schön unpersönlich, wie bei einem Videospiel, dachte er und ließ das Fadenkreuz weiterwandern, während die Frau ihre Kapuze aufsetzte und hinaus in den Schneesturm trat. Er zielte auf den rechten Rand der Kapuze, um die Abdrift auszugleichen. Sie folgte dem breitschultrigen Kerl mit schnellen Schritten die Treppe hinab und über den Bürgersteig auf die Straße, wollte das Schneetreiben so schnell wie möglich hinter sich lassen und zu ihrem frühmorgendlichen Yogakurs kommen.
Zu schade, dachte er, während er abdrückte. Ich habe gehört, dass Yoga sehr gesund sein soll.
Das Gewehr gab ein leises, ploppendes Geräusch von sich. Mit einer ruckartigen Kopfbewegung sackte die Frau hinter ihrem Leibwächter auf die Straße. Lawlors erster Impuls war zu fliehen, aber er blieb voll und ganz auf seine Aufgabe konzentriert, schwenkte das Fadenkreuz auf ihre Brust und schoss erneut.
Dann schloss er das Fenster und wandte sich anderen Dingen zu. Er suchte und fand die beiden Patronenhülsen, nahm mit schnellen Bewegungen das Gewehr auseinander und packte drei der vier Komponenten in seinen Rucksack. Nur das Infrarot-Objektiv behielt er in der Hand, um sich schneller durch das dunkle Haus bewegen zu können.
Nachdem Lawlor zur Hintertür hinausgeschlüpft war, schaltete er das Zielfernrohr aus und steckte es ein. Schon ertönten die ersten Sirenen. Er zog den Kopf ein und machte sich auf den Weg.
Zu schade, dachte er noch einmal. Ein Mann. Fünf Kinder. Sechs Enkelkinder. Wirklich schade.
3
Am 1. Februar kamen Bree und ich kurz nach Anbruch der Dämmerung in Georgetown an. Der Boden war bereits mit einer über zehn Zentimeter hohen Schneeschicht bedeckt, und es schneite immer noch weiter.
Streifenwagen der Metro Police riegelten die Thirty-Fifth Street an beiden Enden des Häuserblocks ab. Wir zeigten dem Beamten unsere Dienstmarken.
Er sagte: »Die US Capitol Police, das FBI und der Secret Service sind schon da.«
»Das kann ich mir vorstellen«, erwiderte Bree.
Wir wurden durchgelassen und gingen die Straße entlang. Dabei registrierten wir viele ängstliche Blicke aus den umliegenden Häusern.
FBI-Kriminaltechniker waren gerade dabei, ein Zelt über dem Mordopfer und dem Tatort zu errichten. Gelbes Absperrband war von den beiden Hausecken über die Straße und um den Suburban gespannt worden. Davor lieferten sich ein großer kräftiger Mann in einem schwarzen Parka und ein kleinerer Mann in Mantel und Skimütze gerade ein Wortgefecht.
»Das ist unsere Angelegenheit«, sagte der Kräftige. »Sie ist während meiner Schicht erschossen worden!«
»Die US Capitol Police wird mit Sicherheit an den Ermittlungen beteiligt werden«, blaffte der Kleinere zurück. »Aber Sie ganz bestimmt nicht, Lieutenant Lee. Sie sind befangen, und genau so werden wir Sie auch behandeln.«
»Befangen?«
Für einen kurzen Augenblick glaubte ich, der Große würde auf den Kleineren losgehen.
Dann kam FBI Special Agent Ned Mahoney hinter dem Zelt hervor.
»Das reicht jetzt«, sagte er. »Agent Reamer, bitte unterlassen Sie jede Äußerung, die darauf hindeutet, dass Sie hier die Ermittlungen führen. Dafür ist ausschließlich das FBI zuständig.«
»Sagt wer?«, wollte Reamer wissen.
»Präsident Hobbs«, entgegnete Mahoney. »Allem Anschein nach hat Ihr neuer Chef kein allzu großes Zutrauen zu den Fähigkeiten des Secret Service. Er hat mit dem Direktor gesprochen, und der Direktor mit mir. Und das war’s auch schon.«
Agent Reamer verzog wutentbrannt das Gesicht, schaffte es aber irgendwie, seine Stimme einigermaßen im Zaum zu halten. »Der Secret Service lässt sich ganz bestimmt nicht einfach so ausschließen.«
»Der Secret Service wird ganz bestimmt nicht ausgeschlossen, aber er wird seine Anweisungen befolgen«, erwiderte Mahoney, bevor sein Blick auf uns fiel. »Alex, Chief Stone. Ich möchte euch beide mit im Boot haben.«
Er machte uns mit den anderen bekannt. Special Agent Lance Reamer vom US Secret Service hatte in den vergangenen zehn Jahren für die Steuerfahndung gearbeitet. Der Breitschultrige war Lieutenant Sheldon Lee von der US Capitol Police. Lieutenant Lee gehörte seit sechs Jahren zum Personenschützer-Team des Opfers.
Durch den Schnee und den Wind hatte Lee weder die Schüsse gehört noch mitbekommen, wie die neunundsechzigjährige US-Senatorin Elizabeth »Betsy« Walker in seinem Rücken zu Boden gestürzt war.
»Ich bin vorgegangen und habe ihr die hintere Tür des Suburban aufgemacht, so wie immer«, berichtete Lee. »Dann habe ich mich umgedreht und sie da liegen sehen, im Schnee, in ihrem eigenen Blut.« Mit erstickter Stimme fuhr er fort: »Mein Gott, und dann musste ich den armen Larry wecken, ihren Mann, und es ihm erzählen. Er telefoniert gerade mit seinen Kindern und … wer verdammt noch mal macht denn so was? Und weshalb? Sie war eine großartige Frau und immer freundlich zu allen.«
Das stimmte. Die Senatorin des Bundesstaats Kalifornien konnte zwar auch knallhart sein, wenn sie für etwas stritt, und sie besaß einen messerscharfen Verstand, aber gleichzeitig war sie eine warmherzige und liebenswürdige Person, die allen Menschen mit großer Offenheit begegnet war. Darüber hinaus war sie das zweiälteste republikanische Mitglied des Senats sowie eine überaus respektierte Politikerin.
»Können wir uns den Tatort mal ansehen?«, erkundigte ich mich, während der Schneefall allmählich nachließ.
»Warum genau sind Sie eigentlich hier, Dr. Cross?«, wollte Agent Reamer wissen.
»Weil ich ihn darum gebeten habe«, knurrte Mahoney unwirsch. »Dr. Cross war früher in der Abteilung für Verhaltensforschung in Quantico tätig und kann auf über zwei Jahrzehnte herausragende Ermittlertätigkeit zurückblicken. Das FBI hat ihn als Berater engagiert, und zwar genau für Fälle wie diesen. Wir halten große Stücke auf ihn.«
Bree nickte. »Das gilt übrigens auch für die Metropolitan Police.«
4
Reamer machte ein Gesicht, als hätte er gerade etwas ausgesprochen Ekliges verschluckt, und hob angewidert die Hände.
Mahoney holte über Funk die Genehmigung ein, dass wir vom Zelteingang aus einen Blick auf den Tatort werfen durften. Zu fünft gingen wir an Lieutenant Lees Suburban vorbei auf die andere Seite des Zelts.
Im Inneren war ein ganzes Team von Spezialisten aus Quantico bei der Arbeit. Sie trugen Schutzanzüge über ihrer Winterkleidung. Senatorin Walker lag verdreht auf der Seite im Schnee. Die Kapuze war ihr halb vom Kopf gerutscht, sodass das Einschussloch unter ihrem rechten Wangenknochen gut zu erkennen war.
»Was kannst du uns sagen, Sally?«
Sally Burton, die leitende FBI-Kriminaltechnikerin, kniete neben dem Mordopfer. Jetzt erhob sie sich. »Der Schnee macht uns die Arbeit fast unmöglich, Ned, aber im Augenblick sieht es so aus, als wäre sie zweimal getroffen worden. Der Kopfschuss hat sie auf der Stelle getötet. Aber nach ihrem Sturz hat der Schütze ihr noch eine zweite Kugel verpasst.«
»So, wie es jemand mit sehr viel Wut im Bauch machen würde«, warf Lieutenant Lee ein. »Ein Fanatiker vielleicht.«
»Oder ein Profi«, meinte Agent Reamer.
»Oder beides«, sagte ich. »Wer hatte einen Grund, sie zu hassen?«
»Gute Frage.« Mahoney wandte sich wieder an Burton. »Weißt du schon, aus welcher Richtung die Schüsse gekommen sind?«
Die Kriminaltechnikerin verzog das Gesicht. »Durch den Schnee und die Tatsache, dass niemand gesehen hat, wie sie gestürzt ist, ist das für den ersten Schuss nur sehr schwer zu sagen. Aber die Brustwunde deutet darauf hin, dass es ungefähr die Richtung gewesen sein müsste.« Sie zeigte auf die obere Ecke des Zelts.
Mahoney bedankte sich und wandte sich an Lieutenant Lee: »Sie haben ein gutes Verhältnis zum Ehemann der Senatorin?«
»Ein hervorragendes, Sir. Larry ist ein sehr liebenswerter, älterer Herr, und ich betrachte ihn als echten Freund. Sehr klug ist er auch. Er war früher Strafrichter in San Francisco.«
»Gehen Sie zu ihm und reden Sie offen mit ihm. Kriegen Sie raus, wer seine Frau nicht mochte oder aus irgendeinem Grund einen Groll gegen sie gehegt hat. Bringen Sie mir Namen und am liebsten auch Telefonnummern, wenn er die hat.«
»Moment mal«, schaltete Reamer sich ein. »Lieutenant Lee ist befangen.«
»Er kennt die Angehörigen«, erwiderte Mahoney, »und zwar besser als wir alle. Dadurch kann er uns helfen.«
»Aber …«
Mahoneys Miene wurde hart. »Glauben Sie ernsthaft, dass Lieutenant Lee an diesem Attentat beteiligt sein könnte?«
»Na ja, also … nein, aber … das ist doch bestimmt gegen die Vorschriften«, stotterte Reamer.
»Ich scheiß auf die Vorschriften«, sagte Mahoney. »Lee ist mit im Boot.«
Der Lieutenant nickte. »Ich kann Ihnen auch ein Verzeichnis der Drohanrufe und Drohbriefe geben. So was hat sogar Betsy ab und zu bekommen.«
»Hat sie die an das FBI weitergeleitet?«, wollte Mahoney wissen.
»Etliche davon. Sie müssten bei Ihren Akten liegen.«
Nachdem Lee gegangen war, sagte der Agent des Secret Service: »Okay. Und was soll ich jetzt machen?«
»Sie schnappen sich ein paar Ihrer Leute und versiegeln sämtliche Büroräume der Senatorin. Dann bewachen Sie die Büros mitsamt den Angestellten, und zwar so lange, bis wir da sind«, wies Mahoney ihn an. »In der Zwischenzeit versuchen Dr. Cross, Chief Stone und ich rauszukriegen, woher die Schüsse gekommen sind.«
Wir brauchten nicht lange.
Wir klingelten bei den beiden Stadtvillen schräg gegenüber, die uns am wahrscheinlichsten erschienen. Die Besitzer waren zu Hause und sehr aufgeregt. Eine prominente Patentanwältin sagte uns, dass ihre direkten Nachbarn, Jimmy und Renee Fairfax, vor über zwei Monaten in ihr Winterdomizil nach Palm Beach gefahren waren.
Wir versuchten, Mr. Fairfax in Florida zu erreichen, um uns eine Genehmigung für eine Hausdurchsuchung geben zu lassen, allerdings vergeblich. Doch als wir auf der Gartenterrasse schneebedeckte Fußspuren entdeckten und feststellten, dass die Alarmanlage lahmgelegt und die Hintertür aufgebrochen worden war, war Mahoney der Ansicht, dass das ein mehr als triftiger Anlass war, um das Haus sofort zu betreten.
Im Flur standen Wasserpfützen, vermutlich geschmolzener Schnee. Mehrere kleinere Wassertropfen bildeten eine Spur durch den Flur bis zu einer Kellertür. Dahinter jedoch war nicht die geringste Spur zu entdecken, schon gar keine Fußabdrücke, womit ich eigentlich fest gerechnet hatte, da der Schütze ja aus dem Schnee gekommen war.
Wir warfen einen Blick zum Fenster hinaus und gelangten zu der Ansicht, dass der Schütze sich weiter oben befunden haben musste. Im ersten Stock. Vom Schlafzimmerfenster aus hatten wir freie Sicht auf das Tatortzelt, das etliche hundert Meter entfernt in Senatorin Walkers Vorgarten stand.
»Genau hier war er«, sagte ich und blickte mich um. »Wahrscheinlich hat er das Fensterbrett als Stütze benutzt.«
»Keine Hülsen«, meinte Bree. »Keine Spuren.«
Mahoney nickte. »Entweder ein Fanatiker oder ein Profi.«
»Oder beides«, sagte ich.
5
Um Viertel vor neun musste ich los, weil ich einen Termin mit einer neuen Klientin hatte, einer juristischen Angestellten im Justizministerium. Da ich auch einen Doktortitel für klinische Psychologie habe, betreibe ich im Keller unseres Hauses in der Fifth Street im Südosten Washingtons neben meiner Polizeiarbeit noch eine kleine, psychotherapeutische Teilzeitpraxis.
Im Norden oder im Westen der Vereinigten Staaten, da sind fünfzehn Zentimeter Neuschnee nichts Besonderes. Aber in unserer Hauptstadt löst so ein Naturereignis für gewöhnlich den Notstand aus und bringt das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen. Irgendwie konnte ich trotzdem ein Taxi ergattern, aber ich musste am Fuß des Capitol Hill aussteigen und den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen.
Der Schneefall legte sich allmählich, doch während ich hastig nach Hause eilte, nagte der kalte Wind an meinen Ohren. Mit den Gedanken war ich immer noch bei der verstorbenen Senatorin Walker. Ich dachte an ihre parlamentarischen Funktionen – sie war Vorsitzende des Ausschusses für Energie und natürliche Ressourcen sowie in herausragender Stellung im Haushalts- sowie Landwirtschaftsausschuss tätig gewesen – und bekam immer mehr Zweifel an der Theorie, dass ein fanatischer Profi für den Anschlag verantwortlich war.
Ehrlich gesagt, das Thema Fanatismus legte ich ganz zu den Akten. Die Tat strahlte eine sehr keimfreie Präzision aus, zumindest aber war sie hervorragend organisiert gewesen. Auch wenn ich einen terroristischen Hintergrund nicht hundertprozentig ausschließen mochte, war ich überzeugt, dass hier ein professioneller Attentäter am Werk gewesen war.
Aber warum? Wozu einen Auftragskiller engagieren? Was hatte Senatorin Walker getan, dass irgendjemand sie kaltblütig vor ihrem Haus erschießen ließ? Wem war sie in die Quere gekommen? Wen hatte sie vernichtet?
War die Tatsache, dass sie vor ihrem Zuhause ermordet worden war, als Botschaft zu verstehen, wie bei einem Mafiamord? Oder hatte sich hier einfach nur eine Gelegenheit geboten?
Ich entschied mich für das Letztere. Vor meinem Weggang vom Tatort hatte Lieutenant Lee mir berichtet, dass die Senatorin immer montags bis donnerstags einen Yogakurs besucht hatte. Jeden Morgen. Es hatte ihr geholfen, den Kopf frei zu bekommen.
Dem Mörder hat es auch geholfen, dachte ich. Er hat ihr Verhaltensmuster gekannt, entweder weil er es selbst beobachtet hatte oder weil er darüber informiert worden war.
Mr. und Mrs. Fairfax waren seit zwei Monaten in Palm Beach. Mahoney hielt es für denkbar, dass der Attentäter die Senatorin von diesem Haus aus mehrfach und über längere Zeit beobachtet hatte. Er hatte eine zweite Einheit von Kriminaltechnikern angefordert, um das Schlafzimmer nach DNA und Mikrofasern zu durchkämmen, aber ich glaubte nicht, dass sie fündig werden würden.
Mehrfach das Haus der Fairfaxes zu betreten wäre meines Erachtens unprofessionell gewesen. Wenn ich ein Auftragskiller wäre, ich würde so wenig Zeit wie nur möglich am Ort des Anschlags zubringen. Jedes Mal, wenn ein Mensch irgendwo entlangstreift, hinterlässt er winzige Gewebespuren oder Haarreste, die dann von Leuten wie Sally Burton eingesammelt und analysiert werden können. Ein geschulter Attentäter wusste so etwas.
Nein, dachte ich, als ich auf die Fifth Street einbog, wo die Leute die Bürgersteige vom Schnee befreiten. Der Killer hat seine Informationen anderswoher bekommen. Er ist ein-, höchstens zweimal selbst im Haus gewe…
»Dad!«
Ich zuckte zusammen, hob den Kopf und sah einen Schneemann vor unserem Haus stehen. Daneben winkte Ali mir aufgeregt zu. Ich grinste. Mein Jüngster besaß eine echte Leidenschaft für das Leben. Ganz egal, was er gerade tat, er machte es immer mit voller Inbrunst und hatte normalerweise jede Menge Spaß dabei.
»Sehr schön«, sagte ich.
»Ich hab nach dem Frühstück damit angefangen!«
»Ist heute keine Schule?«
»Schneefrei.« Er strahlte über das ganze Gesicht. »Heute darf ich spielen.«
»Tja, dein Dad muss arbeiten. Viel Spaß und pass auf, dass du nicht nass wirst. Sonst holst du dir womöglich eine Erkältung.«
»Du klingst schon wie Nana.«
»Dann besteht ja noch Hoffnung für mich«, erwiderte ich. Ich wuschelte ihm über seine Wollmütze und ging seitlich am Haus vorbei durch den unberührten Schnee, der mir bis über die Knöchel reichte, bis zur Kellertreppe.
Ich schloss die Tür auf und trat ein. Schnee landete auf der Fußmatte hinter der Tür, gleich neben einem zusammengefalteten Blatt Papier.
Ich hob es auf und faltete es auseinander.
Ich drehte das Blatt um. Nichts.
Da ertönte in meinem Rücken eine zitternde Frauenstimme. »Dr. Cross?«
Ich drehte mich ruckartig um und stand einer sehr attraktiven Frau Mitte dreißig gegenüber, die mich durch die geöffnete Tür anstarrte. Sie trug eine Strickmütze und Fausthandschuhe und hatte die Arme um ihren himmelblauen Daunenmantel geschlungen. Auf ihren Wangen glänzten frische Tränen. Ihre leicht gebückte Haltung interpretierte ich nicht als Zeichen der Verzweiflung, sondern eher als Mutlosigkeit.
»Ja, richtig, ich bin Alex Cross«, sagte ich und lächelte sie an. Ich steckte den Zettel in meine Jackentasche und machte eine einladende Handbewegung. »Bitte entschuldigen Sie, dass ich den Weg noch nicht geräumt habe. Ms. Davis?«
Trotz der Tränen ließ Nina Davis ein mattes Lächeln sehen, während sie an mir vorbeiging.
»Ich mag den vielen Schnee, Dr. Cross«, sagte sie. »Er erinnert mich an zu Hause.«
6
Nina Davis war in Wisconsin aufgewachsen, in einem Vorort von Madison, und hatte Schnee schon immer als eine Art Wundverband empfunden.
»Wenn es geschneit hat, dann sieht man all die Verletzungen und Narben nicht mehr«, sagte sie. »Als Kind habe ich das geliebt.«
Wir plauderten ein wenig, während sie die notwendigen Formulare ausfüllte. Davis war siebenunddreißig Jahre alt, intelligent, attraktiv und fest entschlossen, im US-Justizministerium Karriere zu machen. Dort war sie als Abteilungsleiterin in der Bekämpfung des organisierten Verbrechens tätig.
»Früher war ich auch mal beim FBI«, sagte ich.
»Ich weiß«, erwiderte Davis. »Genau darum habe ich mich ja für Sie entschieden. Ich habe mir gedacht, dass Sie meine Lage verstehen oder zumindest nachempfinden können.«
Ich lächelte. »Ich werde beides versuchen.«
Davis erwiderte mein Lächeln ohne rechte Überzeugung. »Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.«
»Am besten sagen Sie mir, warum Sie überhaupt zu mir gekommen sind.«
Sie starrte mit hängenden Schultern auf ihre im Schoß gefalteten Hände hinab und seufzte. »Ich glaube, ich weiß nicht, wie man liebt, Dr. Cross.«
»Okay«, erwiderte ich und lehnte mich zurück, um ihr zuzuhören, ihr richtig zuzuhören.
Davis berichtete mir, dass sie ihr ganzes Leben lang nur für einen Menschen Liebe empfunden hatte: für ihren Vater Anderson Davis, einen Kleinstadt-Rechtsanwalt, der viel Zeit mit seinem einzigen Kind verbracht hatte. Sein Frau Katherine hatte unter psychischen Problemen gelitten und wenig Interesse an Sport oder Bewegung gezeigt. Ninas Vater hingegen hatte das Wandern in der freien Natur von Wisconsin immer sehr genossen.
»Er hat es ›Stromern‹ genannt«, sagte sie wehmütig. »›Komm, Nina‹, hat er immer gesagt, ›wir müssen mal wieder zum Beech Ridge stromern.‹«
Davis blinzelte und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Und ich vermisse dieses Herumstromern bis heute. Ich war dreizehn, als er gestorben ist.«
Kein leichtes Alter, dachte ich und machte mir eine Notiz. »Wie ist er gestorben?«, wollte ich dann wissen.
»Sie waren mit dem Auto unterwegs, und meine Mutter ist gefahren. Dann hat sie ihn aus irgendeinem Grund angebrüllt, hat dabei die Straße aus dem Blick verloren und eine rote Ampel übersehen. Er war sofort tot.«
»Das tut mir sehr leid. Das muss sehr schwer für Sie gewesen sein.«
Davis holte tief Luft, spitzte die Lippen und zuckte mit den Schultern. »Mein Dad war tot, und meine Mutter hatte ihn umgebracht. Was gibt es da noch zu sagen?«
Ich ließ das Gehörte sacken und sagte leise: »Dann geben Sie Ihrer Mutter also die Schuld daran?«
»Wem denn sonst?«, erwiderte sie. »Wenn sie geradeaus geschaut hätte, dann hätte mein Dad ein langes, erfülltes Leben gehabt. Wenn sie geradeaus geschaut hätte, dann hätte nicht ein gruseliger Mann nach dem anderen bei uns gewohnt, als ich noch ein Teenager war.«
Davis strahlte eine solche Eiseskälte aus, dass ich beschloss, mich ein andermal näher mit diesem Satz zu befassen.
»Lebt Ihre Mutter noch?«
»Nach allem, was ich gehört habe.«
»Wann haben Sie das letzte Mal etwas von ihr gehört?«
»Vor drei Wochen, als ich den monatlichen Scheck für das Pflegeheim unterschrieben habe.«
»Ich nehme da etliche sehr widersprüchliche Gefühle wahr«, sagte ich. »Zum einen geben Sie ihr die Schuld an vielen Dingen, zum anderen aber kümmern Sie sich darum, dass sie anständig versorgt wird.«
»Tja, na ja, sonst macht es ja niemand.« Schon wieder lief ihr eine Träne übers Gesicht.
Die Zeituhr klingelte. Sie machte ein enttäuschtes Gesicht.
»Beim nächsten Mal haben wir mehr Zeit, versprochen«, sagte ich. »Wenn man, wie ich, ein Ein-Mann-Betrieb ist, dann geht die Hälfte der ersten Stunde immer für Formalitäten und Papierkram drauf. Darum berechne ich Ihrer Versicherung auch nur dreißig Minuten anstatt der vollen Stunde. Aber morgen früh kann ich mir eine ganze Stunde für Sie Zeit nehmen.«
Die Falten auf ihrer Stirn glätteten sich ein wenig. »Das geht.«
»Bevor Sie gehen, habe ich noch eine Bitte. Bitte rufen Sie sich bis zu unserer nächsten Sitzung all die schönen Erinnerungen an Ihre Mutter ins Gedächtnis, die glücklichen Momente, vielleicht auch aus der Zeit vor dem Tod Ihres Vaters, als Sie noch keine Ablehnung, sondern eher Dankbarkeit empfunden haben.«
Sie lachte kurz und bellend auf. »Da werde ich aber ganz schön tief graben müssen.«
»Das erwarte ich auch von Ihnen«, erwiderte ich leise. Wir vereinbarten eine Zeit, dann erhob ich mich und machte meine Praxistür auf.
Ein wenig unsicher ging sie nach draußen, und ich war mir nicht sicher, ob sie wiederkommen würde. Im Lauf der Jahre waren mir immer wieder Klienten begegnet, die der Überzeugung waren, dass sie ihren Problemen mit ein, zwei Sitzungen auf den Grund gehen könnten. Aber sobald ihnen klar geworden war, dass es bei diesem Prozess nicht darum geht, etwas abzuschneiden, sondern viel eher darum, Schicht um Schicht abzutragen, hatten viele aufgegeben, und ich hatte nie wieder etwas von ihnen gehört.
»Dann also bis morgen?«, fragte ich sie, als ich ihr die Kellertür öffnete.
»Bis morgen, Dr. Cross«, erwiderte sie, drehte sich jedoch nicht zu mir um.
»Ich freue mich sehr darauf, Nina«, sagte ich und machte die Tür zu, sperrte auch den kalten Wind aus.
Auf dem Weg zurück in mein Sprechzimmer grübelte ich über das menschliche Gehirn und seine Fähigkeit nach, sich eine einzige grässliche Erfahrung herauszupicken und zuzulassen, dass diese Erfahrung Jahre, Jahrzehnte, ja, vielleicht sogar ein ganzes Leben lang, jede einzelne Handlung definierte und kontrollierte. Ich …
Da klopfte es dreimal kurz hintereinander an die Kellertür.
Ich war verwirrt. Der nächste Klient sollte doch erst am Nachmittag kommen.
Ich machte die Tür auf und sah Ned Mahoney vor mir stehen. Wir haben früher, als ich noch beim FBI war, regelmäßig zusammengearbeitet, und ich habe ihn als ruhigen, ja, fast schon stoischen Zeitgenossen kennengelernt. Aber als er jetzt meine Praxis betrat und sich den Schnee von der Hose schüttelte, da war er offensichtlich geladen.
Ich machte die Tür zu, und er sah mich an. »Da braut sich was zusammen, Alex. Wir brauchen deine Hilfe, und zwar ganz. Nicht nur in Teilzeit.«
7
Mahoney sah mich an und wartete gespannt auf eine Antwort.
»Im Augenblick habe ich nicht viele Klienten, Ned«, sagte ich. »Der Rest meiner Zeit gehört dir. Geht es um den Mord an Senatorin Walker?«
Er zögerte, bevor er die Hand in die Innentasche seines Mantels steckte. »Hast du eigentlich die aktuelle FBI-Vertraulichkeitserklärung schon unterzeichnet?«
»Die ist in meinem Beratervertrag integriert, aber ich kann sie gerne noch mal unterschreiben, wenn du das für nötig hältst.«
»Nein, nein, natürlich nicht«, erwiderte er, während er sein Smartphone aus der Tasche holte. »Es ist nur … die ganze Angelegenheit ist extrem sensibel. Du darfst mit niemandem darüber reden, auch nicht mit Sampson oder Bree.«
»John macht gerade Urlaub in Belize, und ich verspreche, dass ich schweige wie ein Grab, so lange, bis ich eine andere Ansage bekomme.«
»Gut.« Mahoney blickte auf das Display seines Handys. »Das da stammt aus einer Überwachungskamera am Dulles Airport. Ist gerade mal zwei Stunden her.«
Auf dem Standbild war eine ernst dreinblickende, dunkelhaarige Frau zu erkennen, nicht unbedingt schön, aber attraktiv. Sie sah aus wie Ende dreißig und trug eine Jeanshose, eine Jeansbluse und eine Jeansjacke. An ihrem einen Arm baumelte eine Einkaufstasche mit einem aufgedruckten Eiffelturm, und über der anderen Schulter hing ein Lederrucksack. Sie zog einen Rollkoffer hinter sich her und war offensichtlich mit großen Schritten unterwegs.
»Wer ist das?«
»Wir glauben, es handelt sich um eine gewisse Kristina Varjan«, sagte Mahoney. »Eine in Ungarn geborene Auftragskillerin.«
Meine Gedanken überschlugen sich. Eine Attentäterin am internationalen Flughafen von Washington, morgens um 8.30 Uhr, rund drei Stunden nachdem Betsy Walker erschossen worden war?
Ich hob die Hände. »Moment mal. Ihr glaubt nur, dass das Kristina Varjan ist?«
Mahoney hielt kurz inne, bevor er mir berichtete, dass vor genau zwei Stunden und zwanzig Minuten eine hochgeschätzte und erfahrene CIA-Agentin, die gerade auf dem Weg nach London war, in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle gestanden hatte und sie vorbeigehen sah. Diese Agentin hatte vor etlichen Jahren in Istanbul eine direkte persönliche Begegnung mit Kristina Varjan gehabt und wäre damals an den Folgen beinahe gestorben.
Da sie von der Ermordung der Senatorin bereits gehört hatte, hatte die Agentin ihren Platz in der Schlange verlassen und versucht, die Frau zu verfolgen, um sich absolut sicher zu sein. Aber sie war bereits spurlos verschwunden.
Die Agentin ließ daraufhin ihren Flug sausen, telefonierte, machte ihren Einfluss geltend und nahm Kontakt zur Flughafensicherheit auf. Die Überwachungsaufnahmen zeigten, dass Varjan den Kontrollpunkt rund fünfzehn Minuten zuvor passiert hatte. Mithilfe anderer Kameras ließ sich ihr Weg weiterverfolgen, bis sie den Terminal verlassen hatte und im Schneesturm untergetaucht war.
»Also hat die Agentin darauf gedrungen, ihren Ausgangspunkt zu ermitteln«, machte Mahoney weiter. »Und es hat sich herausgestellt, dass Varjan mit einem Deltaflug aus Paris um 8.00 Uhr in Washington angekommen ist. Diese Aufnahme hier stammt aus dem Zollbereich. Sie ist mit einem ungarischen Reisepass unter dem Namen Martina Rodoni eingereist.«
Ich betrachtete das Foto, dann sah ich Ned an. »Das heißt, sie kann Betsy Walker nicht erschossen haben. Die Zeiten stimmen nicht überein.«
»Richtig.«
»Was wiederum bedeutet, dass sich im Moment zwei professionelle Attentäter in Washington und Umgebung aufhalten. Und einer dieser beiden hat eine US-Senatorin umgebracht.«
Mahoney nickte.
»Bedeutet eine zweite Attentäterin auch ein zweites Attentat?«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Varjan nur wegen der Sehenswürdigkeiten hierhergekommen ist.«
»Drückt das Foto jedem Polizisten im Umkreis von hundert Kilometern in die Hand.«
Mahoney schien hin und her gerissen. »Der Direktor will keine anderen Behörden einschalten, sondern alle internen Kräfte bündeln, Varjan aufspüren und dann ausgiebig verhören.«
Ich legte den Kopf schief. »Hat er das irgendwie begründet?«
»Mit der nationalen Sicherheit«, erwiderte Mahoney, auch wenn es ihm nicht in den Kram passte. »Hat wohl irgendwas mit den Methoden der CIA zu tun. Alles weit über deiner Gehaltsklasse. Jedenfalls hat er den Präsidenten überzeugt, für alle Abgeordneten eine erhöhte Sicherheitsstufe anzuordnen. In der Zwischenzeit sollen wir beide Varjan ausfindig machen und festnehmen.«
Ich überlegte kurz. Ned und ich wieder zusammen in Aktion? Das fühlte sich gut an, so gut, dass ich sämtliche Fragen zum Thema nationale Sicherheit, die mir durch den Kopf jagten, beiseiteschob und mich lieber der vor uns liegenden Aufgabe zuwandte.
»Gibt es eine Akte über Varjan? Irgendetwas, womit wir ein Profil erstellen können?«
»Ich kann dir etwas noch Besseres anbieten«, erwiderte Mahoney. »Wir unterhalten uns mit der CIA-Agentin, die sie beinahe umgebracht hätte.«
8
Wir fuhren zur Central Intelligence Agency in Langley, Virginia. Ich rief von unterwegs Bree an, um ihr zu sagen, dass das FBI mich engagiert hatte.
»Geht es um Senatorin Walker?«
»Dazu darf ich nichts sagen.«
»Gut für das FBI, schlecht für die Metro Police«, meinte sie. »Nicht vergessen, heute Abend ist das Spiel.«
»Auf jeden Fall«, entgegnete ich. »Wir sehen uns dort.«
»Versprochen?«
»Versprochen.«
Bree hielt kurz inne, dann sagte sie: »Ich muss los. Der Chief will mich sprechen.«
Die Verbindung brach ab, und kurz darauf fuhren wir auf den Parkplatz vor der Sicherheitsschleuse der CIA, einem rechteckigen Block aus kugelsicherem Glas neben zwei stabilen Stahltoren, die verhindern sollten, dass unbefugte Fahrzeuge auf das Gelände kamen.
Wir zeigten unsere Ausweise vor. Die Wachen wussten anscheinend schon Bescheid, jedenfalls zückte der eine jetzt ohne weitere Erklärung eine Kamera, fotografierte uns, druckte zwei Besucherpässe mit Bild aus und heftete sie an unsere Jacken.
»Zum Haupteingang«, sagte er dann. »Warten Sie im Foyer. Man holt Sie ab.«
Der Wind wurde stärker und wehte uns körnigen Schnee entgegen, sodass wir unsere Schritte beschleunigten. Dann betraten wir ein Foyer mit einer hohen Gewölbedecke. In den schwarz-grauen, frisch polierten Granitfußboden war ein riesiges CIA-Wappen eingelassen. Wir stellten uns neben das Wappen und warteten, während zahlreiche Menschen an uns vorbeigingen, Akademiker in Anzügen ebenso wie eher sportlich wirkende Typen.
»Analysten und Agenten«, murmelte ich leise.
Noch bevor Ned etwas erwidern konnte, ertönte eine weibliche Stimme: »Special Agent Mahoney? Dr. Cross?«
Wir drehten uns um und sahen uns einer adretten, unaufdringlichen Mittdreißigerin gegenüber. Sie trug einen einfachen, blauen Hosenanzug und kam direkt auf uns zu. Ihre Streberbrille saß weit vorne auf der Nasenspitze. Sie blickte uns mit zusammengekniffenen Augen an und machte keine Anstalten, uns die Hand zu reichen.
»Würden Sie mir bitte folgen?«
Ohne unsere Antwort abzuwarten, machte sie auf dem Absatz kehrt und marschierte los. Wir hielten uns dicht hinter ihr und gelangten in einen langen Flur mit vielen Türen ohne jede Markierung. Ich hatte keine Ahnung, woher sie wusste, welche die richtige war.
Sie zückte ihre Schlüsselkarte, dann ertönte ein leises Klicken. Sie drückte die Klinke und führte uns in ein neutrales Besprechungszimmer mit einem leeren Tisch und ein paar Stühlen, umrundete den Tisch, nahm Platz und faltete die Hände.
Dann sah sie uns erneut an. »Was möchten Sie über Kristina Varjan wissen?«
Ich war verblüfft. Ich hatte gedacht, sie würde uns zu der Spionin führen.
Mahoney hob die Augenbrauen. »Sie sind die Agentin, die diese Frau am Flughafen erkannt hat?«
»Das ist korrekt. Sie können mich Edith nennen.«
»Sie sehen eher nach Vorstadtmutter aus als nach Spionin, Edith«, sagte ich.
»Das ist genau so beabsichtigt«, erwiderte sie abweisend.
Mahoney sagte: »Wir wollen Varjan dingfest machen. Was müssen wir dazu über sie wissen?«
»Sie wollen sie dingfest machen?« Edith stieß ein sarkastisches Lachen aus. »Viel Glück, meine Herren. Ich hab’s, weiß Gott, versucht. Und zum Dank hat sie mir das da hinterlassen.«
Sie streifte das Jackett ab, zog ihr rotes, ärmelloses T-Shirt an der linken Schulter zur Seite und brachte unterhalb ihres Schlüsselbeins eine hässliche Narbe zum Vorschein. Sie sah aus wie mehrere ineinander verschlungene Spinnennetze.
Edith berichtete, dass sie sich die Narbe vor drei Jahren eingefangen hatte. Damals hatte die CIA Varjan im Verdacht gehabt, zwei US-Agenten in Istanbul ermordet zu haben. Ediths Auftrag hatte gelautet, Varjan in eine Falle zu locken, sie zu überwältigen und in ein Vernehmungslager in Osteuropa zu bringen.
»Ich habe sie aufgespürt, und als sie einen Wohnblock in der Nähe des Bosporus betreten hat, da dachte ich, ich hätte sie sicher«, fuhr sie fort. »Ich war bewaffnet und sie nicht. Zumindest nicht mit einer Schusswaffe.«
Doch Varjan hatte Edith überrascht und ihr mit einer scharfen Keramikscherbe mehrere Stichwunden zugefügt.
»Ich hätte es wissen müssen«, sagte Edith kopfschüttelnd und verschränkte die Arme vor der Brust. »Sie ist ein Improvisationstalent. In ihrer Hand kann alles zur Waffe werden, und sie tötet, ohne zu zögern.«
Weiter berichtete sie, dass Varjan laut den Aufzeichnungen der Einwanderungsbehörde am heutigen Morgen in die USA eingereist war, und zwar als Martina Rodoni, geboren in Ungarn und wohnhaft in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Als berufliche Tätigkeit hatte sie »Modeberaterin« angegeben und ihren Aufenthalt in den USA als Geschäftsreise deklariert.
»Gehen Sie davon aus, dass Sie sie unter dieser Identität nicht finden werden«, sagte Edith. »Sie hat sich garantiert schon eine neue zugelegt.«
»Aber wie sollen wir dann rauskriegen, wo sie ist? Und wieso sie überhaupt hier ist?«, wollte ich wissen.
Die CIA-Agentin drehte den Kopf zur Seite und spitzte für einen Moment die Lippen.
»Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass ich ihre Gewohnheiten kenne, ihre bevorzugte Hotelkette oder ihre Lieblingsspeisen, aber Varjan ist ein Chamäleon. Sie spricht acht Sprachen und wechselt ununterbrochen ihre Identität. Sie weiß genau, dass das das beste Mittel ist, um unentdeckt zu bleiben.«
»Das heißt also, wir haben absolut nichts in der Hand, was uns weiterhelfen könnte?«, sagte Mahoney.
»Nun ja, Sie könnten das tun, was ich auch gemacht habe, um sie ausfindig zu machen.«
»Und was war das?«, wollte ich wissen.
»Kriegen Sie raus, wer ihr nächstes Opfer ist, und legen Sie sich auf die Lauer.«
Ich ließ mir das durch den Kopf gehen. »Würde sie auch Politiker ins Visier nehmen?«
»Dr. Cross, solange die Bezahlung stimmt, nimmt Kristina Varjan jeden ins Visier.«
9
Bree trat vor die geschlossene Doppeltür im vierten Stock der Polizeizentrale in der Innenstadt und klopfte an.
»Herein«, ließ sich eine vertraute männliche Stimme vernehmen.
Bree stieß die Tür auf und betrat das Büro des Polizeichefs Bryan Michaels. Der Chief, ein sportlicher Mann mit dichtem, stahlgrauem Haar, hatte ein Handy am Ohr, lauschte aufmerksam und nickte dabei.
»Ich verstehe«, sagte er mit fester Stimme. »Klar und deutlich.«
Nachdem er das Gespräch beendet hatte, reichte er Bree die Hand und bot ihr einen Platz an. »Wo stehen wir in Bezug auf den Tod von Senatorin Walker?«
»An vierter Stelle, Sir.« Bree setzte sich auf den angebotenen Stuhl. »Das FBI leitet die Ermittlungen, unterstützt vom Secret Service und der Capitol Police.«
Das gefiel ihm offensichtlich nicht. »Heißt das, wir sind nicht einmal mit im Spiel?«
»Ich habe Ned Mahoney jede Unterstützung vonseiten des Metropolitan Police Department angeboten«, erwiderte sie. »Und ich werde täglich über die Entwicklungen informiert.«
Der Chief erwiderte: »Ich stehe mächtig unter Druck wegen dieser Sache, Bree. Der Polizeipräsident, der Bürgermeister, die Kongressabgeordneten, alle fragen sich, wieso wir bei einem Mordanschlag in unserem Zuständigkeitsbereich nicht ganz vorne mit dabei sind. Und ich frage mich das auch.«
Das verwunderte Bree. Chief Michaels war durch und durch Pragmatiker und kannte die Befehlsstruktur in Situationen wie dieser genauso gut wie sie selbst.
Noch bevor sie ihm eine Antwort geben konnte, stellte er bereits die nächste Frage: »Welche Rolle spielt Alex bei dem allem?«
»Den hat sich das FBI geschnappt. Aber was er im Einzelnen macht, kann ich nicht sagen.«
»Natürlich nicht.« Der Chief schüttelte den Kopf. »Ich weiß wirklich nicht, ob dieses Modell mit dem Beratervertrag tatsächlich funktioniert. Das ist …«
»Sir?«
»Als Alex noch in Vollzeit bei uns war, da war die Metro Police immer an der Spitze mit dabei, ganz egal, was es für ein Fall war«, fuhr Michaels fort.
»So ist er eben, Sir«, meinte Bree.
»Das stimmt«, erwiderte der Chief und beugte sich über den Tisch. »Aber im Moment steht er uns nicht zur Verfügung. Deshalb müssen Sie seine Rolle übernehmen, Bree. Sie sind mein Chief of Detectives, und ich will, dass Sie gierig sind. Unbürokratisch. Nicht so eine Griffelspitzerin. Ich will, dass Sie mutig auftreten, aktiv sind, dass Sie die Stadt würdig vertreten. Ich meine, großer Gott, da wird in unserem Zuständigkeitsbereich eine US-Senatorin ermordet, und bei den Ermittlungen ist von uns nichts zu sehen?«
»Chief, ich sage es noch einmal, und zwar mit dem allergrößten Respekt, aber das FBI …«
»Das FBI oder der Secret Service oder die Capitol Police, die interessieren mich einen feuchten Scheißdreck. Das hier ist meine Stadt, und Sie, Stone, sind hier Chief of Detectives. Beweisen Sie mir, dass Sie immer noch die Richtige sind.«
Bree verstummte kurz, dann hob sie das Kinn. »Und wie genau soll ich das beweisen, Sir?«
»Finden Sie den Mörder von Senatorin Walker und präsentieren Sie seinen Kopf Mahoney auf einem Silbertablett.«
10
Sean Lawlor hatte die Hände auf den Rücken gelegt und ging in seinem Apartment hin und her. Die ausgesprochen komfortable Airbnb-Unterkunft lag fünf Häuserblocks von der Stelle entfernt, wo er das Leben der US-Senatorin Betsy Walker beendet hatte.
Die meisten anderen Attentäter hätten wenige Stunden nach einem Mordanschlag auf eine solch hochrangige Zielperson versucht, die Umgebung ihrer Tat, wenn nicht die Stadt oder sogar das Land zu verlassen. Doch Lawlor war anders als die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen. Er ragte aus der Masse hervor und war stolz auf sein Denken und Handeln außerhalb der Norm.
Angesichts der Bedeutung, die Senatorin Walker gehabt hatte, würde die Einwanderungsbehörde besonders alle diejenigen in den Blick nehmen, die nach einem sehr kurzen Aufenthalt sofort wieder abreisen wollten. Aber auf solche Aufmerksamkeit konnte er getrost verzichten.
Darum hatte er beschlossen, noch drei Tage lang in Washington zu bleiben, bevor er in New York ein langes Wochenende verbrachte. Am darauffolgenden Montag wollte er schließlich von Newark aus nach Amsterdam zurückkehren.
Er ging in die Küche und warf einen Blick auf seinen Laptop, der aufgeklappt auf dem Küchentresen stand. Ein aufwendig verschlüsselter Internet-Browser zeigte den Stand seiner Bankkonten in Panama an, und zwar in Echtzeit. Bis jetzt war noch nichts passiert.
Warum zum Teufel dauert das so lange?
Andererseits … es war erst drei Stunden her, dass Lawlor eine verschlüsselte Kopie der Datei aus seinem Infrarotvisier abgeschickt hatte. Er hatte keine Ahnung, wozu das gut sein sollte. Walkers Tod wurde schließlich in jeder Nachrichtensendung gemeldet. Das hätte doch eigentlich reichen müssen.
Da spürte er ein leichtes Vibrieren in seiner Hosentasche. Er zog ein Prepaidhandy heraus, warf einen Blick auf die Anruferkennung und gestattete sich ein Lächeln.
»Ich bin’s, Piotr«, sagte er auf Russisch.
»Sergei«, erwiderte Piotr. »Du hast meine Welt ein bisschen freundlicher gemacht.«
»Aber auf meinem Konto hat sich das noch nicht niedergeschlagen.«
»Große Summen benötigen heutzutage eine gewisse Zeit, wenn sie anonym bewegt werden wollen. Doch bis dahin … hättest du Zeit für ein persönliches Treffen, um deine weitere Zukunft zu besprechen?«
Lawlor warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Nur wenn es heute Abend stattfindet.«
»Das passt. George Washington Hotel, die Bar auf der Dachterrasse. 20.00 Uhr. Außerdem kannst du dich in Kürze über eine kleine Anerkennung für einen reibungslos erledigten Auftrag freuen.«
Lawlor lächelte. »Wie aufmerksam von dir.«
»Auch Wölfe haben ihre liebenswürdigen Momente.«
Lawlor ging ins Badezimmer, um zu duschen und sich zu rasieren.
Als er fertig war und mit einem Handtuch um die Hüften durch das Apartment tapste, hörte er ein leises Pling.
Er schlenderte zum Laptop und stellte hocherfreut fest, dass soeben 1,4 Millionen Euro auf seinem Konto in Panama eingetroffen waren.
Das gefällt mir, dachte Lawlor. Das gefällt mir sehr.
Was mochte Piotr sich wohl noch für ihn ausgedacht haben?
Da ertönte die Türklingel.
Lawlor verspannte sich augenblicklich. Nur sehr wenige Menschen wussten, dass er sich in den Vereinigten Staaten aufhielt, schon gar nicht in Georgetown und erst recht nicht hier in diesem Apartment. Abgesehen natürlich von Piotr und seinen Vermietern …
Es klingelte erneut.
Er klappte den Laptop zu, ging in den Flur und drückte auf die Sprechtaste.
»Ja?«, sagte er. »Wer ist da?«
Eine weibliche Stimme mit Südstaatenakzent erwiderte: »Ein Geschenk von deinem zufriedenen Agenten.«
Ein Geschenk von seinem zufriedenen Agenten? Mit so einem Trinkgeld hatte er nicht gerechnet, aber es war in seiner Branche auch nicht vollkommen unüblich, vor allem dann nicht, wenn der Auftrag gewisse Schwierigkeiten mit sich gebracht hatte. Wie dieser hier. Trotzdem konnte er ein ungutes Gefühl nicht abschütteln.
»Na?«, gurrte die Frau. »Nimmst du das Geschenk an? Oder soll ich wieder gehen und ihm sagen, dass du kein Interesse hast?«
Lawlor zögerte zunächst, dann dachte er: Wie lange ist es her? Drei Wochen? Nein, mindestens vier.
Er drückte auf die Schlüsseltaste und sagte: »Zweiter Stock, ganz am Ende des Flurs.«
11
Freudig erregt, aber trotzdem vorsichtig eilte Lawlor ins Schlafzimmer und schlüpfte in eine dunkle Hose und ein schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt. Dann holte er ein kleines Messer mitsamt Scheide aus seinem Koffer und machte es an seinem Knöchel fest. Anschließend steckte er seine kleine Neun-Millimeter-Ruger hinten in den Hosenbund.
Ein leises Klopfen ertönte. Er zog seine Joggingschuhe an, ging zur Tür und blickte durch den Spion. Vor seiner Tür stand eine elegante Frau Mitte dreißig mit einem langen, schwarzen Kunstpelzmantel, der gut zu ihren pechschwarzen Haaren passte, hohen Wangenknochen, rubinroten Lippen und blasser Haut.
Spektakulär, dachte er, während er die Tür öffnete. Ein gottverdammtes Kunstwerk.
Sie trat ein. Lawlor nahm ihr Parfüm ebenso wahr wie ihren ganz eigenen, verführerischen Duft.
Er machte die Tür zu, ergriff ihre Hand, wirbelte sie herum und drückte sie fest gegen die Wand.
»He!«, protestierte sie, ohne sich jedoch aktiv zu wehren.
»Hände an die Wand«, befahl er. »Ich muss zuerst deine Handtasche und deine Taschen durchsuchen.«
»Wieso denn das?«, wollte sie wissen, während sie die Hände hob.
»Falls du gewisse Dinge dabeihast, die mir nicht passen.«