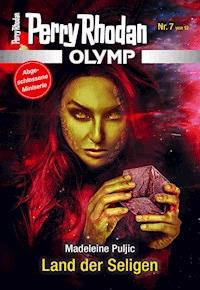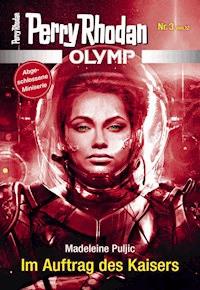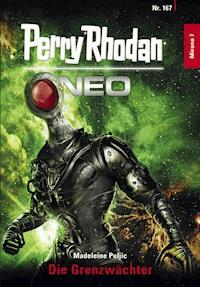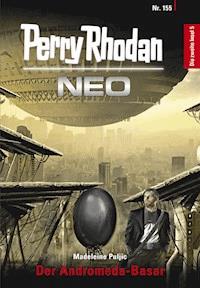3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Manche Wunden heilen nicht. Man muss sie ausbrennen. Noryak ist eine davon. In Noryak tobt ein Bürgerkrieg, der dabei ist, die Grenzen der Gesellschaft auszulöschen. Die Genoptimierung ist nicht länger das Privileg der Oberschicht, sondern ein Fluch, der die gesamte Stadt zu verschlingen droht. Die natürlich geborenen Puristen sind zu jedem Opfer bereit, um die Elite zu vernichten. Im Kampf um den Frieden finden unerwartete Verbündete zusammen: der Schöpfer der Optimierten, der ehemalige Anführer der Puristen und ein junger Priester, der mit beiden Welten verbunden scheint. Aber was können einzelne Menschen ausrichten, wenn eine ganze Stadt nach Krieg schreit? „Eine düstere Welt. Glaubwürdige Figuren, die man liebt und die man hasst. Viel Schmerz und wenig Hoffnung. Dies sind die Ingredienzien für eine beunruhigende, erschreckende SF-Vision von Madeleine Puljic.“ (Micheal M. Turner)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Impressum
Triggerwarnung
Madeleine Puljic
UNTER DEN NARBEN
Darwin’s Failure Teil 2
Roman
Für die, die nach uns kommen.
Wir wussten, was wir tun.
Triggerwarnung: Einige Elemente in dieser Geschichte können für manche Personen sensible Themen enthalten. Eine Auflistung finden Sie am Ende des Ebooks.
Prolog
Leera
Das Mädchen kauerte in der Dunkelheit der Nacht hinter einem Müllberg und horchte auf den Lärm der Aufstände. Das Klirren von berstendem Glas, die dumpfen Schläge von Explosionen. Das Schaben und Kreischen von Metall, das verbogen und zerrissen wurde. Und natürlich die Schreie. Furcht, Wut, Schmerz. Leera duckte sich tiefer.
Ihr Versteck lag etwa einen halben Block vom Gebiet der Überfälle entfernt – das musste ausreichen, um nicht entdeckt zu werden. Je näher sie an das Geschehen herankam, desto größer war ihre Chance, rechtzeitig zuzuschlagen, wenn es an der Zeit war. Sie musste schnell sein, sie durfte nicht zögern.
Die Schreie wurden lauter, aufgebrachter, und ein dumpfes Krachen ließ den Boden unter ihren Füßen beben. Der erste Brand brach aus. Über ihren Müllhaufen hinweg sah Leera das düstere Schimmern der Flammen, das sich deutlich von dem kalten Licht der Reklamen und Bildschirme auf den Häuserfronten abhob. Hitze und Asche wehten zu ihr herüber. Etwas war dort passiert.
Leera musste sehen, was es war. Vorsichtig tastete sie sich in Richtung Straße voran und lugte an dem Unrat vorbei.
Dort! Eines der Fenster war zerbrochen. Dahinter tobte ein Feuer, spuckte lodernde Vorhänge ins Freie. Enttäuscht wich Leera zurück. Die Puristen waren nicht in den Lebensmittelmarkt eingedrungen, bloß in das Wohnhaus daneben. Selbst im besten Fall versprach das wenig Beute, und inzwischen reichten die Flammen bis in den zweiten Stock hinauf. Doch niemand kam aus dem Haus gerannt. Niemand schrie um Hilfe. Das Gebäude stand leer, wie so viele in Noryak. Nichts zu holen.
Ein Scheppern lenkte ihre Aufmerksamkeit erneut auf den Supermarkt, an dem sich eine weitere Gruppe zu schaffen machte. Sie hatten das Schutzgitter abgerissen und es achtlos zur Seite geworfen. Mit aller Kraft droschen sie jetzt auf die Scheiben ein.
Mit jedem Schlag schwand Leeras Hoffnung weiter. Es tat sich rein gar nichts. Die breiten Fensterfronten bestanden offenbar aus bruchsicherem Glas. Trotzdem schlugen die Plünderer weiter in unbändiger Wut darauf ein.
Diese Gewaltbereitschaft der Reinen hatte alle in Panik versetzt. Auch Leera hatte anfangs das Weite gesucht, sobald sie die verhüllten Gestalten nur aus der Ferne erspäht hatte. Die Nachtstunden waren gefährlich geworden, besonders für jemanden wie sie. Jemanden ohne Heim, ohne Familie. Noch ein Kind. Wer die verfallenen und vergessenen Bereiche der Stadt sein Zuhause nannte, schlief im Schutz des Tages und blieb wachsam, solange die Finsternis Noryak regierte.
Die Nacht half, wenn es darum ging, die Abfälle der Arbeiter nach Essbarem oder brauchbaren Dingen zu durchwühlen. Doch die Gestalten, auf die man zu dieser Zeit stieß, begnügten sich selten damit, ihr das Essen unter der Nase wegzuschnappen. Leera war oft genug verprügelt worden, um das zu wissen – und damit war sie noch glimpflich davongekommen. Andere verschwanden einfach, selbst bei Tag.
Sie hatte gelernt, vorsichtig zu sein und Gelegenheiten zu nutzen. Es war der einzige Weg, auf der Straße zu überleben. Und sie sah die Möglichkeiten, die Puristen für jemanden wie sie eröffneten: Nacht für Nacht drangen die Rebellen in Geschäfte aller Art ein, schafften es aber niemals, alles wegzuschleppen. Immer blieb etwas zurück, das Leera erbeuten konnte.
Leider war sie nicht die Einzige, die das erkannt hatte. Selbst Arbeiter fanden sich mittlerweile ein, sobald sie die Feuer sahen – die liebste Waffe der Reinen.
Leera versuchte, in die Gassen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu spähen. Ihre Bemühungen waren sinnlos, das wusste sie. Es war zu finster. So spärlich die Beleuchtung der Hauptstraße auch war, sie machte es unmöglich, Einzelheiten in der Dunkelheit dahinter zu erkennen. Und die anderen waren nicht dumm. Sie lauerten ebenso im Verborgenen wie sie. Trotzdem wusste Leera, dass sie da waren. Nacht für Nacht wurden es mehr. Die meisten waren größer und stärker als Leera. Was bedeutete, dass sie flink sein musste. Nur wenn sie schnell genug hinein-und wieder hinauskam, würde sie ihren Hunger mit etwas anderem als Abfall stillen können.
Es sah jedoch äußerst schlecht aus für sie alle. Das Glas hatte noch nicht einmal einen Kratzer abbekommen.
Plötzlich kam Bewegung in die Gruppe der Plünderer. Ein wütender Schrei schallte durch die Nacht, weitere Feuer flammten auf.
»Verschwindet, ihr verdammten Parasiten!«
Mehrere Gestalten stürmten die Straße herab. Zehn. Zwanzig. Es wurden immer mehr. Andere Stimmen fielen in die Rufe des ersten Mannes ein.
»Mörder!«
»Abschaum!«
»Euretwegen muss meine Familie hungern!«
Die Neuankömmlinge stürmten genau auf die Puristen zu, die augenblicklich von ihrem Einbruchsversuch abließen und zu den Waffen griffen.
Leera erkannte noch die abgewetzten Overalls der Arbeiterschicht der Angreifer, dann wandte sie sich ab. Sie hatte in ihrem Leben bereits genug Blutvergießen gesehen. Die Schreie und Schüsse verrieten ihr alles, was sie wissen musste. Die Arbeiter waren eindeutig in der Überzahl, und sie waren nicht allein. Mindestens fünf in ihrer Gruppe hatten die schwarzen Uniformen der Exekutive getragen. Wer es in diese Ränge schaffte, kannte kein Erbarmen – nicht bei Bettlern, und bestimmt noch weniger, wenn es um Aufständische und Puristen ging.
Hier würde sie nichts finden.
Gegenüber löste sich ein Schatten von der Wand, der offensichtlich zu dem gleichen Schluss gekommen war. Seufzend machte Leera sich auf den Weg zurück zu ihrem Lager. Sie schlüpfte geschickt durch engste Durchgänge, hielt sich dabei immer möglichst nahe an den Häuserfronten. Wo es unvermeidlich blieb, überquerte sie Plätze und Straßen leise und zügig.
Die Gassen waren stockdunkel. Nahezu blind schlich sie voran – und stieß mit dem Fuß gegen eine leere Dose. Das Scheppern hallte von den hohen Wänden wider, so laut, dass es ihr in den Ohren weh tat. Leera erstarrte, wagte nicht einmal, zu atmen.
Das Echo verklang, die Stille kehrte zurück. Nichts geschah. Leera atmete erleichtert auf. Niemand hatte sie bemerkt. Sie setzte zum nächsten Schritt an, da geriet der Müllhaufen, zu dem die Dose gehört hatte, ins Rutschen. Direkt auf sie zu.
Sie wusste nicht, ob es bloß ihr eigenes Ungeschick gewesen war oder ob ihn jemand umgestoßen hatte, und sie hatte auch keine Gelegenheit, darüber nachzudenken. Die Panik in ihr ließ nur einen Gedanken zu: Sie musste weg hier, bevor man sie doch noch erwischte. Ohne weiter auf ihre Deckung zu achten, rannte sie los, sprang über eine Ansammlung von Kisten hinweg und lief, so schnell sie konnte. Sie ignorierte das Brennen in ihrer Lunge, die Schmerzen in den Beinen. Wollte nur noch weg. In Sicherheit, in ihren Unterschlupf …
Als sie endlich in den vertrauten Hinterhof gelangte, der zu ihrem Versteck führte, war das Keuchen in ihrer Brust in ein pfeifendes Rasseln übergegangen. Erschöpft und ein wenig schwindelig lehnte sie sich an die bröckelige Hauswand. In regelmäßigen Abständen war sie gezwungen, ihren Schlafplatz zu wechseln. Diesen hier bewohnte sie bereits seit ein paar Monaten, und bisher hatte noch niemand sie hier gefunden. Allmählich vermittelte ihr der Ort ein Gefühl des Nachhausekommens.
Das Keuchen in ihrer Brust wurde zu einem feuchten Rasseln. Leera hustete einen grünlichen Schleimbrocken heraus und spuckte ihn auf den Boden. Sollten ihn die Ratten fressen. Den zähen Biestern konnte selbst die kontrollsüchtige Oberschicht nichts anhaben. Der Schleim bereitete ihr keine Sorgen – sie kannte es nicht anders. Aber wenn sie eine Wahl gehabt hätte, wäre sie lieber als Ratte geboren worden.
Sie wischte sich übers Kinn, schlüpfte durch ein zerbrochenes Fenster in den Schutz ihres Verstecks und lauschte. Nichts. Selbst das Ungeziefer mied die Ruine heute. Leera atmete auf. Endlich konnte sie sich ausruhen.
In diesem Moment legte sich ihr eine vernarbte Hand auf Mund und Nase – und drückte zu.
1. Kapitel
Ramin
Chaos. Das war es, was die Bilder der Überwachungsvideos zeigten. Das war kein geordnetes Einschreiten der Exekutive, keine Spur einer Überlegenheit der optimierten Bevölkerungsschicht. Das war brutales, sinnloses Gemetzel, weiter nichts.
Ramin wandte sich von dem Bild ab, das auf die gesamte Fensterfront des Besprechungssaals projiziert war. Er hatte genug gesehen. Im Gegensatz zu den anderen Regierungsmitgliedern kannte er das Elend der Straße aus eigener Erfahrung. Ganz gleich, wie lange seine Jahre als Priester zurücklagen und wie gut er sie vor den anderen verbarg – vergessen konnte er sie nicht.
Er musterte die unbeteiligten Gesichter seiner Kollegen. Es war nicht so, als wären ihnen die Vorgänge in der Stadt völlig gleichgültig – jede weitere Stunde, die dieser Aufstand andauerte, bedeutete herbe finanzielle Verluste für die Oberschicht. Sie empfanden nur einfach nichts, weil es für sie nichts zu empfinden gab. Emotionen waren ein Störfaktor, und den hatte man entfernt.
Die Puristen sind fanatische Spinner, dachte er grimmig, aber sie haben recht. Diese Leute hier sind keine Menschen mehr. Nur funktionierende Organismen, die im Reagenzglas zu größtmöglicher Effizienz zusammengemischt wurden. Sie besitzen kein Herz. Keine Seele.
»Das ist erbärmlich.« Der Präsident tippte mit seinen Wurstfingern auf die Tischplatte. Der Bildschirm verschwand und gab den Blick frei auf die dicke Smogschicht, unter der Noryak begraben lag.
Ramin wollte lieber nicht wissen, was dieser Mann seinem Körper antun musste, um derart übergewichtig zu sein. Ein gesteigertes Maß an körperlicher Fitness war jedem Optimierten gegeben, einem so hoch Optimierten wie dem Präsidenten erst recht. Aber Sepion sah es als seine Art, seine genetische Überlegenheit zu demonstrieren: Er hatte es nicht nötig, körperlich fit zu sein. Während halb Noryak hungerte, mästete sich der Präsident zum unappetitlichen Fettklops. Ramin bezweifelte, dass er den anderen Ministern dadurch Respekt einflößte. In ihm weckte es jedenfalls nur Abscheu und Verachtung. Aber die empfand er ohnehin für alle in diesem Raum.
»Jorek!«, wandte Sepion sich an den Mann neben sich. »Ich verlange eine Erklärung für dieses … Debakel.«
»Die Aufstände der Rebellen werden niedergeschlagen, wie du befohlen hast, Präsident«, erwiderte der Kriegsminister ruhig. Zu ruhig für jemanden, der eigentlich gerade um seinen Posten fürchten musste.
Der Präsident sah das wohl genauso. »Deine Befehle lauteten, Arbeiter nur zur Verstärkung einzusetzen, unter der Aufsicht der Exekutive. Sah das für dich so aus, als hätten deine Leute noch die Oberhand über diesen Pöbel?«
Ramin glaubte, leise Verblüffung in den Zügen des Kriegsministers zu sehen. »Die Arbeiter schließen sich unseren Truppen von selbst an«, erklärte Jorek. »Ohne Bezahlung. Und wir können ihre Stärke nutzen …«
»Es sind Natürliche!«, unterbrach ihn der Präsident. »Wir können nicht zulassen, dass unsere Sicherheit von einem Haufen Missgeburten abhängt! Regle das gefälligst. Und was habe ich über Gefangene gesagt?«
»Wir haben Gefangene unter den Puristen gemacht, wie du befohlen hast. Aber sie wollen nicht reden.«
»Dann bring sie gefälligst zum Reden!« Nun hatte der Präsident die völlige Aufmerksamkeit der Versammlung. »Sie verstümmeln sich selbst, hast du etwa Skrupel, es ihnen gleichzutun? Es gibt genug von ihnen da draußen.« Er deutete in Richtung der Fenster, wo die Aufnahmen zu sehen gewesen waren. »Durch solche Aktionen werden wir ihnen jedenfalls nicht beikommen. Ich will wissen, wo sich diese Kreaturen verstecken. Ich will, dass dieser leidige Zustand ein Ende hat, bevor uns noch mehr Investoren abspringen. Verstanden?«
Jorek sah sich um, doch die anderen Minister schwiegen. Niemand wollte Stellung beziehen. Das war Joreks Angelegenheit, nicht ihre. »Ja, Präsident.«
»Gut. Dann wäre wenigstens das geklärt. Eniel, wie sieht es mit dem Wiederaufbau des N4-Centers aus?«
Völlig übergangslos, als würden nicht jede Nacht Hunderte Menschen auf den Straßen sterben und als hätte er nicht soeben das gnadenlose Foltern unzähliger weiterer befohlen, kehrte der Präsident zur Tagesordnung zurück. Es waren nur Zahlen, die Investoren abschreckten. Ein leidiger Zustand.
Je mehr Zeit Ramin in den Reihen der Klone verbrachte, desto mehr begann er, sie zu hassen.
Haron
»Wir sollten die Baustelle zerstören.« Ariats Stimme klang träge, als würde sie ihren Worten nicht die geringste Bedeutung beimessen. Ihr Kopf lag auf seiner Brust, ihre Finger strichen über die verschwitzte Innenseite seines Schenkels hoch und dann ebenso quälend langsam wieder hinab zu seinem Knie.
»Sie ist zu gut bewacht.« Mit seiner rechten Hand – der einzigen Hand, die ihm geblieben war – packte Haron ihren Unterarm und versuchte, sie an die Stelle zu befördern, an der er sie haben wollte. Mit einer geschickten Drehung entwand Ariat sich seinem Griff.
»Und das hält dich ab?«, fragte sie. »Je mehr von ihnen wir erwischen, desto besser!«
Vor ein paar Wochen noch hätte er ihr voll und ganz zugestimmt. Die Vorbereitungen für den Anschlag auf das N4-Center hatten Monate in Anspruch genommen. Sie hatten zu viel riskiert, zu viel investiert, um jetzt tatenlos mit anzusehen, wie die Oberschicht die Ruine des alten Centers einfach durch ein neues ersetzte. Er durfte nicht zulassen, dass die Klonforschung fortgesetzt wurde, als wäre nichts geschehen. Wenn er seine Leute umsonst in einen Bürgerkrieg gestoßen hatte, würden sie bald alles infrage stellen. Sich gegen ihn wenden.
Aber das Risiko allein war nicht der einzige Grund für sein Zögern. Mittlerweile hatte Haron andere Prioritäten. Es genügte, einmal versuchsweise tief Luft zu holen, um sich daran zu erinnern.
Die Sprengung des N4 hatte die Unterstadt von ihrer Hauptluftzufuhr abgeschnitten, weil er die Konsequenzen nicht bis zum Ende durchdacht hatte. Und je mehr Anhänger sie gewannen, desto knapper wurden ihre Vorräte. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der Hunger Einzug hielt. Zuerst musste er einen Weg finden, das Überleben der Reinen zu sichern, dann erst konnte er neue Aktionen riskieren.
Nicht, dass er diese Sorgen irgendjemandem anvertrauen würde – Ariat am allerwenigsten. Es war auch nicht nötig. Die Baustelle in die Luft zu jagen, entsprach ohnehin nicht seinen Plänen.
»Es sind Arbeiter, die dort oben schuften, Ariat«, erinnerte er sie. »Keine Klone. Willst du etwa unsere eigenen Leute umbringen?«
Ihre Antwort bestand aus einem unwilligen Schnauben. »Wenn es unsere Leute wären, wären sie hier unten! Wenn wir sie in den Straßen niedermachen, quält dich auch nicht dein Gewissen.«
»Weil sie sich uns entgegenstellen! Aber die Menschen auf der Baustelle erledigen nur ihre Arbeit. Sie versuchen, zu überleben.«
Er selbst hatte einmal nichts anderes getan. Es schien eine Ewigkeit her zu sein, doch das bedeutete nicht, dass er sein Leben an der Oberfläche einfach vergessen konnte.
Ariat stieß ein abfälliges Lachen aus, als wäre der Wunsch nach dem blanken Überleben nicht weiter ernst zu nehmen. Keine wirklichen Probleme, sondern nur eine kleine Unannehmlichkeit.
Ihre Ignoranz war mehr, als Haron hinnehmen konnte. »Was weißt du schon vom Leben dort oben?«, fuhr er sie an. »Du hast keine Vorstellung davon, du hast nie in einer der Fabriken geschuftet. Dort ist es schwer genug, den Tag zu überstehen!«
Mühsam schüttelte er die Erinnerung an sein altes Leben ab. Er konnte den Arbeitern nur helfen, wenn er das System änderte, und dazu musste er sich auf die Zukunft konzentrieren. Er musste voll und ganz Purist sein.
Davon abgesehen waren noch mehr Anhänger so ziemlich das Letzte, was er hier unten gebrauchen konnte. Wovon sollte er sie ernähren? Die Plünderungen brachten zu wenig ein, und er hatte ohnehin immer mehr Mäuler zu stopfen. Er musste eine Lösung finden, und zwar bald. Einen Weg, zu Ende zu bringen, was sie begonnen hatten, bevor es zu spät war.
»Du wirst lasch.« Ihre aufs Neue wandernden Finger machten deutlich, dass sie damit nicht nur seine Führungsmethoden meinte. »Das sollten wir ändern.«
Ariat rutschte tiefer. Ihr Atem streifte seinen Bauch, ihre Hände glitten seine Schenkel hinauf. Sie beugte sich hinab und flüsterte: »Oder hängst du auch dafür zu sehr an deiner Vergangenheit?«
»Was meinst du?« Jetzt, da sie sich endlich seinen körperlichen Bedürfnissen zu widmen begann, hatte er noch weniger Interesse an diesem Gerede.
Sie sah zu ihm auf. Die blassen Narben in ihrem Gesicht zuckten im schwachen Licht der Lampen. Sie verliehen ihrem Lächeln einen Hauch von Wahnsinn. »Glaubst du, ich weiß nicht, an wen du nachts denkst?«
»Ich denke an niemanden.« Zumindest versuchte er das.
»Natürlich. Du hast auch niemandem eine Blüte ins Fenster gesteckt.«
Schlagartig hatte sie seine Aufmerksamkeit. »Was?«
Es gab nur eine Blume, die er verschenkt hatte, und das hatte er in aller Heimlichkeit getan. Davon war er bis jetzt jedenfalls überzeugt gewesen. Er packte Ariat am Handgelenk.
»Woher weißt du davon? Bist du mir etwa gefolgt?« Er durchforschte seine Erinnerung, ob sie zu jener Zeit schon aufdringlich geworden war, aber die Wut hinderte ihn daran, seine Gedanken zu ordnen.
»Oh, keine Angst. Ich bin nicht eifersüchtig … Sie hätte ohnehin nichts damit angefangen.«
Hätte? Sein Griff wurde eisern, doch das Lächeln blieb unverändert auf Ariats Lippen. Selbst dann, als er sie grob auf Augenhöhe riss.
Diese Blüte war sein Abschiedsgeschenk an Sianna gewesen – seine Frau, sein früheres Leben. Sie war der einzige Mensch, der ihm je etwas bedeutet hatte, und er hatte nie eine Gelegenheit bekommen, sich von ihr zu verabschieden. Die Blüte war alles gewesen, was er ihr hatte geben können. Eine Entschuldigung, ein Lebwohl, ein guter Wunsch für die Zukunft. Etwas Schönes und Einzigartiges, das ihr Freude schenken sollte … Dieser Gedanke hatte ihm Halt gegeben, wenn die Schuldgefühle und Zweifel übermächtig geworden waren. Und nun sollte sie sein Geschenk nie bekommen haben?
»Was hast du damit gemacht?« Jedes Wort brannte wie Feuer in seinen Eingeweiden, doch Ariat blieb unbeeindruckt.
»Wieso regst du dich so auf?«, erwiderte sie kühl. »Es ist ja nicht so, als hättest du ihr die Blüte persönlich gegeben. Hattest du Angst, was sie zu deinen Narben sagen würde?«
»Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst!«
In Wahrheit kam Ariat seinen Befürchtungen weit näher, als er sich eingestehen wollte. Hatte ihn nicht der Gedanke von Sianna ferngehalten, dass sie bei den Puristen, als Teil seines neuen Lebens, kein Glück finden würde? Dass sie ohne ihn an der Welt festhalten konnte, die alles war, was sie kannte? Dass er es nicht ertragen hätte, wenn sie auf seinen Anblick mit Furcht und Abscheu reagiert hätte?
Geschickt nutzte Ariat seine Unachtsamkeit und machte sich von ihm los.
»Wo willst du hin?«, fragte er.
Ihre Gestalt hob sich dunkel gegen das Licht ab. Trotzdem sah er deutlich die Schnitte auf ihrem Rücken, die er auf ihren Wunsch dort hinterlassen hatte. Sie sahen entzündet aus – durch Xenos’ Verschwinden war ihnen auch der einzige Arzt abhandengekommen, den die Puristen besaßen. Noch so ein Problem, für das er keine Lösung hatte.
»Du denkst, ich weiß nicht, wovon ich spreche?«, fragte sie. »Ich weiß jedenfalls, dass du sie zurückgelassen hast. Du hättest sie längst zu uns holen können, aber das hast du nicht. Stattdessen kommst du zu mir. Und das immer wieder.«
Mit flinken Fingern haschte sie nach ihren Kleidern. Haron kam ihr zuvor. Er sprang auf und drückte sie grob an die raue Felswand. Sein Gesicht befand sich nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt. Er fühlte die Muskeln in seinen angespannten Kiefern zucken. Unbändige Wut tobte in ihm. Über ihren Ungehorsam, ihre dreiste Hinterlistigkeit … Nur mit Mühe gelang es ihm, seinen Griff lösen.
Statt ihr den schmalen Hals umzudrehen, nahm er ihre Kleider und stieß ihr damit vor die Brust. »Raus mit dir.«
»Bist du verrückt? Das ist mein Zimmer!«
Als ob ihn das im Augenblick kümmern würde. Er packte sie grob an der Schulter. Nackt, wie sie war, schob er sie durch den Vorhang, der als Abdeckung ihrer Wohnnische diente. Hinaus in das Tunnelgewirr der Unterstadt.
Sianna
Ein stetes, ohrenbetäubendes Hämmern dröhnte durch die Fabrikhalle. Staub und Ruß hingen in der Luft, so dicht, dass Sianna kaum atmen konnte. Es brannte in den Augen, verklebte ihre Lunge. Aber niemand sonst schien sich daran zu stören. Also unterdrückte sie den Hustenreiz und nahm ihren Platz an dem Fließband ein, das die Lagerhalle in mehrere Bereiche zerteilte. Schwäche zu zeigen beendete in den Fabriken leicht ein Leben. Es war ihr erster Tag hier, auf keinen Fall wollte sie auffallen.
Hoch über ihr stampften die Maschinen einen beunruhigenden Rhythmus. Sie versuchte, nicht zusammenzuzucken, wenn der metallene Arm direkt neben ihr herniederfuhr und sich in den Schutt grub, den die Arbeiter auf den Bändern sortierten. Sianna rief sich in Erinnerung, dass diese Fabrik nicht gefährlicher war als ihre letzte. Ihr würde nichts geschehen, solange sie sich aus der Reichweite der Mahlwerke fernhielt.
Wenn nur das Zittern in ihren Händen nicht gewesen wäre.
Mühsam suchte sie brauchbare Beton-und Stahlstücke aus dem vorbeiziehenden Geröll heraus, damit sie für den Bau neuer Gebäude wiederverwendet werden konnten. Mit jedem Brocken sah sie ein Unglück unvermeidlich näherkommen. Es fiel ihr nicht schwer, sich vorzustellen, wie die herabfahrenden Hebel ihre ungeschickten Finger zermalmten. Nicht, nachdem Haron dasselbe widerfahren war – und er hatte jahrelang an der Maschine gearbeitet, die ihm den Arm zertrümmert hatte.
Bei den Gedanken an ihren Mann wurde das Zittern schlimmer, also verscheuchte sie die Erinnerung. Es war egal, wie oft sie sich fragte, was aus ihm geworden war. Sie würde keine Antwort finden. Die Klinik, in der er nach seinem Unfall behandelt worden war, hatte ihr nach seinem Verschwinden kommentarlos eine Rechnung ausgestellt. Die hatte nahezu den gesamten Betrag verschlungen, den Sianna für den N4-Gutschein erhalten hatte. Sie hatte das Leben ihres Mannes mit ihrem ungezeugten Kind erkauft, mit dem Traum von einer besseren Zukunft. Und er hatte sie verlassen.
Sie wusste, dass er es für sie getan hatte. Hätte sein Aufenthalt im Krankenhaus nur ein paar Tage länger gedauert, wäre ihr gar nichts geblieben. Noch eine Woche, und die Schulden hätten begonnen. Schulden, die sie niemals hätte zurückzahlen können. Doch ihr Herz wollte von Verständnis nichts wissen, und mit einem gewissen Trotz hielt sie an ihrer Wut fest. Nach all dem Schmerz, nach der Angst und der Verzweiflung, war ihr Zorn das Einzige, an das sie sich noch klammern konnte. Denn das Geld hatte nicht lange gereicht.
Mit ihrem Lohn allein konnte sie sich keine richtige Wohnung leisten. Eine Weile lang hatte sie den Vermieter noch auf andere Weise bezahlen können, aber der war ihrer rasch überdrüssig geworden. Mit den Worten, dass er an jeder Ecke billigere Mädchen haben konnte, hatte er sie vor die Tür gesetzt.
Da hatte die Angst erst richtig begonnen.
An leerstehenden Gebäuden mangelte es Noryak nicht. Überall fand man billig gebaute Häuser, die zu wenig brauchbares Material enthielten, um einen Abriss zu rechtfertigen. Es waren allerdings kaum mehr als Ruinen, die irgendwann von selbst zusammenfielen.
Was Sianna jedoch wirklich fürchtete, waren die Nächte.
Die Nächte, in denen das Feuer wütete. In denen Schreie hallten und Leute starben.
Seitdem die Aufstände tobten, war das Leben unerträglich geworden. Lebensmittel waren unerschwinglich, für einen Wochenlohn erhielt sie gerade einmal einen Laib Brot und eine Dose Fleisch. Und wer sich zur Arbeit wagte, lief auch noch Gefahr, von vermummten Wahnsinnigen attackiert zu werden.
Haron hätte sie vor diesen Verrückten beschützt, doch Sianna machte sich wenig vor. Sie hatte den Zustand gesehen, in dem er an jenem Tag aus dem Krankenhaus geflohen war. Allein konnte er nicht lange überlebt haben, und Hilfe hätte er niemals angenommen.
Sein Stolz hatte sie oft geärgert, aber wenn man sich ansah, wie die Welt inzwischen geworden war, war es vielleicht besser …
»Was ist los mit dir, Neue?«, höhnte eine raue Stimme hinter ihr. Sie klang eindeutig zu nah.
Bevor Sianna sich umdrehen konnte, drückten grobe Hände auf ihr Gesäß und schoben sie gegen das Fließband. Nur wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht krachte der Metallarm herab, zerbrach den Beton und legte den wertvollen Stahl darin frei. Ihr Körper bebte, bei jedem noch so vorhersehbaren Knirschen der Maschine krampfte sich alles in ihr zusammen.
»Du bist zum Arbeiten hier, also schlaf nicht ein! Oder muss man dir etwa erst zeigen, wie man richtig zupackt?«
Jemand lachte. Sianna kniff die Augen zu, als der Metallklotz ein weiteres Mal herabstieß. Sie fühlte seine Wucht bis in ihre Knochen hinein vibrieren. Unsinnigerweise war ihr einziger Gedanke, dass sie ihren Overall nicht vollbluten durfte, wenn sie unter die Maschine geriet. Es war der letzte Besitz, den sie noch hatte. Auch wenn jeder Arbeiter einen von seiner Fabrik zur Verfügung gestellt bekam – ihr Exemplar war noch neu, und brauchbare Kleidung war auf dem Schwarzmarkt immer etwas wert.
Statt sie jedoch endgültig auf das Fließband zu befördern, lockerte der Schichtleiter seinen Griff.
»Wenn du deine Stelle behalten willst«, flüsterte er ihr zu, »dann solltest du heute ein paar Überstunden dranhängen.«
Als sie sich am Abend in ihre schäbige Bleibe schleppte, hatte sie nicht einmal mehr die Kraft, den Tumulten aus dem Weg zu gehen. Ringsum brannten Müllberge und Fahrzeuge, die Straßen waren übersät mit Schutt und zersplittertem Glas. Sianna setzte einen Fuß vor den anderen. Zu mehr war sie nicht in der Lage. Sie zuckte kaum zusammen, als hinter ihr eine Fassade explodierte. Betonbrocken prasselten zu Boden, doch das alles waren nur Hintergrundgeräusche. Die Welt war dumpf und grau.
Sianna taumelte zwischen den Aufständischen hindurch. Die johlenden Puristen schenkten ihr ebenso wenig Beachtung wie der wütende Mob von Arbeitern, der sich ihnen entgegenstellte. Jede Gruppe hielt sie für eine der ihren. Es kümmerte sie nicht mehr. Ohne aufzublicken, folgte sie den enger werdenden Gassen, bis sie sich schließlich an einem Müllberg vorbeizwängte. Der stinkende Haufen Abfall bildete die einzige Tür, die das Haus besaß, in dem sie Zuflucht gefunden hatte.
Sianna fühlte sich wund und leer. Vielleicht würde sie den nächsten Morgen nicht erleben. Einzuschlafen und einfach nicht mehr aufzuwachen … Was für ein tröstlicher Gedanke.
Aber sie wusste es besser. Morgen würde bloß ein weiterer Tag sein, und sie würde ihn nur auf dieselbe Art überstehen, wie sie den heutigen hinter sich gebracht hatte.
Auf den allgegenwärtigen Bildschirmen, von denen man selbst in der Metro und in den Fabriken nicht verschont wurde, hatte es geklungen wie ein Versprechen. Tagelang hatten die Nachrichten das Unglaubliche verkündet: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten waren Arbeiter nicht im Überfluss vorhanden. Höhere Löhne für jeden, der zur Schicht erschien. Nicht in Siannas alter Anstellung, Textilien hatten in Zeiten wie diesen keine Priorität. Aber unweit heuerte eine Baufirma neue Leute an.
Sianna hatte es für ein Zeichen gehalten, dass es doch noch Hoffnung gab für sie. Die Chance auf eine bessere Zukunft, ohne Hunger und Angst. Bei diesem Gedanken krampfte sich ihr geschundener Unterleib unwillkürlich zusammen. Sie presste eine Hand an ihren Bauch. Auf die Narbe, die Haron an ihrem letzten gemeinsamen Abend geküsst hatte.
Mit dem Zuschuss für ein auch nur geringfügig optimiertes Kind hätten sie ein neues Leben beginnen können, einen Schritt aus der Armut heraus. Aber das Schicksal hatte sich gegen sie gewandt. Erst Harons Unfall, und dann … Selbst wenn sie nicht gezwungen gewesen wäre, den Gutschein zu verkaufen, und die DNS-Entnahme zustande gekommen wäre – mittlerweile lag das Center in Schutt und Asche.
Sianna sank auf die fleckige Matratze, die ihr als Bett diente. Müde schob sie die Arme um ihre Schultern und umklammerte ihren Körper. Für sie würde es kein Kind geben, und das war gut so. Jemand ohne Optimierung konnte bestenfalls in den Fabriken enden. Zu so einem Leben wollte sie niemanden verdammen. Sie wollte es nicht einmal selbst leben.
Ihr fehlte nur der Mut, etwas daran zu ändern.
Atlan
Er sah in die Gesichter der Gläubigen, die sich auf den Bänken seines Gebetshauses eingefunden hatten. Sie waren müde und abgezehrt. Und mit jeder Messe wurden es weniger.
Sie waren hungrig, suchten Rat und Trost. Nichts davon konnte er ihnen geben. Die Spenden, die er und die anderen Priester früher an die Unterschicht verteilt hatten, waren bereits vor Wochen versiegt. Atlan verteilte, was er in besseren Zeiten zurückgelegt hatte, aber seine Vorräte gingen zur Neige. Niemand konnte etwas entbehren. Alle hungerten sie, brauchten … Und er hatte nichts als leere Worte für sie. Was sollte er ihnen sagen? Dass sich alles zum Guten wenden würde, dass sie nur durchhalten mussten?
Die Frau rechts vorne in der zweiten Reihe hatte ihren Mann in den nächtlichen Feuern verloren. Der Arbeiter hinter ihr seinen Sohn, weil der zur Schicht in einer der Fabriken angetreten war. Würde sich irgendetwas daran wieder zum Guten wenden? Nein. Nicht einmal den Trost eines besseren Lebens nach dem Tod konnte er den Hinterbliebenen geben. Davon sprach nur der alte, vergessene Glaube. Über Noryak wachte nur ein Gott: der Enttäuschte, der sich von der Menschheit abgewandt hatte und nur noch ein strafendes Auge auf die Menschen richtete.
Für Atlan fühlte es sich so an, als hätte Gott nun auch dieses letzte Auge vor den Taten seiner Schöpfung geschlossen. Was also sollte er diesen Leuten sagen? Alle Worte fühlten sich fahl und unbedeutend an. Lügen, nichts weiter.
Er wünschte, er hätte den Hass in sich, der in anderen Gebetshäusern gepredigt wurde. Hass auf die Klone, die Schuld waren an allem. Hass auf die Puristen, die den Krieg gebracht hatten. Doch er war zu sehr zwischen den Fronten gefangen. Er hatte eine Klonin geliebt und sie durch die Hände der Puristen auf grausame Art verloren. Die Puristen wiederum … Sie waren nicht alle schlecht. Das konnten sie nicht sein.
Füße schabten über den abgenutzten Fliesenboden. Wie lange hatte er seine Gemeinde nun bereits wortlos angestarrt? Zu lange jedenfalls.
Doch immer noch zögerte er. War es Hass, den sie hören wollten? Bisher hatte er in seinen Predigten von Vergebung und Nächstenliebe gesprochen und ihre Herzen damit erreicht. Aber seit der Krieg begonnen hatte, verlor er sie. An das Feuer, an die Kugeln … und an andere Priester, die ihre Wut und ihren Schmerz nicht abwiegelten, sondern rechtfertigten.
War es das, was die Menschen brauchten? Jemanden, der sie in ihrem Zorn bekräftigte und ihnen das schlechte Gewissen nahm, wenn sie ihre Menschlichkeit vergessen und zu einem weiteren Rädchen in der gewaltigen Maschine dieses unglückseligen Krieges werden wollten?
Nein, nicht seine Anhänger. Sie waren ihm treu geblieben, gerade weil er nicht demselben Pfad folgte wie andere. Weil sie nicht dem Hass verfallen wollten. Sie brauchten ihn als Stütze.
Viele von ihnen hatten Niove gekannt, sie als eine der ihren gesehen, ohne zu ahnen, dass ihre Gene nichts Natürliches an sich hatten. Sie hatten den Menschen in Niove gesehen. Klon, optimiert, natürlich, Purist – das alles waren nur Facetten ein und derselben Spezies. Er würde keinen Hass gegen eine davon predigen.
Entschlossen straffte Atlan die Schultern. Er räusperte sich, und das unruhige Schaben verstummte.
»Ich danke euch für euer Kommen«, begann er. »Gerade in diesen Tagen ist es schwer, sich nicht von der Gewalt vereinnahmen zu lassen, die unsere Leben bestimmt, jetzt mehr denn je. Den Mut nicht zu verlieren. Ein Opfer zu sein, während unsere Nachbarn, unsere Freunde zu Tätern werden. Aber ihr seid keine Opfer.«
Verwirrte, unglückliche Mienen bei seinen Gläubigen. Sie begriffen nicht, worauf er hinauswollte. Atlan war von seinen Worten selbst überrascht. Sie entsprachen nicht dem Ton seiner üblichen Reden. Doch nun, da er sie einmal gefunden hatte, sprudelten sie unaufhaltsam aus ihm hervor.
»Damit meine ich nicht, dass ihr euch zur Wehr setzen sollt. Das Letzte, was Noryak braucht, ist noch mehr Wut und Tod. Wer sich aus freien Stücken an den Kämpfen beteiligt, die unsere Stadt heimsuchen, ist nicht besser als jene, die sie angezettelt haben. Aber ihr müsst es auch nicht still erdulden, wenn man euch bedroht. Wenn man euch eure Liebsten nimmt. Wenn man euch Nahrung und Sicherheit nehmen will. Ihr müsst nicht die andere Wange hinhalten.«
Ein Gleichnis, das Meister Ektor, Atlans Vorgänger und Lehrer, gerne gebracht hatte. Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte auch die andere hin. Atlan hatte viele Weisheiten seines Meisters übernommen, ohne an ihrem Sinn zu zweifeln. Diese zählte nicht dazu. Wenn seine Kindheit im Kloster ihn eines gelehrt hatte, dann, dass Peiniger niemals aufhörten, wenn man sie auch noch in ihrem Tun bestärkte. Sie schlugen nur stärker zu.
»Ihr seid keine Opfer«, wiederholte er deshalb. »Seht euch um.« Er machte eine Geste, mit der er den gesamten Innenraum des Gebetshauses einschloss. »Ihr seid nicht alleine. Ihr müsst nicht alleine leiden.«
Die versammelten Menschen folgten zögernd seinem Appell. Verstohlen sahen sie sich um, begegneten erstmals den Blicken ihrer Sitznachbarn. Abend für Abend fanden sie hier gemeinsam zusammen, lauschten seinen Predigten und waren eine Gemeinschaft. Das änderte jedoch nichts daran, dass außerhalb dieses Gebäudes der Alltag lauerte, und dort draußen galt nach wie vor: Jeder war sich selbst der Nächste. Fremde konnten einen ausnutzen, verraten und hintergehen. Je weniger Leuten man vertraute, desto sicherer war man. So jedenfalls war es früher gewesen. Die Zeiten hatten sich geändert. Konkurrenz um die zu wenigen Arbeitsplätze war nicht länger das, was diesen Leuten Sorge bereiten musste.
»Ihr seid nicht alleine. Ihr seid viele. Wir sind viele. Wir können einander helfen. Wir wollen alle dasselbe: überleben. Wenn ihr Tag für Tag füreinander da seid, so wie ihr es hier seid, dann können sie euch nicht zu Opfern machen. Schützt euch. Unterstützt euch. Habt Vertrauen. Begegnet dem Krieg mit Frieden. Seid das, was Puristen und Klone gleichermaßen vergessen haben: Seid menschlich!«
Betretenes Schweigen breitete sich aus. Sie starrten ihn an, fassungslos. Vielleicht auch enttäuscht. War er zu weit gegangen? Er wollte doch nur helfen!
Der Mann in der zweiten Reihe, dessen Sohn noch keine Woche tot war, erhob sich. Sein Blick war fest auf Atlan gerichtet. Dann drehte er sich um – und streckte dem Mädchen zu seiner Rechten die Hand entgegen. »Vertrauen für Frieden.«
2. Kapitel
Haron
So sehr es Haron auch widerstrebte, er wusste, dass Ariat recht hatte. Er hatte seinen Leuten ein Versprechen gegeben: die Klone zu vernichten und die Reinen aus ihrem Elend zu erlösen. Und nicht nur sie, auch die Arbeiter, die an der Oberfläche zurückgeblieben waren. Menschen sollten nicht länger in Fabriken sterben, das billigste Ersatzteil der Maschinerie.
Nun, zumindest diesen Teil hatte er gehalten. Stattdessen starben sie jetzt auf den Straßen.
Aber doch nur, weil sie sich gegen den Umbruch wehrten, der ihnen helfen sollte! Haron verstand die Angst, die sie dazu bewog. Es änderte nichts. Er brauchte sie. Wenn sich die gesamte Unterschicht erhob, die Türme der Oberschicht erstürmte und dem künstlichen Dasein ein Ende bereitete, gäbe es nichts, was diese verfluchten Klone dagegen unternehmen könnten. Sie waren schwach. Haron wusste, dass er im Recht war. Und dennoch verlor er diesen Krieg, weil es ihm an Ressourcen mangelte.
Er musste handeln. Nicht, um Ariat zu besänftigen – die war im Augenblick seine geringste Sorge, so gerne er auch die sture Aufmüpfigkeit aus ihr herausgeprügelt hätte. Doch in erster Linie musste er an die Menschen denken, die von ihm abhängig waren. Sie würden nicht mehr lange durchhalten. Er musste den Krieg beenden, und zwar bald.
Dazu brauchte er allerdings etwas Großes. Etwas, das den Arbeitern zeigte, dass die Kluft zwischen Ober-und Unterschicht überwunden werden konnte. Dass sie nicht auf die Willkür von Klonen angewiesen waren, sondern ihr Leben selbst bestimmen konnten. Etwas, das die Missgeburten in den Boden stampfte – und bei dem es keine Kollateralschäden unter den Arbeitern geben durfte. Diesmal musste alles nach Plan laufen.
Haron wusste, was er zu tun hatte. Aber dazu benötigte er Hilfe, und es gab nur einen Ort, wo er sie finden konnte.
Er zog die verbeulte, rostige Kiste unter dem Brettergestell hervor, die ihm als Bett diente. Es war lange her, dass er sie zuletzt benötigt hatte, doch der Deckel ließ sich ohne Schwierigkeiten öffnen. Haron entfaltete den Kapuzenmantel aus grobem, grauem Stoff und seufzte. Er hatte sich nicht mehr verhüllt, seit er die Puristen zum offenen Widerstand aufgerufen hatte, stolz trug er seine Narben zur Schau.
Heute jedoch brauchte er Anonymität.
Kurzentschlossen klemmte er sich das Bündel unter den Armstumpf und schob mit der Rechten den Vorhang seiner Wohnnische auf. Er hielt sich an die weniger belebten Gänge des Tunnellabyrinths. Doch mit all den Neuankömmlingen war ungenutzte Fläche hier unten mittlerweile Mangelware, und als Anführer der Reinen lag sein Wohnbereich im Zentrum. Es dauerte nicht lange, bis ihm neugierige Blicke folgten. Haron ignorierte sie. Er war niemandem Rechenschaft schuldig, seine Pläne gingen vorerst nur ihn etwas an.
Er zwängte sich durch die Menschenmenge, die sich zu jeder Tageszeit in der Haupthalle einfand und jeden freien Platz einnahm. Überall standen und saßen hagere Gestalten, die aus schmutzigen Schalen Portionen aßen, von denen Haron wusste, dass sie zu knapp bemessen waren. Er selbst hatte die Rationierung vorgenommen. Und doch tat er, als sähe er den Hunger in ihren Augen nicht. Er beschleunigte seine Schritte, ließ den Blick über die Menge schweifen. Zu viele dieser Menschen waren ihm fremd. Er kannte ihre Namen nicht, oftmals nicht einmal ihre Gesichter. Von ihrer Gesinnung ganz zu schweigen.
Endlich erspähte er den bulligen Umriss, nach dem er gesucht hatte. Hemmon hatte es sich am Rand der Gruppe bequem gemacht. Er hielt ein Kleinkind auf dem Schoß, von dem Haron wusste, dass es nicht seines war. Allerdings konnte er selbst aus dieser Entfernung erkennen, dass die dazugehörige Mutter allen Grund gab, sich um den Bastard zu kümmern. Eine kurvige Schönheit mit dunkel gefärbten Narben auf den bloßen Armen, die ihr ein wildes, entschlossenes Aussehen verliehen. Ihre schmachtenden Blicke machten diesen Eindruck keineswegs zunichte, vor allem, da Hemmon sie ungeniert erwiderte.
Haron zögerte, wurde langsamer. Wollte er Hemmon wirklich erneut an die Front zerren, fort von dieser Frau?
Dann blitzte in ihm die Erinnerung auf, wie eben dieser Mann sich schnaufend und schwitzend auf der Klonin bewegt hatte, die sie gefoltert hatten – während sie sie gefoltert hatten –, und der Zweifel verschwand. Hemmon war der Richtige für diese Aufgabe, nicht allein durch seinen beeindruckenden Körperbau, sondern weil er unberechenbar brutal sein konnte, wenn Haron ihm das Recht dazu einräumte.
Haron trat neben ihn. »Komm. Ich habe eine Aufgabe für dich.« Es war ihm gleich, wer seine Worte hörte.
Hemmon sah auf. Er stellte keine Fragen, ignorierte das Quengeln des Kindes und drückte es wortlos der Mutter in die Arme.
»Aber Hemmon …«
Der Riese brachte sie mit einem Kopfschütteln zum Schweigen. Der Aufstand kam an erster Stelle, alles andere danach. Wenigstens das hatte sich nicht geändert.
»Hol deinen Umhang«, forderte Haron, sobald sie den Hauptraum hinter sich ließen. Nun hob Hemmon doch fragend die Augenbrauen. Haron ließ sich auf keine Diskussionen ein. »Los, mach schon.«
Er selbst hatte die Reinen erst dazu aufgefordert, sich nicht länger zu verhüllen, weil dieser passive Protest nichts bewirkte. Nun würde er nicht anfangen zu erklären, weshalb man eben doch manches Mal Kompromisse eingehen musste.
Zum Glück war Hemmon niemand, der ernsthaft wissen wollte, warum etwas gemacht wurde. Ihm war nur wichtig, dass etwas geschah, und dass er dabei sein durfte. Er marschierte los in Richtung seines eigenen Wohnbereichs. Haron wollte ihm folgen, aber eine kleine Gestalt löste sich aus den Schatten und verstellte ihm den Weg.
»Wo wollt ihr hin?«, fragte Ariat.
»Wir haben etwas zu erledigen.«
»Und ich?«
»Du nicht.«
Ariats Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Drohend kam sie näher. Es hätte mehr Eindruck gemacht, wenn sie ihm nicht bloß bis zur Brust gereicht hätte. »Wir sind Partner, hast du gesagt.«
»Nicht in dieser Sache.« Selbst wenn er sie nicht für die Angelegenheit mit Sianna bestrafen wollte, er konnte Ariat bei dieser Sache tatsächlich nicht gebrauchen. Sie war zu labil. Und im Unterschied zu Hemmon gehorchte sie nicht einfach, wenn er einen Befehl erteilte.
»Was soll das heißen?«, fragte sie.
»Es heißt, dass du hierbleibst. Wir sind nicht lange fort.«
Ariat verzog die Lippen, als wollte sie ihm an die Gurgel springen und die Zähne in sein Fleisch schlagen. Aber so durchtrainiert sie auch war, Haron war ihr an Kraft weit überlegen, und das wussten sie beide. Sie hatten es im Bett oft genug getestet.
Er senkte die Stimme. »Zwing mich nicht, dir wehzutun.«
Sie zögerte, warf einen Blick in die Richtung, in die Hemmon verschwunden war. Als sie sich Haron wieder zuwandte, lag in ihren Zügen blanke Wut. »Dann geh doch!«, spie sie ihm ins Gesicht. »Aber glaub nicht, dass du danach zu mir kommen kannst.«
»Keine Sorge, das habe ich nicht vor.«
Ariat hieb die Faust gegen die steinerne Wand in ihrem Rücken und stürmte davon. Ein kleiner, blutiger Fleck blieb an der Mauer zurück.
Haron wischte ihn fort.
Faran
Während der Rechner initialisierte und all die angeschlossenen Gerätschaften erkannte und aktivierte, sah Faran sich unauffällig um. Geld musste ihr Auftraggeber haben, das hatte bereits seine Bestellung deutlich gemacht. Das Gebäude an sich war eindrucksvoll genug mit seinen unzähligen Sicherheitsvorkehrungen und dem Zugang über das Verbindungssystem, der erst im elften Stock lag. Wer tiefer hinab wollte, musste auf eines der benachbarten Gebäude ausweichen. Vermutlich gab es irgendwo eine versteckte Treppe, das erforderten die Vorschriften – doch wer etwas auf sich hielt, verschwieg so etwas geflissentlich. Die Räume waren hoch, alle Fenster mit Monitoren ausgestattet, die keinen Blick nach draußen erlaubten – oder herein. Noch waren sie schwarz. Das würde sich ändern, sobald die Installation abgeschlossen war.
Das erste Lämpchen schaltete auf Grün. Faran überprüfte die Verbindung: der DNS-Sequenzierer. Er gab einige Befehle ein und führte den Programm-Testlauf durch. Keine Fehlermeldung, alles lief nach Vorgabe. Einer der Fenster-Bildschirme nahm das Signal auf und warf das dreidimensionale Abbild eines menschlichen Genoms vor sich in den Raum. Wozu auch immer der alte Knacker einen Sequenzierer benötigte. Falls er seine Optimierung verbessern wollte, war er eindeutig zu spät dran, auch wenn er das vermutlich nicht hören wollte. Zu viel Geld machte Leute zu Idioten, jedenfalls Farans Meinung nach.
Hinter ihm schrillte ein Systemalarm los. Kelak hatte Probleme mit dem Extraktor. Ausgerechnet. Das sensible Gerät reagierte auf Störungen besonders anfällig. Aber das war Kelaks Problem, das musste er allein lösen. Entsprechend sah Faran nicht einmal von seiner Arbeit auf, als von der Tür her ein leises Schaben erklang und der Alte mit brüchiger Stimme schimpfte: »Das sind empfindliche Geräte! Wenn ihr nicht wisst, wie man damit umzugehen hat, richte ich sie lieber selbst ein.«
Faran ließ sich seine Schadenfreude nicht anmerken. Auch nicht den Hauch von Belustigung, den er bei dem Gedanken daran verspürte, wie der Alte mit seinem Rollstuhl zwischen den empfindlichen Geräten herumkurvte, solange die noch nicht an ihrem endgültigen Bestimmungsort standen. Als ob der auch nur eines der Dinger aktiviert bekommen hätte. Wahrscheinlich war der letzte Rechner, an dem der Alte gesessen hatte, noch über Kabel gelaufen, mit einem großen roten Knopf, auf dem »Einschalten« stand.
Kelak dagegen tat, als wäre der Alte sein Vorgesetzter persönlich. »Verzeihung, das war nur ein kleiner Fehler in der Systemintegration. Ich behebe das umgehend. Es wird nicht wieder vorkommen.«
Natürlich, ein Fehler in der Systemintegration. Wahrscheinlich hatte Kelak bloß einen falschen Berechtigungscode bei der Verbindung eingegeben.
Dem Alten schien diese Antwort jedoch zu genügen. Er grunzte und rollte davon. Nun blickte Faran doch auf. Er sah ihrem Auftraggeber nach, bis sich die Tür hinter ihm schloss. Dann drehte er sich auf seinem Sessel zu seinem Kollegen herum.
»Wenn der Extraktor schon über deinen Fähigkeiten liegt, solltest du vielleicht mal deine Eignung überprüfen lassen.«
»Halt die Klappe.« Kelak arbeitete verbissen weiter. Die Hälfte seiner Lämpchen leuchtete bereits grün und zeigte funktionierende Verbindungen an.
Dennoch konnte es Faran nicht lassen, noch einen draufzusetzen. »Dass du dich von einem Halbtoten so einschüchtern lässt … Was will der Krüppel überhaupt mit diesem ganzen Zeug? Das kann er doch niemals bedienen. Wenn du mich fragst, sollte er lieber Sterbehilfe in Anspruch nehmen, da würde er seinen Erben sicher einen Gefallen tun.«
»Bist du verrückt?« Kelak sah alarmiert zur Tür, doch die blieb geschlossen. »Ich habe gesagt, du sollst still sein!«, zischte er. »Willst du dafür sorgen, dass man uns beide degradiert?«
»Blödsinn.« Natürlich wollte er nicht degradiert werden. Da konnte er gleich seine Kündigung einreichen und versuchen, sich auf Bedienungshilfe umstrukturieren lassen. Aber selbst wenn der Alte sich über ihn beschwerte – seine Quoten waren gut, und er tat, was von ihm verlangt wurde: den Stundenaufwand unauffällig nach oben treiben, sodass der Gewinn ihrer Firma größer ausfiel.
»Vielleicht solltest eher du deine Eignung überprüfen lassen«, meinte Kelak. »Oder stellst du dich einfach nur dumm?« Erneut zuckte sein Blick zur Tür. »Das ist nicht irgendein Auftraggeber. Das ist O. G. Esser!«
Damit hatte er plötzlich Farans volle Aufmerksamkeit. »Der Orson Esser?«
Kelak nickte.
Ohne weitere Umschweife wandte Faran sich wieder seinen eigenen Aufgaben zu. Er versuchte nicht länger, Zeit zu schinden, sondern arbeitete konzentriert und effizient. Er fragte nicht, ob sein Kollege sich sicher war, was die Identität ihres Auftraggebers anging. Diese Erklärung war zu logisch. Er musste auch nicht länger überlegen, was der alte Knacker mit der besten Laborausstattung wollte, die man für Geld und Einfluss kaufen konnte.
Orson G. Esser war Hauptsponsor des N4-Centers gewesen. Das letzte Forschungsprojekt, an dem er aktiv beteiligt gewesen war, hatte die neue Generation hervorgebracht: die verbesserte Optimierung. Klone, deren Gene direkt aus dem Datenpool zur bestmöglichen Funktionalität zusammengesetzt werden konnten. Jedes führende Mitglied der Gesellschaft gehörte der neuen Generation an. Dieser Mann war der Vater der Menschheit, wie Faran sie kannte, und egal, was er mit dieser Ausrüstung vorhatte – es war nichts, dem Faran im Weg stehen wollte.
Das zweite Signal sprang auf Grün.
Ramin
Der Tod lag über Noryak, solange Ramin denken konnte, und vermutlich schon etliche Jahre länger. Bisher war es das schleichende Gift des Smogs gewesen, welches die Stadt erstickte; der Hunger, der sie zerfraß. Nun hatte der Tod ein anderes Gesicht bekommen. Ebenso hässlich, doch weniger verborgen. Er war willkürlich geworden, gierig und brutal. Menschlich.
Ein leises Pling ertönte, und die Fahrstuhltür öffnete sich vor Ramin. Er stieg aus, überquerte den mit kalten Steinfliesen verkleideten Gang und trat in den nächsten Aufzug, der ihn weiter nach oben bringen würde. Es dauerte eine Sekunde, ehe der Sensor seinen Mikrochip erkannte und die Berechtigung für den Zugang zu den gesicherten Ebenen akzeptierte. Das Bedienfeld aktivierte sich. Ramin legte den Finger auf die oberste Taste.
Jedes Mal diese Verzögerung. Und jedes Mal fürchtete er, dass seine Farce aufflog, dass statt der Freigabe ein Alarm ausgelöst wurde. Viel zu lange spielte er bereits dieses Spiel. Es konnte nicht ewig gut gehen.
Ramin musste sich zusammenreißen, um nicht über die schwulstige Narbe in seinem Nacken zu tasten, die unter dem Haaransatz verborgen lag. Narben waren verräterisch, und er trug zu viele davon. Klone und Optimierte erhielten den Chip im embryonalen Stadium, um ihre Entwicklung schon in dieser frühen Wachstumsphase in die gewünschte Richtung zu fördern. Ramin hatte seinen Chip von einem Schwarzhändler erstanden und ihn sich eigenhändig ins Fleisch geschoben. Eine falsche Identität, ein falsches Leben. Und wofür das alles?
Die Intrigen hatten ihren Reiz verloren, das Risiko, dem er sich aussetzte, war nichts mehr im Vergleich zu dem, was dort draußen im wahren Leben geschah. Es gab nichts, das er noch erreichen konnte, außer aus großer Entfernung zuzusehen, wie der Tod Noryak endgültig besiegte.
Da ertönte ein weiteres Pling, und Dunkelheit tat sich auf vor ihm. Ramin trat ins Freie und blickte auf, sah die Schwärze über sich, und darin … Sterne. Kleine, ferne Lichter, die in dem Nichts dort oben glänzten. Wie immer bei diesem Anblick befiel ihn ein leichter Schwindel. Er hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Hastig tastete er hinter sich, suchte Halt an der Wand des Fahrstuhls. Der Himmel. Die Unendlichkeit. Die Freiheit. Dinge, an die er sich noch immer nicht gewöhnt hatte und an die er sich wohl auch niemals gewöhnen würde. Selbst dem Großteil der Oberschicht war diese Erfahrung verwehrt. Seit dem Fall des N4-Centers war der Regierungssitz das einzige Gebäude, das aus der Smogschicht herausragte, kaum jemand hatte Zutritt zu diesem Dach.
Und ausgerechnet Ramin, der aus der Gosse kam und selbst aus dem Kloster verstoßen worden war, gehörte zu den wenigen Auserwählten, die diese wundersamen Sterne sehen durften. Gerade er, der so viele Jahre lang den Glauben gelehrt hatte, hätte wohl argwöhnen müssen, dass Gott ihn zu einem höheren Zweck an diese Position gebracht hatte – wie ein Werkzeug, das bereitgelegt wurde und auf seinen Einsatz wartete. Aber für Ramin zählte nur die größte Wahrheit des Glaubens: Gott scherte sich einen Dreck um seine Schöpfung. Er hatte sie längst aufgegeben und wartete bloß noch darauf, dass sie sich selbst zerstörte.
Und wie es aussah, war die Menschheit auf dem besten Weg dorthin.
Ramin trat auf die Umrandung des Daches zu. Ohne den Smog hätte man von hier aus die verfluchte Stadt überblicken können. Jedenfalls einen Teil davon. Sie erstreckte sich weiter, als man selbst von hier oben sehen konnte. Und dahinter ... Ödnis. Vergiftetes Land, das Noryaks Müll schlucken musste. Und die Leute wunderten sich, dass sie hungern mussten?
Aufständische niederzuschießen würde diese Probleme nicht lösen. Präsident Sepion und seine Handlanger begriffen nicht, wozu Hunger und Verzweiflung Menschen treiben konnten. Ramin schon. Er hatte es am eigenen Leib erfahren. Er würde diese Gewalt niemals unterschätzen, genauso wenig wie die Macht menschlicher Entschlossenheit.
Nachdenklich legte Ramin die Hände um die Brüstung, fühlte das kalte Metall an seiner Haut. Entschlossenheit …
Er war kein Werkzeug, das platziert worden war. Aber er war hier. Ein Natürlicher, dem die mächtigsten Klone der Stadt ihr Ohr leihen mussten, ob sie wollten oder nicht. Da konnte er ihnen auch die richtigen Dinge einreden.
Gewalt war nicht die einzige Lösung, um einen Krieg zu beenden.
Haron
Der Weg war lang. Und mühsam. Haron hörte das gleichmäßige Schnaufen seines Begleiters hinter sich. Mit der Metro hätten sie die Strecke in einer halben Stunde zurückgelegt, aber Haron machte sich nichts vor: Ihre Verkleidung aus abgelegten Arbeitsoveralls und genug verhüllenden Stoffen, um ihre Narben zu verdecken, mochte einem flüchtigen Blick standhalten. In der Enge der überfüllten Metros hätte man sie jedoch unweigerlich als das erkannt, was sie waren.
Die meisten Passagiere würden auf dem Weg von oder zur Arbeit sein – und damit eindeutig zu jener Fraktion gehören, die nicht gut auf Puristen zu sprechen war. Ein Risiko, das Haron nicht bereit war, einzugehen. Also führte er seinen Begleiter durch die engen, vergessenen Seitengassen der Stadt, zwischen Müll, Schutt und Verfall hindurch, bis die schmucklose Mauer des Klosters vor ihnen aufragte.
»Wir sind da«, sagte er.
Hemmon zog die Augenbrauen zusammen. »Hier willst du Unterstützung finden?«, fragte er.
Haron konnte seine Zweifel nachvollziehen. Das Gebäude war schlicht und nur wenige Stockwerke hoch, ohne technische Spielereien oder aufwendige Sicherheitsvorrichtungen. Abgesehen von seiner schieren Größe gab es nichts, was es von den umliegenden Häusern unterschieden hätte. Außerdem wirkte es heruntergekommen. Seit Harons letztem Besuch war die Fassade mit unflätigen Sprüchen beschmiert worden. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie zu entfernen. Ein Fenster war notdürftig mit Platten verbarrikadiert, die anderen zum Teil mit Plastikplanen abgedeckt.
»Wir werden sehen.« Es war der einzige Ort, an dem er noch irgendwelche Forderungen stellen konnte. Hier hatte er Verbündete, zumindest im Geiste. Von den Geschäften, die er mit dem Kloster geführt hatte und Xenos vor ihm, wussten die meisten Puristen jedoch nichts. Wenn es nach Haron ging, würde das auch so bleiben.
Er trat an das Eingangstor. Bei seinem ersten Besuch hatte er noch nach einem Sensorfeld Ausschau gehalten oder nach einer mechanischen Klingel, wie sie in den Arbeitervierteln üblich waren. Inzwischen wusste er es besser. Er hieb mit der Faust gegen das Tor.
Niemand reagierte.
»Sieht ziemlich verlassen aus, wenn du mich fragst«, meinte Hemmon.
Haron wollte ihn bereits zurechtweisen, als er etwas hörte. Stimmen, im Inneren des Gebäudes. Er hämmerte erneut an das Tor. Die Stimmen verstummten. Als niemand Anstalten machte, ihnen zu öffnen, verlor Haron die Geduld. Er warf seine Schulter gegen das rostige Metall. Nach kurzem Zögern tat Hemmon es ihm gleich, und gemeinsam drückten sie das massive Tor auf.
Staubige, abgestandene Luft wehte ihnen entgegen. Die Eingangshalle war leer und verwaist, in den Ecken sammelte sich Staub. Beunruhigung machte sich in Haron breit, aber er ließ sich nichts davon anmerken. Mit ausgreifenden Schritten durchquerte er die Halle. Ein leises Huschen war zu hören, das sich rasch entfernte. Also hatte er sich nicht getäuscht: Jemand war hier. Wieso kam dann niemand, um sie zu empfangen?
Er führte Hemmon in den Flur, von dem die Arbeitsräume der Priester abzweigten. Jedenfalls das eine Büro, das er kannte. Auch hier hatte sich einiges verändert. Die Tische, die den Gang säumten, waren leer, einer lag in Trümmern. Der Boden war fleckig, und von den Wänden bröckelte der Putz, als habe jemand zu oft darauf eingeschlagen. Aus einem Zimmer drang die monotone Stimme eines Nachrichtensprechers, untermalt von den Geräuschen der Aufstände. Irgendwo weinte ein Kind.
Haron deutete seinem Begleiter, zurückzubleiben. Was auch immer sie erwartete – er wollte derjenige sein, der die Situation als Erster einschätzte. Hemmons Reaktion traute er noch weniger als seiner eigenen.
Vorsichtig schob er sich an den Raum heran, aus dem die Geräusche drangen, und stieß die Tür auf. Sie glitt widerstandslos nach innen. Ein ununterbrochenes, wütendes Gemurmel wurde hörbar. Haron straffte die Schultern. Hemmon durfte ihn nicht zögern sehen, also trat er in das Halbdunkel des Arbeitszimmers. Es stank nach altem Schweiß, Talg und Urin. Im Flackern des Monitors erkannte er die verlotterte Gestalt, die hinter dem Schreibtisch hockte.
»Lorio«, sagte er.
Der Abt verstummte, nur seine Finger tasteten weiter über die Tischfläche. Sein Kopf ruckte zur Seite, sodass das lange, fettige Haar den Blick auf sein hageres Gesicht freigab. Dem Geruch im Zimmer nach zu urteilen, hatte er sich seit Wochen nicht mehr aus dem Raum bewegt, geschweige denn gewaschen.
»Sie brennen.« Seine Stimme klang heiser. Unbenutzt. Wie auf sein Kommando erschienen Feuerbilder auf dem Bildschirm und warfen ihr orangefarbenes Licht auf den Abt. »Sie werden alle brennen. Die Ungläubigen, die unnatürlichen Bastarde in ihren Türmen.« Er hob den Kopf und sah Haron an. »Deshalb bist du doch hier, nicht wahr?«
»Ich …« Das kalte Funkeln in Lorios Augen ließ Haron stocken. Was war mit dem jungen Mann geschehen? »Ja, das ist unser Plan. Allerdings benötigen wir dafür noch weitere Ressourcen. Mit der Unterstützung des Klosters …«
Lorio kicherte. Dann richtete er sich auf, legte den Kopf in den Nacken und lachte, laut und anhaltend. »Du willst Unterstützung?«, fragte er. »Von mir?«
»Wir hatten eine Vereinbarung«, erinnerte Haron ihn drohend. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass Hemmon seinen Tonfall erkannt und sich breitschultrig neben ihn gestellt hatte.
Den schmutzigen Priester schien das allerdings nicht zu beeindrucken. »Ja, die hatten wir. Du treibst mit deinen Aufständen die Menschen in meine Gebetsstätten, und ich helfe dir, die Klone zu stürzen.« Er breitete die Arme aus. »Dank deiner Kriegsspiele verfüge ich aber über keine Gebetsstätten mehr. Sie haben mit mir gebrochen. Ich habe keine Mittel mehr, und für dich schon gar nicht.«
Haron biss die Zähne zusammen und zwang seine Wut nieder. »Wir haben getan, was du wolltest. Dass du deine Priester nicht im Griff hast, ist dein Problem, nicht unseres.«
»Pass auf, was du sagst, Krüppel!«, fauchte Lorio.
Haron spürte eine Bewegung an seiner Seite. Sein Begleiter spannte die Muskeln an, bereit, dem Priester eine Lektion zu erteilen. Haron hielt ihn zurück.
Der Abt verzog die schmalen Lippen zu einem abfälligen Grinsen. »Du bist hier in meinem Haus, vergiss das nicht. Diesmal bist du derjenige, der etwas von mir will, nicht umgekehrt.« Er zuckte mit den Schultern. »Dein Ressourcenmangel geht mich nichts an. Ich habe euch bezahlt. Euer Plan ging nach hinten los. Sei ein Mann und akzeptiere das.«
Schneller, als einer der beiden anderen reagieren konnte, hatte Haron den Widerling am Kragen gepackt und zog ihn über die Tischplatte heran. Der Gestank des Priesters biss ihm in die Nase, doch Haron war Schlimmeres gewohnt.
»Was weiß ein Wurm wie du schon davon, zu seinen Fehlern zu stehen?«, zischte er. »Du wolltest groß hinaus, hast dafür sogar deinen eigenen Mentor ermordet. Und jetzt zerfällt dein kleines, idiotisches Imperium unter deinen Händen.« Er stutzte, als ihm die Parallele zu seinem eigenen Aufstieg bewusst wurde. Aber er hatte sich rechtzeitig wieder unter Kontrolle, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. »Der Krieg fordert von uns allen Opfer«, fuhr er fort. »Wir kämpfen wenigstens für unser Recht. Du dagegen hast dich aus reinem Egoismus zerstört.« Er stieß den stinkenden Mann von sich. »Leb mit deiner Schande.«
Lorio stolperte rückwärts. Er tastete nach seinem Hals. »Raus hier«, keuchte er.
Haron erkannte, dass weitere Worte sinnlos waren. Aus dem Kloster war nichts herauszupressen. Er kannte den Ausdruck in den Augen des Abtes gut genug, um zu wissen, was da unter seinem Wahnsinn lauerte: Hunger.
»Lass uns gehen«, sagte er, an seinen Begleiter gewandt. »Hier gibt es nichts für uns.«
»Du willst ihn mit seinen Beleidigungen davonkommen lassen?«, brummte Hemmon. Zum Glück erst, als sie auf den Gang hinausgetreten waren. Der Mann wusste, wann er den Mund zu halten hatte.
»Was gewinne ich, wenn ich dich den Burschen verprügeln lasse?«, entgegnete Haron. »Man kann nichts aus jemandem herauspressen, wenn nichts vorhanden ist.«
Er wollte sich dem Ausgang zuwenden, aber etwas hielt ihn zurück. Jetzt, da sie Lorios Büro hinter sich gelassen hatten, war das Wimmern des Kindes wieder zu hören, lauter als zuvor. Harons Eingeweide krampften sich zusammen. Er folgte dem Laut, von einem inneren Drang erfüllt, das Unglück mit eigenen Augen zu sehen. Er musste nicht lange suchen.
Es war leerer Raum, der wohl einmal für den Unterricht benutzt worden war. Die Staubschicht auf den Tischen verriet jedoch, dass er schon seit geraumer Zeit nicht mehr benutzt wurde.
Haron ging in die Knie. Unter dem hintersten Tisch fand er den Jungen. Sieben, vielleicht acht Jahre alt, abgemagert fast bis auf die Knochen, die Hände auf den aufgeblähten Bauch gepresst. Lorio hatte die Wahrheit gesagt. Er besaß keine Mittel mehr, nicht einmal für seine eigenen Schützlinge, falls er sie denn je als solche gesehen hatte.
Der Novize hob den Kopf, sah Haron aus viel zu großen, wässrigen Augen an.
Haron stieß den Atem aus, den er angehalten hatte, ohne es zu merken. Er kannte das Kind nicht. Natürlich nicht. Erst da wurde ihm bewusst, was er gleichermaßen gehofft und befürchtet hatte: Für einen Augenblick war er überzeugt gewesen, er würde denselben Jungen vor sich finden, den er seinerzeit aus dem N4-Center gestohlen hatte. Für Xenos. Für das Kloster. Ein perfektes Kind, um den Gläubigen die Illusion zu geben, sie könnten ebenso makellos wie die Oberschicht sein. Eines von vielen, wie er wusste. Aber das Einzige, das er selbst entwendet hatte.
Haron löste die Hand, die sich bei diesen Gedanken zur Faust geballt hatte, und streckte sie dem Novizen entgegen. »Komm mit, wenn du möchtest.« Ein Maul mehr, das er stopfen musste. Was machte das noch für einen Unterschied? Viel konnte der Kleine ja wohl nicht brauchen.
Der Junge zögerte, musterte erst ihn, dann Hemmon mit furchtsamem Blick. Doch schließlich siegte der Hunger. Der Hunger siegte immer. Er ergriff Harons Hand und ließ sich von ihm auf die dürren Beine ziehen.
Hemmon sagte nichts. Als der Junge stolperte, hob er ihn auf die breiten Schultern. Zu dritt machten sie sich auf den langen Weg zurück.
Die Nacht fiel herein, als sie noch Stunden von der Unterstadt entfernt waren, färbte den Himmel vom ewigen Grau des Smogs zu undurchdringlichem Schwarz. Haron wartete darauf, die Feuer der Aufstände auflodern zu sehen, doch die Nacht blieb dunkel. Zwar bewegten sie sich immer noch durch die kleinen, uneinsehbaren Nebenstraßen, um nicht aufgehalten zu werden – dass aber nichts zu hören, nichts zu sehen war, erschien ihm seltsam. Hatten seine Leute aufgegeben? Sahen sie keinen Grund zu kämpfen, wenn er sie nicht dazu antrieb?
Erst als ihr Weg sie wieder in die Nähe einer Hauptstraße führte und sie einen Blick auf die riesigen Monitore an den Häuserfronten der Oberschicht werfen konnten, erkannte er seinen Irrtum.
Es hatte sehr wohl einen Anschlag gegeben. Doch nicht auf die Läden der Optimierten, keines der vereinbarten Ziele für Plündereien. Nichts, um den Hunger zu stillen oder den Krieg voranzutreiben. Diesmal war es nicht die Suche nach Lebensmitteln und Waffen gewesen, die das Ziel ausgewählt hatte, sondern blinde Rache.
Haron biss die Zähne zusammen. Das Kloster brannte, und er wusste nur zu gut, wer dafür verantwortlich war.
3. Kapitel
Ramin
Wütend stürmte der ehemalige Priester durch die Gänge des Regierungssitzes. Er stieß jeden beiseite, der nicht schnell genug den Weg freiräumte. Verständnisloses Gemurmel folgte ihm, doch davon ließ er sich nicht bremsen. Er eilte weiter, erreichte die weniger frequentierten Bereiche und schlüpfte unbemerkt in die unscheinbare Nische an der Seite. Nervös sah sich er um, während der Scanner seinen Chip erfasste.