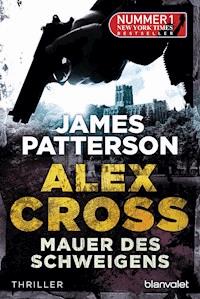9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Women's Murder Club
- Sprache: Deutsch
Was, wenn deine Beschützer die Täter sind?
Lindsay Boxer und ihre Freundinnen feiern gemeinsam den Geburtstag der Gerichtsmedizinerin Claire Washburn, doch die Party endet vorzeitig, als Lindsay an den Ort eines grausamen Verbrechens gerufen wird. Eine Frau wurde am helllichten Tag in der Öffentlichkeit ermordet, getötet mit zahlreichen Messerstichen. Zeugen gibt es keine. Als dann auch noch schockierendes Videomaterial auftaucht, auf dem man eine Gruppe von Cops Raubüberfälle begehen sieht, ist San Francisco in Aufruhr. Die Täter tragen Masken und gehen äußerst brutal vor. Wer sich ihnen in den Weg stellt, stirbt. Jeder könnte dahinterstecken, auch Lindsays Kollegen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Lindsay Boxer und ihre Freundinnen feiern gemeinsam den Geburtstag der Gerichtsmedizinerin Claire Washburn, doch die Party endet vorzeitig, als Lindsay an den Ort eines grausamen Verbrechens gerufen wird. Eine Frau wurde am helllichten Tag in der Öffentlichkeit ermordet, getötet mit zahlreichen Messerstichen. Zeugen gibt es keine. Als dann auch noch schockierendes Videomaterial auftaucht, auf dem man eine Gruppe von Cops Raubüberfälle begehen sieht, ist San Francisco in Aufruhr. Die Täter tragen Masken und gehen äußerst brutal vor. Wer sich ihnen in den Weg stellt, stirbt. Jeder könnte dahinterstecken, auch Lindsays Kollegen …
Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N. Y.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Patterson
mit Maxine Paetro
Das 14. Verbrechen
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »14th Deadly Sin« bei Grand Central Publishing, Hachette Book Group, New York.
Copyright der Originalausgabe © 2015 by James Patterson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
Covergestaltung: www.buerosued.deCovermotiv: Gettyimages/Steve Proehl
AF · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23770-7 V004
Für Suzie und John, Brendan, Alex und Jack
ERSTER TEIL
1 Es war ein strahlend heller, sonniger Morgen im Mai, und Joe Molinari unternahm mit Martha, seiner klugen, drolligen Hündin, sowie Julie, seiner hinreißenden, neun Monate alten Tochter, einen Spaziergang im Park.
Julie hing in einem Tragetuch vor seiner kräftigen, muskulösen Brust, blickte ihm über die Schulter und zeigte mit ihren Fingerchen auf den See. Sie hatte keinerlei Zweifel daran, dass sie richtige, verständliche Worte benützte und dass ihr Dad jede ihrer Anweisungen freudig befolgen würde.
»Hast du eigentlich überhaupt eine Genehmigung, um da überallhin zu zeigen?«, wandte Joe sich an die Kleine.
»Na, klar«, erwiderte er dann mit einer Stimme, wie Julie sie wahrscheinlich gehabt hätte, wenn sie hätte reden können. »Wir wissen doch alle, wer hier das Kommando hat, Daddy. Ich muss bloß irgendwohin zeigen und drauflosbrabbeln. Hihihi. Wer zuerst bei der Bank ist. Zu den Enten.«
Joe wuschelte Julie durch die Haare und nahm Marthas Leine noch ein bisschen fester in die Hand. Aufmerksam blickte er den Weg entlang bis zur Bank und musterte die verschiedenen Menschen mit Hunden und Kinderwagen, die Schatten zwischen den Bäumen und den Verkehr hinter der spiegelnden Wasserfläche. Dann hielt er inne und verharrte etwas länger bei einem Mann im mittleren Alter, der eine Zigarette rauchte und gedankenverloren auf sein Smartphone starrte.
Das alles war völlig normal für einen ehemaligen Bundesagenten, der bis vor Kurzem noch stellvertretender Direktor der Heimatschutzbehörde gewesen war. Mittlerweile hatte er sich auf Risikobewertung und -management spezialisiert und war als freiberuflicher Berater für Großkonzerne, Regierungsstellen und andere Behörden tätig.
Seit nunmehr sechs Monaten war er mit einem hochkomplexen Auftrag befasst, der einem Hindernisparcours voller praktischer und politischer Komplikationen glich und ihn bis zu achtzehn Stunden am Tag in Anspruch nahm. Den Großteil dieser Zeit verbrachte er in dem kleinen Gästezimmer, in dem er sein Büro eingerichtet hatte. Aber insgesamt schien der Auftrag sich positiv zu entwickeln, und er hatte ein gutes Gefühl dabei. Das hatte er auch in Bezug auf seine unmittelbare Umgebung. Jedenfalls setzte er sich ohne weitere Bedenken auf eine leere Bank mit freiem Blick auf die Enten und den See.
Julie lachte und fuchtelte wie wild mit den Ärmchen, als Joe sie aus dem Tragetuch holte und auf seinen Schoß setzte. Martha kam zu ihnen und wollte Julies Gesicht waschen, doch Joe schaltete sich ein und zog die Border-Collie-Hündin an seine Seite. Julie war ganz vernarrt in Martha und ließ ein lang anhaltendes, aufgeregtes Gebrabbel hören. Da klingelte Joes Handy.
Es war nicht Lindsays Klingelton. Er holte das Smartphone aus seiner Brusttasche und sah, dass Brooks Findlay ihn sprechen wollte. Brooks war bei der Hafenbehörde von Los Angeles beschäftigt und hatte Joe für diesen schwierigen Auftrag engagiert. Joe hatte ihn klar und deutlich vor Augen: ein ehemaliger College-Football-Spieler, durchtrainiert, nicht mehr ganz fülliges blondes Haar, Grübchen.
Es war eigenartig, dass Findlay schon so früh am Morgen anrief. Joe meldete sich.
»Joe. Hier ist Brooks Findlay. Haben Sie ein bisschen Zeit für mich?«
Findlays Stimme klang irgendwie dumpf und metallisch und versetzte Joe sofort in Alarmbereitschaft.
Was ist denn mit Findlay los, verdammt noch mal?
2 »Zeit habe ich«, sagte Joe. »Aber ich sitze nicht am Computer.«
»Kein Problem«, erwiderte Findlay. »Hören Sie, Joe. Ich muss Ihnen den Auftrag entziehen. Es funktioniert einfach nicht. Sie wissen ja, wie das ist.«
»Also, ehrlich gesagt … nein, weiß ich nicht«, meinte Joe. »Was ist denn los? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen.«
Ein paar Jungs kamen in Joes Blickfeld. Unter lautem Geschrei kickten sie einen Fußball über den Asphaltweg. Gleichzeitig gab das Baby ihm neue Anweisungen. Er legte der Kleinen die Hand auf den Bauch. Hoffentlich fing sie jetzt nicht an zu brüllen. Julie konnte wahnsinnig laut werden.
»Brooks, können Sie mich hören? Ich habe eine Menge Zeit in dieses Projekt gesteckt. Ich habe zumindest eine Erklärung verdient und die Chance, die eine oder andere Korrektur …«
»Vielen Dank, Joe, aber ich habe da keinerlei Handhabe mehr. Ab sofort nehmen wir das selbst in die Hand, ja? Sie unterliegen natürlich nach wie vor der Schweigepflicht, und … äh … Ihr Scheck ist schon unterwegs. Ach, ich kriege einen Anruf auf der anderen Leitung. Muss Schluss machen. Alles Gute.«
Dann wurde die Verbindung unterbrochen.
Joe hielt das Handy noch eine Weile stumm in der Hand, bevor er es in seine Tasche zurücksteckte. Wow. Keine Entschuldigung. Nicht einmal eine halbwegs plausible Begründung. Nur ein unnötig grausamer Schnitt.
Joe ließ sich die letzten Gespräche mit Findlay noch einmal durch den Kopf gehen. Hatte er womöglich eine Andeutung überhört? Hatten zwischen den Zeilen Vorwürfe oder Beschwerden mitgeschwungen? Ihm fiel beim besten Willen nichts ein. Eigentlich hatte Findlay sich immer sehr zufrieden geäußert. Und Joe war sich sicher, dass seine vorläufigen Analysen der sicherheitsrelevanten Aspekte bei den Abläufen in der Container-Abfertigung am Hafen von Los Angeles keinen Anlass zur Unzufriedenheit gegeben hatten.
Damit hatte er beim besten Willen nicht gerechnet.
Nachdem der erste Schock und die erste Verwirrung überwunden waren, nahm er die Folgen in den Blick. Zunächst einmal waren da die Einkommenseinbußen und dann die Demütigung, wenn er diese Pleite bei seiner nächsten Bewerbung irgendwie begründen musste.
Der Gedanke war nahezu unerträglich.
Er hätte zu gerne Lindsay angerufen, aber andererseits … warum sollte er auch ihr noch den Tag vermiesen?
»Hey, Julie«, sagte er zu seiner quengelnden Tochter. »Ist denn das zu glauben? Sie haben Daddy gefeuert. Am Telefon. Zack.«
Joe hob die Kleine wieder in das Tragetuch, und sie streckte die Hand aus und legte sie an seine Wange.
»Ist schon in Ordnung, Julie Anne. Ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam nach Hause gehen. Ich habe Lust auf einen Bananensmoothie. Du auch?«
Julie machte ein Gesicht, als würde sie gleich anfangen zu weinen.
Sein kleines Mädchen spiegelte ihm seine Gefühle.
»Ist ja gut, ist ja gut, Süße«, sagte Joe. »Nicht weinen. Wir kommen später noch mal wieder und sehen uns die Enten an. In absehbarer Zeit können wir jeden Tag hierherkommen. Ich kann auch ein paar Pfirsiche in den Smoothie mischen, einverstanden? Du magst doch Pfirsiche.«
»Auf jeden Fall, Daddy«, erwiderte er mit seiner Babystimme. Dann ließ er den Blick durch den Park schweifen und stand auf.
»Bist du so weit, Martha? Braves Mädchen.«
Sie bellte und hüpfte, und er ließ ihr lange Leine, bis sie am Ausgang des Parks angekommen waren. Dann nahm er sie für die wenigen Häuserblocks bis nach Hause wieder kurz.
Dort angekommen, dachte Joe nicht mehr an Obst, Eis und Joghurt. Er dachte an Findlay und stellte sich vor, wie er diesen rückgratlosen Mistkerl in den Mixer stopfte.
3 Zur gleichen Zeit saß ich an meinem Schreibtisch. Durch die Fenster zur Bryant Street fiel Tageslicht auf den Linoleumfußboden des Bereitschaftsraums.
Mein Partner, Inspektor Rich Conklin, stand rechts hinter mir, während der Leiter der Kriminalpolizei, Chief Warren Jacobi, sich ungeduldig über meine linke Schulter beugte.
Jacobi hatte vor einigen Jahren mehrere Kugeln in das Bein und die Hüfte bekommen, und die Verletzungen hatten ihn sichtbar altern lassen. Er hatte zwanzig Kilo zu viel auf den Rippen, seine Gelenke knackten bei jedem Schritt, und die ständigen Schmerzen hatten seinem bissigen Humor sämtliche Fröhlichkeit genommen.
»Macht euch auf was gefasst«, knurrte er und reichte mir eine CD. Anschließend seufzte er vernehmlich, während wir gemeinsam darauf warteten, dass mein »lahmarschiger« Computer endlich in Schwung kam.
Ich legte die CD in das Fach. Das Laufwerk surrte, und dann erschien ein Video auf meinem Bildschirm. Laut Datumsstempel war es heute Morgen um 3.06 Uhr aufgezeichnet worden. Die Kamera hing unter einer flackernden Straßenlaterne und zeigte einen menschenleeren Straßenzug im berüchtigt-zwielichtigen Tenderloin-Distrikt. Die grobkörnigen Aufnahmen stammten aus einer dieser billigen Überwachungskameras, die im Grunde genommen eher Kulisse waren als ein wirksames Mittel zur Identifizierung von Straftätern oder anderen Personen.
»Das ist in der Ellis Street«, sagte Jacobi. »Und das da ist Abschaum«, fügte er hinzu und zeigte mit seinem Wurstfinger auf drei Gestalten, die jetzt ins Bild kamen. Sie trugen schwarze Schirmmützen und marineblaue Windjacken, auf deren Rücken in weißen Buchstaben SFPD zu lesen war. Außerdem hatten sie automatische Handfeuerwaffen bei sich und näherten sich mit geschmeidigen Schritten einem rund um die Uhr geöffneten Laden mit einem großen gelben Leuchtschild über dem Schaufenster: BARESGEGENSCHECKS. Es war ein Pfandleihhaus für Schecks, das hauptsächlich von Menschen genutzt wurde, die nicht über ein eigenes Bankkonto verfügten.
Ich drückte den Rücken durch, drehte mich um und sah Jacobi fragend an.
Was zum Teufel ist denn das?
»Konzentrier dich auf die Arschlöcher da, Boxer«, sagte er. »Ist schwer zu erkennen. Kannst du das nicht schärfer stellen?«
»Besser geht’s nicht«, antwortete ich.
Lange, grobkörnige Sekunden lang sahen wir den Polizisten zu, wie sie die dunkle, von niedrigen, rechteckigen Geschäftsgebäuden gesäumte Straße entlanggingen. Dann sammelten sie sich vor dem beleuchteten Schaufenster und betraten im Gänsemarsch den Laden.
Im nächsten Augenblick erloschen sämtliche Lichter im Inneren des Ladens. Die Tür flog auf, und einer der »Polizisten« kam mit einem Beutel unter dem Arm herausgerannt, dicht gefolgt von den beiden anderen, die ähnliche Umhängetaschen bei sich hatten.
Jetzt kamen sie direkt auf die Kamera zu. Ich versuchte, in ihre Gesichter zu sehen, suchte nach besonderen Merkmalen, nach etwas, was eine Gesichtserkennungssoftware vielleicht identifizieren konnte.
Aber ihre Gesichtersahen genau gleich aus.
Erst jetzt wurde mir klar, dass diese Ganoven Latexmasken trugen. Wenige Sekunden nach Verlassen des Ladens waren die Männer mit den SFPD-Windjacken aus dem Blickfeld der Kamera verschwunden.
Jacobi sagte: »Verdammt. Kann mir bitte jemand garantieren, dass diese Typen da keine Polizeibeamten waren?«
4 Mir wurde speiübel angesichts der Bilder, die da gerade über meinen Bildschirm geflackert waren. Wie Jacobi hoffte auch ich, dass die Typen, die diesen bewaffneten Raubüberfall durchgezogen hatten, Ganoven mit einem ganz miesen Sinn für Humor und nicht etwa echte Polizisten waren.
»Hat es Todesopfer gegeben?«, wollte ich wissen.
»Den Besitzer. Er wollte die Kombination für den Safe erst rausrücken, nachdem sie ihn zu Brei geschossen hatten. Die Sanitäter konnten ihm noch ein paar wenige Worte entlocken, bevor er endgültig verblutet ist. Er hat gesagt, dass es Polizisten gewesen sind. Der Junge, der im Laden ausgeholfen hat, sagt, dass in dem Safe im Fußboden ungefähr sechzig Riesen waren.«
Conklin pfiff durch die Zähne.
Jacobi fuhr fort: »Das ist schon der zweite Überfall dieser Art. Vor ein paar Tagen haben drei Männer mit SFPD-Mützen und Windjacken einen spanischen Lebensmittelhändler ausgeraubt. Einen Mercado. Dabei ist zwar niemand getötet worden, aber sie haben auch fette Beute gemacht. Es versteht sich ja von selbst, dass wir diese Typen unbedingt dingfest machen müssen. Sonst fliegt allen Männern und Frauen in Uniform demnächst die Scheiße um die Ohren, ganz egal, ob zu Recht oder nicht.«
Conklin und ich nickten, und Jacobi machte weiter.
»Das Raubdezernat hat die Ermittlungen schon aufgenommen, aber ich habe Brady gesagt, dass ich euch beide ab sofort mit im Boot haben will. Schließlich hat es jetzt auch einen Mord gegeben. – Boxer, du kennst doch Philip Pikelny, den Leiter des Raubdezernats? Ruf ihn an. Du und Conklin, ihr arbeitet ab sofort mit denen zusammen. Dieser Fall hat ab sofort oberste Priorität.«
»Alles klar, Chief.«
Jacobi knurrte irgendetwas Unverständliches vor sich hin und verließ mit stapfenden Schritten den Bereitschaftsraum.
Die Kollegen vom Raub waren mit Sicherheit schon dabei, die Nachbarn in der Ellis Street zu befragen, während die Kriminaltechnik das betroffene Scheckpfandhaus auseinandernehmen würde. Wir konnten nur hoffen, dass vielleicht jemand etwas gesehen hatte und die Bande verriet, oder dass sie irgendwelche verwertbaren Indizien zurückgelassen hatten.
Ich rief Phil Pikelny an und teilte ihm mit, was Jacobi angeordnet hatte. Der Sergeant verriet mir alles, was er bislang über den Fall wusste.
»Der Tatort ist immer noch abgesperrt«, sagte er. »Die Kriminaltechnik wird wohl noch ein bisschen Zeit brauchen.«
Dann sagte er noch, dass er uns die Überwachungsaufnahmen des ersten »Windjacken-Coups«, des bewaffneten Raubüberfalls auf einen spanischen Mercado, zukommen lassen würde.
»Die Original-CDs sind schon bei der Staatsanwaltschaft, aber ich beantrage, dass Sie so schnell wie möglich eine Kopie bekommen.«
Ich rief bei der Verwaltung an und bat um die Dienstpläne jedes einzelnen Beamten des südlichen Bezirks. Vielleicht konnten wir zumindest eine Liste all der Kollegen zusammenstellen, die zum Zeitpunkt der beiden Überfälle dienstfrei gehabt hatten.
Die vordringlichste Frage für mich war folgende: Waren die Räuber tatsächlich Polizisten? Oder nur Verbrecher in Polizei-Windjacken? Damit sicherten sie sich in jedem Fall ein paar Sekunden Vorsprung, bevor die Opfer begriffen, dass sie ausgeraubt werden sollten.
Mein gutmütiger Partner ging ein paar Frühstücksburritos holen, und ich setzte im Pausenraum eine frische Kanne Kaffee auf. Dann nahmen wir an unseren einander gegenüberstehenden Schreibtischen Platz und krempelten die Ärmel hoch.
5 Etliche Stunden nach meinem Telefonat mit Phil Pikelny warteten Conklin und ich noch immer auf die Videoaufnahmen vom ersten uns bekannten Raubüberfall der Windjacken-Räuber. Die Bezirksstaatsanwaltschaft ließ sich Zeit. Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Noch konnte ich es schaffen. Dann teilte ich meinem Partner mit, dass ich in zwei Stunden wieder zurück sei.
»Ich habe eine Verabredung und darf auf keinen Fall zu spät kommen.«
Richie holte ein schlankes, grell umwickeltes Päckchen mit Schleife und Grußkarte aus seiner Schreibtischschublade und gab es mir.
»Das ist für Claire. Vielleicht kannst du mir ja ein Stück Kuchen mitbringen.« Er grinste charmant. Conklin ist ein gut aussehender Typ, der es irgendwie geschafft hat, nicht eingebildet zu werden.
Ich nahm sein Geschenk, holte mein eigenes aus meiner obersten Schublade und setzte mich in mein Auto, das auf dem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand. Zwei kurvenreiche Straßen und zehn Minuten später stellte ich meinen betagten Explorer am Straßenrand vor dem Bay Club ab. Ich legte meinen Ausweis auf das Armaturenbrett und ging um die Ecke zu dem Backsteingebäude, in dessen Erdgeschoss sich das Marlowe befand – ein wundervolles Restaurant mit einer Besonderheit: In die großen Fensterscheiben sind allerhand Zitate zum Thema Wein und Speisen eingeritzt.
Ich spähte durch die Scheiben ins Innere und sah Yuki und Claire im hinteren Teil an einem Vierertisch sitzen. Sie schienen sich ziemlich lebhaft zu unterhalten, und so, wie es aussah, vertraten sie unterschiedliche Positionen. Ich trat durch die Tür in den hellen, fabrikartig aufgemachten Speisesaal, und Yuki entdeckte mich sofort. Es sah fast so aus, als würde sie auf Rettung hoffen.
Sie rief mir über das laute Geplapper der vielen Gäste, das von den Wandfliesen und den zahlreichen Stahlflächen widerhallte, hinweg zu: »Lindsay, hier sind wir.«
Ich ging zu meinen Freundinnen, und Claire stand auf, um mich in den Arm zu nehmen. Sie sah wunderschön aus mit ihrer schwarzen Hose, dem Pullover mit V-Ausschnitt und dem Diamantanhänger in Schmetterlingsform, der an einer Kette um ihren Hals baumelte. In der Regel macht Claire immer gerade irgendeine Diät, um ein paar Pfund abzunehmen, aber in meinen Augen sah sie einfach perfekt aus.
»Alles Liebe, Schmetterling«, sagte ich. »Und alles Gute zum Geburtstag.«
Sie lachte. »Dir auch alles Liebe, Linds.«
Sie erwiderte meine Umarmung, und ich setzte mich ihr gegenüber neben Yuki. Zierlich wie sie war, hatte Yuki sich für einen eleganten blauen Anzug entschieden. Die seidigen Haare fielen ihr bis auf den cremeweißen Seidenkragen, und um den Hals trug sie eine Kette aus pinkfarbenen Korallenperlen. Als ich sie vor einer Woche das letzte Mal gesehen hatte, hatte sie allerdings ein wenig glücklicher gewirkt als jetzt.
»Alles in Ordnung?«, fragte ich sie.
»Alles gut«, lautete ihre Antwort.
Wir umarmten uns, und nachdem ich meine Jacke über die Stuhllehne gehängt hatte, kam Cindy an unseren Tisch geschwebt. Sie strahlte wie eine Rose bei Sonnenaufgang.
Noch mehr herzliche Umarmungen und Begrüßungsküsschen wurden ausgetauscht, dann legte auch Cindy ein raffiniert verschnürtes Päckchen auf den immer größer werdenden Haufen aus glitzerndem Papier und Schleifen in der Tischmitte.
Ich freute mich schon auf die Spezialität des Hauses: einen Hamburger aus Bio-Rindfleisch mit karamellisierten Zwiebeln, Speck, Käse und Meerrettichaioli, eingebettet in zwei warme, mit Butter bestrichene Brötchenhälften. Dazu Pommes frites. Aber noch mehr als auf diesen Genuss freute ich mich auf das Zusammensein mit meinen besten Freundinnen.
Cindy hatte unser kleines Grüppchen vor etlichen Jahren schon den »Club der Ermittlerinnen« getauft. Im Grunde genommen war es ein Witz, aber gleichzeitig steckte eine Menge Wahrheit darin, weil wir alle vier beruflich mit Verbrechen zu tun hatten: ich bei der Mordkommission, Claire als oberste Gerichtsmedizinerin von San Francisco, Yuki als aufgehender Stern bei der Bezirksstaatsanwaltschaft und dazu Cindy Thomas, eine fabelhafte Polizeireporterin beim San Francisco Chronicle.
Außerdem war Cindy seit Neuestem auch Buchautorin. Ihr Tatsachenbericht Fish und sein Mädchen: Eine wahre Geschichte über Liebe und Serienmord basierte auf einem Fall, den Conklin und ich bearbeitet hatten. Wir hatten die beiden Täter sehr gut gekannt. Cindy hatte unsere Ermittlungen begleitet und dazu beigetragen, dass wir Mackie Morales – Fishs Mädchen – letztendlich zur Strecke gebracht hatten.
Am Ende der Woche sollte das Buch erscheinen. Ich war mir ziemlich sicher, dass das der Grund für ihre strahlende Miene war.
Nachdem wir alle etwas zu trinken bestellt hatten, meldete Claire sich zu Wort: »Yuki will ihren Job kündigen.«
»Kann doch nicht sein!«, sagten Cindy und ich wie aus einem Mund.
»Ich denke darüber nach«, sagte Yuki. »Ich denke nur darüber nach. Es ist mehr eine … eine Gedankenspielerei. Jetzt macht doch nicht so einen Wind.«
Cindy sprach genau das aus, was ich dachte: »Oh. Mein. Gott. Ich weiß genau, was mit dir los ist. Du bist schwanger.«
Yuki war mit meinem Chef verheiratet, dem beinharten, aber unbestechlichen Lieutenant Jackson Brady. Allerdings waren sie erst seit vier Monaten verheiratet. Ich hatte gar keine Gelegenheit, mich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass Yuki und Brady ein Kind bekommen würden, weil Yuki Cindy in gewohnter Schnellfeuer-Manier eine Antwort entgegenschleuderte.
»Nein, nein, nein, ich bin nicht schwanger, aber wenn es euch nichts ausmacht – und damit seid ihr alle gemeint –, dann müssen wir jetzt das Essen bestellen, weil ich nämlich in einer Stunde bei einer eidesstattlichen Aussage sein muss.«
In diesem Augenblick klingelte mein Handy.
Ich warf einen Blick auf das Display, während die anderen mich mit ihren Blicken durchbohrten. Unsere Freundschaftstreffen waren von schonungsloser Offenheit geprägt. Wir hatten nur eine einzige Regel: Keine Telefonate.
»Tut mir leid«, sagte ich. »Aber da muss ich rangehen.«
Und das tat ich dann.
6 Ich ließ die Mädels alleine und suchte mir eine Nische, wo ich ungestört telefonieren konnte.
»Was ist denn los?«, wollte ich von Lieutenant Brady wissen.
»Eine Tote, an der Kreuzung Twenty-Fourth und Balmy Alley«, sagte er. »Ich will, dass du mit Conklin zusammen hinfährst. Dann nehmt ihr eine vorläufige Bewertung vor, riegelt den Tatort ab und bleibt so lange da, bis die Ablösung kommt. Jacobi sagt, dass ihr euch komplett auf diese Scheckpfandhaus-Geschichte konzentrieren sollt.«
Ich ging zurück an unseren Tisch.
»Tut mir leid, ihr Lieben. Das war mein Chef. Ich muss los.«
Entrüstet warf Yuki ihre Serviette ein paar Zentimeter hoch in die Luft.
Cindy sagte: »Was kannst du mir verraten?«
Sie war und blieb eben Journalistin durch und durch, egal ob in der Redaktion des Chronicle oder bei der Geburtstagsfeier einer Freundin.
»Gar nichts«, erwiderte ich. »Nicht das kleinste bisschen.«
»Wie oft muss ich dir eigentlich noch beweisen, dass du mir trauen kannst?«, entgegnete Cindy. »Und außerdem bist du mir was schuldig.«
Um ehrlich zu sein, da hatte sie recht. In beiden Punkten. Ich vertraute ihr. Und vor wenigen Monaten hatte sie mir das Leben gerettet.
»Ich kann dir trotzdem nichts sagen. Nicht mal ein Wort.«
Ich griff nach meiner Jacke. Als ich beinahe hineingeschlüpft war, sagte Claire: »Das kann doch nicht wahr sein. Nicht schon wieder!«
Ihre Miene ließ mich innehalten. Sie war sauer. Stinksauer.
»Wieso denn schon wieder?«, wollte ich wissen.
»Weil genau das an meinem letzten Geburtstag auch passiert ist«, erwiderte Claire. »Und im Jahr davor auch.«
»Bist du sicher?«
»Ich bin mir verdammt sicher! Obwohl, wenn ich mich recht entsinne, dann waren wir letztes Jahr mit dem Essen fast fertig, als du plötzlich abgehauen bist. Überleg doch mal, Lindsay. Wann warst du das letzte Mal dabei, als ich die Kerzen ausgepustet habe?«
»Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Wahl. Ich mach es wieder gut, Claire. Bei euch allen. Bei mir auch. Das verspreche ich hoch und heilig!«
Ich schob noch ein paar weitere Entschuldigungen hinterher, verteilte Luftküsschen und stürmte überhastet zur Tür hinaus. Draußen auf der Straße rief ich Rich Conklin an und sagte, während ich zu meinem Wagen ging: »Bin in zehn Minuten da.«
»Ich auch.«
Der Motor sprang sofort an. Ich scherte aus und steuerte meinen Explorer zu einer belebten Kreuzung im Stadtteil Mission.
7 Auf der Kreuzung von Balmy Alley und Twenty-Fourth Street sah es aus wie nach einer Massenkarambolage.
Ich zählte drei hastig abgestellte Streifenwagen, und der nächste kam bereits von hinten angerast. Beide Straßen waren abgesperrt, sodass der Verkehr sich auf der einen freien Spur in der Twenty-Fourth Street staute. Fußgänger drängten sich mit ihren Handys in drei dichten Reihen hinter dem Absperrband. Offensichtlich hatten sie nichts Besseres zu tun, als die blutüberströmte Leiche auf dem Zebrastreifen anzustarren.
Ich stellte meinen Wagen auf dem Bürgersteig ab, holte meine Digitalkamera aus dem Handschuhfach und sah, dass Conklin bereits mit einem jungen Streifenbeamten sprach. Er machte mich mit Officer Martin Einhorn bekannt, einem Berufsanfänger, der gerade einen Strafzettel wegen Falschparkens ausgeschrieben hatte, als es passiert war.
Während Einhorn uns den Tatort zeigte, huschten die Blicke aus seinen schwarzen Augen immer von mir zu Conklin und wieder zurück. Er schwitzte sichtbar, sprach mit gepresster Stimme und in abgehackten Sätzen. Höchstwahrscheinlich hatte er noch nie zuvor einen Toten gesehen, und jetzt war er in unmittelbarer Nähe eines richtigen Mordes gewesen.
Er sagte: »Ich wollte gerade dem roten Mazda da drüben ein Ticket verpassen. Das Mordopfer hat die Straße überquert, zusammen mit vielen anderen Menschen in beide Richtungen. Hauptsächlich Touristen.« Dabei deutete er mit einer Kopfbewegung auf die Attraktion der Balmy Alley: die vielen farbenprächtigen Wandmalereien, die hier im Lauf der letzten fünfzig Jahre entstanden waren und die alle diverse Menschenrechtsverletzungen zum Thema hatten.
»Ich habe nicht gesehen, wie es passiert ist«, sagte der Frischling. »Dann habe ich das Geschrei gehört, und als plötzlich alle weggelaufen sind, da … da habe ich … sie gesehen.« Er musste sich erst wieder sammeln, bevor er weiterreden konnte.
»Ich habe sofort die Zentrale verständigt, und dann war auch schon der Krankenwagen da. Hat vielleicht eine Minute gedauert. Sie haben gesagt, dass das Opfer tot ist, und ich habe gesagt, sie sollen sie liegen lassen. Weil das ein Tatort ist.«
»Sehr gut«, sagte ich.
Einhorn nickte und berichtete weiter, dass einige Minuten danach ein Streifenwagen eingetroffen sei. Die Beamten hatten alles abgesperrt. »Wir haben versucht, die Namen von so vielen Zeugen wie möglich zu notieren, aber die Leute wollten so schnell wie möglich weg von hier, und wir hatten nicht genügend Beamte, um sie festzuhalten. Aber zwei Zeugen sind dageblieben, Mr. und Mrs. Gosselin, da drüben. Mrs. Gosselin hat die Tat beobachtet.«
Während Conklin zu den beiden Genannten ging, die vor einem Zigarettenladen warteten, verschaffte ich mir einen Überblick, prägte mir die genaue Position des Opfers im Verhältnis zu Fahrzeugen, Häusern und Menschen ein. Dann duckte ich mich unter dem Absperrband hindurch und zeigte den Kollegen, die den Tatort bewachten, meinen Dienstausweis.
Einer der Streifenbeamten sagte: »Hier entlang, Sergeant. Und gut aufpassen wegen des Bluts.«
»Geht klar.«
Ich streifte mir Latexhandschuhe über und trat näher, um mir das Opfer genau anzusehen.
8 Es war ein grässlicher Anblick. Die Tote lag auf der Seite. Es handelte sich um eine Weiße mit schulterlangen braunen Haaren. Ihr Alter schätzte ich auf Ende vierzig, Anfang fünfzig.
Sie sah sehr gepflegt aus und war teuer gekleidet: Unter dem offenen hellbraunen Regenmantel trug sie einen Rock und einen Pullover aus beigefarbener Wolle. Das Blut schien aus einem langen Schlitz zu stammen, der sich von ihrem Unterleib bis zum Brustkorb zog. So eine Wunde ließ sich nur mit Kraft, Entschlossenheit und einem langen, scharfen Messer herbeiführen.
Das Opfer war schnell verblutet. Vielleicht hatte sie nicht einmal mitbekommen, was eigentlich passiert war.
Ich richtete meine Kamera auf die Wunde. Anschließend machte ich ein paar Nahaufnahmen von den Händen des Opfers – kein Ehering –, von ihrem Gesicht und ihren nylonbestrumpften Füßen. Die Frau war beim Sturz aus ihren Schuhen gerutscht, sodass ihre Füße wie gestrandete Fische wirkten.
Neben ihr lag eine echte und ziemlich kostspielige Louis-Vuitton-Handtasche. Ich machte die Tasche auf und fotografierte den Inhalt: ein paar gute Joggingschuhe, ein Schminkset, ein Sonnenbrillenetui von Jimmy Choo, ein Taschenbuch sowie eine Brieftasche aus braunem Leder, neu und von guter Qualität.
Ich klappte die Brieftasche auf und erfuhr, dass das Mordopfer den Namen Tina Strichler trug. Nach dem Geburtsdatum auf ihrem Führerschein war sie kürzlich zweiundfünfzig Jahre alt geworden und wohnte sechs Querstraßen vom Ort ihrer Ermordung entfernt. Sie besaß eine ganze Palette an Kreditkarten, und ihre Visitenkarten wiesen sie als Psychiaterin aus. Außerdem fand ich mehrere Quittungen für Einkäufe am heutigen Tag sowie zweihundertzweiundzwanzig Dollar Bargeld.
Ich holte mein Smartphone hervor und gab Strichlers Namen in eine App ein, die mir direkten Zugriff auf die Datenbanken des San Francisco Police Department ermöglichte. Ohne Ergebnis. Das war nicht weiter verwunderlich. Bis jetzt hatte ich keinerlei Erklärung für die Tatsache, dass diese offensichtlich wohlhabende Frau nicht ausgeraubt worden war. Sie war vielmehr am helllichten Tag erstochen worden, auf offener Straße, wo Handykameras eigentlich allgegenwärtig waren.
Ich umrundete den Leichnam und fotografierte die Schaulustigen auf dem Bürgersteig. Vielleicht wollte der Mörder beziehungsweise die Mörderin ja wissen, was wir am Tatort so machten.
Conklin kam zu mir und fasste die Zeugenaussagen zusammen. Dabei zeigte er in die Richtung, aus der das Opfer gekommen war.
»Die Gosselins haben die Balmy Alley überquert, und zwar so, dass sie dem Opfer entgegengegangen sind«, sagte er. »Mrs. Gosselin hat den Täter erst bemerkt, als sein Arm mit einer schnellen Bewegung zum Oberkörper der Ermordeten gezuckt ist. Sie hat aber nur gesehen, dass es ein mittelgroßer Weißer mit einer schwarzen Jacke oder schwarzem Mantel war. Oder mit einem schwarzen, überhängenden Hemd. Und sie glaubt, dass er braune Haare hatte.«
Conklin machte einen verärgerten Eindruck, und mir ging es genauso. So viele Augenpaare und trotzdem nur zwei Zeugen, von denen einer so gut wie gar nichts gesehen hatte.
Mein Partner fuhr fort: »Nach der Attacke ist der Täter einfach weitergegangen und in der Menge untergetaucht. Mr. Gosselin hat von alledem nichts mitbekommen. Als seine Frau angefangen hat zu schreien, hat er sich zu ihr umgedreht. Und danach war nur noch Chaos. Die reinste Massenpanik.«
Jetzt hielt ein Zivilfahrzeug neben uns an, und zwei Kollegen aus unserer Einheit stiegen aus: Fred Michaels und Alex Wang. Brady hatte die beiden erst vor Kurzem eingestellt.
Conklin und ich erzählten ihnen alles, was wir bis jetzt herausgefunden hatten. Ich versprach, dass ich ihnen einen schriftlichen Bericht mitsamt meinen Fotos zukommen lassen würde, sobald ich wieder im Präsidium war. Und dann, so leid es mir persönlich auch tat, übergab ich diesen Fall an meine neuen Kollegen.
Auf Conklin und mich wartete schließlich eine andere, ebenso scheußliche Mordermittlung. Wir setzten uns in unsere Autos und fuhren zurück ins Präsidium, aber in dem Moment, als ich in die Bryant Street einbog, überfiel mich eine Erkenntnis, und zwar so unvermittelt und plötzlich wie eine Ohrfeige aus heiterem Himmel.
Claire hatte recht!
Auch an ihren beiden vorangegangenen Geburtstagen war jeweils ein Mord geschehen. Und ich war mir so gut wie sicher, dass beide Fälle bis heute noch nicht aufgeklärt waren.
9 Als dieser grässliche Arbeitstag dann irgendwann zu Ende war und ich unsere Wohnung betrat, wedelte Martha mit dem Schwanz, bellte und brachte mir ein aufgeregtes Begrüßungsständchen dar. Ich umarmte sie, hielt ihre Vorderpfoten fest, und wir vollführten ein kleines Tänzchen. Dann rief ich nach Joe.
»Ich bade gerade Julie!«, kam es zurück.
Also gut.
Ich hängte meine Jacke auf, streifte die Schuhe ab und legte meine Pistole in den Waffentresor. Anschließend begleitete ich Martha in die offene Küche des luftigen Apartments in der Lake Street, wo ich als Joes Verlobte eingezogen war und in dem ich ein Jahr später, während eines Stromausfalls in einer überaus stürmischen Nacht, Julie zur Welt gebracht hatte. Damals war Joe nicht in der Stadt gewesen.
Jener Abend stand auf Platz eins meiner Liste der denkwürdigsten Nächte meines Lebens.
Ich machte Marthas Futternapf voll und schenkte zwei Gläser kalten Chardonnay ein. Dann ging ich, gefolgt von Martha, ins Schlafzimmer.
Ich klopfte an, machte die Tür zum Badezimmer auf und hatte die beiden Menschen vor mir, die ich mehr liebte als alles andere. Mein Lächeln zog sich bis zu meinen Ohren.
»Ooooooh«, gurrte ich. »Schau mal, wie niedlich und sauber sie ist.«
Ich beugte mich nach unten und gab Joe, der neben der Wanne kniete, einen Kuss. Julie grinste über beide bezaubernden Bäckchen, hob die Ärmchen in die Höhe und quietschte. Ich stellte die Weingläser auf die Kommode. Dann küsste ich Julies Hand und entlockte ihrer Handfläche ein paar komische Geräusche. Ich reichte Joe das pinkfarbene Handtuch, das mit UNSERWONNEPROPPEN beschriftet war.
Ich weiß ja, dass alle Eltern beim ersten Kind besonders unzurechnungsfähig sind, aber dieses Handtuch war ein Geschenk.
»Ich könnte auch ein Bad vertragen«, sagte ich, als Joe unser feuchtes Baby in die Arme nahm.
»Nur zu«, erwiderte mein attraktiver und überaus wundervoller Ehemann. »Wärst du mit einer Pizza Pronto einverstanden? Ich bestelle.«
»Ausgezeichnet«, erwiderte ich. »Würstchen, Champignons, Zwiebeln, okay?«
»Du hast die Jalapeños vergessen.«
»Und Jalapeños.«
Die Pizza kam pronto.
Während wir erschöpft und ungewaschen unser Abendessen verputzten, erzählte ich Joe von den Windjacken-Räubern. Als die Pizzaschachtel im Mülleimer lag, das Baby schlief und Joe in seinem Büro beziehungsweise im Gästezimmer saß und arbeitete, holte ich meinen Laptop ins Wohnzimmer und legte mich auf das große Ledersofa.
Obwohl ich mich vormittags und nachmittags intensiv mit den Windjacken-Räubern beschäftigt hatte, ging mir Tina Strichler, die Psychiaterin, die auf offener Straße erstochen worden war, einfach nicht aus dem Kopf.
Jetzt, wo ich einen vollen Magen und ein bisschen freie Zeit hatte, verspürte ich den inneren Drang, mich noch einmal mit den beiden Morden zu beschäftigen, die in den Vorjahren jeweils an Claires Geburtstag stattgefunden hatten.
Ich war mir so gut wie sicher, dass beide Fälle aus irgendeinem Grund bis jetzt nicht aufgeklärt worden waren.
10 Mein Mann stand hinter mir und massierte meine verkrampfte Nackenmuskulatur.
»Ooooh, zu Hause arbeiten ist echt toll«, sagte ich.
»Tja, kraftvoll und zärtlich zugleich. Zauberhände eben.«
Ich lachte. »Stimmt genau.«
»Noch einen Schluck Wein?«
»Nein, danke. Ich bin zufrieden.«
»Also gut.« Er drückte mir die Schulter. »Ich drehe noch schnell eine Runde mit Martha.«
»Ich warte auf euch.«
Sobald Joe und Martha die Wohnungstür hinter sich zugemacht hatten, sah ich nach unserer schlafenden Kleinen und machte mich wieder an die Arbeit.
Ich gab mein Passwort ein und hatte Zugang zur SFPD-Datenbank. Das Suchregister war im Grunde genommen nicht viel mehr als eine Liste der Opfer. Jede Akte war datiert und mit dem Vermerk »aktiv«, »abgeschlossen« oder »ungeklärt« versehen. Unter den Namen der Opfer stand jeweils der Name des ermittelnden Beamten.
Da ich nach einem ganz bestimmten Datum suchte, dauerte es nicht lange, bis ich die beiden Frauen entdeckt hatte, die an Claires Geburtstag den Tod gefunden hatten. Ich starrte auf die Namen und konnte mich an beide Fälle sofort erinnern.
Genau wie heute war ich vom Mittagstisch an einen Tatort gerufen worden, weil ich den notwendigen Dienstgrad besaß, nicht im Urlaub und in der Nähe des Fundorts der Leiche gewesen war.
Ich klickte den ersten der beiden ungeklärten Fälle an.
Vor genau zwei Jahren war eine Frau namens Catherine Hayes direkt vor dem kleinen Café ihres Vaters in Nob Hill ermordet worden. Hayes hatte tagsüber in dem Café ausgeholfen und nach Feierabend die Abendschule besucht, um sich zur Buchhalterin und Finanzberaterin weiterzubilden. An jenem zwölften Mai hatte sie draußen vor der Tür eine Zigarette geraucht und mit einer Freundin telefoniert, als ihr irgendjemand ein Messer in den Rücken gerammt und ihr anschließend die Kehle aufgeschlitzt hatte.
Es gab keine Zeugen, und die Freundin am anderen Ende der Telefonleitung hatte lediglich die Schreie des Opfers gehört. Hayes war nicht ausgeraubt worden. Der Mörder hatte sein Messer mitgenommen und auch sonst keine Spuren hinterlassen – keinen Zettel, keine DNA, keine Hautzellen unter den Fingernägeln des Opfers. Es gab praktisch keine Indizien, und auch die weiteren Ermittlungen hatten keinerlei verwertbare Hinweise erbracht. Catherine Hayes hatte tief verzweifelte Angehörige und Freunde hinterlassen, während ihre Akte im Stapel mit den ungeklärten Fällen verschwunden war.
Genau wie die von Yolanda Pirro, einer Lyrikerin, die im letzten Jahr an dem berühmten Bay-to-Breakers-Lauf teilgenommen hatte. Dieser zwölf Kilometer lange Volkslauf steht seit über hundert Jahren als Großereignis im Kalender von San Francisco. Viele Läuferinnen und Läufer tragen Kostüme, manche treten ganz nackt an, während andere als Fische verkleidet rückwärts laufen, als würden sie stromaufwärts schwimmen. Es ist wirklich ein unglaubliches Spektakel.
Yolanda Pirros Leichnam war am Tag nach dem Lauf in einem Gebüsch am Ende der Strecke entdeckt worden. Sie hatte Sportkleidung getragen, also nichts, womit sie irgendwie aufgefallen wäre.
Ihr Körper war von zahlreichen Stichwunden übersät gewesen, und jede einzelne wäre wohl tödlich gewesen. Ihr völlig am Boden zerstörter Ehemann und ihre engen Freunde hatten übereinstimmend ausgesagt, dass sie keine Feinde hatte. Sie hatte Gedichte geschrieben, sich ehrenamtlich in einem Gemeinschaftsgarten engagiert und war gerne gejoggt.
Sie hatte keine Berührungspunkte mit Catherine Hayes gehabt, keine gemeinsamen Freunde, Verwandten oder Bekannten. Der nördliche Bezirk hatte den Fall damals übernommen und weder Tatverdächtige noch Zeugen aufstöbern können – oder aber Zehntausende von Verdächtigen, nämlich alle die, die am Rennen teilgenommen hatten oder als Zuschauer dabei gewesen waren. Aber ohne jede Spur war auch Yolanda Pirros Akte irgendwann bei den ungeklärten Fällen gelandet.
Vieles an Pirros Fall erinnerte mich an Tina Strichler.
Viele Menschen, aber keine Zeugen.
Alle drei Opfer, die an Claires Geburtstag umgebracht worden waren, waren attraktive weiße Frauen zwischen vierunddreißig und zweiundfünfzig gewesen. Sie hatten in einer dicht besiedelten Wohngegend gelebt, alles in allem keine fünf Kilometer voneinander entfernt.
Gab es da vielleicht doch eine Parallele?
Nun ja, klar. Sie waren alle erstochen worden.
Ich starrte über den Rand meines Laptop-Monitors hinweg und durchforstete mein Gehirn, ob es vielleicht doch irgendetwas gab, was den Tod dieser drei Frauen miteinander verbinden könnte. Da küsste mich jemand auf die Schläfe.
Ich streckte die Arme aus, so wie Julie es immer macht, und Joe aktivierte sämtliche Lachfältchen und gab mir noch einen Kuss. Dann setzte er sich zu mir aufs Sofa.
»Was machst du denn da?«, wollte er wissen.
»Ich stöbere in ein paar alten Fallakten herum.«
»Ach ja? Und wieso?«
Ich erzählte ihm alles.
11 Um 3.15 Uhr schlug ich die Augen auf. Vielleicht hatte die scharfe Pizza mich schlecht träumen lassen. Oder ich hatte einfach nur gespürt, dass Joe mit offenen Augen neben mir lag.
Jedenfalls wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte.
Ich drehte mich zu meinem Mann um und legte ihm eine Hand auf den Unterarm.
»Joe? Alles in Ordnung?«
Er stieß einen Seufzer aus, der beinahe die Vorhänge auf der anderen Seite des Zimmers zum Rascheln gebracht hätte. Irgendetwas raubte ihm den Schlaf, aber was? Ich ließ mir in Windeseile noch einmal unseren Abend durch den Kopf gehen. Abgesehen von meiner Frage »Wie war dein Tag?« und seiner Antwort »Ganz gut« hatten wir nur über meine Arbeit und mich gesprochen.
Mit einem Mal hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen.
Ich rüttelte ihn sanft am Arm. »Joe? Was ist denn los?«
»Ich wollte dich nicht aufwecken«, sagte er.
»Hast du auch gar nicht. Was ist los?«
Joe seufzte noch einmal, dann knüllte er die Kissen zusammen, zog die Decke zurecht und trank einen Schluck Wasser. Endlich sagte er: »Brooks Findlay, dieser kleine Scheißer. Er hat mich gefeuert. Mann, also echt, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet.«
»Was? Aber wieso denn?«
»So richtig erklärt hat er es gar nicht. Es mit einem anderen Ansatz probieren, bla bla bla. War sowieso gelogen, das war ganz offensichtlich. ›Du bist raus. Dein Scheck ist unterwegs‹.«
Ich war geschockt, nicht nur über die Tatsache, dass Joe keine Arbeit mehr hatte, sondern genauso sehr darüber, dass Findlay meinen Mann so eiskalt abserviert hatte. Und zwar nicht nur deshalb, weil alles, was Joe Kummer bereitet, auch mir Kummer bereitet. Sondern weil Joe stellvertretender Direktor im Ministerium für Heimatschutz war. Er verfügt über ein außergewöhnliches Wissen, kann sehr gut kommunizieren und genießt außerdem überall auf der Welt einen hervorragenden Ruf. Hafenbehörden sind seine Spezialität.
Brooks Findlay hingegen hatte nach seinem Studium der Betriebswirtschaft einen Bürojob in Los Angeles angetreten. Also, aus meiner Sicht muss der Tag, an dem er Joe für diesen Auftrag engagiert hat, der Höhepunkt seiner beruflichen Karriere gewesen sein. Vielleicht passte es ihm ja nicht, dass er in Joes Schatten stand.
»Ich fasse es einfach nicht, Joe! Und du hattest nicht die geringste Ahnung?«
»Nicht den Hauch. Wenn ich irgendwie Mist gebaut hätte, dann hätte Findlay mir das ja garantiert genüsslich unter die Nase gerieben. Aber jetzt fällt mir keine andere Erklärung ein, als dass er mich nicht leiden kann. Oder dass einer seiner Vorgesetzten mich nicht leiden kann. Das stinkt doch zum Himmel! Wobei … letztendlich spielt es keine Rolle.«
»Wie meinst du das?«
»Weil ich noch nicht reif für die Rente bin. Ich werde mir was Besseres suchen. Aber erst, wenn ich diese Angelegenheit sauber zu Ende gebracht habe.«
Joe schnappte sich sein Handy und tippte.
Großer Gott. Es war doch erst halb vier Uhr morgens. Am anderen Ende der Leitung ertönte eine krächzende Stimme. Mein Mann sagte: »Hallo, Brooks, Joe Molinari hier. Hören Sie, Sie haben mich heute Morgen einfach abgewürgt, darum konnte ich es Ihnen nicht mehr sagen. Ich habe nämlich einen entscheidenden Durchbruch in unserer Sache erzielt … Ja, genau. Absolut. Ich habe den Schlüssel für dieses gottverdammte Rätsel entdeckt. – Aber da Sie mich noch einmal an meine Schweigepflicht erinnert haben, habe ich alles gelöscht. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Festplatte ist komplett neu formatiert. Die Informationen lassen sich also auf keinen Fall wiederherstellen. Die bekommt niemand zu Gesicht.«
Ich nahm kreischendes Protestgeschrei im Hörer wahr, ohne jedoch die einzelnen Worte zu verstehen.
»Nein, nein. Das ist alles. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie sich keine Gedanken machen müssen. Meine Arbeit hat nie existiert. Gute Nacht.« Joe unterbrach die Verbindung und fügte hinzu: »Du kleines Arschloch.« Mit einem teuflischen Grinsen im Gesicht wandte er sich an mich: »Also, das war echt unbezahlbar.« Er brach in schallendes Gelächter aus, und ich fiel ein. Dann stellte er sein Telefon auf lautlos und legte sich neben mich.
Ich stellte mir vor, wie Findlay fluchend versuchte zurückzurufen, aber immer nur die Mailbox erreichte. Absolut nichts erreichte.
Ich schlief in den Armen meines Mannes ein, und als ich wieder aufwachte, waren Joe, Julie und Martha in der Küche, und Joe machte Apfel-Pfannkuchen.
Es war der leckere Beginn eines ziemlich lebhaften Tages.
12 Innerlich zerrissen stellte Yuki an diesem Morgen ihren Wagen auf dem unbewachten Parkplatz vor dem Fort Mason Center ab. Um zehn hatte sie ein Bewerbungsgespräch beim Prozesshilfeverein, und obwohl sie gar nicht von selbst auf diese Idee gekommen, sondern vom Verein darum gebeten worden war, war ihr, seitdem sie diesen Termin vereinbart hatte, eigentlich permanent schlecht vor Aufregung.
Der Hauptgrund dafür war, dass ihre Arbeit ihr großen Spaß machte und sie ihren Chef, Leonard »Red Dog« Parisi, sehr gerne mochte. Er war außerdem ihr größter Förderer. Sie hatte weder ihm noch sonst irgendjemandem im Büro erzählt, dass sie mit dem Gedanken spielte, die Seiten zu wechseln. Aus diesem Grund kam ihr dieses Bewerbungsgespräch irgendwie hinterlistig und wie ein Verrat vor.
Und was genauso schwer wog: Sie hatte auch Brady nichts von diesem Termin erzählt. Ihr Mann war meinungsfreudig und konnte ziemlich stur sein, darum wollte sie selbst genau wissen, wo sie stand, bevor er sich äußern konnte. Zumal sie sich ziemlich sicher war, was er ihr raten würde: »Lass es sein!«
Yuki genoss den immer wieder fantastischen Blick auf die Bay Bridge, die sich über die glitzernde Bucht von San Francisco erstreckte. Dann schloss sie ihr Auto ab und ging quer über den Parkplatz zu einem Bürgersteig, der an einem der ehemaligen Kasernengebäude entlang verlief. Nachdem sie mehrere identische rostbraune Türen passiert hatte, entdeckte sie eine mit der Aufschrift PROZESSHILFEVEREIN.
Sie betrat das Büro und nannte der jungen Frau an dem einfachen Holzschreibtisch ihren Namen, nahm sich ein Pfefferminzbonbon aus einer bereitstehenden Schale und setzte sich auf einen von sechs identischen Holzstühlen. Abgesehen von der Empfangsdame war Yuki die einzige Person in dem kleinen, schmucklosen, ja, fast schon schäbigen Zimmer.