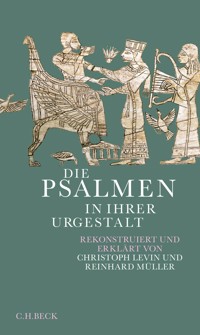9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kein anderes Buch hat Religion und Kultur der westlichen Welt so geprägt wie die Bibel und ihr größerer, Juden und Christen gemeinsamer Teil: das Alte Testament. Christoph Levin beschreibt seinen Aufbau, die Bildung des Kanons und die Überlieferungsgeschichte der Texte auf dem neuesten Forschungsstand. Eine Zeittafel und Literaturhinweise runden das bewährte Standardwerk ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Christoph Levin
DAS ALTE TESTAMENT
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Übersicht: Die Bücher des Alten Testaments/Abkürzungen
Übersicht: Die hebräische Bibel/Die Septuaginta
Einladung zur Lektüre
1. «Kein Jota oder Strichlein soll dahinfallen»: Der Text des Alten Testaments
a) Der hebräische Text
b) Der griechische Text
c) Weitere Übersetzungen
d) Qumran
e) Der Weg zum Urtext
2. Eine Bibliothek als Buch: Der Kanon des Alten Testaments
a) Die hebräische Bibel
b) Die Septuaginta
c) Deuterokanonische Schriften
3. Das Alte Testament als religiöse Überlieferungsliteratur des Judentums
a) Die Trägerschaft
b) Das literaturschaffende Interesse
c) Das Wesen des Interpretationsprozesses
d) Die literarische Analyse
4. Reste der altisraelitischen Literatur
a) Weisheitsbücher
b) Annalen und Geschichtsschreibung
c) Rechtsbücher
d) Kultlyrik
e) Priesterlehre und Prophetensprüche
5. Die großen Redaktionen des 6. Jahrhunderts v. Chr.
a) Das Jahwistische Erzählungswerk
b) Das Deuteronomistische Geschichtswerk
6. Die Anfänge der alttestamentlichen Theologie: Das Buch Jeremia
7. Die religiöse Bedeutung des Gesetzes
a) Der Dekalog
b) Das Deuteronomium
8. Der Rangstreit zwischen den Theologen aus Babylon und der Jerusalemer Tempelschule: Das Buch Ezechiel
9. Der Tempel als Mittelpunkt der Diaspora: Die Priesterschrift
10. Die Grundform der Tora: Die Redaktion des Pentateuchs
11. Die Neuausrichtung der höfischen Religion: Deuterojesaja
12. Die prophetische Eschatologie: Das Buch Jesaja
13. Der Konflikt mit dem Heiligtum auf dem Garizim: Das Buch Hosea
14. Das Judentum an der Schwelle zum hellenistischen Zeitalter: Das chronistische Geschichtswerk
15. Sekten und Gruppen innerhalb des hellenistischen Judentums
a) Der Psalter
b) Das Buch der Sprüche
16. Lehr-Erzählungen
a) Jona
b) Hiob
c) Rut
17. Am Rande des Kanons
a) Das Hohelied
b) Kohelet
c) Ester
18. Die Makkabäerzeit und die Entstehung der Apokalyptik: Das Buch Daniel
19. Der Abschluss des Kanons
a) Das Ende des Textwachstums
b) Der Umfang der Sammlung
c) Kriterien äußerer Kanonizität
d) Die endgültige Festlegung
20. Die Unabgeschlossenheit des Alten Testaments
Weiterführende Literatur
Literaturgeschichte
Textgeschichte
Exegese
Weisheit, Prophetie, Recht
Psalmen
Geschichte Israels
Archäologie und Historische Atlanten
Religionsgeschichte
Theologie des Alten Testaments
Altorientalische Texte zum Alten Testament
Zwischentestamentliche Literatur
Bibel-Lexika
Zeittafel
Zum Buch
Vita
Impressum
Übersicht: Die Bücher des Alten Testaments/Abkürzungen
Übersicht: Die hebräische Bibel/Die Septuaginta
Einladung zur Lektüre
Wie alles Große, das die Menschheit in ihrer Geschichte geschaffen hat, ist auch das Alte Testament von einer Eindrücklichkeit, die sich jedem, der ihm wachen Sinnes begegnet, ohne Weiteres mitteilt. Es gibt sich mit großer Kraft selbst zu verstehen und bleibt jedem Deutungsversuch uneinholbar voraus. Gerade das aber weckt Neugier. Wie mag ein solches Werk zustande gekommen sein? Die Frage gewinnt ihren Nachdruck, weil dieses Buch, aus dem Alten Orient hervorgegangen, Religion und Kultur der westlichen Welt geprägt hat wie kein zweites.
Die alttestamentliche Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten eine Neuausrichtung erlebt, die sie wieder einmal zu einer besonders spannenden Disziplin unter den historischen Geisteswissenschaften hat werden lassen. Mit zunehmender Deutlichkeit hat sich erwiesen, dass die althebräische Literatur als Teil der altorientalischen Kultur- und Religionsgeschichte gelesen werden will. Die Vergleichstexte aus dem Alten Mesopotamien und aus Ägypten, aus dem Hetiterreich und aus Ugarit, viele von ihnen seit langem bekannt, wurden und werden immer besser erschlossen und erscheinen in neuem Licht. Literarische Gattungen und Motive des Alten Testaments, gesellschaftliche Voraussetzungen, ja sogar die Gottesanschauung Alt-Israels sind nicht mehr analogielos. Aufsehenerregende Inschriftenfunde werfen ein Licht auf die «subliterarische» Volksreligion Israels und Judas. Auch die Erforschung der altorientalischen Bilderwelt hat zu einer neuen Sicht beigetragen. Sie lässt alttestamentliche Texte überraschend beredt werden. Die Archäologie Palästinas, voran die Siedlungsforschung, lässt das soziale Umfeld besser verstehen.
Auf der anderen Seite hat die immer tiefer in den alttestamentlichen Text eindringende analytische Exegese gezeigt, dass sich die Entstehung des Alten Testaments zum überwiegenden Teil einem langandauernden Prozess der literarischen Selbst-Auslegung verdankt, dessen Voraussetzungen nicht mehr in der Zeit der Königstümer Israel und Juda zu suchen sind, sondern die in das Judentum der persischen und hellenistischen Zeit gehören. In weit größerem Maße, als man bisher wahrgenommen hat, ist das Alte Testament nicht mehr die Literatur des Alten Israel, sondern von der Wurzel her die Heilige Schrift des Judentums.
Mit dem Alten Testament beginnt die traditionelle Religion am Beispiel eines die natürlichen und politischen Gegebenheiten spiegelnden Hofkults aus der Eisenzeit Palästinas, nach ihrer allgemeingültigen Wahrheit zu fragen, und gelangt schließlich zu einer radikal transzendenten Gottesauffassung, in der sich die Religion mit der Ethik, die Gottesliebe (Dtn 6,4) mit der Nächstenliebe (Lev 19,18) unauflöslich verbinden. «Der jüdische Monotheismus ist der Glaube an die Allmacht des Guten» (Julius Wellhausen). Die Aporien, in die dieser Glaube angesichts der tatsächlichen Welterfahrung führt, sind es, auf die die jüdische und die christliche Theologie seither ihre Antworten suchen.
Diese Einführung bietet nur einen möglichen Entwurf der Literatur- und Religionsgeschichte unter vielen anderen. Der Autor hofft, dass der Leser sich zu eigenem Urteil herausgefordert findet, zumal die Kürze der Darstellung mit sich bringt, dass die unerlässliche Debatte unterbleibt. Wenn gegenüber einer Heiligen Schrift der «Wahlspruch der Aufklärung» anzuwenden ist: «Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!» (Immanuel Kant), gilt das für die Sekundärliteratur umso mehr. Diese Einführung hat nur darin ihr Recht, dass sie auf das Alte Testament selbst verweisen und zu seiner Lektüre ermuntern will. «Tolle lege» – «Nimm und lies!» Das ist auch darum geboten, weil noch die beste Erläuterung vergebens ist, wenn der Gegenstand, auf den sie sich bezieht, nicht bekannt ist.
Freilich kann man das Alte Testament nicht lesen, wie man einen Roman liest. Besser ist es, zunächst hier und da aufzuschlagen und dabei seinen Vorlieben zu folgen. Nur weniges sei vorab erwähnt: das «schöne Gespräch» (Thomas Mann) der Vätergeschichten; die programmatische Sozialethik des Deuteronomiums; das «lieblichste kleine Ganze» (Goethe) des Buches Rut; die spannenden und zugleich erschütternden Erzählungen vom Hofe Davids; die abgründige seelische Not des Hiob; der Schrei aus der Tiefe, aber auch das strahlende Gotteslob und die Schöpfungsfreude der Psalmen; die Lebensregeln des Sprüchebuchs; die skeptische Weltbetrachtung des Kohelet; die Erotik des Hohen Liedes; die Sprachgewalt und visionäre Kraft der Propheten.
Bei all dem kann sich unversehens die Erfahrung einstellen, dass dieser Text über die Kluft der Jahrtausende hin mich ganz unmittelbar ansprechen kann. Er kann mir den Spiegel vorhalten; meinen Zweifeln, meiner Trauer, meiner Freude Worte geben; mich mahnen und trösten; mir sagen, zu welchem Ende und mit welcher Hoffnung ich leben kann, «was die Welt im Innersten zusammenhält», oder was im Allgemeinen oder in einer bestimmten Lage zu tun ist.
Welche Übersetzung soll man wählen? Die Verdeutschung der jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig kommt dem Duktus des Hebräischen besonders nahe, freilich um den Preis einer bisweilen schwer zugänglichen Sprache. Sonst stehen vor allem drei kirchenamtliche Bibeln zur Auswahl, die einander in der Genauigkeit gegenüber dem hebräischen Text und in der Qualität ihrer Sprache ebenbürtig sind: die Zürcher Bibel von 2007, die revidierte katholische Einheitsübersetzung von 2016 und die revidierte Lutherbibel von 2017. Unter diesen bevorzugt der Autor die Lutherbibel, an deren jüngster Durchsicht er mitgewirkt hat. Als der Grundtext der neuhochdeutschen Schriftsprache hat die Übersetzung Luthers und seiner Wittenberger Kollegen durch ein halbes Jahrtausend hin eine unvergleichliche Wirkung gehabt, die nicht nur die Religion, sondern auch die Kulturgeschichte betraf. Auch in ihrer modernen Form, die den seitherigen Sprachwandel sowie den Fortschritt der Exegese berücksichtigt, ist sie nicht einfach nur eine Übersetzung, sondern ein literarisches Werk von hohem Eigenwert. «Die Bibel war bisher das beste deutsche Buch. Gegen Luthers Bibel gehalten ist fast alles übrige nur ‹Literatur›» (Friedrich Nietzsche).
1. «Kein Jota oder Strichlein soll dahinfallen»: Der Text des Alten Testaments
Ein Buch, das auf die Zeit vor der Erfindung der Druckkunst zurückgeht, weckt die Frage nach der Geschichte seiner schriftlichen Überlieferung. Wie tragfähig ist die Fassung, die auf uns gekommen ist? Welche Vorlagen gingen ihr voraus? Wie weit zurück reichen die Zeugnisse, die wir «schwarz auf weiß» besitzen? Nur wenn sicher ist, dass uns ein authentischer Text vorliegt, gibt es eine Grundlage für Schlussfolgerungen zur Herkunft des Inhalts.
a) Der hebräische Text. Die älteste vollständig erhaltene hebräische Bibelhandschrift ist der Codex Petropolitanus B19A der öffentlichen Bibliothek in Sankt Petersburg, früher Codex Leningradensis genannt. Nach der Beischrift wurde er im Jahre 1008 n. Chr. in Kairo geschrieben. Er ist zugleich die beste erhaltene Handschrift und liegt den meisten wissenschaftlichen Textausgaben zugrunde. Nur der einige Jahrzehnte ältere Kodex von Aleppo übertrifft ihn, der aber, seit er 1948 zeitweilig verschollen war, ein Viertel seines Umfangs eingebüßt hat.
Geschrieben wurden diese Handschriften von den sogenannten Masoreten, die vom 8. bis 10. Jh. n. Chr. in Tiberias am See Gennesaret gewirkt haben. «Masora» heißt hebräisch «Überlieferung». Es gab zwei maßgebende Gelehrtenfamilien, die Ben Ascher und die Ben Naftali. Der Kodex von Aleppo, der als Musterkodex für die Anfertigung weiterer Handschriften gedient hat, ist von Aaron ben Ascher vokalisiert worden, der Codex Petropolitanus von Samuel ben Jakob nach Aaron ben Ascher.
Der Anstoß zu dieser Arbeit ging aus von der Sekte der Karäer («Anhänger der Schrift»), die sich seit dem 8. Jh. von Babylonien aus verbreitete. Die Karäer lehnten die rabbinische Auslegung, wie sie der Talmud überliefert, ab und bezogen sich nur noch allein auf die Heilige Schrift selbst. Wenn die Tradition als Lesehilfe entfiel, durften auch kleinste Einzelheiten nicht mehr im Ungefähren bleiben. Diese Haltung wirkte auf das rabbinische Judentum zurück. Die Masoreten waren Rabbanim.
Wichtigste Leistung der Masoreten ist die genaue Aufzeichnung der Aussprache gewesen. Die hebräisch-aramäische Schrift ist wie alle semitischen Alphabetschriften eine Konsonantenschrift. Das bringt zahlreiche Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten mit sich. Zwar hat der Text nie ohne Aussprachetradition bestanden – man wusste, wie man zu lesen hatte –, doch nunmehr wurde die genaue Lesung durch ein System von Vokalzeichen und Akzenten, die «Punktation», festgehalten.
Die Vokalisation unterwarf die im Laufe von Jahrhunderten gewachsene Sprache einem einheitlichen grammatischen System. Das konnte zu Spannungen von überliefertem Text (Ketîb) und masoretischer Lesung (Qerê) führen. Die Masoreten halfen sich, indem sie ihre Auffassung des Konsonantentexts am Kolumnenrand notierten. Dieser Randapparat, die kleine Masora oder Masora parva, bot auch Raum, altüberlieferte Lesarten weiterzugeben sowie statistische und grammatische Hinweise anzubringen. Deren Hauptzweck war der Schutz des Textes vor Veränderung. «Māsoræt ist ein Zaun für die Tora» (Rabbi Aqiba, gest. 135 n. Chr.). Neben der Masora parva gab es am Kopf und Fuß der Kolumne die Masora magna, einen im Laufe langer Auslegungstradition gewachsenen Parallelstellenapparat.
Der so entstandene Text hat innerhalb des rabbinischen Judentums alle anderen Fassungen verdrängt. Da unbrauchbar gewordene Handschriften nicht aufbewahrt oder gar wiederverwendet wurden, sondern es Sitte war, sie feierlich zu begraben, gingen die älteren Textformen verloren. Rückfragen nach der vormasoretischen Textgeschichte liefen lange Zeit ins Leere. Man wusste allerdings aus den Bibelzitaten in der rabbinischen Überlieferung, dass der Konsonantenbestand bis auf Kleinigkeiten mit jener Textform übereinstimmt, die das Judentum seit dem Ende des 1. Jh.s n. Chr. allein noch überliefert hat. Erst ein sensationeller Fund in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s führte für die Textwissenschaft eine neue Situation herauf: In der Geniza (hebr. «Aufbewahrungsort») der Synagoge von Alt-Kairo, einer versteckten Ablagekammer, fanden sich eine große Zahl von Handschriften – man schätzt 200.000 Fragmente –, die der Vernichtung entgangen waren. Sie befinden sich heute in der Universitätsbibliothek von Cambridge und weiteren europäischen und nordamerikanischen Bibliotheken. Die ältesten reichen bis ins 6. Jh. n. Chr. zurück. Dieser Fund brachte unter anderem ans Licht, dass es Vorstufen zu dem masoretischen Vokalisationssystem gegeben hat.
Neben dem rabbinischen Judentum haben auch die Samaritaner eine Form des hebräischen Textes überliefert. Allerdings galt ihnen nur die Tora als Heilige Schrift. Die ältesten erhaltenen Handschriften des samaritanischen Pentateuchs stammen aus dem 12. Jh. n. Chr. Sie bewahren eine Textform, die in hellenistische Zeit zurückreicht.