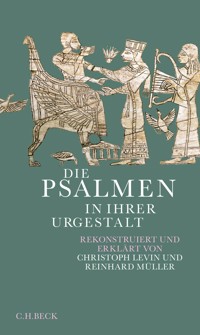
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Psalmen sind ein Wunder. Seit über zweitausend Jahren werden sie gebetet und gesungen. Durch unzählige Nachdichtungen und Vertonungen haben sie weit über die Religionen hinaus die Kultur geprägt. Woher kommen die alten Lieder? In diesem Buch werden die Psalmen erstmals in ihrer faszinierend fremdartigen Urgestalt präsentiert. Die Autoren erläutern ihre ursprüngliche politische und kultische Funktion, vergleichen sie mit anderen altorientalischen Dichtungen und erklären, wie aus den Urfassungen die biblischen Psalmen wurden, deren Verse bis heute zutiefst berühren. Das Buch der Psalmen ist für Juden und Christen das Gebetbuch schlechthin. In ihrer heutigen Form sind diese Gebete Zeugnisse des Judentums der hellenistischen Epoche. Traditionell aber sah man König David als ihren Verfasser. Christoph Levin und Reinhard Müller zeigen auf der Grundlage jahrelanger Forschung, dass sich in den überlieferten Psalmen Urfassungen verbergen, die aus der Zeit der Könige Israels und Judas stammen. Sie erklären deren ursprüngliche Funktion in Königspalast und Tempel, präsentieren erstaunlich ähnliche Lieder aus Ugarit, Babylon oder Ägypten und zeigen, wie nach dem Untergang der Königreiche das entstehende Judentum die alten Gebete ergänzt hat. Ihr Buch ist eine Einladung, die Psalmen ganz neu zu entdecken: als Boten einer längst versunkenen Kultur, die in neuem Gewand die Zeiten überdauert haben und unmittelbar zu uns sprechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die
PSALMEN
in ihrer Urgestalt
Rekonstruiert und erklärt von Christoph Levin und Reinhard Müller
C.H.BECK
ZUM BUCH
Das Buch der Psalmen ist für Juden und Christen das Gebetbuch schlechthin. In ihrer heutigen Form sind diese Gebete Zeugnisse des Judentums der hellenistischen Epoche. Traditionell aber sah man König David als ihren Verfasser. Christoph Levin und Reinhard Müller zeigen auf der Grundlage jahrelanger Forschung, dass sich in den überlieferten Psalmen Urfassungen verbergen, die aus der Zeit der Könige Israels und Judas stammen. Sie erklären deren ursprüngliche Funktion in Königspalast und Tempel, präsentieren erstaunlich ähnliche Lieder aus Ugarit, Babylon oder Ägypten und zeigen, wie nach dem Untergang der Königreiche das entstehende Judentum die alten Gebete ergänzt hat. Ihr Buch ist eine Einladung, die Psalmen ganz neu zu entdecken: als Boten einer längst versunkenen Kultur, die in neuem Gewand die Zeiten überdauert haben und unmittelbar zu uns sprechen.
ÜBER DIE AUTOREN
Christoph Levin ist Professor em. für Altes Testament an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Mitglied der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Finnischen Akademie. Bei C.H.Beck erschien von ihm «Das Alte Testament» (5., überarbeitete Auflage 2018).
Reinhard Müller ist Professor für Altes Testament an der Georg-August-Universität Göttingen. Er schreibt u.a. einen Kommentar zu den Psalmen im «Handbuch zum Alten Testament».
INHALT
EINFÜHRUNG
Auf der Suche nach der Religion des Alten Israel und Juda
Das Königtum als Träger der Überlieferung
Die Religion als Spiegel von Natur und Politik
Die Thronbesteigung des Königs
Besonderheiten
Das Ende des Königtums
Die Transformation
Die Psalmen als Dokumente der Religionsgeschichte
Die Voraussetzungen der literaturgeschichtlichen Analyse
Hinweise zur Lektüre
EIN GEBET UM BEISTAND IM KRIEG – Psalm 3
Der spätere Psalm
ANRUFUNG DES KULTISCHEN GERICHTS – Psalm 5
Der spätere Psalm
EIN GEBET IN SCHWERER KRANKHEIT – Psalm 6
Der spätere Psalm
EIN HILFERUF UND EIN REINIGUNGSEID – Psalm 7
Der spätere Psalm
BITTE UM HILFE GEGEN EINEN FEIND – Psalm 13
DER KAMPF DES WETTERGOTTES GEGEN DAS MEER – Psalm 18,5–20
DANKGEBET NACH DEM SIEG – Psalm 18,30–43
Der spätere Psalm 18
WÜNSCHE BEI DER THRONBESTEIGUNG – Psalm 20
Der spätere Psalm
DIE FREUDE DES KÖNIGS – Psalm 21
Der spätere Psalm
JAHWE, MEIN HIRTE – Psalm 23
Der spätere Psalm
ZWEI LIEDER ZUM NEUJAHRSFEST – Psalm 24
Der spätere Psalm
IN DER ERWARTUNG EINES GOTTESURTEILS – Psalm 26
Der spätere Psalm
DES SIEGES GEWISS – Psalm 27A
Der spätere Psalm
HILFERUF UND ORAKEL – Psalm 27B
Der spätere Psalm
BITTEN IN DER NOT UND IHRE ERHÖRUNG – Psalm 28
Der spätere Psalm
DIE STIMME JAHWES – Psalm 29
Der spätere Psalm
DANKGEBET – Psalm 30
Der spätere Psalm
DRINGENDE BITTE UM HILFE – Psalm 31,1–9
Der spätere Psalmteil 31,1–9
BITTE UM BEISTAND IM KAMPF – Psalm 35,1–10
Der spätere Psalmteil 35,1–10
«IM SCHATTEN DEINER FLÜGEL» – Psalm 36
Der spätere Psalm
BITTE UM HEILUNG ANGESICHTS DER GEGNER – Psalm 41
Der spätere Psalm
DIE SCHÖNHEIT DES KÖNIGS – Psalm 45,2–10.17
ZUR VERMÄHLUNG MIT DER KÖNIGSGEMAHLIN – Psalm 45,11–16
Der spätere Psalm 45
DER MYTHOS VOM WELTENBERG – Psalm 48
Der spätere Psalm
HILFERUF GEGEN WIDERSACHER – Psalm 54
Der spätere Psalm
NÄCHTLICHE KLAGE UND MORGENDLICHER LOBGESANG – Psalm 57
Der spätere Psalm
GEBET IN SCHWERER MILITÄRISCHER BEDRÄNGNIS – Psalm 59
Der spätere Psalm
IM VERTRAUEN AUF JAHWES HILFE – Psalm 63
Der spätere Psalm
EIN HYMNENFRAGMENT UND EIN ERNTELIED – Psalm 65
Der spätere Psalm
GEBET BEI DER ERFÜLLUNG DES DANKGELÜBDES – Psalm 66,13–20
Der spätere Psalmteil 66,13–20
EIN HILFERUF IN GROSSER NOT – Psalm 70
Der spätere Psalm
WÜNSCHE BEI DER THRONBESTEIGUNG – Psalm 72
Der spätere Psalm
EIN LIED ZUM NEUJAHRSFEST – Psalm 77,14–21
Der spätere Psalmteil 77,14–21
PROKLAMATION DER THRONBESTEIGUNG JAHWES – Psalm 93
Der spätere Psalm
AKKLAMATION ZUR THRONBESTEIGUNG JAHWES – Psalm 97
Der spätere Psalm
FREUDE ÜBER DIE THRONBESTEIGUNG JAHWES – Psalm 98
Der spätere Psalm
REGENTENSPIEGEL – Psalm 101
Der spätere Psalm
JAHWE ERNEUERT UND VERSORGT DIE WELT – Psalm 104
Der spätere Psalm
DANK FÜR DIE RETTUNG VOR DEM TOD – Psalm 118,5.14–28
DER KÖNIG BEKENNT SEIN GOTTVERTRAUEN – Psalm 118,6–13
Der spätere Psalm 118
ANHANG
WEITERFÜHRENDE LITERATUR UND NACHWEISE
Zitierte Quellensammlungen
Einführungen in die Psalmen
Psalm 3
Psalm 5
Psalm 6
Psalm 7
Psalm 13
Psalm 18
Psalm 20
Psalm 21
Psalm 23
Psalm 24
Psalm 26
Psalm 27A
Psalm 27B
Psalm 28
Psalm 29
Psalm 30
Psalm 31
Psalm 35
Psalm 36
Psalm 41
Psalm 45
Psalm 48
Psalm 54
Psalm 57
Psalm 59
Psalm 63
Psalm 65
Psalm 66
Psalm 70
Psalm 72
Psalm 77
Psalm 93
Psalm 97
Psalm 98
Psalm 101
Psalm 104
Psalm 118
EINFÜHRUNG
Auf der Suche nach der Religion des Alten Israel und Juda
Die Entstehung des Judentums im Rahmen und auf der Grundlage des alten Vorderen Orients hat die Kulturgeschichte des Westens so stark bestimmt wie weniges andere. Ohne diese Transformation einer altorientalischen Religion wäre die heutige Welt nicht, was sie ist. Der Wandel lässt sich an vielen Zeugnissen ablesen, aber besonders gut an den biblischen Psalmen, die aus Liedern und Gebeten entstanden sind, wie es sie auch im übrigen Alten Orient gab. In diesem Buch rekonstruieren wir die Urgestalt von etwa vierzig Psalmen und zeichnen nach, wie sich auf dieser Grundlage die heutige Gestalt dieser Gebete entwickelt hat.
Das Judentum und in seiner Folge das Christentum sind, religionsgeschichtlich betrachtet, «moderne» Religionen, die sich von ihrem altorientalischen und später hellenistischen Umfeld unterscheiden. Die Religion einschließlich des religiös begründeten Rechts ist nicht mehr ohne weiteres das Mittel und der Ausdruck politischer Herrschaft. Sie tritt der staatlichen Macht als Maßstab und Korrektiv gegenüber, behält aber den Anspruch bei, die gesellschaftliche Ordnung mitzugestalten. Dadurch entsteht im Ansatz so etwas wie Gewaltenteilung. Die Verehrung konzentriert sich auf einen einzigen Gott, der alle weiteren Formen der Religiosität absorbiert. Das lässt die Religion universal und mehr als je zuvor zur Sache persönlicher Entscheidung werden. In der Konsequenz löst sie sich aus der Bindung an bestimmte Ethnien und Gesellschaftsformen. So konnten Judentum und Christentum anders als die übrigen Religionen der Antike durch die Jahrtausende ihre prägende Kraft bewahren.
Judentum und Christentum verstehen sich als Offenbarungsreligionen. Sie behaupten, dass seit Abrahams Zeiten, spätestens aber seit Mose und dann wieder seit Jesus von Nazareth etwas ins Diesseits eingetreten sei, das voraussetzungslos ist. Mit Beginn der Neuzeit, zumal mit der europäischen Aufklärung, wuchsen die Zweifel an diesem traditionellen Bild. Die historische Bibelwissenschaft, die daraus hervorging, konnte an vielen Beispielen zeigen, dass die Literaturgeschichte anders verlaufen ist als die Darstellung, die die Bibel von ihrer Entstehung gibt oder zu geben scheint. Dies bestätigte sich vollends, als im Verlauf des neunzehnten und in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts die Zeugnisse der Nachbarkulturen in Ägypten, Syrien, Mesopotamien und Kleinasien nach und nach ans Licht kamen. Die zahlreichen Inschriften und bildlichen Darstellungen, die in den letzten Jahrzehnten auf dem Boden des Heiligen Landes gefunden oder neu gedeutet wurden, zeigen unabweisbar, dass die Religion, die in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. in den Königtümern Israel und Juda praktiziert wurde, sich deutlich von dem Bild unterschied, das die Bibel von dieser Zeit vermittelt.
Das Königtum als Träger der Überlieferung
Dass sich die religionsgeschichtlichen Verläufe nachvollziehen lassen, verdanken wir vor allem den erhaltenen Texten. Damit geht eine wesentliche Einschränkung einher. In der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. gab es Schreiber in der südlichen Levante fast ausschließlich an den Höfen der Könige. Sie erhielten vom König ihren Unterhalt. Sie teilten die Weltsicht des Hofes. Die von ihnen niedergeschriebenen Texte blieben auf bestimmte Anlässe beschränkt. Die Texte dienten dem Handel, der königlichen Verwaltung und der Diplomatie, vor allem aber der Stabilisierung der königlichen Macht. Sie bestanden aus Inschriften und Berichten über die Taten der Könige, aus Annalen, Helden-Erzählungen, Sammlungen von Rechtssprüchen und Weisheitslehren, aus der Dokumentation von Prophetensprüchen sowie aus Mythen, Hymnen und Gebeten für die rituellen Vollzüge im Kult. Man kann von diesen Quellen kein vollständiges Bild von der damaligen religiösen Lage erwarten.
Das eisenzeitliche Königtum der Levante wurde von einer Ritterschaft getragen, ähnlich wie man sie von Ostasien bis ins europäische Mittelalter in vielen Teilen der Alten Welt als frühe Form staatlicher Macht antreffen kann. Seit der späten Bronzezeit gibt es Nachrichten über Freischärler, die den Stadtkönigen ihre Macht streitig machten und sich das Land Schritt für Schritt unterwarfen. Die Anführer dieser Banden übernahmen befestigte Städte wie Sichem auf dem israelitischen und Jerusalem auf dem judäischen Bergland als ihre Residenzen. Sie erbauten auch neue Burgen wie Samaria und Jesreel, von denen aus sie das Land kontrollierten. Es entstand ein höfisches Leben mit militärischem Apparat und königlichem Kult samt den zugehörigen Mythen. Die Bautätigkeit war zu bestimmten Zeiten bemerkenswert. Eine Verwaltung trieb von der Landbevölkerung die Abgaben ein, die für all das gebraucht wurden.
Die Anführer waren bestrebt, ihrer Herrschaft Dauer zu verschaffen, indem sie sie an den Sohn weitergaben. Dynastien entstanden, deren Kontinuität als Voraussetzung legitimer Herrschaft galt. Besonders ausgeprägt war das in Juda, dessen Königtum sich in vorgeblich ununterbrochener Generationenfolge auf König David im zehnten Jahrhundert zurückführte. Doch bestand immer die Gefahr, dass Rivalen auftraten und rebellierten. Die Bibel berichtet sowohl für Israel als auch für Juda über eine Vielzahl von Umstürzen und Umsturzversuchen.
Die religiösen Vorstellungen, in denen die Könige von Israel und Juda ihr Selbstverständnis zum Ausdruck brachten, gleichen phönizischen Mustern und finden sich ähnlich in den mythologischen Texten aus Ugarit, einer Hafenstadt an der syrischen Küste des Mittelmeers, die im vierzehnten und dreizehnten Jahrhundert v. Chr. geblüht hat. Auf dem Weg über Phönizien gab es auch einen gewissen Einfluss der ägyptischen Kultur. Seit dem neunten Jahrhundert trat der Gott Jahwe in Israel und wenig später auch in Juda, das zu dieser Zeit Vasall der Könige von Israel war, in den Mittelpunkt des königlichen Kults und schob die übrigen Götter in den Hintergrund. Er ist die israelitische Ausprägung des nordwestsemitischen Wettergottes, der in der Regenfeldkultur der Levante seit alters für die Lebensverhältnisse entscheidend war.
Die Religion als Spiegel von Natur und Politik
Für die Stabilisierung der Macht kam dem Kult große Bedeutung zu. Das galt umso mehr, als man auch die natürliche Welt wie die politische als gefährdet erlebte. Das Klima ist bestimmt von dem harten Wechsel zwischen der Regenzeit im Winter und der Trockenheit während des Sommers. Man deutete die Naturvorgänge, von denen das Leben abhing, am Beispiel der politischen Erfahrungen als Kampf der Götter um die Macht über die Lebenswelt. Der Wechsel der Jahreszeiten galt als Herrschaftswechsel unter den Göttern. Der regenbringende Wettergott verkörperte das lebenserhaltende Prinzip, war aber nur periodisch an der Macht. Im Sommer, wenn das Land über Monate trockenfällt, war er abwesend. Mit dem Beginn der Regenzeit im Herbst, der als Jahresbeginn begangen wurde, kehrte er zurück und errang seine Herrschaft im Kampf gegen den Meeresgott Jammu, das personifizierte Chaos.
In den schweren Gewitterstürmen, die über dem Mittelmeer heraufziehen, sah man den Wettergott erscheinen (Psalm 18,5–20, Seite 44). Der Himmel wird schwarz. In den Wolken schwebt der Gott wie ein Falke im Sturm. Das Geschehen wurde als kultisches Drama erlebt. Psalm 97 schildert, wie der Gott seine Blitzpfeile aus den Wolken hervorschießen lässt (Seite 174). Psalm 29 lässt den Donner des über dem Meer tobenden Gewitters ertönen und das siebenfache Echo, das er an den Bergen der Küste hervorruft (Seite 95). Mit der Zerstörungsmacht, die die Zedern des Libanon durch die Luft wirbelt, naht die Segensmacht, die die Erde befruchtet. Im Regen ergießt der Gott seine Lebenskraft in den Boden. Die Steppe beginnt zu kreißen, sie ergrünt.
Das Naturphänomen wurde als politisches und militärisches Ereignis wahrgenommen. Psalm 93 schildert den Kampf (Seite 170). Das Grollen des Donners erweist sich als mächtiger als das Kampfgebrüll der Brandung. Der Wettergott besiegt das Meer «für alle Zeit». Die Periodik der Jahreszeiten soll zur dauerhaften, machtgestützten Sicherung des Daseins führen. Dieser endgültige Sieg aber wurde nur beschworen. Er musste immer wieder neu errungen werden.
Der Sieg ist gleichbedeutend mit der Festigung und Bewahrung der Welt. Denn nicht nur an den Küsten rennt das wütende Chaos gegen die Lebenswelt an. Es lebt auch in den unergründlichen Tiefen, über denen die Erde zwischen den Horizontbergen ausgespannt ist wie eine schwankende Zelthaut. Wenn die Erde bebte, was in Palästina häufig geschah, brandeten die Wogen des Urmeers gegen die Berge, die als die tragenden Säulen der Welt in die Tiefe ragten, und ließen die Erde erzittern. Demgegenüber begründet die ordnende Herrschaft des Gottes Jahwe die bewohnbare Welt und gibt ihr das Fundament, sodass sie nicht im Chaos versinkt (Psalm 24,1–2, Seite 73).
Auf den Machtkampf folgte die Thronbesteigung, wenn der Gott als Sieger in seine angestammte Herrschaft zurückkehrte (Psalm 24,7–10, Seite 74). Sie wurde alljährlich im Kult begangen. Der Gott wurde erneut als König proklamiert: «Jahwe ist König geworden!» (Psalm 93 und 97, Seiten 170, 174) Die Götter müssen sich ihm unterwerfen (Psalm 29, Seite 95). Im Kult wurde das Zeremoniell unter den Göttern nachempfunden. Die Huldigung durch die Kultteilnehmer vereinigte sich mit der Huldigung durch die Götter und Ahnen. Dabei stand der irdische Tempel für den im Himmel gebauten Palast des Gottes.
Der Proklamation antworteten die Kultteilnehmer mit einer zeremoniellen Freudenäußerung, die durch das Blasen des Widderhorns (šôfār) oder durch Händeklatschen bekundet wurde. Die Freude erfasst die ganze bewohnbare Welt bis an ihre Ränder (Psalm 98, Seite 178). Der Kosmos zwischen Himmel und Erde hallt wider von der Anerkennung der Macht des Gottes. Auch die besiegten Rivalen stimmen mit ein: das Meer und die Ströme. Sie unterwerfen sich und sind künftig dem Wettergott dienstbar, der mit ihnen die Erde bewässert.
Die Thronbesteigung des Königs
Die Akklamation des himmlischen Königs diente dem irdischen König dazu, seine eigene Macht zu festigen. Als Vasall des Gottes begann oder erneuerte auch er am Neujahrsfest seine Herrschaft. Er beanspruchte, nicht in eigener Machtvollkommenheit zu handeln. Von seinem Gott beauftragt, wahrte er die Ordnung des Landes. Bei der Thronbesteigung wurde die Beauftragung zelebriert: Im Ritual legte Jahwe die göttliche Gerechtigkeit in die Hände des Königs (Psalm 72, Seite 160). Ebenso wie die Abfolge der Jahreszeiten nach dem Beispiel politischer Machtverhältnisse gedacht wurde, erwartete man von der politischen Stabilität auch das Gedeihen der natürlichen Lebensbedingungen.
Zum Ritual gehörte die Übergabe der Insignien. Der König erhielt seine Waffen und mit ihnen den Auftrag, die Feinde zu besiegen (Psalm 45, siehe Seite 123). Er verpflichtete sich auf seine Aufgabe und legte das Gelübde ab, die Weltordnung zu bewahren (Psalm 101, Seite 182). In Gebeten wurde die Gottheit beschworen, die Wünsche des Königs für ein gerechtes und dauerhaftes Regiment zu erfüllen (Psalm 20, Seite 56).
Zur Wahrung der Lebensordnung hatte der König sich seiner Gegner und Rivalen zu erwehren, die ihn vernichten und die gerechte Ordnung zerstören wollten. Wenn die Feinde sich zusammenrotten und ihn angreifen, sucht der König seinen Gott im Heiligtum auf und bittet um eine Audienz (Psalm 27B, Seite 87). Er klagt dem Gott seine gefährliche Lage (Psalm 59, Seite 141) und bittet um schnelle Hilfe und um Beistand im militärischen Kampf (Psalm 35, Seite 107). Im Ritual wird dem König der Beistand seines Gottes zugesprochen. So gestärkt, bekundet er seine Siegesgewissheit, um auch seiner Truppe Mut zu machen (Psalm 27A, Seite 83; Psalm 118,6–13, Seite 196). Nach dem Sieg bekennt er, dass Jahwe ihm geholfen hat (Psalm 18,30–43, Seite 47), und stattet der Gottheit seinen Dank ab (Psalm 66,13–20, Seite 154).
Da bei den kriegerischen Auseinandersetzungen die gerechte Weltordnung in Frage steht, lassen sich die zugehörenden Psalmen nicht immer von jenen Gebeten unterscheiden, mit denen die kultische Gerichtsbarkeit angerufen wurde. Wer sich beschuldigt sah, konnte im Tempel Asyl finden, bis seine Unschuld erwiesen war (Psalm 31, Seite 104). In Psalm 26 erkennt man Ansätze eines Rituals, mit dem der Beter seine Unschuld bekundete (Seite 78). Ein persönlicher Anlass, sich im Gebet an die Gottheit zu wenden, kann eine lebensgefährliche Erkrankung sein wie in Psalm 6 (Seite 31). Besonders bedrohlich ist, wenn der König als der Garant der Lebensordnung erkrankt, sodass seine Rivalen ihre Chance wittern und die Dynastiefolge in Gefahr gerät (Psalm 41, Seite 116). Umso größer ist der Dank, wenn die Heilung gelingt (Psalm 30, Seite 99; Psalm 118,5.14–28, Seite 193).
Besonderheiten
Im Vergleich zu anderen altorientalischen Kulturen weisen die erhaltenen Gebete aus Israel und Juda einige Besonderheiten auf. Sie sind erheblich kürzer als die oft ausufernd langen sumerischen und babylonischen Hymnen und Gebete. Manche sind in ihrer Urgestalt nicht viel mehr als ein kurzer Hilferuf, wie er sich in Psalm 70 erhalten hat (siehe Seite 157). In der Kürze mag sich das Vertrauen in die Kraft weniger, genau gesetzter Worte zeigen. Oder womöglich war die Schriftform, die sich in der Überlieferung erhalten hat, eher eine Gedächtnisstütze, die als Grundlage tatsächlich vorgetragener Gebete gedient hat, eine Form oder Matrix, nach der die aktuellen Gebete sich richten konnten. Nicht wenige Psalmen zeigen bereits in ihrer Urgestalt die Tendenz zur Erweiterung.
Ein großer inhaltlicher Unterschied besteht darin, dass die babylonischen Klagegebete ein differenziertes Sündenbewusstsein spiegeln können. In ihrer Not äußern die Beter eine Fülle von Selbstzweifeln und möglichen Selbstanklagen. Solche Züge sind in der Urgestalt der Psalmen kaum je zu finden. Ein Grund dafür mag gewesen sein, dass die meisten erhaltenen Gebete keine persönliche Notlage spiegeln, sondern dem offiziellen Kult entstammen. Sie sollen die Stellung des Königs bekräftigen, nicht aber allgemeine Lebenskrisen bewältigen helfen. Wenn es andere Formen schriftlich niedergelegter Gebete gegeben hat, was wahrscheinlich ist, sind sie nicht erhalten geblieben.
Die in den Psalmen greifbare Ausprägung der Jahwe-Religion ist nicht ohne weiteres repräsentativ für die religiöse Praxis der Bevölkerung. Das Bild, das die Psalmen in ihrer Urgestalt geben, darf man keineswegs für das Ganze nehmen. Welche Bedeutung für die Bevölkerung neben Jahwe, dem Gott der Könige von Israel und Juda, andere Götter und Göttinnen hatten, geht aus den Texten nicht hervor. Ebenfalls geben sie, wenn überhaupt, nur mit erheblicher Einschränkung wieder, wie es in den Familien, Orten und Landschaften zuging. Es gibt in den Psalmen kaum Spuren von Dämonenglauben. Auch der Ahnenkult fehlt, der für das dynastische Königtum von Bedeutung gewesen sein muss. Die nicht wenigen bildlichen Darstellungen, die man in den vergangenen Jahrzehnten gefunden hat, zeigen eine ganz andere religiöse Vielfalt. Weiteres lässt sich den Ortsnamen entnehmen sowie den Personennamen, die sich in den benachbarten Königtümern in derselben Form auf die dortigen Götter bezogen. Sie haben sich erst allmählich und nie vollständig auf den Gott Jahwe ausgerichtet.
Ein Teil dieser Vielfalt war in den Texten womöglich dennoch vorhanden und ist im Laufe der Weiterüberlieferung ausgefallen. Dafür muss man nicht einmal unterstellen, dass solche Züge bewusst getilgt worden sind. Die Schriftrollen mussten in regelmäßigen Abständen neu geschrieben werden, weil das Schreibmaterial nicht dauerhaft war. Kopiert wurde nur, was nach wie vor von Belang war. Das Übrige ging verloren.
Das Ende des Königtums
In der Mitte des neunten Jahrhunderts war das israelitische Königtum unter der Dynastie der Omriden eine Macht, die die Region dominierte. Doch schon in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts geriet es durch den Aufstieg der Könige von Aram-Damaskus an den Rand des Untergangs. Der nördliche Teil des Landes ging verloren. Im achten Jahrhundert konnte das Königtum von Israel sich erholen und den Norden zurückgewinnen. Es kam zu einer zweiten Blütezeit, die sich auch archäologisch belegen lässt. In der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts aber fiel es binnen weniger Jahrzehnte der Westexpansion der assyrischen Großkönige zum Opfer. Seit 722 war das Land eine assyrische Provinz.
Seither verlagerte sich der Schwerpunkt südwärts nach Juda. Im letzten Drittel des achten Jahrhunderts begann im Schatten des Neuassyrischen Reichs der Aufstieg Jerusalems, auch unter Mitwirkung der aus dem Königreich Israel geflohenen Aristokratie, die ihr Selbstverständnis und Teile des dortigen Königsarchivs mitbrachte. Die Stadt dehnte sich auf den Westhügel aus. Die Blütezeit wurde unterbrochen durch den Aufstand König Hiskias, in dessen Folge der assyrische Großkönig Sanherib im Jahre 701 Juda eroberte und unterwarf. Doch Sanherib beließ Hiskia als seinen Vasallen auf dem Thron und begnügte sich mit einem hohen Tribut. Unter der Pax Assyriaca stabilisierte sich das Land. Als das Neuassyrische Großreich im letzten Drittel des siebten Jahrhunderts unter dem Ansturm der Meder und der Neubabylonier zusammenbrach, traten die Könige von Juda das Erbe Israels an. Sie propagierten die politische und kultische Einheit beider Königreiche. Das hatte Folgen für das Selbstverständnis des späteren Judentums.
Am Ende des siebten Jahrhunderts geriet Juda zwischen die Fronten der unter Nebukadnezzar rasch expandierenden Neubabylonier, die von Norden her nach der Herrschaft über die levantinische Landbrücke griffen, und der Pharaonen der 26. Dynastie, die sich das Erbe Assyriens von Süden her sichern wollten. Die Könige von Juda wurden mal Vasallen der einen, mal der anderen Seite, konnten aber nicht so schnell die Fahne wechseln, wie die Kräfteverhältnisse hin und her wogten. Im Jahre 597 wurde König Jojachin Opfer einer ersten Strafexpedition. Nebukadnezzar deportierte ihn und seinen Hofstaat nach Babylon. Im Jahre 586 folgte die Deportation König Zedekias. Der von Nebukadnezzar eingesetzte Vasall Gedalja fiel bald darauf einem Mordanschlag zum Opfer. Damit fand auch die Geschichte der Könige von Juda ihr Ende.
Die Transformation
Nach dem Ende des Königtums übernahmen die Priesterschaft und die Repräsentanten der Bevölkerung die Rolle, die vormals der König innegehabt hatte. Die Kultgemeinde verstand sich nunmehr unmittelbar, ohne den königlichen Mittler, als Vasall des Gottes. Die Weltordnung, deren Wahrung, soweit sie in die Aufgabe der Menschen fiel, vordem dem König anvertraut war, lag nun in der Verantwortung von jedermann. «Recht und Gerechtigkeit» als Maßstab richtigen Regiments wurden allgemeine sittliche Norm und zugleich unmittelbarer Ausdruck religiösen Verhaltens. Hier liegen die Wurzeln der Gesetzesfrömmigkeit. Am wiederhergestellten Tempel wurde der Opferkult immer wichtiger.
«Israel» war jetzt nicht mehr das vom König beherrschte Gebiet samt seiner Bevölkerung. Anstelle des Königtums wurde die Religion zum Ausdruck der Identität. Der überlebende Hofstaat und die judäische Aristokratie hielten an der Verehrung des Gottes Jahwe fest. Neben dem Kult wurde im Laufe der Zeit das Brauchtum zum ethnisch-religiösen Erkennungszeichen: Sabbat und Beschneidung, Speisevorschriften und Reinheitsgebote. Der Festkalender schloss nicht nur Hochfeste und Wallfahrten ein, sondern auch Anlässe, die in der häuslichen Gemeinschaft begangen wurden. Besondere Bedeutung gewann das persönliche und das gemeinschaftliche Gebet.
Seit dem sechsten Jahrhundert lebten Judäer in zunehmender Zahl außerhalb ihres Stammlandes. Mesopotamien und Ägypten wurden bedeutende Zentren. In der hellenistischen Epoche nahm die Verbreitung weiter zu. Jerusalem aber wurde zu einer religiösen Metropole mit weltweiter Ausstrahlung und der Tempel zum Sehnsuchtsort. Als es im zweiten Jahrhundert v. Chr. dem hasmonäischen Königtum gelang, die Fremdherrschaft abzuschütteln, folgte eine Blütezeit, deren Spuren noch heute zu sehen sind. Damals wurde das Tempelplateau befestigt.
Die Psalmen als Dokumente der Religionsgeschichte
Besondere Bedeutung für die Identität des werdenden Judentums gewann die schriftliche Überlieferung. Die Reste des königlichen Archivs waren das Zeugnis einer Zeit, die man als normativ ansah und deren Wiederkehr man ersehnte. Sie wurden weiterüberliefert und boten fortan der religiösen Orientierung eine wesentliche Grundlage. In zunehmendem Maße bezog man sich auf die erhaltenen Zeugnisse der Prophetie und auf den in den Rechtssammlungen niedergelegten Willen Gottes. Die Gottesbeziehung speiste sich aus der Überlieferung, und wie man die Antworten auf die Fragen der eigenen Gegenwart den Texten entnahm, so trug man sie wiederum auch hinein. Die Texte wurden so wichtig, dass sich seither ein großer Teil der religiösen Praxis und vor allem des religiösen Denkens in ihnen niedergeschlagen hat.
Schon in dieser Zeit lässt sich beobachten, was Ismar Elbogen für die Entwicklung des jüdischen Gebets nach der Zerstörung des Zweiten Tempels beschrieben hat:
Die ältesten Gebete durften nicht lang, sie mußten ferner schlicht und einfach sein, Schwierigkeiten in der Sprache und im Aufbau waren völlig ausgeschlossen. Als diese Gebete eingebürgert waren, erfuhren sie, ohne daß es bemerkt wurde, stetig Erweiterungen; das Bedürfnis nach Erneuerung, veränderte Geschmacksrichtung, Einflüsse von außen, der Brauch einzelner Frommer waren dabei maßgebend. Die Erweiterungen bestanden in breiterer, wortreicherer Ausführung der vorhandenen Gedanken, in Einfügung von kleineren oder größeren Stücken der Heiligen Schrift, in poetischen Ausschmückungen des bestehenden Textes. (Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, Leipzig 1913, 2)
Wie die Psalmen das älteste religiöse Zeugnis sind, das sich im Alten Testament erhalten hat, so ist der Psalter daher zugleich die wichtigste Quelle für die Geschichte der Frömmigkeit in der hellenistischen Zeit, mit fließenden Übergängen zur deuterokanonischen Literatur des zweiten und ersten Jahrhunderts v. Chr. Die Psalmen enthalten auf diese Weise auch die jüngsten Textzeugnisse, die sich in der hebräischen Bibel finden. Die Wirkungsgeschichte bezeugt bis auf den heutigen Tag, wie aktuell die Psalmen sind. Sie sind es nicht nur wegen ihrer Zeitlosigkeit, sondern auch, weil die theologischen Folgen des Monotheismus im Psalter so deutlich werden wie kaum an anderer Stelle.
Die Voraussetzungen der literaturgeschichtlichen Analyse
Die wichtigsten Anhaltspunkte, die es möglich machen, die ursprüngliche Gestalt eines Psalms freizulegen, ergeben sich aus der sprachlichen Form. Dazu zählen der Zeilenfall, der Gedankenreim, auch Parallelismus membrorum genannt, der Rhythmus, die Rhapsodik und die Strophenbildung. Dass die Psalmen keine Texte aus einem Guss sind, wurde schon immer festgestellt. Die Brüche zeigen sich bereits an den Lesarten der antiken Übersetzungen, allen voran der griechischen Fassung (der sogenannten Septuaginta). Sie haben gelegentlich auch in der handschriftlichen Überlieferung des hebräischen Textes Spuren hinterlassen.





























