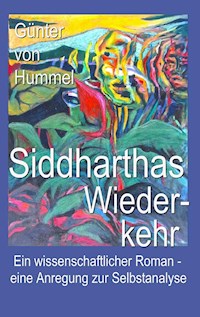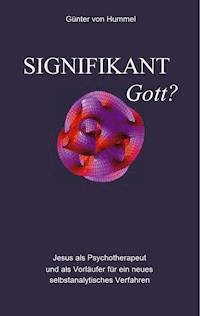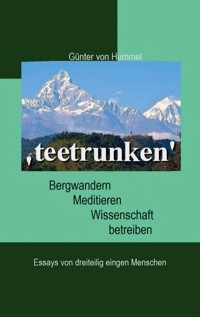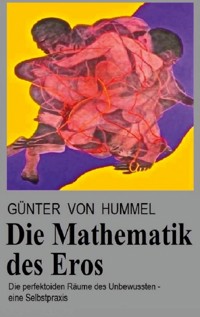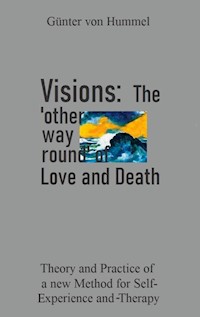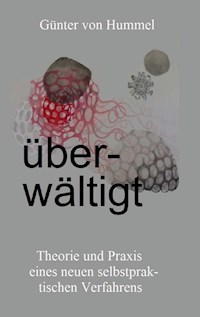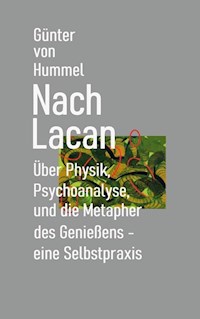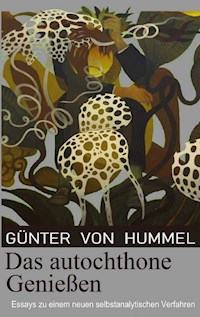
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Begründer der Psychoanalyse, S. Freud war von der Hypnose ausgegangen, und dabei konnten die Probanden den kathartischen Schwebezustand abhängig von der Therapeutenstimme genießen, aber sie wurden nicht richtig mündig und reif. Der Verlust der Katharsis konnte später in der klassischen Therapie nicht mehr wettgemacht werden. In der Psychoanalyse J. Lacans steht der Begriff der 'Jouissance', des reinen Genießens, im Vordergrund, aber auch er kann sie nicht in der Praxis realisieren. Stellt man aber sein sprachwissenschaftliches Konzept und einen meditativen Zugang in den Mittelpunkt, ist es möglich, die Autochthonie des Genießens zu erfahren. Der Autor nennt diese Methode, die einfach zu erlernen ist, Analytische Psychokatharsis, weil aufklärendes und kathartisches Erfahren gleichermaßen zum Zug kommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Umschlagsbild von T. Heydecker zeigt die in sich verwobenen elementaren Formen des Lebens, die – wie im Text erläutert wird – bereits bestimmte Arten des autochthonen Genießens beherbergen. Doch die menschliche Form ist komplexer geartet. In ihr spielt das Sprechen und die Sprache eine zusätzliche und bedeutende Rolle, was in der versteckten Figur – oder sind es gar zwei? – zu sehen ist.
Inhaltsverzeichnis
1.1 Einführung
1.2 Die Pflanzen zum Sprechen bringen
1.3 Die Luzidität und die Echos im Körper
1.4 Ödipus und alle Frauen
1.5 Myschkin oder die heilige Torheit
2.1 Der Tod als Informant des Lebens
2.2 Neuro-Psychisch
3.1 Unbewusstes Sehen und Traummalerei
3.2 Gedankenhören und Gandhis Weiblichkeit
3.3 DiASnalytische Psychokatharsis
4.1 Die Avatare von Pandora
4.2 The ‚Inner Touch‘
4.3 Das ‚Ding‘ und der Seufzer des Realen
Anhang zum Verständnis der Praxis
Literaturverzeichnis
1.1 Einführung
Autochthon genießen? Was soll das heißen? Zu schreiben, dass die Menschen nur oberflächlich, objektverhaftet und banal genießen, würde nach den üblichen Pamphleten klingen, die die Geld- und Machtgier anprangern, die Korruption verteufeln und besserwisserisch zu dem ‚höheren‘ Genießen einer zurückgezogenen Kontemplation raten. Natürlich muss man all diese Gemeinheiten bekämpfen, aber kann man ihnen nicht etwas Reizvolleres entgegensetzen? Es existieren – wenn auch nicht bessere – so doch raffiniertere, gelungenere Formen des Genießens als die, den Leuten das Geld zu stehlen. Man müsste es allerdings wissenschaftlich vorbringen, denn ohne Wissenschaft geht heutzutage gar nichts mehr, auch wenn sie erneut nichts anderes ist, als Betrug mit überintelligenten Mitteln. So meint der Philosoph E. Coccia, dass die Naturwissenschaften nur von der Verdrängung alles Lebendigen leben und die Geisteswissenschaften grundsätzlich insuffizient seien.1 Wie soll man sich Wissenschaft dann also vorstellen? Vor allem eine, deren Objekt das Genießen als solches, als autochthones ist?
Vielleicht so: In seinem 17. Seminar ‚Die Kehrseite der Psychoanalyse‘ sagte der französische Psychoanalytiker J. Lacan: „Das Genießen (Jouissance) ist an den Körper gebunden. Das fängt mit Kribbeln an und hört damit auf, dass man, von Benzin übergossen, in Flammen aufgeht.“ Allerdings war dies die typisch provokante Art Lacans, etwas Tiefenpsychologisches auszudrücken. Ergänzend nämlich sagte er auch, dass sich das Genießen einstellt, wenn man Gymnastik treibt und dass auch die Katze genießt, wenn sie schnurrt. Letztlich fragte er sich sogar, ob das Genießen nicht ein Merkmal des Lebendigen schlechthin ist, das heißt, ob auch Pflanzen genießen.2 Lacan bejaht dies ganz vehement und sagt an anderer Stelle, dass auch die Bäume, die Amöben und die Bakterien genießen.3 Es muss also ein Genießen geben, das den Menschen auf dem komplizierten Weg der Evolution verloren gegangen ist. Nun glaubt Lacan wenigstens Spuren davon in der Psychoanalyse wiederentdeckt zu haben.
Das eigentliche Genießen nämlich, die wahre Jouissance, insofern sie sich auch bestätigen lässt, liege – so Lacan weiterhin – in einer besonderen Art des Geschriebenen, in einer bestimmten Verschriftlichung (L’Écrit, c’est la Jouissance).4 Es geht vor allem um das im menschlichen Unbewussten sprach-bildlich Verfasste, Niedergeschriebene, das der Psychoanalytiker ja zusammen mit seinem Patienten oder Klienten zu entziffern und somit zu lesen versucht. Zwar „gibt es in der Natur, vor jeder Formierung eines Subjekts, das denkt – etwas das zählt, auf der gezählt wird. Wichtig ist, dass in diesem Gezählten ein Zählendes schon da ist“.5 Zählendes ist auch Erzählendes, Schreibbares. Nicht, dass man immer schon in den Dingen las, wie der Mystiker J. Böhme behauptete, als er von der ‘signatura rerum’ sprach, den Zeichen, die den Dingen eingedrückt sind; ein Mythos, an den auch heute noch viele moderne Esoteriker glauben, weil sie nur genießen wollen und nichts wissenschaftlich erfassen! Nein, die Natur ist nicht schon fertig beschriftet. Aber sie bedeutet, sie insistiert, sie liefert die B(r)uchstaben.6
Insofern muss es in doppelter Hinsicht gut sein, wenn ich ein Buch schreiben will, in dem geklärt werden muss, warum dieses ultimative Genießen, die ‚Jouissance‘, mit so vielen Aspekten im Leben und ausgerechnet mit dem Bild und den Buchstaben zu tun hat. Jouir heißt auskosten, freuen, genießen, vergnügen, und es klingt auch ein bisschen nach jaillir: sprühen, aufspritzen oder nach jouer: spielen, funktionieren. Aber egal, in diesem Buch will ich über die bloße Theorie hinaus auch zu einem praktischen Verfahren führen, so dass der Leser sich nicht nur abstrakte Erörterungen über das Genießen anhören muss, sondern auch eine Erfahrung der ‚Jouissance‘ selbst – als des autochthonen, ureigenen, im Innersten verankerten, Genießens – erhalten kann. Dazu ist nur eine Selbstsublimierung, Selbstverfeinerung, Selbstvergeistigung notwendig.
Ein derartiges Vorgehen würden die meisten Psychoanalytiker wohl empört zurückweisen. Solch eine direkte, spontane Erfahrung durch Selbstsublimierung, geht über die klassisch psychoanalytischen Maximen hinaus, die sich auf das verdrängte infantil Sexuelle stützen. Aber ich orientiere mich an Lacan, der die Psychoanalyse etwas differenzierter sieht und der drei Formen des Genießens – entsprechend seiner Einteilung allen Seins in Imaginäres, Symbolisches und Reales – unterscheidet: das Imaginäre des Genießens ist die Körperlust, das Symbolische des Genießens ist die Sprechlust,7 und für das Reale des Genießens fungieren bei Lacan die Mathematiker, denn sie sind großartige Selbstsublimierer. Das Reale ist nicht die äußere Realität, sondern mehr ein Inneres, unbewusst Psychisches, Kombinatorisches. Man spürt es besonders, wenn es die eigenen Grenzen zeigt und es kein Weiterkommen gibt, also all das, was sich nicht zeichnen, sagen und symbolisieren lässt und somit unmöglich scheint.
Doch so ganz abstrus ist dies gar nicht, schließlich geht es immer darum, wie das Symbolische, Imaginäre und Reale zusammenwirken, und nicht nur um das Reale allein. Lacan bestätigte dementsprechend auch ganz klar, dass die letztliche ‚Jouissance‘ jenseits der drei oben genannten Bereiche zu finden ist, also ein Hinausgehen durch deren Zusammenwirken darstellt.8 Und so werde auch ich für den unmittelbarsten Zugang zur Autochthonie des Genießens eine allen drei Bereichen genügende Bild-Buchstaben-Formel verwenden, die ich dem indischen Yoga abgeschaut, sie jedoch dann in die westliche Wissenschaftskultur umformuliert und transferiert habe. Bei ihr geht es zwar nicht um direkte Mathematik, aber doch um rein Formales, perfekt Formalisiertes, das große Wirkung besitzt, indem man es zu psychischen Übungen benutzt. Das wird nicht schwer zu verstehen sein, wenn klar wird, dass für das autochthone Genießen beim Menschen die drei Arten des Genießens eben zusammenwirken und es auf das Reale allein nicht ankommt.
Denn natürlich fehlt – wenn sie genießen – bei allen Formen des einfachen Lebens, wie etwa den Pflanzen, vor allem das Symbolische, das Wort-Wirkende, und so können sie alle davon nichts sagen, auch wenn sie B(r)uchstaben dazu beitragen. Bei den Mathematikern, die so gut im Realen sind, fehlt es am Imaginären, an lebensnahen Vorstellungen, am Bild-Wirkenden, und so gelingt ihnen auch das Zusammenwirken aller drei Bereiche nicht, so wie eben bei allen psychologischen Methoden und Psychotherapien (einschließlich der herkömmlichen und bereits etwas erstarrten Formen der Psychoanalyse) wiederum das Reale zu kurz kommt. Deswegen betone ich die Praxisnähe der von mir entwickelten Analytischen Psychokatharsis, in der Bild-(imaginär), Wort- (symbolisch) Wirkendes (real) die Grundlage darstellen, die vor allem im praktischen Vorgehen zur Wirkung kommt.
Obwohl ich also ein bestimmtes, praktisches Verfahren, vorstellen will, mit dem das autochthone Genießen erreichbar ist, kann man sicher auch sagen, dass es in manchen kleinen Alltagssituationen ebenso anzutreffen ist. Es sind Momente des überwältigt Seins, des glücklichen Zufalls oder Staunens. Ich hatte einen Patienten, der voll depressiver Gedanken war, als er an einem wolkigen Tag mit seinem Lastwagen über eine Geländekuppe fuhr – und, in diesem Augenblick, am Höhepunkt der Kuppe, rissen die Wolken auf und der Bodensee war plötzlich im strahlenden Licht unter ihm zu sehen: ein Glanz, eine Erinnerung, ein scheinbar magisches Zeichen, das ihn über seine schlechten Gedanken hinaushob und ihn sogar für lange Zeit das Depressive vergessen ließ. Freilich muss ich zugeben, dass er ein kleiner Mystiker war, denn er bezog dieses Ereignis als ganz speziell für ihn von Gott gemacht. Und so holte ihn die Depression eine Tages wieder ein, was ihn zu mir führte.
Die Sache mit der ‚Jouissance‘ zwingt einen meist vorher zu einem bestimmten seelischen Rückzug, zu Inständigkeit und Seriosität. Ohnehin lebt jeder irgendwie und irgendwo auch mal für sich alleine, selbst wenn man in harmonischer Eintracht miteinander existiert. Auch in Urlauben, Konzertbesuchen und bei der Teilnahme an gesellschaftlichen Ereignissen, die vorzutäuschen scheinen, dass man zu vielen ist, harrt man oft vereinzelt aus, was zu wenig Selbstsublimierung führt. In solchen Momenten bemerkt man manchmal, dass es noch etwas anderes geben muss als die vielen bereits verkosteten und an Objekte gebundenen Genüsse.9 Für den Psychoanalytiker sind auch andere Menschen äußere Objekte, und deswegen glaubt er ja, jeder müsste in eine Psychoanalyse gehen, wo es auf eine direkte gegenseitige Subjektbezogenheit ankommt. Die Psychoanalyse Lacans ist eine Wissenschaft vom Subjekt, wo eher das Nicht-Sublimierte eine Rolle spielt.
Und so sind Therapeut und Patient nicht mehr nur menschliche Objekte, sondern dem Unbewussten unterstellte Subjekte und müssen zusehen, was sie daraus machen. Auf jeden Fall ist die ‚Jouissance‘ im Spiel. Ich habe viele Bücher über das selbsttherapeutische Verfahren der Analytischen Psychokatharsis geschrieben, das ich also zur Erfahrung der ‚Jouissance‘ anbiete und will mich hier nicht wiederholen. Ich bin mit diesen Veröffentlichungen jedoch stets ein bisschen alleine geblieben. Mein Schreiben war manchmal zu trocken und zu abstrakt, aber da ja das Schreiben selbst der ‚Jouissance‘ so nahe ist, bin ich aufs autochthone Genießen gekommen. Ich habe noch während meiner psychoanalytischen Ausbildung das Meditieren angefangen. Denn im Ausbildungsinstitut war alles sehr bieder und schulmeisterlich, und meditieren versprach einen Zugang zum Genießen in der Beziehung zu sich selbst.
Ich erwähne nur kurz gefasst einiges zur Methodik dieser Selbstsublimation, umranke es aber mit essayistischen Erzählungen und Berichten, die leichter zu lesen sind und die sich mit den Beziehungen der Menschen vor allem zu sich selbst beschäftigen. Früher waren Beziehungsgeschichten wie M. Mitchells ‚Vom Winde verweht‘, T. Manns ‚Buddenbrooks‘ oder L. Bromfields ‚Der große Regen‘, wundervolle psychologische Epen über die Beziehungen der Menschen und insbesondere der Geschlechter, die gegenüber der überromantisierten Literatur Goethes packend modern erschienen. Heute sind es die von Transgendergeschichten durchwirkten Romane wie M. Nelsons ‚Die Argonauten‘, die den neuesten Zeitgeist beflügeln. Wo bei M. Mitchell nie klar wurde, warum Scarlett O’Hara den völlig unscheinbaren Ashley leidenschaftlich begehrte, und mit dem grandiosen Rhett Butler nie zurechtkam, geht es bei M. Nelson um die lesbische Freundin, die sich in einen Mann umwandeln lässt, während sie selbst ein Kind bekommt, das männlich sein wird und somit die gleiche Problematik – zwei Männer zwei Frauen – wiederspiegelt, an der sie selbst leidet. So sieht es zumindest die Autorin. Konstruktiv alleine und selbstsublimiert?
Auch hier und jetzt funktioniert das sogenannte queere Beziehungsdrama nicht einleuchtender als die Psychologie vor hundert Jahren. „Die Literatur liebt“ – so ein Rezensent über Nelsons Buch – „die Theorie, die Philosophie, unterwürfigen Sex und Fäkalien.“10 Nun ja, ich weiß nicht, scheinbar ist das heute so. Es ist wohl keine Erzählweise besser als die andere, so dass man sich fragt, warum es der Literatur trotz erheblicher Wandlungen nicht und wohl auch nie gelingen wird, das Beziehungsproblem – und vor allem das der Geschlechter – einigermaßen zu lösen. Aber da gibt es ja noch die Psychoanalyse – speziell die von Lacan – und ihre Stellungnahmen zum Genießen. Unweigerlich knüpft sie das Genießen ans Begehren, insbesondere an das, das unbewusst geblieben ist.
Ist es so gesehen nicht vielleicht vorteilhaft in eine Lacansche Psychoanalyse zu gehen, um dort endlich zu erfahren, dass Sex gar nicht existiert, weil sich nichts von ihm auch nur annähernd logisch sagen oder definieren lässt? Man kann Sex tun und lassen, seltsame Filme und Beschreibungen darüber abgeben, aber nichts davon logisch und signifikant vermitteln, nichts davon zutreffend ausdrücken oder real artikulieren oder gar definitiv schreiben. „Die sexuelle Beziehung ist in ihrer Struktur nicht fassbar“, konstatierte Lacan.11 Sie sei eine Scheinbeziehung, das Imaginäre der Körperlust herrscht vor. In der Psychoanalyse wird sie nur in der Übertragung, also auf die Dualbeziehung und Sprechlust zwischen Therapeuten und Klienten übertragen, erfahrbar. Man muss bezüglich des Genießens aber wohl weitergehen, also weiter als im Sex oder im Therapiegespräch, und so will ich ein Verfahren zeigen, das auch das Reale (vor allem durch die Praxis) stärker einbezieht.
Im Grunde genommen hat es S. Freud, der Entdecker der Psychoanalyse, mit dem gerade oben erwähnten Alleinsein und der damit verbundenen Autochthonie auch nicht anders gehalten. Er saß viel Zeit alleine über seinen Manuskripten, fuhr oft allein in Urlaub und Sex gab es schon nach dem vierzigsten Lebensjahr für ihn (man müsste sagen: in dieser äußeren, scheinbetriebenen Form) nicht mehr. Einsam war er aber nicht. Man sagt, seine Frau sei sehr ‚uxoriell‘ gewesen, also so etwas madamig und zugeknöpft, Frau Gemahlin eben. Vielleicht machte diese viktorianische Art zu leben sie im Allein-Sein stark, autochthon, während ihr Mann sich in der Jagd nach der Wissenschaft der Seele verausgaben musste. Was ich schreibe hat aber mit Freuds Privatleben nichts zu tun, wohl jedoch mit seiner Psychoanalyse und auch mit Meditation.
Ich bin nämlich darauf gestoßen, dass Meditation auch in der intellektuell und wissenschaftlich gestalteten Psychoanalyse einen festen Platz hat. Denn es verhält sich so, dass in der analytisch-therapeutischen Sitzung nicht der Klient oder Adept meditiert, sondern vor allem auch der Analytiker. Er muss, wie es heißt, mit ‚gleichschwebender Aufmerksamkeit‘ zuhören, und was sollte das anderes sein, als dass er eben meditiert, aber doch gerade noch ein Ohr für den Patienten offen hat. Freud sagte hinsichtlich der „gleichschwebenden Aufmerksamkeit“, der Analytiker solle dem Patienten „sein Unbewusstes als empfangendes Organ zuwenden“.12 Halb Meditation, halb Analyse, klingt alles ein bisschen seltsam.
Denn wie diese Art jungfräulicher Empfängnis vor sich gehen sollte, konnte Freud nicht klarer definieren. Die „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ blieb somit also problematisch. Sagen wir es so: Der Psychoanalytiker kann die vielschichtige Bezogenheit seines Patienten auf den Therapeuten nur erfassen, wenn er selber halb in Trance, aber für die Zwischentöne hochgradig sensibilisiert, zuhört. Man hat so gesehen eine besondere Art der Meditation vor sich, gleichzeitig besteht aber noch eine zweite, wenn auch erneut gegenläufige Gemeinsamkeit zwischen Psychoanalyse und Meditation: Die ‚freie Assoziation‘ nämlich, in der der Adept, der Patient, reden muss was das Zeug hält. Wenn er sich schon nicht mehr dem Treibenlassen in der Hypnose hingeben durfte, musste er alles Entsetzliche aus sich herauslassen und so – etwas übertrieben ausgedrückt – einer bestimmten Art der Glossolalie, des Zungenredens, frönen.
Dieses spontane Reden, in dem der Patient jedem Einfall tranceartig folgen muss, ähnelt dem meditativen Vorgang. Dort, in den üblichen Formen der Meditation, spricht es jedoch – mehr oder weniger – in einem selbst, und auch das ist wieder nur eine Psychoanalyse ‚anders herum‘, ist ihre Kehrseite, nämlich eine Therapie nicht zu zweit getrennt sondern allein zu zweit. Die jungfräuliche Empfänglichkeit ist in der Meditation, in diesem Alleinsein, genauso gegeben, und so lassen sich Psychoanalyse und Meditation gut verbinden. Ich selbst lebe in diesem Sinne gerne etwas zurückgezogen, eigenständig, und dies nicht nur, weil ich – neopublizistisch wie man das heute macht – glaube damit besonders progressiv zu sein, sondern weil ich selbst meditiere und zudem auch davon noch etwas in Lacanscher psychoanalytischer Manier schreibe. Denn ich glaube, dass das Verfahren der Analytischen Psychokatharsis, das ich aus der Anwendung der Meditation und der Psychoanalyse entwickelt habe, dringend notwendig ist.
Es geht über die beiden einzelnen Methoden (sowohl über die klassische, herkömmlich Psychoanalyse und die reine, nicht wissenschaftlich begründete Meditation) hinaus und verbindet in gewisser Weise auch zwei Kulturen: die mehr dem Osten zugeneigte Meditation und die westliche psychologische Wissenschaft. Freud hatte lange mit der Hypnose praktiziert und seine Patienten in eine wohltuend aufgehobene, meditative Situation versetzt. Die Patienten haben den hypnotisierenden Therapeuten jedoch zu sehr als einen göttlich agierenden Arzt angesehen, sich einem Abhängigkeitsrausch mit kathartischen Erlebnissen hingegeben und damit nicht mehr so engagiert therapeutisch mitgearbeitet. Sie sind in Mutters Schoß zurückgefallen, wenn man dies so krass sagen darf, wozu man ergänzen muss, dass eine gewisse seelische Urmatrix angeblich lebenslang bei jedem Menschen mit der Mutter-Imago kontaminiert bleibt. Wir sind dem Schoß wohl nie ganz entwachsen.
Freud wollte daher eine moderne Heilserfahrung begründen, bei der der Kranke von vornherein wach und mündig bleiben sollte. Doch in der von mir inaugurierten Meditation ist die Katharsis als solche wissenschaftlich begreifbar und für sich nutzbar. Auch in ihr bleibt man wach und mündig. Dass man dabei das Gefühl hat, auf sich gestellt und nicht mehr so ganz alleine zu sein, hat jedoch weniger mit der Mutter-Imago zu tun, als mit dem ‚Vater‘-Wort. Denn man hört mittels eines bild-worthaft Formalen in der von mir inaugurierten Meditation Silben, Worte und halbe Sätze aus dem Unbewussten und muss diese mit rationalen Deutungen verbinden. Es handelt sich also nicht um Mystik, sondern um eine Art direkter Psychoanalyse, wozu ich noch bessere Erklärungen nachliefern will. Es sind vor allem diese Worte und Deutungen, die einen nicht mehr so alleine lassen, auch wenn man sonst für sich und ohne große äußere Abwechslungen lebt. Meditation habe ich während meiner psychoanalytischen Ausbildung bei einem vergleichenden Religionswissenschaftler Anfang der Siebziger Jahre erlernt.
Man muss beim Meditieren nicht unbedingt im Grünen zwischen Herbstanemonen und Tigerlilien sitzen. Denn auch die ‚viriditas‘, die Grünheit, wie die Heilige Hildegard von Bingen die den Pflanzen ähnliche Menschenseele nannte, ist in uns. Seltsam, wie die Pflanzen ihre Fortpflanzung durch Insektenbestäubung erledigen lassen. Es würde uns viel helfen, hätten wir diese Methode auch als Menschen beibehalten. Wir könnten alleine irgendwo in der Natur verweilen, fast ungestört und nur gelegentlich durch eine kleine Berührung dem Vermehrungswunsch und der Befruchtung genügen. Vielleicht wäre das jedoch für den Menschen zu langweilig. Die Pflanzen hängen nicht so rigide am Leben wie wir, sondern genießen anscheinend den Überfluss den sie selbst darstellen.
Und so zitiere ich nochmals Lacan, der sagte, „der Stoff aller Arten des Genießens grenzt an das Leiden, und das ist das Kleid, woran man es erkennt – wenn die Pflanze nicht offenkundig leiden würde, wüssten wir nicht, dass sie lebt“.13 Auch an anderer Stelle diskutiert Lacan das Genießen der Pflanzenwelt aus einer dem Unbewussten ähnlichen Form heraus.14 Dieses allerursprünglichste Genießen, das auch der menschlichen Erfahrung und seiner Schriftlust in der besagten ‚Jouissance‘ zugänglich ist, scheint so elementar und eben grundlegend zu sein, dass die Menschen es – dieses also mehr Bildhaft-Reale – weitgehendst verdrängt, verlernt und verworfen haben.15
Auch wenn dies nicht das Alleinige ist, um das es beim autochthonen Genießen geht, so kann man daraus doch Philosophisches, also Wort-Wirkendes, herausziehen. Dies ist die zentrale Auffassung von E. Coccias Buch ‚Die Wurzeln der Welt‘, wenn auch das Wort genießen darin kein einziges Mal vorkommt.16 Er geht davon aus, dass – wie zitiert – die Naturwissenschaften (und im Zusammenhang mit ihr auch die meisten Geisteswissenschaften) das Lebendige als solches nicht fassen können. Wenn überhaupt, so Coccias Meinung, kann es am besten durch das Wesen früher Lebensformen wie der Flora erfasst werden. Denn sie stehen in der Mitte und damit auch im Mittelpunkt allen Seins und Werdens. Sie verbinden die Erde – vor allem im Drang ihrer Wurzeln zum Erdinneren, dem Gravitationszentrum, hin – mit dem Kosmos und dessen gravitativen und elementaren Strukturen. Andererseits aber auch Licht mit der Luft und mit allem anderen Sublimen.
Diese Verbindungen sind äußerst dynamisch, sie bestehen in einem gegenseitigen Durchdringen von Wuchs und Wasser, von Luft und Photoelektrizität, von Meta- und Anamorphose, Geist und Materie. Coccia betont das Eintauchen der rein vegetabilen Strebungen in materielle und tierische Ebenen durch „Fließendes“, durch fließende Rhythmen, durch zellulären Atem, durch Mischung von allem mit allem. So sieht er die Photosynthese als einen übergeordneten „Prozess des Fließendmachens des Universums“ an, in dem die Pflanzensamen wie die Inkarnation einer kosmischen Vernunft wirken. Die Vernüfteleien der herkömmlichen Philosophen dagegen erscheinen ihm nur als völlig „sterile Betrachtungen“, die man durch subjektive Fakten stützt und nur „individuelle Laune“ ist.
Freilich fühlt man sich beim Lesen von Coccias Buch an Theosophie und Esoterik erinnert, an Pantheismus und Pneumatologie. Doch er versteht es, mittels zahlreicher zwischen Materie und Geist, Leben und Tod, Vernunft und Maschine vermittelnder Begriffe eine wissenschaftliche Art der Beschwörung zu kreieren. Dass er damit auch eine Phänomenologie des Genießens beschreibt, weiß er mit Sicherheit, drückt es aber so nicht aus. Und es bleibt bei ihm ja auch eine vollkommen theoretische Erörterung. Wie man sich dieser „Intimität, der Einheit von Subjekt und Materie“, dieser letztlichen Lebendigkeit und Wahrheit des Phytouniversums, als Mensch praktisch annähern könnte, erklärt er nicht. Er verfügt über keine Praxis.
Zu Recht verurteilt Coccia die Physik, deren Apparate und Teilchenbeschleuniger nur unbelebte Augen und so nur altersweitsichtige Vermittler sind. Die Philosophie dagegen hätte sich seiner Meinung nach „immer nur für kurzsichtige Vermittler entschieden“, indem sie sich stets nur auf ein lückenhaftes Bild des Ganzen konzentriert hat. Aber Coccia ist – wie gesagt – selbst kein normalsichtiger Praktiker, er ist kein Psychotherapeut, kein Arzt, der mit den so großartige beschriebenen Pflanzenenergien auch heilen könnte. Sein Buch hilft einem ökologischer, meditativer und umweltverliebter zu werden, doch hält diese Liebe nicht lange genug an oder dringt selber nicht tief genug ins menschliche Seelenleben in wissenschaftlicher Form ein, wie es heute nötig wäre.
Dennoch erwähne ich seine Arbeit und in der Folge weitere Berichte, die eine umfassende psychologische Praxis anregen können, da mir ja die Psychoanalyse (ausgenommen Lacan) zu stoisch geworden ist. Die psychoanalytischen Institute sind zu eigenbrötlerischen Vereinen geworden, in denen inzwischen selbst die Lacanianer meist nur nachplappernde Epigonen sind. Man muss es Lacan „mit der gleichen Münze zurückzahlen“, wie er selber sagte, d. h. ihn nicht nur wortwörtlich zitieren oder gar numismatisch erklären, sondern auch – exakt auf seiner Spur – weiter entwickeln. Ich versuche dies mit dem Verfahren der Analytischen Psychokatharsis, das sich sehr auf Lacans Vorstellungen vom wahren Genießen, von der ‚Jouissance‘ als solcher, stützt.
Als solcher heißt, dass es etwas mit der Wahrheit zu tun hat, also damit das Sein nicht verfehlt und das Leben nicht vertan zu haben. Der Philosoph M. Heidegger sprach von der Seinsvergessenheit und der Verfallensgeneigtheit (wunderbare Heideggersche Formulierungen), die viele Menschen erleiden, weil sie sich gewisse Wahrheiten zu sich selbst nicht eingestehen. Sie genießen nur die Scheinwahrheiten, während im autochthonen Genießen auch die relevante – als nicht jede oder absolute – Wahrheit, Seinswahrheit, Lebenswahrheit, genossen werden kann. Um das im Folgenden noch weiter aufzuklären, hier noch ein kurzer Hinweis auf das Verfahren der Analytischen Psychokatharsis.
Entsprechend den psychoanalytischen Grundprinzipien, Grundtrieben des Bild- und des Wort-Wirkenden (Imaginären und Symbolischen) gibt es zwei Übungen. Die erste, meditative, benutzt das bereits erwähnte Formale (Formel-Worte) bei gleichzeitiger Achtung, ob etwas vom Bild-Wirkenden (z. B. eine Lichterscheinung) wahrgenommen werden kann. In einer zweiten Übung wird auf das innere ‚Hören‘ geachtet und dieses analysiert. Mehrmals werde ich im Weiteren differenzierend auf diese Grundlagen eingehen
1 Coccia, E., Die Wurzeln der Welt, Eine Philosophie der Pflanzen, dtv (2020) S. 34 -35
2 Lacan, J., Lettres de L’Ècole freudienne, Nr. 16 (1975) S. 192
3 Lacan, J., Seminar XXI, Vortrag vom 23. 4. 1974.
4 Lacan, J., Seminaire XVIII, Èditions du Seuil (200) S. 129 Anderswo schreibt Lacan, dass Geschriebenes das Reale ist.
5 Lacan, J., Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, Walter (1980) S. 26
6 Oudee Dünkelsbühler, U., Zeugnis und Schrift: B(r)uchstaben an der Couch, Les Etats Généraux de la Psychanalyse (2001), worin der Autor die elementarsten Schnitt- und Bruchstellen im psychoanalytischen Prozess meint und darstellt, also eine Art linguistischer Mathematik beschreibt, die man auch der Natur unterstellen kann.
7 Lacan nennt beides auch das außerkörperliche, phallische Genießen, der Phallus ist hier nämlich nur Bild und Symbol, Zeichen und Begriff, nicht reales Organ.
8 Lacan, J., Seminar XXI, Vortrag vom 12. 3. 1974
9 Dies war speziell in der Covid19 Pandemie deutlich geworden, auch wenn die meisten Menschen diesen Rückzug zu sich selbst nicht zur Selbstsublimierung genutzt haben.
10 Cranach, v, X., Literaturbeilage, SPIEGEL, 30.9.17
11 Lacan, J., Radiophonie, Silicet 2-3:455-99 (1970)..
12 Freud, S., G. SW. VIII, S. 381
13 Lacan, J., Seminar XVIII, Vortrag vom 17. 3. 1971
14 Lacan, J., Lettres de L’Ècole freudienne, Nr. 16 (1975) S. 192
15 Von Schriftlust kann man schon deswegen sprechen, weil sich niemand von einer Schrift, die er sieht, so distanzieren kann, dass er sie nicht im selben Moment auch schon gelesen hat.
16 Coccia, E., Die Wurzeln der Welt, Eine Philosophie der Pflanzen, dtv (2020)
1.2 Die Pflanzen zum Sprechen bringen.
Das Problem der wunderbaren Flora liegt – wie ich schon angedeutet habe – darin, dass sie selbst nicht genügend sprechen kann. Auch Coccia hat das berücksichtigt, denn er spricht meisterlich über sie, kann sie aber nicht selbst zu Wort kommen lassen. Ja, wie auch?! Exakt dagegen hat Freud mit seiner Psychoanalyse propagiert, indem er in erster Linie den Klienten sprechen lässt und nicht die Methode, nichts Dozierendes, nichts von oben herab favorisiert. Trotzdem kann man heute in der psychoanalytischen Arbeit nicht ganz auf Konstruktionen, Suggestionen und Interventionen (sogenannte ‚enactments‘) verzichten. Viele haben auch Freuds Zielrichtung verlassen und beispielsweise ein ‚Mentalisieren‘ (eine Art von rein kognitiv erstellter ‚Affektspiegelung’ zwischen Klient und Therapeut) verbrämt und suggestiv eingeführt.
So macht auch Coccia den Versuch, die im Pflanzenreich bestehende Vorstellung von Leben als eine primäre, kosmologische Vernunft zu deuten, die grundlegend mit dem Genießen zu tun hat. Dasselbe versucht auch die Philosophin J. Bennet, indem sie sozusagen das Wesen und die Persönlichkeitsrechte der Natur heraushebt und an einleuchtenden Beispielen konkretisiert.17 Doch all das ist ein Schritt zu viel, man braucht dann keine Wissenschaft mehr und verliert sich in der altbekannten These ‚alles ist mit allem verbunden“, ist total verwoben, durchmischt und ineinandergeschachtelt. Dieser von selbst laufenden wissenschaftlich formulierten ‚Jouissance‘ kommt man meiner Ansicht aber nur näher, wenn man in einer gesicherten und an die Wissenschaft der Psychoanalyse angelehnten Weise meditiert, also jeden Einzelnen selbst zum Kreator der Vernunft, der Ineinanderschachtelungen und des „alles in allem“ werden lässt.
Dazu genügt es auch nicht nur einen therapeutischen Prozess zu durchlaufen, der diese oder jene Wahrheit zu Tage bringt. Das Unbewusste muss – wie hinsichtlich der Pflanzen phantasiert – selbst direkt zum Sprechen gebracht werden, was der Psychoanalytiker mittels der erwähnten „freien Assoziation“ des Patienten zu erreichen glaubt. Oft sind es lange Tiraden, die gehört, auf deren Zwischentöne geachtet und die dann – als seien sie auf den Therapeuten im sogenannten Übertragungsvorgang bezogen – interpretiert werden müssen. Dies kann hunderte von therapeutischen Sitzungen dauern, weshalb Freud auch von der „unendlichen Analyse“ gesprochen hat. Steckt nicht der Wunsch nach dem einen, definitiven Wort dahinter, das schon Goethe so ausdrückte: „Denn immer, wenn Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.“
Wenn auch nicht so mystisch, so apodiktisch oder prophetisch, ist dies in der Analytischen Psychokatharsis anders, denn dort ist es möglich, Worte oder halbe Sätze aus dem Unbewussten unmittelbar zu vernehmen. Ein Reglement psychoanalytischer Art (die Sache mit dem Formalen) verhindert, dass es dabei zu einer Inflation des Unbewussten kommt. Ich will mich damit von vornherein von esoterischen Versuchen abgrenzen, die nur intuitiv und fast magisch von Mitteilungen in mystischer Ekstase reden, die gespenstisch aus dem Innersten herauskommen. Um mein Vorgehen – wenn jetzt auch vorschnell – zu erklären, zuerst schon einmal ein erneuter Vorgriff in das Verfahren der Analytischen Psychokatharsis mit einem Beispiel meiner eigenen Erfahrungen. Ich meditiere seit längerem täglich damit und hörte erst vor kurzem solch ein dem Unbewussten entstiegenes Wort bzw. halbe Phrase.
Nach einiger Zeit der Anwendung der eingangs erwähnten Übungen mittels der besonders formalen Ausdrücke (sogenannter Bild-Wortformeln oder Formel-Worte), vernahm ich wie leise gesprochen etwas, das ‚Hans Oberlohn‘ lautete. ‚Hans Oberlohn‘!? Eigenartig, aber ich fand diese Phrase dennoch nach kurzer Zeit ganz zutreffend. Einerseits nämlich suche ich zwar nicht den materiellen, aber doch den geistigen, wissenschaftlichen, den ein wenig weiter ‚oben‘ angesiedelten Lohn meiner Arbeit. Andererseits klang das Wort ‚Hans Oberlohn‘ spöttisch, sarkastisch und schnippisch. Ein Hans ohne Lohn, Oberlehrer, Schulmeister, voll Hohn, Obersatire oder gar Lohengrin fiel mir ein, alles wenig schmeichelhaft. Ich war wie der bekannte ‚Hans ohne Land‘, der englische König aus dem 12. Jahrhundert, zwar nicht ganz ohne Lohn, aber vielleicht doch zu sehr hinter einer besseren Entlohnung her.
Klar, ich sollte es mit einer Stufe weiter unten versuchen, dann bekäme ich den mir zustehenden Lohn der schreibenden Mittelschicht. Immerhin scheint mir doch deutlich zu sein, dass diese Sprüche aus dem Unbewussten, die ich auch Pass-Worte nenne, weil sie so sehr die eigene Identität betreffen, recht originell sind. Vielleicht würde ein phantasiebegabter Dichter auf solche Äußerungen kommen, aber selbst dann bewirkt ein derartiges Identitätswort aus dem Unbewussten einfach mehr, als die einfallsreichste Poesie. Das erlauschte Wort mit dem ‚Hans Oberlohn‘ kam einfach aus dem Eigenen, wenn auch eigenem Anderen, dem groß zu schreibendem Anderen in mir selbst. Lacan bezeichnet mit dem Anderen das durch Spiegelungen (Bild-Wirkendes) verinnerlichte Andere (maßgebliche Umwelt) oder den durch Sprachliches (Wort-Wirkendes) ins Seelenleben integrierten bedeutenden Anderen (Eltern, Lehrer, Analytiker).
Auch eine freudianische Deutung fiel mir ein. Klang nicht auch ein ‚Hans Ober-Sohn‘ heraus? Ist der Obersohn nicht der, der der oberste beim Vater sein will, ihn um dessen Frau willen – wie Ödipus es tat – beseitigen möchte? Dazu war ich mit dem Namen Hans auch an die Geschichte des ‚kleinen Hans‘ von Freud erinnert, der, um bei der Mutter schlafen zu können, versuchte, den Vater wegzuschicken und dann eine Phobie entwickelte. Habe ich noch andere Frauen im Kopf? Oder gar wie der ‚kleine Hans‘ nicht nur eine andere Frau, sondern die Frau eines anderen? Nein, dies war nicht der Fall, aber es ist kein Fehler, solch ein Pass-Wort nach Freud’schen Gesichtspunkten zu durchforsten, um zwar nicht die Pflanzen, aber doch die Wahrheit aus dem Unbewussten zum Sprechen zu bringen.
Auf jeden Fall gingen mir diese Gedanken durch den Kopf, und auch wenn sie negativ oder spekulativ sein sollten, zeigten sie doch, dass ich nicht ganz alleine bin. Ich bin auch nicht so sehr gespalten, wenn mein unbewusster Teil mit mir redet. Gespalten ist man erst, wenn der/das Andere, L‘Autre wie Lacan sagt, in einem nicht kommuniziert, sondern starr bleibt und schweigt. Die Spaltung als „zwei gegensätzliche und unabhängige Einstellungen“ des Seelischen liegt der psychoanalytischen Theorie der menschlichen Person zugrunde.18 Jeder ist also, auch wenn er es im Alltag nicht merkt, irgendwie gespalten.
Unbemerkt verharrt man still und starr vor dem inneren Bild im inneren Spiegel im Unbewustten. Man geht nicht durch es hindurch, um es zu öffnen. Man führt vielleicht ein Selbstgespräch, aber nicht einen Dialog mit dem System des Unbewussten, mit dem Anderen