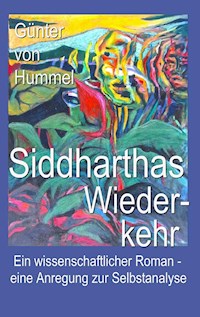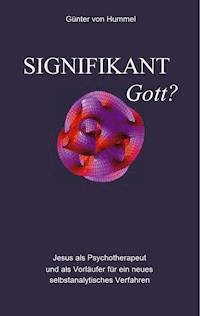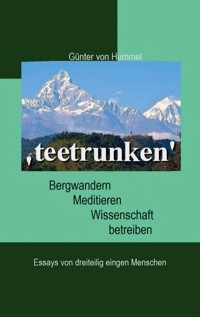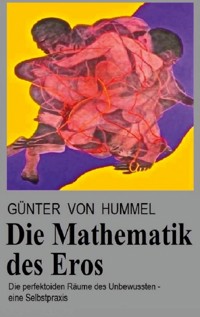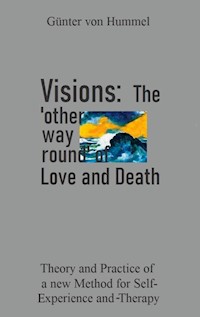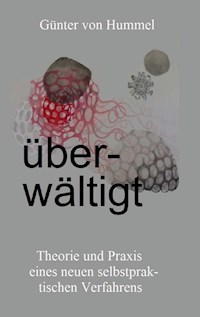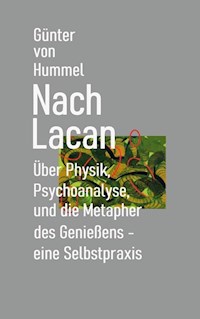Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Ich ist nur der Regieassistent des Films, des Theaters oder der Performance, die unsere Identität ausmachen. Und die andere Seite unserer Seele orientiert sich an dem, was in den Romanen, Zeitungen und den sozialen Medien zu lesen ist. All dies ist keine besondere Neuigkeit. Mit Hilfe der Psychoanalyse Lacans lassen sich diese Thesen anschaulicher und vielseitiger darstellen. Letztlich kann jedoch nur ein Verfahren hilfreich sein, das über die reinen Erklärungen hinaus auch noch zu einem eigenen, zu einem selbstanalytischen Vorgehen führt. Darin sind Selbstsichtung und Gedankenhören die zwei wesentlichsten Elemente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Umschlagsbild zeigt einen Ausschnitt des Bildes der Malerin T. Heydecker mit dem Titel ‚Das Ich und sein Gehirn’. Hinter den ganz gewöhnlichen und alltäglichen Geschehnissen verstecken sich turbulente Szenen. Die Dinge und Menschen vermitteln sich hier also durch eine Verschlüsselung, so dass man bei diesem auch von einer semantischen (versteckt bedeutungsreichen) Kunst sprechen kann. Davon wird auch das Buch handeln, indem diese Semantik zu einem praktischen Verfahren führt, das der Selbstanalyse dient.
Inhaltsverzeichnis
Übertragung /Unterstellung
Bild-Wort-Wirkliches
das Dreieck der Wahrheit
Die (Un) Ordnung der Blicke
NOVI SUI DIVI
Selbstsichtung und Klartraum
Gedankenhören und toter Signifikant
Kandels Pixelästhetik . . .
. . . und Kahnemans Phonemkünste
Schlussfolgerungen
Anhang
Literaturverzeichnis
1. Übertragung / Unterstellung
Wie anfangen bei dieser Vielheit der Bilder, der Blicke und Zeichen, die uns heute im Kino, im Fernsehen, bei YouTube, Instagram, WhatsApp und tausenden von andern Darstellungen und Performances umgeben. Oder bei dieser Vielheit der Worte, die uns noch zusätzlich in Zeitungen, Romanen, E-Books, Magazinen und den üblichen Small-Talk-Gesprächen umschwirren. Warum kommt denn niemand auf die Idee, dass wir uns viel mehr oder doch wenigstens vorwiegend mit dem Film und dem Buch im Inneren von uns selbst beschäftigen sollten. Denn seit der Psychoanalyse wissen wir, dass all dies im Unbewussten in kaleidoskopischer Form, also als buntes, geometrisches Allerlei und schillerndes Farbwechselspiel zu Hause ist. Und genau dort existiert, unbewusst also, auch ein kauderwelsch artiges, symbolisches Durcheinander in der Fasson eines „universalen Gemurmels“ und „ultrareduzierter Phrasen“ – Begriffe, die der französische Psychoanalytiker J. Lacan für das innere Buch verwendete.
Wenn ich es so behaupte, wird freilich schnell klar, dass wir uns in die überflutend imaginäre, bild-blickwirkende, und literarische, wort-wirkende Welt stürzen, weil die innere Welt vielleicht noch verworrener ist. Eine deutliche Ungleichgewichtung zwischen dem Außen und Innen besteht, und so scheint es doch sinnvoll, sich bei der Inflation der Medien heutzutage doch wenigstens etwas mehr dem Inneren zuzuwenden als es bisher getan wurde. Zwar haben sich die Menschen früher, z. B. die alten Propheten, intensivst nach innen gewandt. Sie haben jedoch diese Innenschau und dieses nach innen gewandten Gehör mit so mythisch-mystischen Ausdrucksformen versehen, dass sie nur schwer mit den heutigen – beispielsweise psychoanalytischen – Explorationen des unbewussten Innenraums vergleichbar sind. Doch auch die Psychoanalyse gelangt nicht ganz dahin, wohin ich versuche in diesem Schreiben über Film und Buch zu kommen. Ihr Fehler ist, dass sie die Schau gegenüber dem Sprechen und Hören stark vernachlässigt.
Aber wie anfangen? Für einen Philosophen ist es – vor dem weißen Blatt Papier sitzend – das größte Problem. Die ersten Buchstaben, eine beginnende Silbe oder gar ein anfängliches Wort entscheidet über alles. Dabei hat man sich es früher noch leicht gemacht und behauptet, Raum und Zeit seien ‚a priori‘ bereits da, richtig gewusst und verifiziert (Kant zum Beispiel). Oder man hat versucht den Geist zu objektivieren (Hegel zum Beispiel). Aber was ist mit dem ureigentlichen Subjekt? Ich würde gerne mit etwas Subjektbezogenem anfangen, mit etwas Eigenem, etwas zwischen dem Objekt und Subjekt Befindlichen oder eben einfach mit etwas begründet Vermutetem, also etwas, das man sich in einer Konjekturalwissenschaft oder Wissenschaft vom Subjekt erarbeiten kann.1
Conicere heißt lateinisch also vermuten und subjicere heißt unterstellen, das Subjekt ist also das Unterstellte. Wem oder was unterstellt bleibt offen, denn sonst würde man ja wieder etwas Geistiges oder Materielles dafür einsetzen. Freud nannte das, dem das Subjekt unterstellt ist, das Unbewusste. Das ist eine Sache für sich, es sollte etwas Eigenes sein, was mit Libido zu tun hat, der ‚genießenden Substanz‘, wie Lacan es übersetzte. Er bezog sich auf die ‚Substanzlehre‘, auf Aristoteles ausgedehnte Substanz und Descartes denkende Substanz und kam eben so zum substanziell Genießenden als etwas Drittem, das substanziell und universell ist, denn auch schon die Pflanzen genießen.2
Im Zentrum der Psychoanalyse steht der Begriff der ‚Übertragung‘. Der Patient überträgt unbewusster Weise Bedeutungen aus früheren Lebensabschnitten oder anderen Beziehungen auf den Therapeuten, indem er ihm ein Wissen ums Genießen unterstellt. Übertragung / Unterstellung, durch diese Kombination ergibt sich die Möglichkeit einer besonderen Gesprächsart, denn Übertragung und die genannte Unterstellung verlangen nach einem klärenden Ausgleich. Hier fangen also zwei Subjekte wirklich an, eine Lösung hinsichtlich dessen zu finden, dem sie – vorwiegend sprachlich, linguistisch, ‚wort-wirkend‘ – ausgeliefert sind. Und hier haben sie auch eine bessere Chance, etwas richtig zu wissen und es auch noch gut zu sagen. Denn Unterstellung und Übertragung sind ja tatsächlich sich gegenseitig bedingende bild-wort-wirkende Vorgänge, der eine nach unten, der andere nach oben. Wo etwas worthaft, symbolbezogen, übertragen wird, spielt etwas in gleicher Weise Unterstelltes eine Rolle und umgekehrt. Das Bild, der Blick bleibt unten hingestellt, während das Wort, die Sprache zum übertragen nach oben hin genutzt wird.
Nun kann ich in diesem Buch trotzdem nicht so anfangen wie der Psychoanalytiker in der Therapiesitzung, wo beide, Patient und Therapeut, gleich loslegen können. In einem Buch muss ich selbst erst einmal lange Zeit etwas aufbauen, erst dann kommt der Leser zum Zug. Erst, erst. Zu meiner Rechtfertigung könnte ich einwenden, dass der Psychoanalytiker nicht so frei und ungebunden, also nicht so apriorisch anfängt, wie es scheint, wenn sich zwei Subjekte gegenübersetzen. Der Therapeut muss nämlich mit dem Hinweis auf seine sogenannte ‚Grundregel‘ anfangen: „Sagen Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt, egal wie oder was“. Es ist das psychoanalytische a priori, verhält sich also letztlich ähnlich wie bei Kant.
Der herkömmliche Psychoanalytiker geht davon aus, dass alles gesagt werden kann – analytisch. Dann synthetisiert er, dass aus der Beziehung von Unterstellung / Übertragung alles gelöst werden kann. Mag sein, dass dies nur ein kleiner Trick ist, aber eben: nicht exakt logische Praxis wie Lacan sie forderte. Gut, mir geht es auch nicht anders. Ich muss mit irgendetwas anfangen, und damit ich nicht allzu künstlich anfange, fange ich damit an, dass der sich so stark auf das Wort-Wirkende stützenden Psychoanalyse das Bild- und Blick-Wirkende fehlt, und dass ich beides in einen engen Zusammenhang, ja fast in eine Verschmelzung bringen will mittels eines neuen selbstpraktischen Verfahrens, das ich Analytische Psychokatharsis nenne.
Ich postuliere eine Selbstsichtung, die im Unbewussten als so etwas wie ein Bild-Wirkendes existiert, etwas imaginär Signifikantes, ein ‚unbewusstes Sehen‘.3 Dies ist also bisher von der Psychoanalyse kaum genutzt worden, während das Hörbarmachen der Gedanken, das Wort-Wirkende, das symbolisch Signifikante, die Psychoanalyse dominiert. Lacan meint, schon Freud sei Linguist gewesen und habe dem Unbewussten also eine Kette der Signifikanten, der Bedeutungszeichen, der sprach-symbolischen Ordnung zugewiesen, die man in der Therapie entschlüsseln kann. Beides aber, das Bild-und das Wort-Wirkende sind die Grundelemente, Triebe, Säulen dieser Wissenschaft vom Subjekt, die somit den sogenannten objektiven Wissenschaften gegenübersteht.
Die Selbstsichtung ist also von der Psychoanalyse nicht richtig genutzt worden, und von diesen objektiven Wissenschaften, die mehr oder weniger auf materialistische Weise zu sichten suchen, wer der Mensch ist, haben wir inzwischen auch genug. Nicht anders steht es um die subjektiven Wissenschaften wie die Philosophie, die Literatur- und Kunstwissenschaft, Theologie, Soziologie etc., sie gehen uns nicht ausreichend weit in die Tiefe, wie es die Psychoanalyse als etwas Drittes mit ihrem Bezug zur Libido und zum Genießen versucht hat. Daher will ich zuerst einmal ein paar Vorbemerkungen zu diesem vielleicht etwas seltsamen Begriff der Selbstsichtung (Bild-Wirkendes) und des Gedankenhörens (Wort-Wirkendes) machen.
Das Tier entwickelt nicht ein vom Bedürfnis abgespaltetes, völlig isoliertes eigenes Begehren, das einen libidinösen, quasi-sexuellen Charakter hat. Es folgt nur seinen biologisch fixierten Instinkten. Allerdings kann das Tier, wie es der Verhaltensforscher K. Lorenz nachwies, gelegentlich für den kurzen Moment einer Art Wahlfreiheit die Instinktgebundenheit verlassen, um dann jedoch sofort wieder in einen etwas anders gebildeten Instinkt zurückzufallen.4 Genau so etwas fördert auch der Begriff „sexuell“ bei Freud, indem die Wahlfreiheit jedoch sehr umfassend ist und nicht mehr in etwas Instinkthaftes zurückfallen kann. Man bleibt seinen Intentionen, Trieben und unbewussten Regungen verhaftet.
Das Freud’sche Sexuelle hat eigentlich wenig mit dem zu tun, was wir landläufig darunter verstehen, nämlich die genital sexuelle Beziehung Erwachsener. Die Betonung liegt bei Freud mehr auf dem, was er das „infantil Sexuelle“ nannte wie z. B. das Orale, die Mundlust und deren Trieb. Das Freud’sche Konzept führte allerdings zu vielen Schwierigkeiten, da er neben dem Eros-Lebens-Trieb einen Todestrieb postulierte, den es als aktives Element nicht geben kann. Die Umformulierung durch Lacan in das Paar Wahrnehmungs-, bzw. Schautrieb und Entäußerungs-bzw. Sprechtrieb behebt dieses Problem, was auch für meinen Text maßgebend sein wird.
Wie gesagt, in der Psychoanalyse spricht man sich hunderte von Stunden lang so weitgehend aus, dass man sich ein gewisses Bild (vor dem geistigen Auge) von sich machen kann. Man hat aber immer schon versucht, sich selbst direkt – zwar nicht gerade ins Auge – aber doch ins Ur-Eigenste des Ichs zu schauen. Mystiker, Zen-Buddhisten, Esoteriker etc. haben das versucht, aber ich will einen wissenschaftlich begründeten Weg dazu zeigen, indem ich auf das zu Sichtende, Imaginäre, Bild-Wirkende direkt (meditativ) zugehe, und es – fast gleichzeitig – einer wort-bezogenen Selbstanalyse unterziehe. Sichtbar wird dabei das, was Freud die „Vorstellungsrepräsentanz“ nannte, nämlich das, was die eigentliche Triebkraft (die primärsexuell und real ist) im Psychischen repräsentiert.
Doch ist dies nur eine Zwischenstation, wenn auch direkt erfahrbar und nicht nur wie im herkömmlich Psychoanalytischen abstrakt theoretisiert. Ein Beispiel, um dieses Zwischenstadium zu kennzeichnen, sind ‚Traumvisionen‘, die oft im Zusammenhang mit sogenannten ‚luziden Träumen‘ auftreten. Manchmal versuchen Menschen solch ein besonders eindrucksvolles Traumbild, das also nicht so schnell in anderen Bildern untergeht, sondern zu beharren scheint, zu malen. Lacan meinte, dass es die Traummalerei im Grunde genommen kaum gibt, da der Traum viel zu lebendig, zerstückelt und meist nur schlecht erinnert ist. So zeigt diese Malerei auch oft nichts von der ‚Vorstellungsrepräsentanz‘, die im Bereich des Bild-Wirkenden als imaginärer Signifikant die gerade im Moment wirkende Triebkraft perfekt darstellt und repräsentiert.5
Ich habe jedoch einmal etwas erlebt, was man fast als solch eine ‚Vision‘ bezeichnen könnte und das daher eher der ‚Vorstellungsrepräsentanz‘ zuzurechnen wäre. Aus einem Traum aufwachend nahm ich für kurze Zeit, vielleicht mehr als eine Sekunde, ein festes, also starr bleibendes Bild wahr, das mich irgendwie stark berührte (siehe selbstgemalte Abbildung unten). Obwohl ich es nicht selbst geschaffen hatte, konnte ich es doch durch eine Art Konzentration den genannten Moment halten. Es war also kein Traum mehr, sondern eine Art von ‚Vision‘.
Denn während der Traum rasch an einem vorbeizieht, ja taumelnd dahinrast, hatte dieses Verbleiben, dieses Insistieren eines wie ausgestellten oder betont gezeigten Bildes, eine leicht betörende, anmutende Wirkung auf mich. Hier soll mir etwas vermittelt werden, hier wird nicht schnell das Traumprogramm durchgespielt, sondern etwas davon herausgehoben. Es handelte sich also um das Gegenteil der glatten visuellen Kommunikation. Ich habe es – wenn auch künstlerisch ganz unprofessionell – noch am selben Tag gemalt. Eine gesicherte Aussage konnte ich trotzdem diesem Bild nicht entnehmen.
Ich hatte zwar sofort den Eindruck, dass die weißen Bögen Blüten des Baumes waren, aber auch wolkige Zeichen von irgendwo außerhalb her. Mehr Seelisch-Geistiges (weiße Bögen) und mehr Biologisch- Natürliches (Baum) sollten so verbunden gezeigt werden, dachte ich. Seltsam blieb es trotzdem, auch wenn mir danach die Diskussion Lacans um die Freud’sche ‚Vorstellungs- bzw. Triebrepräsentanz‘ einfiel, die eben die Triebkraft im Seelischen als solchem direkt repräsentiert. Denn gerade die Insistenz des Bildes, macht genauso wie die Insistenz der Buchstaben die Kraft des unbewussten Triebs aus.6
Die Triebkraft kann auch in Form eines Affekts auftreten, der schnell ins Bewusste durchbricht und somit kaum je völlig verdrängt und unbewusst bleibt. Es kann aber eben auch in Form eines Wort-Klang-Bildes, also eines symbolischen Signifikanten, unbewusst und verdrängt bleiben oder in Form der Bild-Repräsentanz, also eines imaginären Signifikanten, besser als traumgemalt, fast wie visionär, vermittelt sein. Beides insistiert, drängt zum Ausdruck. Um Freud gerecht zu werden, könnten die weißen Bögen als Blüten auch eine sexuelle, auf das Weibliche hin bezogene Metapher sein, während der Baumstamm eher das Männliche vermittelt. Genau darauf läuft mein Verfahren ja hinaus: in eine etwas sublimierte, schöpferische Funktion des imaginären Signifikanten, die garantiert, dass der Eros mit berücksichtigt, aber nicht ins Pornographische oder Verrückte abgeglitten ist.
Lacan weist nämlich im Weiteren darauf hin, dass die Traummalerei leicht in die Richtung der psychopathologischen Kunst abdriften kann. Denn wenn das Bild wirklich die Triebkraft repräsentiert, kann es als Kunst und als Gewinn für die Menschen nur dann gelten, wenn es deren Schautrieb, deren Strahlt befriedigt, indem es gleichzeitig eine dezente ‚Blickzähmung‘ ist, eine besänftigte, in den Grenzen der Kunst gehaltene Schaulust. Mein Bild könnte so die Grenze zur Psychopathologie zeigen, der ich jedoch auch gerade deswegen nicht verfallen bin, weil ich dem Bild keine gesicherte Aussage zugebilligt und das, was man eine ‚Vision‘ nennen kann, als grenzwertig demonstriert habe.
Das Ziel meines Verfahrens, das ich also Analytische Psychokatharsis nenne, ist jedoch etwas ganz anderes, das ich im Anhang in seiner praktischen Ausübung beschrieben habe. Nur durch die Praxis lässt sich die oben von mir erwähnte Art einer Verschmelzung der beiden (des Bild- und Wort-Wirkenden) realisieren. Die psychoanalytische Theorie reicht dazu nicht aus, man muss auch eine meditative Praxis mit hinzu nehmen. Damit kann ich auf dem Feld des Sichtenden, Bild-Wirkendem zu mehr Wissenschaftlichkeit kommen und würde ich einen Schritt weitergehen als mit der Traum-‚ Vision‘ gezeigt. Ich könnte dann von einer ‚R-Ein-Sichtigkeit‘ sprechen, also etwas, das die Dinge in ihrer ‚Reinheit‘ sieht, aber auch als ‚Ein-Sichtigkeit‘ für das sie Umfassende Alle gelten kann. Das ist freilich sehr spekulativ gedacht und abstrakt ausgedrückt, und so werde ich diese hypothetische ‚R-Ein-Sichtigkeit’ zuerst einmal weiter mit gezielten Vermutungen anreichern.7
So kann man beispielsweise zu den Frühmenschen, den Neandertalern zurückkehren, die ja größere Gehirne hatten als die heutigen Menschen, dafür allerdings weniger neuronale Vernetzungen. Ich habe an anderer Stelle ausführlich darüber geschrieben, dass die Vermutung gerechtfertigt ist, dass die Frühmenschen gerade wegen dieser Kombination (viel Gehirnmasse, wenig Vernetzung) oft derartige ‚visionäre‘ Erfahrungen hatten. Vernetzungen sind für komplizierte sprachliche Formulierungen nötig, für die ‚Vision‘ braucht es nur das Selbstgenießen des Gehirns. Auch in der griechischen Antike war es ja noch üblich, dass es viele sogenannte ‚Seher‘ gab, die die innerlichen Bilder und Blicke sogar deuten konnten. Die heutigen überforderten Menschen haben im Bereich des imaginären Signifikanten, des Bild-Blick-Wirkenden, nur noch Halluzinationen parat.
Nun gönne ich mir manchmal einen Ausflug in diese Urzeiten in der Form einer ‚Vision‘ des ‚Meeres‘. Wie der ‚Baum‘ gehörte auch das ‚Meer‘ zu diesen Erfahrungen, deren ‚Vision‘ sich nach kurzer Zeit der ersten, der mehr meditativen Übung der Analytischen Psychokatharsis, bei mir manchmal – mit etwas Selbst-Nachhilfe – einstellt. Es kommt zum kathartischen Schimmern, diesmal also fast selbstgemacht als urzeitlicher Blick, als voll in Gang gekommene Vorstellungskraft von der Weite und Blauheit des ‚Meeres‘. Die Faszination ist ungemein größer als der reale Blick auf eine Meereslandschaft, den ich oft an irgendwelchen Stränden oder Küstenregionen gehabt habe, was auch schon oft großartig war. Aber jetzt war es eben so, wie es die frühen Hominiden wohl erlebt haben.
Denn sie haben das ‚Meer‘ in diesen Urzeiten nicht nur bestens gekannt, ist darin doch alles Leben entstanden, sondern auch geliebt, geheiligt. Sie haben es mit Minne ausgestattet, wie die frühen Mystikerinnen sagten.8 Schon immer und freilich besser nachvollziehbar bei den ersten Menschen hat es bereits hinsichtlich des ‚Meeres‘ Kreativität und das autochthone Genießen gegeben. Schon da sind sie – schon vom Blick her – darin geschwommen, haben also visuell in seinem Genuss und ‚fließenden Rhythmus‘ gebadet.9 Lacan meinte, dass das Genießen ein Merkmal des Lebendigen schlechthin ist, d. h. dass es sich nicht nur bei den Pflanzen so verhält, dass sie genießen, auch die Amöben und die Bakterien genießen, versicherte er.10 „Der Stoff aller Arten des Genießens grenzt nämlich an das Leiden, und das ist das Kleid, woran man es erkennt – wenn die Pflanze nicht offenkundig leiden würde, wüssten wir nicht, dass sie lebt“.11
Dieses also der Flora, der Fauna und selbst dem ‚Meer‘ innewohnende allerursprünglichste Genießen betrifft den Zugang zum primär Kreativen, wie es der Wissenschaftsjournalist S. Klein postuliert, und es scheint so elementar und eben ursprünglich zu sein, dass die Menschen es heute weitgehendst verdrängt, verlernt oder verworfen haben.12 Viele Autoren fangen jetzt aus diesem Grund an, sogar in der trockensten Materie nach dem Leben zu suchen wie z. B. E. Coccia oder Jane Bennet. Die zentrale These der letzteren Autorin lautet: „Materie ist aktiv – und sie hat bisweilen sogar politische Handlungsmacht. . . Wann sollte diese Aussage [dass die Materie lebt] plausibler sein als heute, wo ein kleines Virus die ganze Welt in Atem hält?13 „Ist das Virus nicht der Prototyp des viral Materiellen, indem wir es in seine RNA, Spike-Proteine und seine Moleküle, genauso zerlegen können wie eine Harley Davidson, wobei das Virus aber dann die eigenwilligste Lebhaftigkeit entwickelt, es also handelt“?14
Ich glaube nicht, dass man die Dinge so sagen kann, denn was haben die Leute von dieser Realitätssüchtigkeit? Ich gebe zu, dass man, frägt man sich nach dem Bezug zur Tierwelt, zum Vegetarismus und zu dem, was W. Hellpach Geopsyche und E. Gartmann Ökopsychoanalyse nannte, viele Bereiche in mein ‚Visions‘-Konzept einbeziehen müsste. Denn sowohl die ‚lebhafte Materie‘ wie die durchpsychologisierte Fauna und Flora müssten von der Psychoanalyse mitbedacht werden. Aber wo käme sie dahin? Ihr fehlt zwar. wie nun oft genug gesagt, die bessere Einbeziehung des Imaginär-Realen, des Bild-Wirkenden ins Gesamtkonzept, und die Beschäftigung mit der Linguistik, mit dem Symbolischen, Wort-Wirkenden ist aufreibend genug, aber erwähnen sollte man – gerade im Hinblick auf die volle Bewusstheit.- das Ökopsychoanalytische durchaus. Man betreibt ja auch Ethnopsychoanalyse, und das – wenn ebenfalls wieder problemreich – nicht ohne Erfolg.15 Die erfüllende Bewusstheit (awareness) im Gegensatz zum blanden Bewusstsein (consciousness) steigert dies alles auf jeden Fall.
Zurück zum Meer und zu meiner Art von ‚Meeres‘-Psychoanalyse., zu dieser scheinbar wahren Eins, in der sich das ‚Meer‘ nicht nur spiegelt, sondern wild, tosend, schäumend erhöht, wie in den vielen Gemälden E. Noldes, aber auch anderer Expressionisten mit dem Titel ‚Meer‘. Zweifellos strebt Nolde in seinem Bild ‚Meer 1‘ an, das Meer zu überschreiten, vielleicht ins ‚Visionäre‘ hinein oder noch weiter. Denn man sieht nur eine Welle, die sich bricht und im Hintergrund den vergoldeten Himmel. In Noldes zahlreichen Meeresbilder geht es fast immer um diese Vergeistigung, Überbewusstmachung, das ‚anders herum‘ von Liebe zum Meer und vom Tod durch das Verschlungen Werden der meist tief dunkel gemalten Wellen.
Es geht nicht um eine Abbildung, es geht um eine ‚Vision‘, die den Betrachter mittels einer Augentäuschung verführt: betrachte lieber das Bild, bevor du dich in der echten ‚Vision‘ des ‚Meeres‘ (wie ich sie geschildert habe) verlierst.16 Man muss ein Bild ausgiebig betrachten, aber nicht zu lange. Im Film ist es anders, man kann kein Bild ausgiebig betrachten, weil schon schnell das nächste kommt. R. Barthes meint daher, dass der Film zu ständiger Gefräßigkeit zwingt, da man kein Bild für sich genussvoll konsumieren kann.17 Und so wird im Verfahren der Analytischen Psychokatharsis das ‚Visionäre‘ durch die Anwendung der Formel-Worte immer in klarer visueller und auch für die folgenden Pass-Worte in logischer Distanz gehalten. Dieser Aspekt ist ganz wesentlich, sie hält wie schon betont das Wort- und Bild-Wirkende engstens in einer streng formalisierten Weise (ganz definitive Überdeterminierung) zusammen. Hätte man diese klare Führung nicht, könnte man freilich in alptraumartige ‚Visionen‘ verfallen, wie sie die noch wild und unkontrolliert meditierenden Mystiker und Eremiten a la Antonius erleben mussten, der sich bekanntlich mehrmals in die Wüste zurückzog, wo er von quälenden Schreckensszenarien verfolgt wurde.
Hässliche Fratzen, wilde Tiere und Monstergestalten suchten ihn heim. Der Maler Max Ernst hat diese seelischen Foltern trefflich dargestellt und bekam sogar in einen Wettbewerb den ersten Preis dafür. Antonius soll – trotz oder wegen seiner Askese und Halluzinose – hundertvier Jahre alt geworden sein. Auch von vielen alttestamentarischen Figuren, von Buddha und indischen Heiligen wird dies erzählt, und so muss ich freilich ergänzen, dass das ‚Meer‘ gut zu dem passt, was man in der Psychoanalyse die ‚präödipale Mutter‘ nennt (die nahe Bezugsfigur vor der Entstehung der Ödipus-Situation). Sie ist die Verführerische, aber auch die Gefräßige, die man also zwar ausgiebig, aber nicht zu lange betrachten soll. Gemeint ist das Verharren im frühen, unbewussten Phantasma, denn die Neurotiker genießen eine derartige Phantasie zu lange und zu intensiv.
Die ‚präödipale Mutter‘ wird in der Ödipus Sage durch die Sphinx repräsentiert, im alten Orient durch die mutterrechtliche Ishtar und ist im modernen Menschen eben im unbewussten Kernphantasma vorhanden. Dieses Phantasma trägt entscheidend zu den Formen des Verlangens und Begehrens des heutigen Menschen bei, aber auf ein solches kann man eben auch für eine volle, pralle Lebensgestaltung nicht ganz verzichten. Ich nutze in der Analytischen Psychokatharsis für den Sprung von der ‚Vision‘ zur ‚Rhetorik‘ des Pass-Wortes die volle Katharsis in konstruktiver Weise.18 Wenn man den Sprung im Auge hat, wird man beim ‚Meer‘ und der ‚präödipalen Mutter‘ nicht lange verbeiben. Er hat aber seinen Sinn, dass er eben den engen, konkretistischen Zusammenhang des Bild-Wort-Wirkenden überhaupt möglich macht.
1 Konjektur heißt Vermutung, und wurde schon Nikolaus von Kues in seinem Buch De Conjectura so benannt. Es geht um ein Denken in – jedoch sehr präzisen, fast mathematischen – Vermutungen (es sind trotzdem freie Vermutungen, die sich immer mehr zu etwas Zutreffendem hin verdichten, bis ein letztlicher Schluss feststeht).
2 Lacan, J., Lettres de L’Ècole freudienne, Nr. 16 (1975) S. 192 Auf dieses auch ‚autochthones Genießen‘ zu nennende Substanzielle gehe ich später noch ein.
3 Ruhs, A., Das unbewusste Sehen, Locker-Verlag (1989)
4 So haben einige Tiere den Totstellreflex erst spät erlernt und üben ihn nunmehr ganz instinktiv aus.
5 Lacan, J., Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, Walter Verlag (1980) S. 117. Freud spricht hier auch von direkter Triebrepräsentanz (GW X, S. 254).
6 Lacan, J., Das Drängen des Buchstaben im Unbewussten, Olten (1975)
7 Im Folgenden setze ich noch reichlich dieser Betonung des Bild-Wirkenden den psychoanalytischen Schwerpunkt des Wort-Wirkenden entgegen, bezüglich dessen Lacan den gleichwertigen Begriff des (verbalen) Signifikanten verwendet.
8 Ich schreibe ‚Meer‘ in Anführungszeichen, wenn es nicht nur um den realen Ozean geht, sondern auch und speziell im Zusammenhang damit, um die ‚Vision Meer‘. Den Begriff der Minne muss man mit ‚ekstatischer Liebe‘ übersetzen.
9 Ich erinnere nochmals, dass Lacan mit dem Begriff des ‚fließenden Rhythmus‘ das weibliche Genießen bezeichnete, den originären, weiblichen Eros, die ‚jouissance feminine‘.
10 Lacan, J., Seminar XXI, Vortrag vom 23. 4. 1974.
11 Lacan, J., Seminar XVIII, Vortrag vom 17. 3. 1971
12 Klein, S., Wie wir die Welt verändern, S. Fischer (2021)
13 Bennett, J., Lebhafte Materie. Eine politische Ökologie der Dinge, Matthes & Seitz (2020)
14 Roedig, A., Deutschlandfunk Kultur, Lesart vom 25.6. 2020
15 Köhler-Weisker, A., Gespräche unter dem Mopanebaum, Ethnopsychoanalytische Begegnungen mit Himbanomaden, psycho-sozial Verlag (2015)
16 Blümle, C., Von der Heiden, A., Blickzähmung und Augentäuschung, diaphanes (2005). „Weil das Bild jener Schein ist, der behauptet, er sei das, was den Schein gibt, steht Platon auf gegen die Malerei als eine Aktivität, die mit der seinen rivalisiert. Dieses andere ist das ›klein a‹, um das ein Kampf geführt wird, dessen Seele die Augentäuschung ist“ (Lacan).
17 Barthes, R., Die helle Kammer, Suhrkamp (1989) S. 65f
18 Weitere Erklärungen zu den Pass-Worten später.