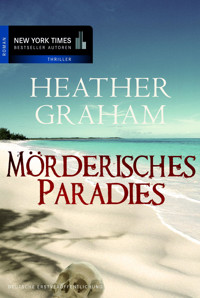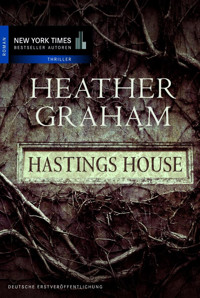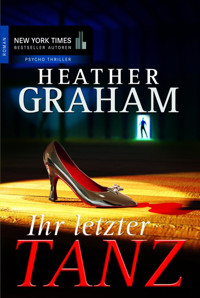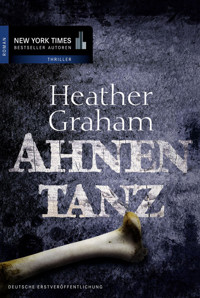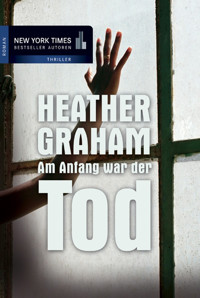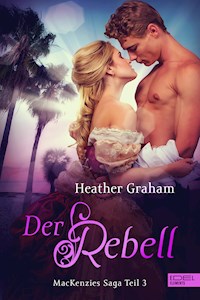6,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Können zwei verfeindete Herzen sich füreinander öffnen? Der historische Liebesroman »Das Begehren des Ritters« von Bestseller-Autorin Heather Graham als eBook bei dotbooks. England, 1483: Die stolze Lady Genevieve würde alles tun, um ihre geliebte Heimat, die prächtige Burg Edenby, zu retten. Doch in den turbulenten Zeiten der Rosenkriege fällt die Burg ausgerechnet in die Hände jenes Mannes, den sie geschworen hat, zu hassen: Lord Tristan. Für seine Verdienste überlässt der König dem kampferprobten Ritter die Burg – und Lady Genevieve als Beute des Siegers. Aber als Tristan die wunderschöne Burgherrin zum ersten Mal erblickt, muss er sich eingestehen, dass er nicht alles im Leben durch Waffengewalt erobern kann – und will. Und auch die unbeugsame Genevieve merkt, dass sie ihre Gefühle nicht immer ihrem Willen unterwerfen kann ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das betörende Historical-Romance-Highlight »Das Begehren des Ritters« von New-York-Times-Bestsellerautorin Heather Graham. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, 1483: Die stolze Lady Genevieve würde alles tun, um ihre geliebte Heimat, die prächtige Burg Edenby, zu retten. Doch in den turbulenten Zeiten der Rosenkriege fällt die Burg ausgerechnet in die Hände jenes Mannes, den sie geschworen hat, zu hassen: Lord Tristan. Für seine Verdienste überlässt der König dem kampferprobten Ritter die Burg – und Lady Genevieve als Beute des Siegers. Aber als Tristan die wunderschöne Burgherrin zum ersten Mal erblickt, muss er sich eingestehen, dass er nicht alles im Leben durch Waffengewalt erobern kann – und will. Und auch die unbeugsame Genevieve merkt, dass sie ihre Gefühle nicht immer ihrem Willen unterwerfen kann ...
Über die Autorin:
Heather Graham wurde 1953 geboren. Die New-York-Times-Bestseller-Autorin hat über zweihundert Romane und Novellen verfasst, die in über dreißig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Heather Graham lebt mit ihrer Familie in Florida.
Eine Übersicht über weitere Romane von Heather Graham bei dotbooks finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Parallelausgabe November 2020
Dieses Buch erschien bereits 1995 unter dem Titel »Dornen im Herzen« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1989 Heather Graham
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel »Lie down in Roses« bei Zebra.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Parallelausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Kit Leong, Phagalley und Mary Chronis Period Images & Dunraven Productions
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-833-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Begehren des Ritters« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Heather Graham
Das Begehren des Ritters
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Malsch
dotbooks.
PROLOG
15. Oktober 1483
»Muß eine Maid ein schönes Antlitz haben?Muß sie das Aug mit Anmut laben?O nein!Sie muß das Leben eines Mannes versüßenUnd freudig seine Leidenschaft begrüßen!«
Übermütig sang Sir Thomas Tidewell die Ballade, schrie sie mit lauter, klarer Stimme dem kühlen Horizont entgegen, der sich allmählich verdunkelte. In seiner Trunkenheit lachte er so heftig, daß er im Sattel seitwärts schwankte. Sicher wäre er vom Pferd gefallen, hätte Jon von Pleasance, der neben ihm ritt, nicht hastig eine Hand ausgestreckt, um ihn festzuhalten. Jon, fast so betrunken wie Thomas, schlang einen Arm um die Schultern seines Freundes. Mühsam hielten sie ihr Gleichgewicht auf den beiden Hengsten und sangen gemeinsam den zotigen Refrain.
»Sie braucht kein schönes Gesicht,Auch Geist und Anmut nicht.Sie muß nur die Lust eines Mannes stillenUnd willig sein Schwert umhüllen!«
Als Jon sich aufrichtete, drohte Thomas erneut aus dem Sattel zu stürzen. Diesmal packte ihn der Anführer der Gruppe, der seine Position geerbt hatte – Tristan de la Tere, zweiter Sohn des Grafen Eustace von Bedford Heath. Freundlich grinste Jon ihn an. Tristan hob die dunklen Brauen, erwiderte das Lächeln und schüttelte resignierend den Kopf. Die drei kamen soeben aus London, wo Tristan in langwierige Diskussionen über die Thronbesteigung Richards III. verwickelt worden war. Konnte man das Ereignis als gesetzwidrige Machtergreifung betrachten? Oder als legitim und notwendig, weil der rechtmäßige Erbe, ein zwölfjähriger Junge, außerstande war, ein Land zu regieren, das die »Rosenkriege« – wie die Poeten sie nannten – verwüstet hatten?
Doch es gab noch andere Schwierigkeiten. Jahrelang hatten verschiedene Mitglieder des Hauses York um die Macht gekämpft und kleinere Scharmützel innerhalb der großen Kriege ausgefochten. Tristans Familie war es gelungen, sich aus den internen Konflikten herauszuhalten. Schon als blutjunger Bursche hatte er für König Edward IV. gegen den »Königsmacher« Warwick gekämpft. Während der Regentschaft Edwards herrschte eine gewisse Ruhe in England. Aber 1483, nach seinem Tod, hatte Richard, Herzog von Gloucester, seinem Neffen, Edwards Sohn und Erben, die Krone entrissen. Nur zu gut wußte Tristan, daß neue Probleme auftauchen würden, und diesmal konnte er sich nicht heraushalten.
»Sing mit, Tristan!« verlangte Jon. »Du kennst doch den Text!«
»Ja, den Text schon«, bestätigte Thomas und rückte seinen Hut zurecht, »aber nicht das Gefühl. Ah, diese schönen Damen, das süße, weiche Fleisch, das wir in Mr. Walcox' Taverne genossen!« Anklagend zeigte er mit einem Finger auf Tristan. »Und du wolltest keine einzige anrühren. Schande über dich, mein Lehnsherr! Vor der Hochzeit warst du ein richtiger Teufel. Keiner wußte seinen Becher Ale schneller zu leeren als du und die hübschesten jungen Dinger zu verführen – mochten es feine Damen oder Huren gewesen sein.«
Wieder zog Tristan die Brauen hoch. Schweigend musterte er seine Freunde, ein schwaches Lächeln umspielte seine Lippen. Zahlreiche Tage im Sattel, Turniere und die wilden Machtkämpfe zwischen den Häusern York und Lancaster hatten diese jungen Männer gestärkt, ihre Muskeln und Herzen gestählt.
Auf Tristans Schultern lastete eine schwere Verantwortung. Sie alle hatten in der Domäne seines Vaters das Licht der Welt erblickt. Jederzeit konnte Graf Eustace ein tausendköpfiges Gefolge zu den Waffen rufen. Bis zum Horizont erstreckten sich seine Felder und Weiden, viel weiter, als das Auge reichte. Die Wolle, die auf seinen Farmen erzeugt wurde, war sogar jenseits des Kanals berühmt.
Eines Tages würde Tristans älterer Bruder den Titel des Vaters und dessen Stellung erben. Aber Tristan hatte sich, im Gegensatz zu vielen jüngeren Söhnen, nicht der Kirche zugewandt und statt dessen große Bedford Heath-Ländereien erhalten. Eustace hatte alle seine Leibeigenen freigelassen, doch Tristan durfte auf die Treue vieler hundert Pächter und Landedelmänner wie Thomas und Jon bauen.
Schon als junger Bursche war er sich seiner Pflichten bewußt gewesen. Er trank zwar gern mit seinen Freunden, gestattete sich aber keinen Vollrausch. Ebensowenig konnte er die Politik außer acht lassen und vergessen, daß die Loyalitäten den Männern manchmal aufgezwungen, manchmal aus freien Stücken gewählt wurden, aber stets einen hohen Preis verlangten.
Während die drei jungen Freunde an diesem Herbsttag nach Hause ritten, schien Frieden zu herrschen. Aber Tristan ahnte, daß seine Landsleute bald wieder kämpfen würden. Richard hatte seinen Neffen entthront, sich der Krone bemächtigt, und das war in London akzeptiert worden. Denn der englische Thron mußte Stärke zeigen.
Auch Tristan hatte sein ursprüngliches Urteil revidiert und die Überzeugung gewonnen, es wäre besser, wenn der ältere, erfahrene Richard das Land regierte – zumindest, bis der rechtmäßige Erbe, ein bockiger Bücherwurm, die nötige Reife erlangte.
Aber dann waren der Knabe und sein jüngerer Bruder aus ihrem Gefängnis im Tower verschwunden. Man munkelte, Richard habe die Ermordung seiner Neffen angeordnet. Als Sohn eines angesehenen Peers hatte Tristan verlangt, die Kinder zu sehen. Richard versuchte, ihn mit Ausflüchten zu beschwichtigen. Aber Tristan ließ sich nicht beirren. Dann übte Buckingham, Richards eifrigster Verfechter vor dessen Machtübernahme, Verrat und zettelte einen Aufstand im Süden an. Tristan hatte es abgelehnt, für die Krone zu kämpfen, und dem König erklärt, er würde erst zu den Waffen greifen, wenn Richard seine Unschuld am Verschwinden der beiden Jungen bewiesen habe. So standen die Dinge, während sie an diesem Abend von London aus nach Norden ritten – Thomas und Jon völlig betrunken, Tristan belustigt, aber auch nachdenklich. Es drängte ihn, endlich das große Schloß zu erreichen, dessen Bau er eben erst vollendet hatte. Es war eher ein komfortables Zuhause als eine Verteidigungsbastion. Dort erwartete ihn seine schöne Gemahlin Lisette.
»Schau dir sein Gesicht an, Jon!« rief Thomas angewidert. »Der Mann findet keinen Geschmack mehr an vergnüglichen Ausschweifungen und kann nur noch an sie denken!«
Jon lachte. »Nun, auch ich würde an sie denken, wäre sie mein eigen.«
»Aber sie ist seine Frau«, klagte Thomas. »Gattinnen, pah! Verzärtelte kleine Dinger von edlem Geblüt, die nichts weiter in die Ehe mitbringen als ihren Reichtum! Tristan, lieber Freund, du sollst dich nicht mit ihr amüsieren. Dafür sind die netten Huren in den Tavernen da.«
Lachend lenkte Tristan sein Pferd näher an Thomas heran und schlang einen Arm um die Schultern des jüngeren Mannes. »Da irrst du dich. Bei einer Hure finde ich nur käufliche Liebe, und die ist niemals so exquisit wie jene, die mir willig geschenkt wird. Meine Frau liebt mich. Freudig begrüßt sie mich, wann immer ich heimkehre. Und wie schön sie ist mit ihren strahlenden Augen! Nein, Thomas, wie könnte ich jemals eine andere begehren? Sie duftet so süß, und ihre Haut schmeckt sauber wie die Frühlingsluft, während deine Huren wie ein Saustall stinken.«
»Die Ehe hat ihn völlig verdorben«, beschwerte sich Thomas bei Jon. Wieder brach Tristan in lautes Gelächter aus und warf den Kopf in den Nacken. Jon schaute ihm grinsend in die Augen, die nun nachtschwarz wirkten, obwohl sie normalerweise indigoblau schimmerten.
In der Tat, Tristan und Lisette waren ein beneidenswertes Paar. Die Eltern hatten die Heirat arrangiert. Aber nun lebten sie schon seit sechs Monaten glücklich zusammen, der große, bärenstarke, attraktive Tristan und die schöne Lisette mit ihrem glänzenden dunklen Haar, der sanften Wesensart, der melodischen Stimme und dem Gesicht eines Engels. Um das Glück noch zu vervollkommnen, erwartete sie bereits den Erben ihres Mannes.
Thomas verdrehte die Augen. »O Gott, er spricht wie ein Dichter, Jon!« Dann lächelte er den Mann an, dem er die Lehnspflicht schuldete. »O ja, sie ist schön, Tristan, und süß und gut. Doch das Vergnügen, das wir nun meinen ...«
»Was weißt du schon von Tristans Glück?« fiel Jon ihm fröhlich ins Wort. »Nachdem du eine reiche Witwe mit Schnurrbart heiraten mußtest!« Da mußte Tristan wieder lachen. In der Tat, Thomas' Frau war die Tochter eines reichen Kaufmanns und häßlich wie die Nacht, aber geistreich und witzig, und Tristan mochte sie. Ein Jahr nach der Hochzeit hatte sie ihrem Mann einen gesunden, kräftigen Sohn geschenkt, also durfte Thomas sich nicht beklagen.
»Mögen dich die Pocken befallen, Jon!« rief Thomas. »Und möge deine künftige Gattin so frigide sein wie eine Nonne!«
Jon wollte protestieren, doch die Worte blieben ihm in der Kehle stecken, als er Tristans gerunzelte Stirn sah. Und dann erkannte er, was den Unmut seines Herrn erregte. Sie hatten eine Hütte an der Grenze von Tristans Ländereien erreicht, die niedergebrannt war. Daran gab es trotz der Dunkelheit keinen Zweifel. In der Nachtluft stieg immer noch Rauch empor. Erbost spornte Tristan seinen Hengst an. Jon und Thomas, sofort ernüchtert, galoppierten hinter ihm her.
Vor der Hütte angekommen, sprang er aus dem Sattel, beugte sich über einen alten Bauern und berührte ihn am Hals. Dann richtete er sich auf. Das Blut, das seine Finger befleckte, war noch warm. Auch Jon und Thomas stiegen ab. Mit schnellen Schritten ging Tristan zu der qualmenden Ruine, blieb auf der Schwelle stehen, und Jon trat an seine Seite. Erstaunt stellten sie fest, daß die Einrichtung zerstört worden war, bevor man das kleine Haus angezündet hatte.
Hinter ihnen hielt Thomas den Atem an. Alle drei entdeckten die Frauenleiche. Entsetzt eilte Tristan zu ihr und kniete nieder. Sie war entkleidet und brutal überfallen worden, dann hatte man sie in den Flammen sterben lassen. »Mein Gott, warum?« stieß Tristan hervor. »Ned war nur ein einfacher Bauer, der seine Felder bestellte, und Edith – seine Frau ...«
Deutlich lasen Jon und Thomas die Angst im Gesicht ihres Freundes. Er sagte nichts mehr, lief zu seinem Pferd zurück und schwang sich in den Sattel. Wenig später galoppierte er mit seinen Begleitern die Straße hinab.
Ein niederträchtiger Mord, an armen, harmlosen Bauern verübt ... Was würde die drei Männer im Schloß erwarten? Herbstlicher Torf wirbelte unter den Hufen auf. Bald sahen die Reiter weitere Rauchwolken vor dem dunklen Himmel. Verwüstet lag das Land vor ihnen, die Hütten verbrannt, die Gärten zertrampelt, die Zäune niedergerissen. Und überall Leichen ...
Endlich erreichten sie die Straße, die zum Schloß führte, zu dem schönen neuen Gebäude, für ein friedliches Leben errichtet. In ungläubigem Grauen starrte Tristan auf seine toten Ritter hinab. Sie lagen auf der Brücke des Burggrabens, und im blutigen Wasser trieben die enthaupteten Schwäne, die Lisette so geliebt hatte.
Im Hof stiegen die Reiter ab. Vor dem Haustor war der treue Hauptmann zusammengebrochen, der die Schloßwache befehligte, offenbar unfähig, die Angreifer abzuwehren. Tristan sank auf die Knie und nahm den blutenden Kopf in die Arme. »Sir Fielding! Ich bin's – Tristan. Seht Ihr mich? Könnt Ihr sprechen?«
»Ah, mein Herr ...« Der Hauptmann umklammerte Tristans Hand. »Verzeiht uns!« keuchte er. »Wir haben versagt ... Bewaffnete Männer ohne Kennzeichen und Flaggen stürmten das Schloß, verwüsteten alles und mordeten – und erklärten nicht, warum ...« In seinen Augen schimmerten Tränen.
Hastig beruhigte ihn Tristan. »Und meine Lady, Sir Fielding?«
»Das weiß ich nicht ...«
Zusammen mit Jan rannte Tristan in die Halle, wo die Stille des Todes herrschte. Er stieg über eine von Lisettes Zofen hinweg, ein junges Mädchen, gnadenlos niedergemetzelt, die Röcke über den Kopf gezogen. Welches Grauen mochte ihrem Tod vorangegangen sein? Tot oder sterbend lagen die Wachtposten in ihrem Blut.
»Lisette!« schrie Tristan, zwischen Angst und Hoffnung hin und her gerissen. Verzweifelt rannte er die Treppe hinauf, suchte einen Raum nach dem anderen ab, rief immer wieder den Namen seiner Frau und erhielt keine Antwort. Im kleinen Kinderzimmer, das neben seinem Schlafgemach lag und bereits eingerichtet war, fand er Lisette. Sie kauerte neben der Wiege, und eine Hand hing über dem geschnitzten Rand, als wollte sie ein Kind berühren.
»Lisette!« Er brauchte nicht mehr zu schreien. Statt dessen war der Name ein geflüstertes Gebet, eine flehende Bitte. Wie gelähmt stand Tristan da, und es dauerte eine Weile, bis er sich wieder bewegen und zu seiner Frau laufen konnte.
Wie friedlich sie aussah! Vielleicht ... Er kniete nieder, nahm sie in die Arme, und ihr Kopf fiel nach hinten. Da sah er das Blut an ihrem Hals. »Lisette!« Jetzt klang der Name wie ein wilder Schmerzensschrei. Fassungslos wiegte er die schlaffe Gestalt hin und her.
Jon beobachtete erschüttert, wie sein Freund das Haar der Toten streichelte, und wagte nicht zu sprechen, obwohl Tristan alles erfahren mußte.
Und dann war es der Schloßherr, der das Schweigen mit stahlharter Stimme brach. »Was ist geschehen?«
Jon schluckte krampfhaft. »Geoffrey Menteith liegt verwundet vor dem Kamin in der Halle. Grundlos, ohne Vorwarnung, wurde das Schloß von unbarmherzigen Männern angegriffen. Unsere Soldaten kämpften tapfer, mußten sich aber geschlagen geben ...« Er verstummte, denn seine Stimme drohte zu versagen.
»Verdammt, erzähl mir alles!« schrie Tristan.
»Auch dein Vater ist tot. Und dein Bruder, seine Frau, sein kleiner Sohn ...«
Reglos kniete Tristan am Boden, Lisette immer noch an sich gedrückt. Er spürte ihr warmes Blut, das Blut seines ungeborenen Kindes.
In einer Ecke erklang leises Weinen, und Jon eilte hinüber. Hinter einem umgestürzten Schrank fand er eine Zofe Lisettes. Schluchzend warf sie sich in seine Arme. Es dauerte eine Weile, bis sich das junge Mädchen einigermaßen gefangen hatte und sprechen konnte. »O Mylords! Wie meine Herrin schrie und um Gnade flehte! Im Flur fielen sie über Mylady her, aber es genügte ihnen nicht, ihr Gewalt anzutun. Auf Knien bat sie um ihr Leben – um das Leben ihres Kindchens. Und dann wurde sie – hierhergejagt.«
Behutsam ließ Tristan die Leiche seiner Frau zu Boden gleiten, und was er nun sah, raubte ihm fast den Verstand. Da lag sein Sohn, nach sechs Monaten im Mutterleib tot geboren. Jon folgte dem Blick seines Lehnsherrn.
»Allmächtiger!«
Wortlos hob Tristan seine Frau und das Baby hoch, trug sie in sein Gemach hinüber und legte sie aufs Bett. Jon versicherte dem Mädchen, die Angreifer seien verschwunden. Dann eilte er Tristan nach, der zielstrebig die Treppe hinablief, zu Fielding.
Eine Frau, die sich während der Attacke im Wald versteckt hatte, gab dem Hauptmann gerade zu trinken. »Einer der Männer sagte, Ihr sollt Euch nie wieder nach den beiden Prinzen im Turm erkundigen, Lord Tristan. Und Richard sei sicher sehr zufrieden mit den Ereignissen dieses Tages.«
»Großer Gott!« rief Jon bestürzt. »Niemals würde der König ein solches Gemetzel befehlen.«
Müde blickte Fielding zu ihm auf. »Vielleicht nicht, aber wenn ein Mann die Gunst der Krone erringen will und auf eigene Faust handelt ...«
»Wann sind sie weggeritten?« fragte Tristan mit gepreßter Stimme. »Und wohin?«
Er müßte weinen, dachte Jon. Niemand kann ein solches Leid stumm erdulden, und Tränen würden ihm helfen.
Aber die Augen des jungen Witwers, des neuen Grafen von Bedford Heath, blieben trocken. Aufmerksam hörte er sich Fieldings Bericht an. Inzwischen waren die Wachtposten von den nördlichen Grenzen der Ländereien ins Schloß gekommen. Verwundete wurden verbunden. Im Hof versammelten sich die Bauern, Handwerker und Diener, die vor den Angreifern geflohen waren.
Tristan mußte keine Anweisungen geben. Bald stand ein berittener, bewaffneter Trupp bereit, dem sich auch einige Verletzte anschlossen, und brach unter der Führung des Schloßherrn auf. Mühelos fanden sie die Spur der Mörder und holten sie um Mitternacht ein. Tristans Männer waren in der geringeren Zahl, doch der Zorn verlieh ihnen ungeahnte Kräfte. Beflügelt von wilder Rachsucht, schwangen sie Schwerter und Schlagkeulen, angespornt von ihrem Lord, der die Feinde wie Bäume fällte.
Nur drei Gefangene blieben am Leben, armselige Gestalten, die sich furchtsam krümmten, denn sie wußten, daß sie keine Gnade erhoffen durften. Eifrig beteuerten sie, Tristans Frau und sein Vater seien nicht durch ihre Hand gestorben.
»Wer hat den Überfall angeordnet?« fragte er.
Nach kurzem Zögern antwortete einer der Männer: »Sir Martin Landry, den Ihr soeben getötet habt, Lord Tristan. Bitte, seid barmherzig! Er behauptete, der König habe ihm seinen Segen gegeben.«
Daß Richard hinter dem brutalen Angriff steckte, glaubte Tristan noch immer nicht. Der König, der ihm zürnte, mochte auf Vergeltung sinnen, würde aber niemals Frauen und Kinder niedermetzeln lassen. Andererseits trug er vielleicht die Schuld am Tod seiner eigenen Neffen. Und er konnte den Überfall auf Bedford Heath befohlen haben, ohne zu ahnen, welcher Abschaum seinen Wunsch erfüllen würde.
»Was sollen wir mit ihnen machen?« fragte Jon. Bedrückt stand Thomas neben ihm. Im Schloß hatte er auch die Leiche seiner Frau gefunden, der häßlichen, aber geistreichen und amüsanten Mutter seines hübschen Sohnes.
»Gnade!« schrie einer der Gefangenen, und Tristan fuhr empört zu ihm herum. Doch ehe er etwas unternehmen konnte, stach Thomas den Mann nieder.
Jetzt waren nur noch zwei am Leben, und einer warf sich Tristan auf die Knie. »Tötet mich nicht! Es war Drew, der in Euer Schloß eindrang, Eure Frau vergewaltigte und neben der Wiege zu Boden schleuderte ...«
Erschrocken verstummte er, denn der Blick des jungen Grafen jagte ihm kalte Todesangst ein. Tristan hatte bemerkt, daß der Mann nicht verwundet und trotzdem blutüberströmt war. Und wenn er Lisette nicht überfallen hatte, wie konnte er wissen, daß sie neben der Wiege gekauert hatte?
»Ich habe sie nicht getötet, es war Drew ...«
»Lügner!« fiel Drew seinem Spießgesellen ins Wort. »Du nahmst sie zuerst, und jetzt klagst du mich an ...«
Angewidert und verächtlich wandte Tristan sich ab. Nie zuvor hatte er so abgrundtiefen Haß empfunden.
»Beide sind gemeine Mörder, Tristan«, betonte Jon. »Und sie verdienen den Tod.«
Ein schneller Tod ist zu barmherzig, dachte Tristan. Aber es gibt keine Folterqualen, die schlimm genug wären, um dieses Verbrechen zu sühnen ... Und so nickte er nur. »Hängt sie auf.«
Schweigend ritt er an der Spitze seines Trupps nach Hause. Die Blutlachen waren weggewaschen, die Leichen von sanften Händen gereinigt, vom Priester gesalbt. Bald würde er die Totenmessen lesen und um ihr Seelenheil beten.
In dieser Nacht blieben Jon und Thomas bei Tristan. Er aß und trank nicht, und er schlief und weinte nicht. In seinem Innern braute sich zorniger Rachedurst zusammen wie ein Gewittersturm.
Bei Tagesanbruch küßte er die aschfahlen, kalten Wangen seines stolzen Vaters, seines Bruders und seiner Schwägerin. Er küßte auch Thomas' häßliche Frau – und Lisette, die er ein letztes Mal in die Arme nahm. Dann ordnete er an, sie solle zusammen mit seinem kleinen Sohn bestattet werden.
Er wartete die Begräbnisse nicht ab und vertraute Thomas die Verwaltung des Schlosses an. Sein Entschluß stand fest. Begleitet. von Jon, mehreren Rittern und Knappen würde er die Bretagne aufsuchen, wo Henry Tudor, der Thronanwärter aus dem Hause Lancaster, seine Streitkräfte sammelte und Vorbereitungen traf, um Richard III. die englische Krone zu entreißen. Sicher würde er Tristan willkommen heißen.
1
15. August 1485
»Verdammt!« fluchte Edgar und schleuderte das Pergament ins Kaminfeuer, dann richtete er seinen Zorn gegen den Boten, der ihm die Nachricht überbracht hatte. »Ich soll das Regiment eines Heeres ernähren, das meinen König bekämpfen wird? O nein, junger Mann, ich werde diesen Tudor-Emporkömmling abwehren, mit aller Macht! Sagt das Eurem Kommandanten, diesem Lord de la Tere. Und es bleibt bei meiner Entscheidung, mag er auch mein Schloß niederbrennen und mich den Geiern zum Fraß vorwerfen!«
Leichenblaß wandte sich der Mann ab und floh aus der Burg. Edgar Llewellyn, Lord von Edenby Castle, grinste seine Tochter voller Genugtuung an. »Schade, daß man einen Boten nicht mit gezücktem Schwert bedrohen kann ...«
Genevieve saß vor dem Kamin in der Halle und streichelte seufzend die langen Ohren eines großen Hundes. Ehe sie den Blick ihres Vaters erwiderte, schaute sie ihre Tante Edwyna und ihren Verlobten Axel an. »Lassen wir's dabei bewenden. Die bedeutsamsten Herzöge, Grafen und Barone dieses Landes tun ihr Bestes, um sich aus dem Streit herauszuhalten. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen und abwarten ...«
»Abwarten!« schrie Edgar erbost. Er war ein großer Mann mit blondem, kaum ergrautem Haar, strotzend vor Kraft, von einem wilden Temperament erfüllt. Aber er wußte, daß seine Tochter niemals vor ihm zittern würde. Das tat sie auch jetzt nicht. »Als Richard den Thron bestieg, schwor ich ihm einen Eid und gelobte, ihn stets zu unterstützen, auch mit Waffengewalt. Genau das habe ich jetzt vor, mein Kind. In ein paar Tagen reiten wir los, um den König zu treffen, und dann werden wir diesen elenden Tudor zur Strecke bringen.«
Sie lächelte sanft. »Aber Henrys Standarte zeigt den roten Drachen von Wales ...«
»Noch haben ihm die walisischen Lords keine Treue geschworen, Mädchen. Hör auf, mich herauszufordern!«
Axel, der an Genevieves Seite in die Flammen gestarrt hatte, zwinkerte ihr zu. In respektvollem Ton sprach der hochgewachsene, gebildete Mann. »Mylord Edgar, meine schöne Braut hat recht. Denkt doch an Henry Percy, den Grafen von Northumbria! Sein Urgroßvater fiel im Kampf gegen Henry IV., sein Vater in Towton, und die Grafschaft wurde konfisziert. Percy bekam sie 1470 zurück, und jetzt ist es ihm völlig gleichgültig, wer die Krone trägt.«
»Er wird sich an Richards Seite stellen«, behauptete Edgar.
»Ja, aber wird er auch für den König kämpfen?« warf Genevieve ein.
»Zum Teufel, kleines Mädchen, ich hätte dich niemals lehren dürfen, über Politik zu diskutieren«, sagte Edgar, aber das Lächeln, das er seiner Schwester schenkte, strafte seine Worte Lügen. Er war stolz auf Genevieve, seine Erbin.
Edwyna, an der Politik völlig desinteressiert, lächelte vage zurück und neigte sich wieder über den Wandteppich, den sie für das Schlafzimmer ihrer kleinen Tochter webte. Nur knapp zehn Jahre älter als Genevieve, war sie bereits Witwe. Seit dem Tod ihres Mannes lebte sie bei ihrem Bruder. Genevieve liebte sie wie eine Schwester und fand in ihr eine gleichgesinnte Freundin, die sich stets um Ruhe und Frieden bemühte.
Zärtlich streichelte Edgar das lange goldblonde Haar seiner Tochter. Wieder einmal bewunderte er ihre Schönheit, ihre Augen, die silbrig wie Mondstrahlen glänzten. Viel zu schmerzlich erinnerte sie ihn an seine Frau, die er innig geliebt und zu früh verloren hatte. Auch in ihrem Wesen glich Genevieve ihrer Mutter – stolz und gütig, klug und pflichtbewußt. Er neigte sich über die Lehne ihres Stuhls.
»Vergiß nicht, du hast mich begleitet, als ich nach London gereist bin, um vor Richard meinen Treueid abzulegen. Möchtest du, daß ich mein Wort breche?«
»Nein, Vater, aber die meisten Adelsfamilien wollen neutral bleiben. Und wenn der Kampf jahrelang dauert, werden letzten Endes keine Peers übrigbleiben.«
»Für einen neuen König wäre das kein Problem«, bemerkte Axel trocken. »Er würde einfach andere Leute in den Adelsstand erheben.«
»Wie auch immer, ich habe geschworen, für Richard zu kämpfen«, erwiderte Edgar. »Wenn es an der Zeit ist, führe ich die Ritter von Edenby aufs Schlachtfeld. Ich nehme an, Ihr werdet Euch anschließen, Axel.«
Zustimmend verneigte sich der junge Mann, und Edgar verließ die Halle. Edwyna verkündete, nun müsse sie nach Anne, ihrer fünfjährigen Tochter, sehen. Und so blieb das Paar allein zurück.
Genevieve musterte ihren sanftmütigen, intelligenten Verlobten, dem sie sehr zugetan war. Ernsthaft und bedächtig pflegte er alle Angelegenheiten gründlich zu erwägen, bevor er sich dazu äußerte, und er versäumte es niemals, auch die Meinung seiner Braut zu hören. Sie betrachtete ihn als guten Freund, mit dem sie den Rest ihres Lebens höchst angenehm verbringen würde. Zudem war er ein hübscher, kraftvoll gebauter Ritter mit freundlichen haselnußbraunen Augen und dem weizenblonden Haar. Vor allem aber respektierte sie seine Gelehrsamkeit. Die Mathematik beherrschte er ebenso wie mehrere Fremdsprachen.
Aufmerksam beobachtete sie seine Miene. »Irgend etwas bedrückt dich, Axel.«
Er zuckte unglücklich die Schultern. »Darüber spreche ich nicht gern«, entgegnete er und warf einen Blick auf Griswald, der aus der Küche gekommen war, um die Fackeln an der Wand zu entzünden. Genevieve erhob sich. Ihre seidenen Röcke raschelten leise, als sie zu dem alten Diener eilte und ihn bat, etwas Wein zu bringen. Er gehorchte, dann zog er sich diskret zurück.
Während sie am Tisch saßen und Wein tranken, wartete Genevieve geduldig, bis ihr Verlobter das Schweigen brach. »Natürlich werde ich mich nicht gegen deinen Vater stellen«, begann er zögernd. »Auch ich habe Richard die Treue geschworen. Aber wie kann man einem König gehorchen, der seine eigenen Neffen ermorden ließ?«
»Das ist nicht erwiesen, Axel, und es steht nicht einmal fest, daß sie tot sind.« Sie erinnerte sich an ihre Begegnung mit Richard, der sie tief beeindruckt hatte. Wenn er auch eher schmächtig gebaut war, so besaß er doch faszinierende Augen und markante Züge, die deutlich zeigten, daß er das ganze Ausmaß seiner Verantwortung kannte. Nach Genevieves Ansicht trug er die Krone keineswegs widerrechtlich. Ganz England war gegen die Woodvilles gewesen, die Familie des »rechtmäßigen« Erben, seines Neffen. Zahlreiche Leute, vor allem die Kaufmänner, hatten Richard angefleht, die Macht zu übernehmen, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen, den Handelsgeschäften eine neue Grundlage zu verschaffen.
Nein, diesem respektablen Mann, dem sie in London gegenübergestanden hatte, traute sie keinen Mord zu. Auch sie schuldete ihm ihre Loyalität. Und daran würde sich nichts ändern, es sei denn, seine Gegner konnten beweisen, daß er den Tod der beiden Prinzen verschuldete. Leise fragte sie: »Werden wir jemals die Wahrheit erfahren?«
Axel ergriff ihre Hand und lächelte wehmütig. »Das spielt keine Rolle. Vorerst wird Richard regieren. Sicher, Henry ist mit seinen Truppen gelandet, aber nicht einmal die walisischen Lords, die ihm ihre Loyalität versprochen haben, stellen sich neben seine Standarte. Und Richards Heer ist in der Überzahl ... Ach, Genevieve, reden wir nicht von solchen Dingen. Da unsere Hochzeit näher rückt, hatte ich gehofft, du würdest unsere Zweisamkeit nutzen, um mich mit der Beschreibung deines Brautkleids zu erfreuen.«
»Nun, es ist silbergrau und wundervoll. Edwyna hat ein paar Dutzend Perlen darauf genäht. Noch nie im Leben hast du so etwas Schönes gesehen ...«
»Die Frau, die das Kleid tragen wird, ist noch viel schöner als alle Samt- und Seidenstoffe und Perlen dieser Welt«, unterbrach er sie und küßte liebevoll ihre Hand.
»Oh, du Schmeichler!« erwiderte sie lachend. Sie unterhielten sich noch eine Weile, dann erklärte er, jetzt müsse er ihren Vater aufsuchen. Wenn sie in einigen Tagen mit Richards Heer zusammentreffen sollten, gab es noch viel zu besprechen.
Nachdem er ihr einen Abschiedskuß gegeben hatte, starrte sie gedankenverloren ins Kaminfeuer. Ah, ihr Vater ... Wie unerschütterlich er an seinen Überzeugungen festhielt! Halb England würde sich zurückziehen, wenn Richard den Usurpator bekämpfte, aber Edgar nicht.
Plötzlich stieg kalte Angst in ihr auf. Wenn ihr geliebter Vater auf dem Schlachtfeld den Tod fand ... Nein, allzulange würden die Kämpfe nicht dauern. Sicher würde der König seinen Feind bald über den Kanal zurücktreiben. Und doch ... Schmerzhaft hämmerte ihr Herz gegen die Rippen.
»So nachdenklich? Das sieht dir gar nicht ähnlich.«
Seufzend drehte sich Genevieve zu Edwyna um und gestand: »Ich habe Angst.«
Ihre Tante erschauerte. Auch sie fürchtete sich, seit die ersten Gerüchte über Henry Tudors Invasion ins Edenby Castle gedrungen waren. Sie ging zum Kamin und legte einen Arm um Genevieves Schultern. »Von meinem Fenster aus sah ich, wie Edgar, Axel, Sir Guy und Sir Humphrey im Hof Kriegsrat hielten. Soeben schickten sie zweihundert Mann zu Richard. Und so, wie ich meinen Bruder kenne, läßt er dem König ausrichten, er würde ihm bald persönlich zur Seite stehen.«
»Nie zuvor mußte ich um das Leben meines Vaters bangen. O Edwyna, ich liebe ihn so sehr ...«
»Sicher wird Richard ihn beschützen. Und was auch immer geschehen mag – du kannst Edgar nicht zurückhalten. So sind die Männer nun einmal. Für ihre Ehre tun sie alles.«
»Die Frauen etwa nicht?«
Lächelnd ging Edwyna zum großen Tisch und schenkte sich einen Becher Wein ein. »In manchen Fällen muß man die Ehre opfern.«
»Was redest du da?« rief Genevieve entrüstet. »Immerhin hast du mir beigebracht, was Ehre bedeutet!«
»O ja, und ich betrachte mich auch als ehrenwerte Frau.« Edwyna prostete ihrer Nichte zu. »Aber die Liebe ist viel wichtiger. Meine Tochter liebe ich heiß und innig. Und sollte Edgars Ehre der Preis für das Leben oder die Sicherheit meines Kindes sein, würde ich ihn gern bezahlen. Das wirst du verstehen, wenn du selber Kinder hast.«
Genevieve wandte sich wieder zum Feuer.
»Natürlich weiß ich, was Liebe ist.«
»Ach ja, Axel ... Hast du die traute Zweisamkeit mit deinem jungen Ritter genossen?«
»Nun, wir haben uns angeregt unterhalten.«
»Gewiß wirst du ein sehr schönes Hochzeitsfest feiern. Hast du Angst?«
»Ein wenig«, gestand Genevieve.
»Aber du zögerst nicht? Ich war stets glücklich über die Wahl deines Vaters, denn er hat einen wunderbaren Mann für dich ausgesucht.«
»Nein, ich zögere nicht, es ist nur ...« Genevieves Wangen röteten sich. »Er achtet mich, und ich bewundere ihn. Wirklich, ich liebe ihn sehr. Und ich male mir oft aus, wie wir abends vor dem Kamin sitzen und Wein trinken, über den Mummenschanz zu Weihnachten lachen und fröhlich miteinander speisen werden. Es ist nur ...«
»Nur – was?« drängte Edwyna.
»Aber, ach, ich weiß nicht!« Impulsiv lief Genevieve zu ihrer Tante. »Irgend etwas, das in all den schönen Balladen und Sonetten besungen wird ... Kommt es ganz von selbst, wenn man verheiratet ist, Edwyna? Dieses Wunder, dieses geheimnisvolle Gefühl, vor Sehnsucht nach einem Kuß zu vergehen ...«
»Offensichtlich bist du in den Gedanken an die Liebe verliebt. Aber die Liebe selbst ist stiller, tiefer und dauerhafter. Wovon du redest ...«
»Ja?«
»Das ist Leidenschaft«, erklärte Edwyna unbehaglich und setzte sich, um wieder an ihrem Wandteppich zu arbeiten. Sie ergriff die Nadel und schaute träumerisch vor sich hin. »Nach Leidenschaft solltest du nicht streben, Genevieve. Letzten Endes stürzt sie einen nur ins Unglück. Sei froh, daß Axel ein sanfter, rücksichtsvoller Mann ist ...«
»Hast du die Leidenschaft erlebt, Edwyna?« fiel Genevieve ihr ins Wort und kniete zu ihren Füßen nieder.
Forschend blickte Edwyna in die silberblauen Augen ihrer Nichte, und was sie darin las, weckte gewisse Bedenken. War Axel wirklich der Richtige für Genevieve? Sicher, ein untadeliger Mann, aber eher ein Gelehrter als ein stürmischer Ritter, vielleicht zu sanft für dieses heiße Temperament ...
Doch dann zwang sich Edwyna, die Frage des Mädchens zu beantworten. Sie lachte leise. »Meine erste Begegnung mit der Leidenschaft? Nun, damals verstand ich nicht, wie irgend jemand auf dieser Welt Liebesgedichte schreiben kann. Aber später ...«
»In deiner Ehe hast du Freude an der wahren Leidenschaft gefunden? O Edwyna! Das wünsche ich mir auch! Einen Mann, der mich so liebt wie Lancelot seine Guinevere, wie Paris seine Helena!«
»Eine zerstörerische Liebe ...«, warnte Edwyna.
»Das ist romantische Liebe!« entgegnete Genevieve. »Werde ich sie in der Ehe kennenlernen?«
Wie sollte Edwyna diese Frage beantworten? Sie selbst hatte niemals jene Liebe verspürt, die Poeten inspirierte, die einer Frau den Schlaf raubte und ihr Herz höher schlagen ließ. Ihre Ehe war in ruhigeren Bahnen verlaufen und trotzdem glücklich gewesen. Aber die echte Leidenschaft kannte sie nicht, um so besser die Einsamkeit, die sie seit Philips Tod quälte. Unsicher wich sie dem Blick ihrer Nichte aus und gab vor, sie müßte mühsam ihre Fäden entwirren. »Da du dich so gut mit Axel verstehst ...«
Plötzlich flog die Tür der großen Halle auf, und Edgar stürmte herein, dicht gefolgt von Axel, Sir Guy und Sir Humphrey. »Bei Gott, das dulde ich nicht!« donnerte er. Hochrot vor Wut schleuderte er seine Panzerhandschuhe auf den Tisch und schrie nach Griswald, dem er befahl, kalten Braten und Ale zu bringen.
»Was hast du denn, Vater?« Genevieve sprang auf und eilte zu ihm. Verwirrt starrte sie Sir Humphrey an, Edgars lieben alten Freund, und den jungen, hübschen Sir Guy, Axels guten Kameraden.
»Glaub mir, dieser Tristan de la Tere wird noch bitter bereuen, daß er jemals zur Welt gekommen ist! Schau dir diese Nachricht an, meine Tochter!«
Als sie sich zu Axel wandte und die Brauen hob, zuckte er nur die Schultern und bedeutete ihr, den Brief zu lesen. Sie warf einen flüchtigen Blick auf das erbrochene Siegel, dann rollte sie das Pergament auseinander. Die Handschrift war schwungvoll und kultiviert, die Mitteilung unverschämt und anmaßend.
Das Schreiben war an Edgar Llewellyn, Herzog von Edenby gerichtet. »Mein teurer Lord, ich, Tristan de la Tere, der treue Anhänger Henry Tudors, ersuche Euch eindringlich, Euch anders zu besinnen und Euch mit allem, was Ihr besitzt – mit Eurem Titel, Euren Ländereien und Eurer Ehre – für Henry einzusetzen. Wenn Ihr Euer Schloß und Eure Männer zur Verfügung stellt, so wird niemand in Eurer Domäne Schaden erleiden, das schwöre ich, Sir. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es für Euch wäre, Henry Tudor, dem Lancaster-Erbe der englischen Krone, freundlich zu begegnen. Und so bitte ich Euch, Sir, öffnet Euer Tor und heißt uns an Eurem Tisch willkommen. Mit herzlichen Empfehlungen, Tristan de la Tere, Graf von Bedford Heath, im Auftrag Henry Tudors und des Hauses Lancaster.«
Entgeistert starrte Genevieve ihren Vater an, »Welch eine Frechheit!« Mehr wußte sie nicht zu sagen. Ein kalter Schauer rann über ihren Rücken, so als hätte sie ein unheimliches Gespenst aus seinem Grab steigen sehen.
»Das ist ungeheuerlich!« stieß Edgar hervor. »Dieser Tristan de la Tere soll sofort seine Antwort erhalten. Axel! Werft den Boten hinaus und laßt alle Tore verriegeln! Sir Guy, Ihr holt den Priester. Er soll unsere Männer und die Waffen segnen. Humphrey, wir beide kümmern uns um die Munition. Wir müssen uns beeilen und diesen dreisten Gesandten des Teufels zurückschlagen, mit Pech und Höllenfeuer!«
»Vater«, begann Genevieve, aber er hörte nicht zu, tätschelte die Schulter seiner Tochter und rannte mit großen Schritten davon. Axel warf ihr nur einen kurzen Blick zu, dann heftete er sich an die Fersen des Herzogs.
Beklommen streckte sie einen Arm aus, um die Männer zurückzuhalten, aber es war zu spät. Sie wandte sich zu ihrer Tante, die eine bebende Hand auf ihre Brust preßte. »O Gott, was wird geschehen?«
Das wußten sie bei Einbruch der Dunkelheit. Edenby hatte sich auf die Seite der englischen Krone geschlagen, noch bevor die Schlacht richtig begann. Nun wurde das Schloß von Henrys Männern belagert, die es mit Kanonen und Katapulten und Rammböcken angriffen. Doch die festen Mauern waren allem Anschein nach uneinnehmbar. Während dieser ganzen ersten Nacht schleuderten Edgars Langbögen einen Hagel aus brennenden Pfeilen auf die Angreifer. Glühend heißes Pech rann an den Wänden herab. Auf der Gegenseite flammte Schießpulver auf, Steine und große Felsbrocken prallten gegen das Schloß. Die Schmiede fing Feuer und brannte bis zu den Grundfesten nieder. Dann wurde die Gerberei dem Erdboden gleichgemacht, viele andere hölzerne Nebengebäude fingen Feuer. Aber Edenby war eine starke Festung, die auch der hartnäckigsten Belagerung trotzte. Und Edgar bezweifelte, daß de la Teres Männer noch lange hier ausharren würden, denn Henry brauchte sie in seinem Feldzug gegen Richard.
Ereignislos verstrich die zweite Nacht, aber im Morgengrauen erfolgte eine neue Attacke. Nachmittags erschien ein Bote im Hof, um eine Nachricht von de la Tere zu überbringen, der Edgar aufforderte, sich endlich zu ergeben. »Sir, wie gern würde ich diesen Ort möglichst schnell verlassen! Aber Eure Haltung kränkt Henry, und deshalb hat er uns befohlen, Euer Schloß einzunehmen. Er betont, zwischen den Tudors und den Llewellyns würden schon seit langer Zeit verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, und es verletzt ihn, daß Ihr die Waffen gegen ihn erhebt. Sir, noch einmal beschwöre ich Euch, ergebt Euch, denn ich habe den Auftrag, niemanden in dieser Festung zu schonen, sollten wir uns gezwungen sehen, sie gewaltsam zu erobern. Tristan de la Tere.«
Wütend warf Edgar das Pergament beiseite.
»Dieser Narr! Wir sind es, die niemanden verschonen werden! Begreift Ihr denn nicht, daß diese Burg unbezwingbar ist?«
Offensichtlich nicht, denn die Kanonen und Katapulte attackierten die Mauern auch am dritten Tag, dann am vierten.
An diesem Abend stieg Genevieve mit ihrem Vater und Axel zu den Zinnen hinauf und betrachtete die Felder, wo die Feinde nächtigten. Ihrer Position entnahm Edgar, daß sie beabsichtigten, am nächsten Morgen die Tore mit Rammböcken anzugreifen und die Mauern hinaufzuklettern. Welch eine Niedertracht!
Unglücklich lauschte Genevieve dem Klagen der Verwundeten, dem Schluchzen der eben erst Verwitweten und Verwaisten. Beißender Rauch brannte in ihren Augen, denn die Außengebäude schwelten immer noch.
Wie sie diesen Tristan de la Tere haßte! Wie konnte er es wagen, einfach hier aufzutauchen und Edenby zu bekämpfen? Sie haßte und fürchtete ihn zugleich, weil sie ahnte, daß die Burg diesen starken Streitkräften nicht mehr allzulange standhalten würde. Hätte ihr Vater doch keine Truppen zu Richard gesandt ...
»Gedulden wir uns«, schlug Axel vor, umklammerte die steinerne Brüstung und starrte zu den Lagerfeuern hinab. »Warten wir ab und hoffen, daß Henry die Ritter de la Teres in den Kampf gegen Richard führen wird, ehe sie hier noch mehr Schaden anrichten können. Der König befehligt das größere Heer, und er wird Henry besiegen, dann sind wir gerettet.«
Aber Edgar hatte einen anderen Plan geschmiedet. Mit schmalen Augen betrachtete er eine Schwachstelle an der Mauer, wo die Gegner heraufsteigen würden. »Heute nacht müssen wir hinausschleichen und die Überzahl des Feindes verringern.«
»Nein, Vater!« widersprach Genevieve erschrocken. »Du bist der Herr von Edenby, und du darfst nichts riskieren ...«
»Ich kann keine Männer in meinem Namen in den Kampf schicken, wenn ich sie nicht selbst anführe«, erwiderte er leise und nahm sie in die Arme. Über ihren Kopf hinweg schaute er Axel an. Erst als ihr Bräutigam verschwand, erkannte Genevieve, daß der Vater bereits einem Trupp befohlen hatte, die Burg zu verlassen. Lächelnd blickte Edgar in ihre Augen. »Hab keine Angst, mein Kind. Der Allmächtige steht auf meiner Seite, und ich werde den Feind schlagen.«
Vergeblich versuchte sie, das Lächeln zu erwidern. Sie umarmte ihn, dann kehrten sie in den Hof zurück. Dort beobachtete sie, wie er lautlos über die Mauer stieg, gefolgt von seinen Männern, um das feindliche Lager in der Dunkelheit anzugreifen.
Hoch oben auf dem Wall sah sie Axel stehen. Sie begegnete seinem Blick mit der ganzen Liebe, die ihr Herz erfüllte, und warf ihm eine Kußhand zu. Da sprang er herunter, rannte zu ihr und riß sie an seine Brust. Hungrig preßte er seinen Mund auf ihren und jagte heiße Wellen durch ihre Adern.
Jäh ließ er sie los, und die Nacht verschluckte ihn, während sie unter Tränen lächelte. Das ist also Leidenschaft, dachte sie, das ist Liebe, diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach immer neuen Küssen ...
Bei dieser Erkenntnis fühlte sie sich so einsam wie nie zuvor. Edwyna lag bei ihrer kleinen Tochter, um sie in den Schlaf zu wiegen. Und der Priester konnte Genevieve nicht Gesellschaft leisten, denn zu viele schwerverwundete Krieger warteten auf die Letzte Ölung.
Sie war allein in der Stille ... Und dann hörte, sie das gellende Geschrei, den. Schlachtenlärm. Angstvoll wartete sie, und sie wußte nicht, wieviel Zeit verstrichen war, bis die Männer ihren Verlobten in den Hof zurückschleiften. »Axel! O Gott, nein!«
Mit gesenkten Köpfen umstanden die Männer den toten Freund. Sir Humphrey räusperte sich und versicherte, Axel habe tapfer gekämpft. Ungläubig kniete Genevieve nieder, strich über Axels fahle Wange, starrte ihre blutbefleckten Finger an, die eine tiefe Stichwunde in seinem Hals berührt hatten.
Doch das Grauen dieser Nacht war noch nicht beendet. Sichtlich verzweifelt berichtete Sir Guy, Lord Edgar von Edenby sei nicht mit seinen Leuten zurückgekehrt. Nun wollte der junge Ritter mit Sir Humphrey aufbrechen, um ihn zu suchen, aber Genevieve bestand darauf, das Kommando zu übernehmen. »In Abwesenheit meines Vaters steht die Festung unter meinem Befehl«, erklärte sie kühl. Und obwohl alle Männer protestierten, stieg sie über die Mauer und eilte zwischen den Gefallenen umher. Und dann fand sie ihren Vater, der tödlich verwundet war, aber noch lebte. Weinend sank sie auf die Knie, nahm ihn in die Arme, wischte mit ihrem Rock das Blut von seinem Gesicht. Inständig flehte sie ihn an, bei ihr zu bleiben und beteuerte, alles würde ein gutes Ende nehmen.
»Liebste Tochter – süßes Kind, mein Engel ...«, keuchte er. Kraftlos strichen seine zitternden Finger über ihre Wange. »Jetzt bist du die Herrin von Edenby ...«
»Nein, Vater, ich werde deine Wunden baden ...«
»Du badest sie bereits mit deinen Tränen«, erwiderte er sanft. »Nun muß ich sterben, und ich hinterlasse dir voller Stolz meine Ehre, meine Loyalität. Sei guten Mutes, sorge für die Menschen, die dir dienen. Und ergib dich niemals! Meine treuen Untertanen sollen nicht umsonst in den Tod gehen. Du mußt siegen, Genevieve. Und Axel wird dir zur Seite stehen ...«
Seine Stimme erstarb, seine Augen brachen. Schluchzend preßte Genevieve ihren toten Vater an sich. Er hatte nicht gewußt, daß Axel schon vor ihm ins Jenseits gegangen war, daß sie ganz allein zurückbleiben mußte.
Sir Guy eilte zu ihr und zog sie auf die Beine. »Bitte, Genevieve, wir müssen in die Burg zurückkehren. Hier draußen lauert immer noch der Feind ...«
»Nein, niemals werde ich meinen Vater den Aasgeiern überlassen!«
Und so trugen sie Edgar in den Hof. Wieder stieg Genevieve zu den Zinnen hinauf. Und während die Nachtluft ihre tränennassen Wangen kühlte, gelobte sie dem Geist ihres toten Vaters, sich niemals zu ergeben. Genauso inbrünstig schwor sie ihrem Verlobten, daß sein Tod und das Ende ihrer Liebe nicht sinnlos gewesen waren.
»De la Tere!« rief sie in die Finsternis. »Tristan de la Tere! Ich werde dich vernichten, das verspreche ich dir!«
Erschöpft lehnte sie den Kopf an die steinerne Brüstung. Trotz ihres tapferen Entschlusses verlor sie beinahe den Mut. De la Tere würde sie unentwegt angreifen. Und sie konnte ihm zuwenig entgegensetzen.
Aber sie würde Mittel und Wege finden – und sich niemals unterwerfen.
2
Wie ein Sonnenball flog die feurige Kugel in den Himmel. Dann fiel der große Stein herab – in Leinen gewickelt, in Öl getränkt, in Brandgesteckt. Hinter den Steinwällen und Felsbastionen von Edenby Castle erklang gellendes Geschrei. Unentwegt donnerte Tristans Kanone, aber die dicken Mauern hielten ihr stand, und bald wurde das hastig wieder errichtete Katapult erneut betätigt. Die Hölle schien loszubrechen. Zwischen züngelnden Flammen und dem Pulverdampf, der die Gesichter schwärzte, konnte man die Gestalten der Männer, die roten Rosenwappen des Hauses Lancaster kaum erkennen.
Tristan de la Tere saß auf seinem großen Streitroß, in Helm und Rüstung, das Emblem der roten Rose auf dem Umhang. Von seinem Gesicht sah man nur die Augen, dunkel wie die Nacht. Nun verengten sie sich, während er reglos im Sattel saß. Auch sein kampferprobter Hengst rührte sich nicht. Plötzlich fluchte er wütend. »Oh, verdammt! Sind sie wirklich so unvernünftig? Warum ergeben sie sich nicht? Dieses sinnlose Blutvergießen werde ich nicht länger dulden.«
Jon, als stellvertretender Befehlshaber an seiner Seite, wagte einzuwenden: »Leider achten sie den Lancaster-Erben nicht so wie wir, Tristan. Und der Herr von Edenby ist offensichtlich nicht bereit, uns seine Festung zu überlassen.« Wie Tristan hoffte er, der erbitterte Kampf würde bald ein Ende finden. Aber es war ihm unmöglich, einen tapferen Feind nicht zu bewundern, und er verstand sogar dessen Gesinnung.
»Edgar von Edenby muß doch wissen, daß ein großer Krieg bevorsteht.«
»Hm ...« Erschrocken zuckte Jon zusammen, als ein Pferd zusammenbrach, nicht vom Feind getötet, sondern von einer Kanonenkugel getroffen, die ihr Ziel verfehlt hatte. »Du hast den Befehl, diese Burg einzunehmen, von einem König erhalten, der noch nicht auf dem Thron sitzt.«
»Nun, er wird ihn bald ersteigen«, entgegnete Tristan grimmig. »Jon, ich habe alles versucht. Nun wurde ich aufgefordert, keine Nachsicht mehr zu üben, und ich will mich trotzdem barmherzig zeigen. Aber wenn das so weitergeht, werden meine Männer bald in den Wahnsinn getrieben, und womöglich wüte ich selber wie ein Verrückter, wenn ich diese Mauern endlich überwunden habe.«
»Plünderei, Mord und Vergewaltigung – welch großartige Aufträge wurden uns doch erteilt! Einen schönen Silberteller könnte ich übrigens gebrauchen.« Jon grinste. »Und wenn das alles vorbei ist – Wein, Weib und Gesang.«
Statt zu antworten, fluchte Tristan: »Zum Teufel mit diesem Schloß und Edenbys Stolz! Er müßte Henry doch nur seine Treue schwören.« Unmutig betrachtete er die Flammen, die in den blauen Winterhimmel hinaufloderten, die Brustwehr, wo die Männer in ihren schweren Rüstungen ungelenk umherrannten und das Feuer verzweifelt zu löschen suchten.
Die Burg erhob sich auf einer Meeresklippe, an der Vorderseite von einer senkrechten Felswand geschützt. Das Katapult hatte die Mauern erheblich beschädigt, aber Edgar kapitulierte noch immer nicht.
Tristan wandte sich zu seinen müden, schmutzigen, rußgeschwärzten Männern, die unter der Last ihrer Waffen ächzten. Neuer Zorn stieg in ihm auf. Ergebt Euch endlich, Edenby, forderte er ihn in Gedanken auf. Ich will Euch nicht demütigen, aber Ihr laßt mir keine Wahl. Und ich werde siegen! Henry Tudor wird den Thron besteigen!
Voll und ganz setzte er sich für Henry ein, denn er konnte Richard nicht verzeihen. Der König mochte das Gemetzel auf Bedford Heath nicht ausdrücklich angeordnet haben, aber er steckte offenbar dahinter, denn er hatte seinen Groll gegen de la Tere deutlich gezeigt. Und Tristan hatte alles verloren, was ihm lieb und teuer gewesen war. Zwei Jahre später schmerzte die Wunde in seinem Herzen immer noch. Henry Tudor, der Sohn Owens und Thronerbe mütterlicherseits, war ein harter, kompromißloser Mann, aber trotzdem entschlossen, das Blutvergießen zu beenden. Und Richard klammerte sich beharrlich an den Thron.
Doch dies würde ihm nicht mehr lange gelingen. Das Land begann, sich gegen ihn zu wenden, erbost über seine Betrügereien und Täuschungsmanöver. Obwohl Tudor wußte, daß ihm zu diesem Zeitpunkt nur wenige englische Peers im Kampf um die Krone beistehen würden, da sie aus reinem Überlebenswillen die Neutralität bevorzugten, haßte er den Herzog von Llewellyn besonders leidenschaftlich. Sofort nach dessen Weigerung, die Lancaster-Truppe zu beherbergen, hatte Henry befohlen, Edenby Castle einzunehmen. Tristan versicherte ihm, er würde Edgar zur Kapitulation zwingen.
Aber Tudor lachte bitter und betonte, der Mann unterstütze das Haus York schon seit dreißig Jahren. »Einmal nannte er mich ›verrückten Bastard‹, und so denkt er auch heute noch. Er wird sich nicht ergeben – nicht bevor der letzte Rest seiner Mauern zusammengebrochen ist. Sucht ihn zu vernichten, Tristan, ohne Gnade, und wenn Ihr Edenby erobert habt, gehört es Euch.« Eindringlich hatte er hinzugefügt: »Vergeßt nicht, was das Haus York Eurer Familie antat.«
Nein, das würde Tristan nie vergessen. Anderseits wußte er auch, daß der künftige König kein Schlachtfeld voller Leichen sehen wollte. Mochte Henry auch einen persönlichen Groll gegen Edgar hegen, er wünschte sich lebende Untertanen – Bauern, die Felder bebauen, und Lords, die Steuern zahlen würden. Wäre Edgar doch nur auf jene erste Bitte um Gastfreundschaft eingegangen! Dann hätte Tristan seinen Anführer niemals um Rat gefragt und jene gnadenlose, unwiderrufliche Antwort nicht erhalten. »Zum Teufel!« fluchte er wieder. Wenn sie das Schloß einnahmen, konnte er seinen Leuten die Kriegsbeute nicht versagen. Er hoffte nur, daß möglichst wenig Blut fließen würde. »Nun, es läßt sich nicht ändern«, seufzte er und gab Tibald, der hinter dem Katapult stand, ein Zeichen. Eine weitere flammende Todeskugel schoß in die Luft.
Schmerzensschreie hallten von Edenby Castle herüber, Rauch quoll empor, hastig rannten die Leute in Deckung, andere holten Wassereimer. Tristans Augen verengten sich, als er durch den Qualm spähte. Jetzt war die Brustwehr leer. Seine Bogenschützen hatten auch die kühnsten Feinde verjagt.
Doch dann sah er eine einsame Gestalt, die dem Feuer und allgemeinen Chaos trotzte. Stolz aufgerichtet stand sie da, und er blinzelte verwirrt. Eine Frau, ganz in Weiß gekleidet ... Sonnenlicht drang durch die schwarzgrauen Wolken herab und berührte langes, welliges, goldenes Haar.
Ihre Hände lagen auf dem Steinwall, und sie schien seinen Blick zu erwidern. Ihr Gesicht konnte er nicht erkennen, aber er spürte, daß sie keine Angst empfand. Was tat sie dort oben? Wo war ihr Vater, Ehemann oder Bruder? Warum erlaubte man ihr, sich einer solchen Gefahr auszusetzen?
Vergeblich hatte die arme Lisette um Gnade gefleht. Und diese Frau forderte furchtlos den Tod heraus. Am liebsten hätte er sie von der Brustwehr heruntergezerrt und sie geschüttelt, um ihr Vernunft beizubringen ...
»Mylord Tristan, was befehlt Ihr nun?« Tibalds Ruf ließ ihn zusammenzucken.
»Noch ein Geschoß?« fragte Jon.
»Nein, wir warten.« Tristan schaute wieder zur Brustwehr hinauf, doch die Frau war verschwunden. »Geben wir ihnen etwas Zeit. Sie sollen über unsere Kampfkraft nachdenken, dann schicken wir ihnen einen Brief mit den Kapitulationsbedingungen.«
Plötzlich flog ein Hagel brennender Pfeile von den Zinnen herab, neue Schmerzensschreie wurden diesmal von Tristans Männern ausgestoßen. Mehrere brachen zusammen, bluteten aus tiefen Wunden und starben.
»Hebt die Schilde!« Wie Donnerschall übertönte seine Stimme den Lärm. Auch er hielt seinen Schild mit dem Emblem des Habichts und des Tigers hoch, um sich vor dem tödlichen Pfeilregen zu schützen. Endlich verebbte der Angriff, und Tristan wandte sich wütend zu Tibald. »Offenbar wollen sie bis zum letzten Atemzug kämpfen. Nun, diesen Wunsch werden wir erfüllen. Noch ein Schuß!«
Wieder sprang eine Feuerkugel empor. Tristan befahl seinen Leuten, die Verwundeten in Sicherheit zu bringen. Einige Pferde waren niedergestreckt worden, unheimlich durchdrangen ihre Todesschreie die verrauchte Luft.
Nach einer Weile blickte Tristan zur brennenden Festung hinauf, wo noch immer keine Kapitulationsflagge wehte. Er ordnete den Rückzug zum Lager an. Dieselbe Klippe, die das Schloß schützte, schirmte auch die Zelte der Belagerer ab. Dorthin schleiften sie nun das riesige Katapult und trugen die Bahren mit den Verletzten.
Im Lager stieg Tristan vom Pferd und ging mit Jon in sein Zelt. Er legte seinen Helm und die Rüstung ab und wusch sein Gesicht mit kaltem Wasser.
Nachdenklich beobachtete Jon seinen Freund, das markante Gesicht mit der hohen Stirn, in die dichtes schwarzes Haar fiel, der geraden Nase, den ausgeprägten Wangenknochen und dem eigenwilligen Kinn, wie aus Granit gemeißelt. Seit zwei Jahren vermochten die vollen Lippen kaum noch zu lächeln, düstere Schatten verdunkelten die blauen Augen.
»Ruf Alaric!« befahl Tristan kurz angebunden, und Jon gehorchte.
Wenig später erschien der alte Schreiber, der schon Graf Eustace treu gedient hatte. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, wanderte Tristan rastlos umher, und Alaric wartete schweigend, bis sein Herr zu sprechen begann. »Teilt Ihnen mit, wir werden morgen die Tore rammen. Sie sollen um Gottes Gnade beten, denn ich – Graf Tristan de la Tere, im Dienste Henry Tudors – kenne keine Barmherzigkeit. Die Nachricht muß unter dem weißen Banner in die Festung gebracht werden.«
Der Schreiber nickte, verließ das Zelt, und Tristan wandte sich an Jon. »Könnte man eine Mahlzeit für uns vorbereiten? Ich glaube, irgendwo haben wir noch eine Kiste Bordeaux. Kümmere dich darum, Jon. Und Tibald soll mir berichten, wie es um die Verwundeten steht.«
Bald danach setzten sie sich und aßen. Tristan erläuterte seine Pläne für den nächsten Morgen. Dann unterbrach er sich, als Alaric ins Zelt stürmte. »Wir haben Antwort bekommen, Mylord. Heute abend sollt Ihr Euch mit dem Lord von Edenby auf der Klippe, in der Nähe einer Höhle, treffen, die außerhalb der Schußweite von Freund und Feind liegt.«
»Geh nicht hin, Tristan!« warnte Jon. »Das ist sicher eine Falle!«
»Die Botschaft erfolgte ausdrücklich ›im Namen unseres Herrn Jesus Christus«‹, erklärte der Schreiber.
Zögernd nippte Tristan an seinem Bordeaux. »Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Niemand darf die Begegnung stören, und in diesem Sinne muß auf beiden Seiten ein feierlicher Eid geleistet werden.«
»Diesen Schurken kannst du nicht trauen!« protestierte Jon.
Tristans Becher landete klirrend auf dem Tisch. »Ich habe schon genug Männer verloren. Deshalb werde ich mit dem Lord reden, und er wird zu meinen Bedingungen kapitulieren, das schwöre ich.«
Eine Stunde später schwang er sich wieder in den Sattel, ohne Helm, Rüstung und Schwert, aber in seinem Stiefelschaft steckte ein Messer. Jon begleitete ihn bis zu einer Stelle unterhalb des Klippengrats. »Sei vorsichtig, mein Freund!«
»Das bin ich immer.« Tristan stieg vom Pferd, warf seinen Mantel um die Schultern und kletterte mit einer brennenden Fackel in der Hand über das Geröll weiter nach oben. Vor der Höhle blieb erstehen und rief: »Edenby! Zeigt Euch!«
Als er leise Schritte hinter sich hörte, fuhr er herum, und seine Hand glitt zum Messergriff. Dann hielt er verwirrt inne.
Es war kein Mann, der auf ihn zukam, sondern die seltsame weißgekleidete Frau. Sogar im Mondlicht schien ihr Haar das Sonnenlicht festzuhalten. Goldene Locken umrahmten ein schönes, feingezeichnetes Gesicht mit silbrig glänzenden Augen.
»Wer seid Ihr?« stieß er hervor. »Ich wollte den Schloßherrn treffen, kein Mädchen.«
Dichte Wimpern senkten sich über ihre Augen, ein verächtliches Lächeln umspielte die Mundwinkel. »Der Schloßherr wurde am vierten Tag dieser Schlacht ermordet.«
Wortlos steckte er die Fackel in eine Felsenspalte. Ehe er zu sprechen begann, ging er langsam um die junge Frau herum, die Hände in die Hüften gestemmt. »So, der Schloßherr ist tot. Und wo bleibt sein Sohn oder Bruder oder Vetter – sein Nachfolger?«
»Jetzt herrsche ich über Edenby«, erwiderte sie so seelenruhig, daß er sie am liebsten geschlagen hätte.
»Dann wart Ihr es, die noch tagelang ein sinnloses Blutvergießen zuließ?« fauchte er.
»Ich?« Verwundert hob sie ihre honigblonden Brauen. »Nein, Sir, ich habe niemanden angegriffen. Ich möchte weder morden noch plündern, sondern nur verteidigen; was mir gehört.«
»Auch ich will weder morden noch plündern, aber bei Gott, Lady, nun habe ich keine andere Wahl.«
»Ihr verwehrt mir eine ehrenvolle Kapitulation?«