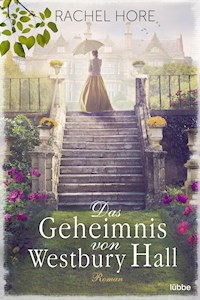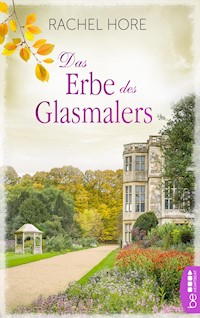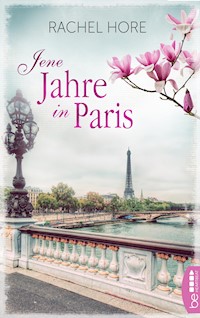5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die bewegenden Familienromane der britischen Erfolgsautorin
- Sprache: Deutsch
Ein packender Roman über zwei ungleiche Freundinnen, ein lange gehütetes Familiengeheimnis und eine große Liebe in dunklen Zeiten
Nach dem Tod ihres Vaters stößt Lucy in seinem Nachlass auf den Namen eines Onkels, von dem sie noch nie gehört hat. Neugierig geworden reist sie in die Heimat ihres Vaters - ein kleines Dorf an der Küste Cornwalls. Dort trifft sie Beatrice, eine alte Frau, die Lucys Familie gut kannte. Beatrice hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen - eine Geschichte über wahre Liebe, Mut und Verrat. Ihre Erzählungen aus der Vergangenheit offenbaren Lucy ein Geheimnis, das alles verändert ...
Für Leserinnen von Lucinda Riley, Kate Morton und Elaine Winter.
Weitere Romane von Rachel Hore bei beHEARTBEAT: Das Haus der Träume. Der Garten der Erinnerung. Das Erbe des Glasmalers. Die Karte des Himmels. Jene Jahre in Paris.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
EPILOG
NACHBEMERKUNG
Weitere Titel der Autorin
Das Erbe des Glasmalers (alter Titel: Der Zauber des Engels)
Das Haus der Träume
Der Garten der Erinnerung
Das Geheimnis von Westbury Hall
Die Karte des Himmels
Jene Jahre in Paris
Wo das Glück zuhause ist
Über dieses Buch
Ein packender Roman über zwei ungleiche Freundinnen, ein lange gehütetes Familiengeheimnis und eine große Liebe in dunklen Zeiten
Nach dem Tod ihres Vaters stößt Lucy in seinem Nachlass auf den Namen eines Onkels, von dem sie noch nie gehört hat. Neugierig geworden reist sie in die Heimat ihres Vaters – ein kleines Dorf an der Küste Cornwalls. Dort trifft sie Beatrice, eine alte Frau, die Lucys Familie gut kannte. Beatrice hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen – eine Geschichte über wahre Liebe, Mut und Verrat. Ihre Erzählungen aus der Vergangenheit offenbaren Lucy ein Geheimnis, das alles verändert …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Rachel Hore, geboren in Epsom, Surrey, hat lange Zeit in der Londoner Verlagsbranche gearbeitet, zuletzt als Lektorin. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen in Norwich. Sie arbeitet als freiberufliche Lektorin und schreibt Rezensionen für den renommierten Guardian. Mehr über die Autorin und ihre Bücher erfahren Sie unter https://rachelhore.co.uk/.
RACHEL HORE
DasBienen-mädchen
Familiengeheimnis-Roman
Aus dem britischen Englisch vonDr. Arno Hoven
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Rachel Hore
Titel der englischen Originalausgabe: „A Gathering Storm“
Originalverlag: Simon & Schuster UK Inc.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2013/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Erweitertes Lektorat: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Covergestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung von Motiven © Rebecca Stice/Trevillion Images; © photonova/Shutterstock; © coffee prince/Shutterstock; © Daniel Prudek/Shutterstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0284-3
be-ebooks.de
lesejury.de
PROLOG
Süd-London, März 2000
Lautlos wie ein Gespenst schlüpfte Beatrice in die Kapelle und fand einen Platz in einer der hinteren Bankreihen. Orgelmusik ertönte, aber sie nahm sie kaum zur Kenntnis. Sie setzte ihre Brille auf und warf einen Blick auf das Blatt mit dem Verlauf des Gottesdienstes, das ihr der Kollektensammler gegeben hatte. Auf der Vorderseite war ein Foto von Angelina abgebildet, das Beatrice geradewegs zurück in die Vergangenheit zog.
Sie erinnerte sich gut an dieses Bild. Es war ein Schnappschuss, den sie selbst aufgenommen hatte, in Cornwall am Strand von Carlyon, kurz vor dem Krieg. Angelina war damals siebzehn gewesen. Angies Mutter hatte das Foto rahmen lassen, und fortan stand es auf dem Flügel in Carlyon Manor. Angelina strahlte Beatrice daraus über die Jahre hinweg an, lachend, schön und in Sonnenlicht getaucht.
Als sie in diese leuchtenden Augen starrte, fühlte Beatrice, wie eine heiße Lava der Sehnsucht und Verbitterung in ihr aufstieg. Sie legte das Blatt mit der Vorderseite nach unten neben sich auf die Kirchenbank. Sie hatte geglaubt, sie hätte diese Gefühle schon vor langer Zeit überwunden – niedergerungen in vielen Nächten voller Qualen, aber jetzt musste sie erkennen, dass sie sich geirrt hatte. Hinter der Fassade der praktischen Vernunft wüteten noch immer die Leidenschaften der Vergangenheit. Sie schloss die Augen und versuchte, ihre Gedanken zu sammeln. Sie hätte nicht herkommen sollen – aber es gab da jemanden, den sie unbedingt sehen wollte.
Beatrice öffnete die Augen und schaute sich um. Die Kirchenbänke im Krematorium waren fast gefüllt, aber nicht ganz. Als ihr Blick über die Reihen wanderte, stellte sie fest, dass es meist Leute in ihrem Alter waren, die Frauen korrekt mit Hüten, die alten Männer rotgesichtig oder eingefallen in dunklen Anzügen, darunter ein paar – die alten Schlachtrösser – mit glitzernden Orden. Es gab niemanden, den sie wiedererkannte. Schließlich erlaubte sie sich, nach vorn zu schauen. Sie richtete sich ein wenig auf und reckte den Hals. Am Kopfende des Kirchenschiffs stand der Sarg, der hoch mit blauen und weißen Blumen bedeckt war. Ihre Augen glitten darüber hinweg. Ihr Puls beschleunigte sich.
Denn dort waren sie. Sie mussten es sein, obwohl es schwierig war, sie von hinten zu erkennen. Die Frau mittleren Alters hatte krause, blond gefärbte Haare, die im Nacken von einem Band zusammengehalten wurden, und war in eine extravagant geschnittene Jacke aus mitternachtsblauem Knautschsamt gekleidet. Der Mann trug einen rabenschwarzen Mantel, und sein dunkles Haar war, wie Beatrice zärtlich bemerkte, von grauen Strähnen durchzogen. Seltsam, dachte sie, dass Tom auf die sechzig zugeht! Zwischen den beiden saß ein junges Mädchen von vielleicht sechzehn Jahren, das sich ständig umdrehte und in der Kapelle herumschaute, sodass Beatrice reichlich Gelegenheit hatte, das spitze Kinn, die Stupsnase und den lebhaften Ausdruck in den braunen Augen mit den kurzen Wimpern genau zu betrachten. Das also war Lucy.
Nun erhoben sich die Trauergäste, der Geistliche eilte mit wehendem weißen Gewand nach vorn, und der Organist stimmte das erste Lied an. Beatrice stützte sich auf den Rücken der Kirchenbank vor ihr und versuchte, sich auf die Worte zu konzentrieren. Aber sie fand nicht die Kraft zum Singen.
Die tröstenden Worte des Gottesdienstes spülten über sie hinweg. Beatrice nahm sie kaum wahr – sie war völlig darin versunken, die kleine Familie in der ersten Reihe zu beobachten. Lucy streichelte den Arm ihres Vaters, doch er nahm es kaum zur Kenntnis. Die Art, wie er dastand – die Schultern hochgezogen, den Kopf gebeugt –, hatte etwas Einsames.
Alle außer Tom setzten sich wieder. Er ging nach vorn zum Lesepult, sodass sie zum ersten Mal sein Gesicht sehen konnte. Wie sehr er seinem Vater ähnelte! Die blasse Haut, die Art, mit der er sich langsam die Brille aufsetzte, die ruhige Ausstrahlung, als er sich seinem Publikum zuwandte. Doch als er schließlich zu sprechen begann, war es vollkommen seine eigene Stimme – tief und so leise, dass Beatrice sich anstrengen musste, um ihn zu verstehen. Und was er zu sagen hatte, versetzte sie in Erstaunen.
»Meine Mutter Angelina Cardwell«, sagte Tom, »war eine der schönsten Frauen«, er lächelte seiner Frau und seiner Tochter in der ersten Reihe zu, »und sicherlich die tapferste Frau, die ich je gekannt habe.«
Das klang irgendwie nicht richtig. Beatrice hatte Angie noch nie in diesem Licht gesehen. Schön, ja, aber tapfer? Was meinte er?
»… ein schwieriges Leben«, hörte sie ihn fortfahren. »Der tragische Tod ihres Bruders und ihrer Mutter, die gesundheitlichen Probleme ihres Mannes …«
Die Lautstärke der Wörter schwoll an und verebbte in dieser leisen Bassstimme.
»Ich weiß, es war eine Enttäuschung für sie, dass ich ihr einziges Kind war, und mir war immer bewusst, wie kostbar ich war.« Er sah kurz auf und blickte seine Zuhörer an. »Viele von Ihnen werden wissen, wie sehr meine Mutter in ihren späten Jahren mit Krankheit zu kämpfen hatte. Auch dies ertrug sie mit großer Tapferkeit, besonders nach dem Tod meines Vaters. Schön und tapfer war sie, aber ich habe meine Mutter auch wegen ihrer Treue geschätzt. Sie war eine hingebungsvolle Mutter und Ehefrau und – wie alle Briefe bezeugen, die ich nach ihrem Tod erhalten habe – eine warmherzige und liebevolle Freundin. Ich war stolz darauf, ihr Sohn zu sein!«
Einen Moment lang kniff Beatrice die Augen zusammen und versuchte, all das, was sie hörte, in sich aufzunehmen. Hingebungsvoll, warmherzig, treu. So sah sie Angelina gewiss nicht. Als sie wieder aufschaute, bemerkte sie, dass Tom Cardwell sie unmittelbar anstarrte. Seine Miene drückte eine leichte Verwirrung aus, so als ob er versuchte, sie einzuordnen.
Am Ende des kurzen Gottesdienstes erhoben sich die Trauergäste und standen schweigend da, während sich der elektrische Vorhang rund um den Sarg schloss. Nur Lucy brach die Anspannung mit einem einzigen schluchzenden Aufschrei, und ihre Mutter griff nach ihrer Hand, wobei ihre Armreifen leise klirrten.
Es war vorbei.
Beatrice beobachtete Tom, der mit seiner Frau und seiner Tochter vor den anderen nach draußen ging. An der Tür blieb er stehen und dankte allen beim Hinausgehen. Beatrice zögerte, aber dann machte sie sich bewusst, dass ihr nichts anderes übrig blieb – sie würde mit ihm sprechen müssen. Sie hatte sich ein paar Worte zurechtgelegt, aber sie war sich nicht mehr sicher, ob es die richtigen waren. Während sie darauf wartete, dass sie an der Reihe war, stupste jemand gegen ihren Arm und sprach sie mit ihrem Namen an. Sie wandte sich um und sah in ein vertrautes Gesicht. Es gehörte einer untersetzten alten Frau mit einem Basthut, den sie zu fest auf ihr dünnes graues Haar gedrückt hatte. In ihrem Gesicht stand ein Ausdruck boshaften Vergnügens.
»Hetty … Du bist doch Hetty?«, fragte Beatrice. Angelinas Schwester musste Anfang siebzig sein, drei oder vier Jahre jünger als sie selbst, aber sie sah älter aus.
»Natürlich bin ich Hetty«, erwiderte die Frau in ihrer gewohnten Schroffheit. »Was zum Teufel machst du denn hier, Bea?« Die Augen, es waren immer die Augen, die jemanden verrieten! Hettys Augen waren braun und blickten unheilvoll, und ihre Mundwinkel waren nach unten gezogen. Unsympathisch, das war schon immer die beste Beschreibung für Hesther Wincanton gewesen. Beatrice beschloss, die Unhöflichkeit zu ignorieren.
»Wie geht’s dir?«, erkundigte sie sich. »Ich hab dich nicht früher entdeckt, war nicht sicher, ob du hier bist.«
»Wieso sollte ich nicht?«, entgegnete Hetty. »Ich war ihre Schwester.«
»Das hab ich nicht gemeint. Ich habe dich nur nicht gesehen – du hast nicht bei Tom gesessen.«
»Nein«, sagte Hetty knapp. »Spielt ja auch keine Rolle. Ich dachte, ich sollte dich warnen, damit du nicht irgendwas Dummes sagst. Das wirst du doch nicht, oder?«
»Etwas Dummes? Für wen hältst du mich?«
Hetty packte ihren Arm, und Beatrice bekam einen Spritzer Spucke ab, als sie ihr zuzischte: »Angie hat ihm nie von dir erzählt, weißt du. Niemals.«
Beatrice spürte, wie das letzte Fünkchen Hoffnung erlosch. »Hat sie nicht?«, fragte sie leise. Dann richtete sie sich auf. »Wem was erzählt?«
»Tu doch nicht so, als ob du nicht wüsstest, wovon ich rede. Also halt den Mund! Glaub mir, es ist das Beste.«
Beatrice mochte Hetty vielleicht nicht leiden, aber aus deren Gesicht sprach eine solche Dringlichkeit, dass sie beunruhigt war. Sie wandte sich mit einem angedeuteten Nicken ab.
Als sie Tom schließlich gegenüberstand, fühlte sie sich wie betäubt. Sie wusste, dass sie nicht aussprechen durfte, was sie auf dem Herzen hatte. Sie streckte ihre Hand aus.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, murmelte Tom, als er ihre Hand schüttelte. Er sah sie neugierig an. »Kenne ich Sie?«
»Ich bin Beatrice Ashton«, antwortete sie. »Früher hieß ich Beatrice Marlow. Eine Freundin der Familie.«
Sie sah, wie sich sein Gesicht veränderte. Er wusste es, das erkannte sie sofort. Er wusste, wer sie war!
Mit allergrößter Anstrengung gelang es Tom Cardwell, seine Fassung wiederzugewinnen.
»Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, Mrs Ashton. Vielleicht möchten Sie mitkommen und gleich einen Kaffee mit uns trinken? Irgendjemand kann Sie bestimmt mit zum Hotel nehmen.«
»Ich bin mit meinem eigenen Wagen hier«, erwiderte sie, aber Tom hatte sich schon wieder abgewandt.
»Tante Hetty«, hörte sie ihn sagen, als sie weiterging.
»Was für eine Schande, dass mein Bruder Peter sich nicht herbemüht hat.« Hettys Worte waren klar und deutlich zu verstehen.
»Es ist ein langer Weg von New York, Hetty, und soweit ich weiß, geht es ihm gesundheitlich nicht gut.«
»Jedenfalls braucht er nicht damit zu rechnen, dass wir bei seinem Begräbnis aufkreuzen.« Sie gab ein schnaubendes Lachen von sich.
»Also, ich weiß nicht«, sagte Tom.
Beatrice gesellte sich zu den anderen Trauergästen und bewunderte mit ihnen die Kränze, die auf dem Boden ausgelegt waren. Lucy und ihre Mutter Gabriella standen ein Stück weit vor ihr.
»Oh, das ist alles so … furchtbar!«, rief das Mädchen leidenschaftlich und fing an zu weinen. Gabriella versuchte, ihre Tochter zu beruhigen.
Beatrice beobachtete, wie die beiden die Kapelle verließen und in den Garten gingen. Es sah so aus, als sollte sie auch mit ihnen nicht sprechen. Niemand redete mit ihr. Sie war eine Fremde … Nein, schlimmer noch: ein Geist.
Das alles raubte ihr völlig den Mut. Sie beschloss, Toms Einladung auszuschlagen und machte sich auf den Weg zum Parkplatz.
Später quälte sie sich damit herum, dass sie so feige gewesen war. Wenn Hetty sie nicht gewarnt hätte – wer weiß, was sie vielleicht zu Tom gesagt hätte und was daraus geworden wäre. Vielleicht war es besser, die Wahrheit weiterhin ruhen zu lassen. Wem würde es nutzen, wenn alles ans Licht käme? Womöglich nur ihr selbst. Aber hatte ihre Mutter sie nicht immer eindringlich ermahnt, bei der Wahrheit zu bleiben? Eine Lüge führt zu einer größeren Lüge, hatte sie immer gesagt.
Dabei war es am Anfang nicht Beatrice’ Lüge gewesen, sondern die von Angelina.
KAPITEL 1
Cornwall, April 2011
»Bitte, Will!«
»Lucy, wir sind sowieso schon zu spät dran! Wenn ihr Mädels nicht so lange zum Packen gebraucht hättet …«
»Auf der Karte ist es nicht weit – schau mal.«
»Kann ich nicht, wenn ich fahre, oder?« Wills Augen waren auf die Straße vor ihm geheftet.
»Gleich kommt ein Schild nach Saint Florian«, sagte Lucy. »Ich hab’s dir gezeigt, als wir hergefahren sind, erinnerst du dich? Oh, Will, es sind nur ein paar Meilen bis zur Küste. Komm schon, bitte! Ich hab doch gesagt, dass ich gerne dahin fahren würde.« Sie gab sich Mühe, nicht gereizt zu klingen.
»Und wir waren die ganze Woche mit anderen Dingen beschäftigt. Willst du mir das etwa vorwerfen?«
»Ich werfe dir gar nichts vor. Ich möchte einfach nur mal da an die Küste.«
»Hör zu, Lu. Wir fahren ein anderes Mal hin, was hältst du davon? Jon hat vorgeschlagen, dass wir im Sommer wiederkommen.« Als Zeichen, dass die Diskussion für ihn beendet war, tippte Will auf eine Taste am Lenkrad. Rockmusik dröhnte durch das Auto und erstickte jede Möglichkeit zum Gespräch.
Lucy fuhr auf der Karte mit dem Finger die zitterige Linie der Küste von Cornwall entlang, die Schmugglerbuchten und wilde Landzungen verhieß, und fragte sich im Stillen, ob sie noch einmal herkommen würden. Jon und Natalia, das andere Paar, hatte sie kaum näher kennengelernt. Sie waren Freunde von Will, und auch mit ihm war sie noch nicht sehr lange zusammen. Sie sah ihn verstohlen von der Seite an, und ihr Pessimismus wuchs. Dieses mürrische Gesicht setzte er inzwischen immer häufiger auf, wenn sie sich stritten. Er war siebenundzwanzig wie sie. Mit seinen längeren Haaren und dem attraktiven Dreitagebart hatte er in London lässig auf sie gewirkt, offen für neue Ideen. Es hatte sich herausgestellt, dass er alles andere war als das. Und was seine Freunde betraf, so war Jon wie Will davon besessen, den besten Surfstrand zu finden, und Natalia vom Shoppen. Lucy war die Einzige, die bereit gewesen war, die Klippen zu Fuß zu erkunden, wenn mehr als ein Regentropfen fiel. Aber als die Neue in der Gruppe hatte sie sich den Plänen der anderen fügen müssen. Außerdem hatte sie ja auch kein eigenes Fortbewegungsmittel gehabt. Lucy verschränkte die Arme, starrte aus dem Fenster und versuchte, die nervige Musik zu ignorieren.
Will sah sie an und drehte die Lautstärke herunter. »Du siehst ziemlich jämmerlich aus«, sagte er.
»Danke«, erwiderte sie. »Ich versteh nicht, warum es dich so eilig nach Hause zieht.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich möchte die Fahrt hinter mich bringen. Außerdem will ich noch ein paar Dinge erledigen. Ich habe diese Woche den Schneideraum gebucht, und ich muss die Kurzanweisung durchgehen.« Will war freiberuflicher Film-Cutter, und Lucy arbeitete als Produktionsassistentin bei einer TV-Produktionsgesellschaft.
»Denkst du etwa schon wieder an die Arbeit, Will?«
»Du hast Glück, dass du nächste Woche freihast.«
»Ich hab das Gefühl, ich hab’s mir verdient … Oh, sieh nur!«
Ein Straßenschild war aufgetaucht. Lucy beugte sich vor. »Die Abzweigung. Bitte, Will! Es dauert nur zwanzig Minuten, ich verspreche es dir. Lass uns hinfahren. Bitte!«
Will, den Lucys impulsive Seite ein wenig irritierte, gab nach und schwenkte das Lenkrad herum.
»Danke«, flüsterte Lucy und berührte seinen Arm. Er runzelte die Stirn.
Schweigend fuhren sie weiter. Die enge Straße wand sich zwischen hohen Hecken. Mehrmals mussten sie an die Seite fahren, um Autos aus der entgegengesetzten Richtung vorbeizulassen, während Wills Finger auf das Lenkrad trommelten.
»Wie weit ist es denn noch?«, knurrte er.
»Nur noch eine halbe Meile. Schau doch, das Meer!«
Sie hatten ein Plateau überquert und den Punkt erreicht, wo das Land zu einer hufeisenförmigen Bucht abfiel. Zur Linken beschrieben hohe Klippen eine Kurve, die in einer Landzunge mündete, auf der sich ein Leuchtturm erhob. Die Aussicht nach rechts wurde versperrt von einer Reihe Waldföhren, in denen Saatkrähen ihre Nester gebaut hatten. Die Straße senkte sich nun steil auf eine Ansammlung weiß getünchter Häuser zu, vermutlich begann dort die Stadt.
Ein anderes Schild kam in Sicht. Es wies nach rechts auf einen Weg, der hinter den Föhren entlangführte. »Der Strand und Carlyon Manor«, las Lucy vor. »Will, halt an! Das ist Carlyon!«
Will schaute in den Rückspiegel, bevor er scharf auf die Bremse trat. »Um Himmels willen, Lu! Ich dachte, du wolltest in die Stadt.«
»Will ich auch … aber Carlyon Manor, verstehst du? Da hat Granny gelebt, als sie klein war.«
Will brummte ungehalten vor sich hin, bog aber trotzdem nach rechts ab. Lucy schaute aus dem Fenster auf die wilden Narzissen in den Hecken, und ihre Laune hob sich.
Eine halbe Meile weiter gabelte sich die Straße. Eine weiße Tafel, auf der Parkgebühren aufgeführt waren, zeigte nach links zum Strand.
»Wieder nach rechts«, sagte Lucy.
Will lenkte das Auto zwischen einem Paar Granitsäulen hindurch und anschließend über eine tiefe Fahrspur. Zu beiden Seiten erstreckten sich frisch gepflügte Felder. Dann kamen eine weitere Biegung und eine kurze Auffahrt, die nach links führte, wo sich, fest verankert in einer langen Steinmauer, ein hohes doppelflügeliges Tor aus Schmiedeeisen befand.
»Halt an!«, rief Lucy, und Will brachte den Wagen zum Stehen.
Sie stieß die Beifahrertür mit Schwung auf und rannte zum Tor. Es war verschlossen, und das Vorhängeschloss starrte vor Rost. Frustriert rüttelte Lucy an den Torflügeln und spähte dann durch die Stangen. Sie versuchte, einen Blick auf das Haus zu erhaschen, aber die vielen Bäume versperrten ihr die Sicht.
»Was für ein Pech«, sagte Will. »Steig ein. Lass uns fahren.« Er ließ den Motor aufheulen, doch Lucy hatte ein Stück weiter eine Stelle entdeckt, wo ein paar Steine aus der langen Mauer auf den Weg gestürzt waren.
Sie nahm ihre Kameratasche vom Rücksitz, schwang sie sich über die Schulter und lief los. »Dauert nur eine Minute!«
»Lucy!«, rief Will.
Sie winkte, ohne sich umzusehen.
Etwa hundert Yards vom Tor entfernt erreichte sie den Abschnitt der Mauer, wo die Steine abgebröckelt waren. Sie kletterte hoch, sprang ins Unterholz auf der anderen Seite und bahnte sich den Weg durch einen dichten Gürtel aus Bäumen. Plötzlich blieb sie wie angewurzelt stehen: Vor ihr erhob sich Carlyon Manor.
Auf den Fotos, die sie in Grannys Schachtel gefunden hatte, präsentierte sich Carlyon als langes, graziös wirkendes elisabethanisches Steinhaus, das zwischen gepflegten Bäumen stand und dessen gewellte Rasenflächen vom Sonnenlicht getüpfelt waren. Doch dieses Gebäude hier war verfallen und geschwärzt von Feuer, sein gezacktes Skelett zeichnete sich scharf vom Himmel dahinter ab, und der einzige übrig gebliebene Schornstein streckte sich erbarmungswürdig in die Höhe wie der Flügel eines überfahrenen Vogels. Instinktiv nahm sie ihre Kamera und machte ein paar Aufnahmen. Dabei fragte sie sich die ganze Zeit, wann das wohl passiert war. Niemand hatte je ein Feuer erwähnt.
Lucy hastete über das struppige Gras und den vom Unkraut befallenen Kies. Mehrere Stufen führten zum Vordereingang hoch. Von der zweiflügeligen Tür waren allerdings nur ein paar Holzsplitter an verrosteten Scharnieren übriggeblieben. Auf der Türschwelle zögerte sie und überdachte die möglichen Gefahren. Dann siegte ihre Neugier, und sie ging hinein.
Sie kam in eine zerstörte Eingangshalle, die teilweise zum Himmel hin geöffnet war. Von dort schlenderte sie vorsichtig von Raum zu Raum, wobei sie über Trümmer stieg, vorbei an den verbogenen Formen von Dingen, die aus Metall gewesen waren. Sie versuchte sich vorzustellen, wie es hier einst, vor dem Feuer, ausgesehen haben mochte. Man konnte noch den Grundriss der Räume im Erdgeschoss und ihren ehemaligen Zweck kennen. Es könnte einen zentralen Treppenaufgang und eine Galerie gegeben haben, dachte Lucy, aber vielleicht stellte sie sich das auch nur vor.
Voller Bestürzung blickte sie sich um und fragte sich, wann das Feuer gewütet hatte und wie es ausgebrochen war. In einem großen Raum hinten im Haus schaute man von den verrosteten Resten einer Verandatür auf eine mit großen Steinplatten ausgelegte Terrasse und dahinter auf einen verwilderten Garten. Das Haus stand oben auf der Kuppe einer Klippe, und zwischen den flatternden Blättern der Pappeln funkelte das Meer.
Lucy wandte sich wieder dem Raum zu. Dies war der Salon gewesen, vermutete sie. Ihr Blick fiel auf die korrodierten metallenen Innereien eines Sessels, die sich am offenen Kamin duckten. An der Wand darüber hing der verkohlte Umriss von dem, was einmal ein großer Spiegel gewesen war. Sie überquerte den verrotteten Fußboden, wobei der Schutt unter ihren Füßen knirschte, und betrachtete den zerstörten Kaminsims genauer. Seine geschnitzten Muster waren immer noch zu erkennen. Sie fuhr mit ihren Fingern über die Kanten und Kurven des verbrannten Holzes und war erstaunt über die Formen der dargestellten Früchte und Blumen. Es musste ein atemberaubendes Beispiel großer Handwerkskunst gewesen sein. Die gespenstischen Überreste des Spiegels und des Sessels faszinierten sie, und sie griff erneut nach ihrer Kamera.
Wie in einem Tagtraum bewegte sie sich in den Räumen umher und fotografierte alles, was ihr ins Auge fiel. Dabei versuchte sie, sich die Menschen vorzustellen, die hier gelebt hatten. Manchmal glaubte sie, Kinderstimmen zu hören. Gott bewahre! Hoffentlich waren keine Kinder im Haus gewesen, als das Feuer ausbrach. Aber es waren leise Stimmen, keine Äußerungen des Entsetzens, und allmählich realisierte Lucy, dass es nur der Wind war, der in den Ruinen flüsterte.
Eine halbe Stunde später wurde ihr bewusst, dass da wirklich jemand nach ihr rief. Will. Sie hatte ihn völlig vergessen. Sie suchte sich einen Weg zurück zum Vordereingang und schaute in den Park. Will stand drüben zwischen den dichten Bäumen, die Beine gespreizt und die Hände in die Hüften gestemmt. Sie winkte, und er kam langsam auf sie zugelaufen.
»Lucy, was zum Teufel …? Ich wusste nicht, wo du hingegangen bist. Du bist einfach verschwunden!«
»Es tut mir so leid. Ich hab die Zeit vergessen. Ist es nicht wunderschön?«
Er schaute an ihr vorbei auf die Ruine. »Für mich sieht es aus wie eine Schutthalde. Wie hast du es genannt?«
»Carlyon Manor. Wo Granny gelebt hat, als sie jung war.«
»Sehr hübsch«, sagte er, »aber bestimmt auch gefährlich. Komm jetzt. Wir müssen los.«
Sie mochte seinen einschüchternden Tonfall nicht und ging widerwillig die Stufen hinunter.
»Ich war immer noch nicht in Saint Florian«, sagte sie und biss sich auf die Lippe, als sie sein empörtes Gesicht sah.
»Tut mir leid, Lucy, aber das ist einfach nicht drin! Wir müssen endlich nach Hause.«
Er war wirklich wütend, und obgleich sie es ihm übel nahm, war es wohl verständlich. Sie ging auf das Auto zu, aber ihre Schritte waren zögerlich. Sie wurde das alberne Gefühl nicht los, dass das Haus sie zurückrief.
Sie sah, dass Will bereits gewendet hatte, sodass der Wagen entschlossen in Richtung Heimat wies, und stieg ein. Als Will den Motor anließ, stellte sie sich plötzlich vor, wie sie den ganzen Weg nach London neben ihm sitzen, der scheppernden Musik lauschen und über den verdammten Dokumentarfilm sprechen würde, an dem er arbeitete, während sich das noch unbesuchte Städtchen Saint Florian weiter und weiter entfernte.
Sie fuhren an den Föhren mit den Saatkrähennestern vorbei, und Will blinkte nach links, fort von Saint Florian. Eine verrückte Idee kam ihr in den Sinn. Es war ja nicht so, dass sie unbedingt an diesem Tag nach Hause musste.
»Will«, sagte sie, »halt an und lass mich raus.«
Er zögerte. »Lucy, bitte! Ich möchte wenn möglich irgendwann heute heimkommen.«
»Ich komme nicht mit.«
»Was?« Sein Gesicht war vor Fassungslosigkeit erstarrt.
»Schau – ich habe noch eine Woche«, erklärte sie ihm. »Ich wollte eigentlich nur mit Fotos herumspielen, vielleicht ein paar rahmen lassen, aber das kann ich jederzeit machen. Also hab ich beschlossen hierzubleiben. Ich möchte mir Saint Florian in Ruhe anschauen und herausfinden, ob es jemanden gibt, der mir etwas über Carlyon und meine Familie erzählen kann.«
»Das ist lächerlich! Wo willst du wohnen? Das kannst du doch nicht einfach so entscheiden.«
Sie rollte die Augen. »Ich werde schon was finden.« Sie griff nach ihrer Handtasche und der Kamera. »Danke, Will. Für alles. Es war fantastisch.« Sie beugte sich zu ihm und gab ihm einen raschen Kuss, dann öffnete sie die Tür. Er saß da wie gelähmt und sah sie nicht an. »Machst du bitte den Kofferraum auf? Ich brauche meinen Koffer.«
Er wandte den Kopf, sah sie mit besorgtem, unglücklichem Gesicht an und sagte: »Das ist einfach nur dumm! Hör zu, ich sag dir jetzt was: Ich fahre dich runter nach Saint Florian, wenn es dir so ernst damit ist. Und dann kommst du mit mir zurück.«
Es war nicht nur der Ton seiner Stimme, der sie auf die Palme brachte, sondern auch die Tatsache, dass er keinerlei Interesse an diesem Abenteuer hatte.
»Das musst du nicht – wirklich nicht. Ich kann zu Fuß gehen. Bitte mach den Kofferraum auf.«
»Lucy …«
»Ich will das auf eigene Faust machen.« Das wusste sie jetzt.
Einen Augenblick später stand sie mit ihrem Koffer am Straßenrand und sah ihm nach, als sein Wagen davonraste.
»Leb wohl, Will«, flüsterte sie.
Die Frühlingssonne wärmte ihren Rücken, während sie, den Koffer hinter sich herziehend, den Hügel hinuntermarschierte – direkt auf das Städtchen zu.
KAPITEL 2
Drei Monate zuvor
Eigentlich hätte Lucys Vater Tom eine Reise nach Saint Florian unternehmen sollen, als er noch lebte. Aber er hatte sich dagegen entschieden, und so machte sie es nun für ihn.
Angefangen hatte das Ganze an einem Nachmittag Mitte Januar mit einem Besuch bei ihrer Stiefmutter Helena in Suffolk. Helena hatte Lucy gebeten, aus London herüberzukommen, weil sie Toms persönliche Dinge sortiert hatte und ihr einige Sachen geben wollte.
Während Lucy ihren Mietwagen durch die karge Landschaft von East Anglia steuerte, spürte sie ihren Gefühlen nach. Wirklich seltsam, dass sich an der Abneigung, die sie schon immer gegen Helena hegte, seit dem Tod ihres Vaters bei einem Autounfall im letzten Juni nichts geändert hatte. Wenn überhaupt, war die Ablehnung nur noch stärker geworden. Sie hatte Mitleid mit ihrer Stiefmutter, das schon. Jeder, der Helenas erschöpftes Gesicht sah und ihre Angewohnheit, ständig die Hände zu ringen, merkte, dass sie Tom sehr geliebt hatte und um ihn trauerte. Aber Lucy konnte ihrer Stiefmutter nicht verzeihen, dass sie ihr den Vater weggenommen hatte. Und es war ihr auch nicht recht gewesen, dass Helena, die zweite Frau und Nachzüglerin in Tom Cardwells Leben, die Hauptrolle bei den Formalitäten nach seinem Tod übernommen hatte. Als Toms Ehefrau hatten sie Helena – nicht Lucy oder Lucys Mutter Gabriella – ins Krankenhaus gerufen, als das Autowrack gefunden worden war. Und es war Helena gewesen, die sich um das Begräbnis gekümmert hatte. Da es kein Testament von Tom gab, hatte Helena die Aufteilung seines Vermögens übernommen, Lucy allerdings problemlos das ihr rechtlich zustehende Erbe zugestanden.
Was Lucy zusätzlich zu ihren eigenen verworrenen Gefühlen belastete, war der heftige Kummer ihrer Mutter. Als Tom starb, war es für Gabriella Cardwell, als hätte er sie noch einmal verlassen, und sie fand keinen Trost in der Tatsache, dass »die andere Frau« ihn diesmal auch verloren hatte. Die beiden Witwen waren nicht in der Lage, sich zu begegnen und gemeinsam zu trauern. Lucy nahm an, dass sie in der anderen jeweils genau das sahen, was sie selbst Tom nicht hatten geben können, und Lucy hatte keine Lust mehr, die Brücke zwischen ihnen zu sein.
Als sie in der ruhigen Gasse draußen vor dem Walnut Tree Cottage aus dem Auto stieg, sah Lucy, dass Helena schon an der Haustür auf sie wartete – eine gertenschlanke Gestalt in einem taubengrauen Twinset.
»Du kommst furchtbar spät!«, rief Helena. Ihre helle Stimme zitterte. »Ich hab mir schon Sorgen gemacht.«
»Tut mir leid, Helena«, erwiderte Lucy, die sich schuldig fühlte. »Ich konnte erst um eins losfahren, und dann hat es ewig gedauert, bis ich aus London raus war.«
»Ist schon in Ordnung«, sagte Helena. »Es ist nur, seit dein Vater … Ich kann nicht anders, ich mach mir immer Sorgen.«
Ihre Wange fühlte sich trocken an, als Lucy sie küsste. Ihr glanzloses braunes Haar hatte einen Stich ins Graue bekommen und sah aus wie mit Asche bestäubt.
Die weißen Nelken, die Lucy bei einem Zwischenstopp zum Tanken gekauft hatte, waren zerquetscht und vertrocknet. Sie überreichte den Strauß mit einer gemurmelten Entschuldigung.
»Wie aufmerksam von dir, Liebes. Ich bin so froh, dass du gekommen bist!«
»Ich hätte dich schon früher besuchen sollen.«
»Du hast zu viel zu tun, das weiß ich doch. Du warst auch unterwegs, oder?«
Helena hängte Lucys Mantel in einen Schrank und führte sie in die sterile weiße Küche. »Hast du am Telefon nicht von Rumänien gesprochen?«
»Bulgarien«, antwortete Lucy, während sie zusah, wie Helena die schrecklichen Blumen in einer cremefarbenen Porzellanvase arrangierte. »Wir haben einen Kostümfilm gedreht. Mit Unterbrechungen war ich drei Wochen dort.«
Im Flur stellte Helena die Vase auf ein Regal zwischen zwei konturlose Figürchen. »Also, wir sollten hier drinnen anfangen, glaub ich …« Ihre Stimme erstarb langsam, während sie die Tür zum Esszimmer aufschob. Lucy sah, warum. Vier hässliche Kartons waren auf dem Tisch aufgereiht und zerstörten die ordentlichen Linien in Helenas Leben.
»Da drin ist lauter Krimskrams von deinem Vater«, sagte Helena und trat an den Tisch. »Seine Kleidung hat ein Wohlfahrtsverband abgeholt.«
»Ja, natürlich«, sagte Lucy rasch. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Fremde in den Anzügen und Schuhen ihres Vaters herumliefen.
Helena sah sie an. »Wie du weißt, sind seine finanziellen Angelegenheiten geregelt. Es gibt nur noch diese Sachen und ein paar Dinge in seinem Arbeitszimmer – die Bücher natürlich.«
Ein Karton war zu voll und ging nicht mehr richtig zu. Oben auf einem Berg von Rugby-Programmen lag eine Fotografie in einem Silberrahmen. Helena griff danach und reichte sie Lucy: »Hier, das lag in der unteren Schublade seines Schreibtischs. Ist das nicht deine Großmutter?«
Lucy durchfuhr ein leichtes Beben des Wiedererkennens. Das Bild zeigte Granny in ihrer Jugend am Strand. Es war das Foto, das ihr Vater bei Grannys Begräbnis auf die Vorderseite des Blattes mit dem Ablauf des Trauergottesdienstes hatte drucken lassen. Lucys ganze Kindheit über hatte es zu Hause im Bücherregal gestanden, aber hier hatte ihr Vater es offenbar verborgen aufbewahrt. Hatte er es nicht ertragen können, das Foto anzuschauen? Aus welchem Grund?
»Ich wäre dir jedenfalls sehr dankbar«, sagte Helena, »wenn du das alles mitnehmen würdest.«
»Mach ich gern«, entgegnete Lucy. Sie fügte nicht hinzu, dass diese Dinge Helena ohnehin nicht gehörten.
Als hätte sie Lucys Gedanken gelesen, warf ihr Helena einen ruhigen Blick aus ihren grauen Augen zu und sagte mit ihrer hellen Stimme: »Es hat nie infrage gestanden, dass du das bekommst.«
»Nein, natürlich nicht«, erwiderte Lucy. Sie betrachtete immer noch das Foto. Ihre Großmutter war sehr schön gewesen, und der wissende Blick, mit dem Granny seitlich in die Kamera sah, weckte Lucys berufliches Interesse. Sie musste ein dankbares Objekt für einen Fotografen gewesen sein. Es stimmte wahrhaftig: Manche Menschen wurden von der Kamera geliebt.
»Eine bezaubernde Person, oder?«, bemerkte Helena, als ob sie das missbilligte. »Ach, Lucy, ich weiß, es ist bestimmt nicht einfach für dich … diese Situation. Ich hoffe, dass du und ich … dass wir Freundinnen bleiben.«
»Natürlich bleiben wir das.« Es wäre grausam gewesen, etwas anderes zu sagen, aber Lucy fragte sich ernsthaft, ob eine Freundschaft möglich wäre. Helena war fast dreißig Jahre älter als sie, und was, um Himmels willen, hatten sie schon gemeinsam?
»Dein Vater war sehr lieb zu mir. Er hat so verloren und unglücklich ausgesehen, als wir uns kennengelernt haben. Er brauchte mich.«
Warum? Lucy hätte sie das gerne gefragt, aber dazu war sie zu stolz. Ein Bild kam ihr in den Sinn: ihre Mutter, hemmungslos weinend, als Lucys Vater sie verlassen hatte – das fleckige Gesicht, das Haar krauser denn je. Helena war immer gleichmütig und beherrscht, wenn man einmal von dem Händeringen absah. Weshalb hatte ihr Vater diese stille, farblose Frau gebraucht?
Der Schlüssel dazu lag irgendwo in der Vergangenheit. Als er nach dem Tod von Lucys Großmutter damit angefangen hatte, die Schachteln mit ihren Papieren und Erinnerungen durchzusehen, hatte sich Tom sehr verändert. War das normale Trauerarbeit, oder hatte er etwas in ihren Habseligkeiten gefunden, das ihm zu schaffen machte? Lucy verstand das alles noch immer nicht ganz. Ihr Vater war ein äußerst zurückgezogener Mann mit einem ausgeprägten Sinn für Stolz und Tradition gewesen und hatte selten über seine Gefühle gesprochen. Dennoch war er immer warmherzig und liebevoll gewesen, und Lucy konnte sich nicht erklären, weshalb er seine Bindungen durchtrennt hatte und aufgebrochen war, um noch einmal von vorn anzufangen.
***
Nachdem Helena ihr geholfen hatte, die Kartons nach draußen zum Auto zu tragen, tranken sie in dem beigefarbenen Wohnzimmer Tee aus zerbrechlichen Tassen.
»Sollen wir nach oben gehen und uns da umsehen?«, fragte Helena dann.
Oben in dem Haus gab es einen luftigen Raum, in dem sich Tom, kurz nachdem sie das Cottage vor sechs oder sieben Jahren gekauft hatten, ein Arbeitszimmer eingerichtet hatte. Während Helena die Lampen anknipste und dann an der klemmenden Jalousie herumhantierte, sah Lucy sich um. Es war der einzige Ort im Haus, wo sie noch die Anwesenheit ihres Vaters spürte. Sein verwaschenes marineblaues Sweatshirt hing an der Rückseite der Tür und wurde wahrscheinlich bei den Sachen für die Wohlfahrtsorganisation vermisst. Ihr Vater war auch dort in den geordneten Buchreihen und dem alten Mahagonischreibtisch vor dem Fenster, durch das Lucy auf winterliche Felder blickte, die langsam in der Dämmerung versanken.
Ein Foto, das unter den Schreibtisch gefallen war, erregte ihre Aufmerksamkeit. Lucy hob es auf. Das Bild zeigte die ersten fünfzehn Spieler der Rugbymannschaft von der Schule ihres Vaters, das hübsche, erwartungsvolle Gesicht des damals Achtzehnjährigen in der vorderen Reihe. Lucy suchte es nach Vorzeichen des eher finsteren, introvertierten Mannes ab, zu dem er sich schließlich entwickeln sollte, fand jedoch keine. Sie stellte das Foto auf den Schreibtisch neben dem Computer und einem weiteren Karton.
»Ach ja«, sagte Helena, »den da solltest du auch mitnehmen. Es ist hauptsächlich Zeug von deiner Großmutter.«
Lucy klappte den Karton auf und schaute hinein. Ganz oben lag ein gelbes Ringbuch, und als sie es aufschlug, sah sie Notizen in der kleinen, eleganten Handschrift ihres Vaters: Listen mit Daten, Schaubilder mit Pfeilen und ein Verweis auf ein Buch über den D-Day, den Tag, als die Alliierten im Zweiten Weltkrieg in der Normandie landeten. Militärgeschichte also – das war alles. Enttäuscht nahm sie das Ringbuch heraus. Darunter fand sie eine große viereckige Blechdose, in der ursprünglich Kuchen oder Kekse gewesen waren. Lucy hob den Deckel an, auf dem das Bild von einem Garten prangte, und roch den Duft von Rosen. In der Dose lagen verschiedene Andenken. Lucy schloss den Deckel wieder. Vor Helenas Augen wollte sie sich das nicht anschauen.
»Was soll ich mit den Büchern machen?«
Helena stand vor den Regalen und richtete eine Reihe alter Schulchroniken mit verzierten Buchrücken gerade. Sie sah aus, als ob sie hier oben fehl am Platz wäre. Toms Arbeitszimmer war seine eigene Welt gewesen. Hier hatte er viele Stunden lesend in dem großen Sessel verbracht und am Schreibtisch gesessen, um zu schreiben oder auf Websites von Antiquariatsbuchhändlern zu stöbern.
»Ich würde sie bloß nehmen, weil sie Dad gehört haben«, erwiderte Lucy, »und ich hab einfach keinen Platz in meiner Wohnung.«
»Was ist mit deiner Mutter?«
»Nein. Kannst du es nicht in diesem Laden in der Hauptstraße versuchen?«
»Das wäre wahrscheinlich das Beste.«
Helena sah sich im Zimmer um und fragte sich, von welchen Dingen sie sich sonst noch trennen sollte. Ihre Augen blieben schließlich an dem Computer hängen. »Ich möchte dir noch etwas zeigen, Lucy. Dein Vater hat irgendwas in der Familiengeschichte erforscht. Vielleicht interessiert es dich. Ich habe heute Morgen versucht, das Dokument auszudrucken, doch der elende Drucker hat nicht funktioniert.«
»Ich probier’s mal, wenn du möchtest«, bot Lucy an, die neugierig geworden war. Sie setzte sich hin und schaltete den Computer an.
»Ich habe sein Passwort auf Anhieb erraten«, erklärte Helena. »Es ist wasps.« Toms Lieblingsrugbymannschaft.
Lucy tippte es lächelnd ein und sah zu, wie eine Reihe von Icons auf dem schwarzen und gelben Desktop erschien. Helena wies sie auf eine Datei hin, die »Cardwell« hieß. Eine Textseite öffnete sich. Lucy starrte auf die Überschrift. Es war der Name eines Mannes.
»Wer ist Rafe Ashton?«, fragte sie.
»Du hast nie von ihm gehört?«, entgegnete Helena stirnrunzelnd.
»Nein.«
»Dein Vater hat gesagt, er sei sein Onkel gewesen. Du musst von ihm gehört haben.«
»Nein, bestimmt nicht«, beharrte Lucy. Großonkel Rafe? Der Name sagte ihr nichts.
»Ich vermute, er war der jüngere Bruder deines Großvaters Gerald.«
»Ich hatte keine Ahnung, dass er einen hatte. Warum hieß er dann nicht Rafe Cardwell?«
»Er muss ein Halbbruder gewesen sein. Jedenfalls ist er im Krieg verschwunden oder so. Es ist alles ein bisschen verwirrend.«
»Ich werde zu Hause mal einen Blick darauf werfen.«
Lucy war verärgert, dass Helena mehr über ihre Familie zu wissen schien als sie selbst. Der Drucker erwachte klappernd zum Leben, und mehrere bedruckte Seiten glitten leise in die Ablage. Lucy steckte sie in den Karton, hob ihn auf und schaute sich im Zimmer ihres Vaters um – vielleicht zum letzten Mal.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte sie zu Helena. »Um acht soll ich bei einem Freund in London sein.«
»Selbstverständlich«, entgegnete Helena, aber sie sah enttäuscht aus.
Sobald Lucy wieder im Auto saß und nach Hause fuhr, vergaß sie Helena rasch. In Gedanken beschäftigte sie sich bereits mit dem Geheimnis von Großonkel Rafe.
Lucy wohnte in einer winzigen Wohnung, bei deren Kauf ihr Vater geholfen hatte – nicht weit entfernt vom Kanal in Little Venice im Norden von London. Sie liebte es, auf dem Treidelpfad spazieren zu gehen und zuzuschauen, wie die Lastkähne hin- und herfuhren. Sie fand es schade, dass sie die Zeit verpasst hatte, als die Schiffe noch von Pferden gezogen wurden. Heutzutage beförderten die Kähne hauptsächlich Touristen. Im vorigen Jahr hatte sie eine Serie von Aufnahmen von der Gegend gemacht, die bei einer Ausstellung in einer Galerie in Camden recht guten Absatz gefunden hatten.
Was ihre Arbeit betraf, fühlte sie sich ein bisschen wie an einem Scheideweg. Die Fotografie war ihr Hobby, aber vielleicht konnte sie ja auch mehr daraus machen. Sie mochte die kleine TV-Produktionsgesellschaft, bei der sie arbeitete, doch sie wünschte sich mehr Verantwortung. Delilah, ihre Chefin, hatte ihr Mut gemacht.
»Die Leute fragen uns dauernd nach kurzen Dokumentarfilmen«, hatte sie gesagt. »Ernste Themen, das Leben von Frauen und so was. Bring mir ein paar Ideen.«
Lucy hatte ihr das eine oder andere vorgeschlagen, doch bis jetzt hatte es noch nicht funktioniert.
Mit siebenundzwanzig hatte Lucy noch keinen Mann gefunden, mit dem sie ihr Leben teilen wollte. Und da sie leidenschaftlich auf ihre Unabhängigkeit pochte, fragte sie sich, ob es ihn jemals geben würde. Will, den sie durch die Arbeit kennengelernt hatte, war der letzte in einer nicht sehr langen Reihe von Freunden.
In den Wochen nach dem Besuch bei Helena stellte Lucy, wenn sie es ertragen konnte, hin und wieder einen der Kartons ihres Vaters auf den Tisch in ihrer Wohnung und nahm nacheinander die Schätze heraus. Mit seinen persönlichen Dingen – eine geschnitzte Holzkiste, die Manschettenknöpfe und Krawattennadeln enthielt, die LP-Cover von seinen Lieblings-Folkbands – hielt sie sich nicht auf und verstaute sie in einem Schrank in ihrem Schlafzimmer, sodass deren schmerzhafter Anblick ihr aus den Augen und aus dem Sinn kam. Mit dem Foto von ihrer Großmutter war es anders. Sie stellte es auf den Schreibtisch und ertappte sich häufig dabei, dass sie bei der Arbeit darauf blickte. Es war seltsam, sich vorzustellen, dass die alte, gebrechliche Frau, die sie gekannt hatte, einmal dieses wunderschöne junge Mädchen gewesen war.
Lucy hatte die Mutter ihres Vaters sehr gemocht, aber die Besuche in der muffigen Londoner Mietwohnung während ihrer Kindheit waren manchmal auch eine Tortur gewesen. Es lag eine Atmosphäre schäbiger Pracht über den Räumen und die Erwartung, dass man ein perfektes Benehmen zeigte. Angelina Cardwell wollte, dass Lucy hübsch gekleidet war. Manchmal sträubte sie sich dagegen, was einen Streit zwischen ihren Eltern hervorrief. Ihre Mutter Gabriella meinte, dass jeder Mensch das anziehen durfte, was er mochte, während ihr Vater argumentierte, dass die beste Kleidung eine Form des Respekts darstellte und dass Granny Cardwell kleine Mädchen eben gern in hübschen Kleidern und anständigen Lederschuhen sah – und nicht in Jeans und Turnschuhen. Da Gabriella sich weigerte, ihren Mann und Lucy bei diesen Besuchen zu begleiten, trug Tom für gewöhnlich den Sieg davon. Als Lucy ins Teenageralter kam, fand sie allmählich Gefallen an der Herausforderung, Grannys hohen Ansprüchen zu genügen und zugleich ihr eigenes farbenfrohes Stilempfinden zufriedenzustellen. Granny hatte nichts gegen modische Kleidung, tatsächlich billigte sie sie eher.
Zu dritt saßen sie dann in den viel zu dick gepolsterten Sesseln und tranken Tee, der von Grannys polnischer Zugehfrau serviert wurde, und plauderten darüber, wie sich Lucy in der Schule machte und ob es Granny, die sehr nervös war und stark unter Arthritis litt, gut genug ging, um mit ein paar Freunden eine Kreuzfahrt zu machen. Soweit sich Lucy erinnerte, war das nie der Fall gewesen.
An einem Sonntagnachmittag, als Lucy in einer nachdenklichen Stimmung war, stöberte sie in dem Karton, den sie aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters mitgenommen hatte. In Angelinas Keksdose fanden sich eine Locke von Toms Babyhaar, die in einem zusammengefalteten Taschentuch lag, eine Geburtstagskarte mit einer kindlichen Zeichnung, die er für sie gebastelt hatte, und ein Paar gestrickte Fäustlinge. Lucy steckte einen Finger hinein. Hatte ihr Vater wirklich einmal so winzige Hände gehabt, dass sie in diese Fäustlinge passten?
Es gab einige Briefe und Postkarten, die er seinen Eltern aus der Schule oder aus den Ferien geschickt hatte. Und jede Menge Fotos: nur wenige Aufnahmen von Tom als Kleinkind, aber viele, auf denen er als Schuljunge und dann als Teenager zu sehen war. Ein Hochzeitsfoto von Angelinas Eltern und ein Bild von ihr selbst mit drei Jahren – auf dem Arm ihrer Mutter, mit dem großen grünen Teddy, den sie auf einem Rummelplatz gewonnen hatte. All das hatte ihre Großmutter in dieser Dose mit Andenken zusammengetragen. Es machte Lucy traurig und gleichzeitig glücklich, diese Dinge anzuschauen.
Sie stellte die Dose zur Seite, um nachzusehen, was sonst noch in dem Karton war. Die Ausweispapiere ihres Vaters fand sie nicht – vermutlich hatte Helena diese Dinge behalten wollen –, aber sie förderte weitere Fotos aus früheren Zeiten zutage. Unter anderem entdeckte Lucy ein einziges Bild von ihrem Großvater Gerald als jungem Mann, bevor er verwundet worden war. Sie erinnerte sich nur schwach an ihn – ein beängstigend aussehender alter Gentleman mit einem narbenbedeckten Gesicht und einem Glasauge.
Auf zahlreichen Bildern war ein elisabethanisches Haus mit hohen Schornsteinen zu sehen. Ein Schnappschuss zeigte ein elfenartiges Hausmädchen, dass in einem offenen Fenster ein Staubtuch ausschüttelte. Auf einem anderen spielten fünf Kinder Krocket auf dem Rasen: zwei Jungen, der eine dunkelhaarig, der andere blond – und beide älter als das Mädchen, das Granny war. Das jüngste Kind, ein mürrisches Mädchen mit einem viereckigen Gesicht, schielte in die Kamera und hielt seinen Krocketschläger wie ein Gewehr in die Höhe – das musste Großtante Hetty sein. Ein schlankes dunkelhaariges Mädchen hielt sich scheu im Hintergrund. Lucy hatte keine Ahnung, wer das sein konnte.
Ihre Großmutter hatte manchmal über das Haus an der Südküste von Cornwall gesprochen, wo sie aufgewachsen war. Carlyon hatte sie es genannt – Carlyon Manor. Es sei nun fort, hatte sie gesagt. Lucy war sich nicht sicher, wie sie das zu verstehen hatte. Als Nächstes förderte Lucy eine Schwarz-Weiß-Postkarte von einer kleinen Küstenstadt – Saint Florian – zutage. Dort lag Carlyon, wie sie sich jetzt erinnerte.
Sie wandte sich wieder der Fotografie mit den Kindern von Carlyon Manor zu. Es war traurig, an die Veränderungen zu denken, die der Lauf der Zeit erzwungen hatte. Grannys ältester Bruder Edward war tot, im Krieg gefallen. Großonkel Peter lebte noch, aber er wohnte in Manhattan und ließ wenig von sich hören. Großtante Hetty, eine ziemlich griesgrämige Frau, die Lucy nur bei wichtigen Familienanlässen gesehen hatte, lebte irgendwo in einem Pflegeheim und hatte sich zu schwach gefühlt, um an dem Begräbnis von Lucys Vater teilzunehmen.
Bislang gab es nichts über Großonkel Rafe. Es hatte tatsächlich den Anschein, als sei er in der Familiengeschichte ausgelöscht worden. Was, um Himmels willen, hatte er getan? Lucy grub noch einmal in dem Karton und brachte ein Foto zum Vorschein, das in einer Ecke klemmte. Sie hätte es fast übersehen. Als sie es studierte, hatte sie das Gefühl, als blicke sie in das Gesicht eines Menschen, den sie einst, vor langer Zeit, gekannt, aber dann vergessen hatte.
Konnte dieser junge Mann Rafe sein?
KAPITEL 3
Die frisch gestrichene Fassade des »Mermaid Inn« am Kai in Saint Florian erinnerte Lucy an Schlagsahne. Auf dem glänzenden Schild räkelte sich eine Sirene mit Alabasterhaut in der Brandung. Lucy lächelte über ihren neckischen Blick und ging hinein.
Der Empfangsbereich war leer, aber ein köstlicher Duft von brutzelnder Butter ließ vermuten, dass jemand in der Nähe war. Das »Ping« der Klingel rief eine junge Frau mit rundem Gesicht und einem struppigen Pferdeschwanz herbei, die sich mit einem Paket sauberer Wäsche durch den Dienstboteneingang schob, das sie neben der Rezeption ablud.
»Tut mir leid, meine Liebe, dass ich Sie habe warten lassen«, sagte sie. »Alle sind heute spät dran mit den Lieferungen. Was kann ich für Sie tun?«
»Haben Sie wohl ein Zimmer für mich? Ich habe nichts reserviert.«
»Sie haben Glück«, erwiderte die Frau. »Heute Morgen hat jemand storniert.«
Das Zimmer war erstaunlich preiswert, und das Mädchen führte Lucy mehrere Treppen hinauf. Es war nur ein enges kleines, L-förmiges Zimmer im Dachgeschoss mit Aussicht auf den Himmel, aber Lucy mochte die Gediegenheit des alten Gebäudes und den Duft von Lavendelpolitur. Nach einem Blick auf das winzige Duschbad und die kleine Kaffeemaschine war sie vollends zufrieden. Es war vielleicht ein bisschen beengt, aber für ein paar Nächte würde es sicherlich gehen.
»Ach, ich glaube, ich muss Ihnen ein paar Sachen zum Waschen geben«, erklärte Lucy dem Mädchen. Sie hatte nur für die eine Woche Urlaub mit Will gepackt.
»Kein Problem. Da im Kleiderschrank ist ein Beutel. Legen Sie ihn mir einfach raus. Ich bin übrigens Cara. Sagen Sie mir Bescheid, wenn sie noch etwas brauchen.«
Als Cara gegangen war, griff Lucy nach der Fernbedienung für den Fernseher. Sie setzte sich im Schneidersitz auf das Bett und zappte mit abgeschaltetem Ton durch die Sender. Im Nachrichtenprogramm bewegten sich Soldaten in Panzern durch eine Felsenlandschaft. Nach einer Weile drückte sie die Austaste und ließ sich in die Kissen zurücksinken. Plötzlich fühlte sie sich erschöpft. Und all ihre Ängste stürmten auf sie ein.
Warum hatte sie sich selbst hier ausgesetzt? Die Wirklichkeit holte sie allmählich ein. Was hatte sie sich bloß dabei gedacht? Sie hatte Will gekränkt – den sie ziemlich gerngehabt und der sie zu einem nicht unerfreulichen Urlaub mitgenommen hatte –, und nun hockte sie hier allein in einem Hotelzimmer, wahrscheinlich meilenweit entfernt von jeglichem öffentlichen Verkehrsmittel. Und aus welchem Grund genau?
Als die Panik nachließ, zog sie eine Kunststoffmappe aus einem Fach ihres Koffers und nahm die Seiten zur Hand, die sie auf dem Laptop ihres Vaters ausgedruckt hatte. Auf der Suche nach Rafe hatte er das Imperial War Museum besucht und bestimmte Dokumente des Nationalarchivs durchgesehen. Außer Rafes Geburtstagsdatum, 1920, und den knappen Fakten zu seiner schulischen Ausbildung und seiner militärischen Laufbahn während des Krieges hatte er nicht viel herausgefunden – jedenfalls nichts Persönliches. Es gab allerdings etwas, das ihn mit Saint Florian verband: Die Schwester von Rafes Mutter hatte hier gelebt.
In der Mappe befand sich auch ein Briefumschlag mit dem Foto, das sie ganz unten in dem Karton mit Grannys Sachen gefunden hatte. Es war das Porträt eines sehr jungen Mannes mit dichtem blondem Haar, das glatt nach hinten gekämmt war, und dessen funkelnde Augen einen fröhlichen Ausdruck hatten. Das Foto zeigte ihn, wie er sich über eine Steinmauer lehnte, den Kopf auf den Unterarm gestützt. Es stand zwar kein Name darauf, aber irgendwie wusste sie, wer er war. Der junge Mann sah ihrem Großvater Gerald sehr ähnlich, aber er war nicht Gerald. Es musste Rafe sein.
In den vergangenen drei Monaten hatte Lucy versucht, aus den Nachforschungen ihres Vaters schlau zu werden. Am Ende hatte sie mehr über Tom Cardwell in Erfahrung gebracht als über seinen Onkel Rafe.
»Hast du von Rafe gewusst?«, fragte sie ihre Mutter, als sie sie im März an einem Wochenende besuchte.
Nach der Scheidung hatte sich Gabriella in ein kleines Cottage in Nord-Norfolk zurückgezogen, wo sie große abstrakte Leinwandgemälde schuf, die sich nicht verkauften, und konventionellere Seestücke, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdiente. Gabriella wirkte glücklicher und gelassener als in den Monaten zuvor. Lucy fragte sich, ob ein Mann namens Lewin, dem eine Kunstgalerie im Ort gehörte und den Gabriella im Gespräch immer wieder erwähnte, etwas damit zu tun hatte. Wenn es so war, dann war sie froh darüber. Gabriella Cardwell war noch keine sechzig und verdiente ein bisschen Glück.
»Nein, dein Vater war ziemlich verschlossen«, sagte Gabriella und streichelte ihre schöne langhaarige Tigerkatze. »Ganz anders als Lewin. Wir sprechen über alles.« Lucy war diese Art der Argumentation vertraut. »Dein Vater war puritanisch erzogen, weißt du. Diese elitären Internate sind für so vieles verantwortlich, und was seine Mutter betrifft … Oh, ein Albtraum – total besitzergreifend! Ich habe sofort gewusst, was sie über mich dachte. Aber trotz all unserer Differenzen waren Tom und ich glücklich miteinander, Lucy. Wirklich sehr glücklich!« Sie sah ihre Tochter bittend an.
»Ich weiß, Mum«, sagte Lucy leise.
»Erst als deine Granny gestorben ist und du uns dann verlassen hast, um aufs College zu gehen – nicht dass ich dir die Schuld gebe, Liebling, natürlich nicht. Da erst hat er sich verändert und wurde furchtbar schwermütig. Aus Kummer, vermute ich. Aber wir hätten das trotzdem durchgestanden, wenn nicht dieses Weibsstück aufgetaucht wäre!« Sie wandte ihren Blick nach Süden, als könnte sie Helena, die angespannt in ihrem nichtssagenden Zuhause in Suffolk saß, selbst über diese Entfernung hinweg mit ihrem zornigen Blick versengen.
Lucy versuchte, beim Thema zu bleiben. »Und er hat seinen Onkel Rafe nie erwähnt?«, fragte sie.
»Nicht mit einem Wort. Grandad Gerald ging es zum Schluss nicht besonders gut, und was er sagte, ergab nicht viel Sinn. Ich erinnere mich, dass er als Kind in Indien gelebt hat – ich hab dir ja schon erzählt, dass ich ein wunderschönes Jahr im Aschram verbracht habe, bevor ich deinen Vater kennenlernte. Von einem jüngeren Bruder habe ich nie etwas gehört.«
Als sie sich an dieses Gespräch erinnerte, legte Lucy das Foto und die Notizen beiseite. Sie nahm ihre Tasche und die Kamera und ging die Treppe hinunter. Sie wollte sich in dem Städtchen umsehen. Cara, die im Eingangsbereich mit Staubsaugen beschäftigt war, nickte Lucy aufmunternd zu, als diese sich von einem Stapel auf dem Empfangstresen einen kostenlosen Stadtplan für Touristen nahm.
Lucy spazierte durch verwinkelte Straßen und schaute sich den Hafen an, wo sie den stechenden Geruch von Öl, Farbe und nassen Tauen einatmete und sich vorzustellen versuchte, wie es hier wohl zwischen den Kriegen ausgesehen haben mochte. Jedenfalls nicht so wie auf einer Postkarte. Kein »Spindrift«-Geschenkladen und keine »Surf Girls«-Boutique mit plärrender Popmusik. Wahrscheinlich war es eine ganz normale Stadt gewesen, mit Lebensmittelläden und einem Bäcker, mit Pensionswirtinnen und Fischernetzen, die in der Sonne trockneten. Die Pfarrkirche war wohl noch immer die gleiche. Bestimmt gab es ein paar Gedenkstätten, aber wohl keinen richtigen Friedhof. Als Lucy die Eichentür der Kirche öffnen wollte, stellte sie fest, dass sie verschlossen war.
Das kleine Museum, an dem sie in einer der Gassen vorbeikam, hätte sie interessiert. Aber dem Aushang auf der Tür war zu entnehmen, dass es mittags zwischen zwölf und zwei geschlossen war – sie war ein paar Minuten zu spät gekommen.
Schließlich kaufte sie sich zum Mittagessen eine Tüte Chips und einen Müsliriegel. Sie setzte sich auf die Kaimauer, schaute sich die Umgebung an und komponierte in Gedanken ein paar Fotos. Eine innere Ruhe überkam sie, und sie dachte darüber nach, dass sie sich mit diesem Ort verbunden fühlte, obwohl sie nicht hier geboren war. Niemand wusste, dass sie hier war – außer Will natürlich –, und niemand stellte irgendwelche Ansprüche an sie.
Die Boote im Hafen zogen ihren Blick auf sich. Die Flut kam rasch, und ein halbes Dutzend kleiner Schiffe tanzte sicher und geborgen innerhalb der Umfassungsmauern. An einem Anlegesteg vertäute ein braun gebrannter, breitschultriger junger Mann sein Segelboot. Ein ganz besonders schönes Schiff, dachte Lucy, mit seiner weißen Kabine und einem Rumpf, der genau in dem blassen Blau eines Rotkehlchen-Eis angestrichen war. Eine sehr passende Farbe – das Boot trug den Namen Early Bird. Lucy fand, dass es das perfekte Motiv für den Vordergrund einer Aufnahme vom Hafen abgeben würde.
Als das Boot gesichert war, beobachtete sie, wie der Mann hineinstieg und sich daranmachte, es abzudecken. Sie wusste überhaupt nichts über Boote, aber ihr gefiel die Vorstellung, auf Wind und Wellen zu reiten und den Elementen nahe zu sein. Der Mann zog eine Abdeckung über das Kabinendach und befestigte sie, warf sich dann einen Seesack über die Schulter und schlenderte über den Anlegesteg auf sie zu. Als er an ihr vorüberging, lächelten sie sich an. Er hatte kurzes rötlich braunes Haar, blaue Augen mit blonden Wimpern und ein kräftiges, offenes Gesicht.
Sie aß den Müsliriegel auf und ließ die Verpackung in einen Abfallkorb fallen. Also gut, sie wusste zwar nicht, was sie hier tun sollte, aber irgendwas würde sich ergeben, da war sie sicher. Das Licht war perfekt. Sie machte sich daran, ein paar Fotos zu schießen.
Das Saint-Florian-Museum machte um zwei wieder auf. Als Lucy hineintrat, schaute ein Mann mit grauem Bart auf – er steckte Touristik-Informationsbroschüren in einen Drehständer – und begrüßte sie.
»Hallo«, sagte sie. »Ich würde mich gern mal umschauen.«
»Tun Sie das«, antwortete er und sah sie über seine Brille hinweg an. »Deshalb sind wir ja hier. Der Eintritt ist kostenlos – wir sind auf Spenden angewiesen.« Er wies auf eine Sammelbüchse auf dem Tresen. »Es gibt bloß zwei Räume. Wir waren übrigens früher ein Süßwarengeschäft.«
Lucy kramte ihr Portemonnaie heraus und ließ ein paar Münzen in die Büchse fallen. Sie konnte sich die Regale im Erkerfenster leicht voller Gefäße mit Süßigkeiten vorstellen – jetzt prangten dort hübsche Steine und Muschelschalen. Außerdem gab es eine kleine Auswahl von Erinnerungsstücken aus dem Zweiten Weltkrieg: eine Gasmaske, eine Lebensmittelkarte und einen Teddybären, der einem evakuierten Kind gehört hatte.
»Möchten Sie irgendetwas Spezielles sehen?«, erkundigte sich der Museumsdirektor. »Die Ausstellung über den Krieg ist im hinteren Raum, und da drüben haben wir ›Das Leben eines viktorianischen Fischers‹ als Frühjahrsausstellung. Die Leute bringen uns dauernd Sachen, deshalb ändert sich bei uns häufig der Schwerpunkt.«
»Haben Sie vielleicht irgendwas über Carlyon?«
»Das alte Herrenhaus?«, fragte er. »Sie wissen, dass es jetzt nur noch eine Ruine ist?«
»Ja, es ist so traurig. Was ist passiert?«
»Das Feuer? Ich glaube, es war kurz nach dem Krieg. Weshalb interessiert Sie das?«
»Meine Großmutter ist dort aufgewachsen. Bevor sie geheiratet hat, hieß sie Angelina Wincanton.«
»Sie war eine Wincanton? Also, der Name war mal sehr bekannt hier in der Gegend. Ich dachte, die Familie wäre ausgestorben.«
»Das sind sie auch – so gut wie«, erklärte Lucy mit einem kläglichen Lächeln. »In meiner Generation gibt es noch ein paar Cousins und Cousinen zweiten Grades in Neuseeland, die ich noch nie gesehen habe – und mich. Ich heiße übrigens Lucy. Lucy Cardwell.«
»Ich bin Simon Vine«, sagte er. »Ich hab wirklich nicht viel über das Haus, um ehrlich zu sein, aber vielleicht gibt es etwas im Lagerraum. Wonach genau suchen Sie denn?«
»Wirklich alles, was mit den Wincantons zu tun hat.«
»Lassen Sie uns mal nachschauen«, sagte Simon. »Ich überlege gerade, wen ich kenne, der Ihnen helfen könnte, aber es fällt mir keiner ein … Ah! Da war eine Frau, die kürzlich reingekommen ist – wie zum Teufel hieß sie noch? Warten Sie einen Augenblick, ich sehe nach.«
Er verschwand im hinteren Raum, und Lucy hörte, wie sich eine Tür öffnete. Sie folgte dem Mann, um sich die Ausstellung über den Krieg anzusehen. Es gab noch mehr Dinge wie die, die sie im Fenster gesehen hatte: alte Kleidergutscheine, einen Brief von einem Soldaten an seine Freundin, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von einem Beobachtungsposten aus Beton. Dahinter sah man einen Strand, der von spiralförmigem Stacheldraht übersät war.
Nach ein paar Minuten kam Simon Vine mit zwei flachen Holzkästen mit Glasdeckeln zurück. »Hier, bitte schön«, sagte er und stellte sie vor Lucy auf dem Tisch ab.
»Oh«, entfuhr es Lucy. »Wie merkwürdig!« Jeder Kasten enthielt Reihen von Insekten, die mit Nadeln auf Kork festgesteckt waren: Schmetterlinge, deren Flügel so farbenfroh gemustert waren wie an dem Tag, als man sie befestigt hatte – verschiedene Arten von Motten und ein riesiger Käfer. Alles war sorgfältig mit winzigen Papierstreifen etikettiert.
»Und wie könnte mir das weiterhelfen?«, fragte Lucy.
»Diese Frau hat sie vor ein paar Monaten gebracht. Sie sagte, sie hätte sie als junges Mädchen hier in der Gegend gefangen. Wir haben hier also eine Momentaufnahme der Naturgeschichte aus den Dreißigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts, was ziemlich faszinierend ist. Ich denke, sie könnte Ihnen ein paar nützliche Geschichten erzählen. Ich hab ihren Namen und ihre Adresse irgendwo aufgeschrieben.« Er nahm ein DIN-A4-großes Heft aus einer Schublade des Tresens und fing an zu blättern.
»Manchmal laufen wir uns zufällig über den Weg. Ich kann mir ihren Namen nicht merken, aber sie erinnert sich immer an meinen, obwohl sie bestimmt schon über achtzig ist. Warten Sie!« Er sah auf das Etikett, das auf einem der Kästen klebte, und blätterte ein paar weitere Seiten um. »Hier haben wir’s. Mrs Beatrice Ashton. Und das Haus ist an der Straße, die zum Klippenpfad führt. Diese Frau kann Ihnen bestimmt etwas über diesen Ort vor dem Krieg erzählen.«
»Beatrice Ashton?« Hatte sie richtig gehört?
»Ja. Ich sage Ihnen was … Wohnen Sie im Moment in Saint Florian?«
»Ja, im ›Mermaid‹.«
»Was halten Sie davon, wenn ich heute Abend auf dem Heimweg mal bei ihr vorbeischaue und sie frage, ob sie Sie treffen möchte.«
Lucy verließ das Museum und seinen Direktor und konnte ihr Glück kaum fassen. Beatrice Ashton. Der Name war bestimmt kein Zufall. Wer konnte sie sein? Rafes Frau oder irgendeine andere Verwandte? Lucy hatte sich Simon Vines Wegbeschreibung zu Mrs Ashtons Haus sorgfältig notiert, obwohl sie innerlich aufgewühlt war.
Sie verbrachte den Rest des Nachmittags damit, das Städtchen zu erkunden, bevor sie zum Hotel zurückkehrte. Es war ein merkwürdiges Gefühl, an einem Samstagabend allein zu sein und nichts Bestimmtes vorzuhaben. Als sie wieder in ihrem Zimmer war, legte sie sich einen Moment hin und nahm dann ein frühes Abendessen in der Hotelbar zu sich. Sie erkundigte sich bei Cara, aber es gab keine Nachricht von einer Mrs Ashton. Nach einem letzten Blick auf den Hafen ging sie früh zu Bett und vertiefte sich in ein Buch.
Um halb zehn rief Will an. »Oh, du hast ja da doch ein Netz!«, sagte er. »Ich hab’s schon mal versucht.«
»Wann warst du zu Hause?«, fragte sie.
»Gegen fünf. Hör mal, Lucy, ich mach mir Sorgen um dich. Ich hätte dich nicht so zurücklassen sollen.«
»Vermutlich ist dir nichts anderes übrig geblieben. Und es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen – wirklich nicht.« Sie erzählte ihm von dem möglichen Treffen mit Beatrice Ashton, aber er hörte ihr nicht zu.
»Wie lange willst du bleiben?«, fragte er.