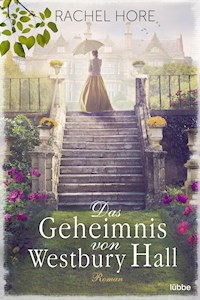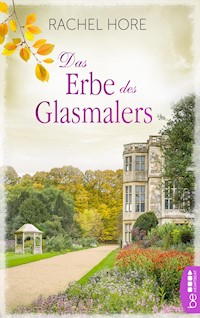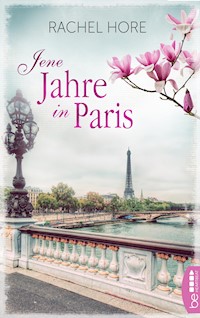9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rosa ist nach London gekommen, um ihren Bruder zu suchen. Stef läuft vor ihrem Freund davon, der sie in seiner sterilen Luxuswohnung mit seiner Fürsorge erdrückt. Der schüchterne Rick wiederum würde sich am liebsten in ein Loch verkriechen, um zu schreiben, zu zeichnen, zu träumen. Ob alt ob jung, ob Mann ob Frau: Wer in Not gerät, findet in Leonies Haus in Bellevue Gardens eine Zuflucht. Doch Leonie hat selbst Probleme mit ihrem unsteten Enkelsohn - und droht das Haus für immer zu verlieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitate
Einleitung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Dank
Über die Autorin
Rachel Hore, geboren in Epsom, Surrey, hat lange Zeit in der Londoner Verlagsbranche gearbeitet. Zuletzt war sie Lektorin bei Harper Collins Publishers. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen in Norwich. Sie arbeitet als freiberufliche Lektorin und schreibt Rezensionen für den renommierten Guardian. Dies ist ihr siebter Roman.
Rachel Hore
Wo dasGlückzuhause ist
Roman
Aus dem Englischen vonBarbara Röhl
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by Simon & Schuster UK Ltd., A CBS CompanyTitel der englischen Originalausgabe: »The House on Bellevue Gardens«Originalverlag: Simon & Schuster
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Birgit Volk, BonnTitelillustration: © shutterstock/Vadim Ivanov; © shutterstock/Ola-laUmschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
eBook-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3098-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
In unserer Kultur ist das Leben der meisten Menschen vollgestopft mit Überflüssigem; Gewohnheiten, Aktivitäten, Besitztümern. Die meisten von uns sind an Händen und Füßen gefesselt; nicht buchstäblich, sondern durch unsere Träume, unsere Vorurteile und unsere Ängste.
Greta McDonough, »The Clary Ghost«
Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber des Menschen Sohn hat nichts, da er sein Haupt hin lege.
Matthäus 8, Vers 20
Zu Hause ist der Ort, wo man dich aufnehmen muss, wenn du nirgendwo anders mehr hingehen kannst.
Hinter einer belebten Straße im Norden von London, in Camden, liegt versteckt ein kleiner von Häusern umgebener Park. Man könnte daran vorbeigehen, ohne etwas von seiner Existenz zu ahnen. Die Reihenhäuser sind weiß und sehen mit ihrem Stuck aus wie riesige Hochzeitskuchen mit üppigem Guss. Irgendwann im Lauf seiner Geschichte hat ein Unbekannter diese Wohngegend Bellevue Gardens genannt. Viele der Häuser sind in Einzelwohnungen aufgeteilt worden. Ihre Ruhmeszeiten liegen lange zurück, aber einst waren sie das Zuhause wohlhabender Mittelschichtfamilien, deren Väter Anwälte oder Banker waren und deren Kinder unter den wachsamen Blicken ihrer Nannys auf den gepflegten Rasenflächen in den rückwärtigen Gärten oder in dem verwilderten Park spielten, während ihre Mütter reihum in den Salons Tee tranken und Abendessen oder Whist-Turniere für einen wohltätigen Zweck organisierten und sich mehrmals täglich umkleideten. Die bürgerliche Welt eines lange vergangenen Zeitalters.
Viel mehr gibt es nicht zu sagen. In den 1890er-Jahren besuchte Oscar Wilde Freunde in Nummer 13, und eine Plakette erinnert daran, dass einst eine berühmte Schauspielerin aus der Zeit Edwards VII. Nummer 34 bewohnte. Drei Häuser an der Nordseite tragen immer noch die Narben des Zweiten Weltkriegs – missgestaltete Kamine, Dächer, die wie ein Flickenteppich wirken, schiefe Winkel.
Manchmal, wenn Leonie Brett an einem warmen Sommerabend spät nach Hause kommt, fällt es ihr leicht, die Reihen parkender Autos und das ferne Grollen des Londoner Verkehrs zu vergessen, und sie stellt sich vor, wie stattdessen Pferdehufe auf den Pflastersteinen Funken schlagen, das Zaumzeug hell klirrt und Kutschenräder knarren. Die Musik und das Gelächter, die aus einem offenen Fenster dringen, könnten von einer Gesellschaft aus einem anderen Jahrhundert herrühren, auf der junge Mädchen mit strahlenden Augen in weißen Kleidern mit bunten Schärpen tanzten, frisch und liebreizend wie Blumen.
Obwohl es heute heruntergekommen ist, ist Leonie überzeugt davon, dass ihr Haus – Nummer 11 – einst das prachtvollste an dem Park gewesen sein muss. Es befindet sich in der Mitte der linken Häuserreihe, und dass es nur eine Türklingel besitzt, ist schon ein Hinweis darauf, dass es nicht in Wohnungen aufgeteilt wurde. Es besitzt auch ein prunkvolles Portal, das es besonders einladend wirken lässt. Leonie erinnert sich daran, wie sie an einem Tag vor vierzig Jahren als verängstigte Ausreißerin darunter Schutz vor dem Regen suchte, wie sie ihre Taschen im Foyer abstellte und durch die weitläufigen Zimmer mit den glänzenden Parkettböden, den hohen Decken und den großen, kantigen Kaminen wanderte. Mit seinen schweren Mahagonimöbeln, die zu polieren eine Plage war, wirkte das Haus damals sehr beeindruckend. An den Wänden hingen früher Ölgemälde, aber im Lauf der Jahre sind sie verkauft worden, um Rechnungen zu bezahlen.
Die Küche ist immer noch das Herz des Hauses, doch heute ist der schöne Eichentisch voller Farbspritzer und Teeflecken, und es stehen Kerzen darauf, die in leere Weinflaschen gerammt wurden und im Laufe der Zeit Stalaktiten aus Wachs erzeugt haben. Der Garten war einst im italienischen Stil gestaltet. Heute ist er ein wundervolles verwildertes Paradies. Nur ein paar Hecken erinnern noch an die elegante Vergangenheit.
Eins
Leonie
2015
Es war ein Tag voller Erinnerungen gewesen – so viele waren in ihr aufgestiegen –, aber auch ein Tag der Trauer. So war das immer mit Trudi, überlegte Leonie, während sie von der U-Bahn-Station nach Hause lief. Sie traf sich sehr gern mit ihrer alten Freundin. Es kam allerdings nur selten dazu, denn Trudi war immer unglaublich beschäftigt, besuchte ihre verheiratete Tochter in New York oder machte Urlaub in Florida. Doch so erfrischend ihre Gesellschaft war, Trudi konnte manchmal auch anstrengend sein.
Als sie in die von Läden und Büros gesäumte Straße einbog, die sie schließlich nach Bellevue Gardens führen würde, dachte Leonie an einen Satz, den einer von Trudis Exmännern – es gab drei davon – einmal gesagt hatte, und lächelte. Trudi sähe sich selbst als Star ihrer eigenen Show, und alle anderen wären bloß Zuschauer. Voller Verbitterung hatte er das vorgebracht, und auch wenn das nicht die ganze Wahrheit war – Trudi hatte auch eine fürsorgliche und großzügige Seite –, steckte mehr als ein Körnchen Wahrheit darin. Trudi hatte schon immer einen Hang zum Theatralischen gehabt. Selbst jetzt, mit über siebzig, war ihr Leben eine bunte Folge von Intrigen und Krisen – wenigstens tat sie so. Heute hatten sie sich zum Mittagessen in ihrer Maisonettewohnung in Chelsea getroffen, die eine wunderbare Aussicht auf den Fluss hatte. Dabei hatte Trudi ihr mit vor Aufregung strahlenden Augen erzählt, dass ihr neuer Nachbar von unten – der mit seinem eisengrauen, mit Pomade zurückgekämmten Haar einfach ein Gangster im Ruhestand sein musste – ihr in letzter Zeit ständig Blumen und Schokoladentrüffel von Fortnum’s schickte und sich absolut nicht davon abbringen ließ. Als Leonie ironisch gefragt hatte, ob Trudi es denn auch energisch genug versucht hätte, hatten die grünen Augen ihrer Freundin boshaft geblitzt. »Und wie geht’s dem alten Kauz, den du dir im Keller hältst? Wirklich, Schätzchen, du und deine lahmen Enten.«
»Sie sind nicht lahm«, gab Leonie zurück. »Sie können ausgezeichnet laufen.« Bis auf Bela vielleicht, die ältere Dame aus Kaschmir, die wegen ihrer Ballenzehen in Pantoffeln herumschlurfte. »Ein paar von ihnen hatten Pech im Leben, das ist alles.«
Leonie runzelte die Stirn. Obwohl Trudi und sie einander immer noch sehr gern mochten, war es komisch, wie unterschiedlich sich ihrer beider Leben entwickelt hatte, seit sie sich vor vielen Jahren zusammen mit einem dritten Mädchen eine Wohnung über einem Laden in der Edgware Road geteilt hatten. Da war Trudi, gut betucht und weit gereist, die kürzlich ihr neues Luxus-Apartment mit Aussicht auf die Boote im Jachthafen bezogen hatte, und hier war sie, Leonie Brett, die gerade in ihre Straße aus georgianischer Zeit einbog, wie sie es schon Tausende Male zuvor getan hatte. Trotzdem freute sie sich jedes Mal wieder, in das Haus heimzukehren, das sie im Lauf der Jahre mit so vielen Freunden geteilt hatte.
Heute Abend wirkte der Platz im Licht eines spektakulären Sonnenuntergangs wie mit Flammen übergossen. Wunderschön. Sie blieb stehen, um die Silhouetten der ausschlagenden Platanen vor dem Himmel zu bewundern und die stattlichen Häuser zu betrachten, die im Schein der versinkenden Sonne in einem pfirsichfarbenen Ton leuchteten. Dieser abgelegene Platz war immer so friedlich. Aus dem Park drang das satte Trällern einer Amsel, das zweifellos den anderen geflügelten Anwohnern signalisierte, dass in ihrer Welt alles gut war.
Als sie die Straße überquerte und die bohemienhafte Schäbigkeit von Nummer 11 erblickte, tat ihr Herz einen kleinen, zufriedenen Satz; das Haus wirkte wie ein derangiertes Aschenbrödel inmitten seiner prächtiger gekleideten Schwestern. Die Nachbarn – größtenteils junge, gut ausgebildete Berufstätige, die sich um die umgebauten Wohnungen gerissen hatten – mochten die Stirn über die abblätternde Farbe und das Unkraut, das aus den Regenrinnen wuchs, runzeln, aber sie liebte das Haus mit allen seinen Makeln. In einer Lebenskrise war es ihr zum Zuhause geworden, und dafür öffnete sie es seitdem anderen, die einen sicheren Unterschlupf brauchten.
Nachdem sie sich zwischen zwei eng hintereinander geparkten Autos durchgequetscht hatte, blieb sie auf dem Gehweg verblüfft stehen. Denn ein Fuchs trabte auf sie zu, nach der zarten Gestalt zu urteilen, ein Weibchen. Einen oder zwei Meter entfernt blieb es abrupt stehen, und seine obsidianschwarzen Augen leuchteten in der einbrechenden Dunkelheit. Eine lange Sekunde starrten sie einander an, die Frau und die Füchsin, dann drehte sich das Tier um und rannte davon.
Heutzutage gab es viel mehr Füchse als früher. Nachts spielten sie ausgiebig und laut und ließen ihr Spielzeug auf den Rasen liegen: alte Schuhe, zerkaute Tennisbälle und einmal einen Taubenflügel. Die Gärten waren ihre Spielplätze, Mülleimer ihre Futtertröge, Höhlen unter Schuppen oder Dornenbüschen ihr Zuhause. Genau wie ihr Haus ein Zufluchtsort für viele Menschen gewesen war. Mit Wehmut sah Leonie zu, wie der buschige Schwanz der Füchsin durch das Geländer verschwand, das den Park umgab. Es war, als habe das wunderschöne Wesen mit seiner Wildheit etwas von ihrer eigenen mitgenommen. Leonie dachte an ihren Enkel Jamie. Noch ein ungezähmtes Wesen, das vor ihr davongelaufen und verschwunden war.
Während sie die Treppe zu Nummer 11 hinaufging, suchte sie in ihrer Handtasche nach den Schlüsseln und hob ein dickes Paket auf, das unter dem Vordach lag. Als sie die Tür aufstemmte, verspürte sie dieses wunderbare Gefühl von Erleichterung, das immer in ihr aufstieg, wenn sie das Haus betrat. Sie sog die Luft ein und drückte die Tür hinter sich zu. Sie liebte den Geruch nach altem Holz und Möbelpolitur, der von dem Duft der Lilien, die in einer Vase auf der schweren Flurgarderobe standen, und heute auch von einem starken Hauch Terpentin überlagert wurde.
Sie musterte das Adressetikett auf dem Päckchen und sah, dass es für Belas Mann Hari war. So klumpig wie sich der Inhalt anfühlte, handelte es sich zweifellos um Nachschub für seine verwirrende Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln. Sie legte es auf die Garderobe und blätterte den Poststapel durch. Die Stromrechnung und ein paar Wurfsendungen, ein Brief für Peter, den »Kauz«, der die Kellerwohnung bewohnte, und wie immer Post für Mieter, die hier schon lange nicht mehr wohnten. Ein Modekatalog für Jennifer, die nicht als solche arbeitende Schauspielerin, und ihre stille kleine Tochter, die vor einem Jahr nach Cornwall gezogen waren. Eine Ansichtskarte vom Strand in Frinton für den lieben alten Norman, den Krankenhauspförtner, der vor ein paar Wochen in Rente gegangen und zu seinem Bruder nach Newcastle gezogen war. Sie legte die letzteren beiden Briefe beiseite, um sie ihren Empfängern nachzuschicken, und suchte nach einer Nachricht von Jamie. Letzte Woche hatte sie Geburtstag gehabt und gehofft, er würde vielleicht daran denken. Möglicherweise hatte er das auch, versuchte sie sich zu beruhigen, aber die Mühe, eine Karte und eine Briefmarke zu besorgen, war wohl mehr, als sie von ihm erwarten konnte.
Seufzend drehte sie einen steifen braunen Umschlag um. Als sie oben den Namen eines Anwalts aufgedruckt sah, schnalzte sie leise mit der Zunge. Wahrscheinlich war es noch eine Beschwerde von nebenan. Sie wusste, was darin stehen würde. Eine grundlegende Sanierung der gemeinsamen Wand, bla, bla, bla, und wie, bitte, sollte sie das bezahlen? Sie warf die andere unerwünschte Post in die oberste Schublade und knallte sie zu, den braunen Umschlag jedoch ließ sie trotzig hinter die Garderobe fallen. Aus den Augen, aus dem Sinn, erklärte sie ihrem Bild in dem angelaufenen Spiegel. Sie hängte ihren Mantel an einen Haken und ging in die Küche. Doch sie war immer noch beunruhigt. Ich denke später über den Brief nach, sagte sie sich. Das war ihre erprobte Herangehensweise, um mit unlösbaren Problemen umzugehen. Wenn man sie lange genug vor sich hinschmoren ließ, lösten sie sich manchmal von ganz allein. Während sie Wasser in den Kessel füllte, wanderten ihre Gedanken erneut zu Jamie. Manchmal war es auch nicht so.
Rosa
Als Rosa aus dem Bus gestiegen war und in dem frühmorgendlichen Halbdunkel auf dem Vorplatz des Busbahnhofs stand, erinnerte sie der heiße Gestank der Dieselabgase und das Dröhnen der Motoren an zu Hause und den Busbahnhof, an dem sie vor sechsundzwanzig Stunden aufgebrochen war. Bleierne Müdigkeit und Nervosität angesichts der Aufgabe, die vor ihr lag, vermittelten ihr das surreale Gefühl, in einem Albtraum gefangen zu sein.
Der Fahrer zerrte Gepäckstücke aus dem dunklen Bauch des Fahrzeugs, und sie wartete geduldig, bis er den kleinen Rollkoffer heraushob, der ihrer Mutter gehört hatte. Sie nahm ihn entgegen und stieß einen verblüfften Ausruf aus.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte er in ihrer gemeinsamen Sprache.
»Er ist kalt, das ist alles.«
Er stieß ein rauchiges Lachen aus. »Gehört alles zur großen britischen Begrüßung. Vergessen Sie nicht, dieser Tunnel führt unter dem Meer hindurch.«
»Ja, natürlich«, stammelte sie. Sie dankte ihm, trat beiseite, hängte sich ihre Handtasche quer über die Brust, wo sie sicherer war, und musterte das Durcheinander aus Menschen und Fahrzeugen, das sie umgab. Auf der anderen Seite des Platzes, hinter den Absperrungen, fiel ihr auf einer Tür ein vertrautes Symbol ins Auge. Sie stellte den Koffer auf die Räder und ging darauf zu.
In der Toilette angekommen, stellte sie sich in eine Schlange von Frauen und Kindern, die gerade aus den Morgenbussen gestiegen waren und deren Augen vom Schlaf noch ganz verquollen waren. Als eine Kabine frei wurde, schloss sie sich ein, holte Feuchttücher und saubere Unterwäsche aus ihrem Koffer und machte sich frisch, so gut sie konnte.
Als sie anschließend an einem der Becken stand und der scharfe Geschmack der Zahnpasta sie vollends aufweckte, sah sie in den Spiegel und meinte einen unheimlichen Moment lang, es wäre ihr Bruder, der ihren Blick erwiderte. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen wie die von Michal und waren tiefblau, nur dass sie darin heute Morgen statt ihres üblichen ernsten Ausdrucks seine zu Herzen gehende Verletzlichkeit erblickte. Die restlichen Züge – der breite Mund, das trotzig gereckte Kinn und die kurze, gerade Nase – waren beruhigenderweise ihre eigenen. Sie ließ die Schatten unter ihren Augen unter Abdeckcreme verschwinden. Doch andere Frauen warteten darauf, dass das Waschbecken frei wurde. Daher brachte sie mit schnellen Fingern ihren dunklen Pony in Form, biss sich auf die Lippen, damit sie rot wurden, und sammelte ihre Besitztümer ein. Ein letzter Blick in den Spiegel galt Michals flehenden Augen. Ich werde dich finden, versprach sie ihm lautlos, bevor sie die Toilette verließ.
Zurück in der Eingangshalle studierte sie die Hinweisschilder, bis sie sicher war, die Wörter Ausgang und U-Bahn identifiziert zu haben. Dann steuerte sie ihren Koffer in die angezeigte Richtung und vereinte sich mit der menschlichen Flut, die zum Tageslicht emporstieg.
Nach dem schmuddeligen Teil von Warschau, den sie hinter sich gelassen hatte, beeindruckte sie draußen zuerst die Sauberkeit der Londoner Straßen. Ihr gefielen die eleganten alten Häuser und ihre gedeckten Grau- und Brauntöne, die in einen Himmel von einem ganz zarten Blau hinaufstrebten. Auf der anderen Straßenseite löste sich eine cremefarbene Limousine von der Bordsteinkante, glitt davon und enthüllte eine bunte Ladenfront, vor der Kisten mit taufeuchten Äpfeln, Orangen und Bananen und Eimer mit fertig gebundenen Narzissensträußen standen. Mit einem Mal verspürte sie Hunger. Ihr Frühstück hatte aus einem Brot mit kaltem Fleisch bestanden, das sie vor Stunden gegessen hatte, als der Bus in Calais gewartet hatte. Sie dachte an die Schokolade in ihrer Umhängetasche. Wenn sie die verzehrt hatte, würde sie ihre sorgfältig gehorteten Bargeldreserven angreifen müssen. Sie wusste, London war teuer.
Sie zog ein Stück Papier aus ihrer Manteltasche und faltete es auseinander. Dann ging sie an der Ampel über die Straße. Während sie den Schildern zur U-Bahn folgte, wuchs ihre Beklommenheit. Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern, dann würde sie es wissen. Was wissen? Wenigstens etwas. Das wäre besser als das Schweigen und die furchtbare Ungewissheit, unter der sie nun schon seit so vielen Monaten litt.
Als sie in dem schaukelnden Waggon saß, der nordwärts durch die Tunnel polterte, warf sie ihren Mitpassagieren verstohlene Blicke zu. Eine junge Frau mit einem schwarzen Kopftuch beugte sich über einen Kinderwagen. Ein intellektuell wirkender Asiate musste sich zu seiner vollen Größe recken, um die Haltestange an der Decke zu erreichen. Neben ihr saß eine kugelrunde Großmutter und kuschelte mit einem Kleinkind, das Rosa aus Augen, die wie kleine dunkle Sterne leuchteten, ansah. Zwei blasse Jugendliche in Jogginganzügen strichen durch den Wagen wie Panther. Es verblüffte sie, dass so viele unterschiedliche Menschen hier auf engem Raum zusammengedrängt waren und doch weder miteinander sprachen noch neugierig aufeinander zu sein schienen. Stattdessen lauschten die Jugendlichen über Ohrhörer Musik, die nur sie hören konnten. Einige Fahrgäste lasen in den Gratiszeitungen mit den blauen Schlagzeilen, die in dem Waggon herumflogen. Andere starrten auf ihre Smartphones. Sie sah noch einmal auf ihrem eigenen Handy nach für den Fall, dass Michal auf die SMS geantwortet hatte, die sie aus Dover geschickt hatte. Aber hier unten in dem grellen blauweißen Licht, tief unter der Stadt, hatte sie keinen Empfang.
Der Zug hielt an einem halben Dutzend Stationen, bis der Name, nach dem sie Ausschau hielt, auftauchte. Sie wartete, bis sich die Türen öffneten, dann wuchtete sie ihren Koffer hindurch und manövrierte ihn durch einen Gang mit weißgekachelten Wänden, mehrere Treppen hoch und durch eine Ticketschranke nach draußen.
Am Ausgang der U-Bahn-Station blieb sie stehen und sah sich um. Sie stand an einer belebten Kreuzung, sah aber keine Straßenschilder. Sollte sie sich nach rechts oder links wenden? »In welche Richtung geht es zur High Street?«, fragte sie eine gelangweilt wirkende Angestellte, die vor dem Eingang stand. Die Frau wies auf eine große Karte, die an der Wand hing.
Der Weg zum Haus ihres Vaters dauerte zwanzig Minuten. Die Straße führte sie einen Hügel hinauf, vorbei an modernen Wohnblocks mit ungepflegten Rasenflächen, kleinen Läden und einer Kirche aus dunklem Backstein, deren kurzer, dicker Turm so ganz anders wirkte als die ätherischen englischen Kirchtürme, die sie im Fernsehen gesehen hatte. Rosa erkannte nichts davon wieder, aber andererseits war sie aus London fortgegangen, als sie noch klein war. Es war schon über zwanzig Jahre her. Eine rotblaue Schaukel in einem von Dornenranken überwucherten Garten. Grobe Holzstufen, die in einer kalte, muffig riechende Dunkelheit hinabführten. Eine Schildpatt-Katze, die sie aus gelben Augen feindselig anstarrte und dann durch eine Katzenklappe verschwand. Das waren ihre einzigen Erinnerungen an das Haus.
Eines der Räder ihres Koffers blockierte ab und zu, sodass er vor allem an den Bordsteinkanten immer wieder ins Schlingern geriet. Vor Schlafmangel und Hunger war ihr schwindlig, und die nervöse Vorahnung schnürte ihr den Hals zu, sodass ihr Herz bei jedem Schritt schneller zu schlagen schien. Als sie die richtige Abzweigung erreichte, bog sie nach links in eine Straße mit pastellfarben gestrichenen Häusern ein. Dort setzte sie sich einen Moment auf ein Mäuerchen, um wieder zu Atem zu kommen und das letzte Stück Schokolade zu essen. In der Nähe pickte im Rinnstein eine Taube an den Überresten eines Hähnchenschenkels herum, und ihr drehte sich der Magen um.
Sie trank einen Schluck Wasser aus der Flasche in ihrer Tasche, und langsam kehrte ihr Mut zurück. Nicht mehr lange, sagte sie sich, als sie wieder aufstand. Nicht mehr lange, dann wüsste sie Bescheid.
Bei jeder der drei Nebenstraßen, die sie passierte, sank ihre Hoffnung, bevor sie schließlich bei dem Schild »Dartmouth Street« wieder wuchs. Sie blieb stehen, um sich umzusehen. Sie suchte nach etwas Vertrautem. Bildete sie sich nur ein, dass sie diese im Bogen errichteten Doppelhäuser aus rotem Backstein mit ihren weiß gestrichenen Balkonen im ersten Stock schon einmal gesehen hatte? Sie ging weiter und achtete im Gehen auf die Hausnummern.
Nummer 28 sah genauso aus wie die Nachbarhäuser, nur dass der Balkon grün statt weiß war, die Farbe abblätterte und es noch einen kleinen, ungepflegten Vorgarten besaß, während andere Hausbesitzer ihren zubetoniert hatten, um einen Parkplatz für ihr Auto daraus zu machen. Niemand war in der Nähe. Abgesehen von dem Grollen eines Flugzeugs hoch über ihr war es merkwürdig still.
Das Tor aus verschnörkeltem Gitterwerk ließ sich nur schwer aufschieben. Gestreifte Vorhänge hinter dem Schiebefenster an der Haustür rührten eine ferne Erinnerung an. Ihre Zuversicht wuchs – und verließ sie dann wieder. Etwas stimmte nicht. Das Fenster war von Schmutzschlieren überzogen. Als sie sich umsah, entdeckte sie überall Anzeichen von Vernachlässigung. Das Gras wucherte wild, eine Topfpflanze, die innen auf dem Fensterbrett stand, war lange eingegangen. Sie klingelte und wartete auf der schmalen, braun gefliesten Vorderveranda. Niemand öffnete, daher drückte sie die Klingel noch einmal und klopfte dann an die Tür.
Nach einiger Zeit schob sie den Briefschlitz auf und spähte hindurch. Umschläge und Papiere lagen über einen schmutzigen braunen Teppich verteilt. Es waren so viele, dass sie schon lange dort liegen mussten. Wahrscheinlich, so wurde ihr schlagartig bewusst, war ihr eigener Brief auch dabei. Nicht nur unbeantwortet, sondern auch ungeöffnet.
Sie zog die Hand zurück, und die Briefklappe knallte ihr auf die Finger. All ihre Hoffnung und ihre ganze Energie waren verflogen, und sie ließ sich an der Wand entlang auf die kalten Fliesen sinken und rieb sich die schmerzende Hand. Ihr Kopf war leer. Das sie überhaupt niemanden antreffen würde, war das Letzte, womit sie gerechnet hatte. War sie umsonst so weit gefahren?
Ein metallisches Geräusch ließ sie zusammenzucken. Zuerst dachte sie, es käme aus dem Inneren des Hauses. Aber es stammte von nebenan. Sie spähte hinüber zu der anderen Hälfte des Doppelhauses und sah, dass sich die Tür öffnete und jemand herauskam, ein jüngerer Mann mit einem fröhlichen, rosigen Gesicht, Geheimratsecken und sandfarbenem Haar. Alles an ihm war vollkommen gewöhnlich: seine Jeans, seine weiche graue Jacke, das T-Shirt, das sich über seinem vorgewölbten Bauch spannte. »Bis dann«, rief er jemandem zu, der sich drinnen befand. Dann schloss er die Tür hinter sich. Mit einem Schlüssel in der Hand ging er zur Fahrertür eines silbernen Kombis, der mit dem Vorderteil zur Hauswand geparkt war. Dann bemerkte er sie und runzelte erstaunt die Stirn.
»Guten Morgen«, sagte sie.
»Hier wohnt niemand, Kleine.« Er klang freundlich, aber verwundert.
»Dexter. Kennen Sie Mr. Dexter?«
»Hab hier noch nie jemanden gesehen«, sagte er, dieses Mal lauter. »Wir sind im Sommer hier eingezogen, und …« Er breitete die Arme aus und zuckte die Achseln, um zu signalisieren, dass er nichts und niemanden gesehen hatte.
Sie blickte zu dem leeren Haus hoch, als suche sie eine Bestätigung für das, was er gesagt hatte. Als sie sich wieder zu ihm umdrehte, sah er sie neugierig an.
»Warten Sie mal, vor ein paar Monaten war da jemand. Ein junger Bursche, der ein bisschen wie Sie aussah, wenn ich es recht bedenke. Er ist zwei- oder dreimal hier gewesen. Ich habe ihm erklärt, dass dort niemand lebt, aber er hat mich nicht verstanden.«
Das Wesentliche dessen, was er gesagt hatte, hatte sie verstanden. »Vielleicht mein Bruder, Michal.« Ihre Stimme zitterte. »Er spricht kein Englisch wie ich.«
»Ihr Bruder, das klingt einleuchtend, ja.«
»Wo er dann hingegangen?«
»Keine Ahnung. Tut mir leid.« Er richtete den Schlüssel auf das silberne Auto, und die Scheinwerfer flammten gehorsam auf.
»Vielleicht fragen Sie einmal die anderen Nachbarn«, meinte er und öffnete die Autotür. »Da drüben wohnt eine alte Dame, die vielleicht Bescheid weiß. Sorry, ich muss jetzt los. Ich muss meinen Sohn abholen.«
Sie nickte und sah zu, wie er einstieg und davonfuhr. In der Straße war es wieder still.
Sie folgte seinem Rat, überquerte die Straße und klingelte an beiden Türen des Hauses, das er gemeint hatte, aber niemand öffnete. Sie ging zurück und klingelte bei dem anderen Nachbarn ihres Vaters, aber die junge Frau mit dem Baby, die die Tür öffnete, wusste nicht mehr als der junge Mann. Daher ging Rosa zurück zu Nummer 28, setzte sich auf die Schwelle und fragte sich, was sie jetzt tun sollte. Ihr Vater war nicht da, er war anscheinend schon seit Monaten nicht mehr hier gewesen. Wo war er? Was war passiert? Ihr Bruder war hergekommen, dann aber weggegangen. Wohin? Und warum hatte sie nichts von ihm gehört?
Sie sprang auf und drückte frustriert gegen die Haustür. Sie gab nicht nach. Als Nächstes versuchte sie, das Fenster hochzuschieben. Als auch das nicht funktionierte, rüttelte sie an der Klinke der hohen hölzernen Seitentür. Sogar die war fest abgeschlossen, und über den Türsturz hatte jemand einen gefährlich aussehenden Stacheldraht gezogen. Verzweifelt sah sie sich im Vorgarten nach etwas um, mit dem sie ein Fenster einschlagen könnte. Eine zerbrochene Dachpfanne lag im Gras. Sie hob eine große Scherbe auf. Doch plötzlich hatte sie das Gefühl, dass sie beobachtet wurde. Sie sah sich um, und ihr Blick fiel auf das Haus gegenüber.
Hinter einem Fenster im ersten Stock bewegte sich etwas. Ein stämmiger Mann stand da und beobachtete sie. In der einen Hand hielt er eine Tasse, mit der anderen drückte er ein Telefon an sein Ohr. Sie legte die Scherbe weg, griff nach ihrem Koffer und ging davon, in die Richtung, aus der sie gekommen war. Sie hatte keine Ahnung, ob der Mann dabei gewesen war, die Polizei zu rufen, aber möglich war es. Einzubrechen war eine dumme Idee gewesen. Angenommen, das Haus gehörte ihrem Vater nicht mehr. Sie hätte ernsthafte Schwierigkeiten bekommen können.
Jedenfalls musste sie entscheiden, was sie nun tun sollte. Die Mission, die sie hergeführt hatte, war zu Ende, bevor sie begonnen hatte. Sie hatte keinen Plan B. Sie war davon ausgegangen, dass ihr Vater hier sein würde, um sie zu begrüßen, und dass sie bei ihm wohnen würde. Wie hatte sie nur so naiv sein können?
Rosa drückte sich vor der U-Bahn-Station herum und sah sich nach jemandem um, den sie nach einer Unterkunft fragen könnte, da entdeckte sie ein paar Häuser weiter ein Café. Plötzlich sehnte sie sich nach einem warmen Platz, wo sie sich hinsetzen und nachdenken konnte. Sie ging hin, um es sich genauer anzuschauen.
Das Black Cat Café war klein und sah gemütlich aus. Es hatte Sprossenfenster, und vor dem Laden verkündete eine Reklametafel in Form einer Katze, es sei Ganztags geöffnet. Es lag in einer Ladenzeile im Erdgeschoss einer Reihe schöner Backsteingebäude, die aus derselben Zeit stammten wie die Bahnstation. Die Fenster waren beschlagen, aber Rosa konnte trotzdem hineinsehen. Sie sah ungefähr ein Dutzend Holztische und -stühle, von denen einige besetzt waren. Andere Gäste standen Schlange an der Theke, über der eine Preistafel hing. Das hölzerne Mobiliar und die heimelige Atmosphäre erinnerten sie an das Café, das einer Freundin ihrer Mutter gehörte und in dem sie nach ihrem Schulabschluss einige Zeit gearbeitet hatte. Es kam ihr vollkommen natürlich vor, die Tür aufzustoßen und einzutreten.
Sofort umhüllten sie köstliche Düfte nach Zucker und Zimt, und leises Stimmengewirr wetteiferte mit dem fröhlichen Zischen der Kaffeemaschine. Hinter der Theke stand eine mollige junge Frau mit rosigen Wangen und dunklem Haar, das sie unter ihrer schneeweißen Kappe zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden hatte. Sie nickte Rosa zu. Rosa stellte ihren Koffer unter den Mänteln ab, die an den Kleiderhaken neben der Tür hingen, und stellte sich in die kurze Schlange. Während sie wartete, las sie eine handgeschriebene Notiz, die mit Klebeband an der Kasse befestigt war. Aushilfe gesucht. Erfahrung Voraussetzung. Fragen Sie nach Karina.
Als sie an die Reihe kam, bestellte sie Kaffee und ein Teilchen. Ihr Tablett trug sie an einen Tisch, an dem ein alter Mann mit runzligem Gesicht saß. Er las in einer Zeitung mit dicken schwarzen Schlagzeilen und reißerischen Bildern. Der Kaffee war wundervoll, cremig, mild und belebend, und das Teilchen schmeckte wie die süßen, mit Sirup getränkten Mandelkuchen, die ihre Mutter so geliebt hatte. Rosa aß und trank, so langsam sie konnte, denn sie wollte den Moment möglichst lange genießen. Hier drinnen war es sicher und warm, und sie genoss es, der Frau hinter der Theke dabei zuzusehen, wie sie mit den Gästen scherzte und eine ältere Dame beruhigte, die mit ihrem Kleingeld durcheinandergekommen war. Ja, dieser Ort gefiel ihr. Es wäre vernünftig, in dieser Gegend zu bleiben und sich hier eine Unterkunft zu besorgen, solange sie nach Michal und ihrem Vater suchte.
Sie stippte das letzte Mandelblättchen von ihrem Teller auf und leckte den Schaum von ihrem Kaffeelöffel. Als an der Theke kurz keine Schlange war, brachte sie ihr schmutziges Geschirr dorthin zurück.
»Danke.« Die Frau nahm das Tablett mit erfreuter Miene entgegen.
»Kein Problem.« Rosa lächelte ihr verhalten zu. »Ich würde gern mit Karina sprechen.«
»Sie reden mit ihr. Ich bin Karina«, antwortete die Frau und musterte sie aus klugen braunen Augen.
Rosa zeigte auf den Zettel an der Kasse. »Ich habe Erfahrung«, erklärte sie. »Zu Hause habe ich jahrelang in einem Café wie diesem gearbeitet.«
»Ach ja?« Karina trocknete sich die Hände ab und griff nach einem Kugelschreiber. »Und wie heißen Sie?«, fragte sie und nahm einen Notizblock. »Könnten Sie um fünf noch einmal zu einem Gespräch vorbeikommen?«
Rosa nickte. Sie konnte jederzeit wiederkommen.
Stef
Eine Woche später
Ich will das nicht mehr, schrie die Stimme in ihrem Traum, und Stef erwachte. Sie hörte das Krachen und Scheppern des Müllwagens, der sich draußen die Straße entlangschob. Sie drehte sich um und spürte, wie kalte Luft unter die Bettdecke drang, und ihr wurde klar, dass er nicht da war. Als sie auf die Uhr auf seiner Bettseite sah, zeigten die Leuchtziffern 8.04 Uhr. Er musste schon weg sein. Normalerweise klingelte sein Wecker um 6.30 Uhr und weckte sie, und sie lag dann mit geschlossenen Augen da und lauschte dem Rauschen der Dusche, den geheimnisvollen dumpfen Geräuschen und dem Rascheln, mit dem er sich anzog, und dem schnellen Klicken seiner Schuhe auf den Küchenfliesen, auf die kurz darauf das weiche, dumpfe Geräusch folgte, mit dem sich die Wohnungstür schloss. Dann herrschte Stille, und sie konnte sich entspannen. Heute musste sie all das verschlafen haben, statt nur so zu tun. Zurzeit sehnte sie sich danach, dass er ging, und fürchtete es zugleich. Er nahm all die Anspannung mit, die Notwendigkeit, ständig auf der Hut zu sein; und doch fühlte sie sich allein in der Wohnung haltlos, bar jeder Entschlusskraft. Wenn er gegangen war, pflegte sie die Decke fester um sich zu ziehen und wieder einzuschlafen. Schließlich gab es nichts anderes, was sie gern getan hätte.
Doch heute war etwas anders. Irgendwo in ihrem Kopf war ein Schalter umgelegt worden. Was genau das bedeutete, hätte sie nicht sagen können, aber es hatte mit dem Traum zu tun. Sie konnte sich nicht erinnern, worum es darin gegangen war, nur an viele laute Auseinandersetzungen. Vielleicht war das Geschrei ja das der Müllmänner gewesen, die sich mit lauten Rufen verständigt hatten, während sie langsam aufgewacht war.
Seufzend wälzte sie sich aus dem Bett und tappte ins Bad. Es roch noch nach ihm. Der Raum war noch feucht und warm, und der moschusartige Geruch von Rasierwasser hing in der Luft. Eingewickelt in den seidigen weißen Morgenmantel, den er ihr gekauft hatte, ging sie über den Flur in die Küche, wo sie aus dem Hahn über der Spüle kochend heißes Wasser in einen Becher laufen ließ. Das sterile, praktische Design aus Metall und Granit verweigerte ihr sogar das gemütliche Ritual, einen Wasserkessel aufzusetzen. Allerdings war sie froh über die beheizten Fliesen unter ihren Füßen. Sie schwenkte den Teebeutel an seinem Faden und ließ ihn in den Abfallbehälter neben der Spüle fallen. Dann streckte sie den Arm aus und schob das Rollo vor dem Fenster beiseite.
Die Küche lag auf der Rückseite des Gebäudes, und das Fenster gab den Blick auf ähnliche Wohnblocks frei. Diese Wohnung war, wie er immer wieder zufrieden bemerkte, eine der größten. Sie lag im ersten Stock, und man hatte eine gute Aussicht auf den gemeinschaftlich genutzten Park. Dort unten sah sie einen jungen Mann in einem Arbeitsoverall, der schnell und ungeduldig mit einer Hacke Kompost in ein Blumenbeet einarbeitete. Zwischen den Häusern glomm an einem Himmel, der grau wie Spülwasser war, eine wolkenverhangene Sonne. Möwen glitten auf einem Aufwind dahin, und sie musste an den Fluss hinter den Häusern denken. Sie stellte sich den frischen Wind vor und sah das Einlaufen der Flut vor sich. Vielleicht würde sie heute dort hinspazieren; aber der Gedanke löste sich auf, bevor er Wurzeln schlagen konnte. Zu anstrengend. Sie ließ das Rollo fallen und kehrte mit ihren Gedanken zurück in die Küche, in die drückende Stille in der Wohnung.
Nachdem sie eine Schale mit zuckrigen Cornflakes gefüllt hatte, trug sie das Frühstück ins Wohnzimmer und stellte es auf den gläsernen Couchtisch neben eine ordentlich ausgerichtete Reihe von Fernbedienungen. Sie nahm die zweite zur Hand und drückte auf eine Taste, sodass der Fernseher flackernd zum Leben erwachte. Sie machte es sich im Schneidersitz auf dem Sofa gemütlich, drückte sich eines der harten Kissen in den Rücken und trank ihren Tee. Auf dem Bildschirm war eine bunt gekleidete Blondine zu sehen, die in grellem Sonnenschein vor einer Villa stand und irgendetwas über den Ehebruch eines Tennisstars in ein Mikrofon plapperte. »Ich hab noch nie von dir gehört«, flüsterte Stef, als das Bild eines Mannes eingeblendet wurde. Sie wedelte mit der Fernbedienung, und der Fernseher zeigte jetzt körnige Aufnahmen von ein paar argwöhnisch dreinblickenden Jugendlichen, die in einen Transporter stiegen. Stef hatte nicht mitbekommen, worum es ging, und dachte stattdessen an ihre Mutter und daran, wie lange sie nicht mehr miteinander gesprochen hatten. Heutzutage schweiften ihre Gedanken so oft ab; sie konnte sich kaum noch konzentrieren. Als sie das nächste Mal ihre Aufmerksamkeit dem Fernseher zuwandte, saßen drei Frauen auf einem lila Sofa und führten eine ernste Diskussion. Dann sagte eine von ihnen etwas, das sie dazu brachte, sich vorzubeugen und zuzuhören. Ich will das nicht mehr. Dieselben Worte, die sich in ihrem Kopf gebildet hatten, als sie aus ihrem Traum erwacht war. Ich will das nicht mehr. Dieses Mal griff sie zur Fernbedienung, um das Gerät lauter zu stellen.
Sie hörte zu, aß ihre Frühstücksflocken und registrierte deren leere Süße kaum.
Rosa
Am selben Vormittag um halb zwölf füllte Rosa, die seit fünf Tagen im Black Cat Café arbeitete, die Eiersalat-Schüssel in der Kühltheke auf. Als sich die Tür öffnete, blickte sie auf. Eine Frau, die sie noch nie gesehen hatte, kam herein. Sie sah weder jung noch besonders alt aus, aber sie hatte etwas Gepflegtes, Elegantes und Selbstsicheres an sich, das Rosas Blick anzog.
»Einen Americano mit Milch, aber ohne Zucker, und ein Panino mit Ziegenkäse«, sagte die Frau zu Karina. Ihre Stimme klang angenehm rauchig. Sie sprach die Worte sehr deutlich aus.
»Wenn Sie sich setzen wollen, bringe ich es Ihnen«, erklärte Karina, als sie der Frau ihr Wechselgeld gab.
»Danke.« Die Frau zog die Times aus dem Ständer, ließ sich an einem Tisch am Fenster nieder und nahm eine Brille aus ihrem Etui. Rosa wischte den Rand der Eiersalat-Schüssel ab, und während sie sie zurück in die Theke stellte, konnte sie nicht anders, als die Frau zu beobachten. Was für schönes Haar sie hatte; es war von einem silbrigen Aschgrau und zu einem schulterlangen Bob geschnitten. Ihre kirschrote Strickjacke war zwar ein wenig verwaschen, aber sie schmiegte sich perfekt um ihre schmalen Schultern, und ihr dunkelblau und weiß gemusterter Schal war über ihrem Schlüsselbein geknotet, als gehöre er dorthin. Sie glaubte nicht, dass das teure Designerstücke waren, aber die geschickte Zusammenstellung des Outfits zeigte, dass die Frau modisches Gespür besaß.
»Danke, das sieht sehr lecker aus«, sagte die Frau und lächelte zu Karina auf, die ihr das Sandwich hinstellte.
Rosa schob den Plastikeimer mit dem Eiersalat wieder in den großen Kühlschrank, begann Tomaten zu schneiden und hörte Karina zu, die die Kaffeesatz-Schublade der Kaffeemaschine leerte und dabei von ihren Plänen erzählte, mit ihrem Freund Jared zusammen in eine Mietwohnung zu ziehen.
»Wie lange willst du in diesem Wohnheim bleiben?«, fragte sie Rosa. »Ist das Zimmer okay?«
Rosa runzelte die Stirn. »Es ist … gut, aber einige der Leute dort sind nicht …« Sie verzog das Gesicht. Nachdem sie ihr den Job gegeben hatte, hatte Karina für sie bei der Stadt angerufen und die Adresse der Unterkunft erhalten. Es sollte nur für den Übergang sein, sie musste also bald etwas anderes finden.
»Es ist alles so teuer, nicht wahr?«, sagte Karina und schnitt einen Beutel Salat auf. »Wenn du mit den Tomaten fertig bist, muss Tisch sechs abgeräumt werden.«
Rosa trug schmutziges Geschirr hin und her und streckte dann den Arm aus, um nach einem Tablett zu greifen, das ein Gast ans Fenster gelehnt hatte. In der Nähe nahm die elegante Frau ihre Zeitung herunter. »Ich sitze Ihnen doch nicht im Weg, oder?«, fragte sie.
»Nein, nein, überhaupt nicht.« Das Lächeln der Frau vermittelte Rosa ein warmes Gefühl
Statt ihre Lektüre wieder aufzunehmen, schob sie die Brille hoch auf den Kopf. »Ich habe Sie noch nie hier gesehen, oder? Sind Sie neu?«
»Fünf Tage«, erklärte Rosa, unterbrach das Abwischen des Tabletts und hob ihre Finger.
»Also noch nicht lange. Sind Sie gern hier?«
»Ja, sehr. Ich habe Glück, Arbeit zu haben.«
»Wahrscheinlich. Sind Sie schon lange in London? Verzeihen Sie, ich habe Ihren Akzent bemerkt.«
»Erst seit sieben Tagen.« Sie fragte sich, wohin dieses Gespräch führen sollte. Die Frau schien ihr Misstrauen wahrzunehmen. Tut mir leid, wie unhöflich von mir«, sagte sie. »Mein Name ist Leonie. Leonie Brett.« Sie streckte Rosa die Hand entgegen. »Ich komme ziemlich oft her. Das gönne ich mir vor dem Einkaufen.«
»Ich bin Rosa«, sagte sie und schüttelte sie. »Rosa Dexter.«
»Schön, Sie kennenzulernen, Rosa.« Die Hand der Frau fühlte sich kühl an. Kühl und sanft, aber ihr Griff hatte auch etwas Festes. Rosa spürte, dass die Frau sie taxierte, aber aus irgendeinem Grund machte ihr das nichts aus.
»Ich will mich nicht einmischen, aber ich konnte nicht umhin, Ihr Gespräch mit anzuhören. Brauchen Sie eine Unterkunft? Es ist … Nun, mein Haus liegt nur eine halbe Meile in diese Richtung entfernt.« Sie wies in die Richtung. »Kennen Sie Bellevue Gardens?« Rosa kannte es nicht. »Zufällig ist bei mir überraschend ein Zimmer frei geworden, und Sie dürfen gern kommen und es sich ansehen.«
»Sie haben ein Zimmer, in dem ich wohnen könnte?« Rosa konnte es kaum glauben. »Danke.«
»Nun ja, wenn Sie möchten. Natürlich kann es sein, dass es Ihnen nicht zusagt, und Sie müssten meine anderen Mieter kennenlernen, aber das Angebot steht. Die anderen Mieter sagen, dass die Miete akzeptabel ist.« Sie nannte eine Summe, und es klang in der Tat erstaunlich preiswert.
»Danke. Ich danke Ihnen sehr«, sagte Rosa. Sie fragte sich, ob das Angebot einen Haken hatte, aber die Frau machte einen aufrichtigen Eindruck.
Sie sah, dass Karina ihr stirnrunzelnd einen Blick zuwarf, daher wandte sie sich ab und begann, einen anderen Tisch abzuwischen. Das gab ihr Zeit zum Nachdenken. Einen Moment später richtete sie sich auf. »Ich würde mir Ihr Haus sehr gern ansehen«, sagte sie zu der Frau, zu dieser Leonie Brett. »Wann darf ich kommen? Ich bin hier heute um vier fertig.«
»Dann kommen Sie nach der Arbeit«, sagte Leonie Brett, schrieb eine Adresse auf eine Papierserviette und zeichnete dazu eine kleine Wegskizze.
Als Rosa die Serviette entgegennahm, trafen sich ihre Blicke, und wieder spürte sie die Freundlichkeit der Frau. Und etwas Verblüffendes. Respekt.
Nach all den Erfahrungen, die sie gemacht hatte, wusste Rosa, dass sie vorsichtig sein sollte, aber sie hatte das Gefühl, Leonie Brett sei jemand, dem sie vielleicht vertrauen konnte.
Stef
Nachdem die Diskussion im Fernsehstudio vorbei war, schaltete Stef den Fernseher aus, stand auf, stellte ihre Müslischale weg und trat ans Fenster. Draußen war der Gärtner mit dem Hacken fertig und schaufelte Pflanzenteile in eine Schubkarre. Alles wirkte so normal und ruhig, und doch war sie innerlich in Aufruhr. Sie wusste, was sie zu tun hatte, aber einen Moment lang konnte sie sich nicht rühren. Es war, als weigerten sich ihre Glieder, ihr zu gehorchen. Doch dann brachte sie langsam ihr Geschirr in die Küche, wusch es in der Spüle, trocknete es ab, stellte es weg und wischte dann ein paar Frühstücksflocken auf, die auf die Arbeitsplatte gefallen waren. Die leeren, sauberen Flächen glänzten. Jetzt würde nichts mehr an sie erinnern. Es war, als wäre sie nie hier gewesen. Sie hatte sich selbst ausgelöscht. Die Botschaft war deutlich: Es war genug. Es war Zeit zu gehen.
Sie ging zurück ins Schlafzimmer, duschte und zog sich an. Dann ging sie durch die Wohnung, sammelte ihre Besitztümer ein und stopfte sie in die Reisetasche, die sie im Flurschrank fand. Mit Erstaunen stellte sie fest, wie wenig sie besaß. Die meisten ihrer Sachen mussten zusammen mit den anderen Dingen aus dem Haus ihrer Kindheit eingepackt worden sein und standen wahrscheinlich in Kartons im neuen Haus ihrer Mutter.
Sie strich die Bettdecke glatt und sah sich ein letztes Mal im Schlafzimmer um. Es sah genauso aus wie vor sechs Monaten, als sie es zum ersten Mal betreten hatte. Der schwarz-weiß gestreifte Bettbezug, der gerahmte Akt, der aus wenigen Kohlestrichen bestand und über dem Bett hing – alles war ordentlich, bis auf … Sie bückte sich, um eine große schwarze Zeichenmappe unter dem Bett hervorzuholen, und etwas Kleines, Metallisches rollte über den Holzboden. Sie kniete nieder, um es aufzuheben. Es war ein Ansteckbutton, der wie ein Kronkorken aussah. Wie war der denn dahingekommen? Sie hielt ihn zwischen den Fingerspitzen und erinnerte sich daran, wo sie ihn gekauft hatte. Auf dem Camden-Markt, vor etlichen Jahren. Er zeigte ein Symbol, ein Mädchengesicht, das aus der Mitte einer Blume herauslächelte. »Original aus den Swinging Sixties«, hatte der Standbesitzer behauptet. Sie hatte ihm fünf Pfund dafür gegeben, Das war Wucher, aber sie hatte den Button haben wollen. Jetzt steckte sie ihn an ihre Jacke. Dann nahm sie ihre Reisetasche und die Zeichenmappe und verließ die Wohnung. Sie schloss zweimal ab und warf den Schlüssel nach kurzem Zögern in den Briefkasten. Sie hinterließ keine Nachricht, denn was hätte sie auch schreiben sollen? Er würde wissen, warum sie gegangen war. Und wenn nicht, dann war es Zeit, dass er sich Gedanken darüber machte.
Draußen war es kälter, als sie erwartet hatte, und die Sonne blendete sie, als sie rasch die Straße entlangging und dabei den Tonnen auswich, die die Müllmänner achtlos auf dem Bürgersteig hatten stehen lassen. Wohin sollte sie gehen? Sie ging ihre Optionen durch. Viele waren es nicht. Sie war gerade dabei, eine Entscheidung zu treffen, als …
»Passen Sie doch auf!«, sagte ein alter Mann. Sie war fast auf seinen Hund getreten, der die Größe und Farbe einer kräftigeren Ratte hatte.
»Tut mir leid!«, sagte sie über die Schulter, als sie ihm auswich. Es war, als besäße die Wohnung ein Kraftfeld, und wenn sie sich nicht beeilte, bestand die Gefahr, dass sie zurückgezogen wurde und die Kraft zum Fortgehen nie wieder finden würde. Sie wagte nicht, zu dem Mann und seinem Hund zurückzublicken, denn dann würde sie vielleicht erstarren wie diese Frau aus der biblischen Geschichte. Sie dachte daran, wie Oliver sie mit seinem schneidenden Blick durchbohren und erklären würde, dass er sie brauche und nicht ohne sie leben könne. Nein, daran durfte sie nicht denken, sonst würde sie zurückgehen und sich wieder vollkommen verlieren.
Auf der Straße wimmelte es von Menschen und Autos. Es war nicht weit bis zum Fluss. Die Brücke, zunächst noch ein eleganter Bogen in der Ferne, erwies sich beim Näherkommen als Knotenpunkt eines lärmenden Verkehrschaos, an dem Busse und Laster sich zentimeterweise und Stoßstange an Stoßstange nach Westminster und in die Gegenrichtung voranschoben. Die Abgase brannten ihr im Hals. Sie wartete an der Ampel, und als sie auf Grün umsprang, wurde sie von den Menschenmassen mit auf die Straße gezogen. Ein Lieferwagen blockierte die Straße, sodass die Fußgänger ihm ausweichen mussten. Ein großer, stark behaarter Mann vor ihr schlug mit der Faust gegen die Seite des Wagens. Der Fahrer ließ das Fenster herunter und beschimpfte ihn. »Entschuldigen Sie«, sagte sie – zwei Mal – zu dem Haarigen, bis er sie vorbeiließ.
Als sie die Verkehrsinsel in der Mitte der Straße erreichte, stand die Ampel schon wieder auf Rot, und sie musste erneut warten. Vor ihr zog ein Bus an dem langsam vorwärtskriechenden Verkehr vorbei und bremste vor der Haltestelle auf der Brücke ab. Plötzlich wusste sie, wohin sie wollte – sie wollte zu ihrer Mum. Sie konnte die Nummer nicht erkennen, aber vielleicht war das der richtige Bus. Die Sekunden dehnten sich zu Minuten. Komm schon, dachte sie. Endlich hielten die Autos an, standen hintereinander und ließen ungeduldig die Motoren aufheulen. Sie bewegte sich vorwärts. »Entschuldigung«, keuchte sie und drängte sich an Menschen vorbei, um den Bus zu erreichen, denn es war der, den sie brauchte, der, der zum Busbahnhof fuhr.
Sie hatte die andere Straßenseite fast erreicht, als sie ihn in der Nähe der Busschlange warten sah. Er drehte ihr den Rücken zu, das kurz geschnittene schwarze Haar berührte seinen schneeweißen Hemdkragen kaum, er hatte einen Aktenkoffer dabei, und an seinem Handgelenk schaute unter der Manschette seines Hemds seine schwere silberne Armbanduhr hervor. Wie angewurzelt blieb sie auf der Straße stehen. Das Letzte, was sie sah, war, dass er sich zu ihr umdrehte und sich Entsetzen auf seinem Gesicht ausbreitete. Es war nicht Oliver, dachte sie nur noch, bevor der Schlag sie traf und sie durch die Luft geschleudert wurde.
Rick
An jedem normalen Montag wäre Rick nicht einmal in der Nähe der Unfallstelle gewesen. Er hätte wohlbehalten in seinem Zimmer in dem Haus in Bellevue Gardens geschlafen und sich die schmuddelige Bettdecke über den Kopf gezogen, um das Tageslicht auszusperren, das durch den schäbigen Vorhang fiel. Aber gestern Abend hatte ihn seine Schwester angerufen. Sie war »verzweifelt« gewesen. Claire war oft verzweifelt. Ständig wurden ihre Pläne über den Haufen geworfen. Dieses Mal hatte sie der Babysitter im letzten Moment im Stich gelassen, und sie hatte gefragt, ob er nicht stattdessen kommen könne? Er hatte brummig reagiert, denn er hatte vorgehabt, einen ruhigen Abend zu verbringen und an der Geschichte weiterzuarbeiten, an der er schrieb; und sosehr er seine zwei kleinen Neffen liebte, die beiden tanzten ihm auch oft genug auf der Nase herum. Er wusste allerdings, dass Claire abends selten mit Freunden ausging. Daher erklärte er sich einverstanden, obwohl er auf dem Weg zu ihrer Wohnung südlich des Flusses umsteigen musste und noch nichts zu Abend gegessen hatte. Claire war erst spät wieder zurückgekehrt, was trotz gegenteiliger Versprechungen oft vorkam. Weil sie außerdem auch ein wenig angeschlagen war, war er über Nacht geblieben, hatte die Jungs zum Frühstück geweckt und zur Schule gebracht. Danach hatte er nichts anderes mehr zu tun, als den Bus zurück nach Hause zu nehmen. Gott sei Dank hatte er heute frei.
Er wartete an der Ampel und bemerkte das Mädchen, das neben ihm stand, nur, weil ihre Reisetasche das gleiche Muster hatte wie Claires Kulturtasche. Es war eines dieser hübschen Blumenmuster, die man früher meist an Vorhängen und Kleidern für kleine Mädchen gesehen hatte, die aber heutzutage auf allem auftauchten, von Regenmänteln bis hin zu Zelten.
Das Mädchen sah nervös aus. Es war dünn und überhaupt nicht sein Typ; obwohl es ihm schwergefallen wäre, mit Sicherheit zu sagen, was sein Typ war, da er schon eine ganze Weile keine Freundin mehr gehabt hatte. Auf jeden Fall stand er nicht auf diesen blonden, elfenhaften, eingeschüchterten Typ, dachte er, während die Ampel umsprang und sich die Menge in Bewegung setzte. Ihm waren entschlossenere Leute wie seine Schwester lieber, die wussten, was sie wollten, und ihm sagten, was er zu tun hatte. Obwohl Claires Ehe gescheitert war, kam sie mit ihrem Leben zurecht und hatte noch guten Kontakt zu dem Vater der Jungs. Wenn Liam nur beruflich nicht so viel unterwegs wäre und sich öfter um die Kinder kümmern könnte.
»Entschuldigen Sie«, sagte das nervöse Mädchen mit ausdrucksloser Stimme. Ihm wurde klar, dass sie nicht mit ihm redete, sondern mit dem großen, haarigen Affen, der mit dem Fahrer des Lieferwagens stritt. Rick lächelte ihr kurz zu, um ihr zu bedeuten, dass er ihr den Vortritt lassen würde. Als sie auf dem Mittelstreifen warteten, fiel ihm auf, dass sie braune Augen hatte, keine blauen, wie er es bei ihrer Haarfarbe erwartet hätte. »Goldbraun« war das Wort, das ihm zu ihrem Haar einfiel, aber vielleicht war »goldbraun« auch zu dunkel. Aber ihm gefiel das Wort, es klang nach Wärme und Glanz. »Honigfarben« hätte es vielleicht genauer getroffen. Rick sammelte Wörter und Redewendungen. Irgendwann konnte man sie immer gebrauchen. Das Mädchen rannte vor ihm zu einem wartenden Bus, doch die Reisetasche und eine große Skizzenmappe waren ihr dabei im Weg. Sie trug enge Jeans und kleine rosa Pumps ohne Strümpfe. Sie muss doch frieren, dachte er. Und dann: Warum bleibt sie stehen, die dumme Gans? Sieht sie den Radfahrer denn nicht?
»Hey!« Wie aus weiter Ferne hörte er seine eigene Stimme. Und plötzlich rannte er ihr nach.
Der Radfahrer war bei Rot über die Ampel gefahren, hatte auf der Busspur beschleunigt und war dann seitlich ausgeschert, um den wartenden Bus zu überholen. Später würde Rick von einem Polizisten erfahren, dass der junge Mann mit einem Kollegen gewettet hatte, dass er seine Zeit verbessern würde. Dreißig Minuten von South Wimbledon bis ins Büro waren das Ziel. Alle drei gingen gleichzeitig zu Boden, ein schreiendes Bündel aus Armen und Beinen.
Gesichter, Stimmen, Schmerz, Verwirrung. Dann Erleichterung, als ein stämmiger Straßenarbeiter mit einer neonfarbenen Weste das Fahrrad von Ricks Brust hob und ihm aufhalf. Seine Rippen schmerzten, aber er bemerkte es kaum und winkte ab, als der Mann besorgt nach seinem Befinden fragte: »Alles klar, Kumpel?« Hinter ihm saß der Radfahrer auf der Bordsteinkante und verfluchte die »blöden Hohlköpfe, die mitten auf der Straße ein Picknick machen«. Rick machte sich Sorgen um das Mädchen. Sie lag halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Straße, reglos und mit geschlossenen Augen. Eine mollige Schwarze mit türkisfarbenem Nagellack beugte sich über sie und fühlte ihr am Hals den Puls. Neben ihnen stand ein gepflegt aussehender Mann in einem schicken Anzug, der aufgeregt in sein Handy sprach. Ringsherum standen Passanten in unterschiedlichen Stadien von Schock oder Neugierde, und der Verkehr um sie herum war völlig zum Erliegen gekommen. Die Menschen in den Autos starrten sie an. »Das Rad ist neu«, schimpfte der Radfahrer. »Sehen Sie sich das an. Haben Sie eine Ahnung, wie viel so eine Gangschaltung kostet?«
Der Arbeiter versuchte, Rick dazu zu bewegen, sich auf die Straße zu setzen, doch er schüttelte den Kopf und beugte sich stattdessen unter Schmerzen über das Mädchen. Auf ihrem Gesicht waren Ölflecken zu sehen, die aussahen wie Kratzspuren. »Geht es ihr gut?«, fragte er die Frau mit den türkisfarbenen Nägeln.
»Sie atmet, falls Sie das meinen«, antwortete die Frau. »Kennen Sie sie?«
»Nein, nein. Ich hatte nur versucht …«
»Kommt der Krankenwagen?« Sie drehte den Kopf und sprach den Mann im Anzug an.
»Ja, glaube schon«, sagte er und sah unsicher auf sein Handy. Der Arbeiter sammelte das Gepäck des Mädchens ein.
Ein Polizist trat zu ihnen und hockte sich neben Rick. »Was ist passiert?«
»Sie hat sich den Kopf verletzt, die arme Kleine«, erklärte die Frau ihm.
Während der Polizist aufgeregt in sein Funkgerät sprach, sah Rick in das stille Gesicht des Mädchen und spürte Traurigkeit in sich aufsteigen.
Endlich kam der Krankenwagen, und Rick begleitete das Mädchen auf der kurzen Fahrt ins Krankenhaus. Die Sanitäter vermuteten, dass er sich eine Rippe gebrochen hatte, und fanden, dass er sich untersuchen lassen sollte. Rick war dankbar, unter diesem Vorwand, mit ihr fahren zu können. Den unverletzten Radfahrer, der mit dem Polizisten redete, ließen sie zurück.
Unterwegs lag Rick ruhig auf einer schmalen Trage und sah zu, wie sich der Sanitäter um das Mädchen kümmerte, ihre Sauerstoffmaske zurechtrückte und die Anzeige auf einem Monitor überprüfte. Sie kam langsam wieder zu sich, und ihre Lider flatterten. Als sie die Augen aufschlug, huschte ihr Blick ängstlich und verwirrt im Fahrzeug umher, aber als der junge Mann beruhigend auf sie einredete, schloss sie die Augen wieder. Rick sah Tränen unter ihren Lidern hervorquellen und spürte das Verlangen, die Hand auszustrecken und sie zu trösten.
»Liegen Sie bequem?« Der Sanitäter drehte den Kopf zu Rick und sah ihn an. Rick nickte, legte sich zurück und starrte an die Decke des Krankenwagens. Er fragte sich, ob er Claire anrufen sollte, traute sich aber nicht, nach dem Handy in seiner hinteren Hosentasche zu greifen, weil er ahnte, dass die Bewegung wehtun würde. Denn dort, wo sich der Fahrradlenker in seine Brust gebohrt hatte, spürte er inzwischen einen heißen, stechenden Schmerz, der beim Einatmen noch schlimmer wurde.
Die Röntgenbilder zeigten, dass tatsächlich eine Rippe angebrochen war. Außerdem würde er vermutlich ordentliche Blutergüsse bekommen. Er sollte sich deshalb vorsichtig bewegen, aber sie wollten ihn nicht dabehalten. In der Zwischenzeit war auch der Polizist eingetroffen und hatte seine Aussage aufgenommen. Dann stand Rick allein an der Rezeption der Notaufnahme und war für niemanden mehr von Interesse. Er versuchte, die Doppeltüren zu öffnen, die zurück in den Behandlungsbereich führten, aber sie waren elektronisch gesichert.
»Kann ich Ihnen helfen?« Er drehte sich um und erkannte die Schwester, die bei der Einlieferung seine Daten aufgenommen hatte.
»Ich würde gern das Mädchen sehen, mit dem ich zusammen im Krankenwagen gekommen bin. Wie geht es ihr?«
Die Schwester zögerte. »Die Blonde mit der Kopfverletzung?«, fragte sie dann. »Die kommt wieder in Ordnung. Das heißt, sie ist aufgewacht, es scheint ihr gut zu gehen, und wir haben ein paar Tests bei ihr gemacht. Nur um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen haben.«
»Kann ich sie sehen, bitte?« Das musste er, das gehörte sich so. Außerdem hatte er ein schlechtes Gewissen. Er war nicht rechtzeitig bei ihr gewesen, und vielleicht hatte er den Unfall sogar noch schlimmer gemacht, weil er im Weg gestanden hatte, sodass der Radfahrer nicht ausweichen konnte. So hatte er es jedenfalls dem Polizisten erklärt. Er hoffte nur, dass es ihm nicht leidtun würde, die Wahrheit gesagt zu haben. Vielleicht war der Radfahrer ja von der prozesswütigen Sorte.
»Sind Sie ein Verwandter?«, wollte die Schwester wissen.
»Nein«, gestand Rick. »Ich habe sie heute zum ersten Mal gesehen. Es ist nur … Ich fühle mich für das Ganze verantwortlich. Würden Sie sie fragen, ob ich sie besuchen darf? Bitte! Ich heiße Rick, aber das wissen Sie sicher noch.«
»Ich kann mir nicht jeden Namen merken.« Sie wirkte verärgert, gab dann aber nach. Rick stellte oft fest, dass Menschen so auf ihn reagierten. »Warten Sie hier und rühren Sie sich nicht vom Fleck«, befahl sie, und wie durch Zauberei schwangen die Türflügel auf und ließen sie durch.
Stef
Stef lag reglos da. Die Decke des Zimmers verschwamm immer wieder vor ihren Augen. Ihr Kopf tat weh, obwohl sie Schmerzmittel bekommen hatte und der stechende Schmerz zu einem dumpfen Pochen gemildert geworden war. Der Arzt hatte ihr erklärt, sie müsse bei ihrem Sturz mit dem Kopf auf die Bordsteinkante geschlagen sein. Während er sprach, war ihr aufgefallen, wie das Licht durch sein kurzes, struppiges Haar schien, das sie an das Fell einer Katze erinnerte. Sie konnte sich nicht an den Sturz erinnern. Anscheinend hatte sie einen Unfall gehabt. Ein Radfahrer hatte sie zu Fall gebracht. Sie konnte nur an die schwarze Katze ihrer Mutter denken, wie sie sich auf dem Nachtspeicherofen zusammenrollte und ihr Fell sich in der heißen Luft aufplusterte. Das war in dem alten Haus gewesen. Ihre Familie war gerade nach Derby gezogen, in ein neues Haus. Dort gab es anscheinend keine Nachtspeicheröfen. Sie stellte sich vor, wie die Katze auf einem Heizkörper balancierte.
»Erinnern Sie sich daran, was passiert ist?«, unterbrach der Arzt stirnrunzelnd ihre Gedanken.
Sie versuchte, den Kopf zu schütteln, und bereute es.
»Was ist Ihre letzte Erinnerung?«
Sie überlegte. Sie erinnerte sich daran, wie sie heute Morgen aufgestanden war. Dann hatte sie den Fernseher eingeschaltet. Das war alles. Sie war allein gewesen. Oliver war zur Arbeit gegangen. Er ging immer früh aus dem Haus. »Ich weiß nicht.«
»Wer ist gerade Premierminister?«
»Was?«
»Ich überprüfe Ihr Gedächtnis.«
»Ist schon okay, ich weiß die Antwort.« Sie nannte den Namen.
Er seufzte. »Können wir jemanden für Sie anrufen? Ihre Mutter? Ihren Freund?«
Sie dachte an Oliver, stellte sich seinen Hinterkopf vor und das kurze schwarze Haar, das im Nacken auf Kragenlinie gestutzt war. Der Mann an der Bushaltestelle, der sich umgedreht hatte, war doch nicht Oliver gewesen, sondern ein Unbekannter. Sie versuchte, sich Oliver in einer Umgebung wie dieser hier vorzustellen. Das grelle Licht, dieser winzige Raum, Schwestern und Ärzte, die kamen und gingen. Er hätte es gehasst. Ein Krankenhaus war ein Ort, an dem er nicht die Kontrolle hatte, wo Unordnung und Ungewissheit herrschten und man keine Privatsphäre hatte. Sie konnte sich sein Unbehagen, seine Frustration vorstellen. Nein, sie wollte Oliver nicht sehen. Das erkannte sie jetzt mit immer stärkerer Gewissheit.
»Meine Mum ist nach Derby gezogen, aber ich habe ihre neue Adresse nicht. Ihre Nummer ist aber in meinem Handy gespeichert.« Ihr Handy steckte in ihrer Handtasche. Ihre Reisetasche stand neben ihrem Bett, und jemand hatte ihre Wolljacke darübergelegt. Ihre mit Schmutz bespritzten rosa Pumps standen unter dem Stuhl, und ihre Mappe lehnte in der Nähe an der Wand. Doch als sie sich nach ihrer Handtasche erkundigte, wusste niemand, wo sie geblieben war. Eine Schwester wurde losgeschickt, um den Fahrer des Krankenwagens zu fragen, ob er die Handtasche gesehen hatte, aber sie war noch nicht zurück, und Stef konnte sich nicht an die Handynummer ihrer Mutter erinnern.
Sie saß im Bett, trank süßen Tee aus einem Plastikbecher und wackelte mit den Zehen, die unter der Bettdecke hervorschauten, als der Vorhang beiseitegeschoben wurde und eine andere Schwester hereinkam, die zweifelnd dreinblickte.
»Da ist ein junger Mann, der Sie sehen möchte. Er sagt, er sei in den Unfall verwickelt gewesen.«
Oliver, war ihr erster Gedanke, und sie musste erschrocken gewirkt haben, denn die Schwester sprach rasch weiter. »Sie brauchen ihn nicht zu sehen, wenn Sie nicht wollen. Er sagt, sein Name sei Rick.«
Rick? Sie kannte keinen Rick. »Der Mann auf dem Fahrrad?«
»Ich glaube nicht. Sie wollen ihn also nicht sehen?«
»Doch. Nein, ich meine, warten Sie.« Der Unfall. Sie musste wissen, was passiert war. »Wie schlimm sehe ich denn aus?«
Die Schwester musterte Stef und lächelte. »Es wird gehen.«
»Hi.« Ein junger Mann in ihrem Alter drückte sich in der Zimmertür herum, und Stef zog die Zehen unter die Decke zurück.
»Hi«, gab sie zurück. Nett, aber schüchtern, war ihr Eindruck. Die Art Mann, mit der man reden konnte, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob er einen attraktiv fand. Was eine Erleichterung war, denn sie musste furchtbar aussehen mit der Beule am Hinterkopf und den getrockneten Tränenspuren im Gesicht. Andererseits sah er natürlich auch nicht so toll aus. Er hatte langes sandsteinfarbenes Haar, das zu einem lockeren Knoten zurückgebunden war, und trug einen Parka mit einer zerrissenen Tasche. Seine Augen allerdings waren von einem weichen Blau, und seine vollen Lippen lächelten schief.
»Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, als du dort auf der Straße gelegen hast. Wie geht’s dir?« Er sprach leicht näselnd, vielleicht war er Ire oder so.
Sie verzog das Gesicht und lehnte sich in die Kissen zurück. »Okay, denke ich mal. Mein Kopf tut weh. Hast du gesehen, was passiert ist? Das klingt jetzt blöd, aber ich … ich kann mich nicht erinnern.«
»Ich hab’s gesehen. An der Ampel war ich hinter dir. Du bist einem Bus nachgerannt, aber dann bist du mitten auf der Straße stehen geblieben, als hättest du es dir anders überlegt, und dann ist dieser Radfahrer wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ich bin dir nachgelaufen, aber es hat nichts genutzt. Ich habe nur alles schlimmer gemacht. Vielleicht hätte er dich verfehlt, wenn ich mich nicht eingemischt hätte. Das sagt meine Mum immer: Halt dich heraus, Richard, du machst immer alles noch schlimmer.«