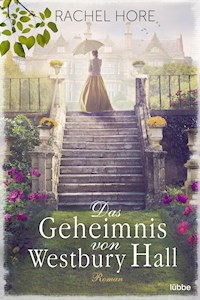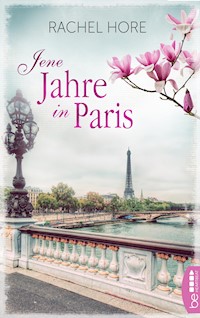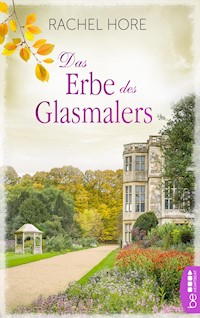
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die bewegenden Familienromane der britischen Erfolgsautorin
- Sprache: Deutsch
Die Vergangenheit bringt die Wahrheit ans Licht ...
Nur widerwillig kehrt Fran in ihr Elternhaus in London zurück. Seit dem frühen Tod ihrer Mutter ist das Verhältnis zu ihrem Vater schwierig, und als Musikerin sollte Fran eigentlich auf Tournee sein. Doch als ihr Vater einen Schlaganfall erleidet, ist sie plötzlich für das traditionsreiche kleine Familienunternehmen Minster Glass zuständig, eine Werkstatt für Glasmalerei und Glaskunst. Ihr erster Auftrag: die Restauration eines zerbrochenen Kirchenfensters. Bei der Suche nach den Originalzeichnungen stoßen Fran und Zac, der Assistent ihres Vaters, auf eine faszinierende Liebesgeschichte aus viktorianischer Zeit - eine Liebesgeschichte, die auch ihr eigenes Leben berührt ...
Mit "Das Erbe des Glasmalers" hat Rachel Hore einen bewegenden Roman auf zwei Zeitebenen geschrieben: Die historische Handlung aus dem Jahr 1879 hilft Fran, der Wahrheit über ihre eigene Vergangenheit näher zu kommen.
Dieser Familiengeheimnis-Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Der Zauber des Engels" erschienen.
Weitere Romane von Rachel Hore bei beHEARTBEAT:
Das Haus der Träume.
Der Garten der Erinnerung.
Die Karte des Himmels.
Jene Jahre in Paris.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Prolog
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
NACHTRAG
DANKSAGUNG
Weitere Titel der Autorin
Das Haus der Träume
Der Garten der Erinnerung
Die Karte des Himmels
Jene Jahre in Paris
Das Bienenmädchen
Wo das Glück zuhause ist
Das Geheimnis von Westbury Hall (November 2019)
Über dieses Buch
Die Vergangenheit bringt die Wahrheit ans Licht …
Nur widerwillig kehrt Fran in ihr Elternhaus in London zurück. Seit dem frühen Tod ihrer Mutter ist das Verhältnis zu ihrem Vater schwierig, und als Musikerin sollte Fran eigentlich auf Tournee sein. Doch als ihr Vater einen Schlaganfall erleidet, ist sie plötzlich für das traditionsreiche kleine Familienunternehmen Minster Glass zuständig, eine Werkstatt für Glasmalerei und Glaskunst. Ihr erster Auftrag: die Restauration eines zerbrochenen Kirchenfensters. Bei der Suche nach den Originalzeichnungen stoßen Fran und Zac, der Assistent ihres Vaters, auf eine faszinierende Liebesgeschichte aus viktorianischer Zeit – eine Liebesgeschichte, die auch ihr eigenes Leben berührt …
Über die Autorin
Rachel Hore, geboren in Epsom, Surrey, hat lange Zeit in der Londoner Verlagsbranche gearbeitet, zuletzt als Lektorin. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen in Norwich. Sie arbeitet als freiberufliche Lektorin und schreibt Rezensionen für den renommierten Guardian.
Mehr über die Autorin und ihre Bücher erfahren Sie unter www.rachelhore.co.uk.
RACHEL HORE
DAS ERBEDES GLASMALERS
Familiengeheimnis-Roman
Aus dem britischen Englisch vonBarbara Ritterbach
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Rachel Hore
Titel der englischen Originalausgabe: »The Glass Painter’s Daughter«
Originalverlag: Pocket Books UK, an Imprint of Simon & Schuster UK Ltd.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2011/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Der Zauber des Engels«
Textredaktion: Jutta Nickel
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: Lee Yiu Tung | Nella | Nebs | Ian Dyball
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7720-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Felix,Benjy und Leo –non angeli sed Angli.
In früheren Zeiten gab es Engel, die kamen und Menschen an die Hand nahmen und von der Stadt der Zerstörung wegführten. Heute sehen wir keine Engel mit weißen Flügeln mehr. Und dennoch werden Menschen von drohender Zerstörung weggeführt: Eine Hand legt sich sanft um ihre und geleitet sie in ein friedliches, helles Land, sodass sie nicht mehr zurückblicken; und die Hand könnte die eines kleinen Kindes sein.
George Eliot, Silas Marner
Eine Frau ist wie der Erzengel Michael, der auf der Engelsburg in Rom steht. Sie ist ausgestattet mit mächtigen Flügeln, die aussehen, als würden sie sie über Erde und Himmel hinwegtragen, aber wenn sie versucht, sie zu benutzen, erstarrt sie zu Stein, und ihre Füße bleiben fest verhaftet mit dem Bronze-Podest.
Florence Nightingale, Cassandra
Prolog
London, 3. September 1993
Das Schild mit der Aufschrift Geschlossen hing nun schon seit fast einer Woche an dem Laden für Glaskunst. Aber es hatte die Passanten nicht davon abgehalten, an der Tür zu rütteln oder durch die Fenster ins Innere zu spähen, ob es drinnen nicht doch ein Lebenszeichen gab. Schließlich brannten ein paar Lichter, und die exquisiten Auslagen im Schaufenster hatten sie aus ihrer frühmorgendlichen Trance gerissen: ein Engel, der in der Mitte eines bogenförmigen Glasbildes schwebte; Sonnenfänger – zarte Libellen und Feen, die bei jeder Luftbewegung erzitterten; eine Vielzahl von Lampenschirmen im Tiffany-Stil, die wie üppige Blüten im Baumkronendach eines tropischen Regenwaldes von der Decke herabhingen.
Ein junges Mädchen, das jeden Tag vorbeikam, bemerkte, dass die Tür hinten im Laden manchmal offen und manchmal geschlossen war und dass einmal zwei oder drei Kartons auf der Theke standen, die später wieder verschwunden waren.
Noch eine andere Person besuchte den Laden in dieser Woche gleich mehrfach: ein Mann mittleren Alters, der eine Tweedjacke trug, unter der der Kragen eines Geistlichen zu erkennen war. Beim ersten Mal rüttelte er an der Tür und fand sie verschlossen vor. Er trat einen Schritt zurück und las die Worte Minster Glass über dem Eingang, dann rückte er seine Brille zurecht, um die Öffnungszeiten zu studieren. Anschließend ging er stirnrunzelnd durch die Grünanlage des gegenüberliegenden Platzes davon. Am nächsten Tag schob er einen weißen Umschlag durch den Briefkastenschlitz. Beim dritten Mal, als er gerade die Telefonnummer auf dem Schild in ein Notizbüchlein kritzelte, kam eine Frau mit Schürze und dicker Geldbörse aus dem Café nebenan.
»Möchten Sie zu Mr. Morrison?«, rief sie und musterte den Mann von oben bis unten, als wolle sie sich vergewissern, dass er nicht nur ein hergelaufener Landstreicher war. »Er ist krank. Letzte Woche war der Krankenwagen da.« Mehr wusste sie auch nicht. Er bedankte sich höflich, steckte sein Notizbuch in die Tasche und wandte sich zum Gehen.
Am Freitagnachmittag schließlich scherte ein schwarzes Taxi aus dem Verkehrsstrom aus und hielt vor dem Laden. Eine schlanke, hübsche Frau mit schulterlangen dunklen Haaren und blasser Haut stieg aus und zerrte ein paar Gepäckstücke auf den Gehweg.
Anita war im Café und schaute gerade aus dem Fenster, während sie darauf wartete, dass die Kaffeemaschine einen Espresso brühte. Sie betrachtete die abgewetzte Reisetasche und den vollgestopften Rucksack und fragte sich, was wohl in dem anderen, seltsam unförmigen Behälter stecken mochte. Sicher irgendein Musikinstrument, überlegte sie. Entweder das oder ein ziemlich kleiner Elefant, der Form nach zu schließen.
Die Frau wartete, bis das Taxi davongefahren war, und blickte versonnen auf das Ladenschild. Minster Glass. Mit dem kurzen Mantel, dem gestreiften Schal und den ernsten braunen Augen sah sie aus wie ein schüchternes Schulmädchen am ersten Tag nach wundervollen Sommerferien. Anita war neu im Café, sonst hätte sie die Identität der jungen Frau vielleicht erahnt und begriffen, dass Fran Morrisons ganzes Leben an ihrem geistigen Auge vorüberzog, während sie das Geschäft ihres Vaters betrachtete.
1. KAPITEL
Tränen, wie von Engeln, fließen heraus.
John Milton, Paradise Lost
Manchmal, wenn ich an einem Sommermorgen früh erwache und alle anderen noch schlafen, liege ich wie in einem Tagtraum da und denke daran, wie alles begann. Ich erinnere mich genau an jenen Augenblick vor zehn Jahren, an jene Millisekunde, als ich beim Blick auf den geschlossenen, verlassenen Laden erkannt habe, dass alles anders geworden war, unwiederbringlich und für immer.
Normalerweise ist eine Rückkehr nach Hause ein Rückschritt. Genau das hatte ich auch befürchtet, aber in diesem Fall entpuppte es sich als Schritt nach vorn in ein neues Leben. Ich habe häufig nachgedacht über diese Geschichte, die meine ganz persönliche Geschichte einer – ja, einer Engelsuche ist. Und nachdem ich so lange darüber gegrübelt und zugesehen habe, wie sich alles entwickelte – wie konzentrische Kreise, die entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft –, ist nun der Zeitpunkt gekommen, alles niederzuschreiben. Und so steige ich jeden Abend die Treppe zum Dachgeschoss hinauf, setze mich an Dads alten Schreibtisch und nehme den Füllhalter zur Hand. Und während es draußen noch lange hell ist, vertiefe ich mich in meine Arbeit.
Mein altes Zuhause war das allerletzte, wo ich in jenem wunderbar milden Herbst 1993 sein wollte. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mir eine Wohnung in einem alten Palazzo in Venedig ausgesucht, eine hübsche Pension in Heidelberg oder ein vornehmes Luxushotel in New York oder Tokio. Irgendwas ganz anderes jedenfalls, etwas Exotisches, wo ich ganz und gar in der Gegenwart leben und die Vergangenheit vergessen konnte. Aber manchmal lässt uns das Leben keine Wahl. So fand ich mich in London wieder – eine traurige Heimkehr angesichts der Umstände. Und trotzdem: Wenn ich es vom heutigen Standpunkt aus betrachte, erkenne ich, dass es genau richtig war.
Am Tag zuvor, als Zac mich endlich erreicht und mir die Nachricht übermittelt hatte, befand ich mich in Athen. Ich dämmerte an einem brütend heißen Nachmittag in meinem Hotelzimmer in einem der älteren Stadtteile vor mich hin. Der Hausmeistersohn, ein mürrischer Sechzehnjähriger, hatte an meine Tür geklopft und mich dann zu einem Telefon in der kühlen, gefliesten Hotellobby geführt.
»Fran! Endlich!«, rief die Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Zac, was ist denn los?« Den schottischen Akzent hätte ich überall auf der Welt erkannt. Zac war Dads Mitarbeiter bei Minster Glass.
»Wieso zum Teufel liest du deine Nachrichten nicht?«
Kein »Wie geht’s dir?« oder »Ich hab ja ewig nichts von dir gehört«. Er klang so aufgeregt, dass ich ihn nicht mal fragte, wo er denn Nachrichten für mich hinterlassen und wie er meine Nummer ausfindig gemacht habe.
»Ich habe keine Nachrichten bekommen, deshalb. Was ist denn los, Zac?« Dabei ahnte ich längst, was los war.
Die Gereiztheit in Zacs Stimme verschwand, an ihre Stelle trat Verzweiflung. »Du musst unbedingt nach Hause kommen. Sofort! Dein Vater liegt im Krankenhaus – und diesmal ist es sehr ernst, Fran. Er hatte einen schweren Schlaganfall.«
Ich versuchte, klar zu denken, als ich an diesem Abend packte. Es gab niemanden in Athen, den ich benachrichtigen musste, denn die Konzerttournee war seit einigen Tagen beendet. Die anderen Mitglieder des Orchesters waren gleich am nächsten Morgen weitergereist, hatten sich in der Lobby mit lautstark auf die Wange gehauchten Küsschen verabschiedet und sich gegenseitig versprochen, in Kontakt zu bleiben. Auch Nick war abgereist. Ich hatte einige Tage zuvor beschlossen, mir eine preiswertere Bleibe zu suchen und noch ein bisschen Urlaub zu machen, und er war genau in dem Augenblick aufgetaucht, als es mir gerade mies ging und ich die anderen darum beneidete, dass sie aufgeregt nach Hause fuhren. Er hatte gelächelt, mich züchtig auf die Wange geküsst und gemurmelt: »Auf Wiedersehen. Pass auf dich auf.«
»Das tue ich immer. Auf Wiedersehen, Nick«, hatte ich, so cool ich nur konnte, geantwortet und zugesehen, wie er sein Gepäck nach draußen schleppte. Um mich noch ein bisschen mehr zu quälen, spähte ich durch die Topfpflanzen im Fenster, sah zu, wie er sein Cello im Kofferraum des Taxis verstaute und aus meinem Leben verschwand – für immer.
Als alle fort waren, reiste ich mit meinen Taschen und meiner Tuba in das schäbige Hostel Aphrodite. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, ein bisschen Sightseeing zu machen, bis ich erfuhr, wo ich als Nächstes musizieren würde – irgendwas Schickes, hoffte ich. München zum Beispiel oder Rio oder Paris. Aber dann war ich so erschöpft gewesen, dass ich nicht mehr die Energie aufbrachte, mir die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Schließlich hatte Zac angerufen, und alles war ganz anders geworden.
Nun stand ich also vor unserem alten Laden am Greycoat Square. Minster Glass, der Ort, an dem ich geboren wurde. Das meine ich natürlich nicht wörtlich. Meine Geburt hatte vor dreißig Jahren in demselben Krankenhaus stattgefunden, in dem mein Vater nun lag, vermutlich auch in demselben Krankenhaus, in dem meine Mutter gestorben war, als ich noch klein war.
Es ist eine geheimnisvolle Gegend, dieser Teil von Westminster, mit der gewaltigen gotischen Westminster Abbey und der im italienischen Stil verschnörkelten katholischen Kathedrale, zwischen der geschäftigen Victoria Street im Norden und der Themse im Süden; eine Gegend voller versteckter grüner Plätzchen wie unserem, mit viktorianischen Häusern, deren Vorgärten mit schwarzen schmiedeeisernen Zäunen umgeben waren. An den Türen hingen Messingschilder der seltsamsten Organisationen und Firmen: die Theosophische Gesellschaft London, der Königliche Orden der Griffins, die Bookbinders Gazette. Vermutlich war auch Minster Glass so eine Seltsamkeit. Aber ich liebte sie alle.
Ein Geschäft für viktorianische Glaskunst mit tiefen Erkerfenstern und einem gefliesten, herrlich altertümlichen Eingang entsprach sicher nicht der gängigen Vorstellung eines gemütlichen Heims. Dad und ich hatten in der Wohnung über dem Laden gehaust – treffender konnte man unsere chaotischen Wohnverhältnisse wirklich nicht beschreiben. Ein Wohnzimmer, eine große Küche, drei Schlafräume und ein riesiger Dachboden hätten für uns beide eigentlich ausreichen müssen, aber jede Ecke und jede Nische war mit irgendwelchem Gerümpel vollgestellt: Bücher, Kisten, Aktenordner, die die gesamte Geschichte von Minster Glass ausmachten.
Die Tür, die in die Wohnung hinaufführte, erreichte man von der kleinen Werkstatt hinter dem Ladenlokal. Ich erinnerte mich noch gut, wie ich an düsteren Wintermorgen die nackte Holztreppe hinunterging, durch die eiskalte Werkstatt mit den dunklen Ecken und dem beißenden Geruch, in ständiger Angst, etwas kaputt zu machen und mir Dads Zorn zuzuziehen, um meine Freundin Jo zu treffen und mit ihr zusammen zur Schule zu gehen. Jos Familie wohnte in einem Stadthaus ganz in der Nähe, ihr Vater war ein erfolgreicher Rechtsanwalt in der City.
Draußen auf dem Gehweg blieb ich immer kurz stehen und warf einen Blick auf das Ladenlokal, weil es so schön war. Ich liebte das wechselnde farbige Licht, vor allem wenn die Sonne durchs Fenster schien und rubinrote, smaragdgrüne und saphirblaue Muster auf den Holzfußboden malte, sodass es wie ein geweihter Ort aussah.
Die stille Schönheit beruhigte mich auch jetzt, als ich den Schlüssel umdrehte, die Klinke herunterdrückte und eintrat. Das Glöckchen bimmelte traurig über meinem Kopf. Einen Moment lang blieb ich stehen, atmete die vertrauten Gerüche ein, den Moder des alten Holzes, den Hauch irgendeiner Chemikalie. Einen flüchtigen Augenblick fühlte ich mich wieder wie das kleine Mädchen, das früher in den staubigen Strahlen des bunten Lichts getanzt hatte.
Etwas erregte meine Aufmerksamkeit – ein praller weißer Briefumschlag, der auf der Fußmatte lag. Ich hob ihn auf und registrierte ein Wappen, das auf der Rückseite eingeprägt war. Der Brief war an Dad adressiert, daher legte ich ihn ungeöffnet auf die Verkaufstheke.
Das Letzte, wonach mir jetzt der Sinn stand, war irgendein nervender Kunde. Daher schloss ich ab, zerrte mein Gepäck durch den Laden, öffnete die Tür hinter der Theke und betrat die Werkstatt.
Während das Ladenlokal immer warm und einladend war wie eine Kirche, war die Werkstatt so kühl wie die dazugehörende Krypta. Ich schaltete die Deckenlampen ein und blinzelte kurz in das gleißend helle Licht. Scherben knirschten unter meinen Füßen, als ich über den Betonfußboden lief.
Durch das rechteckige Fenster schaute ich in den rumpeligen Hinterhof mit der Garage, die man über eine Einfahrt rechts vom Laden erreichen konnte. Auf der Arbeitsfläche neben mir lag ein bleiverglastes Fenster, bereits teilweise verlötet. Sicher hatte Dad daran gearbeitet, als es passierte. Zac hatte erzählt, er hätte in dem winzigen Büro gesessen, als er Dad stöhnen und Sekunden später einen Stuhl polternd zu Boden krachen gehört hatte.
Traurig blickte ich nun auf den Stuhl. Mit dem Finger fuhr ich über das keltische Flechtmuster, das Dad gemacht hatte und das er besonders gern zur Umrandung oder zum Füllen von kleinen Flächen benutzte und manchmal sogar als seine Künstlersignatur. Er mochte es deshalb so, wie er immer sagte, weil er es in einer einzigen ununterbrochenen Linie zeichnen konnte. Unter der Arbeitsfläche stieß ich mit dem Fuß an irgendetwas, das daraufhin wegzurollen begann. Ich bückte mich. Es war die Spitze eines zerbrochenen Lötkolbens. Das restliche Teil lag auch dort unten. Zac schien es aus der Steckdose gezogen und in der Hektik einfach liegen gelassen zu haben. Ich hob die Einzelteile auf und betrachtete sie. Dabei bemerkte ich noch etwas anderes, etwas Glitzerndes, zwischen den Staubflocken unter der Werkbank. Ich streckte die Hand danach aus.
Es war eine kleine goldene Brosche in Form eines Engels, mit funkelnden blauen Steinchen. Sehr hübsch und vielleicht auch wertvoll. Ich hatte die Brosche noch nie zuvor gesehen und nicht die leiseste Ahnung, woher sie stammen könnte. Ich legte sie auf die Werkbank neben die Teile des Lötkolbens und Dads fleckiges Arbeitsmesser.
An einem Farbklecks am Messer war Dads Fingerabdruck zu erkennen, und ganz plötzlich wurde ich mir bewusst, wie sehr er hier fehlte. Ich barg mein Gesicht in den Händen und gestattete mir endlich, daran zu denken, wie ich ihn ein paar Stunden zuvor gesehen hatte.
Niemand hatte mich vom Flughafen Heathrow abgeholt, aber ich hatte Zac ja nicht mal meine Flugzeiten durchgegeben. Ich war sofort ins Krankenhaus gefahren, wo mich eine Schwester in ein kleines Zimmer und dort zum Bett am äußersten Ende geführt hatte.
Es dauerte einen Moment, ehe ich begriffen hatte, dass die Gestalt in diesem Bett Dad war, mein Dad. Er war so hilflos, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Die Augen hatte er geschlossen. Schläuche, die einer Kanüle in seinem Handrücken entsprangen, waren über seinem Bett befestigt. Unwillkürlich musste ich an die langen Streifen Bleilot denken, die in seiner Werkstatt an Haken aufgehängt waren. Die roten, gleichmäßig pulsierenden Zickzackkurven auf dem Monitor neben seinem Bett waren das einzige erkennbare Lebenszeichen.
Ich setzte mich auf einen Stuhl neben dem Bett und betrachtete das blasse schlafende Gesicht. »Dad. Daddy«, flüsterte ich. Kein Anzeichen, dass er es gehört hätte. Mit dem Handrücken berührte ich seine Wange. Sie fühlte sich kühl an.
Ein bisschen ist er wie immer, versuchte ich mir einzureden, um mich zu beruhigen. Sein schütteres graues Haar war wie üblich ordentlich zurückgekämmt; der lange, schmale Kopf mit den hohen Wangenknochen und der Hakennase besaß noch immer dieselbe Würde. Aber seine durchscheinende Haut, der Speicheltropfen auf den grauen Lippen, das zuckende Augenlid, all das ließ mich befürchten, dass ein schreckliches fremdes Wesen Besitz von ihm ergriffen hatte. Und nicht zum ersten Mal in meinem Leben fragte ich mich, wie dieser Mann, mein Vater, eigentlich wirklich war.
Man sagt, dass man einen Menschen nie ganz und gar kennt, und große Teile des Innenlebens von Edward Morrison waren mir, seinem einzigen Kind, immer verschlossen geblieben. Er war kein böser Mensch, aber häufig distanziert, leicht reizbar, rau und unsensibel. Alles konnte ihn nerven – wenn jemand anrief, während wir gerade beim Essen saßen, wenn ein benachbarter Ladenbesitzer Müll auf dem Gehweg stapelte, obwohl die Müllabfuhr an dem Tag gar nicht kam. Im Laufe des Alters wurde das immer schlimmer, und ich hatte mich oft gefragt, wie Zac damit zurechtkam.
Jetzt machte Dad einen umso friedlicheren Eindruck. Ich saß neben ihm und wartete auf einen Gefühlsausbruch, auf Tränen. Aber alles, was ich spürte, war Taubheit.
»Wir glauben, dass er bald wieder zu sich kommt.« Dr. Bashir, der Arzt, der wenig später auftauchte, war ein ruhiger, untersetzter Pakistani mittleren Alters. »Es gibt Anzeichen dafür, dass er allmählich aus dem Koma erwacht. Aber die Untersuchungen deuten auf einen schweren Hirnschlag hin. Wir wissen daher nicht, was sein wird, wenn er aufwacht.«
»Er ist doch erst einundsechzig«, antwortete ich. »Ist das nicht viel zu jung?«
Dr. Bashir schüttelte den Kopf. »Leider ist das nicht ungewöhnlich, zumal Ihr Vater an Diabetes Typ I litt. Dazu kam noch der erhöhte Blutdruck.« Seit ich denken konnte, hatte Dad Diabetes gehabt, und ich erinnerte mich an die schlechten Phasen, wenn er sich die Insulinspritze zu spät gesetzt hatte, was zum Glück nur selten passierte. Doch dieser Schlaganfall war unbekanntes Terrain für mich.
Als Dr. Bashir wieder weg war, schaute ich aus dem Fenster in den klaren Himmel. Wenn Dad aufwachte – und er würde aufwachen, davon war ich überzeugt –, würde er wenigstens das wechselnde Licht sehen können, das er so sehr liebte. Er würde die Vögel sehen und die Wolken, die am Himmel vorüberzogen, die Abendröte, die in die Dunkelheit überging, die funkelnden Sterne und die blinkenden Positionslichter der Flugzeuge.
Dieser Gedanke tröstete mich, als ich mich flüsternd verabschiedete und seine kühle, leblose Hand streichelte.
Erst am späten Nachmittag fiel mir der offiziell aussehende Brief wieder ein, den ich auf die Ladentheke gelegt hatte. Ich hatte die Wohnung inspiziert, die aufgeräumt, wenn auch nicht sonderlich sauber war, hatte in meinem alten Zimmer das Bett gemacht, ausgepackt und ein paar Lebensmittel im Supermarkt an der Ecke gekauft. Als ich mit meinen Einkaufstüten zurückkam, fiel mein Blick wieder auf den Brief. Das Wappen, dachte ich, es könnte also wichtig sein, und riss den Umschlag auf.
Die einzelne Seite war überschrieben mit Pfarrei St. Martin’s Westminster. Pfarramt und stammte offenbar vom Pfarrer selbst, denn es gab weder Absätze noch einen Seitenrand.
Lieber Ted,
ich wollte dich gestern im Geschäft besuchen, aber es war leider geschlossen. Bist du vielleicht unterwegs? Wenn ja, so hoffe ich, dass du diesen Brief bei deiner Rückkehr findest.
Es wäre jedenfalls schön, wenn du mich bei nächster Gelegenheit anrufen würdest, denn ich habe eine Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Auf jeden Fall erfordert sie deinen fachmännischen Rat, da deine Firma ja einige unserer Kirchenfenster angefertigt hat. Das könnte auch eine gute Gelegenheit für dich sein, die Fenster einmal in Augenschein zu nehmen – bezüglich der Befunde in unserem jüngsten Fünfjahresgutachten, von denen ich dir ja berichtet hatte.
Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Unsere Gespräche bedeuten mir sehr viel.Beste GrüßeJeremyREVEREND JEREMY QUENTIN
St. Martin’s war die viktorianisch-gotische Sandstein-Kirche in der Vincent Street, die den Greycoat Square an der gegenüberliegenden Ecke streifte und in etwa parallel zur Victoria Street verlief. Ich erinnerte mich nicht daran, die Kirche je betreten zu haben, weil sie immer geschlossen ausgesehen hatte, wenn ich an ihr vorbeikam. Aber die vergitterten bunten Fenster waren mir schon häufiger aufgefallen, und ich hatte mich gefragt, welche Szenen darauf wohl dargestellt sein mochten. Vage erinnerte ich mich daran, dass Dad mir mal erzählt hatte, Minster Glass habe sie hergestellt – irgendwann in viktorianischer Zeit.
Er hatte mir auch erzählt, dass ich dort getauft worden bin, aber bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen wir einen Gottesdienst besuchten, gingen wir immer in die Westminster Abbey. Wir beide liebten die Musik, und Dad fand die Predigten intellektuell anspruchsvoller. Außerdem konnten wir uns dort nach dem Gottesdienst leichter hinausschleichen, ohne dass er in aufdringliche Gespräche verwickelt wurde. Denn in spirituellen Angelegenheiten bevorzugte er es ebenso wie sonst im Leben eher privat. Es wunderte mich, dass er sich mit Reverend Quentin angefreundet hatte.
Ich steckte den Brief zurück in den Umschlag und ließ ihn auf der Theke liegen. Zugleich nahm ich mir vor, den Pfarrer so bald wie möglich anzurufen und über Dads Zustand zu informieren.
An diesem Abend putzte ich die Wohnung gründlich, auch um mich ein bisschen abzulenken. Ich warf alte Lebensmittel fort, wischte den verblichenen Linoleumboden, schrubbte das alte Bad und staubsaugte das Wohnzimmer, so gut es mit Dads altersschwachem Gerät möglich war. Der lange Tag, die aufwühlenden Gefühle und die ungewohnte körperliche Anstrengung hatten mich vollkommen erschöpft. Ich ließ mich in den Sessel am Wohnzimmerfenster fallen und stocherte in einem abgepackten Hühnersalat herum.
Die Gärten am Greycoat Square färbten sich im Sonnenuntergang erst golden, dann silbrig, als die Dunkelheit hereinbrach. Der Reihe nach gingen in den Häusern ringsum die Lichter an, und die Gehwege schimmerten im schwefelgelben Schein der Straßenlaternen. Ich hatte ganz vergessen, wie friedlich und schön der Platz sein konnte. Kaum zu glauben, dass man sich im Herzen einer Großstadt befand.
Ein paar Häuser weiter, neben einem Antiquariat, gab es eine neue Weinbar. Die Gäste kamen heraus und traten in die milde Abendluft. Durch das allgemeine Stimmengewirr registrierte ich in der Ferne die erhabenen Klänge von Elgars Cello-Konzert. Ich stand auf, um genauer hinzuhören. Die Musik drang von irgendwo auf der anderen Seite des Platzes an mein Ohr. Plötzlich überfiel mich der Wunsch, noch einmal mit Nick zu sprechen, mit solcher Heftigkeit, dass es fast körperlich schmerzte.
Ich hatte ihn vor drei Wochen in Belgrad kennengelernt, als ich zum Royal London Orchestra stieß, das sich auf einer Osteuropa-Tournee befand. Nick Parton war ein paar Jahre jünger als ich, ein sehr begabter und ebenso ehrgeiziger Cellist. Seine ungeheure Energie gefiel mir ebenso wie die sanfte, immer etwas spöttische Stimme, die glatte, olivfarbene Haut und das perfekte Profil, das ich jeden Abend von meiner Position im hinteren Teil des Orchesters bewundern konnte.
»Ich kann gar nicht glauben, dass Sie stark genug sind, dieses Monstrum zu spielen«, waren seine ersten Worte gewesen. Dabei hatte er auf die Tuba in meinem Arm gezeigt.
»Dann schauen Sie mal genau zu«, hatte ich kühl geantwortet. Ich hatte die Lippen gespitzt und einen derart ohrenbetäubenden Ton auf dem Instrument erzeugt, dass der mürrische Orchesterleiter seinen Notenständer umwarf und erbost fluchte. Nick warf bloß den Kopf in den Nacken und lachte.
Danach spürte ich die ganze Zeit seine Blicke auf mir. Er behandelte mich mit übertriebener Fürsorge, bot mir spöttisch an, meinen Instrumentenkoffer für mich zu tragen, weil ich viel zu zart dazu sei, und hielt mir, als ich gereizt ablehnte, trotz seines eigenen schweren Gepäcks mit einer galanten Verbeugung die Tür auf. Nach ein paar Tagen wurde ich etwas zugänglicher, und eines Abends teilten wir uns nach einem späten Essen im Restaurant erschöpft ein Taxi und genehmigten uns an der Hotelbar noch einen Absacker.
Danach gab es nur noch einen Abend in Belgrad, denn das Orchester reiste weiter nach Prag, Zagreb und Budapest, einem wunderbaren Ort nach dem nächsten, sodass unsere Romanze nie alltäglich werden konnte. Nur ein Problem gab es, von dem ich jedoch erst an unserem letzten Abend in Athen erfuhr: die Existenz seiner Verlobten Fiona zu Hause in Birmingham. Es stellte sich heraus, dass Nick unsere Liaison als letztes »Abenteuer« vor seiner Hochzeit im Oktober betrachtete. Und daher war der letzte Abend unserer Tournee zugleich unser persönliches Finale, das mit Tränen und Vorwürfen von meiner und Unverständnis von seiner Seite endete.
Als ich in meinem klapprigen Bett in der griechischen Pension lag und noch einmal über das nachdachte, was Nick in den Wochen zuvor gesagt und getan hatte, wurde mir klar, dass er immer Andeutungen gemacht hatte, die ich jedoch nie verstehen wollte. Auch wenn ich wütend und enttäuscht war, als er mir von Fiona erzählt hatte, war ich nicht wirklich überrascht gewesen, denn in diesem Moment ergab vieles plötzlich einen Sinn. Seine Weigerung zum Beispiel, noch länger mit mir in Athen zu bleiben, die Telefongespräche, die er dauernd führte, sein Unwillen, darüber zu sprechen, wie es nach der Tournee weitergehen würde.
Ich versuchte mich mit der Vorstellung zu trösten, wie schrecklich das alles für die arme, betrogene Fiona sein musste und wie ich mich fühlen würde, wenn die Sachlage umgekehrt gewesen wäre und ich herausgefunden hätte, dass mein Verlobter mich hintergangen hatte. Sie musste doch Verdacht geschöpft haben. Was wäre schlimmer? Wenn sie es nicht hatte – oder aber, wenn sie doch einen Verdacht hatte und ihn trotzdem heiratete? Ich wusste es nicht. Wenigstens hatte ich die Wahrheit erfahren, ehe unser Verhältnis zu eng geworden war. Und es war nicht das erste Mal, dass ich in solch einem Schlamassel steckte. Man konnte behaupten, ich hatte ein Talent dazu.
Ich hatte nicht die Absicht gehabt, mich in einen unerreichbaren Mann zu verlieben; es war einfach so passiert. Vielleicht besaß ich eine Antenne, die auf irgendwelche seltsamen Schwingungen reagierte, die sie allesamt aussandten – diese Männer, die entweder immer verheiratet waren oder aber niemals vorgehabt hatten, bis zum Ende durchzuhalten.
Ich lauschte den aufwühlenden Klängen des Cellos und grübelte über meine Vorliebe für Kinofilme nach, in denen Liebende zusammenfanden, während Schiffe versanken, Städte von feindlichen Truppen erobert wurden oder ein Asteroid die Erde traf … Situationen, in denen die Liebe verzweifelt und leidenschaftlich war und nichts mit der eintönigen Realität gemein hatte.
Ich war erwachsen genug, um den schmerzhaften Prozess zu durchschauen, in den ich mich immer wieder selbst hineinmanövrierte, und ich wusste auch, dass es allmählich Zeit wurde, mich ihm zu entziehen. Während ich allein in der schäbigen alten Wohnung saß, die immer noch mein Zuhause war, weil ich kein anderes hatte, kämpfte ich gegen den Drang, Nicks Nummer ausfindig zu machen und ihn anzurufen. Das Einzige, was mich davon abhielt, war der Gedanke, die arme Fiona könne abheben. Ich sehnte mich verzweifelt nach Nick. Aber nicht nach einem Nick, der kommen und wieder gehen würde. Ich wusste inzwischen, dass ich mich nach jemandem sehnte, der auf immer und ewig und ganz und gar zu mir gehören würde.
2. KAPITEL
Und der Engel sagte: »Ich habe gehört, dass der Mensch nicht durch sich selbst, sondern durch die Liebe lebt.«
Leo Tolstoi, Wovon die Menschen leben
In dieser Nacht schlief ich, als stände ich unter Drogen, und als ich wach wurde, fühlte ich mich hungrig und elend. Als ich, noch immer im Pyjama, ungefähr fünf Zentimeter Fett von Dads Grillpfanne kratzte, die ich bei meinem Großreinemachen gestern offenbar übersehen hatte, klingelte das Telefon. Es war das Krankenhaus. Dad sei in der Nacht kurz wach geworden, berichtete eine Krankenschwester. Ich war ungeheuer erleichtert. Er würde wieder gesund werden. Alles würde gut!
Hastig aß ich einen Bissen Toast, schlüpfte in Jeans und Jacke und machte mich auf den Weg. Als ich die Horseferry Road hinablief, begegneten mir ein paar frühmorgendliche Jogger und ein Trupp Müllarbeiter. Eine dicke Inderin fegte mit langsamen Bewegungen den Gehweg vor einem Blumenladen. Spontan bat ich sie, mir ein paar Freesien einzupacken. Vielleicht würde Dad sich ja über den Duft freuen, auch wenn er die Farben nicht wahrnehmen konnte.
Auf der Lambeth Bridge wehte mir ein kräftiger Wind vom Fluss entgegen, der meinen Optimismus gehörig dämpfte. Ein Gefühl der Angst machte sich in mir breit.
Als ich in Dads Krankenzimmer kam, sah ich, dass die Vorhänge um sein Bett herum zugezogen waren. Aus meiner Angst wurde Panik. Hoffentlich hatte er keinen Rückfall erlitten. Als eine Schwester mit einer Schüssel Seifenlauge und einem Handtuch erschien und lächelte, legte sich meine Panik wieder. Doch ich war voreilig. Im nächsten Moment erkannte ich, dass längst nicht alles gut war.
Dad sah genauso aus wie am Tag zuvor. Er hatte die Augen geschlossen, den Mund geöffnet und schnarchte leise. Ich zog den Stuhl heran und suchte nach Anzeichen für irgendeine Veränderung. Hatte er mehr Farbe im Gesicht? Möglich. Auf einmal öffnete er die Augen einen Spalt breit und blinzelte ins Licht.
»Dad«, flüsterte ich und setzte mich genau so, dass er mich praktisch direkt anschauen musste. Er schien verwirrt zu sein, sein Mund zuckte leicht, als versuchte er zu sprechen.
»Schsch«, sagte ich hilflos. Weil seine linke Hand, die mir am nächsten war, ein bisschen zitterte, legte ich meine Hand ganz vorsichtig auf seine. Wir schauten einander an; und er hatte den unschuldigen Blick eines kleinen Kindes an sich. Ich wandte mich zuerst ab, wollte die Tränen in meinen Augen verbergen.
Etwas Positives gab es immerhin. Er hatte mich erkannt, das wusste ich ganz genau. Er war noch derselbe, trotz meiner Befürchtungen. Und doch beschlich mich das Gefühl, dass er mich inständig um etwas bitten wollte, wie ein Tier, das gefangen war.
»Dad, alles ist gut. Ich bin bei dir.« Beruhigend redete ich auf ihn ein. »Ich kümmere mich um den Laden, mach dir keine Sorgen. Zac wird mir sicher helfen.« Dabei hatte ich seit meiner Rückkehr noch keinen Ton von Zac gehört.
Ich blieb, bis Dad wieder eingeschlafen war. Mein Rückweg vom Krankenhaus dauerte doppelt so lange, weil ich auf der Lambeth Bridge herumtrödelte, in das graue Wasser unter mir starrte und froh war, dass der beißend kalte Wind meinen seelischen Schmerz betäubte. Auch in mir stieg eine Flut, die mich forttrug … aber wohin? Ich hatte keine Ahnung. Mein Leben war hoffnungslos ins Trudeln geraten.
Als ich in den Laden kam, stand Zac in der Werkstatt und schnitt ein Stück leuchtend rotes Glas zurecht. Er schaute auf, als ich hereinkam, den schmalen Körper gebeugt, den Glasschneider einsatzbereit in der Hand. Ich blieb in der Tür stehen, als ich spürte, dass die alte Unbeholfenheit zwischen uns sofort wieder da war, wie ein undurchdringlicher Nebel.
»Hallo, Fremde«, murmelte er schließlich und lächelte mühsam. »Wie sieht’s aus?«
»Ich war gerade bei Dad«, antwortete ich so fest wie möglich. Zac legte das Messer aus der Hand und musterte mich. Zerstreut rieb er sich eine Schwiele am Zeigefinger.
»Wie geht es ihm?«, fragte er. Seine Stimme klang so heiser, als hätte er seit ein paar Tagen nicht mehr gesprochen. Was mich nicht überrascht hätte. Ich hatte nie viel über Dads Mitarbeiter in Erfahrung bringen können. Er arbeitete für Dad, seit ich vor zwölf Jahren das Haus verlassen hatte. Damals war er Anfang zwanzig gewesen, ein dünner, blasser Mann mit dunklen Augen, dichten schwarzen Haaren, Glasgower Akzent und jener typisch keltischen, geheimnisvollen Aura. Er war sehr verschlossen. Heute, zwölf Jahre später, war er ein wenig rundlicher geworden und sein Akzent nicht mehr so ausgeprägt, aber ansonsten war er unverändert – wie Minster Glass.
Die ungewöhnlichen Arbeitszeiten, die Dad verlangte, schienen Zac nie gestört zu haben. Es machte ihm weder etwas aus, sich die Nachmittage freizunehmen, wenn das Geschäft schleppend lief, noch vor einem knappen Liefertermin sieben Tage durchzuarbeiten. Zu anderen Zeiten kam und ging er, wie er Lust hatte, womit beide klarzukommen schienen; mich hätte es gestört, wenn ich sein Boss gewesen wäre. Und jetzt, wo Dad nicht da war, war ich wohl sein Boss. Dieser Gedanke irritierte mich. Was sollte ich Zac beibringen? Abgesehen von ein wenig Charme – nichts. Er könnte wenigstens so tun, als würde er sich freuen, mich zu sehen.
»Du hattest recht mit dem Schlaganfall, Zac«, sagte ich. »Es ist wirklich ernst.«
Ich berichtete ihm, dass Dad zu sich gekommen sei und die Ärztin, mit der ich heute gesprochen hatte – leider nicht der nette Dr. Bashir, sondern eine junge Frau mit kurzem, abstehendem Haar –, mir gesagt habe, dass die bisherigen Untersuchungen keinen Aufschluss darüber ergeben hätten, wie schlimm die Folgen des Schlaganfalls bleiben würden. Als ich sie fragte, wie schnell Dad sich wohl erholen würde, weigerte sie sich, darüber zu spekulieren, bestätigte aber, dass sein Erwachen ein gutes Zeichen sei.
Zac steckte die Hände in die Taschen seiner speckigen Lederhose und starrte zu Boden. Nach einer Weile sagte er: »Das ist schrecklich. Es tut mir leid, Fran.« Und dann fügte er zögernd hinzu: »Ich habe wirklich getan, was ich konnte. Seine Atmung kontrolliert und sofort den Notarzt verständigt. Die Rettungskräfte waren innerhalb weniger Minuten hier. Vielleicht hätte ich noch etwas anderes …« In seinem Gesicht spiegelte sich die pure Verzweiflung.
»Ich bin sicher, dass du alles richtig gemacht hast«, antwortete ich. »Und du warst bei ihm, das ist das Wichtigste. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er allein gewesen wäre.«
»Ja, da hast du sicher recht«, antwortete er düster. Einen Moment lang standen wir in Gedanken versunken da, dann sagte er: »Was hast du nun vor?«
»Vor?«, wiederholte ich.
»Ich meine, wie lange bleibst du hier? Du weißt ja, ich tue was ich kann, aber …« Er machte eine hilflose Handbewegung.
»Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich schätze, ich werde vorläufig erst mal bleiben. Wir wissen ja nicht, wie lange es dauert, bis es Dad wieder besser geht.« Wieder herrschte Schweigen. Dabei wurde mir bewusst, dass er mich ansah, mitleidig, aber auch forschend. Ich versuchte mir klarzumachen, dass es lange, sehr lange dauern konnte, bis Dad wieder arbeitsfähig war, wenn es überhaupt je wieder so weit kam. Ich verdrängte den Gedanken.
»Es gibt genug Arbeit, um das Geschäft über Wasser zu halten«, meinte Zac langsam. »Und ich könnte etwas Hilfe im Laden gut gebrauchen.«
Die Gedanken drehten sich in meinem Kopf, bis mir ganz schwindelig wurde. War es das, was Dads Krankheit für mich bedeutete? Hierzubleiben und meine Musik bis auf Weiteres aufzugeben?
»Was für Arbeit?«, fragte ich, um mir Zeit zu verschaffen.
»Diese hier zum Beispiel.« Er hob die rote Glasscheibe hoch, damit ich die Zeichenschablone darunter sehen konnte. »Ein Fenster für eine dieser Penthouse-Wohnungen am Themse-Ufer. Die Kundin wünscht einen Sonnenaufgang. Offenbar reicht ihr der echte nicht. Schau mal.« Er nahm eine Papierrolle vom Tisch und zeigte mir die Skizze, die er angefertigt hatte – die farbige Darstellung eines Sonnenaufgangs über einer Fantasielandschaft.
»Das ist sehr hübsch«, sagte ich. »Was sonst noch?«
Er beschrieb mir ein paar weitere Aufträge, die er zu bearbeiten hatte. Danach schaute ich mir die Reparaturaufträge an, die auf dem Regal aufgereiht waren: zerbrochene Lampenschirme, verstaubte Spiegel und Bilderrahmen mit gesprungener Zierleiste. An einer Wand lehnte ein hässlicher Paravent, dessen mittlerer Teil eingerissen war. Obwohl ich gar nicht die Absicht gehabt hatte, ertappte ich mich dabei, darüber nachzudenken, wie viel Arbeit die Reparatur wohl kosten würde. Ja, es waren einige Jahre vergangen, aber ich konnte sie übernehmen – wenn ich es denn wollte.
»Und dann gibt es noch eine ganze Reihe Aufträge für Fensterreparaturen in Privathäusern«, erklärte Zac.
»Was ist denn hiermit?« Ich ging zu Dads keltischem Entwurf, der immer noch unter dem Fenster lag. Auf einmal wollte ich mich gern nützlich machen. »Soll ich das fertigstellen?«
»Wenn du möchtest.« Zac sah mich überrascht an. »Aber keine Eile. Schließlich bist du gerade erst …«
»Ich würde es gern machen, sobald ich die Zeit dazu finde. Dann kann ich wenigstens etwas tun. Für Dad.«
»Gut.« Er zuckte mit den Schultern. »Wenn du magst, schaue ich mir mal den Papierkram an.«
»Danke. Ach, übrigens …«, mein Blick fiel auf die Anstecknadel, die ich neben der unfertigen Scheibe liegen lassen hatte, »weißt du zufällig etwas über diese Brosche? Ist sie Dad vielleicht runtergefallen?«
Zac nahm das Schmuckstück in die Hand, betrachtete es einen Moment lang und gab es mir kopfschüttelnd zurück. Ich drehte es herum, wunderte mich noch einmal über seine Herkunft und steckte es schließlich in die Tasche.
Er ging ins Büro und begann, Dads großes Auftragsbuch auf dem Schreibtisch durchzublättern. »Sieht so aus, als wäre dieses Bild der letzte Teil einer Bestellung für eine neue Kirche in Süd-London«, sagte er schließlich.
Eine Kirche. Der Brief des Pfarrers fiel mir wieder ein.
»Das erinnert mich an was!« Ich lief los, um das Schreiben von Reverend Quentin von der Ladentheke zu holen. Aber es lag nicht mehr dort, weder auf der Theke noch irgendwo auf dem Fußboden.
»Hast du zufällig einen weißen Briefumschlag gesehen?«, fragte ich Zac.
»Meinst du den hier?« Zac zog den Brief aus der Tasche seines Overalls. »Du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Ich habe ihn schon angerufen.«
»Wie bitte?« Ich wusste, dass mein Ärger völlig unangemessen war, besonders weil ich vor Kurzem noch befürchtet hatte, überhaupt in die Sache hineingezogen zu werden, aber irgendwie nervte mich Zacs eigenmächtige Art. »Was hat er denn gesagt?«
»Seine ›aufregende Entdeckung‹ hat er mit keiner Silbe erwähnt. Wollte bloß wissen, wie es deinem Vater geht. Anita aus dem Café hatte ihm erzählt, dass er im Krankenhaus liegt. Ich habe ihm vorgeschlagen, vorbeizukommen und ihm über den Stand der Arbeit an den Fenstern zu berichten. Am Montag um fünf bin ich mit ihm verabredet.«
»Reicht das Licht um diese Zeit denn noch aus, um gut zu sehen?«, fragte ich scharf. Vielleicht war es albern, aber ich fühlte mich übergangen. Schließlich war ich diejenige gewesen, die den Brief geöffnet hatte, es war mein Vater, mit dem der Absender befreundet war, und wenn ich Reverend Quentin selbst angerufen hätte, hätte ich ganz sicher herausgekriegt, worum es sich bei seiner geheimnisvollen Entdeckung handelte.
»Ja, es wird schon reichen.« Wir belauerten uns plötzlich wie zwei Preisboxer. Es war absurd. Ich wusste, dass Zac nur seinen Job machte; aber irgendein sturer Impuls in mir wollte unbedingt die Oberhand behalten.
»Ich fahre mit dir«, entschied ich und verließ die Werkstatt, ehe Zac widersprechen konnte.
Es war eine Zeit lang still, dann setzte das hässlich quietschende Geräusch des Glasschneidens ein. Ich hatte mich unmöglich benommen, und ich schämte mich dafür. Aber wenn ich heute zurückblicke, erkenne ich, dass ich viel zu niedergeschlagen und wegen Dad viel zu besorgt gewesen war, um vernünftig zu handeln.
Ich versuchte die Scharte auszuwetzen, indem ich mich nützlich machte, die Ladentür aufschloss und alle Lichter anschaltete. Auf dem Fußboden stapelten sich mehrere Kartons mit Glasscheiben, die unser Großhändler gebracht hatte. Ich schnitt den obersten auf. Zumindest heute würde bei Minster Glass alles sein wie immer. Ich würde den Platz meines Vaters hinter der Verkaufstheke einnehmen.
Während ich die farbigen Rechtecke seitlich in die dafür vorgesehenen Rillen der Regalfächer schob, damit man sie leichter durchsehen konnte – so wie früher die Vinylschallplatten –, kam Zac von Zeit zu Zeit vorbei, um irgendetwas zu holen. Er schien sich jedes Mal zu freuen, wenn er mich sah.
Als Nächstes packte ich einen Stapel kleiner verzierter Spiegel aus und hängte sie an die hintere Wand, während ich an meine Tuba oben in der Wohnung dachte. Seit meiner Ankunft hatte ich sie noch nicht aus ihrem Kasten genommen. Auch mit Jessica von der Konzertagentur, die meine Engagements buchte, hatte ich noch nicht gesprochen. Sie wusste nicht, was passiert war und wo sie mich erreichen konnte. Ich dachte an Dad, wie er in seinem Krankenbett lag, und wieder kroch diese dunkle Angst in mir hoch und drohte mich zu ersticken. Ich hatte wahnsinnige Angst um Dad, aber auch um mich. Mein Leben kreiste in einer Art Warteschleife – aber im Moment konnte ich nichts tun. Nichts außer warten und mich damit beschäftigen, Glas auszupacken.
Zac verschwand um die Mittagszeit; er murmelte etwas davon, dass er auf dem Weg zu einem Geschäftstermin bei Dad vorbeischauen wolle. Ich sah ihm nach, wie er über den Greycoat Square verschwand, und war froh, allein zu sein.
Der Nachmittag im Laden verlief ruhig. Ich überprüfte die Vorräte an Werkzeugen, die wir verkauften, und machte mir Notizen für Nachbestellungen. Danach suchte ich mir in der Werkstatt einen Platz, von dem aus ich sehen konnte, wenn jemand hereinkam. Ich steckte den Lötkolben ein und versuchte, einen Lampenschirm zu reparieren. Aber ich hatte so lange kein Blei mehr verlötet, dass ich erst an ein paar Reststücken üben musste, ehe ich mich an die Lampe wagte. Anschließend betrachtete ich mein Werk und kam zu dem Schluss, dass es gar nicht so schlecht geworden war. Ich stellte den fertigen Lampenschirm zur Seite. Dann nahm ich mir einen Spiegel mit zersplittertem Zierrand vor. Die Arbeit nahm meine ganze Aufmerksamkeit gefangen und beruhigte mich.
Nur wenige Kunden kamen an diesem Nachmittag in den Laden. Ein kleiner Junge mit seinem Vater, der seiner Mutter zum Geburtstag einen der kleinen Spiegel kaufte. Eine Frau mittleren Alters mit blassroten Haaren und Kreol-Ohrringen brauchte Glas für ein Projekt in einem Abendkurs. Sie zog jede einzelne Scheibe aus dem Regal, ehe sie sich für eine schlichte blaue entschied. Eine junge Frau mit Jogginghose, strähnigen schwarzen Haaren und dunklen Augen stand lange vor dem Schaufenster herum, betrachtete die Auslagen und kaute an ihren Fingernägeln. Als ich herausging, um mir im Café einen Cappuccino zu holen, lächelte sie scheu und lief davon. Dabei schaute sie sich ängstlich um. Wie ein streunender Hund, dachte ich plötzlich mitleidig, sicher ist sie es gewohnt, ständig davongejagt zu werden.
Am Abend fühlte ich mich plötzlich schrecklich einsam. Ich nahm mein Adressbuch aus der Handtasche und wählte die Nummer einer alten Freundin von der Musikhochschule, von der ich seit Jahren nichts gehört hatte. Ich erfuhr, dass sie weggezogen war, wohin konnte man mir nicht sagen. Als Nächstes rief ich einen Musiker-Kollegen in Süd-London an, danach eine Frau von der Konzertagentur, mit der ich locker befreundet war. Aber es war Samstagabend, und niemand war zu Hause. Niemand außer mir.
Während ich die zerfledderten Seiten durchblätterte, wurde mir klar, dass ich alte Freundschaften zu wenig gepflegt hatte. Es war kaum noch jemand übrig.
Unter ›P‹ stieß ich auf den Namen meiner alten Schulfreundin Jo Pryde. Rochester Mansions 11 lautete ihre Adresse, es war ihr Elternhaus. Aber ich hatte Jo ewig nicht gesehen, sie war sicher längst ausgezogen. Ich überlegte kurz, die Nummer trotzdem zu probieren, aber der Gedanke an ein mühsames Gespräch mit ihrem Vater oder ihrer Mutter hielt mich schließlich davon ab. Vielleicht war zu viel Zeit vergangen. Genauso wie bei allen anderen hatte ich mich auch bei ihr nicht mehr gemeldet, seit ich die Schule verlassen und mein unstetes Arbeitsleben begonnen hatte. Jetzt quälte mich deshalb ein schlechtes Gewissen. Doch damals war es mir wichtig gewesen, alles aufzugeben, alle Brücken abzubrechen und es auf eigene Faust zu versuchen.
Schließlich gab ich die Suche nach alten Freunden auf und ging stattdessen nach oben, um ein paar Sachen einzupacken, die ich Dad am nächsten Tag ins Krankenhaus mitnehmen würde.
Sein Schlafzimmer wirkte traurig und verlassen. Die goldene Anstecknadel mit dem Engel hatte ich auf seinen Nachttisch gelegt, gleich neben das Foto von mir. Es zeigte mich als Zwölfjährige, auf einem Walliser-Pony, während einem unserer seltenen Urlaube in der Nähe von Aberystwyth. Es war der einzige persönliche Gegenstand, den ich entdecken konnte. Nur an der Wand hing noch ein Bild, der gerahmte Druck eines Gemäldes von Alma Tadema, das eine unnatürlich blasse Badende in klassizistischer Umgebung zeigte. Das Wasser im Pool schimmerte märchenhaft blau, das Bild war handwerklich perfekt, aber ich hatte Alma Tademas Arbeiten schon immer kühl und emotionslos gefunden. Vielleicht war das der Grund, weshalb Dad das Bild gefiel. Denn auch er zeigte nur selten Gefühle. Und trotzdem wusste ich, dass er kein kalter Mensch war. Er versteckte seine Gefühle nur.
Es gab nirgends ein Foto von meiner Mutter, was mich schon gewundert hatte, als ich noch sehr klein gewesen war. Ich wusste schlicht nicht, wie sie aussah, und Dad sorgte dafür, dass es in der Wohnung nichts gab, was an sie erinnerte. Er sprach kaum von ihr und wich meinen Fragen beharrlich aus. Einmal beim Abendessen erwähnte ich eine Freundin aus der Grundschule, die an Heiligabend Geburtstag hatte. »Es ist so unfair«, sagte ich damals, »von manchen Leuten bekommt sie immer nur ein Geschenk.« Zu meinem Entsetzen sah ich, wie ein Anflug gequälter Traurigkeit über sein Gesicht huschte.
»Darüber hat sich deine Mutter auch beklagt«, murmelte er und legte Messer und Gabel aus der Hand. »Sie hatte auch an Weihnachten Geburtstag. Einmal hatte ich nur ein Geschenk für sie, und darüber hat sie sich schrecklich aufgeregt.« Wie ein Häufchen Elend starrte er auf das Essen, das ich ihm gekocht hatte. Und dann erhob er sich so langsam und bedächtig, als sei ich gar nicht da, kratzte die Reste auf seinem Teller zusammen, leerte sie in den Mülleimer und verließ das Zimmer. Ich saß allein am Tisch, und die Tränen liefen mir über die Wangen. Mir war klar, dass ich etwas Falsches gesagt hatte, verstand aber nicht, wieso.
Nur weil ich irgendwann an der Tür lauschte, erfuhr ich, wie meine Mutter gestorben war. In meinem ersten Jahr an der weiterführenden Schule hatten wir Besuch, was nur sehr selten vorkam. Es war Mrs. Webb, meine Klassenlehrerin. Sie war gekommen, um sich zu erkundigen, warum Dad sich geweigert hatte, mir die Erlaubnis zu einer einwöchigen Klassenfahrt in den Peak District zu unterschreiben. Vermutlich hatte er Angst, mich so lange wegzulassen. »Sie ist doch alles, was ich habe«, hörte ich ihn von meinem Versteck vor der Wohnzimmertür zu Mrs. Webb sagen und strahlte förmlich vor Freude über diesen Liebesbeweis. Natürlich würde ich zu Hause bleiben, wenn er nicht ohne mich sein konnte. Aber das, worüber sie als Nächstes sprachen, beunruhigte mich.
Mrs. Webb erkundigte sich nach meiner Mutter. »Ein Unfall. Frances war noch klein.« Dad sprach so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte. »Sie ist im Krankenhaus gestorben. Mit meiner Tochter habe ich nie darüber gesprochen. Es würde sie nur belasten.«
Dad gab nicht preis, wann, wie oder wo der Unfall geschehen war. Mrs. Webb überredete ihn schließlich dazu, die Einwilligung zur Klassenfahrt zu unterschreiben, und war im Übrigen sensibel genug, ihn nicht weiter zu bedrängen.
Meine Mutter. Ich sehnte mich danach, mehr über sie zu erfahren, wusste aber nicht, wie ich es anstellen sollte; aus Rücksicht auf Dad traute ich mich nicht, ihn anzusprechen.
Obwohl ich mich nicht an sie erinnern konnte, war mir ihre Abwesenheit immer äußerst schmerzlich bewusst. »Malt eine Karte zum Muttertag«, sagte die Lehrerin in der Grundschule zum Beispiel, ehe sie mein angespanntes Gesicht bemerkte und verlegen zu stottern begann, während die anderen Kinder mich neugierig anstarrten. »Äh … Vielleicht malst du stattdessen eine für deine G … Großmutter, Frances.«
Manchmal, wenn ich abends im Bett lag und gerade einschlafen wollte, versuchte ich mich an sie zu erinnern, an irgendwas von ihr, aber es gelang mir nicht. Hin und wieder erregte das Stoffmuster eines Kleids meine Aufmerksamkeit oder der Hauch eines bestimmten Parfums … aber nie konnte ich den Zipfel der Erinnerung einfangen, so schnell war er schon wieder verflogen.
Und als ich ungefähr zehn war, brachte ich den Mut auf, Dad zu fragen, wie meine Mutter ausgesehen hatte. »Wie du«, sagte er, und das gefiel mir. Aber er könne sich keine Fotos von ihr anschauen, fügte er hinzu, das mache ihn zu traurig. Damals fand ich mich damit ab. Ich kam nicht auf die Idee, dass ich in dieser Angelegenheit irgendwelche Rechte haben könnte. Erst als Teenager wurde ich zunehmend aufsässig und unzufrieden und redete mir ein, Dad zu hassen – denn ganz offensichtlich schien es ihn nicht zu interessieren, ob ich traurig war oder nicht!
Kurz darauf fand ich ein Album mit Fotos von mir, erst als Baby, dann als pausbäckiges, fröhliches Kleinkind. An manchen Stellen hatte offensichtlich jemand Fotos herausgerissen. Fotos meiner Mutter, so vermutete ich. Ich musste mich damit begnügen, nur Details von ihr zu sehen – ihre Arme, die mich umschlossen; ein elegantes Beinpaar, das sichtbar war, weil sie hinter mir stand, während ich meine ersten Schritte machte; wellige schwarze Haare, geschwungene Lippen, die über meinen Babylocken zu erkennen waren.
Einige Monate später war es dann endlich so weit – mir gelang der große Glücksgriff. Ich interessierte mich zunehmend für Dads Arbeit, beschäftigte mich mit Kunstgeschichte und las häufig in den vielen Büchern, die er in der Wohnung aufbewahrte. Einmal hievte ich einen besonders schweren Band über Edward Burne-Jones aus dem Regal und schlug ihn auf. Auf der Titelseite stand geschrieben:
Meinem eigenen geliebten Edward zum GeburtstagIn Liebe, Angie29. März 1963
Staunend blätterte ich weiter, spürte, wie kostbar dieser Beweis der Liebe zwischen meinen Eltern mir war, bis ich auf eine Serie von Engelsgemälden stieß. Dort steckte – zwischen einem Engelsbild mit dem Titel Glaube und einem anderen namens Hoffnung – ein kleines Schwarzweißfoto einer Frau. Diese Lippen, diese Haarpracht hätte ich überall erkannt.
Ich steckte das Foto zurück zwischen die Seiten, legte das Buch unter mein Bett und erfreute mich daran, es jede Nacht bei mir zu haben. Als ich zum ersten Mal auf Tournee ging, hatte ich das Buch zur Sicherheit in meinem Kleiderschrank versteckt; und nun, nachdem ich die Krankenhaustasche für Dad gepackt hatte, schaute ich nach, ob es noch da war. Das Buch lag tatsächlich noch immer an derselben Stelle. Ich zog es heraus, setzte mich aufs Bett und betrachtete das Foto.
Es war eine Studioaufnahme im Dreiviertelprofil. Das Licht fiel ihr schräg ins Gesicht. Ich vermutete, dass sie leicht geschminkt war, denn ihre Haut war einfach makellos. Aber auch sonst konnte niemand bestreiten, dass sie sehr hübsch war. Das dichte schwarze Haar war zu einer Ponyfrisur geschnitten, wie sie 1963 modisch gewesen war. Es war die Art Foto, wie man sie auf Theater- oder Konzertprogrammheften sah, und mir fiel plötzlich auf, dass ich eigentlich nie darüber nachgedacht hatte, was sie gemacht hatte, ehe sie Mutter geworden war. Für mich war sie immer und zuallererst meine Mutter gewesen, nie eine eigenständige Person mit einem eigenen Leben und einer eigenen Geschichte.
Wie kann ich die Einsamkeit in meiner Kindheit beschreiben? Mein Vater liebte mich, das erkannte ich an der Art und Weise, wie er sich um meine körperlichen Bedürfnisse kümmerte, wie er mich behütete. Später merkte ich es an der gründlichen Ausbildung, die er mir in der Werkstatt zuteilwerden ließ, und daran, wie er mir mehr und mehr Verantwortung übertrug, mich im Laden bedienen und auch eigene Entwürfe machen ließ, die er sorgfältig ausführte und den Kunden stolz präsentierte, obwohl er sie auch als seine eigenen hätte ausgeben können.
Einerseits vertraute ich ihm, bewunderte ihn. Aber ich konnte nie herausfinden, was an den Tagen in ihm vorging, an denen er verschlossen und in Depressionen versunken schien oder mich gereizt anfuhr. Ich lernte, keine Fragen zu stellen. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich einen Bruder oder eine Schwester gehabt hätte, mit denen ich die Last der Einsamkeit hätte teilen können, vielleicht sogar nur einen anderen Erwachsenen, der sich für mich interessierte. Aber Dad war selbst ein Einzelkind gewesen; seine Eltern waren schon vor meiner Geburt gestorben, und wenn es noch lebende Angehörige meiner Mutter gab, hatten wir den Kontakt zu ihnen verloren. Ich hatte also keine Großmutter, für die ich zum Muttertag ein Bild hätte malen können, malte stattdessen eins für Dad.
Ich kannte ihn als stolzen, würdevollen Mann, der immer sehr gepflegt gekleidet war. Unter seinem Arbeitsoverall trug er stets Hemd und Krawatte, und seine Lederschuhe waren immer frisch geputzt. Kein Wunder, dass er auch mit sechzig noch attraktiv für Frauen war. Seine tief liegenden Augen schienen in weite Ferne zu blicken, geheimnisvoll und unergründlich, und die leise, wohlklingende Stimme ließ auf unverbrauchte Leidenschaft schließen. Mit seiner körperlichen Präsenz – er war über eins achtzig groß – und seiner offenkundigen Überheblichkeit fiel er auf und wurde mit Respekt behandelt.
Trotzdem glaube ich, dass er nach meiner Mutter nie wieder eine andere Frau angeschaut hat. Mit größter Leidenschaft stürzte er sich in den Entwurf wunderbarster Glasbilder und strebte in der Ausführung immer die höchste Perfektion an. Diese Kunstfertigkeit war es, die mich und ihn verband. Wir konnten stundenlang über die Herkunft irgendwelcher Kirchenfenster reden; sein Erinnerungsvermögen war phänomenal. Darüber hinaus galt sein Interesse der klassischen Musik. Er war es, der darauf bestanden hatte, dass ich zuerst Klavier und danach ein Orchesterinstrument meiner Wahl spielen lernte. Als ich mich für ein Blechblasinstrument entschied, war er etwas überrascht, aber er bezahlte mir die Stunden und kam zu jedem meiner Konzerte in der Schule. Allerdings hielt er sich anschließend auch mit seiner Kritik nicht zurück, und ich wünschte mir manches Mal, er wäre nicht gekommen. Und was die eher persönlichen oder gefühlsmäßigen Seiten meiner Erziehung betraf – ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mir je gesagt hätte, er würde mich lieben.
Später war Dad unverhohlen eifersüchtig auf meine männlichen Freunde. Ich war sechzehn, als ein Hornspieler aus dem Schulorchester allen Mut zusammennahm und mich fragte, ob ich mit ihm ausginge. Ich war überrascht, dass jemand es gewagt hatte, meine Zurückhaltung zu durchbrechen, und sagte Ja. Wir gingen ein- oder zweimal ins Kino und einmal in ein Konzert, aber die Beziehung bröckelte, als Dad darauf bestand, dass Alan mich zu Hause abholte, damit er ihn kennenlernen könne. Dad war unwirsch und Alan mächtig eingeschüchtert, der arme Junge verlor in meinen Augen, und ich beendete die Beziehung kurze Zeit später. Danach weigerte ich mich, noch mal jemanden nach Hause mitzubringen, und gewöhnte mir stattdessen an, heimliche Affären zu haben – heimlich, aber köstlich.
Ich will meine Probleme nicht übertreiben, denn die meiste Zeit kamen Dad und ich gut miteinander zurecht. Was führte also dazu, dass ich mich schließlich abseilte und nach einem Leben suchte, das mit ihm nichts zu tun hatte? Die Verhaltensmuster, die in der Kindheit geprägt werden, die Hochs und Tiefs einer Beziehung, sind nicht immer leicht zu beschreiben, aber ich will es versuchen.
Ich schätze, mir wurden die zunehmende Sprachlosigkeit und die Heimlichkeiten zwischen uns immer stärker bewusst. Als ich älter wurde und neue Erfahrungen machte, musste ich so viel vor ihm verbergen – wie auch er immer so
viel vor mir verborgen hatte. Außerdem nahm ich es ihm übel, dass er mein Älterwerden als Unglück zu empfinden schien, nahm es ihm übel, dass er sich beharrlich weigerte, Veränderungen zu begrüßen. Selbst wenn wir uns nicht schlimm gestritten hatten, als ich achtzehn wurde, war mir klar, dass die Trennung unvermeidlich war. Damals musste ich einfach fortgehen, genau so, wie ich jetzt zurückkommen musste.
3. KAPITEL
Welcher Engel hinterlässt in diesem endlos gefrorenen Schnee nachts seine Spur?
Emily Brontë, The Visionary
Am nächsten Morgen weckten mich wie an jedem Sonntag während meiner Kindheit die Kirchenglocken. Und auch auf dem Weg zum Krankenhaus rief die einzelne klare Glocke von St. Martin’s beharrlich zum Gottesdienst.
Ich fand meinen Vater zwischen mehrere Kissen gebettet halb aufrecht sitzend vor. Traurig schaute er aus dem Fenster. Eine Gesichtshälfte hing schlaff herab, es war fürchterlich anzusehen. Aber wenigstens war er wach, und nachdem es mir gelungen war, seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, war ich mir sicher, dass seine Augen aufleuchteten.
Ich packte sein Waschzeug aus, saubere Schlafanzüge und einen Bademantel. Ich hatte sogar einen Abenteuerroman seines Lieblingsautors mitgebracht, weil ich dachte, ich könne ihm vielleicht daraus vorlesen, sobald es ihm besser ging. Wie lange mochte das noch dauern? Nachdenklich legte ich das Buch neben die Freesien auf den Nachttisch.
Ganz unten in der Tasche stieß ich mit der Hand an ein Päckchen aus Papiertüchern. Ich zögerte, dann packte ich die blaugoldene Brosche aus und zeigte sie ihm.
»Gehört sie dir?«, fragte ich.
Seine Augen signalisierten mir ein klares Ja – aber es lag unübersehbar Unruhe darin.
»Ist sie etwas ganz Besonderes?«
Anstelle einer Antwort drang ein qualvoller Laut aus seiner Kehle.
»Du musst nicht sprechen«, sagte ich schnell. »Ich nehme sie wieder mit nach Hause, damit sie hier nicht gestohlen wird. Ich passe gut auf sie auf.«
Verzweifelt suchte ich nach einem neuen Gesprächsthema. Der Mann im Nachbarbett schrie plötzlich im Schlaf, wie ein Kind, das einen bösen Traum hatte.
»Im Geschäft läuft alles bestens«, begann ich schließlich und bemühte mich, meine falsche Fröhlichkeit zu zügeln, »ich kümmere mich darum, das Fenster für dich fertigzustellen.« Das sollte meine Aufgabe für den Nachmittag sein. »Und Zac arbeitet gerade an einem wunderschönen Sonnenaufgang. Gestern habe ich ein Stück Glas verkauft.« Ich redete immer weiter, erzählte ihm alles, was mir gerade einfiel. Von der rothaarigen Frau, die im Laden so lange alles durchwühlt hatte, dem Lampenschirm, den ich repariert hatte, von Anita aus dem Café, die sich nach ihm erkundigt hatte.
Irgendwann fielen ihm die Augen zu. Ich wartete ein paar Minuten, aber er war in tiefen Schlaf gesunken. Ich verstaute die Brosche wieder sicher in meiner Handtasche, dann beugte ich mich vor und drückte meine Lippen an seine Wange. Wie viele Jahre waren vergangen, seit ich das zum letzten Mal getan hatte?
Ich wollte mich noch nach seinen Fortschritten erkundigen, aber weit und breit war kein Arzt zu sehen. Auf dem Weg nach draußen fragte ich im Schwesternzimmer nach; dort riet man mir, morgens anzurufen, wenn Dr. Bashir Dienst hatte.
Erst als ich das Krankenhaus verließ, fiel mir ein, dass ich Dad gar nichts von Reverend Quentins geheimnisvoller Entdeckung und unserem geplanten Besuch in St. Martin’s erzählt hatte.
Nach einem kurzen Mittagsimbiss schaute ich mir die Zeichnungen für das keltische Fenster an und überprüfte, welche Maße es verlangte. Anschließend maß ich die Glasscheibe, die Dad dafür vorgesehen hatte, und nahm ein paar kleinere Anpassungen vor, ehe ich alles miteinander verlötete und verkittete. Das Ergebnis gefiel mir gut, offenbar hatte ich nichts verlernt. Ob das auch für mein Tuba-Spiel galt, stand auf einem ganz anderen Blatt. Kurz entschlossen ging ich nach oben und nahm sie aus dem Kasten. Ich zerlegte sie in ihre Einzelteile, reinigte sie gründlich, fettete die Ventile ein und spielte ein paar Übungsstücke.
Am späten Nachmittag unternahm ich einen Spaziergang. Ich ging am Innenministerium vorbei bis zum Parliament Square. Diesen Weg waren Dad und ich früher oft gegangen, und er hatte mir erzählt, wie es früher in dieser Gegend ausgesehen hatte. »Da, wo wir heute wohnen, waren Obstwiesen«, hatte er zum Beispiel gesagt. Oder: »In viktorianischer Zeit stand das Royal Aquarium an der Stelle, wo sich heute das Hotel befindet.«
Heute ging ich auf dem Rückweg an der Kirche St. Martin’s vorbei. Offenbar fand dort gerade die Abendmesse statt. Mit neuem Interesse betrachtete ich die Fassade. In den Schlussstein über dem Hauptportal war das Jahr der Grundsteinlegung eingemeißelt. 1851. Wann genau mochte Minster Glass die Fenster gefertigt haben? Wer wohl der Künstler gewesen war? Nachdenklich setzte ich meinen einsamen Nachhauseweg fort. Ich musste es herausfinden.