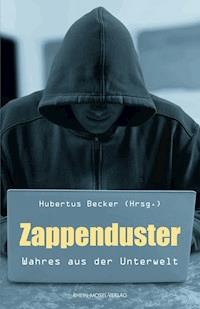Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dem vorliegenden Buch erzählt der Autor seine ersten zwanzig Lebensjahre, beginnend mit seiner Kindheit auf dem Hunsrück, seiner Schulzeit am Rhein und seinem Dienst bei der Bundeswehr in Bayern. Er beschreibt das Leben in einem Hunsrückdorf in den 1950er und 60er Jahren und lässt den Leser teilhaben, wie er sich nach und nach von der Familie, dem Dorf und der Heimat emanzipiert. Sein ungekünstelter Schreibstil, oft selbstironisch und immer facettenreich, garantiert eine unterhaltsame Lektüre. Wer die beschriebenen Ereignisse überdenkt, findet die Ursachen, die dazu führten, dass der Autor mit dem Gesetz in Konflikt geriet und mehrfach zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde. Unter diesem Gesichtspunkt sind die vorliegenden Jugenderinnerungen mehr als die Biographie eines Zeitgenossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2015 E-Book-Ausgabe Rhein-Mosel-Verlag Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158www.rhein-mosel-verlag.de Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-832-6 Ausstattung: Marina Follmann Lektorat: Gabriele Korn-Steinmetz Titelabbildung: Sabershausen, 1950 Gemälde von Anton Wendling Die Fotos im Buch stammen aus dem Privatarchiv des Autors.
Hubertus Becker
Das Blaue vom Hunsrück
Erinnerungen an die 1950er und 60er Jahre auf dem Hunsrück
RHEIN-MOSEL-VERLAG
***
Die Erinnerung ist ein Hund, der sich hinlegt wo er will.
Cees Nooteboom
Ich hatte das Renommee eines Spitzbuben, und ich glaube, nicht zu Unrecht, aber es war doch manchmal verletzend für mich, immer daran erinnert zu werden. Ich hätte gern verzärtelt werden mögen; als ich aber einsah, dass es unmöglich war, dass man mir diese Aufmerksamkeit schenke, wurde ich ein Flegel und verlegte mich darauf, diejenigen zu ärgern, welche den Vorzug genossen, brave, geliebte Kinder zu sein.
Robert Walser
Es gibt in den Erinnerungen eines jeden Menschen Dinge, die er nicht allen Leuten aufdeckt, sondern höchstens sich selbst, und auch das nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Endlich aber gibt es auch Dinge, die der Mensch sich selbst aufzudecken scheut …
Fjodor Dostojewski
Trotzdem …
Albert Camus
Die ähne sahn suu, die annere sahn suu.
Hunsrücker Redensart
Für alle die,
die immer noch Widerstand leisten
und für die,
die den Wert des kleinen Glücks schätzen!
Im freundlichen Gedenken an
meine Eltern Anna Margarethe Coenen und Karl-Heinz Becker,
meine Großeltern Helene Frentz und Peter Coenen,
sowie Mathilde Scholz und Heinrich Becker,
Hermann Etzkorn,
Ernst Weiler,
die Rötsche Goti,
Josef und Hanna Müller,
von all denen ich das ein oder andere geschenkt bekommen habe …
***
Prolog
»Warum gehen Sie auf den Berg?« – »Weil er da ist«, war Reinhold Messners ebenso lapidare wie tiefsinnige Antwort. Ähnlich mag man der Frage begegnen, warum einer seine Lebensgeschichte aufschreibe: weil ich sie erlebt habe. Wer auf den Berg geht, wer seine Geschichte erzählt, der muss sich nicht legitimieren. Jeder Mensch hat seinen Berg zu besteigen, und jeder Mensch hat seine Geschichte zu erzählen, und je nachdem, wie hoch er hinaufsteigt oder wie tief er eindringt, wird sogar eine spannende Geschichte daraus.
Die hier aufgezeichneten Erinnerungen an meine Kindheit in einem Dorf auf dem Hunsrück während der Nachkriegsjahre schrieb ich im Gefängnis. Schreiben ist eine Tätigkeit, die der Einzelzelle angemessen ist, denn die Gefängniszelle ist der klassische Ort von Feder und Papier. Und so beschloss ich dort, die Geschichte aufzuschreiben, die mir am nächsten liegt, die ich aus dem Stehgreif erzählen kann, ohne viel recherchieren zu müssen. Denn im Gefängnis ist die einzige Datenbank, auf die man zurückgreifen kann, das eigene Gedächtnis.
Wer von seiner Kindheit berichtet, von seinen Großeltern und seinen Spielsachen, von der ersten Liebe und ihrem Scheitern, der findet bei Google keine Hilfe.
Ich berichte aus heutiger Sicht, was ich seinerzeit subjektiv wahrgenommen habe, wie mir die Menschen und die Ereignisse vorgekommen sind. Für den Leser dieser Erinnerungen soll unter dem Strich die gute Unterhaltung stehen. Wenn wir uns nebenbei dann noch vor dem einen oder anderen Menschen verneigen, der lange schon verstorben ist, und wenn beim Lesen das Bild einer Zeit aufscheint, die inzwischen Gegenstand von Historikern geworden ist, dann hat sich die Mühe gelohnt.
Hubertus Becker, am 01.05.2015
Alles fängt mit einem Zufall an
Kapitel 1
Einem Stammbaum ist zu entnehmen, dass seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges in Münstermaifeld (Eifel) eine von der Pfarrei dokumentierte Familie Becker lebte. Die Beckers, deren Namen und Gene ich trage, haben offenbar über mehrere Generationen auf dem Maifeld gelebt.
Mein Großvater Heinrich Becker, der um das Jahr 1880 geboren wurde, ging in Münstermaifeld zur Schule. Den Krieg von 1914–1918 hatte er überlebt, wahrscheinlich musste er als Lehrer nicht Soldat werden, aber genau weiß das keiner mehr. Wie wir so vieles nicht wissen, das uns zu Lebzeiten der Vorfahren nicht oder nur am Rande interessiert hat. Nachdem er seine Prüfung als Lehrer bestanden hatte, unterrichtete er zunächst an der Volksschule in Fernthal im Westerwald. Nach dem Ende des Krieges wurde er nach Simmern im Hunsrück versetzt, wo er seine Frau Mathilde kennenlernte.
Mathilde Scholz war die Tochter eines Försters, ein mürrisch dreinschauendes Mädchen, wie ich dem Foto von 1910 ersehe, für welches die Familie Scholz einem Fotografen posiert hat. Die Scholze kamen ursprünglich aus Oberschlesien, aus der Gegend um Oppeln. Als preußischer Staatsbeamter war mein Urgroßvater erst nach Brandenburg und dann ins Rheinland versetzt worden, wo er die Försterei von Külz bei Simmern übernahm. Der Forstberuf hatte in der Familie Tradition, denn mein Urgroßvater war schon der dritte Förster mit Namen Scholz. Über die Familie Scholz aus Külz weiß ich, dass sie acht Kinder hatte. Von der Frau des Försters, einer meiner Urgroßmütter, ist außer dem besagten Foto nichts überliefert. Lediglich Albert, einer ihrer Söhne, der Bruder meiner Großmutter und Onkel meines Vaters, hat bleibende Spuren hinterlassen, die wir später noch aufnehmen werden. Im Sommer 1917, kurz nachdem die USA beschlossen hatten, in den ersten Weltkrieg einzugreifen, muss die schöne Mathilde Scholz den Lehrer Heinrich Becker wohl verführt haben. Als katholisches Mädchen habe sie ihren Mann aber zuvor geheiratet, versicherte mir die Oma einmal.
Am 2. Mai 1918, noch zu Zeiten Kaiser Wilhelms, kam ihr erstes Kind Karl-Heinz zur Welt. In den Jahren danach folgten noch drei Schwestern und ein Bruder. Karl-Heinz Becker, mein Vater, war also das älteste von fünf Kindern eines Lehrers und einer Försterstochter. Die Familie lebte in der Gartenstraße, wo sie ein Haus gekauft hatten. Die Gartenstraße lag damals am äußersten Stadtrand von Simmern, eine kleine Sackgasse parallel zum Simmerbach. Es gibt sie zwar noch heute, die Gartenstraße, aber durch den Bau des Kreiskrankenhauses ist sie längst in die Stadt integriert. Auf die Kinder, allen voran auf meinen Vater, übte das Forsthaus in Külz große Anziehungskraft aus. Früh hatte er sich entschlossen, es seinem Großvater gleichzutun: auch er wollte Förster werden. Nachdem er bis zur vierten Klasse die Volksschule bei seinem strengen Vater besucht hatte, wechselte er nach Mainz auf ein Internat, von wo aus er aufs Gymnasium ging. Mir ist nicht bekannt, ob man damals die Mittlere Reife nicht auch in Simmern hätte erwerben können, und warum die Familie die kostspieligere Variante gewählt hatte. Jedenfalls lernten die Kinder des Schullehrers alle, was man in ihren Kreisen einen anständigen Beruf nannte.
Nachdem Karl-Heinz das »Einjährige« am Gymnasium in Mainz bestanden hatte, fing er 1935 beim Oberförster Tillmann in Kastellaun eine Forstlehre an. Anschließend rief ihn der Nazi-Staat zum Arbeitsdienst[1] nach Kassel, dann zur Wehrmacht, und kaum dass er seine Grundausbildung hinter sich hatte, benötigte man ihn zur »Verteidigung des Vaterlandes«.
Nach dem Überfall auf Polen, nachdem sie in Frankreich einmarschiert waren, als er sich längst damit abgefunden hatte, den Befehlen der Nazis zu folgen und in ihrem Auftrag Menschen zu töten, befand sich mein Vater ab 1941 in Lappland, wo er am Belagerungsring um Leningrad mitwirkte. Deutsche und finnische Soldaten waren zunächst Verbündete, der gemeinsame Feind war »der Russe«, der sich im sogenannten Winterkrieg 1939–40 finnische Siedlungsgebiete einverleibt hatte. Der Krieg am Polarkreis war ein Stellungskrieg. Fotos zeigen meinen Vater und seine Kameraden vor bunkerfesten Unterständen in weißen Anzügen, die ihnen im Schnee zur Tarnung dienten. Große Verluste unter deutschen Soldaten gab es an der Nordfront nicht. Der Unteroffizier Becker wurde als Jäger in die Wälder geschickt, wo er Rehe und Wildschweine für die Kompanieküche erlegte. Mit dem Töten von Menschen hatte er also zunächst noch nicht viel zu tun. Gestorben wurde derweil in Leningrad[2], wo durch die Belagerung der Deutschen am Ende mehr als eine Million Menschen verhungerten. Ob das Ausmaß der Blockade meinem Vater und seinen Kameraden bewusst war, kann ich nicht sagen. Wenn er vom Krieg in Finnland erzählte, dann waren es Geschichten von der Jagd, zuweilen von ereignislosen Spähtrupps, gerne gekrönt von einem Abend in der Sauna; wie sie mit Handgranaten Löcher ins Eis sprengten, wie sie mit den Russen einen stillschweigenden Nichtangriffspakt vereinbart hatten, wo jeder den Rückzug antrat, sobald er den anderen erblickte, wo also wenig geschossen wurde. Er war damals 24 Jahre alt, hatte vor dem Krieg einen Teil der Forstlehre durchlaufen, und hätte er damals geahnt, dass er erst zehn Jahre später mit 48 Kilo Körpergewicht aus einem jugoslawischen Kriegsgefangenenlager entlassen werden sollte, vielleicht hätte ihm das zu denken gegeben. Andererseits, die Charakterchemie der Beckers aus Simmern brachte keine Widerstandskämpfer hervor. Mein Vater war zum Gehorsam erzogen worden, zum Soldaten, zum Beamten. Seine Schwester Mathilde hatte zu dieser Zeit gerade ihre Prüfung als Lehrerin bestanden, und ihre erste Stelle war die Volksschule in Frimmersdorf bei Neuss.
Anna Margarethe Coenen, meine Mutter, entstammte einer Bauernfamilie aus Neurath, dem Nachbarort von Frimmersdorf. Am 18. März 1920 geboren, war sie im gleichen Alter wie Mathilde. Die Eltern meiner Mutter stammten aus der Gegend des Niederrheins: die Familie der Helene Frentz aus Titz, die des Peter Coenen aus Jackerath. Sie heirateten nach dem ersten Krieg, bekam neben Margarethe noch ein Kind, welches aber wenige Wochen nach der Geburt starb. Auch von der Familie Frentz existiert noch ein Bild aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, auf dem meine Oma Helene als junges Mädchen zu sehen ist. Mein Opa hatte offenbar Geschmack.
Als einziges Kind der Coenens wuchs meine Mutter auf dem Bauernhof unter Mägden, Knechten und Tieren auf. Sie dürfte verwöhnt worden sein. Die Coenens hatten ein Dutzend Holsteiner Kühe, die tagsüber auf der Weide grasten und die abends zum Melken auf den Hof getrieben wurden. Auf Bauernhöfen war es damals üblich, dass Kinder mithelfen mussten, und so hatte auch meine Mutter schon früh ihre Pflichten. Sie fütterte Gänse und Hühner, füllte dem Hund den Napf, und wenn ihre Mutter in der Küche etwas benötigte, dann wurde das Mädchen entweder in den Garten oder zum Kaufladen geschickt. Täglich musste sie den Mägden helfen, die Kühe zu melken. Dennoch besuchte meine Mutter die Schule bis zur Mittleren Reife, vermutlich in der Kreisstadt Grevenbroich. Danach blieb sie daheim, denn ihre Eltern hatten vorgesehen, dass ihr einziges Kind einmal den Hof übernehmen sollte, vorzugsweise mit einem Bauern als Ehemann. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Der Krieg warf die Pläne der Coenens über den Haufen.
Die junge Lehrerin aus Frimmersdorf suchte nach einem Bauernhof, wo sie Eier, Speck und Milch beziehen konnte, und da sie die Tochter schon kennengelernt hatte, lag es nahe, dass sie eines Tages auf dem Hof der Coenens vorsprach. Der Weg von Frimmersdorf nach Neurath war nicht weit. Die gleichaltrigen Frauen verbanden gemeinsame Interessen: Beide suchten sie einen Mann, beide jubelten sie dem Führer zu, beide schwärmten sie für die Schlagersänger, die das Volk beschwichtigten, Lale Andersen und Hans Albers etwa. Wahrscheinlich bekamen auch sie eine Gänsehaut, wenn sie »Lili Marleen« hörten. Die Freundschaft zwischen den jungen Frauen festigte sich. Auf diese Weise kam der Kontakt zwischen den Familien Becker und Coenen zustande. Mathilde erzählte Margrit von ihrem Bruder, der am Polarkreis stationiert war. Und da Mathilde mit Karl-Heinz in Finnland in regem Briefkontakt stand, und weil zu der Zeit die meisten heiratsfähigen Männer im Krieg waren, schlug Mathilde ihrer Freundin Margrit vor, dem Bruder an der Front einfach einen Brief zu schreiben.
So lernten sich meine Eltern 1942 mitten im Krieg kennen. Margrit schickte zunächst einen Brief mit Bild. Heinz antwortete mit einem Foto in Uniform. Dann kam ein Paket mit Wurst, Speck und Kerzen an der Front an, und Heinz bedankte sich mit lieben Briefen und einer Auerhahnfeder. Margrit strickte ihm daraufhin einen Schal. Offenbar war mein Vater ein Charmeur, denn es gelang ihm recht bald, das Herz der Neurather Bauerntochter zu erobern.
Im Jahr darauf erhielt er zwei Wochen Fronturlaub. Die Briefverliebten lernten sich persönlich kennen. Sie erwogen, zu heiraten, aber erst sollte dieser »Scheißkrieg« noch gewonnen werden, was sich bei der Zähigkeit der Russen als zunehmend schwierig erwies. Karl-Heinz musste zurück an die Front nach Karelien. Per Feldpost hielt Margrit ihm die Treue.
1944 brach die Nordfront ein und die Finnen wechselten die Seite. Die Deutschen, die dort gekämpft hatten, wurden nach und nach auf Schiffen zurück ins Reich geholt. Sie hinterließen verbrannte Erde, sie sprengten Brücken, zerstörten ganze Städte (wie etwa Rovaniemi[3]). Dass dabei mehrere hundert finnische Mädchen, die sich in deutsche Soldaten verliebt hatten und sich als blinde Passagiere auf die Evakuierungsschiffe gemogelt hatten, erst auf der Ostsee entdeckt und auf Befehl der Kapitäne über Bord geworfen worden waren, hatte mein Vater nicht mitbekommen. Jedenfalls behauptete er das …
Mir hingegen ließ dieses kleine Detail des großen Wahnsinns keine Ruhe. Wie hatte man sich das vorzustellen: da werden hunderte von jungen Frauen auf hoher See ins kalte Meer geworfen, verzweifelt schreiend, um ihr Leben flehend, und ihre deutschen Liebhaber vieler polarer Nächte bleiben untätig? Was muss mit den Herzen der Männer zuvor geschehen sein, dass sie bei solchen Verbrechen nicht aufbegehrten?
Wie die meisten Soldaten, die traumatisiert aus dem Krieg kamen, sprach mein Vater selten und wenig über diese Jahre. Und wenn er davon sprach oder schrieb, dann erzählte er von der Jagd auf Rehböcke in Frankreich, auf Wildschweine in Polen und auf Birkwild in Karelien. Menschen scheinen ihm während des ganzen Krieges keine vor die Flinte gekommen zu sein. Und ob er in Frankreich, Polen oder Finnland während der relativ friedlichen Perioden der Besatzung ein Liebchen hatte, auch darüber schwieg er sich aus. Lediglich in Frankreich scheint er sich mit einer Mademoiselle eingelassen zu haben, aber auch da beließ er es bei Andeutungen. Nach einem weiteren Heimaturlaub wurde er nach Jugoslawien beordert. Und falls er es bis dahin wirklich noch nicht begriffen hatte, auf dem Balkan lernte er, was Krieg bedeutete: Partisanenüberfälle, Heckenschützen, Erschießungen von Zivilisten, Vergewaltigungen, Zerstörung ganzer Dörfer. Gegen Kriegsende (die deutschen Soldaten waren längst auf dem Rückzug und versuchten, sich auf Reichsgebiet durchzuschlagen) wurden er und der versprengte Rest seiner Einheit in Bosnien geschnappt. Mit erhobenen Händen – der Waffen hatten sie sich zuvor entledigt – betraten sie ein Dorf und ergaben sich den Bauern.
Aus dieser Zeit datiert eine Begebenheit, welche die Rolle des Zufalls im Krieg verdeutlicht: Während ihres Rückzuges versteckten sich die Deutschen tagsüber im Wald. Nachts marschierten sie, immer auf der Hut, keinen Partisanen zu begegnen. Eines Tages – die Männer litten an der Ruhr – saß mein Vater in einem Gehölz und entleerte den infizierten Darm. Die Maschinenpistole hatte er umhängen. Da näherte sich ein Trupp Partisanen, die den Wald nach versprengten deutschen Soldaten absuchten. Mein Vater richtete die Waffe auf einen Mann, der keine zehn Meter an ihm vorbeiging. Doch der sah ihn nicht. Hätte er ihn entdeckt, so versicherte mir mein Vater später, er hätte ihn erschossen. Aber der Mann hatte ihn nicht gesehen und so, ohne es je erfahren zu haben, sein eigenes Leben (und wahrscheinlich das meines Vaters) gerettet.
Wegen seiner Teilnahme an Erschießungskommandos kam mein Vater kurzfristig in ein Kriegsverbrecherlager, konnte sich dort aber mit der Hilfe eines befreundeten Dolmetschers herausreden. Die bewaffnete tour d‘europe endete für den Feldwebel Karl-Heinz Becker in einem Lager in der Nähe von Banja Luka, wo er als Kriegsgefangener registriert wurde. Was folgte, waren vier Jahre Zwangsarbeit in Kohlegruben, Hunger und Erniedrigung. Jahrelang wusste daheim niemand, wo Karl-Heinz abgeblieben war, ob er überhaupt noch lebte, wenn ja, wie es ihm erging. Erst 1947 erhielten seine Eltern und seine Verlobte ein Lebenszeichen.
Als er im Herbst 1949 aus Jugoslawien heimkehrte, wog mein Vater noch 48 Kilo. Er war 31 Jahre alt, und aus dem größten Teil des Deutschen Reiches war die Bundesrepublik Deutschland geworden. Er kam nach Simmern, wo alle Mitglieder der Familie den Krieg überlebt hatten, insbesondere sein kleiner Bruder Hansi, der, Jahrgang 1926, noch zum Kriegsdienst eingezogen worden war. Dann fuhr er weiter nach Neurath zu seinem Liebchen. Die Coenens fütterten ihn mit allem, was ein Bauernhof an Kohlehydraten, Eiweiß und Fett produzierte. An seinem 32. Geburtstag wog Karl-Heinz wieder gesunde 75 Kilogramm.
Kapitel 2
Am 31. August 1950 heirateten meine Eltern in der katholischen Pfarrkirche in Neurath. Es ist davon auszugehen, dass sich die Coenens nicht knauserig zeigten, an dem Tag, als sie ihre einzige Tochter einem angehenden Beamten anvertrauten. Die Beckers aus Simmern waren vollständig angereist, denn für sie war es die erste Hochzeit eines ihrer Kinder. Das Fest soll ausgelassen gewesen sein, wenngleich ich mir Derartiges bei den Simmerner Großeltern nicht recht vorstellen kann. Denn sowohl der Lehrer Heinrich Becker als auch seine Frau Mathilde waren von den beiden Kriegen, die ihr Leben überschattet hatten, stark traumatisiert. Nichtsdestotrotz, am Hochzeitstag soll es auf dem Hof der Coenens fröhlich zugegangen sein.
Unterdessen hatte mein Vater seine Ausbildung zum Förster wieder aufgenommen. An die Lehre beim Oberförster Tillmann anknüpfend, besuchte er die Forstschule in Hachenburg im Westerwald. Im Frühjahr 1951 legte er die Forstprüfung ab und fortan durfte er sich Revierförster nennen.
Sein Schwiegervater Peter Coenen kaufte dem jungen Ehepaar ein Motorrad, eine 150er Hecker[4], wenn ich recht informiert bin. Meine Mutter war damals schwanger und blieb zunächst bei ihren Eltern in Neurath. So kam es, dass ich im Krankenhaus zu Grevenbroich geboren wurde: am 31. Mai 1951, dem fünften Tag der fünften Woche des fünften Monats des Jahres, einem Donnerstagmorgen, auf den Tag neun Monate nach der Hochzeit, wie meine Mutter stets betonte. Traditionell nannten Förster ihren ersten Sohn Hubertus, nach dem mittelalterlichen Heiligen, der zuerst Einsiedler und Jäger und später Bischof von Lüttich gewesen sein soll. Seither wird Hubertus als der Schutzpatron der Jäger verehrt.
Vaters erste Forststelle hieß Kalenborn, ein Dorf im Westerwald, oberhalb von Linz am Rhein. Gegen Ende des Jahres 1951 (in Paris hatte Alain Bernardin Anfang des Jahres das Crazy Horse[5] eröffnet und J. D. Salinger schrieb gerade »Der Fänger im Roggen«[6]) richtete sich unsere kleine Familie dort in einer Mietwohnung ein. Das bedeutete für die junge Mutter Improvisation, denn ich war ihr erstes Kind, und das meiste, was sie bislang auf dem Coenenshof gelernt hatte, half ihr jetzt nicht weiter. Ebenso erging es meinem Soldatenvater, der ja, rechnet man den Arbeits- und den Wehrdienst mit ein, zwölf Jahre für den Staat unterwegs gewesen war. Auch er war völlig unerfahren, was die neuen Rollen als Ehemann und Erzieher anging. Es war absehbar, dass, sollte es zu Krisen innerhalb der Familie kommen, meine Eltern überfordert wären. Ich betone das an dieser frühen Stelle, denn die Orientierungslosigkeit, die sich durch ihr ganzes Leben ziehen sollte, und von der auch meine Brüder und ich nicht verschont blieben, wird später noch sichtbar. Die meinen Eltern durch den Krieg geraubte Jugend, die Demütigung dieser ganzen Generation, die nichts hatte, was sie stolz hätte vorzeigen können, die fehlenden Gelegenheiten, sich niveauvoll zu bilden, sich als autonome Subjekte der eigenen Lebensplanung zu erleben, sich als kritische Bürger in den gesellschaftlichen Prozess einzubringen, all dies begünstigte es, dass sie erneut den Fehler begingen, blauäugig der Staatsmaschinerie zu vertrauen, der sie gerade erst entkommen waren und die sie fast vernichtet hatte. Naiv und einfältig wie sie waren, wählten sie die Partei, in der sich viele der ehemaligen Nazis versteckt hatten und die jetzt vorgaben, geläuterte Christen zu sein. Ohne die historische Zäsur der Niederlage zur Neuorientierung zu nutzen, reihten meine Eltern sich ein in die Käuferschlange vor dem Kaufhof, in die Konvois auf der Autobahn, in die Prozession der Gläubigen auf dem Weg zur Heiligen Kommunion. Auf einer Demo hingegen hat man sie nie gesehen. Zivilcourage hatte ihnen bei den Nazis keiner beigebracht. Unvorstellbar: mein Vater mit zornig erhobener Faust auf der Barrikade! Wir, die Kinder der Unmündigen, kultivierten die Traumatisierungen der Verführten in sublimierter Form weiter. Der Krieg war noch lange nicht zu Ende. Und er ist es gewissermaßen bis heute nicht …
In Kalenborn wohnten wir zur Miete bei einer Frau Stoffel, eine Witwe, die sowohl ihren Mann als auch ihren Sohn im Krieg verloren hatte. Abrufbare Erinnerungen an diese Zeit meiner frühesten Kindheit habe ich natürlich nicht. Wenn ich heute noch ein Bild des Hauses in Kalenborn vor mir sehe, dann muss es von einem Besuch in späteren Jahren stammen.
Alle paar Tage hatte der Revierförster Becker auf dem Forstamt in Linz zu tun. Dazu fuhr er auf seiner Hecker ins Rheintal hinunter, ohne Helm, wie es damals üblich war. Die Uniform eines Försters bestand aus Schaftstiefeln, Breeches[7], und dem Uniformrock mit den Schulterklappen, auf denen je nach Dienstgrad silberne Eicheln das Selbstbewusstsein des Beamten stärkten. Darunter trug er vorzugsweise lindgrüne Hemden, eine tannengrüne Krawatte und den obligatorischen Hut, wahlweise mit Pürzel oder Gamsbart, an dem Förster sofort zu erkennen waren. Zur damaligen Zeit waren fast alle Förster auch Jäger, das heißt, im Dienst trugen sie Waffen, was so kurz nach Krieg und Besatzung ein besonderes Privileg darstellte. Der Revierförster Becker besaß einen Ferlacher[8] Drilling, den ihm vermutlich der Opa Coenen finanziert hatte. Von seinem mageren Anfangsgehalt (wenn ich mich nicht täusche, waren es weniger als 200 Mark brutto im Monat) war so eine Waffe jedenfalls nicht zu finanzieren. Zwei Anekdoten aus dem Leben meines Vaters in der Kalenborner Zeit sind mir noch geläufig, weil er sie mir später einmal erzählt hat.
Auf einer seiner Dienstfahrten zum Forstamt nach Linz wurde er von einem Polizisten angehalten. Wie der Förster später gestand, hatte er zuvor ein paar Schnäpse getrunken und war auf dem Rückweg dem Gendarm durch offensichtlich angeheiterte Fahrweise aufgefallen. Der hatte den Förster wohl zu spät erkannt, anderenfalls hätte er ihn gegrüßt, anstatt ihn anzuhalten. So bremsten sie ab, lehnten ihre Motorräder an einen Baum und tauschten Neuigkeiten aus. Sobald das Thema Krieg aufkam und man feststellte, gemeinsame Feldzüge miterlebt zu haben, kam Solidarität auf. Dann fielen die Namen der Kommandeure und Einheiten, bei denen sie gedient hatten (immer noch sagten sie: gedient!), die Regimentsbezeichnung, und schon war man auf vertrautem Terrain. Als nach einer halben Stunde ein Auto den Berg hoch kam und die Herren ein paar Schritte zur Seite treten mussten, erinnerten sie sich, dass sie von ihren Frauen daheim zum Mittagessen erwartet wurden. Sie wünschten sich noch einen schönen Tag, und jeder ging seinen Geschäften nach. So war das damals unter uniformierten Kollegen.
Eine zweite Westerwälder Anekdote betrifft die Jagd. Ein Kollege meines Vaters hatte bei einer Drückjagd einen kapitalen Keiler angeschossen. Wegen der starken Schweißspur[9] glaubte der Schütze, das Wildschwein könne nicht weit gekommen sein, und er folgte ihm bis zu einem aufgegebenen Steinbruch. Deutlich war zu sehen, an welcher Stelle die Sau eine Geröllhalde hinab gerutscht war. Der Förster folgte der Fährte, kam dabei ins Straucheln und landete in einer Brombeerhecke, im Wundbett[10] des waidwunden Tieres.
Als der Keiler mit ihm fertig war, stand es schlecht um den Mann. Erst Stunden später, nachdem der Förster nicht nach Hause gekommen war, machten sich Leute auf den Weg, ihn zu suchen. Den Ärzten gelang es, den Mann wieder zusammenzuflicken, aber der Schreck dürfte für den Rest seines Lebens in seinem Herzen steckengeblieben sein. Die Geschichte ist mir deshalb im Gedächtnis haften geblieben, weil sie für mich damals den jagdlichen Albtraum darstellte, ein Erlebnis, welchem jeder Jäger gerne aus dem Weg ginge. Aber derartige Unglücke, so selten sie sich auch ereignen, nährten den Mythos von der gefährlichen Wildsau im deutschen Wald.
Im April 1953 kam mein Bruder Dieter zur Welt, ebenfalls in Grevenbroich. Keine Ahnung, weshalb meine Eltern der Hebamme in Kalenborn nicht trauten … Auch habe ich nie erfahren, warum sie ihn ausgerechnet Dieter nannten.
Kapitel 3
Kurz darauf wurde eine Forststelle im Hunsrück frei, für die sich mein Vater von Anfang an beworben hatte. Er übernahm die Revierförsterei Sabershausen, die zum Forstamt Kastellaun gehörte. Forstlich zählten die Gemeinden Korweiler, Mannebach und Dorweiler noch zu seinem Revier. Mehr als 1000 Hektar Wald, ein kleines Königreich für einen jungen Förster. Im Sommer des Jahres 1953 bezog die inzwischen vierköpfige Familie das Forsthaus von Sabershausen. Als meine Familie auf den Hunsrück kam, war ich zwei Jahre alt. Was ich aus dieser frühen Zeit noch zu erinnern glaube, weiß ich von Verwandten, Eltern oder aufgrund von Fotos. Was ich selbst aus den frühen Kindheitstagen noch abrufen kann, das sind Versatzstücke, Schnappschüsse, kleine Episoden: wie ich morgens nach dem Aufwachen hinüber ins Schlafzimmer der Eltern lief und wie ich mich zwischen sie kuschelte. Wie ich auf Papas angewinkelte Knie kletterte und hinunterrutschte, und dann das Ganze von vorne, bis der Papa keine Lust mehr hatte und aufstand. Oder wie ich vorne auf dem Tank des Motorrads saß und mit ihm in den Wald fuhr.
Sabershausen sollte der Ort meiner Kindheit, meiner frühen Prägungen werden. Das Dorf bestand damals aus achtzig Wohnhäusern. Daneben gab es noch eine Kirche, einen Kindergarten, eine Schule, einen Backes, den Stierstall und eine am Ortsrand gelegene Kapelle; keine Industrie, noch kein Neubaugebiet und keinen Sportplatz. Das Dorf liegt an einer Querverbindung zwischen zwei Landstraßen, die beide die Hunsrückhöhenstraße[11] mit der Moseluferstraße verbinden, verkehrslogistisch also eine Nebenstrecke. Wer sie befährt, befindet sich selten auf der Durchreise. So kamen in den fünfziger Jahren nur wenige Autos durch unser Dorf, man konnte sie mit den Fingern abzählen.
Täglich kam der Lastwagen der Molkerei, um die Milchkannen abzuholen. An zentraler Stelle des Dorfes gab es ein Holzpodest, wo die Bauern die gefüllten Kannen abstellten. Dreimal am Tag kam der Postbus, für die meisten Dorfbewohner die einzige Möglichkeit, in die Stadt zu gelangen. Es sei denn, man ging zu Fuß oder man nahm das Fahrrad. Die nächste Kleinstadt hieß Kastellaun, im Grunde auch nicht mehr als ein etwas groß geratenes Dorf. Dort befanden sich die Amtsverwaltung, das Forstamt, diverse Einzelhandelsgeschäfte, Apotheken, einige Hotels, ein paar Bäckereien und Metzgereien. Donnerstags war Wochenmarkt. Beim Obst- und Gemüsegeschäft Faber in der Marktstraße gab es freitags frischen Kabeljau, mit Lastwagen zwischen Eisblöcken von der Nordsee bis auf den Hunsrück gebracht.
Das erste Auto in Sabershausen war ein Opel Blitz Kleinlaster, und der gehörte dem Schreiner Wagner. Das zweite, ein Lloyd LP 600, schaffte sich der Pfarrer an. Der Förster fuhr 1953 noch Motorrad, der Lehrer ging zu Fuß. Den Autofahrern brachte man Respekt entgegen, weil es Männer waren, die es offenbar zu etwas gebracht hatten. Dasselbe galt für die Handwerker. Da gab es neben dem Schreiner Wagner den Anstreicher Weiler, den Schuster Dauster, den Dachdecker Pies und den Hufschmied Ohlmüller, alles alteingesessene »Sawascher«, wie sie sich nannten. Der Schneider Kretschmann, den der Krieg irgendwo im Osten aufgewirbelt hatte und der, nachdem der Staub sich gelegt hatte, mit seiner Familie im Hunsrück gelandet war, verschaffte sich Respekt durch die Qualität seiner Anzüge und die verbindliche Form seines Umgangs. Die Schmiede vom alten Ohlmüller, der bei der Arbeit an den Pferdehufen immer eine Schüppekapp trug und dem dabei eine nässende Pfeife zwischen den Zähnen hing, lag gegenüber der Kirche. Mitte der Sechziger wurde vor Ohlmüllers Schmiede der letzte Gaul beschlagen. Dann sattelte sein Sohn auf Heizungsbau um, die Schmiede wurde abgerissen und machte einer modernen Montagehalle Platz.
In Sabershausen lebten in den fünfziger Jahren etwa 300 Seelen. Die erste Seele im Dorf war der Pfarrer Schneider, dessen Gottesdienste stets gut besucht waren. Der Pfarrer, obwohl katholisch, war für alle im Dorf »de Bastuur«. Außerhalb der Kirche war er stets mit Soutane und Birett[12] unterwegs. Einmal im Monat ließ er sich die Sünden der Leute beichten, hielt wöchentlich zwei Stunden Religionsunterricht an der Schule, und sonntags feierte er mit der Gemeinde die Heilige Messe. Dass alle Dorfbewohner daran teilnahmen, war selbstverständlich. Pfarrer, Lehrer und Förster waren die »Studierten« im Dorf, Zugereiste, die von den Bauern mit einer Mischung aus Argwohn und Respekt betrachtet wurden. Kein Einheimischer zu sein, das wurde im Dorf wie eine zweifelhafte Charaktereigenschaft gewertet. Und das bekamen auch wir Kinder zu spüren.
Das Forsthaus lag am westlichen Ortsrand und trug die Hausnummer eins. Es bildete zusammen mit zwei Gehöften einen eigenen Ortsteil. Die beiden Bauernhöfe und das Forsthaus lagen auf einem Plateau, während sich der größte Teil des Dorfes in eine Mulde duckte, wo die Häuser vor den Stürmen, die von Frankreich kommend über den Hunsrück brausten, geschützt waren. Das schiefergedeckte und mit Gauben versehene Forsthaus bot dem Sturm die Stirn, aber alles was der Sturm ausrichten konnte, war ein geräuschvolles Anwehen des Hauses, das am Ende immer den Sieg davontrug. Draußen tobten die Elemente, drinnen war es warm, trocken und windstill. Schon als Kind erlebte ich den Sturm als etwas Anheimelndes, ein Naturereignis, das mich die Geborgenheit des Hauses spüren ließ.
Zum Forsthaus gehörte ein gemauerter Schuppen, halb Hühnerstall, halb Brennholzlager. Als der Vater sich 1956 ein Auto anschaffte, ließ er zwischen Schopp und Garten eine Garage bauen. Durch den schmalen Durchgang gelangte man in die eingezäunte Wiese, in der tagsüber die Hühner scharrten. Derart schmale Pfade zwischen zwei Gebäuden nannte man Reuel, was vermutlich vom französischen Wort ruelle (Sträßchen) abgeleitet wurde.
Die wechselvolle Geschichte des Rheinlandes seit dem Mittelalter hat den Hunsrück konfessionell und sprachlich zu einem Flickenteppich gemacht: Katholische und evangelische Dörfer wechseln sich ab, und der Dialekt ändert sich von Dorf zu Dorf. In Sabershausen unterhielt man sich in mosel-fränkischem Dialekt, einer Sprache, die nirgendwo dokumentiert ist und die in ihrer spezifischen Ausprägung einzig und allein in diesem Dorf gesprochen und verstanden wird; oder wurde, denn wie Erfahrungen mit Dialekten und Sprachen ethnischer Minderheiten gezeigt haben, sterben diese Verständigungscodes langsam aus.
Die hinter dem Forsthaus gelegene Wiese war Gehege und zugleich die Todeszone der Hühnerschar, die unsere Mutter von Neurath mitgebracht hatte. Zusätzlich zu den Kulturbäumen (ein alter Kirschbaum, eine Sauerkirsche, mehrere Pflaumen- und Zwetschgenbäume sowie ein schattiger Walnussbaum) pflanzte der Vater ein weiteres Dutzend Apfelbäume, die er im Laufe der Jahre veredelte. Entlang des Zauns setzte er Brombeeren und Sträucher. Dazwischen wuchs die Wiese, wo die Hühner den ganzen Tag nach Käfern, Larven und Würmern suchten. Dabei geschah es zuweilen, dass sich die Heenawei (Hühnerweihe) auf ein Huhn stürzte. Zum Glück waren Habichte und Bussarde nicht in der Lage, die fette Beute abzutransportieren, so dass sie sich an Ort und Stelle über sie hermachen mussten. Meist alarmierte das Geschrei des Gockels den Opa oder die Mutter, die dann rasch vor Ort waren, um dem Räuber die Beute abzujagen. So gab es im Forsthaus von Zeit zu Zeit außerplanmäßiges Hühnerfrikassee. Mischte sich allerdings der Vater ein, ging es für den Räuber übel aus. Der Förster war nämlich ein guter Schütze. Er stopfte zwei Schrotpatronen in den Drilling, pirschte sich an und holte den fliehenden Greif mit einem Schuss vom Himmel. Das war für uns Kinder jedes Mal der Beweis dafür, dass unser Papa ein Held war. Dass der Vater als einziger Mann im Dorf eine (legale) Schusswaffe besaß, wertete nicht bloß ihn, sondern auch meine Brüder und mich in den Augen der Dorfkinder auf. Damit konnte man angeben, das machte den Makel, einen Migrationshintergrund zu haben, ein Stück weit wett.
Entlang des Hauses, des Gartens und der Wiese verlief die Hauptstraße. Aus Richtung Korweiler kommend, tauchte sie hinter einem Hügel auf, lief einen halben Kilometer schnurstracks auf das Forsthaus zu, wo sie mit einem leichten Rechtsknick einer dicken Kastanie auswich, die gegenüber am Straßengraben stand. Begleitet wurde sie von der Telefonleitung: alle dreißig Meter stand ein Telegraphenmast, und wenn Kinder die Ohren an den Mast legten, hörten sie ein geheimnisvolles Summen. Manchmal brummte sogar der Draht. Zwischen Haus und Obstwiese lag ein großer Garten, der ebenfalls von Bäumen beschattet wurde: Tafelpflaumen, Spanische Kirschen, Reineclauden. Der Garten war durch gekieste Pfade in vier gleiche Parzellen eingeteilt. Eine davon war das Kartoffelbeet, eine zweite das Erdbeerfeld. Auf den übrigen wuchsen Salat, Kohl, verschiedene Hülsenfrüchte und Gewürzkräuter. Anfangs war die Gartenarbeit Sache meines Vaters, aber nachdem der Opa 1958 in Neurath den Hof aufgegeben hatte, kam er häufig auf den Hunsrück, um ihm diese Arbeit abzunehmen. Unter seinen Händen entwickelte sich der Garten hinter dem Forsthaus zum fruchtbarsten des ganzen Dorfes.
Zwischen dem Anwesen des Försters und dem angrenzenden Gehöft der Familie Simon führte diagonal ein befestigter Weg in die Felder und weiter zum Nachbardorf Zilshausen. Das gab unserem Grundstück eine Keilform, in dessen Spitze eine stattliche Birke wuchs.
Das Forsthaus hatte eine Grundfläche von 8 x 8 Metern. Über eine außenliegende Treppe von drei breiten Stufen gelangte man zur Haustür, die aus massiver Eiche gezimmert war. Dahinter lag ein kleiner Windfang, dann ein Flur mit Garderobe und Türen ins Büro des Vaters, ins Wohnzimmer und in die Küche. Eine geschwungene Treppe aus Buchenholz führte zu der auf halber Höhe gelegenen Toilette und weiter hinauf auf einen oberen Flur, von wo aus man die drei Schlafzimmer und die Speichertreppe betreten konnte: Elternzimmer, Kinderzimmer und Gästezimmer. Letzteres war dauerhaft vom Neurather Opa bewohnt.
Der Weg ins Badezimmer führte durchs Kinderzimmer. Das Bad war schmal und es passten nur ein kleines Waschbecken, eine Wanne und ein Badeofen hinein. Ein Bad im Haus war Luxus zu dieser Zeit, was mir aber erst klar wurde, nachdem ich einige Bauernhäuser von innen gesehen hatte. Auf dem Speicher hingen geräucherte Würste, Speck und Schinken an Holzstangen. Es roch gut da oben, hinaufzusteigen machte Appetit. Den Keller erreichte man von der Küche aus; über eine steile und düstere Steintreppe ging es hinunter. Im Keller gab es einen Vorratsraum, eine Waschküche und eine Kammer, in der Kohlen und Briketts für den Winter gelagert wurden. Aus der Waschküche ging es ebenerdig hinaus in den Hof und den Garten. Die Türen im Keller waren einfache Lattenroste, und da der Vorratskeller immer gut gefüllt war, roch es nach Obst, nach Sauerkraut und nach Kohle.
In einer großen Horde überwinterten die Kartoffeln, die im Frühjahr zu keimen begannen. Meine Mutter verstand sich auf die Kunst, Obst und Gemüse einzukochen, und so gab es ein ganzes Regal voller Weckgläser, gefüllt mit Pfifferlingen und Steinpilzen, mit Wähle (Heidelbeeren) und Quetsche, mit Kirschen und bissfesten Mirabellen. Auf einem Holzregal reiften Goldparmänen und Renetten, Apfelsorten, die heute kaum noch jemand kennt, und die sich bis weit in den Winter hinein hielten. Sofern die Mäuse sie in Ruhe ließen.
Mäuse gab es im Haus immer, die meisten im Keller, wo sie mit Krombiere und Äbbel ihren Hunger stillten, wenn gerade mal kein Speck auf der Speisekarte stand. Ab und zu ging eine Maus in die Falle, aber immer wieder schafften sie es, ein Schlupfloch ins Haus zu finden.
Weil es im Forsthaus keine Zentralheizung gab, standen in allen Zimmern Holz- und Kohleöfen. Eine der Aufgaben, die uns Kindern schon früh übertragen wurde, war Holz herein- und Kohle heraufzuholen. Und da meine Mutter aus Angst vor Mäusen nicht gerne in den Keller hinabstieg, erst recht nicht im Dunkeln, übertrug sie diese Aufgabe meist mir. Ab dem Alter von fünf oder sechs Jahren mussten meine Brüder und ich daheim helfen. Die Mutter schickte uns zum Kräuterpflücken in den Garten und der Vater zum Holzholen in den Schuppen. Auch mussten wir Eier aus dem Hühnerstall und Kartoffeln aus dem Keller holen. Zur verhasstesten aller häuslichen Hilfsarbeiten wurde mir das Abtrocknen nach dem Geschirrspülen, zu dem unsere Mutter uns rekrutierte, sobald wir alt genug waren.
Um die Beschreibung des Hauses zu vervollständigen, sollten noch die Spülecke und die dahinter liegende Speisekammer erwähnt werden. In einer durch einen Vorhang abgetrennten Ecke der Küche gab es einen Spülstein mit dem Wasserkran. Fließendes kaltes Wasser war damals Standard, warmes Wasser musste am Herd geschöpft werden, wo in einem integrierten Wasserbehälter immer welches vorrätig war.
Die Speisekammer war für uns Kinder der Ort kulinarischer Versprechen und der Verlockung zum Naschen. Hatte die Mutter gebacken, kühlten dort die Formen mit den Kuchen aus. In der Vorweihnachtszeit duftete es nach Zimtsternen, Pfeffernüssen und Anisplätzchen. Obwohl man davon ausgehen muss, dass sie unsere heimlichen Besuche in der Kammer bemerkte, sah unsere Mutter großzügig über derartige Regelverstöße hinweg. Einen Kühlschrank schaffte sie sich erst Mitte der Fünfziger an. An dessen Anlieferung kann ich mich noch erinnern. Er erhielt seinen Platz neben dem Herd, der sogenannten Küchenhexe[13], die vorerst noch mit Holz »gestocht« wurde. Die nächste Erleichterung im Haushalt war die Waschmaschine, die das leidige Windelkochen im Zuber in der Waschküche ablöste. Zu all diesen Anschaffungen dürfte der Neurather Opa etwas beigesteuert haben, denn ein Forstbeamter verdiente in diesen Zwischenzeiten nicht viel.
Das Büro des Försters war selten besetzt. Hier empfing mein Vater den Haumeister oder einen der Holzhauer, die ihm Listen über im Wald gestapeltes Industrieholz brachten und kleine von Harz verklebte Zettel, auf denen die Arbeitsstunden der Waldarbeiter vermerkt waren. Bei der Büroarbeit duldete er keine Störungen. Meine Erinnerungen an die Tabuzone »Büro« sind vor allem vom Geruch geprägt. Es duftete dort nach Bleistift und Leinöl, nach frischem Papier, nach Pfeifentabak und Tintenfass. In der Mitte des Zimmers, auf einem abgewetzten Teppich, stand ein Schreibtisch aus Buchenholz. Davor und dahinter je ein Stuhl, seitlich an der Wand ein Aktenschrank. Der schwarze aus Bakelit[14] hergestellte Telefonapparat stand auf dem Schreibtisch. Die Nummer war dreistellig: 399. Im ganzen Dorf gab es 1955 nur fünf Telefone, und die schellten beim Pfarrer, in der Post, beim Bürgermeister, in der Schreinerei und im Forsthaus.
Da alle Räume des Hauses Eckzimmer waren, hatten auch alle Fenster nach zwei Seiten. Hinter der Tür stand ein Kohleofen, der, wenn er brannte, die vorhandenen Gerüche noch verstärkte. Vor dem Ofen lag eine gegerbte Sauschwarte, und auf der Schwarte lag Flori, unser langhaariger rotbrauner Dackel, der sofort in miese Laune verfiel, sobald ein Gast das Haus betrat. Diese Fremdenfeindlichkeit hatte ihm meine Mutter antrainiert, indem sie sein wütendes Gebell positiv verstärkte. Ließ sie den Hund neben dem Kinderwagen vor dem Haus Wache schieben, konnte sie sicher sein, dass sich kein Fremder ihren Kindern näherte. Aber genetisch war der Dackel auf Jagd programmiert, sowohl als Stöberer nach Niederwild, als auch für die Fuchsjagd geeignet. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als Flori von einem Ausflug in die Hänge des Baybachtales unterhalb des Steffenshofs nicht mehr zurückkehrte. Lange betrauerten wir seinen Verlust. Vater meinte, der Flori sei vielleicht in einen fremden VW-Käfer gesprungen, denn das hatte er schon öfter getan. Er schien zu glauben, jeder grüne Käfer gehöre seinem Herrn. Als einige Wochen vergangen waren, ohne dass wir etwas von Flori gehört hatten, begannen unsere Eltern, nach einem jungen Hund Ausschau zu halten. Mutter wollte unbedingt wieder einen Dackel, also brachte der Vater eines Tages den zehn Wochen alten Raudi mit, einen Rauhaardackel.
Im Wohnzimmer des Forsthauses stand ein Schrank voller Porzellan und Gläser. Auch gab es dort ein Fach für Liköre, Cognac und Schnaps. Aber meine Eltern tranken kaum Alkohol. Höchstens wenn sie Gäste bewirteten, wurde eine Flasche Wein aus dem Keller geholt. Hin und wieder konnte man sie auf einer Kirmes beschwipst erleben, aber nie betrunken.
Weiter bestand das Mobiliar aus einer durchgesessenen Couch mit teilweise gebrochenen Sprungfedern, einem Sessel, dem Tisch mit sechs Stühlen, einem kleinen lackierten Lampentisch mit einem Radio darauf. All das im Stil der damaligen Zeit, aus Sperrholz und Furnier. Komplettiert wurde das bürgerliche Wohnzimmer durch einen Teppich und Vorhänge aus dem Sonderangebot eines Koblenzer Einrichtungshauses. An Kunst an den Wänden kann ich mich nicht entsinnen. Zwar malte unser Vater mit Ölfarben auf Leinwand, aber dieses Hobby entfaltete sich erst später. Das einzige Gemälde aus seinen frühen Jahren war ein dunkelgrauer Rehbock, dessen gedrungener Leib eher an ein Wildschwein erinnerte. Die Wände im Wohnzimmer waren für Jagdtrophäen reserviert. Da hingen der präparierte Kopf eines Keilers, Bälge von Füchsen, Gehörne von Rehböcken, die Hauer von Wildschweinen und im Laufe der Jahre kamen Gamskricken und Hirschgeweihe hinzu. Es war ihm sogar gelungen, das Gehörn eines kapitalen Rehbocks, den er während des Krieges in der Gegend von Belfort erlegt hatte, nach Hause zu schicken. Dieser »französische Bock« gehörte wegen der stattlichen Höhe und den ausgeprägten Perlen zu seinen besten Trophäen.
Die Jagdtrophäen waren und blieben Vaters ganzer Stolz, was nur jemand verstehen kann, der selbst im Herzen ein Jäger ist. Oder der mit Begeisterung Hemingways Jagdgeschichten gelesen hat. Eine kritische Haltung zu Jagdtrophäen, wie sie inzwischen verbreitet ist, konnte der Jäger Becker nie nachvollziehen. Noch in den achtziger Jahren erlegte er auf dem Donnersberg[15] einen Mufflon-Widder, dessen Haupt samt Schnecken er ausstopfen ließ, und der fortan im Wohnzimmer anklagend auf uns herabblickte.
Die Familie verbrachte die meisten Abende bei Brett- und Kartenspielen. Sowohl mein Opa als auch mein Vater waren versierte Skat-Spieler, sodass ich dieses Spiel früh von ihnen lernte. Gerne erinnere ich mich an die Winterabende im Kreise der Familie in der beheizten Stube, wenn Mutter oder einer von uns Buben Geschichten vorlasen oder der Vater Jägerlatein[16] erzählte. Irgendwann hatte er ein Brettspiel mitgebracht, eine Mischung aus Mensch-ärgere-dich-nicht, Monopoly und Treibjagd. Es ging darum, zu würfeln, auf einem vorgezeichneten Pirschpfad vorzurücken, um an bestimmten Orten anstatt ein Hotel zu kaufen, ein Wild zu erlegen. Dabei hatte jedes Tier einen bestimmten Wert, und wer am Ende die größte Beute gemacht hatte, war der Sieger. Die wenigsten Punkte brachte der Abschuss einer Taube, die meisten gab es für Bär, Hirsch und Steinbock.
Kapitel 4
Ich muss noch sehr klein gewesen sein, vielleicht vier oder fünf Jahre alt, als mein Vater mich zum ersten Mal mit auf einen Hochsitz nahm. Zwei Stunden lang durfte ich nicht sprechen, nicht husten und mich nur behutsam bewegen. Jedes überflüssige Geräusch sollte ich vermeiden. Die Hochsitze von damals hatten mit den mobilen Konstruktionen von heute nicht viel gemeinsam. Als Stütze diente meist eine stabile Eiche, das Gerüst bestand aus Stangen und Knüppeln vertrockneter Fichten. Eine derartige Kanzel war damals nach oben hin offen, die Baumkrone bildet das Dach. Regnete es stark, dann wurden wir eben nass, oder wir brachen den Ansitz ab.
Ich begleitete meinen Vater also schon als kleiner Junge in den Wald und auf die Jagd. Ich war dabei, wenn Rehe äsend im Feuer fielen und Wildschweine auf der Flucht von der Kugel getroffen in den Schnee sackten und starben. Im Laufe vieler Jahre sah ich manchen Fasan vom Himmel stürzen und manchen Hasen im Schuss rollieren. Die tausend Stunden, die ich als Kind meinen Vater auf der Jagd begleiten durfte, haben mich viel gelehrt, nicht zuletzt die vielen Abende beim Ansitz am Waldrand, wo wir schweigend saßen und die Natur betrachteten. In wolkenfreien Nächten deutete Vater auf die Sterne und nannte mir ihre Namen. Er erklärte mir die vier Himmelsrichtungen, und vergaß nicht, den Himmel selbst, also den Blick hinauf ins Firmament als die fünfte zu bezeichnen. Am Polarstern, der zuverlässig im Norden steht, kann man sich orientieren.
Vater kannte die einheimischen Pflanzen, inklusive der lateinischen Namen, er wusste über Ameisenhaufen so viel zu berichten wie über Waldohreulen, über das Paarungsverhalten von Dachsen so viel wie über die Besonderheiten der Tragzeit beim Rehwild. Ich ging noch nicht zur Schule, da wusste ich schon, wie ein Reh von innen aussieht, kannte den Unterschied zwischen Sumpf- und Wiesenschachtelhalmen und konnte Champignons von Knollenblätterpilzen unterscheiden.
Einen Förster zum Vater zu haben, war ein Schlüssel zu vielen Geheimnissen der Natur. Dass die Dorfbewohner den Wald als ökonomische Ressource betrachteten, erfuhr ich im Winter, wenn die Holzhauer mit dem Fällen der Bäume beschäftigt waren. Wenn wir sie an ihrem Arbeitsplatz aufsuchten, spürte ich den besonderen Reiz, den die Waldarbeit damals noch besaß. Schon von fern hörten wir Axt und Säge. Selbst dicke Buchen und Eichen wurden noch mit der von zwei Männern gezogenen Blattsäge gefällt. Und wenn wir miterlebten, wie ein mehrere hundert Jahre alter Riese zu Boden krachte und die Erde ringsum erzitterte, dann zitterte ich mit und es erfasste mich ein Unbehagen, als sei ich Zeuge einer Hinrichtung geworden. Wenn ich im Winter im Schnee hinter meinem Vater und dem Hund durch den Wald stapfte und wir uns dem Feuer der Holzhauer näherten, konnte man sie bei günstigem Wind schon von weitem wittern. Der Duft, den sie verströmten und der von kalter Winterluft umgeben würzig zwischen den Bäumen lag, war komponiert aus Tannenharz, Tabak und dem Fett, mit dem sie ihre Lederschuhe einschmierten. Sie rauchten Reval, Overstolz und Eckstein[17]. Ihre Brotzeiten brachten sie von zu Hause mit, Fleisch und Kartoffeln in »Henkelmännern«, Leberwurstbrote in »Brotbüchsen« aus Blech. Zuweilen brach mir einer der Männer ein Stück von seiner Stulle ab, dann legte ich es auf eine Astgabel und röstete es über der Glut.
Der Arbeitstag eines Försters war abwechslungsreich. Mein Vater war, was die Einteilung seiner Arbeit anging, selbständig, sofern sich nicht gerade der Forstmeister zu einer Revierbegehung angemeldet hatte, was aber höchstens zweimal im Jahr der Fall war. Mehr noch, er konnte Dienst und Privates miteinander verbinden, die Hauptsache war, dass am Ende die Abrechnungen stimmten.
Besuche bei den Holzfällern im Winter und bei den Frauen, die im Herbst die jungen Bäume pflanzten, bildeten einen Großteil seiner Beschäftigung. Ein Förster musste seinen Wald genau kennen, aus diesem Umstand ergab sich seine Hauptarbeit. Eine der anstrengendsten Tätigkeiten war das sogenannte Auszeichnen. Dabei bestimmte er, welche Bäume gefällt werden sollten. Er ging durch die Bestände, sah sich den Wuchs der einzelnen Stämme und ihre Standorte an, hielt nach Baumkrankheiten Ausschau, nahm zuweilen Rücksicht auf Spechthöhlen, Eichhornkobel und Bussardhorste. Oft stand er lange vor den Kandidaten, lief hin und her, wog Für und Wider ab, ehe er sich entschied, welcher der Bäume, die sich gegenseitig im Wachstum behinderten, älter werden und welcher sterben sollte. Um seinen Holzmähschern, wie die Holzfäller im Dorf bezeichnet wurden, mitzuteilen, welche Bäume sie fällen sollten, markierte er diese mit dem Reißhaken. Dabei handelt es sich um ein heute längst nicht mehr gebräuchliches Forstwerkzeug, ein spezielles Schälmesser, bestehend aus einem Handgriff mit einer im Bogen geschmiedeten Schneide, mit der die Baumrinde eingeritzt wurde. Bei Nadelhölzern eine leichte Sache, bei der Borke alter Kiefern oder Eichen hingegen war Kraft erforderlich. Der Förster in früheren Jahren war also noch gezwungen, physischen Kontakt zu den Bäumen herzustellen (heute erledigen Forsttechniker das Markieren mit Sprühdosen). Und wo seinerzeit eine Rotte Holzhauer die Bäume mit Sägen, Äxten und Keilen fällte, und wo ein Holzrücker mit Pferden die Stämme aus dem Wald schleifte, da bahnt sich heute der Harvester[18] seine Schneisen und benötigt für Absägen, Entasten, Zerkleinern auf Industriemaße und Beladen des Holztransporters einen Bruchteil der Zeit, die diese Arbeit früher in Anspruch nahm.
Als ich kürzlich einmal eine solche Baumerntemaschine im Einsatz sah, fragte ich mich, was der alte Förster wohl dazu sagen würde, hätte er noch erlebt, mit welch brachialen Methoden sein Nachfolger mit dem Wald umgeht, den er einst angelegt hatte.
Ein weiterer Verantwortungsbereich lag in der Auswahl der Baumarten, die auf Kahlflächen neu angepflanzt wurden. Zwar hatte er schon früh erkannt, dass Koniferen-Monokulturen [19] der Ökologie des Waldes nicht gut bekommen, aber die ökonomischen Interessen der Gemeinden brachten ihn oft zum Einlenken. Für seine kleinen Gemeinden war der Holzverkauf eine der wenigen Einnahmequellen, und die im Gemeinderat sitzenden Bauern übten ständigen Druck auf ihren Förster aus, mehr Geld aus dem Wald zu erwirtschaften. Um eine konsequente ökologische Waldbewirtschaftung umzusetzen, wäre Durchsetzungsvermögen vonnöten gewesen, das man aber bei Beamten eher selten findet. Dass der Wald von Sabershausen heute so heruntergekommen ist, liegt also nicht an meines Vaters Nachfolger im Amt, sondern er selbst hat dies durch unkluge Beforstung in den sechziger Jahren mit zu verantworten.
Mein Vater bestimmte also seinen Tagesablauf selbst. Regnete es, so erledigte er die Büroarbeit. Ganz ohne Bürokratie ging es auch damals im Forstberuf nicht. Dann übertrug er endlose Zahlenkolonnen in dicke Kladden, Maße gefällter Bäume, Festmeter, Stammlängen, erzielte Preise bei Holzverkäufen. Das Feilschen mit Holzhändlern gehörte ebenso zu seinen Aufgaben wie die Planung des Waldwegebaus. Wege im Wald wurden in erster Linie zum Abtransport des Holzes gebaut. Oft waren Baumbestände jahrzehntelang nicht durchforstet worden, also waren die alten Wege zugewachsen oder erodiert. Sie waren den Anforderungen der schweren Rückfahrzeuge und Sattelschlepper nicht mehr gewachsen.
Ich entsinne mich eines Wegebauprojektes im Staatswald. Im Hang des Deimerbachtals[20], unweit der Junkersmühle sollte der neue Waldweg um eine Felsrippe herum geführt werden, und weil die Fahrzeuge mit den langen Baumstämmen keine engen Kehren nehmen konnten, war eine Sprengung anberaumt worden. Da wollte der Förster persönlich dabei sein, schließlich kamen Sprengungen nicht alle Tage vor. Und weil ich davon erfahren hatte, wollte ich unbedingt mit. Als wir vor Ort eintrafen, war der Sprengmeister noch mit den Vorbereitungen beschäftigt. Pressluftbohrer trieben Löcher in den Fels, Dynamitstangen wurden hineingeschoben, Zündschnüre gelegt. Dann wurden wir aufgefordert, uns in Sicherheit zu bringen. Vater fand, es reiche aus, in knapp hundert Metern Entfernung hinter einer dicken Eiche in Deckung zu gehen. Das Warnsignal ertönte, es krachte und dann flog uns die Felsnase in tausend Brocken um die Ohren, wobei die hoch in die Luft geschleuderten Steine erst nach einiger Verzögerung in die Baumkronen prasselten. Es regnete Felsbrocken. Ich glaube, Vater war froh, dass wir am Ende heil davon gekommen sind.
Viel Zeit verbrachte der Förster damit, indem er mit offenen Augen im Wald umherpirschte. In der Regel mit dem Hund bei Fuß und dem geschulterten Drilling. Er musste nach Stürmen dafür sorgen, dass die Wege befahrbar waren, und er versuchte einen Überblick über die Wildschäden zu behalten. Zu den ältesten Lärchen, Fichten, Buchen und Eichen hatte er ein persönliches Verhältnis. Immer wieder zog es ihn zu diesen Bäumen hin, und wenn ich ihn begleitete, dann erklärte er mir ihre Namen, zeigte mir, woran man sie erkennt, und wie man ihr ungefähres Alter bestimmt. So lernte ich, wie man eine Fichte von einer Tanne unterscheidet, woran man Erlen und Weiden erkennt, und dass eine Ulme auch Rüster genannt wird. Für mich als Bub im Vorschulalter waren die Waldspaziergänge mit dem Vater botanische Exkursionen: jeden Tag lernte ich weitere Blumen, Farne und Tiere kennen.
Unter anderem erfuhr ich, dass die alte Lau-Eiche von Sabershausen, von der die Leute sagten, sie sei tausend Jahre alt, höchstens halb so alt war. Aber auch das ist durchaus ein stattliches Alter für einen Baum! Anfang der sechziger Jahre schlug ein Blitz in diese Eiche ein, den Rest verarbeitete ein Bauer zu Brennholz, und dass sie hier erwähnt wird, ist wohl die letzte Ehrung, die dieser Veteran des Lau-Waldes erfährt. Solange die hohle Lau-Eiche noch Wind und Wetter trotzte, war sie ein Treffpunkt für die Kinder des Dorfes. Hier fingen unsere Abenteuer an …
Wenn ich zuvor sagte, dass der Förster die Möglichkeit hatte, Berufliches und Privates zu verbinden, so dachte ich weniger daran, dass er seine Frau zu Spaziergängen mit in den Forst genommen hätte, sondern daran, dass er während der Reviergänge immer ein Auge für die Jagd hatte und ein anderes für Früchte und Pilze. Überraschte er unterwegs zum Beispiel ein Wildschwein, dann erlegte er es. Den Rest des Tages verbrachte er anschließend damit, die Sau aufzubrechen und nach Hause zu schaffen, was solange er noch kein Auto besaß, gar nicht so einfach war. Ein Reh ließ sich ja noch im Rucksack transportieren, aber eine Sau von 50 Kilo oder mehr … Später lag für diese Zwecke immer eine Gummiplane unter der Haube des Käfers.
Im Sommer stieß unser Vater zuweilen auf Steinpilze oder Pfifferlinge. Dann machte er sich sogleich an die Ernte. Je nach Jahreszeit brachte er heim, was er im Wald gefunden hatte: Im Spätsommer Brombeeren und Pilze, im Herbst Buchecker und Haselnüsse. Manchmal waren es so viele, dass er die Familie als Erntehelfer rekrutierte.
In einem Steilhang des Deimerbachtals fanden wir in einem Jahr Unmengen an Steinpilzen. Vater und Mutter schnitten sie aus dem Waldboden, wir Buben schleppten die Taschen und Körbe an den Waldrand, wo der Käfer im Schatten stand. Anschließend waren wir tagelang damit beschäftigt, die Pilze zu putzen, sie in Scheiben zu schneiden, zu trocknen, zu zermahlen oder in Stücken einzufrieren. Mit ihrer Pilzpulver-Mischung verfeinerte die Hausfrau Saucen, die es zu Fasan oder Rehrücken gab. Meine Mutter war, was Wildgerichte anging, eine erfahrene Köchin: Bei ihr schmeckten Hase und Reh nicht zu sehr nach Wild, und das ist es, was der Gourmet in der Regel schätzt.
Der Alltag eines Försters gestaltete sich abwechslungsreich und stressfrei. Hatte mein Vater Lust in den Wald zu gehen, und das war bei schönem Wetter oft der Fall, so gab es dafür immer einen Grund: entweder er stattete den Waldarbeitern einen Besuch ab, oder er durchstreifte eine Kultur, um nachzusehen, ob es dort Wildverbiss zu beklagen gab. Oder er vergewisserte sich, ob in dem hohen Buchenbestand »im Alten Berg« die Naturverjüngung hochkam. Im Wald gab es immer etwas zu beobachten, zu hegen oder einfach in Ruhe wachsen zu lassen.
Kapitel 5
Das Bauernmädchen vom Niederrhein hatte sich inzwischen an ihren Mann, ihre Kinder, an das Forsthaus, das Dorf und den Hunsrück gewöhnt. Als Gattin des Försters war sie, was bestimmte modische Extravaganzen anging (Parfum zum Beispiel, Nagellack oder Nylonstrümpfe, nicht zu vergessen die Zigaretten), den Bauersfrauen um Längen voraus, und ich vermute, dieForschtersch, wie sie im Dorf genannt wurde, war oftmals Gegenstand von Klatsch und Tratsch. Was ihr allerdings nicht viel ausgemacht zu haben scheint, denn schon bald entdeckte sie bei sich selbst ein ausgeprägtes Bedürfnis, anderer Leute Liebschaften und Skandälchen breitzutreten. Zu dieser Zeit rauchten unsere Eltern Zigaretten, der Vater zusätzlich Pfeife. Für eine junge Frau wie meine Mutter war das nicht selbstverständlich, denn sie war die Erste im Dorf, die sich diesen Luxus leistete. Der Pfarrer Schneider sah sich sogar aufgerufen, zum Thema Rauchen und Frauen von der Kanzel zu sprechen. Mein Vater indes schien damit kein Problem zu haben, auch nicht damit, dass sie die erste Frau im Dorf war, die Ende der Fünfziger den Führerschein machte und fortan einmal die Woche zum Einkaufen nach Kastellaun fuhr; und die sich zuweilen im Salon Scholten eine neue Dauerwelle legen ließ.
Im November 1954 kam mein jüngster Bruder Michael zur Welt. Die Oma Coenen aus Neurath war eigens angereist, um in den Tagen vor und nach der Geburt den Haushalt zu übernehmen und um sich um Dieter und mich zu kümmern. Michael wurde im Simmerner Krankenhaus geboren. Der Vater, damals noch mit dem Motorrad unterwegs, nahm mich mit, um den kleinen Bruder zu begrüßen. Nach ein paar Tagen kamen Mutter und Brüderchen nach Hause. Ich weiß noch, als plötzlich ein weiteres Bett im Kinderzimmer stand, wie die Mutter dort neben dem Kindchen schlief (das Wort »Baby« war damals noch unüblich), damit sie den kleinen Schreihals auch nachts stillen konnte, ohne den Vater aufwecken zu müssen. Wie er als Säugling aussah, das habe ich vergessen. Bewusst tritt Michael in meine Erinnerung, als er zwei Jahre alt war. Mit seinen Kopf voller brauner Locken hatte er sich zum Spaßvogel der Familie entwickelt. Im Kinderzimmer des Forsthauses waren wir nun zu dritt, und das sollte auch, solange wir in Sabershausen wohnten, so bleiben. Soweit ich mich entsinne, kamen wir Kinder gut miteinander aus, an Prügeleien kann ich mich nicht erinnern. Wir wurden früh ins Bett geschickt, wir hatten ausreichend Schlaf, und wenn wir wach lagen, dann erzählten wir uns gegenseitig unsere Träume oder wir dachten uns Spiele aus. Jedenfalls kannten wir keine Langeweile. Die Tapete, stundenlang vor Augen, wurde zur Landkarte, der altmodische Lampenschirm – gelbes Glas mit braunen Schlieren – wurde zur fliegenden Untertasse. Wenn sich abends ein Auto mit eingeschalteten Scheinwerfern dem Dorf näherte, dann fiel der Lichtschein durch das Fenster an die Wand unseres Zimmers und bildete dort ein Licht- und Schattengitter ab, und je näher das Auto dem Forsthaus kam, umso weiter wanderte der Schein zur Seite, bis er plötzlich weghuschte. Auch wenn sich dieses Schauspiel allabendlich wiederholte, faszinierte es mich wie im Kino, auch wenn immer wieder derselbe Film gezeigt wurde.
Eine weitere Besonderheit, die im Zusammenhang mit dem Kinderzimmer erwähnt werden muss, waren die geflügelten »Haustiere«. In einem Hohlraum unter dem Dach nistete ein Pärchen Schleiereulen. Kurz nachdem wir Kinder zu Bett gebracht worden waren und es dunkelte, fingen sie an, ihre geheimnisvoll kehligen Schreie auszustoßen, die nah und mahnend bis in unsere Betten drangen. Insbesondere dem kleinen Michael waren sie unheimlich, und als Dieter und ich das herausfanden, bestärkten wir den Kleinen noch in seiner Furcht.
Unsere direkten Nachbarn, die Familie Simon, die im Dorf Hannese genannt wurde, gehörte zu den weniger wohlhabenden Bauern von Sabershausen. Der Vater war ein schweigsamer Mann, möglicherweise deshalb, weil er im Krieg einen Arm verloren hatte. Vermutlich hatte er in der Nachttischschublade sogar einen Orden liegen. Der fehlende Arm hielt den Simons-Opa aber nicht davon ab, ganze Berge von Brennholz zu spalten. Auf dem Kopf trug er die bei den Bauern übliche Schüppekapp. Den leeren Hemdsärmel hatte er bis zur Schulter hochgekrempelt, dass es aussah, als habe der alte Herr Simon den Arm eingerollt. Lange musste er sich mit der Behinderung nicht mehr plagen: Gegen Ende der fünfziger Jahre legte er sich eines Tages ins Bett und starb an den Folgen der Kriegsverletzung.
Stärker in Erinnerung geblieben sind mir seine Frau und die sieben Kinder. Ernst, der älteste Sohn zog ins Ruhrgebiet. Die beiden älteren Töchter heirateten und zogen Anfang der sechziger Jahre weg, Anneliese ein paar Dörfer weiter nach Lieg und Mechthild nach Leverkusen, wo ihr Mann einen Job in der Industrie gefunden hatte. Jupp, der jüngste Sohn der Simons, übernahm den Hof. Anita, die jüngste Tochter, half im Haushalt mit. Außerdem passte sie ein paar Jahre auf meine Brüder und mich auf, bis sie Mitte der Sechziger den Willi Weiler heiratete, einen älteren Bruder meines Klassenkameraden Hermann. Für uns Kinder war die Simons-Oma von allen Omas die präsenteste. Die Neurather Oma und die Oma in Simmern sahen wir nicht so oft.
Unsere Mutter freundete sich mit der alten Frau Simon an. Der Bauernhof lag in der direkten Nachbarschaft des Forsthauses, und wenn sie Zeit für ein Schwätzchen hatte, besuchte die Frau des Försters die Bäuerin in der Küche. Dann saß sie auf der hölzernen Bank am Fenster, rauchte Zigaretten und blickte von Zeit zu Zeit hinüber zum Forsthaus, wo derweil der Hund auf ihre Kinder aufpasste.
Simons Jupp war Bauer mit ganzer Seele. Ein Teil seiner Äcker grenzte an den Hof, die Wiese mit den Apfelbäumen lag an dem Weg, der zwischen dem Forsthaus und dem Simonshof verlief. Zum Pflügen schirrte der Jupp noch Kühe ein. Entweder konnte er sich noch keinen Traktor leisten, oder er liebte es ganz einfach, mit Kühen zu arbeiten. Im Herbst kaufte ihm mein Vater jedes Mal einen Sack Kartoffeln ab. Der Bauernhof war überhaupt ein wichtiger Nahrungslieferant für uns. Alle zwei Wochen, wenn die Oma Butter schlug – noch in Handarbeit – bekamen auch wir einen gesalzenen Klumpen. Das war die beste Butter, die ich je aufs Brot gestrichen habe.
Von dort bezogen wir auch die Milch, täglich zwei Liter, die einer von uns Brüdern in einer zerbeulten Blechkanne abholen musste. Dann steuerten wir den Kuhstall an, wo die Oma auf einem dreibeinigen Schemel saß, halb neben, halb unter der Kuh und mit kräftigem Strahl die Milch in den Eimer molk, der zwischen ihren Knien klemmte. Im Stall standen sechs Kühe, dazu meist zwei Kälbchen, unter der Decke nisteten Schwalben. Wenn ich den Stall betrat, stellte mir die Oma Fragen und verwickelte mich in ein Gespräch, so lange, bis das Euter leer war. Es roch nach den Ausdünstungen der Kühe und nach warmer Milch. Die Milch goss sie durch einen Filter, bevor sie sie in die verbeulte Blechkanne füllte. Den kurzen Weg zu unserem Haus lief ich, die Kanne am Mund, mich satt trinkend. Wenn die Mutter die Rahmspuren auf meinen Kinderbacken sah, küsste sie mich und stellte lächelnd die restliche Milch in den Kühlschrank.
Sehr gut in Erinnerung geblieben sind mir die Tage, an denen bei Simons ein Schwein geschlachtet wurde. Ich weiß noch, wie ich mich mit gemischten Gefühlen am Zaun unseres Vorgartens herumtrieb. Einerseits faszinierte es mich, dem Schlächter dabei zuzusehen, wie er dem laut um sein Leben flehenden Schwein den Garaus machte, andererseits fürchtete ich den Moment des Todes, wenn das getroffene Tier zu Boden sackte. In den ersten Kindesjahren konnte ich nicht hinsehen, später hielt ich mir die Ohren zu, um die Todesschreie nicht hören zu müssen.
Als erstes ließ der Metzger das Schwein ausbluten, wobei man das Blut in einer Schüssel auffing. Anschließend wurde es geschlagen, damit es nicht gerann. Dies diente als Rohstoff für die Blutwurst. Das leblose Schwein wurde dann in eine Molle gelegt, einen hölzernen Brühtrog, wo es mit kochendem Wasser übergossen wurde, was das Entfernen der Borsten erleichterte. Dann legte man der Sau zwei Stricke um die Hinterbeine, und man hängte sie an einer Leiter auf. Die in einem Bottich liegenden Gedärme dampften in der kalten Luft, und in der Kartoffelküche siedeten schon bald im Kessel die Würste.
Später gab es Wurstsuppe – auch für die Nachbarn, das war Brauch – und der Metzger füllte Blut- und Leberwurstmasse in den gereinigten Darm. In die Blase und den Magen kam der Schwartenmagen. Je nach Geschmack der Leute wurden noch Fleischwurst und Mettwürste hergestellt, Schinken gepökelt und Speckseiten geräuchert.