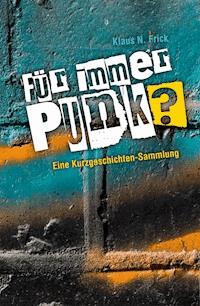6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Brutale Kämpfe, tödliche Intrigen und uralte Magie - Klaus N. Fricks düsteres Epos entführt den Leser in eine neue, faszinierende Dark Fantasy-Welt Das Imperium der Eskoher herrscht mit eiserner Hand über das Land Patloren. Als blutige Aufstände ausbrechen, wird der Bauernsohn Sardev in die Kämpfe verwickelt. Er gerät in Gefangenschaft – bei einem der letzten noch lebenden Zauberer. In einem Zeitalter, in dem sich die Magie ihrem Ende zuneigt, wird er zum Opfer eines grausamen magischen Experiments: Sardevs Geist wird mit dem eines Wolfes verschmolzen. Fortan soll er den Eskohern als menschliche Waffe dienen. Der Zauberer allerdings verfolgt ein Ziel, das nur sein eigenes Überleben vorsieht, und Sardev erweist sich als der Einzige, der ihn aufhalten kann. Düster, grimmig, actionreich - Sword & Sorcery für Fans epischer Fantasy
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 822
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Klaus N. Frick
Das blutende Land
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Imperium der Eskoher herrscht mit eiserner Hand über das Land Patloren. Als blutige Aufstände ausbrechen, wird der Bauernsohn Sardev in die Kämpfe verwickelt. Er gerät in Gefangenschaft – bei einem der letzten noch lebenden Zauberer. In einem Zeitalter, in dem sich die Magie ihrem Ende zuneigt, wird er zum Opfer eines grausamen magischen Experiments: Sardevs Geist wird mit dem eines Wolfes verschmolzen. Fortan soll er den Eskohern als menschliche Waffe dienen. Der Zauberer allerdings verfolgt ein Ziel, das nur sein eigenes Überleben vorsieht, und Sardev erweist sich als der Einzige, der ihn aufhalten kann.
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Epilog
Prolog
Die Gedärme des Schafs glitzerten im Licht der zwei Monde wie silbrige Würste, ineinander verschlungen und von einer Schicht aus getrocknetem Blut und Schleim bedeckt. Sardev starrte in die flache Senke hinunter, auf den Haufen aus totem Fleisch, Blut und Knochen, als habe er noch nie ein geschlachtetes Tier gesehen. Er sog den metallischen Geruch ein, der aus der Senke drang.
»Er muss ganz in der Nähe sein«, flüsterte sein Vater.
Sardev nickte. Er hätte keinen Ton herausbekommen, die Hände zitterten ihm immer wieder vor Anspannung
Auch wenn er kein weiteres Wort hörte, spürte Sardev seinen Vater rechts von sich, den vor Kraft und Energie strotzenden Körper, neben dem er sich so dünn fühlte. Er kauerte in derselben unbequemen Stellung zwischen Dornen und intensiv duftenden Luftwurzeln, deren Ausdünstungen den Geruch von Menschen unkenntlich machten. Beide hielten ihre Bogen in den Händen, genauso geschwärzt und mit Wurzelsud eingeschmiert wie ihre Gesichter.
Der Junge atmete flach und hielt seinen Puls niedrig. Nur ein ruhiger Jäger war ein guter Jäger, das hatten sein Vater und alle anderen Männer ihm tausendmal gesagt, und heute Nacht wollte er ein sehr guter Jäger sein. Trotz der warmen Luft spürte er die Gänsehaut auf den nackten Armen. Sein Gesicht juckte. Am liebsten hätte er sich gekratzt, aber er ignorierte das unangenehme Gefühl.
Im Wind stachen die Dornen der Salligenhecke neben ihm durch die Luft, als wollten sie ihn angreifen, zackige Reflexe am Rande seines Blickfelds. Fingerlang waren sie, jeder Dorn so spitz wie eine Nadel, und sie schimmerten im Licht wie Dolche. Immer fünf wuchsen in einer Gruppe, eine Hand aus Dornen, die sich im Ernstfall gleichzeitig in die Beute bohrten. Sardev achtete auf die Dornen der Salligen, auf ihre Bewegungen, auf ihr gleichmäßiges Atmen, das so harmlos wirkte und so todbringend war – wie gefährlich sie waren, lernte man als Kind bei den Freibauern schon sehr früh.
In der Ferne erklang ein Heulen, zuerst lang gezogen, dann abgehackt, und ein zweites Heulen fiel ein, weit entfernt. Es hörte sich an, als unterhielten sich Wölfe über die Hügel hinweg. Gespannt hielt Sardev den Atem an und kaute auf der Unterlippe, bis er die Antwort vernahm. Dieses Heulen kam von der anderen Seite der Senke, drang hinter einer Buschgruppe hervor, die vielleicht hundert Schritt von ihnen entfernt in die Höhe strebte. Ein lautes und wildes Geräusch, als ob der Wolf irgendwas besonders deutlich machen wollte.
Sardev sah seinen Vater an. Im Mondlicht waren die hageren Züge trotz der schwarzen Farbe gut zu erkennen, sie waren starr, dann verzogen sie sich zu der Andeutung eines Lächelns. »Es ist kein Geisterwolf«, flüsterte Corvis Örhun fast lautlos. »Geisterwölfe klingen anders, sie schreien vom Tod und von den Ahnen, und ihre Stimmen hallen lange zwischen den Hügeln.«
Sardev hätte den Unterschied nicht herausgehört, er wusste nur, dass es Geisterwölfe gab. In ihnen lebten die Verstorbenen weiter. Wie es hieß, waren es Menschen, die während ihres Lebens so viel an Leben und Genuss oder Hass und Gemeinheit in sich aufgesogen hatten, dass sie nach ihrem Tod nicht zu den Ahnen aufgingen, sondern einen Teil ihres Geists in einen neu geborenen Wolf entsandten. Wenn man einen solchen Wolf tötete, ging alles Gute des Toten auf den Jäger über – aber auch der Fluch, falls es einen solchen gegeben hatte. Corvis Örhun hatte es zeit seines Lebens vermieden, einen Geisterwolf zu töten, und Sardev wollte es ebenso halten.
In dieser Nacht ging es ihnen darum, einen ganz gewöhnlichen Wolf zu erledigen, einer von jenen, die fast jede Nacht ein Tier aus der Herde der Örhuns rissen. Die Wölfe des Steppenlands galten als eher harmlos und nicht so gefährlich wie die grauen Bestien, die das Kalkgebirge oder die Wälder im Süden unsicher machten. »Dafür sind die Biester schlau«, hatte Corvis Örhun vor dem Aufbruch gesagt. »Denen müssen wir eine Falle stellen.«
Wieder ertönte das Heulen in der Ferne, diesmal noch länger als vorher, wie ein Klagelied, das über die Hügel getragen wurde. Es schwang sich in die Höhe und waberte durch das weite Land. Sardev stellte sich vor, wie der Wolf – oder die Wölfin – auf einer Kuppe stand, die Silhouette von den zwei Monden beschienen, den Kopf in die Höhe gestreckt.
Er sah in die Richtung, aus der das Heulen drang. Für einen Augenblick flackerte ein Licht am Horizont auf. Ein blaues Leuchten zuckte hinter den dornigen Hecken entlang, flammte grell und jäh auf und ließ sie wie einen Hagel aus Pfeilen erscheinen, feine Zacken aus Schwärze, die sich in das Blau bohrten. Sardev schloss die Augen und presste die linke Faust gegen die Brust.
Corvis’ Hand legte sich auf seine Schulter und drückte zu. Es war eine kurze Berührung, aber lang genug, dass Sardev die aufmunternde Geste verstand. Erneut wechselte er einen Blick mit seinem Vater, und der nickte ihm mit ernstem Gesicht zu. Stumm formten seine Lippen einen Satz.
»Die alte Magie ist noch da«, las Sadev, »aber sie wird uns in dieser Nacht keinen Schaden zufügen.« Dann wies Corvis auf die andere Seite der Senke, ein Hinweis und gleichzeitig die Aufforderung, ganz still zu sein.
Zwischen dem Gestrüpp bewegte sich etwas. Das musste der Wolf sein, angelockt durch den Gestank nach Blut und zerfetztem Fleisch zwischen ihm und den Jägern. Sardev fieberte vor Erwartung, seine Finger umklammerten den Bogen noch fester. Er betrachtete die Dornen rechts und links, bevor er sich ein wenig zur Seite drehte. Wenn er schnell aus dem Gestrüpp springen musste, wollte er sich nicht in den Dornen verfangen.
Mit einer gleitenden Bewegung, so schnell, dass Sardev sie kaum mitbekam, huschte der Wolf aus dem Gebüsch und stand am Rand der Senke: grau und wuchtig, ein großes Tier, die helle Schnauze nach vorne gereckt und die Ohren aufmerksam gespitzt. Er sah aus, als traute er der leichten Beute zu seinen Füßen nicht, als wittere er bereits eine Falle. Er schnüffelte, und das Geräusch übertönte das sanfte Rauschen der Blätter und Zweige. Die Ohren bewegten sich ein wenig, das rechte Ohr war eingerissen und sah in der Dunkelheit aus wie ein grauer Fetzen, über den das Licht der Monde huschte.
Während er ruhig den Pfeil vom Boden aufhob, spürte Sardev, dass sein Vater das Gleiche tat. Beide legten die Pfeile ein, beide konzentrierten sich auf das Ziel, spannten den Bogen aber noch nicht. »Warte immer ab, wenn du schießen kannst«, hatte ihm sein Vater auf dem heimatlichen Hof eingebläut, »und schieß vor allem nicht zu früh. Jeder Wolf ist schlau, es sind gerissene Bestien, und mancher ist schlauer als jeder Mensch.«
Der Wind trieb den Geruch des Raubtiers zu ihnen herüber, eine Schärfe, die sich mit dem Gestank aus der Senke vermischte. Sardev glaubte, den Tod zu spüren, den der Wolf mit sich brachte, den Tod unzähliger Tiere und vielleicht sogar Menschen, die das graue Tier vor ihnen gerissen hatte. Das Maul des Wolfs stand offen, die Zunge hing seitlich heraus, im Mondlicht schimmerten die Zähne.
Langsam und mit sanften Bewegungen, als gelte es, bei einem Tanz eine gute Figur zu machen, näherte sich der Wolf der Beute. Sein Schweif schwang hin und her, dann hielt er inne. Der Kopf reckte sich in die Höhe, bevor das Tier mit der Schnauze am Boden entlangstreifte, schnüffelnd und hechelnd. Offenbar traute er der so harmlos aussehenden Beute nicht.
Ob er ahnt, dass wir da sind?, fragte sich Sardev. Riechen konnte der Wolf sie nicht, dafür sorgten der Sud und der Schutz der Luftwurzeln. Aber was konnten diese Bestien wirklich, wie spürten sie Gefahren? Niemand wusste es, und es gab zahllose Geschichten über Wölfe, die jeden Angriff vermieden.
Dann aber überwand der Wolf seine Abneigung: Mit zwei, drei Sätzen huschte er zu dem Schaf. Noch während er das Maul aufriss, um sich in dem toten Tier zu verbeißen, spannte Corvis Örhun seinen Bogen. Sardev folgte seinem Beispiel. Die beiden schossen gleichzeitig, und die Pfeile trafen den Wolf mit voller Wucht in die Seite.
Er heulte auf, ein schreckliches Geräusch, das nichts mehr gemein hatte mit dem Heulen von vorhin, und er taumelte schwer zur Seite, stürzte aber nicht. Die Pfeile ragten aus seiner Flanke wie riesige Stachel, Zeichen eines tödlichen Endes, er war getroffen, aber noch lange nicht gestürzt. Auf wackeligen Läufen stand er da, schüttelte den Kopf, als wollte er nicht glauben, was gerade geschehen war, und ließ ein unheilvolles Knurren vernehmen. Sein zerfetztes Ohr bewegte sich in der Luft, die Zunge hing ihm aus dem offenen Maul.
»Los jetzt!«, rief Corvis. Die beiden sprangen aus der Deckung, wie auf dem Hof geübt, jeder mit einem Spieß in der Hand. »Du von rechts, ich von links!« Die rechte Seite war die, in der die Pfeile steckten. Sardev begriff, dass sein Vater ihn auf diese Weise absichern wollte.
Corvis war als Erster bei dem Wolf, den Spieß stoßbereit, um ihm den Garaus zu machen. Das Tier schien noch einmal alle Kraft zusammenzuraffen und setzte zum Sprung an. Der Wolf war groß, doch wie riesig er tatsächlich war, sah Sardev jetzt erst: Mit beiden Vorderläufen erreichte das Tier die Schulter seines Vaters, das Maul aufgerissen, während ihm dieser den Spieß in den Leib rammte.
Nur einen Augenblick später war Sardev heran, und er dachte nicht nach, packte seinen Spieß und drückte die Schulter mit voller Wucht gegen die Flanke des Wolfs, eine Handbreit unter den Pfeilen, die im grauen Pelz steckten. Während der massige Körper ins Wanken geriet, stieß Sardev den Spieß in die Weichteile des Wolfs.
Mit einem gellenden Heulen brach das Tier zusammen, riss Sardev mit sich, der immer noch seinen Spieß umklammerte. Gemeinsam stürzten sie zur Seite, Sardevs Kopf knallte neben den Schafsgedärmen auf den Boden. Seine Wange glitschte durch Blut, der Gestank stieg ihm in die Nase. Er ließ den Spieß stecken, rollte sich zur Seite und griff nach dem Dolch an der Seite.
»Es ist vorbei«, hörte er die Stimme seines Vaters, und der Rausch, in dem er sich befunden hatte, verschwand, als hätte ihm jemand einen Schleier vom Gesicht gezogen. Jetzt musste Corvis nicht mehr flüstern. »Dieser Wolf wird keine Schafe und Rinder mehr töten.«
Mühsam drehte sich Sardev zur Seite, immer noch den Dolch in der Hand. Er sah das tote Schaf und daneben einen massigen Körper im grauen Pelz, dann wanderte sein Blick nach oben. Sein Vater stand neben ihm, schwer atmend, aber unverletzt, die breiten Schultern verdeckten die Monde wie eine Mauer. »Du lebst«, sagte Sardev. »Du …« Erst jetzt merkte er, dass er zitterte.
»Das habe ich nur dir zu verdanken.« Corvis Örhun legte seinem Sohn die Hand auf die Schulter, dann half er ihm beim Aufstehen. »Der Wolf ist tot, und wir leben – so muss es sein.« Er legte den Arm um Sardevs Schulter. »Sieh mal, er ist noch nicht ganz tot. Wir nehmen ihm die Ohren erst danach, zuerst muss er vollends sterben.«
Während Sardev den Dolch zurück in die Scheide steckte, blickte er auf den Wolf hinab. Noch im Liegen wirkte das Tier riesig, von den Hinterläufen bis zum Kopf viel größer als ein Mann, ein Ungetüm aus grauem Pelz, Muskeln und Knochen. Die Pfeile steckten im zitternden Körper, die mit Blut und Eiter verschmierten Spieße lagen daneben. Die Zunge hing heraus, aber sie vibrierte, und Dampf stieg von ihr auf. Wie lange es wohl dauerte, bis der Wolf starb? Sardev betrachtete das Auge, das wie ein schwarzes Oval wirkte, wie ein Tümpel in der Dunkelheit und nicht wie das Organ eines noch lebenden Wesens.
»Es war ein würdiger Gegner«, sagte Corvis ruhig. »Wir lassen ihm seine letzte Zeit, es kann nicht mehr lange dauern.«
Aus dem Augenwinkel nahm Sardev wahr, dass es am Horizont erneut zuckte. Blaues Licht flimmerte, diesmal nicht nur in der Breite, sondern auch in der Höhe, aber wieder waren es nur wenige Augenblicke. Sein Vater schien diesmal nichts bemerkt zu haben, also sagte Sardev kein Wort.
Corvis beugte sich vor. »Es ist vorbei«, sagte er und wies auf das offene Maul. »Unser Gegner ist tot.« Er ging in die Knie, das Messer bereits in der Hand. Sein Wams war an der Schulter zerrissen, aber er war unverletzt.
Der Wolfskörper schien sich mit einem Schimmer zu überziehen, die grauen Haare flimmerten in den Spitzen. Was zuvor ein schwarz glänzendes Auge gewesen war, zeigte einen blauen Funken, der in der Tiefe aufflammte und rasch wieder verschwand, als hätte nie auch nur ein Hauch Leben in dem Tier gewohnt.
»Es war … es ist …« Corvis sah seinen Sohn an. Die Narben auf seiner linken Wange zuckten im Mondlicht, er wirkte beunruhigt. »Wir haben einen Geisterwolf getötet, Sardev«, sagte er tonlos. »Das war kein gewöhnliches Tier. Und ich weiß noch nicht, was es bedeutet.«
Hinter ihm raschelte es im Gebüsch, Corvis wirbelte herum. Sardev griff erneut nach seinem Dolch, hielt dann aber inne. Ein weiterer Wolf stand am Rand der Senke, ziemlich genau an der Stelle, wo der andere zuvor aufgetaucht war. Die Silhouette des Tiers war schmal, und Sardev sah, dass es auf dem Kopf eine dunkle Verfärbung im Fell trug. Der Wolf wirkte ruhig, fast gelassen. Er schnupperte geräuschvoll, und seine Ohren bewegten sich.
Langsam, um das Tier nicht zu einer möglichen Attacke zu reizen, ging Corvis in die Hocke und griff nach dem Spieß. Sardev hatte das Gefühl, sich nicht rühren zu können. Der Blick des Wolfs war auf ihn gerichtet, und die schwarzen Augen schienen sein Gesicht zu fesseln. Sein Hals war trocken, sein Herz pochte aufgeregt, und als sich Corvis langsam wieder aus der Hocke erhob, den Spieß in der Hand, sah Sardev erleichtert, wie der Wolf ohne ein weiteres Geräusch verschwand.
Dann vernahm Sardev das Heulen aus dem Gestrüpp und wie es sich langsam entfernte, und er hörte die Antworten, die aus weiter Ferne kamen. Es klang, als trauere der Wolf um seinen getöteten Artgenossen, und dann merkte Sardev auf einmal, wie ihm kalt wurde. Seine Fingerspitzen fühlten sich an, als hätte er sie in einen Eimer mit Eis getaucht. Er begann zu zittern, Kälte kroch ihm über den Rücken, und er spürte den feuchten Schweiß im Gesicht.
»Ein anderer Wolf«, sagte Corvis andächtig. »Mit dem habe ich nicht gerechnet. Wahrscheinlich die Gefährtin. Wir haben Glück, dass sie gleich abgezogen ist. Das wäre sonst ein harter Kampf geworden.« Er sah seinen Sohn an. »Was ist mit dir? Frierst du?«
»Nur die Erleichterung«, log Sardev. »Es ist nichts, nur die Erleichterung nach dem Kampf. Ich bin froh, dass es vorüber ist.«
Sein Vater musterte ihn, sagte aber kein Wort. Stumm ging er in die Knie und betastete den Kopf des toten Wolfs, griff mit den Fingern nach den Ohren. Sardev merkte, dass sein Vater ahnte, dass er ihn anlog. Und er wusste darüber hinaus, dass er auf einmal Angst hatte, Angst vor etwas, das er nicht erspüren konnte, von dem er aber glaubte, dass es irgendwo hinter den Hügeln auf ihn lauerte, in einer zottig-grauen Gestalt, die auf vier Pfoten lief und jetzt vor Verzweiflung und Wut die Monde anheulte.
1
Mit einem Ruck stieß Shorrn Mekeis das Schilfblatt zur Seite. Krachend schlug die Tür gegen die Wand, schwungvoll trat er ein, die Hand am Dolch. »Wo ist Kerron?«, rief er in den Raum, noch bevor sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten. »Wo ist dieser besoffene Kerl?«
An einem schlichten Tisch saßen ein Mann und eine Frau. Sie sahen ihn an, vor Schreck erstarrt. Die Frau, schon grauhaarig und gebeugt, hielt ein Stück Leder und eine Ahle in den Händen, der Mann zog gerade ein Lederstück über eine Schneidefläche. Es roch nach gegerbten Tierhäuten, Fell und scharfem Alkohol, durch eine Lücke in der Mauer hinter den beiden fiel Tageslicht in den Raum.
»Wir wissen nicht …«, begann die Frau, hielt aber inne. »Wer bist du?«
»Sein Vorgesetzter«, gab Shorrn barsch zurück. »Und ich suche ihn, weil er nicht zu seinem Dienst erschienen ist.«
»Aber wir wissen nicht …«
»Das weiß ich schon!«, unterbrach Shorrn. »Aber mit dir red’ ich nicht, Alte! Dein Mann weiß hoffentlich mehr.« Er trat einen Schritt näher an den Tisch heran und blickte auf den Handwerker hinunter, einen Kerl, dem man ansah, dass er vor Jahren noch unglaublich stark gewesen war. Dicke Büschel schwarzer Haare wuchsen auf seinen nackten Schultern und dem Rücken.
Er knurrte Shorrn an. »Bin ich die Magd, die auf Kerron aufpassen muss?«
»Das nicht. Aber dein verschlafener kleiner Bruder besucht nun mal gern dich, wenn er hier ist.« Shorrn stieß den Mann mit der Faust gegen den Oberarm. »Na sag schon: Wo ist er?«
»Ich weiß es wirklich nicht«, sagte der Mann, und seine Stimme klang müde. »Er war hier, aber das ist schon einen halben Tag her. Am frühen Morgen bereits, und …« Er unterbrach sich, als überlegte er, was er sagen sollte. »Er hat früh angefangen zu trinken, und dann ist er gegangen.« Er wies auf seine Arbeit. »Wir haben die Hütte seitdem nicht mehr verlassen.«
»Nur zum Essen und …« Die Frau unterbrach sich selbst. »Du weißt, was ich meine«, fügte sie leise hinzu.
»Ja ja.« Shorrn war wütend und hätte am liebsten auf die beiden eingeprügelt. Aber er wusste, es würde nichts nützen. Seine Männer hatten am frühen Morgen ihren Sold erhalten, und nach der Freizeit war einer von ihnen nicht zurückgekommen. »Ich fürchte, ich weiß, wo er ist.« Er fluchte und machte kehrt.
In der Tür wandte er sich noch einmal um. »Falls er bei euch auftaucht, sagt ihm, Shorrn Mekeis sucht ihn.« Er spuckte auf die Gasse hinaus. »Er soll seinen Dienst sofort antreten, sonst prügle ich ihn windelweich oder werfe ihn gleich in den Fluss.«
Verärgert trat Shorrn in den Dreck hinaus, der als dünne Schicht aus getrocknetem Schlamm, Unrat und Fäkalien die schmale Gasse bedeckte. Es roch nach Fisch und Kot, nach Erbrochenem und billigem Fusel. Zwischen den Steinen, aus denen die einfachen Hütten errichtet waren, drangen der Geruch und die Wärme hervor, dazu Stimmen sowie Koch- oder Arbeitsgeräusche. Shorrn ging angespannt, die Hand am Dolch und zur Abwehr gegen einen möglichen Angriff bereit. Schandufer bot den unterschiedlichsten Menschen Unterschlupf. Nicht mit allen kam er gut aus, und nicht jeder mochte es, wenn ein Raureiter in der kleinen Siedlung unterwegs war.
Aus einigen Hütten ertönte gedämpftes Stöhnen und Keuchen, in ihnen waren billige Nutten den Burschen aus den umliegenden Dörfern zu Diensten. Shorrn hielt vor jeder Tür an und lauschte kurz, bevor er weiterging. Er hatte keine Lust, jede Hütte zu durchstöbern, und hoffte darauf, durch Lauschen schnell ans Ziel zu kommen.
Zwischen zwei Hütten stand ein vierschrötiger Mann trotz der Hitze in einer Pelzjacke und urinierte in einen halb vollen Holzeimer. Als er Shorrns breitschultrige Gestalt sah, hielt er inne, die Hand an der Hose, als wollte er den gelben Strahl abpressen. Der Ausdruck in seinem groben Gesicht, zur Hälfte von einem wilden Bart überwuchert, war der eines Mannes, den man bei einer Untat ertappt hatte.
»Kannst ruhig weitermachen«, sagte Shorrn und winkte ab. »Was du tust, ist mir heute gleichgültig.« Er kannte den Mann vom Sehen, hatte mit ihm schon einmal Schwierigkeiten gehabt, seinen Namen aber längst vergessen: ein rauflustiger Trunkenbold, einer der Knechte vom nahegelegenen Freibauernhof.
Hinter ihm atmete der Mann erleichtert aus, dann plätscherte es erneut in den Holzeimer. Später würde einer der Träger kommen, die regelmäßig durch die Gassen eilten, und den Eimer in den Fluss entleeren.
Am Ende der Gasse hielt Shorrn erneut an. Statt des üblichen Stöhnens kamen aus dieser Hütte unterdrückte Schmerzenslaute, dazwischen Geräusche, die sich anhörten, als schlage jemand mit der flachen Hand auf nackte Haut. »Mach schon, du Schlampe!«, schnauzte ein Mann, dann schrie eine Frau auf.
Shorrn betrachtete die Tür: schlecht zurechtgeschnittene Schilfblätter, die mit Tauen verbunden und mittels allerlei Fetzen befestigt waren, ohne Riegel, sondern nur mithilfe eines Tuchs verschlossen. Er trat gegen das Schilf, die Tür knallte nach innen, er sprang hinterher.
Ein Augenblick genügte ihm, um die Szene im Halbdunkel zu erfassen. Auf dem Lager aus Stroh und Säcken, das die Hälfte des Raums einnahm, lag eine Frau auf dem Bauch und starrte ihm entgegen, den Rock hochgeschoben, die Augen weit aufgerissen vor Schreck und Schmerz. Verschwitzte Haare hingen ihr ins Gesicht, ein feiner Blutfaden rann ihr aus der Nase. Über ihren Rücken beugte sich ein Mann, dürr und halb nackt, nur noch mit einem Wams bekleidet und die Hose bis zu den Knöcheln heruntergelassen.
»Du bist ein Stück Dreck, Kerron!«, schnauzte Shorrn, ohne Zeit mit Begrüßungen zu verschwenden. »Du verlässt deinen Dienst, ohne um Erlaubnis zu fragen – und dann das da!« Er wies auf das Gesicht der Frau. »Ein Raureiter, der eine Hure prügelt, ist bald kein Raureiter mehr. Raus hier!«
Der Mann richtete sich auf und grinste Shorrn an. Sein Gesicht glänzte, die Nase stach rot hervor. »Ich will nur ein wenig Spaß haben«, sagte er, und seine Stimme verriet, wie betrunken er war. »Das verstehst du doch sicher.«
»Ich verstehe gar nichts.« Mit zwei Schritten überwand Shorrn die Distanz zu dem Mann und packte ihn am Kragen seines Wamses. »Ich will nicht wissen, was du unter Spaß verstehst. Raus mit dir, ab ans Ufer!« Er zerrte Kerron mit sich, weg von der Frau, die sich stöhnend zur Seite wälzte, und schüttelte ihn.
Kerron griff mit der einen Hand nach unten, als wollte er seine Hose hochziehen, und versuchte mit der anderen, Shorrn abzuschütteln. »Lass mich!«, keuchte er. Sein Atem stank nach Fusel. »Ich will doch nur …«
»Es reicht.« Shorrn hielt den Betrunkenen weiterhin mit einer Hand fest, die andere knallte er ihm mit voller Kraft ins Gesicht. »Raus mit dir, du Stück Dreck!«
Kerrons Kopf wurde unter der Wucht des Schlags zur Seite geschleudert, ein zweiter Hieb folgte. Der Betrunkene wollte sich mit beiden Händen wehren, schaffte es aber nicht, hilflos tastete er durch die Luft. Zwei Faustschläge trafen seinen Bauch, er kippte nach vorne. Shorrns Fäuste krachten in den Nacken, und Kerron stürzte zu Boden. Zwei Tritte in den Bauch folgten, der Betrunkene blieb liegen.
Schwer atmend blickte Shorrn Mekeis auf ihn hinunter. »War das nötig?«, murmelte er. »Schwachkopf.«
Ohne sich um die Frau zu kümmern, packte er den Liegenden an den Armen und hob ihn an. Kerron war ein dürrer Kerl, lang und knochig, mit wenig Muskeln und noch weniger Fett, aber jetzt erwies es sich als schwer, ihn einige Schritte zu schleppen. Shorrn zerrte ihn über den Boden und aus der Hütte, wo er ihn in den Dreck fallen ließ. Die Hose hing immer noch an den Knöcheln, der haarige Unterleib sah aus wie ein Haufen Filz und Wolle. Vom Lager der Frau holte Shorrn Kerrons Jacke und legte sie so auf ihn, dass seine Blöße bedeckt war.
Neben dem Bett lagen Kerrons Waffengurt und sein Dolch, er hob beides auf. »Der tut dir jetzt nichts mehr«, sagte er zu der Frau. »Lass ihn draußen liegen und wieder zu sich kommen. Ich lasse ihn holen, sobald ich bei meinen Männern bin.« Er zeigte auf die Waffen. »Die nehme ich mit. Wenn er danach fragt, sag ihm, dass ich sie habe. Ich bin Shorrn Mekeis, Gruppenführer der Raureiter.«
»Ich weiß, wer du bist«, sagte sie mit brüchiger Stimme. Sie zog ihr zerrissenes Oberteil zusammen und wischte sich mit dem Handrücken das Blut aus dem Gesicht. »Danke für deine Hilfe.«
»Es ist trotzdem einer meiner Leute, verstanden?« Shorrn wies auf den Liegenden. »Ich sehe jetzt nicht, was er bei sich trägt – aber du auch nicht. Dem Mann fehlt nachher nichts. Niemand von deinesgleichen wird ihm etwas stehlen, verstanden?«
»Ja, Herr. Ich bin eine ehrliche Hure.« Sie schob sich die verschwitzten Haarsträhnen aus dem schmutzigen Gesicht.
Shorrn schätzte, dass die Frau vielleicht dreißig Jahre alt war, aber sie wirkte älter.
»Ich danke dir noch mal.«
»Wie heißt du?«
»Jamile«, sagte sie. »Jamile aus Vastoris. Ich danke dir ein weiteres Mal, Herr.«
»Schon gut. Aus dem Süden also.« Shorrn band sich Kerrons Waffengurt um. »Pass gut auf dich auf, Jamile, vor allem, wenn Kerron wiederkommt. Aber wahrscheinlich wird er morgen früh vergessen haben, bei welcher Hure er war.«
Sie versuchte zu lächeln. »Herr, kann ich dir zu Diensten sein? Ich bin nicht nur ehrlich, ich bin auch eine gute Hure.« Über das zerwühlte Lager kroch sie auf ihn zu, streckte die Hand nach ihm aus. »Ich habe gelernt, wie man die Männer glücklich macht, und ich …«
»Lass deine dreckigen Finger von mir!«, schnauzte Shorrn. »Du kannst froh sein, dass ich dir nicht ein paar Schläge verpasse. Du hast einen meiner Männer verführt, du bist mit schuld daran, dass er dir Gewalt antat.« Er spuckte aus. »Wäre er nicht seinem Dienst fern geblieben, wäre mir gleich, was Kerron mit dir macht. Solange er dich nicht umbringt, versteht sich.« Er drehte sich um, ohne Jamile ein weiteres Mal anzusehen.
Zwischen den Hütten blieb er stehen. Noch einmal blickte er auf Kerron hinunter. Er kannte den Mann seit zwei Jahren, und eigentlich hielt er ihn für einen ordentlichen Raureiter. Nur wenn er zu viel Schnaps getrunken hatte, vorzugsweise aus den süßen Steppenfrüchten gewonnen, wurde Kerron gefährlich, prügelte sich sogar mit seinen besten Freunden oder vergriff sich eben an einer Hure.
Vom Ende der Gasse kamen zwei Männer auf ihn zu. Shorrn winkte sie zu sich.
»Tjammis, Nakheen!«, befahl er. »Kommt her – ich hab’ ihn schon gefunden. Kümmert euch um Kerron.« Er wies auf den Mann, der vor ihm im Dreck lag. »Bringt ihn ins Lager und schmeißt ihn auf seine Bettstatt. Wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat, werde ich mit ihm reden. Jetzt ist das zwecklos.« Er sah die zwei Raureiter scharf an. »Sorgt dafür, dass er auf seinem Bett bleibt. Er soll noch nicht wieder ins Dorf, vorher bekommt er von mir seine Strafe.«
Die beiden jungen Männer, beide noch keine zwanzig, grinsten und murmelten einige bestätigende Worte. Sie packten den Liegenden an Armen und Beinen.
»Und du?«, fragte Tjammis, ein schmächtiger Kerl mit ungewöhnlich heller Haut, der zwischen anderen Patloreniern stets auffiel. »Kommst du gleich nach?«
Shorrn schüttelte den Kopf. »Dass ich Kerron gesucht habe, war eigentlich nicht mein Ziel«, sagte er. »Eigentlich wollte ich zur alten Harghilye. Die betrügt die Leute, hat man mir gesagt.«
Harghilye war eine alteingesessene Kräuterhexe, das wusste Shorrn, der nicht zum ersten Mal in Schandufer war. Besucht hatte er sie noch nie, gesehen ebenso wenig. Aber es mangelte nicht an Gerüchten und Geschichten über sie. Die Handwerker und Huren im Schandufer mochten die Kräuterhexe nicht, aber manchmal hatte er den Eindruck, dass sie dennoch heimlich stolz darauf waren, eine bei sich zu haben.
Das Dorf selbst bestand aus einigen Dutzend Hütten, die sich zwischen den Schilfwäldern entlang des Ufers verteilten. Harghilye hauste am Ende des Dorfs, an einer Stelle, die weit von den anderen Hütten entfernt lag. Schmale Seitenarme des Flusses schlängelten sich durch die Ebene, und teilweise war nicht zu erkennen, wo Wasser und Land ineinander übergingen.
Der Weg führte über eine trockene Fläche, die rechts und links von Seitenarmen gesäumt wurde, aus denen hohes Schilf wuchs. An manchen Stellen wucherten die Pflanzen so in den Pfad hinein, dass Shorrn sie aus dem Weg räumen musste. Er zog sein Messer und schlug einige besonders weit vorstehende Blätter ab oder zerhackte sie gleich. Es war anstrengend. Die dicken Blätter ließen sich von seinen Hieben nicht leicht zerteilen. Manchmal war es einfacher für ihn, sich einfach zu ducken und dem Schilf auszuweichen.
»Wie schafft die Alte es bloß, den Weg freizuhalten?«, überlegte er halblaut. Der Pflanzenwuchs war so stark, dass die Kräuterhexe es auf keinen Fall allein schaffen konnte, täglich die Blätter und Triebe zu beseitigen. Er hielt an und blickte auf den Weg hinunter. Flache Steine lagen auf dem festgestampften Boden, einer nach dem anderen, und gaben festen Tritt. Keinen Schritt davon entfernt schimmerte das stehende Wasser. Kleine Insekten schwirrten über der ölig wirkenden Flüssigkeit, die an dieser Stelle streng roch.
Shorrn zog die Nase hoch – das hier war kein gewöhnliches Wasser, aber er konnte den Geruch nicht zuordnen. Er hielt den Zeigefinger der rechten Hand an einer sandigen Stelle in den Fluss, zog ihn wieder heraus und rieb die Fingerkuppe am Daumen. Schmierig fühlte sich das an, wie eine der Tinkturen, mit denen sich Frauen einschmierten. Shorrn überlegte kurz, ob er den Finger in den Mund stecken und von der seltsamen Flüssigkeit probieren sollte, ließ es aber sein.
Nachdenklich erhob er sich wieder und rieb die Hand an der weiten Leinenhose ab. Die Alte kippte wahrscheinlich einen Trunk ins Wasser, den sie selbst gebraut hatte, irgendwelche Kräuter und Früchte, deren Wirkung nur sie kannte und die sie so lange kochte und zubereitete, bis sie die gewünschte Wirkung hatten. »Schlau«, murmelte er, »du kannst doch was, Harghilye.«
Der Weg machte eine leichte Biegung, dann hatte Shorrn sein Ziel erreicht. Die Hütte der Kräuterhexe stand auf einem winzigen Hügel, der sich gut zwei Schritte über dem umliegenden Land erhob. Selbst wenn der Fluss über die Ufer trat und das Dorf überspült wurde, blieb die Hütte lange trocken. Sie war aus Holz errichtet, nicht aus Steinen wie die Gebäude im Dorf, oder aus getrocknetem Lehm wie viele schlichte Hütten im Umland, und sie stand auf Pfählen. Wer wollte, konnte sich auf allen vieren unter dem Haus bewegen.
Davor saß eine alte Frau in einem Umhang, der aussah, als hätte ihn jemand aus Dutzenden von Rattenfellen zusammengenäht, eine Fleckenmischung in zahlreichen Farbtönungen. Ein breitkrempiger Hut bedeckte ihren Kopf, darunter hingen lange graue Haare auf ihre Schultern herunter. Vor ihr glühte Holzkohle in einem Ring aus Steinen, darüber hing ein Topf an einem Eisengestänge. Weißer Dampf stieg von dem Topf auf, der immer wieder hellblaue Schattierungen aufwies.
»Du hast lange gebraucht, um zu mir zu kommen«, sagte die alte Frau, ohne aufzublicken. Mit einem Ast rührte sie in dem Topf. »Was führt dich an diesem sonnigen Tag zu mir? Suchst du Rat, oder benötigst du einen Liebeszauber?«
»Bist du Harghilye?«, fragte er schroff. »Ich muss dich befragen.«
»Welche Fragen könntest du mir schon stellen, Raureiter?« Ihre Stimme klang nicht alt: Weder krächzte die alte Frau, noch kamen die Wort brüchig über ihre Lippen. »Geht es um deine Zukunft?«
»Woher weißt du, dass ich Raureiter bin?«
»Ich weiß mehr, als du denkst, Shorrn Mekeis.« Die Alte blickte auf. Ihr Gesicht war grau, tiefe Falten hatten sich in die Haut gegraben, aber die Augen waren ungewöhnlich hell und schienen das Licht der Sonne widerzuspiegeln. »Ich verlasse mein Heim nur selten, aber die Menschen kommen zu mir und tragen mir ihr Wissen zu. Und ich spreche mit den Winden, lausche den Geistern der Ahnen und ahne, was die Pflanzen und die Fische fühlen.«
Shorrn lachte. »Du bist eine elende Schwätzerin, Harghilye«, spottete er, obwohl er spürte, dass die Alte genau wusste, was sie von sich gab. »Die Leute sagen, dass du sie betrügst, dass du ihnen Kräutersud verkaufst, der keine Wirkung hat und …« Er wies auf den Qualm, der aus dem Topf aufstieg. »Sie sagen, dass du versuchst, von der alten Magie zu zehren, obwohl diese schon lange vergangen ist.«
»Was die Leute so sagen …« Harghilye verfiel in einen gedehnten Singsang und beugte sich über den Topf. Dabei rührte sie langsam. »Sie haben Angst vor mir, und doch kommen sie und fragen um Rat. Sie verbreiten Gerüchte über mich und wollen Übles, aber sie reisen aus vielen Dörfern zu mir und wollen Hilfe. Was meinst du, Raureiter, was ich hier mache? Glaubst du an die alte Magie?«
»Ich glaube nicht daran«, sagte er barsch. »Das Land war früher voller Magie, aber das ist lange her.«
»Und was ist das?« Vorsichtig hob sie den Stock aus dem Topf und hielt ihn in die Höhe. Verkochte Pflanzenreste hingen daran, feine Triebe vom Schilf, dazu faserige Abschnitte, die wohl von Arbeitern aus den großen Blättern geschnitten worden waren. Einige Fasern schimmerten in einem hellen Blau. »Was sagst du, wenn du das siehst?«
»Lass das!« Shorrn trat einen Schritt auf sie zu. Jetzt stand er am Feuer. Ein Tritt, und er könnte alles zerstören. »Du weißt, dass es gefährlich ist, mit den alten Dingen zu spielen. Du sollst das nicht tun!«
»Es ist nicht verboten.« Die Alte lachte und ließ die Pflanzen wieder in den Topf fallen. Wasser brodelte, Dampf stieg in die Höhe. »Oder willst du mich mit deinem Messer daran hindern, hier eine schöne Suppe zu kochen?«
»Unfug! Ich bin hier, weil ich dich warnen will. Die Dorfbewohner sind …«
Die Kräuterhexe zeigte keinen Respekt vor ihm. »Wieso hast du dein Schwert nicht dabei?«, fragte sie und lachte. »Mit deinem Messer machst du mir keine Angst, noch weniger mit einem Dolch.«
»Ich ziehe nicht in den Krieg. Mein Schwert ist im Lager, wo es hingehört, dort sind auch mein Helm und meine Rüstung.« Shorrn räusperte sich. »Aber jetzt zu dir. Magie ist nicht verboten, das wissen alle, aber sie wird nicht gern gesehen. Wenn du irgendwelche Kräuter aufkochst und Frauen bei der Geburt hilfst, dann ist das …«
»Shorrn, du bist ein guter Kerl.« Die Kräuterhexe sah ihn an. »Du kannst viel für deine Heimat tun, für dein Land und seine Bewohner. Aber du steckst voller Zorn und Wut. Du musst diese Gefühle lenken, musst dir Ziele setzen, du musst sehen, wo du in diesem Leben bleibst und was du tun kannst, um erfolgreich zu werden.«
»Ich bin Raureiter und du eine Kräuterhexe. Was willst du mir schon sagen?«
»Ich weiß genug. Ich koche das Blauschilf, wenn ich ihn bekomme, und das ist selten. Ich trinke davon, ich rieche daran, und ich sehe die wenigen Zeichen, die in meinen Augen entstehen, grelle Bilder mit Blut und Tod, mit brennenden Häusern und toten Männern, die durch die Straßen wanken. Das Land wird bluten – und wie es bluten wird!« Harghilye verfiel wieder in ihren Singsang, blickte auf den Topf hinunter und rührte mit dem Ast darin. »Du kannst es verhindern, Shorrn, denn das Grauen greift nach Patloren. Nur wenig trennt das Land von der uralten Magie darunter. Unheimliche Kräfte schlummern unter dem Land und in den Alten Bergen, und ich …« Sie brach ab und atmete schwer. »Pass auf, Shorrn«, flüsterte sie plötzlich. »Pass auf dich auf und auf unser Land.«
»Das ist alles Unfug! Das alles sagst du nur, weil du von dir ablenken willst.« Er beugte sich nach vorne. »Die Leute beschweren sich über dich. Ich will nicht wissen, was du genau tust, aber ich will nicht, dass du für Unruhe in den Dörfern am Fluss sorgst. Du bist eine Kräuterhexe, und wenn du das tust, was für deinesgleichen in Ordnung ist, bekommen wir keine Schwierigkeiten.«
Sie lächelte ihn an, zwei Reihen schwarz verfärbter Zähne. »Vielleicht musst du weniger reden und mehr fühlen«, sagte sie und wedelte mit beiden Händen durch den Dampf, der wieder bläulich schimmerte. »Das könnte dir helfen, mehr zu erkennen als bisher.«
Shorrn riss den Kopf zurück, konnte aber nicht verhindern, dass der Dampf sein Gesicht erreichte und er einen kräftigen Zug nahm. Es roch süßlich, nicht im Geringsten so, wie Schilf normalerweise roch und schmeckte, wenn man ihn kochte, und schon gar nicht nach dem Schnaps, den manche Brenner aus den Pflanzen herstellten. »Was soll …?«, fing er wütend an, brach aber ab.
Ohne dass er etwas tat, weitete sich Shorrns Blickfeld. Er sah über die Kräuterhexe hinweg, folgte einem Windhauch, der unter dem Haus hindurchpfiff, wurde von diesem hinaus in den Wald aus Schilf und struppigen Hecken geleitet und erreichte dann den Fluss. Wie ein Spiegel aus geschliffenem Metall lag der träge Han vor ihm, eine Wasserfläche, die in der Sonne glitzerte und blinkte, darüber einige Reiher, die nach Beute Ausschau hielten. Die Luft verfärbte sich, der blaue Himmel stürzte auf ihn herab, eine Welle aus Wolken erbrach sich über das Land, und Shorrn fühlte, wie er in dieser Welle verwirbelt wurde, wie er die Orientierung verlor und auf einmal in ein grauenerregendes Durcheinander blickte.
Blitzende Schwerter, hochflackernde Flammen, spritzendes Blut, ein Mann mit blauen Farben im Gesicht, tanzende Kräuterfrauen und immer wieder Blut, das wie ein Rinnsal über den Boden lief und immer breiter wurde, bis es ein Strom war, der sich in den Han ergoss und den trägen Fluss in einen wild gurgelnden Strom verwandelte, voller Trümmer, toter Tiere und Baumstämme. Männer ritten durch den Nebel, der vom Strom aufstieg, die Gesichter bleich vom jahrhundertelangen Schlaf, die Körper ausgezehrt und die Kleidung halb zerfallen, aber mit blitzenden Klingen und in schweren Rüstungen.
Und Shorrn sah sich jetzt auch selbst, ein einzelner Mann in der schlichten Rüstung eines Raureiters, mit einem Helm aus Leder und Eisenstücken, einsam auf einem braunen Streitross, der sich einer träumenden Stadt näherte, deren Türme sich in den Himmel reckten. Er sah Schwärme von Pfeilen, er sah heranstürmende Krieger, er sah monströse Tiere, auf denen Männer ritten, und er …
Mit einem Ruck kehrte er in die wirkliche Welt zurück. Vor ihm saß Harghilye. Sie blickte auf den Topf, als sei nichts geschehen, und rührte weiter. Alles machte den Eindruck, als habe sich nichts verändert, aber Shorrn spürte in sich die Angst nachwirken, die er empfunden hatte.
»Was … was war das?«, fragte er. »Was hast du mit mir gemacht, du Hexe?«
»Das warst alles nur du selbst, Raureiter. Der Dampf ist nicht von mir, er kommt aus dem Schilf, und er weckt nur das, was in dir steckt, tief in dir drin.« Die Kräuterhexe lachte leise, und jetzt klang ihre Stimme doch alt und gebrechlich. »Es war eine Vision, und man kann solche Visionen bekommen, wenn man diesen Dampf einatmet. Mach daraus, was du möchtest und kannst.«
»Verfluchte Hexe!« Shorrn keuchte vor Wut und Anstrengung. Er schüttelte den Kopf, versuchte so, den Druck abzumildern, den er auf seinen Gedanken spürte. »Jetzt verstehe ich, warum die Leute Angst vor dir haben.«
Fast fluchtartig wandte er sich zum Gehen, ohne ein Wort des Abschieds. Seine Kehle brannte, als habe er seit Tagen nichts mehr getrunken. Es wurde Zeit, dass er zum Lager zurückkam und nach seinen Männern sah.
2
Wenn Nesh-Tilan die Augen schloss, erwartete er für einige Zeit, sich zurück in die Heimat träumen zu können, zurück zu dem Haus am Hang, zu den Gärten voll duftender Pflanzen, über denen die Bienen tanzten und summten, zu den geistvollen Gesprächen im Empfangssaal und den Begegnungen mit den wunderbaren Frauen, die in den Gärten der Akademie lustwandelten. Doch es nutzte alles nicht: Selbst wenn er die Augen zukniff, blieb er auf dem Schiff und reiste sanft schaukelnd in die Einöde und die Langeweile, unter dem Sonnendach, das ihm zwar Schatten spendete, ihn aber nicht von der Außenwelt abschottete.
Auch mit geschlossenen Augen roch er den Schweiß ungewaschener Männer, der bei wechselndem Wind immer wieder vom Ufer des Flusses zu ihm herüberwehte, hörte er das Fluchen der Vorarbeiter und das unterdrückte Stöhnen der Treidelknechte, die ihre Füße in die staubige Erde stemmten und an langen Seilen zogen, spürte er vor allem die sengend heiße Luft, die ihm den Schweiß aus den Poren trieb. Nesh-Tilan bettete sich ein wenig bequemer in den Kissen, die man ihm bereitgelegt hatte, und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Sein Gesicht richtete er nach oben, wo er die Sonne und vor allem das gespannte Tuch wusste. Wenn er die Augen zusammenkniff, huschten Lichtfunken über die Innenseite seiner Lider, eine Kette von Blitzen, in denen er eine Botschaft zu erkennen glaubte.
Wie schön wäre das Leben, wenn er zu Hause wäre und sich dort auf seine Laufbahn vorbereiten könnte! Eine Laufbahn mit Herausforderungen, mit Erfolgen und Belobigungen, ein unaufhörlicher gesellschaftlicher Aufstieg. Ein behagliches Leben im Kreis gebildeter und strebsamer Menschen, die gemeinsam mit ihm die Inselwelt nach den Vorstellungen des Hohen Rats gestalten würden. Eine Familie, die ihn unterstützte und förderte und der er in einigen Jahrzehnten all das zurückgeben konnte, was er erhalten hatte.
Aber ich bin nicht in Eskoh, ich weile nicht im Zentrum der Macht, schlich sich der träge Gedanke in Nesh-Tilans Bewusstsein, sondern reise in diesen verlassenen Landstrich, in dem es nur Bauern und stinkende Knechte gibt. Warum hatte er sich nicht massiv genug gegen die seltsame Beförderung, diese unendlich erscheinende Reise und ihre zahlreichen Zumutungen ausgesprochen?
»Herr, wir sind bald da«, drang die Stimme an sein Ohr, die er mittlerweile fast mehr hasste als dieses Land und sein Ziel. »Bald werdet Ihr das Schiff hinter Euch lassen und auf dem Landweg weiterreisen. Euer Ziel ist Eure künftige Aufgabe. Und ich werde Euch ebenfalls verlassen.«
»Stör mich nicht, Zarg-Nolesa«, gab Nesh-Tilan patzig zurück, »du siehst doch, dass ich in Gedanken bin.«
»Das sehe ich, Herr, und normalerweise würde ich Eure Gedankengänge nicht zu unterbrechen wagen. Das wisst Ihr genau.« Die Stimme der Beraterin klang unterwürfig und höflich, in einer so auffällig zurückhaltenden Art, dass Nesh-Tilan schon immer vermutete, dass sie in Wirklichkeit eine einzige Abfolge von Beleidigungen enthielt.
Er schlug die Augen auf und schloss sie gleich wieder. Trotz des Sonnendachs empfand er die Helligkeit als viel zu intensiv. Das beigefarbene Dach über Nesh-Tilan bewegte sich sanft, ebenso wie die Reling, die rechts von ihm aufragte. Er neigte den Kopf, und dann sah er seine Beraterin, die in voller Größe vor ihm stand.
Zarg-Nolesa trug bereits leichte Reitkleidung, die ihre schmale Silhouette noch schlanker und höher erscheinen ließ: Stiefel, eine weite Hose, ein helles Wams, darüber ein ebenfalls heller Umhang, den sie während der Reise notfalls über den Kopf ziehen konnte. Sie wirkte wenig weiblich, weder durch ihre Kleidung noch aufgrund ihrer Erscheinung. Über ihr gebräuntes Gesicht, aus dem die spitze Nase herausragte, als wollte sie mit ihr Löcher in die Luft stochern, huschte die Andeutung eines höflichen Lächelns.
»Wir erreichen bald die Ankerstelle, Herr«, sagte sie. »Dort werde ich von Bord gehen und meinem Auftrag folgen. Ihr seht an diesem Platz erstmals Eure künftigen Untertanen. Euer Auftritt sollte würdevoll sein und dem Volk zeigen, wie bedeutend Ihr seid.«
»Das wird er.« Nesh-Tilan hob den Kopf vom Kissen. Wollte die junge Beraterin damit sagen, dass er gelegentlich nicht würdevoll und eindrucksvoll genug auftrat? Musste er sie dafür gleich bestrafen? Tadelte sie ihn für sein Verhalten gegenüber seiner Sklavin? Er entschloss sich, dem Unterton keine Beachtung zu schenken und sich lieber auf die Tatsachen zu beschränken. »Aber ich erlaube mir, dich zu korrigieren. Die Menschen hier in Patloren sind keine Untertanen. Der Hohe Rat von Eskoh verwaltet sie und ihr Schicksal, und ich bin der statthaltende Verwalter, mehr nicht.«
Jetzt grinste die junge Frau. »Ich weiß das, und Ihr habt selbstverständlich recht. Aber als Eure Beraterin erlaube ich mir den Hinweis, dass Ihr für die Bauern und Knechte in diesem Land weit mehr seid. In Abwesenheit des Königs dieses Landes, der weit weg von hier in seinem Palast sitzt, seid Ihr seine Vertretung – und Ihr habt alle Vollmachten, das Land weise zu regieren oder auch zu verwalten.« Sie verbeugte sich kurz. »Wie Ihr es wünscht, Herr, es ist stets Eure Entscheidung.«
»Ja, ja.« Nesh-Tilan erhob sich in eine sitzende Stellung. Die Beraterin sprach nur Tatsachen aus. Eine gewisse Geste der Bescheidenheit schadete nie, das hatte man ihm vor seiner Abreise gesagt. Wer zurückhaltend auftrat, bekam das Volk auf seine Seite und konnte später auf wesentlich einfachere Weise das tun, wonach ihm beliebte.
Er ließ den Blick über das Deck schweifen, das im gnadenlosen Licht der Mittagssonne dünstete. Das Schiff war breit und lag wie ein Brett im Wasser. Dank des niedrigen Tiefgangs konnte es auch ein Gewässer wie den Han hinaufgezogen werden. Ein hoher Gast wie der neue Verwalter und viele Waren ließen sich so einfacher und bequemer transportieren.
Die Fracht hatten die Schiffsknechte gleichmäßig angeordnet, um das Gewicht sauber zu verteilen. Nesh-Tilan sah die schweren Holzkisten, deren Kanten mit Schienen aus Eisen verstärkt worden waren, er betrachtete die Tonbehälter, in denen Rollen mit Dokumenten und diplomatischen Botschaften steckten, dazu die Formulare und Übersichten zu laufenden Verhandlungen, und sein Blick streifte die Körbe, in denen er frische Nahrungsmittel wusste, die er in seinem Verwaltungspalast benötigte. Das Schiff war gut bestückt, und der größte Teil seiner Fracht diente ihm.
Kein Wunder, dass man ihn im Seehafen mit entsprechender Bewachung ausgestattet hatte. Zwar war das Land ruhig, und es gab keinerlei Anzeichen von Unruhen, aber zwei Bogenschützen sowie zwei Nahkämpfer mit Schwert und Dolch standen den ganzen Tag an Deck, überwachten die Schiffsknechte und blickten mit zusammengekniffenen Augen hinaus in das karge Hügelland.
Am Ufer ritten die anderen Soldaten, ein halbes Dutzend narbiger, wortkarger Söldner, mit denen sich Nesh-Tilan so wenig wie möglich unterhalten hatte. Er hätte nicht gewusst, was er mit den ungebildeten Männern hätte sprechen sollen, nicht einmal ihr Anführer verfügte über eine einigermaßen ansprechende Bildung. Die Aufgabe der Männer erschöpfte sich darin, für seine Sicherheit zu sorgen. Derzeit beäugten sie die Treidelknechte.
Die schwitzenden Männer hatten die Hände in die langen Taue gekrampft, die ihnen über die Schulter liefen und sie mit dem Mast am vorderen Schiffsteil verbanden. Schwitzend und immer wieder unterdrückt fluchend stemmten sie die Füße in den Boden, ihre Muskeln spannten sich an, und Schritt für Schritt zogen sie das Schiff flussaufwärts. Es war eine langsame Bewegung, aber der neue Verwalter und seine Begleiter wären im unwegsamen Gelände mit der Sänfte kaum schneller vorangekommen. Unbequemer wäre es auf jeden Fall gewesen.
Nesh-Tilan graute schon davor, in die Sänfte umzusteigen. Er war in der Heimat mit der Sänfte gereist und wusste, dass ihm das keine Freude bereitete. Lieber ritt er selbst – aber nur über kurze Strecken. Das mit roten und blauen Fähnchen geschmückte Gestell stand ihm während der ganzen Reise den Fluss hinauf vor den Augen. Zwei Pferde transportierten die leere Sänfte am Ufer, einer der Soldaten führte das vordere Tier an einer langen Leine. Ebenso zogen die Soldaten zusätzliche Reitpferde an Leinen hinter sich her, ihre Hufe wirbelten Staub auf, der in einer langen dünnen Wolke in der Luft waberte und sich in einer feinen Schicht auf die Treidelknechte legte.
»Diese Knechte da …« Nesh-Tilan wies auf die Männer, die das Schiff zogen, und sah seine Beraterin aufmunternd an. »Weißt du, ob das freiwillige Arbeiter sind oder Sträflinge?«
Zarg-Nolesa musterte ihn mit einem dieser Blicke, bei denen Nesh-Tilan nie wusste, wie er sie einzuschätzen hatte. »Ich habe zwar meine Jugend in diesen Ländern verbracht, Herr, aber ich weiß nicht alles über die Menschen, die hier leben. Warum fragt Ihr?«
»Einfach so.« Nesh-Tilan winkte ab. »Vergiss die Frage, sie ist nicht wichtig.« Er hätte die Frage in der Tat lieber nicht geäußert. Unter Umständen unterstellte ihm die Beraterin jetzt gar, Mitleid mit den Männern am Ufer zu haben. Seinem Ruf wäre ein solcher Gedanke nicht zuträglich. Ein Verwalter hatte hart und gerecht zu sein, ein wichtiger Herr für die Menschen, die er zu beaufsichtigen hatte, kein Freund ihrer Schwächen und Fehler.
»Ich glaube aber …« Zarg-Nolesa sprach langsam, als wollte sie dem Verwalter die Chance geben, sie zu unterbrechen. »Es müssen freie Männer sein.« Sie lachte kurz und zeigte dabei ihre ebenmäßigen Zähne. »Was hier eben als freie Männer gilt … die Leute in der Gegend haben sehr unterschiedliche Ansichten. Es gibt zu viele Abstufungen zwischen Freibauern, Händlern, Handwerkern und den Knechten, die überall die schmutzige Arbeit leisten. Ohne sie liefe nichts – aber sie sind frei.«
»Eigentümliche Denkweise.«
»Das schon. Als Verwalter von Nogtehantis werdet Ihr dies alles steuern und lenken. Wenn Ihr die Macht der Freibauern nicht antastet, habt Ihr ein völlig ruhiges Land. Es gibt nur einige kleine Banden, die durch die Hügel streifen und gelegentlich einen Überfall verüben oder Vieh stehlen. Die meisten Leute hier sind mürrisch, aber friedlich, weil sie einigermaßen wohlhabend sind.« Sie wies auf die Knechte. »Sogar die Männer dort müssen keinen Hunger leiden, die meisten bekommen regelmäßig Fleisch zu essen.«
Die junge Frau lehnte sich mit dem Rücken an die Reling und blickte ihn an. Es wirkte, als fühlte sie sich überlegen, als wüsste sie über manche Dinge besser Bescheid als der Verwalter selbst. Nesh-Tilan wusste nicht genug über die junge Frau, die ihm mit den besten Beurteilungen empfohlen worden war. Soweit ihm bekannt war, hatte ihr Vater als hoher Offizier seinen Dienst in der Armee geleistet, stationiert in den Steppenländern, und als Sohn dieses Offiziers war Zarg-Nolesa gezwungenermaßen viel in Patloren und den anliegenden Staaten herumgekommen. Sie stammte zwar aus einem Alten Haus, aber in Eskoh hatte ihre Familie keinen hohen Rang, für sie blieben Beratertätigkeiten.
Nesh-Tilan erhob sich. Er wollte nicht länger zu der Beraterin aufsehen. Auch wenn er der Ranghöhere war, wurde er das Gefühl nicht los, dass sie ihn in Gedanken verspottete. Er streckte und dehnte sich, es krachte kurz im Nacken. Mit der Rechten griff er nach dem Krug, der auf einem kleinen Schemel neben seinem Kissenlager stand, und trank. Der gekühlte Wein, zur Hälfte mit Wasser vermengt, schmeckte gut und erfrischte. Sofort fühlte sich Nesh-Tilan wacher.
Er trat neben die Beraterin, ebenfalls mit dem Rücken zur Reling, den Krug noch in der Hand. »Willst du auch?«, fragte er und hielt ihr den Wein hin.
»Nein.« Zarg-Nolesa machte eine abwehrende Handbewegung. »Heute nicht. Ihr wisst, dass ich einen langen Ritt vor mir habe.«
»Über den du mir nach wie vor nichts sagen möchtest.«
»Nein.« Sie lächelte höflich und nichtssagend zugleich. »Ihr wisst, dass ich meine Anweisungen vom Hohen Rat habe und diesen zu folgen habe.«
»Und du weißt, dass du mir Ratschläge zu geben hast. Zumindest so lange, wie du mit mir auf diesem Schiff unterwegs bist.« Nesh-Tilan nahm einen Schluck Wein. Er stillte den Durst, aber er durfte nicht zu viel davon trinken, am frühen Nachmittag wollte er nicht den Genuss des Rauschs spüren.
»Welchen Rat wollt Ihr von mir?« Wieder lächelte Zarg-Nolesa. »Gibt es etwas, das Ihr dringend wissen müsst?«
Nesh-Tilan blickte auf das dürre Land, das sich in sanften Hügeln entlang des Flusses erstreckte. Durch eine Senke kamen Hirten mit einigen Dutzend Schafen auf sie zu, hinter ihnen zitterte eine Schleppe aus Staub in der Luft. Die Männer gingen langsam, als hätten sie viel Zeit zur Verfügung, und führten die Tiere hinunter zum Fluss. »Du sagst, dies sei ein friedliches Land, in dem nicht viel geschieht. Das klingt langweilig.«
Zarg-Nolesa sah ihm in die Augen, wachsam und ernst. »Ich verstehe Euren Gedankengang. Ihr fürchtet, dass eine solch triste Gegend nicht dazu beiträgt, Euren Ruhm in Eskoh zu mehren. Es könnte Eurer Laufbahn schaden, wenn Ihr nur zu vermelden habt, dass nichts los ist. Langweilige Verwalter in geruhsamen Gegenden bleiben Verwalter, die weit entfernt von der Macht leben.« Sie lächelte. »Ich habe einige Verwalter kennengelernt, die froh sind, dass sie ruhige Posten am Rand haben, weil sie dort machen können, was sie möchten. Aber Ihr, Herr, Ihr strebt nach mehr.«
Nesh-Tilan nickte. »Das hast du richtig erkannt. Und was muss ich tun, dass man in Eskoh wahrnimmt, wie tatkräftig und gewissenhaft ich mein Amt ausübe?«
»Es gibt ein Hilfsmittel, das immer wieder wirkt.« Zarg-Nolesa grinste erneut, ihre spitze Nase reckte sich in die Höhe. »Es birgt gewisse Risiken, aber es sorgt für Aufmerksamkeit.«
»Was meinst du?«
»Ihr müsst die Leute aufstacheln. Ihr müsst ihre Ruhe stören. Ihr benötigt einen lokal begrenzten Konflikt, einen kleinen Aufstand oder dergleichen. Irgendwelche Bauern, die sich zusammenrotten und die Ihr dann bekämpft. Ihr beweist Eure Tatkraft, indem Ihr einige Bauerntölpel aufhängen lasst. Werft ihnen Wilderei vor, oder Steuerhinterziehung, oder was immer Euch einfällt. Aber sorgt dafür, dass einige von ihnen aufrührerisch werden.«
»Dann habe ich einen Krieg am Hals.«
»Nein«, widersprach Zarg-Nolesa sanft. »Einen lokalen Konflikt. Mithilfe einiger Dutzend Söldner lässt sich so etwas leicht niederschlagen. Aber in der Hauptstadt wird man sehr aufmerksam wahrnehmen, wie schnell Ihr dafür sorgt, dass einige Rebellen am Galgen von Nogtehantis baumeln.« Sie lachte erneut, drehte sich zur Seite und spuckte geräuschvoll über die Reling.
Nachdenklich ging Nesh-Tilan am Oberdeck des Schiffs auf und ab. Seine Beraterin hielt sich in der winzigen Kammer auf, die sie während der Fahrt bewohnte und nachts sorgfältig verschloss, und machte sich reisefertig, denn für die Entfernung bis zur Anlegestelle war nur noch wenig Zeit veranschlagt. Hatte Nesh-Tilan keinen gleichwertigen Gesprächspartner, vertiefte er sich zumeist in die Dokumente, die er mit sich führte. Dazu verspürte er im Augenblick nicht die geringste Lust, zu viel ging ihm durch den Kopf.
Er sah sich selbst nicht als Grübler, sondern als jemanden, der schnell entschied und danach trachtete, rasche Erfolge zu erzielen. Die Kaltschnäuzigkeit, mit der seine Beraterin den Vorschlag geäußert hatte, überraschte ihn. Er sollte also einen Konflikt erzeugen, sollte für Unruhe sorgen. Verfolgte die Frau etwa eigene Pläne? Nesh-Tilan wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, und das störte ihn am meisten.
Mit Zarg-Nolesa hatte er stets gut geplaudert, sie würde ihm fehlen: Die junge Frau war gebildet und weitgereist, sie kannte sich mit den Gepflogenheiten der Oberschicht aus und wusste zahllose Fabelgeschichten über alte, halb vergessene Götter, unglaubliche Geschichten voller Gewalt und Sex, schlechten Manieren und groben Streichen, die sie mit breitem Grinsen und lautem, eigentlich überhaupt nicht schicklichem Lachen zum Besten geben konnte. Andererseits fand Nesh-Tilan das Verhalten der Rangniederen seltsam. Nicht nur einmal hatte sie getan, als sei in Wirklichkeit sie selbst die Herrin, als sei sie diejenige, der eigentlich die Verwaltertätigkeit über das Gebiet von Nogtehantis zustand.
Nesh-Tilan schüttelte den Kopf und beendete seine nervöse Wanderung über das Oberdeck. Er betrachtete den Haufen an Kissen und Decken, auf denen er einen Teil der Reise zugebracht hatte, lesend, schlafend oder diskutierend, und ließ dann den Blick erneut über das Deck wandern. Sollte er Chira holen lassen? Sie war zumindest eine gute Unterhaltung und ihm jederzeit zu Willen. Aber er verdrängte den Gedanken: Die Sklavin ging derzeit ihrer Tätigkeit nach, in der Kochkammer unter seinen Füßen bereitete sie ein leichtes Mahl für ihn zu.
Er nahm einen Schluck Wein, fühlte sich mittlerweile leicht berauscht und blickte auf das Wasser, das sich langsam bewegte. Der Han kam als schmales Flüsschen aus den schroffen Gebirgszügen, den Alten Bergen, die sich in der Mitte des Steppengebiets erstreckten, entwickelte sich, während er Nogtehantis durchfloss, zu einem immer breiteren Fluss, um dann als Strom in das Innere Meer zu fließen. Wenn es längere Zeit trocken blieb, wurde er rasch flach, und in genauso einer Zeit war Nesh-Tilan unterwegs. Man hatte ihm gesagt, dies sei ein idealer Zeitraum, sich im unteren Bereich den Fluss hochrudern und im oberen Bereich von den Treidelknechten ziehen zu lassen.
Das Wasser zu seinen Füßen war schlierig. Träge floss es dahin, eine schmutzig-braune Brühe, in der schwarze Flecken wie zerfaserte Inseln trieben, immer wieder ein dürrer Ast dazwischen oder einige vergilbte Blätter. Der Blick reichte kaum eine Handbreit ins Wasser, der Grund schien meilenweit entfernt zu sein, obwohl der Fluss nicht tief war. Kleine Wellen schäumten am Schiff entlang, Verwirbelungen lösten sich und trieben mit kleinen Schaumkronen zur Seite, gelegentlich huschte der Schatten eines Fischs vorüber.
Nesh-Tilan stellte sich vor, dass der Fluss bei seinem Lauf den unterschiedlichsten Gegebenheiten ausgeliefert war. Flaches und bergiges Land, schroffe Felsen, fruchtbare Regionen, kleine Städte und Dörfer – seine Anrainer waren vielfältig und eigenständig. Die meisten in dieser Gegend waren Bauern und Händler, Viehzüchter und am Oberlauf sogar Nomaden, wie er wusste. Und irgendwo, so hoffte er, musste der Fluss an Magie vorbeigekommen sein, irgendwo in diesem Land musste es die Reste des magischen Einflusses geben, verborgene Zauberer und Hexen, verlassene Punkte voller Kraft und Macht, die er finden und nutzen musste.
»Aber zuerst muss ich meinen eigenen Machtbereich absichern«, sagte er halblaut, während er den Blick von dem Wasser hob und auf die Männer am Ufer richtete. Sie passierten ein kleines Dorf: ein Dutzend einfacher Häuser aus schlecht verputztem Stein, alle einstöckig und mit flachen Dächern. Sie standen einige Dutzend Meter vom Flussufer entfernt, wahrscheinlich, um bei einem plötzlichen Hochwasser nicht einfach weggespült zu werden. Halb nackte Kinder rannten kreischend zwischen den Häusern hin und her und schlugen mit dünnen Stöcken aufeinander ein; es sah aus, als ob sie einen Krieg nachspielten.
Zwei Frauen trugen Wasserschläuche und kleine Krüge. Sie befüllten die Krüge und reichten sie den Treidelknechten, die durstig tranken. Erst jetzt bemerkte Nesh-Tilan, dass sie eine Pause einlegten. Seine Reise den Han hinauf war unterbrochen, das Schiff wurde von der seichten Flussbewegung sanft geschaukelt, und mehr geschah nicht.
Mit wenigen Schritten stand Nesh-Tilan bei einem der Bogenschützen, die nach wie vor wachsam auf dem Schiff patrouillierten, als rechneten sie mit einem Angriff. »Du!«, schnauzte er den Mann an, von dem er keinen Namen kannte. »Wieso halten wir an, wieso geht es nicht weiter?«
»Ich weiß es nicht«, gab der Söldner verdutzt zurück. Sein Eskohisch klang schwerfällig, als hätte er es erst vor Kurzem gelernt. »Die Knechte benötigen wohl eine Pause.«
»Die Kerle bekommen nur dann eine Pause, wenn ich es ihnen erlaube! Und bisher hat mich niemand gefragt, ob sie das dürfen.« Er fixierte den Söldner. »Ruf euren Anführer her, diesen Sapheanes! Und zwar schnell!«
»Wie Ihr wünscht, Herr!« Der Söldner hielt die Hände an die Seiten des Munds, schrie dann einige Worte zum Flussufer hinüber, die Nesh-Tilan nicht verstand. Wahrscheinlich benutzte er einen lorenischen Dialekt. Soweit er wusste, stammten die meisten Söldner in seiner Begleitung aus einem dieser unwichtigen Fürstentümer der Insel Hichtag, und in manchen von denen wurden Dialekte benutzt, die außerhalb der Gegend kein Mensch sprach.
Einer der Reiter trieb sein Pferd in den Fluss. Das Wasser ging dem Tier gerade mal bis an den Bauch, und er kam nahe genug an das Schiff heran, dass er sich mit Nesh-Tilan unterhalten konnte: zwar lautstark, aber nicht schreiend.
»Ihr habt einen Befehl für mich, Herr?«, fragte er höflich. Auch sein Eskohisch klang ein wenig fremd, aber er sprach die Wörter alle korrekt aus.
»Ja, Sapheanes«, antwortete Nesh-Tilan schroff. »Ich will, dass du und deine Leute diese Knechte stärker antreibt. Wir kommen nicht schnell genug voran, das ist eine Schande. Wenn diese Kerle die ganze Zeit pausieren, dauert es lang bis zu unserem Ziel.«
»Herr, die Männer benötigen eine Rast, wie mir scheint. Es ist schwere Arbeit für sie bei dieser Hitze.«
»Hast du etwa Mitleid mit diesem Gesindel? Ich dachte, du seist ein Reiterführer. Treib sie an!«
Der Söldner hielt sein Pferd straff am Zügel, und immer wieder wollte das Tier den Kopf zur Seite drehen und zurück ans Ufer. Nesh-Tilan sah dem grobschlächtigen Mann an, dass er am liebsten widersprochen hätte. »Ich habe kein Mitleid«, sagte er nach kurzer Pause rau, »und notfalls mache ich selbst die Schmutzarbeit.« Er nahm eine Peitsche zur Hand, die er zusammengerollt hinter seinem Sattel befestigt hatte, und hob sie leicht an. »Das wird Euch auf jeden Fall helfen, schneller ans Ziel zu kommen.«
Sapheanes ritt zurück ans Ufer, wo er kurz mit den anderen Reitern sprach. Dann trieben die Söldner ihre Pferde zu den Treidelknechten, von denen einige auf dem Boden saßen, und schrien sie an. Mühsam erhoben sich einige Männer, was den Söldnern zu langsam war. Ihre Pferde gingen aufgeregt hin und her, Tonkrüge fielen zu Boden, Peitschen knallten und Staub wirbelte auf. Die Frauen, die das Wasser gebracht hatten, schrien ebenfalls und sprangen zur Seite, um nicht von den Peitschen getroffen zu werden. Sogar die spielenden Kinder beteiligten sich an dem Durcheinander: Mit lautem Gebrüll stürmten sie durch den Staub, als sei für sie alles ein riesiges Vergnügen.