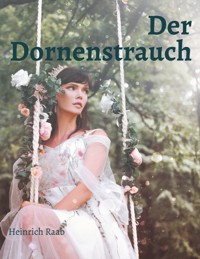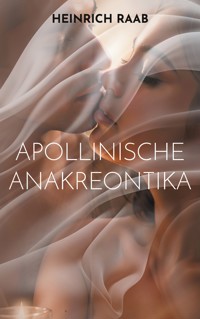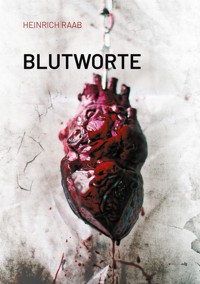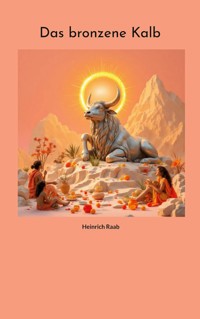
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immer philosophisch interessiert, war Heinrich Raab lange Zeit nur in der Unterhaltungsliteratur tätig. Mit "Das bronzene Kalb" ändert sich das grundlegend. Es wird eine umfassende Abhandlung über die Gesamtheit der Philosophie in leicht verständlicher Sprache geboten. Standpunkt ist der absolute Idealismus nach dem Vorbild Hegel. Auch moderne Themen, wie KI oder die Todesstrafe werden behandelt. "Das bronzene Kalb" darf in keinem Bücherregal fehlen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 54
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der unvergleichlichen Frau Hartmann gewidmet, der ich nicht nur meine Genesung, sondern auch tiefe Einsichten in die Psychologie verdanke.
Viele Namen hör ich nennen, Anders stets nach Ort und Frist; Doch es ahnen, die dich kennen, Daß du stets die Selbe bist. —Hugo Kaeker
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Nachwort
1.
Dieses Werk bietet sich dar als Dreischritt des Geistes, d.i. zunächst als Zugabe zum silbernen Kalbe, welches wiederum im dritten Grade verwandt ist mit seinem berühmten Vorgänger, dem goldenen – mosaischen Angedenkens. Und wie dazumal die Menschen anbetend auf die Knie fielen, falle ich, den Hochzeitsring wohlaufbewahrt, dem Leser zu Füßen. Wahrlich, es könnte schlimmer sein. Ich hätte den Unreinen die Füße säubern können. Solch eine Schmutzwäsche aber ist immer dem Verdacht ausgesetzt, aus Eitelkeit, aus einem innerlichen Aufbegehren gegen Norm und Moral, entstanden zu sein. Kein Neid, kein falscher Stolz, keine Krümmung des Rückens, bewegt mich zur Niederschrift dieser Zeilen.
Es ist nichts, als die lautere Wahrhaftigkeit herself, der ich im Folgenden eine Stimme gebe. Möge sie Anlass sein, ein ganzes Chor an Zweit- und Drittstimmen heraufzubeschwören, dem Diesseits ein Lied darzubringen von seiner Jenseitigkeit. Eine krasse Kakophonie dem Puristen.
2.
Wissenschaft ist immer das Behandeln des Unmittelbaren mit mittelbaren Mitteln; Philosophie das Betrachten der ersten Grundsätze, worauf alle wissenschaftlichen Versuche beruhen. Philosophie versucht die Antwort auf die Frage zu geben, ob objektive Wahrheit im Reich der Subjekte möglich sei und welcher Gestalt man über eine erste Wissenschaft zu reden habe. Im Skeptizismus tut sie dies im Negativen, im Dogmatismus als religiöse Offenlegung, im absoluten Idealismus als völlige, letzte Gewissheit a priori. Philosophie ist zugleich positiver Skeptizismus, als auch weltliche Offenbarung. Sie ist das Zwischen zwischen den unmittelbaren Objekten der Anschauung und ihrem System des Bewusstseins, ist Struktur allen Denkens, jeglichen nur möglichen Subjektes, jeglicher nur möglichen Zeit, jeglichen Ortes. Das absolute, uneingeschränkt geltende, unhintergehbare Wahre der Wahrheit.
3.
Alles, was sich widerspruchsfrei denken lässt, ist wahr. Es ist dies nicht notwendig als unmittelbares Objekt der Apperzeption, sondern kann sich auch darstellen als Seinsmöglichkeit im Reich der Begriffe. Daß dieser Bereich nicht willkürlich gewählt ist, zeigt sich darin, daß dort Regeln gelten, wie sie die Struktur des Bewusstseins der Wirklichkeit oktroyiert und umgekehrt.
Es gelten dort nämlich basale Grundregeln der Mathematik, der Kausalität und allgemein die Gültigkeit erster, apriorischer Normen. Selbst im Märchen gilt die Mathematik, selbst in der Phantasie der Satz vom Widerspruch. Psychologische Mechanismen weiten sich aus auf die Figur im Roman.
4.
Die Struktur des subjektiven Bewusstseins ist synonym mit der Objektivität der Dinge, an sich identisch mit dem Absoluten des Seins, weil Subjekte auch nur das Objektive wahrnehmen und folglich in der reinen Schau der Dinge mit dem Objektiven verschmelzen. Ohne objektive Strukturen kein Subjekt, das sich immer in der Ganzheitlichkeit des Seins zu dem Sein verhält.
Ohne Subjektivität kein Objekt. Die beiden sind eins. Sie bedingen sich gegenseitig, existieren durch einander. Die Schau der Dinge ist dabei nur die erste Stufe im Prozess des Erkennens. Die zweite ist die Verschiedenheit, die dritte das Verschmelzen beider zur absoluten Wirklichkeit.
5.
In der Zeit realisiert das Absolute die Seinsmöglichkeit aus dem Reich der Begriffe. Eine mögliche Welt unter möglichen Welten produzierend, ein wildes Ginnungagap, aus dem aus den Gegenpolen von Sein und Nichts Welten entstehen, zerbersten, vollkommener werden. Die Bewegung des Seins in der Zeit ist die Realisierung von Vollkommenheit. Nur die Bewegung ist das Reale, nur das Vollkommenwerden die Wirklichkeit.
Dabei existiert Zeit nicht und folglich auch kein Werden. Sie tut dies nur als Illusion in der Unvollkommenheit des Subjektiven. Das Böse ist ein Versuch, gegen das Vollkommene anzukämpfen, in Wirklichkeit aber gibt es nur das Vollkommene und die Vollkommenwerdung durch den Kontrast, wie auch in einem Musikstück Dissonanzen zu einer größeren Harmonie beitragen. Jeder hat einen freien Willen. Freier Wille bedeutet, dem Gesetz zu gehorchen, der Vollkommenwerdung des Seins. Das absolute Sein ist nicht definiert, es ist die Allheit des Nichts. Die Spezifikation erfolgt aus der Illusion der Subjektivität, welche Moment des Seins ist. Die Wüste ist zugleich homogene Masse, als auch Summe einzelner Sandkörner. So auch ist das Sein in seiner Realisierung real, in seiner Gänze jedoch weder objektiv noch subjektiv, sondern das Resultat einer Negatorik aus beiden. Es ist das Nichts.
6.
Der Christengott lässt sich nicht widerspruchsfrei denken, weil ein absolutes Wesen, als welcher der Christengott gedacht wird, nicht imstande wäre, unmögliches zu vollbringen, folglich nicht in der Lage ist, das vollkommenste Wesen zu sein. Noch wäre die Schöpfung autonomer, also nicht vollkommener Wesen durch ein vollkommenes Wesen möglich, denn Vollkommenheit hebt selbst das Wesensein des Seins auf.
Es ergibt sich ein evagelisches Heidentum, welches sich an dem Vernüftigwerden des bloß Objektiven erfreut. Evagelisch meint die Glorifizierung des Geistes vor der Unvernunft. Über den Göttern herrscht das Fatum: Das Vollkommenwerden des Seins in der Zeit. Niemand stirbt, denn jeder ist Teil des Seins. Niemand lebt, denn jeder ist das Sein selbst, zugleich Abend- und Morgenstern, Sandkorn und Wüste. Die Illusion der Zeit verführt die Menschen zu unvollkommenen Urteilen über die Vollkommenheit: Sie ist notwendig, denn das Sein hat sich noch nicht selbst erkannt. Sie wird hinter sich gelassen, wenn das Sein erkannt ist als Seiendes. Bewegung ist Stillstand. Die Form des Bogens eine Anpassung an das Wild, das er schießt, jedoch nicht schon die Einheit zwischen Jäger und Gejagtem, subjektivem und objektivem.
Die Götter der Heiden könnten wahr sein, darum existieren sie. In dem absoluten des Seins aber gibt es nichts, das Ding, das Gestalt, das ein So=Sein ist, denn es ist selbst das Nichts. Individualität ist eine Illusion. Wir müssen uns in die Illusion der Zeit flüchten, um zu philosophieren. Wir müssen Zeit denken, weil wir Subjekte sind. Alles Denken abseits des Absoluten ist lediglich eine Heuristik.
7.
In der Präsenz der heidnischen Götter zeigt sich die Spiritualität, welche meint die sich realisierende Seinsmöglichkeit im Prozess des Vollkommenwerdens. Ob die Götter dabei schon Objekt der Anschauung sind oder nur mittelbar als Möglichkeit, ist gleichgültig, weil beide Sphären auf einer Line liegen; im absoluten Sein nicht voneinander unterschieden sind.