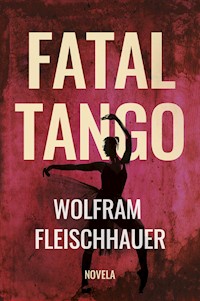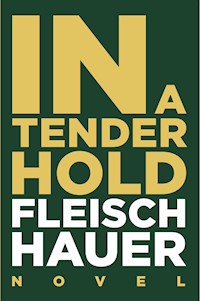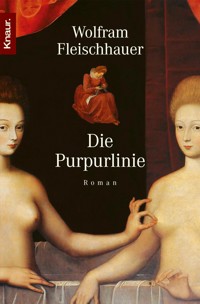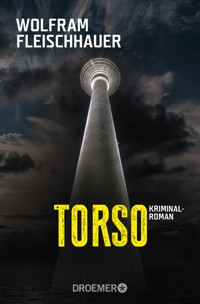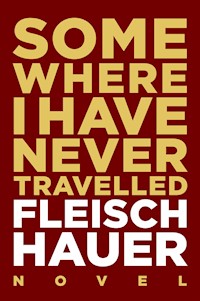9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris im Frühjahr 1867: Aus den dunklen Gewässern der Seine wird die Leiche eines Kindes geborgen. Für die Polizei steht fest: Die Mutter des Babys ist schuldig und muss zum Tode verurteilt werden. Aber warum verschwinden plötzlich Zeugen und Beweismaterial? Warum interessieren sich auf einmal die höchsten Regierungskreise für den Vorfall? 100 Jahre später beginnt eine geheimnisvolle junge Frau über die Hintergründe zu recherchieren. Was verbindet sie mit dem Fall? "Spannende Fiktion mit detaillierten Fakten vermischt." Focus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wolfram Fleischhauer
Die Frau mit den Regenhänden
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Paris im Frühjahr 1867. Aus den dunklen Gewässern der Seine wird die Leiche eines Kindes geborgen. Für die Polizei steht fest: Die Mutter des Babys ist schuldig und muss zum Tode verurteilt werden. Aber warum verschwinden plötzlich Zeugen und Beweismaterial? Warum interessieren sich auf einmal die höchsten Regierungskreise für den Vorfall? Hundert Jahre später beginnt eine junge Frau über die Hintergründe zu recherchieren.
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
I. Kapitel
I.
II.
III.
II. Kapitel
I. Heft, 7. Juli 1992
III. Kapitel
I.
II.
III.
IV. Kapitel
I. Heft, 8. Juli 1992
V. Kapitel
I.
II.
III.
VI. Kapitel
II. Heft, 9. Juli 1992
VII. Kapitel
I.
II.
Berkingers Aussage
VIII. Kapitel
II. Heft, 10. Juli 1992
IX. Kapitel
I.
II.
X. Kapitel
II. Heft, 11. Juli 1992
XI. Kapitel
I.
II.
XII. Kapitel
II. Heft, 12. Juli 1992
XIII. Kapitel
I.
II.
III.
XIV. Kapitel
II. Heft, 13. Juli 1992
XV. Kapitel
März 1999
Epilog
Ich danke
(ich weiß nicht, was an dir sich schließtund öffnet; nur etwas ist in mir, als fändeich die antwort in der stimme deiner augen, tiefer noch als rosen)niemand, nicht einmal der regen, hat solch kleine hände
e.e. cummings
Prolog
Cher Bruno,
ich bin auf dem Weg zu jenem Rendezvous, von dem Du weißt. Ich habe die halbe Nacht wach gelegen, an Dich gedacht und mir gewünscht, Deine Wärme an meinem Körper zu spüren. Jetzt sitze ich in der Metro zwischen Menschen, deren Blicke ungeduldig sind. Zeit ist etwas sehr Kostbares hier. Ich bin unter meinesgleichen.
Gestern abend wollte ich Dir schreiben und habe es nicht mehr ausgehalten, wollte Deine Stimme hören. Aber Du warst nicht da. Wo warst Du? Ach, Briefe sind immer von Toten an noch nicht Geborene. Sobald Dein Zeigefinger die Stelle zerschneidet, die meine Zunge beleckt hat, schon ist es etwas anderes. Wie sehr fehlt mir der Klang Deiner Stimme.
Bist Du mit der Übersetzung der Geschichte weitergekommen? Wie fühlt sie sich an in Deiner Sprache? Ich habe auf der Rolltreppe im Flughafen Gesprächsfetzen von deutschen Touristen belauscht und bin ihnen sogar ein Stück gefolgt. Welch seltsame Sprache, deren Klang mich so an Dich erinnert. Es erregt mich zu wissen, daß jedes Wort, jede Beschreibung aus meiner Feder nun durch Deine Seele geht und sie mit Bildern füllt, die ich gesehen habe. Ich wäre gerne jedes einzelne dieser Worte, neide ihnen, daß Deine Augen auf ihnen ruhen, ihr Klang vielleicht Deine Zunge bewegt.
Ich gehe durch diese Stadt, durch diese Gegenwart, und sehe überall Szenen vor mir, die mich an diese Vergangenheit erinnern. Die Kulisse ist anders, aber die Figuren sind gleich.
Die Leute sind freundlich hier in New York. Der Kofferträger im Hotel spricht sogar Französisch. Als ich ihm sagte, daß ich aus Paris komme, glänzten seine Augen. Merweijeuh, sagte er. Queal beile wille. Das Hotel, das Serge mir empfohlen hatte, ist heute ein Altersheim. Ich bin nur eine Nacht dortgeblieben und dann hierher umgezogen. Serge würde sich wundern, wenn ich ihm erzählen würde, was aus seinem Lieblingshotel geworden ist. In der Lobby riecht es nach alten Menschen und billigem Bohnerwachs. Man erkennt noch, daß es einmal ein stattliches Haus gewesen sein muß. Jetzt sieht es aus wie leer geräumt. Heute erfuhr ich, daß die Stadt in diesem Hotel Zimmer für alte Menschen subventioniert. Solange sie es irgendwie bewerkstelligen, zwanzig Dollar am Tag zu erbetteln, duldet man sie hier.
Ich mußte an Marie denken, an ihr Leben damals in Belleville. Ich denke oft an sie, fühle mich ihr nah. Ich sehe sie auf dem Wehr am Kanal St. Martin stehen, den Blick auf das schwarze Wasser unter ihr gerichtet, die Hände um die Brüstung gekrallt.
Du weißt, daß ich Maries Geschichte erzählt habe, um nicht verrückt zu werden. Ich habe sie Dir zu lesen gegeben, um Dir etwas zu sagen, worüber ich nicht sprechen konnte. Maries Geschichte ist meine Geschichte. Aber das ist nur ihre Bedeutung. Erst durch uns bekommt sie einen Sinn.
Erzähle mir auch Deine Geschichte. Ich will Deine Stimme hören, Deinen Erinnerungen lauschen. Und dann, wenn alles gesagt ist, sprich nur noch meinen Namen, leise und sanft an meinem Ohr.
Ich spreche still den Deinen mit jedem Schlag meines Herzens.
Bruno.
A bientôt, mon amour
Mainsdepluie
I. Kapitel
Freilich dient das Wasser nicht bloß dazu, sich unnützer und lästiger Sachen zu entledigen, wie Schutt, Kehricht, Excremente, leere, von einem Diebstahl herrührende Kisten und Kästen u. dergl. m., sondern es werden auch Leichen, namentlich die von Neugeborenen, hineingeworfen, um sie auf bequeme und wohlfeile Weise zu beseitigen oder um Verbrechen zu verdunkeln.
Johann Ludwig CasperHandbuch der gerichtlichen MedicinBerlin 1882
I.
Das Tauwetter brachte nichts Gutes.
Als das Eis im Frühjahr 1867 aufbrach und die ersten Eisplatten in der Seine trieben, stak hier und da ein halber Mensch darin. Es waren die Leichen der im Winter Ertrunkenen, der Eingebrochenen. Irgendwo unter dem Eis waren sie hängengeblieben und festgefroren. Jetzt, da die Strömung die aufbrechende Eisschicht in Bewegung versetzte, riß es die feststekkenden Körper einfach auseinander. Die gruseligen Funde zogen sich über Wochen hin.
Wie kalt der Winter wirklich gewesen war, darüber gingen die Meinungen auseinander. Neun Grad unter Null waren durchschnittlich gemessen worden. Auf dem Pont Neuf hatte sich täglich eine ansehnliche Menschenmenge um das Thermometer des Ingenieurs Chevalier versammelt. Um wie viele Wärmegrade der Atem der vielen Neugierigen das Meßergebnis verfälschte, mochte jeder selber schätzen. Den meisten war’s egal. Sie maßen die Kälte nach der alten Maßeinheit der Zahl der Erfrorenen und hofften, daß es endlich damit vorüber sei.
Als das Eis endlich geschmolzen war und alle Toten geborgen, kam das Hochwasser. Es ging so schnell, daß in einer einzigen Nacht zwei Dutzend Lastkähne vom Quai losgerissen wurden und sich wie Spielzeugschiffe unter den Brückendurchfahrten des Pont d’Arcole verkeilten. Nicht auszudenken, was der Rückstau der Seine alles überflutet hätte. Gute Ratschläge, wie man die Schiffe losbekommen sollte, hatten alle. Eine Lösung keiner. Die Kähne, einen nach dem anderen, wegziehen? Wo eine so riesige Winde herbekommen? Und von wo aus ziehen? Draußen auf dem Marsfeld hatten sie Kräne für den Bau des Ausstellungsgebäudes für die Weltausstellung. Doch hält so eine Brücke einen Kran aus? Außerdem mußte das alles sehr schnell gehen. Anzünden? Sprengen? Dann ging auch die Brücke mit drauf. Und wer ersetzt die Schiffe? Schließlich besorgte der Fluß die Lösung selber. Mit ohrenbetäubendem Krach von zersplitterndem Holz brach einer der Kähne unter dem Druck und gab die anderen frei. Für manche ein gelungener Ausdruck dafür, wie die Regierung derzeit die Probleme des Landes löste: durch Nichtstun.
Bis um halb elf Uhr war alles ruhig gewesen an jenem Montagabend im März. Sie waren zu viert auf der Wache. Der Ofen zog schlecht wegen des verdammten Wetters, aber wenigstens war es nicht mehr so kalt wie die Woche zuvor. Lobiau und Grol spielten Karten. Thermann ging Streife. Das war zwar gegen die Regel, alleine Streife zu gehen, aber so war das eben an jenem Montagabend. Außerdem kam Thermann zurück, bevor dieser Gerber auftauchte. Duvergnier, der als Inspektor der Polizeiwache vorstand, saß in seinem Arbeitszimmer. Er hatte Tee aufgesetzt. Der Schuß Rum, der dazugehörte, entsprach zwar auch nicht den Dienstvorschriften, aber davon erfuhr ja niemand. Außerdem kam er nicht mehr dazu, den Tee zu trinken. Den Rum freilich schon, später, ohne den Tee, aber dafür hätte jeder Verständnis gehabt, nach all dem, was dann geschehen war.
Duvergnier hatte in seiner Laufbahn schon einiges gesehen. Die Barrikadenkämpfe von 1848 waren nicht gerade ein schöner Anblick gewesen. Als 1858 Orsinis Bomben vor der Oper die Kutsche des Kaisers trafen, hatte er den Knall der Sprengsätze gehört und kurz darauf mit eigenen Augen gesehen, was die mitten in der Menschenmenge gezündeten Granaten angerichtet hatten. Das Schlimmste waren die Kopfwunden. Er konnte einiges ertragen, solange es nur nicht am Kopf war. Ein entstelltes Gesicht verfolgte ihn Wochen. Aber seit dem Attentat vor neun Jahren war ihm dergleichen erspart geblieben. Wenn er gewußt hätte, was dort draußen im Kanal schwamm, hätte er seine Kollegen alleine losgeschickt. Der Gerber, der auf der Wache erschienen war, hätte ihm ja sagen können, wie der Kopf aussah. Aber der Mann hatte von einem Kind gesprochen. Von einer Kinderleiche. Wer dachte dabei schon an den Kopf. Diesen Montagabend würde er jedenfalls so schnell nicht vergessen.
Thermann hatte eben seine nassen Stiefel ausgezogen und sie neben den Ofen gestellt, als Duvergnier aus dem Büro in die Amtsstube kam, um Tinte zu holen, die im Schrank unter dem Empfangstresen aufbewahrt wurde. Er schrieb das Tagesprotokoll, was ihm als Vorsteher der Wache zufiel. Grol hatte ein schlechtes Blatt und überhaupt schlechte Laune, weshalb er Thermann auch nur wortlos den Figaro vom Vortag zuwarf, als dieser fragte, ob irgend jemand Zeitungspapier habe. Duvergnier verschwand wieder im Büro, schrieb den Bericht zu Ende und heftete ihn ab. Zu früh, wie sich gleich darauf herausstellte, denn plötzlich klopfte draußen jemand energisch gegen die Tür. Da Duvergnier sogleich Stimmen aus dem Vorraum vernahm, ging er nicht hinaus, in der Annahme, daß seine Kollegen sich schon darum kümmern würden. Eine Weile hörte er auch nur eine gedämpfte Unterhaltung. Er stand am Ofen und schaute nach dem Tee, als seine Tür aufflog.
»Chef!« rief Grol, der im Türrahmen erschienen war. »Kommen Sie bitte mal.«
»Was ist denn?«
Aber Grol deutete nur mit dem Kopf hinter sich in die Amtsstube.
Als Duvergnier hinauskam, stand Lobiau hinter dem Empfangstresen und füllte einen Meldezettel aus. Thermann saß noch neben dem Ofen, den Figaro auf dem Schoß, und knetete sich die feuchten Strümpfe. Lobiau gegenüber stand ein älterer Mann, der soeben seine Adresse nannte.
»… Passage Feuillet.«
»Welche Nummer?«
»Es gibt keine Nummern.«
»Beruf?«
»Gerber.«
Duvergnier trat neben Lobiau.
»Monsieur …?«
»Briffaut, Charles«, sagte Lobiau. »Monsieur Briffaut, das ist Inspektor Duvergnier. Könnten Sie ihm bitte wiederholen, was Sie uns eben erzählt haben.«
Der Mann schien beeindruckt von Duvergniers Uniform. Jedenfalls richtete er sich respektvoll auf. Sein graues Haar hing in Strähnen herunter und umrahmte ein verhärmtes Gesicht. Unter seinem Umhang trug er eine schmutzige Lederschürze und einen dicken, grauen Wollpullover. Seine groben Schuhe hatten Matschflecken auf dem Holzboden hinterlassen.
»Ich war eben am Kanal, um Lauge wegzugießen«, sagte er. »Als ich umkehren wollte, war der Hund verschwunden.«
»Was für ein Hund?«
»Mein Hund. Bernadette. Ich rief nach ihr. Da hörte ich sie bellen. Weiter oben, nicht weit vom Wehr. Ich ging die Böschung entlang. Ich rief wieder nach ihr, aber sie bellte nur und kam nicht bei. Auf dieser Seite kann man nicht weit an der Böschung entlanglaufen, wegen der Sperrgitter. Bernadette war darunter hindurchgekrochen, also mußte ich erst die Böschung ein Stück hinauflaufen, um das Gitter zu umgehen. Ich rief sie noch mal, und als sie bellte, sah ich sie unten am Kanal hin und her springen. Aber sie wollte nicht heraufkommen. Daher ging ich runter, so weit es eben geht, und dann sah ich, daß da etwas im Wasser lag. Es sah aus wie ein ertrunkenes Lamm oder so etwas. Also rief ich den Hund wieder, aber das Vieh wollte einfach nicht beikommen, sondern lief immer wieder zu dem Lamm dort. Schließlich habe ich mich durch das Gestrüpp gekämpft, um sie zu holen. Als ich fast bei ihr war, sprang sie auf mich zu und jaulte. Was ist denn, sagte ich zu ihr. Und dann habe ich es auch gesehen. Da liegt ein Kind im Wasser.«
»Ein Kind?« fragte Duvergnier.
Der Alte nickte. »Jedenfalls kein Lamm. Es ist vielleicht so groß.« Er zeigte mit den Händen die Größe an. »Schwimmt dort im Wasser, ja, mit dem Gesicht nach unten.«
»Haben Sie es an Land gezogen?«
»Nein. Um Gottes willen. Ich habe den Hund gepackt und bin die Böschung hinauf. Gleich hierhergekommen bin ich. Das ist was für die Polizei, habe ich mir gesagt.«
»Haben Sie irgend jemanden gesehen?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein, um diese Zeit ist da niemand.«
»Thermann!« sagte Duvergnier. Aber der hatte seine Stiefel schon wieder angezogen. »Grol, Sie gehen bitte zum Hôpital St. Louis und holen einen Arzt. Wo, sagten Sie? Kurz vor dem Wehr?«
»Ja, keine hundert Schritte.«
»Und ich?« fragte Lobiau.
»Sie bleiben hier und sehen zu, daß die Öfen nicht ausgehen.«
Duvergnier und Grol verschwanden im Lager, um sich Ölzeug und Lampen zu holen. Thermanns Regencape hing noch triefend am Haken hinter der Tür. Lobiau schob dem Gerber den Meldezettel zur Unterschrift hin. Er unterschrieb, langsam, mit großen, unsicheren Buchstaben, und streckte dabei leicht die Zunge heraus.
Als sie auf die Straße hinaustraten, begrüßte sie das Bellen des Hundes, der neben der Tür festgebunden war. Briffaut band ihn los und stapfte Duvergnier und Thermann voran die Straße hinab, während sich Grol in die entgegengesetzte Richtung entfernte, wo das Krankenhaus St. Louis lag.
Als sie den Kanal an der Rue des Ecluses überquerten, fing der Hund plötzlich zu bellen und zu winseln an. Unter ihnen floß träge das Wasser. Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt und kräuselte die schwarze Oberfläche des Kanals. Duvergnier blieb stehen und schlug sich gegen den Kopf.
»Verdammt, eine Schubkarre. Wir haben keine Schubkarre mitgenommen.«
Thermann machte augenblicklich kehrt, doch Duvergnier hielt ihn noch einmal zurück. »Nein, warten Sie einen Moment. Monsieur Briffaut, kann man die Stelle von hier aus sehen?«
Der Gerber trat an die Brüstung der Eisenbrücke und sah angestrengt in nördlicher Richtung zum Wehr. Der Hund zog ungeduldig an der Leine, keuchte und jaulte und beruhigte sich auch dann nicht, als der Gerber schroff am Halsband riß. Zu beiden Seiten des Kanals war die Uferböschung in tiefe Dunkelheit getaucht. Am Horizont sah man undeutlich die Umrisse des Wehrs. Briffaut blickte suchend die rechte Uferseite entlang und wies schließlich achselzuckend auf eine Stelle zwischen der Brücke und dem Wehr.
»Dort hinten, Sie gehen oben an der Böschung entlang, und nach dem dritten Absperrgitter sind es noch ein paar Schritte.«
»Nun gut, Sie werden meine Lampe sehen«, sagte Duvergnier. »Dann finden Sie es schon. Machen Sie schnell, Thermann. Aber warten Sie auf Grol und den Arzt.«
Thermann verschwand, und Duvergnier folgte Briffaut über die Brücke. Der Weg an der Böschung entlang war aufgeweicht und bot keinen sicheren Tritt. Als sie ein paar Meter gegangen waren, fuhr es Duvergnier durch den Kopf, daß er noch etwas Grundlegendes vergessen hatte. Er hielt Briffaut an und befahl ihm zu warten. Dann kehrte er zu der Stelle zurück, wo sie von der über die Brücke führenden Straße abgebogen waren. Aus einem Haufen Unrat, über den der Schein seiner Lampe hinwegglitt, zog er zwei alte Holzbretter heraus und rammte sie kurz entschlossen kreuzweise am Anfang der Böschung in den aufgeweichten Boden. Dann zog er einen Papierblock aus seiner Ledertasche, schrieb mit großen Buchstaben »Den Weg nicht betreten – Fußspuren« auf einen Zettel, faltete ihn gegen die Nässe zusammen und steckte ihn an einem der Bretter auf einen Holzsplitter. Dann kehrte er zu Briffaut zurück, der Mühe hatte, den Hund zurückzuhalten, nahm ihn am Arm und wies ihn an, hart am Rande des Pfades auf der Böschung entlangzulaufen.
Mit einiger Mühe erreichten sie das dritte Absperrgitter, gingen daran vorüber und standen kurz darauf oberhalb der Stelle, wo der Gerber das Kind gefunden haben wollte. Der Hund wurde immer unruhiger, und Briffaut zischte ihn zornig an. Duvergnier ließ die Lampe über dem Boden kreisen. Da waren tatsächlich Fußspuren. Duvergnier bat Briffaut, seinen Fuß neben einen der Schuhabdrücke im Matsch zu setzen, und stellte enttäuscht fest, daß es der gleiche Sohlenabdruck war. Bernadettes leichtfüßige Pfotenabdrücke prangten außerdem daneben.
Die Uferböschung war hier brusthoch mit Büschen und Gestrüpp bewachsen. Die Lampe schützend in Kniehöhe haltend, bahnte sich Duvergnier vorsichtig einen Weg durch das Dickicht und arbeitete sich langsam zum Kanal hinab. Die Böschung war vielleicht fünf Meter hoch und mündete in einen schmalen, unbewachsenen Streifen unten am Wasser. Briffaut folgte ihm in geringer Entfernung, und zwischen den beiden kroch der Hund keuchend durchs Unterholz. Als Duvergnier den unbewachsenen Streifen erreicht hatte, richtete er sich auf, hob die Lampe hoch und ließ seinen Blick über das Wasser gleiten. Briffaut trat neben ihn und zeigte mit der Hand auf eine Stelle, wo zwei Armlängen vom Ufer entfernt etwas Helles im Wasser trieb. Duvergnier ging darauf zu, hielt die Lampe über das Wasser und fuhr plötzlich erschrocken zurück. Ein dunkler Schatten schoß pfeilschnell zwischen dem Schilf davon. Ein zweiter folgte ihm. Das Bündel wippte ruckartig auf und nieder, wie von kleinen Stößen bewegt. Dann lag es wieder still. Bernadette winselte, kauerte am Boden, legte die Ohren an, bellte zweimal laut auf und ließ dann ein warnendes Knurren ertönen.
»Binden Sie den Hund dahinten irgendwo fest«, sagte Duvergnier nervös und suchte gleichzeitig nach einem Gegenstand, mit dem er das Bündel ans Ufer ziehen könnte. Er stellte die Lampe auf den Boden, machte sich an einem der Büsche zu schaffen und brach mit nicht geringer Mühe einen starken Ast ab. Dann wandte er sich wieder dem Kanal zu, hob erneut die Lampe hoch und starrte unruhig auf das nun wieder völlig bewegungslos im Wasser treibende Kind. Denn jetzt sah auch er, daß der Gerber sich nicht getäuscht hatte. Es lag mit dem Gesicht nach unten. Der Kopf war fast vollständig untergetaucht, doch Duvergnier erkannte an der Wasseroberfläche einen Hinterkopf mit dunklem Haar. Die Schultern waren nackt. Von der Brust abwärts war das Kind noch in Stoffbahnen eingewickelt, die sich um die Schultern herum gelöst hatten und in langen schlierigen Bahnen im Wasser hingen. Die Arme waren nicht zu sehen. Er erkannte den Ansatz einer hellen Hose, aber die Beine waren wie die Arme unter der Wasseroberfläche verborgen.
Duvergnier führte die Spitze seines Astes vorsichtig an das Kind heran und versuchte, es unter der Achselhöhle zu fassen zu bekommen. Der leblose Körper drehte sich leicht. Mit Schaudern sah der Polizist, daß die ihm zugewandte Seite der Leiche dunkle Stellen aufwies. Er legte das Astende auf das Bündel und zog es behutsam heran. Willfährig schwebte das Kind durch das Wasser und kam nach wenigen Augenblicken zu Füßen Duvergniers am Kanalufer zu ruhen. Briffaut war hinzugetreten und schaute betroffen auf den gräßlichen Fund. Der Rücken des Kindes war von einem kremigen Weiß und glänzte im Schein der Lampe. Arme und Beine waren noch immer nicht zu sehen. Der Nacken wies eine dunkle Färbung auf. Es schien, als kauerte der kleine Körper dort im Wasser, das Gesicht auf den Grund gerichtet, Arme und Beine fest vor dem Oberkörper zusammengezogen.
Duvergnier gab Briffaut die Lampe in die Hand, legte den Ast beiseite und zog seinen schwarzen Regenmantel aus. Dann kniete er sich hin, legte den Mantel flach ins Wasser und zog ihn vorsichtig unter der Leiche durch. Er ergriff die beiden Enden längs des Körpers, schlug sie behutsam über dem Kind zusammen und wuchtete das ganze Bündel aus dem Wasser. Einen Moment lang stand er unschlüssig da, wartete, bis ein Großteil des Wassers aus der so geborgenen Fracht herausgelaufen war, und legte den Mantel mit dem darin befindlichen Kind auf dem Boden ab. Er schaute Briffaut an, doch der sagte kein Wort, betrachtete nur bekümmert das nasse Bündel aus schwarzem Ölzeug, das da vor ihm lag.
Kanalabwärts auf der Brücke waren drei helle Punkte erschienen. Wie kleine Irrlichter bewegten sie sich darüber hinweg. Duvergnier griff nach der Laterne, schwenkte sie mehrmals hin und her und betrachtete zufrieden das lautlose Echo des zweiten Lichtpunktes dort auf der Brücke, der mehrmals kurz verlöschte.
»Eine der Eisleichen?« fragte Briffaut.
Duvergnier schüttelte den Kopf.
»Nein«, antwortete er ernst. »Das Kind hier ist noch nicht sehr lange tot.«
»Wer tut nur so etwas«, hörte er den Gerber sagen.
»Tiere«, sagte Duvergnier.
»Nein, Tiere tun so etwas nicht.«
Es regnete noch immer leicht. Duvergnier fröstelte. Die beiden Männer standen schweigend beieinander.
»Sollten wir nicht nachsehen, was mit ihm ist?« fragte Briffaut nach einer Weile unsicher.
Duvergnier schüttelte den Kopf. »Ich will lieber auf den Arzt warten. Wir können hier sowieso nicht mehr helfen.«
Er dachte an die zuckenden Bewegungen der davonschwimmenden Ratten. Von Thermann, Grol und dem Arzt war noch nichts zu sehen. Offensichtlich hatten sie seine Botschaft gefunden und bewegten sich vorsichtig heran. Duvergnier überdachte sein weiteres Vorgehen.
Wie war das Kind hierher gelangt? Wahrscheinlich hatte man es am Wehr in den Kanal geworfen. Oder war auch ein Unfall denkbar? Ihm war kein verschwundenes Kind gemeldet worden. Der Arzt müßte feststellen, wie lange das Kind schon im Wasser lag. Dann könnte man zurückrechnen und die umliegenden Polizeistellen befragen, ob eine Vermißtenmeldung vorlag. Die Strömung vom Wehr aus ging stadteinwärts. Das Kind mußte also auf den hundert Metern bis zum Wehr ins Wasser gelangt sein, vermutlich auf dieser Uferseite, aber das war nicht sicher, und so würde man beide Ufer auf Hinweise absuchen müssen. Vielleicht fanden sich irgendwo Spuren oder Kleidungsstücke oder Schuhe. Hatte das Kind Schuhe getragen? Duvergnier war versucht, den Leichnam aufzudekken, konnte sich jedoch nicht dazu durchringen. Nein, das sollte der Arzt machen. Die erste Untersuchung war von enormer Bedeutung. Duvergnier hatte wiederholt Doktor Tardieu im Gerichtssaal erlebt und gesehen, wie die eindeutigsten Zeichen eines Gewaltverbrechens sich als Täuschung herausstellen konnten, wenn sie wissenschaftlich untersucht wurden. Es war so leicht, Fehler zu machen. Und die meisten Fehler unterliefen der Polizei, weil sie über die Methoden der Gerichtsmedizin so schlecht unterrichtet war. Er tat, was er für richtig hielt, und im Rahmen dessen, was er hier an der Uferböschung vorgefunden zu haben glaubte, verhielt er sich auch richtig. Es waren schon wiederholt Kinderleichen aus dem Kanal gezogen worden. So auch jetzt wieder. Wie hätte er ahnen sollen, daß es diesmal nicht das gleiche war?
Oben auf der Böschung waren nun Schritte zu vernehmen. Duvergnier hörte Thermann rufen und antwortete. Das Gebüsch geriet in Bewegung, und man sah den Lichtschein von Laternen dazwischen hindurchschimmern. Briffaut ging zu seinem Hund, der wieder zu bellen begonnen hatte, und beruhigte das Tier. Thermann und Grol traten aus dem Gestrüpp, gefolgt von einem weiteren Mann mit einer Ledertasche. Thermann erstattete Duvergnier kurz Bericht, sagte, daß sie seine Anweisung, den Pfad nicht zu betreten, gefunden und die Schubkarre daher an der Brücke zurückgelassen hätten. Duvergnier erklärte dem Arzt schnell, was sich ereignet hatte, und deutete auf das schwarze Ölzeug am Boden. Der Arzt atmete schwer und schien vom raschen Laufen erschöpft zu sein. Er war klein und dick. Seine Brille war von feinen Wassertropfen beschlagen, und er nahm sie ab, um sie zu putzen, während er Duvergniers Ausführungen lauschte. Als der Polizist geendet hatte, beugte er sich ohne ein weiteres Wort über das Bündel am Boden und schlug die nassen Ölbahnen beiseite. Thermann und Grol wichen ein wenig zurück. Duvergnier stand unbeweglich da und beobachtete die Verrichtungen des Arztes.
Der Leichnam lag auf der Seite. Der Kopf war nach hinten geknickt, Augen und Mund waren geschlossen. Ein dunkelgraues, zusammengerolltes Tuch war um den Kopf gebunden und unter dem Kinn verknotet.
Der Arzt ergriff eines der Ärmchen des Kindes. Es ließ sich ein wenig hin und her bewegen, war jedoch in sich starr. Er drehte sich um und öffnete seine Tasche. Er zog ein Thermometer hervor, legte es neben sich hin, nahm dann eine Schere zur Hand und schnitt über dem Gesäß die Hose bis in den Schritt auf. Dann ging er um die Leiche herum, spreizte mit dem Daumen und Zeigefinger das Gesäß auf und versenkte das Thermometer darin.
»Würden Sie bitte Protokoll führen?« sagte er, zu Duvergnier gewandt. »Und Sie, meine Herren, könnte ich etwas mehr Licht bekommen.«
Duvergnier nahm seinen Notizblock zur Hand, während seine beiden Kollegen mit ihren Laternen näher kamen. Das kleine Wesen lag zusammengekauert da, die Beine fest an den Bauch hochgezogen, die Arme über der Brust verschränkt, als habe es versucht, in einem kleinen Behälter Platz zu finden. Der Rücken war stark gekrümmt, und wenn man es so betrachtete, drängte sich der Eindruck auf, es sei in eben dieser Stellung in einem Tuch vor der Brust seiner Mutter getragen worden.
»Wann haben Sie die Leiche geborgen?« fragte der Arzt sachlich.
»Kurz bevor Sie eintrafen. Vor vielleicht zehn oder fünfzehn Minuten.«
»Immerhin mal ein vollständiger Körper nach den ganzen Brocken und Klumpen der letzten Wochen.«
Duvergnier überging die geschmacklose Bemerkung kommentarlos. Der Arzt tastete die Leistengegend der Leiche ab und begann zu diktieren.
»Denatus ist sechs bis acht Monate alt. Am Montag, dem fünfundzwanzigsten März, eine halbe Stunde vor Mitternacht am Ostufer des Kanals St. Martin im Wasser treibend aufgefunden. Bergung erfolgte ohne Gewaltanwendung …«
Duvergnier verzeichnete gewissenhaft die Angaben, welche der Arzt mit monotoner Stimme vortrug. Thermann und Grol standen in geringer Entfernung mit dem Gerber zusammen und unterhielten sich leise. Bruchstücke der Protokollstimme des Arztes trieben zu ihnen herüber.
»… rigor mortis in Embryonalstellung … keine Gänsehaut … Gesicht und ganze Leiche bleich … Reste von Fettspuren auf den Wangen … im Nackenbereich leichte Dunkelfärbung … Zunge nicht geschwollen, aber mit der Spitze hinter geschlossenen Lippen eingeklemmt … an den Händen und Füßen zeigt sich die Haut längsfaltig … Todeszeitpunkt liegt vermutlich mindestens zwölf, höchstens vierundzwanzig Stunden zurück … Brustkorb hart und gespannt … kein äußerlich sichtbarer Madenbefall … Bißspuren an Weichteilen im Gesicht und am Brustkorb links …«
Duvergnier blickte unwillkürlich vor sich auf den Boden, wo der leblose Körper mittlerweile vollständig entkleidet dalag. »… Körperinnentemperatur 47 Fahrenheit, unschlüssig … Wassertemperatur … schreiben Sie noch mit?«
Duvergnier fuhr auf, schaute den Arzt an, dann wieder das Gesicht des Kindes. Die Wangen waren angefressen. Er spürte einen bitteren Geschmack im Mund und plötzlich ein Würgen im Hals. Er schaffte es gerade noch zu den Büschen. Aber was ihm nicht gelang, war, das Bild aus seinem Kopf zu verscheuchen, das im Wasser treibende, nach unten gerichtete Gesicht, an das ein spitzes Maul heranschießt, mit scharfen Zähnen einen Hautfetzen herausreißt.
Thermann trat neben ihn und legte ihm freundschaftlich die Hand auf die Schulter. »Soll ich weiterschreiben?«
Er nickte und gab ihm den Block.
»Fahren Sie fort«, sagte Thermann.
Der Arzt wandte sich wieder dem Körper zu und schaute erneut auf das Thermometer. »Lufttemperatur …«
Duvergnier stolperte die Böschung hinauf. Oben angekommen, richtete er sich auf und atmete mehrmals tief durch. Dann spuckte er eine gute Weile aus, um den widerlichen Geschmack aus dem Mund zu bekommen. Seine Nase und sein Rachen brannten von der Säure des Erbrochenen, und kaum dachte er an das, was dort unten lag, bäumte sich sein Magen erneut auf und schnitt ihm die Luft ab. Allmählich beruhigte er sich, und als er zwanzig Minuten später die Böschung wieder hinabstieg, war die Untersuchung beendet und die Leiche wieder in seine Öljacke eingewickelt. Grol und Thermann trugen sie zwischen sich zur Brücke vor, dann ging es weiter mit der Schubkarre bis zur Wachstube. Als das Protokoll erledigt war, konnte der Weitertransport in die Morgue erfolgen, wo die Leiche gegen vier Uhr morgens eintraf. So war sie bereits am Dienstag zur allgemeinen Besichtigung freigegeben.
Die umstrittene Praxis der öffentlichen Leichenschau in der Morgue bewährte sich wieder einmal: Noch am gleichen Tag identifizierte ein Wasserträger aus Belleville das Kind anhand einiger am Morgen unweit des Fundortes der Leiche aufgefundener und gleichfalls ausgestellter Kleidungsstücke.
Die Mutter, eine gewisse Marie Lazès, wurde noch am gleichen Abend festgenommen.
II.
Antoine Bertaut hatte an jenem Montag seine Mittagspause auf dem Pont Louis Philippe verbracht und die Stelle betrachtet, wo noch einige Tage zuvor die ineinander verkeilten Schiffe den Fluß aufgestaut hatten. Die Verhandlung vor der sechsten Strafkammer war um halb eins unterbrochen worden. Jozon, der die Anklage vertrat, hatte Antoines Verteidigungsstrategie mit einer üblen Finte pariert, so übel, daß ihm jetzt noch die Hände zitterten vor Wut. Aber das war es nicht allein. Eine Niederlage dieser Art war etwas Neues für den Achtundzwanzigjährigen. Er, Antoine Bertaut, Sohn eines der berühmtesten Pariser Juristen, war Jozon unterlegen, diesem windigen Fuchs, den man nicht zum Richteramt zugelassen hatte, weil er einmal gesagt hatte, er würde am liebsten Kläger, Angeklagten und gleich auch noch die Geschworenen dazu aburteilen und in die Straflager schicken; eine Rechtsauffassung, die sogar den keineswegs zimperlichen Richtern des Zweiten Kaiserreiches als zu extrem erschien. So tobte er sich eben als Staatsanwalt aus, und dies mit einer Hinterhältigkeit, die Antoine völlig unterschätzt hatte. Er wußte, daß die Geschworenen nach der Mittagspause zurückkommen würden, um den Angeklagten Vrain-Lucas zu verurteilen. Deshalb war er dem hektischen Treiben der Wandelhalle im Westflügel des fast fertig renovierten Justizpalastes entflohen und bis auf die Ile St. Louis spaziert, anstatt mit den Kollegen auf dem Boulevard Sebastopol zu Mittag zu essen.
Sein erster großer Fall, und er hatte sich wie ein Anfänger verhalten. Das Vergehen an sich war relativ harmlos. Aber die Affäre hatte Aufsehen erregt. Der Gerichtssaal war bis auf den letzten Platz mit Zuschauern gefüllt gewesen. Mehr als sechshundert Anträge hatte es gegeben und das übliche Gerangel um die Verteilung der Eintrittskarten. Wie gewohnt bot die Zuschauerversammlung ein getreues Abbild der Pariser Bevölkerung: vorne auf den reservierten Plätzen Seide und Spitzen, hinten in den Rängen die blauen Tücher der Arbeiter; unten der Duft von Parfüm, oben der Gestank nach Knoblauchwurst.
Jozon hatte es verstanden, die Arena für einen grandiosen Auftritt zu nutzen. Dabei genoß dieser Vrain-Lucas beim Publikum mehr Sympathie als der zerknirschte Geograph und Mathematiker Chasles, der ihn angezeigt hatte.
Alles hatte damit begonnen, daß Vrain-Lucas besagtem Herrn Chasles einige Briefe anbot, die Pascal an den englischen Chemiker Robert Boyle geschrieben haben sollte. Herr Chasles las die Briefe mit Begeisterung. Was war das für eine tolle Sache! Die Briefe bewiesen, daß Newton Erfindungen zugeschrieben wurden, die in Wirklichkeit von Pascal stammten, der als der tatsächliche Entdecker der Schwerkraftgesetze anzusehen sei. Die Briefe Pascals wurden in das Protokoll der Sitzung aufgenommen.
Doch schon bald meldeten einige Akademiemitglieder Zweifel an der Echtheit der Briefe an, da Pascal sich seltsamerweise eines recht modern klingenden Französisch bediente. Um den Bedenken zu begegnen, legte Herr Chasles Briefe vor, die Pascal an Sir Isaac Newton gerichtet hatte. Unter der Last der Beweise beugten sich die Skeptiker. Um jedoch auch seinen letzten Gegner in der Akademie unter einer Flut von Autographen zum Schweigen zu bringen, breitete Herr Chasles in den darauffolgenden Monaten auf den Tischen der Akademie ganze Korrespondenzen von Galileo Galilei über Luther bis zu Karl dem Großen aus.
Die Quelle all dieser wundersamen Episteln war Vrain-Lucas. Angeblich hatte er sie aus der gigantischen Sammlung eines gewissen Herrn de Boisjourdain besorgt, der als verarmter Erbe eines alten Adelsgeschlechtes gezwungen war, sich mit gebrochenem Herzen von einigen seiner Schätze zu trennen. Da er selbst nicht als Verkäufer in Erscheinung treten wollte, hatte er Vrain-Lucas damit beauftragt, die Briefe zu veräußern. Jene geheimnisvolle Briefesammlung sollte so umfangreich sein, daß Herr Chasles nach Bedarf jedwedes Schriftstück anfordern konnte, das er zur Verteidigung seiner Thesen in der Wissenschaftsakademie gegenüber seinen Widersachern benötigte. Diese wurden freilich immer zahlreicher. Sogar ausländische Gelehrte schalteten sich allmählich in die interessante Debatte ein. Mit immer neuen Dokumenten bot Herr Chasles ihnen die Stirn. Sein gesunder Menschenverstand hatte ihn anscheinend verlassen, und es kam der Augenblick, da seine Glaubwürdigkeit die gleiche Gefahr lief.
Die Sitzung der Wissenschaftsakademie im September 1866 war tragisch für Herrn Chasles. An jenem Tag präsentierte er nämlich einen Brief Galileo Galileis, worin der große Gelehrte auf das Vorwort einer ihn selbst betreffenden Studie aus dem achtzehnten Jahrhundert Bezug nahm. Gleich einem Menschen, der alles verloren hatte, war Herr Chasles gezwungen, zuzugeben, daß er betrogen worden war. Er zeigte den Fälscher unverzüglich an. Vrain-Lucas war leicht zu verhaften gewesen, denn Herr Chasles hatte damit begonnen, ihn überwachen zu lassen, nicht etwa, weil er ihn des Betrugs verdächtigte, sondern aus Furcht, sein Lieferant könnte sich mit seinen Schätzen ins Ausland absetzen.
Eine lange Untersuchung wurde eingeleitet. Die Prüfung der Dokumente förderte Unglaubliches zutage. Herrn Chasles’ Sammlung enthielt nicht nur Briefe berühmter Wissenschaftler, sondern auch Handschriften bedeutender antiker Persönlichkeiten. Es gab da Briefe von Archimedes, Cato, Vergil, Alkibiades, Nero, Caligula, Plato, Sokrates, Anakreon, Cicero, Petrus, Paulus, Herodes, ja von allen und jedem, der in der Weltgeschichte jemals eine Rolle gespielt hatte.
Herr Chasles erklärte dem Gericht, es sei ihm schon seltsam vorgekommen, daß all diese Helden der Antike auf französisch schrieben, doch Vrain-Lucas habe dafür eine einleuchtende Erklärung gehabt: Alkuin, der Minister Karls des Großen, habe all diese Briefe im Kloster von Tours gesammelt. Sieben Jahrhunderte später habe kein Geringerer als Rabelais diese Sammlung entdeckt und einen großen Teil davon übersetzt. Die meisten dieser Übersetzungen seien also Rabelais zuzuschreiben, und ebendiese seien in den Besitz des besagten Herrn de Boisjourdain gelangt.
Seit er Anklage erhoben hatte, war in dem getäuschten Herrn Chasles, der sich lautstark über sein ruiniertes Sammlerglück beklagte, die vage Hoffnung gekeimt, daß wenigstens einige seiner Handschriften authentisch sein könnten. Manche behaupteten sogar, er hege einen stärkeren Groll gegen die Wissenschaftler und Akademiekollegen, die seine Illusionen hämisch gegeißelt, als gegen den Angeklagten, der ihn so schändlich betrogen hatte. Konnte er vielleicht die Stunden des Glücks nicht vergessen, die er durch diesen genossen hatte, als er ihm noch in naivem Vertrauen verbunden war? Ein Kollege hatte Antoine noch am Morgen hinterbracht, was er aus dem Mund eines der Geschworenen gehört hatte: »Der Einfaltspinsel glaubt wahrscheinlich jetzt noch ein wenig an die Existenz dieses geheimnisvollen Herrn de Boisjourdain.«
Antoine schaute verdrießlich über das Wasser. Es war unverzeihlich, daß er sich so sicher gefühlt und geglaubt hatte, die Geschworenen wären auf seiner Seite. Nichts war gefährlicher als scheinbar gewonnene Geschworene. Man mußte sie in jedem Fall von einer Seite ansprechen, mit der sie überhaupt nicht rechneten. Diese Lektion würde er nie vergessen. Dabei hatte Brunet, der Vorsitzende, ihm noch in die Hände gespielt:
»Aber sagen Sie mal«, hatte Brunet den Kläger gefragt, »Sie müssen doch manchmal Zweifel gehabt haben, denn manche dieser sogenannten Handschriften enthalten grobe Datierungsfehler?«
»Ja«, antwortete Herr Chasles, »manche Stücke kamen mir verdächtig vor, zum Beispiel ein Brief, unterschrieben von der ›Witwe Luther‹, ein anderer von ›Mohammed‹.«
Kichern auf der Geschworenenbank.
»… aber Herr Vrain-Lucas drohte, mir mein Geld zurückzugeben und die Schriftstücke zurückzufordern, die ich doch so gerne behalten wollte.«
Antoine hatte sich freilich nicht der Illusion hingegeben, einen Freispruch erwirken zu können. Aber war Herr Chasles für das ganze Ausmaß des Betruges nicht wenigstens mitverantwortlich?
»Ich frage Sie, verehrte Geschworene, trifft den Kläger nicht vielleicht auch ein wenig Mitschuld, und hat Herr Chasles durch sein eigenes Unwissen und seinen vermessenen Geltungstrieb Herrn Vrain-Lucas nicht geradezu gereizt, es nach seinen Anfangserfolgen immer verwegener zu treiben? Wenn Ihnen auf dem Pferdemarkt ein pfiffiger Händler eine alte Schindmähre als ein Rennpferd verkauft, trifft dann nur den Händler die Schuld? Vielleicht, wenn Sie noch nie ein Pferd gesehen haben. Aber wir alle wissen doch, was für ein eminent bedeutender Gelehrter Herr Chasles ist. Ich will nicht wagen zu behaupten, Herrn Chasles’ wissenschaftlicher Instinkt sei durch seinen Erfolgsdrang derart getrübt gewesen, daß er sich vielleicht sogar wissentlich zum Komplizen von Herrn Vrain-Lucas gemacht hat. Niemand kann das Verhalten des Angeklagten entschuldigen, aber um jemanden einer arglistigen Täuschung zu bezichtigen, bedarf es zumindest eines ahnungslosen Opfers. Herr Chasles ist Mitglied einer wissenschaftlichen Akademie, Autographen sind seine Leidenschaft. Er gilt auf diesem Gebiet geradezu als Autorität …«
Auf der Geschworenenbank stahl sich hier und da ein Grinsen auf die Gesichter der Zuhörenden. Und während Antoine fortfuhr, Vrain-Lucas’ Vergehen mehr und mehr in ein gewitztes Bubenstück zu verwandeln, das zwar zu bestrafen, aber im Grunde harmlos war, wurde aus dem bösartigen, durchtriebenen Fälscher auf der Anklagebank allmählich ein einfacher, kleiner Betrüger, dem ein eitler, selbstgefälliger Gelehrter die Möglichkeit eingeräumt hatte, die ganze Wissenschaftlerzunft zum Narren zu halten.
Jozon, der Anklagevertreter, hatte Antoine die ganze Zeit über nicht einmal angesehen. Statt dessen machte er sich Notizen oder beobachtete die Reaktionen der Geschworenen. Es schien fast, als habe er Mitleid mit dem jungen Anwalt, der ihm das Feld so kampflos überlassen wollte. Er hegte keinen Groll gegen Antoine, den er hier zum ersten Mal zum Gegner hatte. Er war ja erst vor sechs Monaten in die Anwaltszunft aufgenommen worden und daher noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Hätte er Lachaud vor sich gehabt, diesen Hitzkopf, wegen dessen Wutausbrüchen man seit neuestem eine Holzschranke vor der Geschworenenbank installiert hatte, weil Lachaud bisweilen Gefahr zu laufen schien, in die Geschworenenbank hinaufzuspringen; oder Léon Duval, diesen geistreichen Schwätzer, der ihm vor Jahresfrist einen todsicher mit zehn Jahren Steinbruch zu ahndenden betrügerischen Konkurs vereitelt hatte. Mit diesen beiden hätte er gerne eine Rechnung beglichen. Statt dessen gab es heute nur diesen Anfänger aus dem Feld zu schlagen, der den Grundfehler beging, seinen Geschworenen etwas vorzubeten, was diese längst wußten.
Jozon würde ihnen etwas erzählen, was sie nicht wußten, denn nur dadurch war ihnen die notwendige Angst einzujagen, ohne die kein Urteilsspruch zustande kommt. Er wußte längst, welches Rädchen er in den Köpfen der auf der Geschworenenbank versammelten Bürger anstoßen mußte, um diesen Urkundenfälscher für fünf Jahre hinter Schloß und Riegel zu bringen. Leider nur fünf Jahre, aber wenigstens dieses Höchstmaß wollte er voll ausschöpfen.
»Hohes Gericht, verehrte Geschworene«, begann er. »Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ein einfacher Bürger wie Sie und ich hat einen großen Gelehrten vor aller Welt als Narren hingestellt. Verständlich, daß wir eine heimliche Genugtuung empfinden. Denn wollen wir nicht alle bisweilen den großen Köpfen aus Wissenschaft und Politik gerne einen Streich spielen? Aber ich bitte Sie, einen Moment darüber nachzudenken, ob Herr Vrain-Lucas nur ein einfacher Betrüger ist oder ob sich hinter seiner Tat nicht ein Angriff auf die Grundfesten unserer Zeit verbirgt, auf Grundsätze und Prinzipien, die unser aller Wohlergehen bedeuten.«
Er stolzierte gewichtig durch den Raum und streute durchdringende Blicke in das Publikum. Dann hob er die Hand, senkte die Stimme ein wenig, trat vor die Geschworenen hin und fixierte einen nach dem anderen, indem er fortfuhr:
»Meine Herren, ich nehme an, daß nicht wenige von Ihnen das großartige Projekt des Isthmusdurchstichs der Suez-Kompagnie durch eine Zeichnung von Wertpapieren unterstützt haben?«
Plötzlich war es totenstill im Saal. Antoine war zu verdutzt, um gegen diesen seltsamen Argumentationsstrang Einspruch zu erheben, und bevor ihm richtig zum Bewußtsein gekommen war, was für einen Keim Jozon dort gelegt hatte, fuhr der auch schon fort, die Saat zu gießen.
»Angenommen, ich fälschte eine diplomatische Geheimdepesche, aus der hervorgeht, daß England beabsichtigt, Truppen nach Ägypten zu verlegen, um das Kanalprojekt durch Kriegsdrohung zu sabotieren. Die Depesche wird der Presse zugespielt, die sie eifrig veröffentlicht. Am selben Tag stürzen Ihre Aktien ins Bodenlose …«
»Einspruch, Euer Ehren«, rief Antoine jetzt endlich. »Meinem Mandanten wird nichts dergleichen vorgeworfen, dieser Vergleich ist infam …«
»Stattgegeben«, sagte Brunet und blickte Jozon scharf an. »Meine Damen und Herren, vergessen Sie diesen Vergleich.«
Antoine brauchte jedoch nicht zweimal in die Gesichter der Bürger auf den Rängen zu blicken, um das Ergebnis von Jozons Winkelzug zu erkennen. Jeder dort oben besaß Suez-Aktien. Paris war im Aktienfieber, und selbst die spektakulärsten Konkurse konnten die Menschen nicht davon abbringen, ihren letzten Besitz in hochriskanten Großvorhaben anzulegen. Bei der letzten Ausgabe von Suez-Aktien war es vor den Bankschaltern sogar zu Schlägereien gekommen. Die Geschworenenbank sah plötzlich aus wie erstarrt.
»Nun gut. Herr Vrain-Lucas hat sich ja auch nicht auf die Fälschung von diplomatischer Post spezialisiert, sondern auf die betrügerische Erfindung historischer Quellen. Doch wie steht es damit, meine Herren? Abgesehen vom finanziellen Schaden, den ich Ihnen ja bereits erläutert habe. Muß ich das unselige Buch erwähnen, das gegenwärtig jeden aufrechten Christenmenschen mit Ekel und Verachtung erfüllt, jenes widerwärtige ›Leben Jesu‹, das nichts anderes ist als die vorsätzliche Verunglimpfung all unserer Glaubensinhalte …«
»Einspruch, Euer Ehren«, rief Antoine erbost. »Es geht hier nicht um das Buch von Herrn Renan. Maître Jozon …«
»… oder jenes von Charles Darwin, der behauptet, der Mensch stamme vom Affen ab …«
»Einspruch, Euer Ehren …«
»… und Leute wie der hier Angeklagte liefern diesen Scharlatanen vielleicht auch noch die erfundenen Beweise für ihre ketzerischen Theorien …«
»Einspruch!!« brüllte Antoine jetzt.
»Jozon!« donnerte Brunet. »Wenn Sie nicht bei der Sache bleiben, ist Ihr Plädoyer jetzt zu Ende. Meine Herren, die eben gemachten Ausführungen bleiben für Ihre Urteilsfindung unberücksichtigt. Jozon, noch eine solche Abschweifung, und ich entziehe Ihnen das Wort.«
Doch Jozon hatte erreicht, was er wollte. Im Zuschauerraum war Erregung entstanden. Darwin. Renan. Allein diese beiden Namen genügten, um den leibhaftigen Teufel heraufzubeschwören. Renan, der die Widersprüche in der Bibel aufgedeckt hatte, und dieser Darwin mit seiner absurden Evolutionstheorie. Und wenn das Verbrechen dieses Angeklagten auch noch mit einem drohenden Sturz der Aktienkurse in Zusammenhang gebracht werden konnte, so war seine sofortige Entfernung allerhöchstes Gebot.
»Verzeihen Sie mir«, sagte Jozon und hob unschuldsvoll die Hände hoch, »doch als Vertreter der Anklage ist es meine vornehmliche Pflicht, den Staat und die Öffentlichkeit vor drohenden Übeln zu schützen. Herr Bertaut hat Ihnen die Karikatur eines Betruges vorgeführt, und Sie haben mit Recht gelacht. So muß es mir auch gestattet sein, Ihnen die Fratze des Verbrechens zu enthüllen. Ich habe Ihnen das wahre Gesicht dieses angeblichen Bubenstücks gezeigt. Es ist an Ihnen, zu entscheiden, wie weit wir dergleichen kriminelle Subjekte von uns stoßen wollen. Doch sagen Sie nachher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt, und kommen Sie nicht zu mir mit Heulen und Zähneklappern!«
Antoine saß reglos da und lauschte den weitschweifigen Ausführungen Jozons. Dieser war klug genug, sich keinen weiteren Verstoß zu leisten, sondern beschränkte sich darauf, die gelegte Lunte ungestört brennen zu lassen. Antoine mußte hilflos zusehen. Das Geld und die Religion, dachte er fluchend. Die besten Zangen, um einen Bürger zu zwicken. Jozon hatte ihn vorgeführt wie einen dummen jungen Studenten.
Antoines Plädoyer geriet zum Fiasko. Als er zum Ende gekommen war, gähnten zwei Geschworene. Einer schlief. Brunet verordnete eine dreistündige Mittagspause.
Die Urteilsverkündung war auf sechzehn Uhr anberaumt. Als Antoine bei seiner Rückkehr erfuhr, daß die Geschworenen nach zwanzig Minuten mit ihren Beratungen fertig gewesen waren, sank seine Stimmung noch tiefer. Vrain-Lucas saß bekümmert da und lauschte fassungslos dem Urteilsspruch. Wie erwartet, hatte die Jury ihn schuldig gesprochen. Einziger Trost für Antoine und seinen Mandanten war es noch, daß Brunet sich nicht an das von Jozon geforderte Strafmaß hielt. Brunet warf dem Kläger Chasles grobe Fahrlässigkeit vor und verwies Jozon auch noch einmal wegen seines Plädoyers. Dennoch wurde Vrain-Lucas zu drei Jahren Haft verurteilt und sogleich abgeführt. Das Spektakel war vorüber, und die Reihen der Zuschauer lichteten sich rasch. Jozon verließ den Saal ohne ein weiteres Wort. Antoine schaute ihm zerknirscht hinterher. Dann packte er seine Unterlagen zusammen.
Plötzlich sprach ihn jemand an.
»Trotz allem ein gerechter Spruch, meinen Sie nicht auch, Maître Bertaut?«
Er wußte, auch ohne aufzusehen, wen er vor sich hatte. Der Gerichtsreporter Marivol, genannt »Die Feder«, war der bekannteste Einrichtungsgegenstand des Palais de Justice. Er hatte zwei Spezialgebiete: Verbrechen und Gesellschaftsklatsch, den er den Hausmädchen und Domestiken ablauschte, um Glossen daraus zu destillieren, die reißenden Absatz fanden. Seine Gerichtsreportagen wurden von der Pariser Bevölkerung mit ähnlicher Begeisterung gelesen wie die beliebten Fortsetzungsromane. Der Grund dafür war, daß zwischen ihnen kaum ein Unterschied bestand. Marivol verstand es, selbst die gewöhnlichsten Kriminalfälle in den schaurigsten Farben auszumalen, und das Publikum liebte ihn dafür. Niemand nahm ihn so recht ernst, aber alle fürchteten seine Feder. Antoine hatte ihn früher, als er noch als Zuschauer den Prozessen beiwohnte, bisweilen beobachtet. Damals plazierte der Journalist sich entweder am Protokollantentisch neben den Gerichtsschreibern, was eher selten vorkam, oder, was die Regel war, im Publikum in der Nähe der stets überrepräsentierten Damen. Seit beim Umbau des Gebäudes neben der Geschworenenbank ein Stand für die Presse eingerichtet worden war, verfolgte der Zeitungsschreiber das Geschehen von dort aus, wenn nicht eine Zuschauerin seine Aufmerksamkeit gefangennahm. Marivol erschien immer vorbildlich gekleidet, und seinem ganzen Wesen haftete eine Eleganz an, die zu seiner Tätigkeit in auffallendem Widerspruch stand. Sein Handwerk hatte er auf der Krim gelernt, wo er als Kriegsberichterstatter gearbeitet hatte. Dafür hätte Antoine ihm noch Respekt gezollt. Doch was dieser windige, umtriebige Journalist gewöhnlich in den Zeitungen abdrucken ließ, erfüllte ihn meist mit Widerwillen oder Abscheu. Deshalb hatte er den Beinamen des Journalisten vielsagend erweitert. In der Tat, eine Feder: für den Gaumen.
»Rechtens vielleicht«, entgegnete Antoine. »Aber gerecht an der ganzen Sache ist höchstens die Lektion, die ich bezogen habe.«
»Machen Sie sich nichts draus. Jozon ist ein alter Feigling. Er reitet nur gegen Schwächere in die Schlacht.«
»Vielen Dank.«
»Nein, verstehen Sie mich nicht falsch …«
»Es war ein langer Tag, Monsieur Marivol. Was sich hier heute abgespielt hat, werden wir ja morgen alle in der Zeitung lesen dürfen.«
Antoine wandte sich brüsk zum Gehen. Das fehlte ihm jetzt gerade noch, Belehrungen von dieser Canaille.
»Und vergessen Sie nicht, Ihren Lesern zu empfehlen, schnellstens Ihre Suez-Aktien abzustoßen. Sie gestatten?«
Marivol schaute ihm bekümmert nach.
Sehr eitel, dachte er.
Der Boulevard vor dem Palais de Justice war trotz des schlechten Wetters von Passanten bevölkert. Lediglich die Stühle auf den Gehsteigen standen verwaist an den Häuserwänden. Antoine sprang auf einen vorbeifahrenden Omnibus auf und stieg die Treppe in das für Männer reservierte Oberdeck hinauf.
Seine Verabredung mit Nicholas Sykes kam ihm in den Sinn. Am liebsten hätte er abgesagt. Die Niederlage gegen Jozon hatte ihm jede Lust auf Vergnügungen genommen, aber vielleicht würde ihn der Engländer auf andere Gedanken bringen. Nicholas hatte ihm schon vor Wochen hinter vorgehaltener Hand von einer Touristenattraktion berichtet, die so exklusiv sei, daß selbst alteingesessene Pariser kaum jemals dazu zugelassen wurden. Am Vorabend hatte Antoine eine Nachricht bekommen, daß die Sache am Montag abend stattfinden würde.
Nicholas war Ingenieur und seit einem halben Jahr in Paris. Er hatte die technische Leitung beim Bau des unterirdischen Aquariums der Weltausstellung. Tatsächlich gab es zwei davon, ein Salzwasser- und ein Süßwasseraquarium. Aber die Probleme beim Bau waren die gleichen. Das Projekt schien mehr als phantastisch. Angeblich sollten sogar Menschen in Unterwasseranzügen in den Becken herumlaufen und dort Arbeiten auf dem Meeresgrund simulieren. Durch lange Schläuche wollte man sie mit Luft versorgen. Wie verrückt das ganze Vorhaben war, zeigte sich schon allein daran, wer sich dafür überhaupt interessiert hatte: ein für phantastische Erzählungen bekannter Schriftsteller war bei Nicholas vorstellig geworden und hatte ihn stundenlang über diese Technik ausgefragt; ein gewisser Verne, der seine Abenteuergeschichten in den gleichen Zeitungen veröffentlichte, in denen auch Marivol seine Gerichtsreportagen verbreitete.
Antoine hatte Nicholas einige Male ins Varieté mitgenommen. Jetzt wollte sich der Engländer wohl revanchieren und hatte sich diese Abendunterhaltung ausgedacht, von der Antoine immer noch nicht wußte, worum es sich handelte. Was sollte schon so exklusiv sein, daß er nicht einmal davon gehört hatte?
Nein. Am liebsten hätte er abgesagt. Die Niederlage setzte ihm mehr zu, als er erwartet hatte. Schließlich wußte er nicht, was sich zur gleichen Zeit in Belleville anbahnte.
III.
Die Polizei nahm noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Untersuchung der Tatumstände auf. Die Behausung der mutmaßlichen Kindesmörderin, ein Bretterverschlag in einer als »Sandhügel« bezeichneten Hüttensiedlung unweit der Kalköfen von Belleville, wurde gegen Mitternacht einer ersten Prüfung unterzogen. Der Raum, in dem das Drama seinen Anfang genommen hatte, war vielleicht drei mal vier Meter groß. Die Wände der Behausung bestanden aus einfachen Holzbrettern, die auf runde Pfosten genagelt waren. Das Dach war eine phantastische Konstruktion aus zusammengebundenen Holzstücken, über die ein gewachstes Tuchmaterial gespannt war. Bei genauerem Hinsehen erkannte man, daß manche der Holzstücke in Wirklichkeit Knochen waren, die wohl aus einer Pferdeabdeckerei entwendet worden waren. Der wetterfest beschichtete Stoff stammte von einem Lastkahn.
Ein Fenster gab es nicht. Der Lehmboden war feucht und uneben, die Tür reichte nur bis etwa eine Handbreit über den Boden. Der Grund war hier allerdings abschüssig, so daß am Eingang kein Wasser hereinfließen konnte. Gegen Insekten und kleinere Tiere bot die Tür freilich keinen Schutz. Doch durch den wochenlangen Regen gab es wenig Ungeziefer.
Die Einrichtung der Behausung war spärlich. Sie bestand aus einer Schlafstätte, einem Ofen, einer Holzkiste und einem Schemel. An den Wänden waren einige zerrissene Tücher gespannt, die dem durch die Ritzen pfeifenden Wind ein wenig von seiner Schärfe nehmen sollten. Auf dem Schemel stand ein Holzteller, von dessen völlig verkratzter Oberfläche ein aus Wachsresten zusammengebackener Kerzenstumpf emporwucherte. Die Holzkiste daneben war unverschlossen und enthielt neben einigen wenigen Lebensmitteln wie Linsen und Kartoffeln auch Kochutensilien sowie einen abgebrochenen Schirmgriff aus Rhinozeroshorn. An einer quer durch die Stube gespannten Leine hingen zum Trocknen einige Wäschestücke, insbesondere völlig verschlissene, jedoch saubere Lumpen, die wohl als Windeln dienten. Neben dem Ofen fanden sich ein Lochsieb aus Horn sowie zwei Blechtöpfe. Zur Zeit der Durchsuchung war die Hütte verlassen.
Als Eigentümlichkeit vermerkte das Polizeiprotokoll noch, daß in einem an der Rückwand der Hütte angebrachten Verschlag ein Sack mit sieben toten Ratten gefunden wurde. Weder der ohnehin vermißte Ehemann der Verhafteten noch ihr älterer Sohn wurden angetroffen. Über den Verbleib des älteren Sohnes namens Johann war nur in Erfahrung zu bringen, daß er sich nach Aussage der Nachbarin gemeinhin in den Kalksteinbrüchen aufhielte und nur selten hierher zum Sandhügel kam. Die Nachbarin sagte außerdem, daß sie Frau Lazès am Sonntag noch mit ihrem kleinen Kind gesehen habe. Das Kind sei kränklich gewesen und habe den ganzen Tag und ein gut Teil des Abends geweint.
Erst spät in der Nacht sei Ruhe eingekehrt.
II. Kapitel
I. Heft, 7. Juli 1992
Sie saß an einem der Kartentische und hatte den ganzen Morgen nicht ein einziges Mal hochgeschaut, eine Beobachtung, die erkennen läßt, wie oft ich in den letzten zwei Stunden zu ihr herübergeblickt hatte.
Ich war bereits seit Oktober in der Stadt, hatte den Besuch in dieser Bibliothek jedoch immer wieder vor mir hergeschoben. Schließlich schrieb ich eine Doktorarbeit über Architekturgeschichte und keine historische Abhandlung über Paris. Aber die Mahnungen meines Professors, mich auch ein wenig mit dem Zweiten Kaiserreich zu beschäftigen, konnte ich nicht länger ignorieren. Ohne Kenntnis der Zeitumstände sei das Weltausstellungsgebäude von 1867 nicht zu verstehen, hatte er mir wiederholt vorgeworfen. So begann es. An einem Dienstag im März.
Die historische Bibliothek der Stadt Paris ist in einem Hôtel, also einem vornehmen, ehemaligen Privathaus, untergebracht. Durch zwei aufeinanderfolgende Glastüren, zwischen denen geraucht werden durfte, gelangte man in die Empfangshalle, wo neben der Pförtnerloge der Katalog stand. Der größere, linke Gebäudeflügel mit Sicht auf den Garten beherbergte den Lesesaal. Der andere Gebäudeteil war dem Kartenbereich vorbehalten. Man bog aus der Eingangshalle nach rechts ab und sah gleich die großen Kartentische. Dahinter schloß sich ein weiterer Raum an, in dem ein Kamerastativ aufgebaut war, das man benutzen durfte, um alte Karten, Pläne oder Bilder abzuphotographieren.
Die Nachfrage nach Bild- und Kartenmaterial schien gering zu sein. Nur einer der sechs Tische war belegt, der zweite auf der Fensterseite zum Innenhof. Ein kleines Schild wies darauf hin, daß hier jemand für einen längeren Zeitraum einen Platz reserviert hatte. Vier riesige Folianten, Jahrgänge von Zeitungen, lagen da. Davor stand eine Reihe von vielleicht zehn oder zwölf Büchern, aus denen einige dieser selbstklebenden gelben Notizzettel heraushingen, die aus wissenschaftlichen Bibliotheken ebensowenig mehr wegzudenken sind wie Photokopiergeräte. Vor der Bücherreihe lag eine Papierrolle, vermutlich ein Stadtplan. Ich plazierte mich am letzten Tisch auf der Wandseite neben dem Durchgang zum Photoraum, packte meine Unterlagen aus und verbrachte die nächste dreiviertel Stunde am Bildkatalog und mit dem Ausfüllen von Bestellscheinen.
Als ich zurückkam, sah ich sie zum ersten Mal. Einer der Folianten war aufgeschlagen. Sie schrieb daraus etwas ab. Sie mußte kurz nach mir gekommen sein, denn neben ihr lagen bereits drei eng beschriftete Papierbögen. Sie hatte die Beine übereinandergeschlagen, saß konzentriert über ihre Arbeit gebeugt, den linken Arm auf dem Folianten, den Zeigefinger auf die Stelle gelegt, die sie gerade übertrug, die rechte Hand gleichmäßig schreibend. Sie benutzte einen Füller. Eben fiel etwas Sonnenlicht durch das Fenster und leuchtete den Raum angenehm aus. Im Vorbeigehen sah ich kurz ihre Hände und das vom Druck auf den Füller blutleer und hell erscheinende Nagelbett ihres Zeigefingers. Von ihrem Gesicht sah ich kaum mehr als die Stirn und einen Teil der Wangenpartie. Ihr Haar war dunkel. Sie trug es hochgesteckt.
Ich hatte ein unverfängliches Bonjour auf den Lippen, falls sie aufblicken sollte, was jedoch nicht geschah. Ich hatte mir diese Geste schnell angewöhnt. Wenn die Menschen in Frankreich in der Öffentlichkeit plötzlich in eine unerwartete Intimität mit Unbekannten gezwungen werden, im Fahrstuhl etwa oder in einem Wartezimmer, dann habe ich es selten erlebt, daß man sich einfach anschwieg. Zu Beginn meines Aufenthaltes hier in Paris war ich manchmal darüber erschrocken, wenn sich ein wildfremder Mensch im Bus neben mich setzte und bonjour sagte. Während der Weihnachtsferien, die ich zu Hause in Deutschland verbrachte, hatte ich festgestellt, daß es mir jetzt eher merkwürdig vorkam, wenn diese Geste ausblieb.
Ich bekam den ganzen Morgen über nichts zustande. Wieder und wieder mußte ich zu ihr hinüberschauen. Manchmal ging jemand in den Repro-Raum. Sobald ich Schritte hörte, hob ich den Kopf, schaute jedoch immer gleich auf sie und erst dann auf die Person, die zwischen uns vorbeiging. Von meinem Platz aus konnte ich ihren Nacken sehen, ihre Arme, ihren Hinterkopf mit einer silbernen Haarspange. Manchmal auch einen Teil ihres Profils, schmal geschnittene Augen mit langen Wimpern oder das flüchtige Bild fein modellierter Lippen. Ich habe auch ihre schmale Taille angeschaut und maß ihren Oberkörper mit indiskreten Blicken, als sie sich einmal zurücklehnte und sich ihre Weste um ihre Brüste spannte. Doch sie unterbrach ihre Konzentration selten. Sie schrieb und schrieb, den Blick abwechselnd auf das vergilbte Zeitungspapier, dann wieder auf die weißen Blätter gerichtet, die vor ihr lagen. Einmal fiel ihr eine Haarsträhne über die Augen. Sie strich sie mit der linken Hand zur Seite, ohne den Füller abzusetzen.
Ich zwang mich, die Photographien zu betrachten, die man mir aus dem Magazin gebracht hatte, fast hundert Originalaufnahmen von den unterschiedlichen Bauphasen des Weltausstellungsgebäudes von 1867. Man konnte gut erkennen, mit welch primitiven Mitteln die Grundarbeiten durchgeführt worden waren. Ich sah einfache Pferdegespanne, die Erde wegbeförderten. Arbeiter wuchteten Stützpfähle von einem Karren, dessen mannshohe Räder im Schlamm feststeckten. Die Pferde waren stämmig und gedrungen. Ein vom Trocadéro aufgenommenes Bild der Frühphase ließ erkennen, warum manche Zeitgenossen das Gebäude als Gasometer verspottet hatten. Der äußere Stahlkranz des riesigen Ovals, die spätere Maschinengalerie, nahm sich aus wie das Strebengewirr einer Achterbahn.
Die Ausführungen meines Doktorvaters klangen noch in mir nach. Gebäude sind nicht nur technische Gebilde, hatte er mich belehrt. Es sind auch Zeichensysteme.
Er war im Februar für ein paar Tage in der Stadt gewesen und hatte mich zusammen mit einem befreundeten Architekten zum Essen eingeladen. Wir trafen uns in einem Restaurant mit dem seltsamen Namen La pluie et plus rien, was übersetzt etwa soviel bedeutete wie »Regen und Schluß«. Der Sinn dieses Restaurantnamens ist mir bis heute ein Rätsel geblieben. Das Lokal befand sich in einer Seitenstraße der Champs-Elysées, verfügte über nicht mehr als acht Tische, die, wie ich erfuhr, stets auf Wochen im voraus reserviert waren. Es gab keine Preise auf der Speisekarte, so daß ich erst gar nicht in die übliche Verlegenheit des Eingeladenen kam, sondern nur nach dem Wohlklang der Gerichte wählen konnte. Allein die Phantasienamen dieser Gerichte waren schon einen Besuch wert. Mein Professor empfahl mir augenzwinkernd ein Horsd’œuvre namens Les danseuses du pré. Ich willigte ein und wartete gespannt, was es mit diesen Wiesentänzerinnen wohl auf sich haben mochte. Er selbst entschied sich für ein Lachscarpaccio, und sein Kollege, ein sehr interessant aussehender Endvierziger, aus Algerien stammender Architekt mit ausgesprochen schönen Händen, wählte einen chèvre chaud. Die Wiesentänzerinnen entpuppten sich als Froschschenkel, und Cyril, so hieß der Freund meines Professors, lachte nicht schlecht, als er mein Gesicht sah. Es wurde ein sehr netter Abend. Der Franzose nannte mich gleich beim Vornamen und bat mich, es ihm gleichzutun. Mein Doktorvater folgte, hielt mir sein Glas hin und sagte: »Heinrich«. Allerdings waren wir schon bei der zweiten Flasche Rotwein angelangt, bevor mir bei ihm diese plötzliche Vertraulichkeit unbeschwert über die Lippen ging. Auch ihm entglitt anfänglich noch das gewohnte »Herr Tucher«, bis er sich zwei Stunden später, bei Cognac und Zigarren angelangt, zurücklehnte und mir zufrieden zurief: »Bruno, wenn du jemals ein nettes Mädchen in Paris ausführen willst, dann versprich mir, daß du hierherkommst.«
Ich versprach es.
Ein Ergebnis dieses Abends und unseres »Fachgesprächs« am nächsten Tag war, daß ich mich nicht länger um etwas herumdrücken konnte, was ich seit Oktober vor mir hergeschoben hatte: die leidige Erforschung der Bauvorbereitung. Daß ich sie würde erwähnen müssen, wußte ich. Aber da ich mich nicht sonderlich dafür interessierte, hatte ich mich mit einem, wie ich glaubte, geschickt plazierten Absatz in der Einleitung darum herumgemogelt. Ich liebe an Gebäuden die Einzelheiten, die technischen Details. Raumplanerische Aspekte haben mich noch nie sonderlich fasziniert. Aber Heinrich bestand darauf. Er war sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen, was die Konstruktionsseite betraf, meinte jedoch, ich müßte bei der Erörterung der Bauvorbereitung und der Frage der Bauplatzwahl viel genauer vorgehen.
»Wie viele Grundstücke standen denn für die Weltausstellung zur Diskussion?« hatte er mich gefragt. Wir saßen in einem Café unweit der Hallen, von wo er in zwei Stunden den RER zum Flughafen Charles de Gaulle nehmen würde.
»Zweiundzwanzig«, sagte ich.
»Und warum wurde das Marsfeld gewählt?«
»Es war unbebaut, lag in Stadtnähe und bildete eine zusammenhängende Fläche. Die Bevölkerung war an Festlichkeiten und denkwürdige Ereignisse dort gewöhnt. Über die Seine hatte man einen guten Transportanschluß für Material und Besucher.«
»Wem gehörte das Gelände?« fragte er.
»Dem Kriegsministerium. Das war auch ein Vorteil. Im Katastrophenfall hätte man von der Ecole Militaire rasch Hilfe bekommen können.«
Er schüttelte den Kopf.
»Sicher. Aber die Stadt konnte das Gelände nicht erwerben, oder?«
Ich überlegte, worauf er hinauswollte. Er fuhr fort.
»Nach der Ausstellung mußte das Gelände im ursprünglichen Zustand zurückgegeben werden. Was heißt das?«
»Daß man es wieder abreißen mußte.«
»Ja. Eben.«
Er schaute mich an, aber ich begriff beim besten Willen nicht, was ihm daran wichtig vorkam.
»Bruno«, sagte er, »hast du dich mit dem Zweiten Kaiserreich beschäftigt?«
»Ja, sicher«, antwortete ich verwirrt.
»Und was bedeutete die Weltausstellung für Napoleon?«
»Sie sollte der Menschheit die Wunder der Welt vor Augen führen, alle Kenntnisse und Fähigkeiten versammeln …«
»Ja, ja, aber wie war die Situation Frankreichs zu dieser Zeit? Wie war die Stimmung im Land, der Zeitgeist? Gebäude sind nicht nur technische Gebilde. Sie sind auch Zeichensysteme. Es gibt technische Gründe für bestimmte Entscheidungen. War Beton schon erfunden? Was kostete Stahl? Das hast du alles sehr gut herausgearbeitet. Aber das politische Gewebe des ganzen Projekts fehlt mir noch. 1867. Was fällt einem da als erstes ein?«
Ich begann, mich unwohl zu fühlen über den Verlauf, den das Gespräch eingeschlagen hatte. Dadurch, daß wir uns seit dem Vortag duzten, bekamen seine lehrerhaften Ausführungen nun etwas Persönliches, das mich verletzte. Ich wäre lieber der Student gewesen, dem man eine Aufgabe stellt, als ein gleichgestellter Kollege, dem man vorwirft, eindimensional zu sein. Die Wahrheit war, daß mir zu 1867 nicht viel einfiel. Auch zu der Antwort nicht, die er sich selber gab.
»1866 natürlich.«
Es dämmerte mir erst, als er konkret wurde.
»Königgrätz. Preußen hat Österreich geschlagen. In Neudeutsch übersetzt: Die Sowjetunion ist in Afghanistan einmarschiert. Oder: China hat die Bombe. Der Vergleich hinkt natürlich, wie alle Vergleiche. In der Geschichte wiederholt sich ja nichts. Auch nicht als Farce, wie Marx geschrieben hat. Ein Artikel, den du übrigens mal lesen solltest.«
»Welchen Artikel?« fragte ich mürrisch.
»Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, von Karl Marx. Ein Glanzstück des politischen Journalismus. Sei doch nicht eingeschnappt. Ich will dir doch nur helfen.«
»Du klingst wie diese postmodernen Architekturkritiker aus der FAZ, die noch nie im Leben einen Strich mit Tusche gezogen haben«, sagte ich ärgerlich.
Er überging die Unverschämtheit, die mir sofort leid tat.
»Bruno«, sagte er und legte mir freundschaftlich die Hand auf die Schulter, »Napoleon III. war ein Diktator, ein Usurpator. Aber auch ein Visionär. Er sah sich als die Reinkarnation seines Onkels, als Herrscher Europas. Sein ganzes Regime war auf Repräsentation ausgerichtet. Endlose Feste, Prunkbauten, halb Paris läßt er abreißen und neu aufbauen. Er spielt sich als Schiedsrichter auf. Erst im Krimkrieg. Dann nach dem Italienfeldzug. Doch wie steht es mit Frankreich im Jahr 1867? Preußens Blitzsieg über Österreich war ein Schock für Frankreich. Das Zündnadelgewehr ist in aller Munde. Das Zündnadelgewehr! Hört sich putzig an für uns heute, nicht wahr? Weißt du, was es für die Menschen damals bedeutet hat? Es war ein Reizwort, wie vor ein paar Jahren noch für uns Begriffe wie Pershing, Cruise Missile oder SS