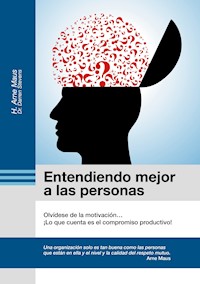Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
H. Arne Maus erklärt in seinem Buch die Bausteine des Denkens und wie man Menschen besser versteht. Lernen Sie, warum Menschen tun, was sie tun. Erfahren Sie den Unterschied zwischen Managern und Führungskräften und wie sie für jede dieser Rollen erforderlichen Profile identifiziert werden können. Darüberhinaus zeigt Arne Maus den Einfluss von Kognitiven Absichten in beruflichen Situationen auf und wie viel man gewinnt, wenn man sie bei der Einstellungsentscheidung berücksichtigt. Ziel ist es, die richtige Person für den richtigen Job zu finden - das erhöht die Effizienz des Arbeitsplatzes und gleichzeitig die Arbeitszufriedenheit in den Unternehmenskulturen - sei es auf der Ebene des Unternehmens, der Abteilung oder des Teams. Erkennen Sie den Unterschied zwischen Motivation und Engagement. Dieses Buch zeigt, warum Motivation nicht ausreicht. Heute können wir messen, wie das Engagement innerhalb einer Organisation ist und zu welcher Art von Produktivität sie führt. Damit zeigen wir auch die Hebel zur Verbesserung des Engagements und der Produktivität. Der Autor ist der Entwickler des Identity Compass. In seiner Arbeit hat er den Schwerpunkt auf die Messung von Kognitiven Absichten gelegt. Durch die Identifizierung dieser unbewussten Präferenzen, seien es von Managern, Führungskräften, Mitarbeitern oder sogar Kunden, kann ein Unternehmen motivierende und demotivierende Faktoren im Arbeitsumfeld messen und neue Wege finden, um ideale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen. Dies erhöht nicht nur die Effizienz am Arbeitsplatz, sondern ermöglicht Unternehmen auch, intelligente Wege zur Senkung der Personalkosten zu finden. Dieses Buch unterstützt auch Coaches und Trainer dabei, ihre Kunden und Teilnehmer intensiver und effektiver zu einem nachhaltigen Erfolg zu führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DANKSAGUNG
Ich danke Barbara Walther, Jürgen Wulff und Prof. Dr. David Scheffer, die mich tatkräftig beim Schreiben dieses Buches unterstützten. Dank an Darren Stevens, der die englische Fassung des Buches so unermüdlich Korrektur gelesen hat und nun das Kapitel 8 zusammen mit Barbara Walther schrieb. Und Danke auch an meine Lektorin Melina Streckert und die Teilnehmer meiner Trainings für die zahlreichen Anregungen.
Dieses Buch widme ich:
Sabine Tobias Daniel Angels
INHALT
VORWORT
KAPITEL 1
Warum Profilsysteme einsetzen?
1.1 Wie betreiben Sie einen Mitarbeiter?
1.2 Investition in die Mitarbeiter sichern
KAPITEL 2
Anforderungen an ein Profilsystem
2.1 Handhabbarkeit
2.2 Abgleich mit Stellenprofilen
2.3 Sind die Ergebnisse nützlich?
2.4 Ergebnisse kommunizierbar?
2.5 Wie ist die soziale Akzeptanz?
2.6 „Darf’s auch ein paar Details mehr sein?“
KAPITEL 3
Denken heißt tilgen
3.1 Kompensation der Tilgung
3.2 Gesetz der Aufmerksamkeit
3.3 Was sind Kognitive Absichten?
3.4 Standortbestimmung als Unternehmen
3.5 Die Entdeckung der Kognitiven Absichten
3.6 Definition von Kognitiven Absichten
KAPITEL 4
Hintergrund
4.1 Logische Ebenen des Lernens
4.2 Neurologische Ebenen
4.3 Einordnung der Kognitiven Absichten
KAPITEL 5
Wozu ist das alles wichtig?
5.1 Motivation hilft – gutes Engagement mehr
5.2 Studie: Kosten schlechter Führung
KAPITEL 6
Kognitive Absichten - Übersicht
6.1 Wahrnehmung
Sinneskanal
Primäres Interesse
Perspektive
6.2 Motivationsfaktoren
Werte
Motiv
Richtung
Referenz
Planungsstil
Primäre Aufmerksamkeit
6.3 Motivationsverarbeitung
Aktivitätsgrad
Vergleichsmodus
Primäre Reaktion
Erfolgsstrategie
Erfolg gestalten – Erfolgsstrategie in der Praxis
Arbeitsorientierung
6.4 Informationsverarbeitung
Informationsgröße
Denkstil
Arbeitsstil
Zeitorientierung
Zeitrahmen
Überzeugungskanal
Überzeugungsmodus
Managementstil
6.5 Meta-Skalen
KAPITEL 7
Kombinationen
7.1 Das Riemann-Thomann-Modell
Die Raumachse: Nähe-Distanz
Die Zeitachse: Dauer-Wechsel
7.2 Häufige Kombinationen
Vier Seiten einer Nachricht
Spontan bis unberechenbar
Dominanz
Durchsetzungsvermögen
Durchhaltevermögen
Qualitätskontrolle und Unterschiede
Intrinsische Motivation
Guter Kommunikator bis führungsstark
Geschwindigkeit im Denken
Geschwindigkeit bei Entscheidungen
Krisenmanagement
Gewissenhaft bis zwanghaft
7.3 Kultur in Organisationen
Referenz: Internal ↔ External
Richtung: Hin-zu ↔ Weg-von
Planungsstil: Möglichkeiten ↔ Prozeduren
Vergleichsmodus: Ähnlichkeit ↔ Unterschied
Erfolgsstrategie: Vision ↔ Qualitätskontrolle
Informationsgröße: Global ↔ Details
Denkstil: Abstrakt ↔ Konkret
7.4 Teamcoaching/Personalentwicklung
KAPITEL 8
Kognitive Entwicklung - nicht Persönlichkeit!
8.1 Der Denk-Quotient (TQ): Sozial-emotionale Entwicklung nach Kegan
TQ2 - Selbständiger Verstand
TQ3 - Sozialisierter Verstand
TQ4 - Selbstbestimmter Verstand
TQ5 - Selbsttransformierender Verstand
8.2 Bewusstseins-Quotient (AQ5): Dynamische Reaktionsfähigkeit
AQ5 - Unbewusstes Selbst
AQ6 - Kulturelle Unkenntnis
AQ7 - Kulturelles Bewusstsein
AQ8 - Selbst-Bewusstsein
AQ9 - Selbst-Konstruktion
AQ10 - Bewusste Konstruktion
Fazit der kognitiven Entwicklung
KAPITEL 9
Arbeitsmotivation messen
9.1 Autonomie versus Abhängigkeit
Autonomie
Einfluss
Sinnhaftigkeit der Arbeit
Identifikation
Soziales Beziehungsnetz
Aufstiegschancen
Autonomie in der Praxis
Identifikation in der Praxis
Abhängigkeit
Negativer Stress
9.2 Sicherheit versus Perspektivlosigkeit
Sicherheit
Entwicklungsmöglichkeiten
Anerkennung
Gemeinschaft
Perspektivlosigkeit
Mangelnde Unterstützung
Mangel an Kommunikation
Soziale Kälte
Perspektivlosigkeit in der Praxis
9.3 Herausforderung versus Sinnlosigkeit
Herausforderung
Positiver Stress
Strategisches Geschick
Soziales Geschick
Serviceorientierung
Herausforderung in der Praxis
Sinnlosigkeit
KAPITEL 10
Burnout und Boreout
10.1 Burnout – eine mentale Strategie
10.2 Was ist am Thema „Burnout“ so wichtig?
10.3 Boreout
KAPITEL 11
Potenziell aktive Mobber erkennen
KAPITEL 12
Fallstudien aus der Praxis: Coaching
12.1 Von den Besten lernen
12.2 Engagement im Team
KAPITEL 13
Profilsysteme für Kognitive Absichten
13.1 Valide Ergebnisse
13.2 Der Zweck
13.3 Musterprofil
Übersicht Kognitive Absichten 1
Übersicht Kognitive Absichten 2
Übersicht Kombinationen
Übersicht Arbeitsklima
Übersicht Engagement
Nachwort
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Fotografien und Grafiken
Fragebogen zur Erfassung Kognitiver Absichten
I. Wahrnehmung
II. Motivationsfaktoren
III. Motivationsverarbeitung
IV. Informationsverarbeitung
VORWORT
Führung hat damit zu tun, Menschen dabei zu unterstützen, Veränderungen zu bewältigen. Management dagegen hat damit zu tun, Veränderungen umzusetzen. Führungskräfte setzen Kurs, Manager planen und budgetieren. Führungskräfte bündeln die Kräfte der Mitarbeiter, Manager organisieren und besorgen Mitarbeiter. Führungskräfte motivieren, Manager kontrollieren. Führungskräfte loten Chancen aus, Manager Grenzen.
Ein gut geführtes Unternehmen braucht beide Kräfte. Dieses Buch hilft, das Potenzial für Führung und Management zu identifizieren und das eine vom anderen zu unterscheiden.
Ebenso eignet sich dieses Buch, die richtigen Mitarbeiter zu finden – nicht die, die den besten Eindruck machen – und sie anschließend optimal zu führen. Gute Mitarbeiter auszuwählen wird immer schwieriger, denn allein aufgrund des demographischen Faktors steuern wir auf einen großen Mangel an Fachkräften zu.
Dieses Buch unterstützt auch Coaches und Trainer darin, die Begleitung ihrer Klienten und Teilnehmer intensiver, effektiver und nachhaltig erfolgreicher zu gestalten.
Abschließend sei erwähnt, die hier vorgestellten Prinzipien werden zwar ausschließlich im beruflichen Kontext behandelt, lassen sich aber meist 1:1 auf den privaten Kontext übertragen.
Hinweis:
Da spätere Kapitel auf vorhergehenden aufbauen, erzielt man den optimalen Nutzen aus diesem Buch, wenn man es zunächst vollständig von Anfang bis Ende durchliest. Anschließend eignet sich dies Buch sehr gut als Nachschlagewerk, um gezielt nachzulesen.
KAPITEL 1
Warum Profilsysteme einsetzen?
Eine Fehlbesetzung kostet leicht ein Jahresgehalt, leicht 50 000 Euro oder mehr. Mir hat eine weltweit tätige Unternehmensberatung vorgerechnet, dass die Suche eines neuen Mitarbeiters rund 50 000 Euro kostet, bis sie den vermeintlich richtigen Mitarbeiter gefunden haben. Das heißt, es kostet dieses Unternehmen auch 50 000 Euro, wenn sich später herausstellt, dass es doch nicht den Richtigen eingestellt hat. Dabei wurden in dieser Kalkulation die internen Interviews mit den Senior Consultants, die final über die Einstellung entscheiden, nicht mit eingerechnet.
Diese Kosten müsste man betriebswirtschaftlich gesehen jedoch dazurechnen. Das bedeutet, dass eine falsche Entscheidung bei der Einstellung eines Mitarbeiters leicht die doppelten der oben genannten Kosten verursacht. Und immer noch sind dann nicht alle Kosten berücksichtigt. Denn ein Mitarbeiter, der an der falschen Stelle sitzt, kann teuer werden. Nicht, weil er ein schlechter Mensch wäre, sondern weil bei seiner Einstellung nicht ausreichend beachtet wurde, ob er neben der fachlichen Qualifikation auch die soziale Kompetenz hat, um den gestellten Aufgaben gerecht zu werden.
Für einen Bewerber ist es ebenfalls schlecht, eine nicht passende Stelle anzutreten. Wechselt er schon bald wieder die Anstellung oder übersteht gar die Probezeit nicht, hinterlässt das Spuren im Lebenslauf, die für die spätere Karriere hemmend sein können. Hinzu kommt noch, dass eine schlechte Person-Job-Passung beim Jobinhaber Stress auslöst. Dieser Stress überträgt sich meist auch auf die Kollegen, da sie die miese Stimmung des Jobinhabers abbekommen. Zum Teil müssen sie auch von ihm Arbeit übernehmen, die er nicht bewältigen kann, und weitere Konsequenzen der Fehleinstellung tragen. Bevor ein Bewerber sich für eine Stelle entscheidet, sollte er sich eigentlich immer die Frage stellen: „Passt die Stelle zu mir?“ Doch das passiert in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit leider viel zu selten. Bei einem Fachkräftemangel sieht dies anders aus.
Mit einem guten Kompetenz-Profil-System kann man zuvor feststellen, inwieweit ein Bewerber zu einer Stelle beziehungsweise umgekehrt die Stelle zum Bewerber passt.
1.1 Wie betreiben Sie einen Mitarbeiter?
Das ist eine provozierende Frage. Wenn man sie einem Chef stellt, dann reagiert er typischerweise mit: „Wie? Mitarbeiter betreiben? – Der soll seinen Job machen, dafür wird er doch bezahlt. Punkt.“ Und dann fragt man: „Ja – verstehe ich. Wie betreiben Sie denn eine Maschine im Wert von 50 000 Euro?“ Dann kommen so ganz typisch Antworten wie: „Da kommt der Service, der installiert die Maschine, bevor man sie überhaupt das erste Mal einschaltet. Und dann bekommt jeder Mitarbeiter natürlich eine Einweisung. So zwei bis drei Tage Schulung. Da darf nur eingewiesenes Personal dran und natürlich gibt es einen Wartungsvertrag für die Maschine. So eine Investition muss man natürlich sichern.“
Einem solchen Firmenchef könnte man daraufhin sagen: „In Ihrem Unternehmen wäre ich lieber eine Maschine als ein Mitarbeiter. Denn um die Maschinen kümmern Sie sich. Aber um Ihre Mitarbeiter?“ In der Regel stutzt derjenige dann kurz und stellt fest: „An dieser Aussage ist etwas Wahres dran.“ Solche Antworten bekommt man übrigens auch schon bei Maschinen um die 10 000 oder 20 000 Euro.
1.2 Investition in die Mitarbeiter sichern
Also geht es darum, die Investition in die Mitarbeiter zu sichern. Dies passiert zum einen durch die Überprüfung von beruflicher Qualifikation, meist in Form von Zeugnissen. Dabei ist die Aussagekraft von Arbeitszeugnissen heute allerdings zum Teil sehr zweifelhaft. Ich jedenfalls habe seit Ende der 1970er Jahre meine Arbeitszeugnisse immer selber geschrieben. Und meine Vorgesetzten/Personalabteilung haben sie einfach nur unterschrieben. Zum anderen sind die persönlichen Kompetenzen für die Erfüllung einer Aufgabe entscheidend. Meine Großmutter pflegte zu sagen: „Man kann den Leuten nur bis zur Stirn gucken.“ Das ist richtig. Trotzdem haben wir den Bedarf, persönliche Kompetenzen schnell und zuverlässig zu erkennen.
Was versteht man überhaupt unter persönlichen Kompetenzen? Dazu zählt man zum Beispiel Flexibilität, soziale Kompetenz, Führungsstärke, Kontaktstärke, Konfliktfähigkeit in Teams oder auch mit Kunden oder Vorgesetzten, den persönlichen Arbeitsstil oder emotionale Intelligenz.
Dabei erhebt sich die Frage, wie groß ist die Konsistenz von beruflicher und von persönlicher Kompetenz? Damit ist die Antwort auf die Frage gemeint: „Wie lange kann ich nach einem beruflichen Ausstieg wieder einsteigen und sofort qualifiziert weiterarbeiten?“. Die Konsistenz beruflicher Kompetenzen beträgt je nach Branche zwischen einem Vierteljahr und fünf Jahren.
Das Vierteljahr kommt aus der Computerbranche. Dort werden Produkte für eine Produktionsdauer von einem Vierteljahr entwickelt. Danach sind die Produkte bereits von der technischen Weiterentwicklung überholt und werden durch neuere Modelle ersetzt. Auf der CeBIT 2000 (Computermesse im März) hatte ich einen Computer, der mir sehr gefiel, gesehen und ihn bestellt. Im Juni habe ich ihn bekommen. Im November wollte sich ein Kollege von mir genau den gleichen Computer kaufen. Da war der Rechner schon nicht mehr im Programm, weil längst veraltet.
Dabei haben Computer einen längeren Lebenszyklus als einzelne Computerkomponenten, beispielsweise Festplatten. Sie werden heute nur noch ein Vierteljahr produziert. Danach sind sie veraltet.
Als ich Ende der 1970er Jahre zum ersten Mal mit Computern zu tun hatte, munkelte man von Laufwerken mit großen Kapazitäten. Man nannte sie damals nicht Festplatten, sondern „Winchester Drives“ oder „Rigid Discs“ – und sie sollten die unglaubliche Kapazität von 1 MB auf einem 5 ¼-Zoll-Laufwerk haben. Es ruft heute eher ein ungläubiges Staunen hervor, dass es so wenig war.
Das Ende dieser Entwicklung ist heute noch nicht abzusehen. Moore’s Law aus den 1970er Jahren besagt, dass im Computerbereich alle 18 Monate die doppelte Kapazität zum halben Preis lieferbar ist. Und seit den 1970er Jahren bewahrheitet sich dieses Gesetz immer wieder. Ein Ende wird es irgendwann geben, aber es ist zurzeit noch nicht erkennbar. Steigt also jemand komplett für 18 Monate aus dieser Branche aus, so muss er sich wieder neu einarbeiten.
Und was auch immer ich hier von Menschen, die schon im Beruf stehen, gehört habe, es schwang immer mit: „Irgendwann habe ich einmal etwas gelernt und heute mache ich etwas anderes, weil der Wandel im Beruf doch sehr groß ist.“ Es ist nicht mehr wie Anfang des 20. Jahrhunderts: Man geht in einen Beruf rein, lernt ihn und macht ihn auf die gleiche Art und Weise für den Rest seines Lebens.
Was haben Sie einmal ursprünglich gelernt? Und was tun Sie heute? Wieviel haben Sie dazugelernt? Wieviel mussten Sie aufgrund des Veränderungsdrucks neu lernen? So viel zum Thema Berufsausbildung.
Das macht die Dinge auf der anderen Seite spannender, aber andererseits auch sehr viel komplexer. Bei der persönlichen Kompetenz ist es nun nicht so, dass sich diese in einem Vierteljahr ändert. Wenn man jemanden ein Vierteljahr nicht gesehen hat und ihn dann wieder trifft, dann ist er nicht plötzlich ein anderer Mensch geworden. Das könnte vielleicht nach fünf Jahren passieren, vielleicht nach 25 Jahren oder vielleicht auch überhaupt nicht. Denn Menschen ändern sich nicht so schnell. Es sei denn, sie haben in der Zwischenzeit traumatisierende oder andere prägende Erfahrungen gemacht, zum Beispiel eine Scheidung, Unfälle oder Krankheiten, die sehr starke Veränderungen in der Persönlichkeit hervorrufen. Aber das ist nicht die Regel. Und es ist nicht vorhersehbar. Wenn man die persönlichen Kompetenzen einer Person ermittelt, kann man sich auf diese sehr viel mehr verlassen als auf die beruflichen.
In der Regel ist es sogar so, dass die Arbeiten in vielen Abteilungen eines Unternehmens so sehr spezialisiert sind, dass neue Mitarbeiter, so qualifiziert sie auch sein mögen, auf jeden Fall über mehrere Monate eingearbeitet werden müssen. Also kann es nur im Interesse des Unternehmens sein, die Mitarbeiter auszuwählen, die von ihrer persönlichen Kompetenz her zum Unternehmen passen. Dabei kann ein gutes Profilsystem, mit welchem Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltenstendenzen von Bewerbern herausgefunden und deren Eignung für eine Stelle überprüft werden können, eine große Unterstützung sein. Das Angebot auf dem Markt ist fast unübersichtlich: Welches der vielen Profilsysteme wählt man am besten aus? Worauf sollte ein Unternehmen unbedingt achten?
KAPITEL 2
Anforderungen an ein Profilsystem
Wenn ein Unternehmen ein Persönlichkeitsprofilsystem einsetzen möchte, nach welchen Kriterien sollte es am besten seine Wahl treffen? Wichtige Kriterien sind sicherlich eine hohe inhaltliche Qualität, eine einfache Handhabbarkeit und ein erkennbarer Nutzen im Alltag. Ebenso wichtig ist eine hohe Trennschärfe in den Fragen. Sind die Fragen im Profilsystem nicht wirklich trennscharf, dann weiß der Interviewführende nicht genau, worauf der Proband antwortet.
Darüber hinaus sollten rein berufliche Fragen gestellt werden, weil Menschen sich im Beruf anders verhalten als im Privatleben. Auch wenn einige es anzweifeln, Untersuchungen zeigen, dass sich Menschen je nach Kontext völlig anders verhalten. Bei Fragen zum Privatleben im Bewerbungsgespräch würde den Menschen unterstellt werden, dass sie die Kontexte nicht unterscheiden können.
Das Risikoverhalten von Menschen im beruflichen Bereich ist ein völlig anderes als im privaten Bereich. Wenn beispielsweise Menschen in ihrer Freizeit Risikosportarten betreiben wie Snowboarden, Bungeejumping oder Ähnliches, dann kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie auch im beruflichen Kontext risikofreudig sind. So kann ein Chef in der Firma eiskalt Mitarbeiter entlassen und gleichzeitig zu Hause ein sehr warmherziger Vater und Ehemann sein. Deswegen sollten in Analysen immer situative und berufsbezogene Fragen gestellt werden, sonst werden die Ergebnisse zu unscharf.
2.1 Handhabbarkeit
Wie lange dauert die Fragezeit? Kann man die Auswertung selbst durchführen oder muss man die Antworten einschicken und kriegt das Ergebnis erst drei Tage später? Müssen bei der Bestellung eines selbstauswertbaren Profilsystems sinnlose Folgeleistungen im Voraus bezahlt werden? Was ist, wenn man zehn Auswertungen bestellt oder gekauft hat und hat plötzlich zwölf Probanden da stehen, die alle interessant sind? Oder was passiert, wenn man vergessen hat, rechtzeitig nachzubestellen? Oder hat man rechtzeitig nachbestellt, aber die Bearbeitung der Bestellung dauert länger als normal?
2.2 Abgleich mit Stellenprofilen
Kann man mit dem Profilsystem ein Stellenprofil erstellen? Kann man später den Bewerber mit diesem Stellenprofil vergleichen? Und wie einfach ist dies? Sind Teamvergleiche möglich? Kann man damit auch Schwierigkeiten im Team erkennen? Oder kann man auch ein „Team-Design“ machen? Das heißt: Gilt es zum Beispiel ein Projektteam zusammenzustellen, damit alle geforderten Leistungsdisziplinen abgedeckt werden, – kann man dann einfach mehrere Team-Profile ausprobieren, um zu sehen, wie die einzelnen Teammitglieder zusammenpassen? Kann das Profilsystem zur Personalentwicklung eingesetzt werden? Wenn ein Stelleninhaber heute wirklich gut ist in seinem Job, heißt das nicht, dass dieser in Zeiten des Berufswandels auch noch in fünf Jahren gut ist – kann man sich zum Beispiel dann überlegen, wie sich die Anforderungen an den Stelleninhaber in Zukunft entwickeln werden? Kann das Profilsystem auch dazu benutzt werden, um die heutigen Stelleninhaber dahin zu führen?
2.3 Sind die Ergebnisse nützlich?
Kann der Anwender aus den Ergebnissen der Profilanalyse ganz Praktisches für das eigene Unternehmen ableiten? Es nutzen die besten Ergebnisse wenig, wenn sich daraus nicht ganz konkrete Handlungsschritte für das Unternehmen oder die betroffenen Mitarbeiter ableiten lassen, beispielsweise, wie man die Fähigkeiten von Mitarbeitern weiterentwickeln kann, oder ob man den Arbeitsplatz besser gestalten kann.
Kann man dabei Relevantes für eine Stellenbesetzung ablesen? Ist es möglich, mit vorhandenen Profilen Teamauswertungen durchzuführen, um zu sehen, wie das Zusammenspiel eines neuen Teams sein wird? Bei manchen Profilsystemen bekommt der Lizenznehmer die Profile nur in Form von fertigen Auswertungen, beispielsweise in Papierform oder elektronisch als druckbare PDF-Datei. Dann lassen sich die Ergebnisse nur schwer übereinanderlegen, um Teamvergleiche durchzuführen.
2.4 Ergebnisse kommunizierbar?
Und ganz wichtig: Sind die Ergebnisse des Profils leicht kommunizierbar? Wenn diese nur Experten verstehen und dann auch noch Schwierigkeiten haben, es herüberzubringen, dann sagt doch ein Bewerber: „Ich verstehe das alles gar nicht richtig und finde mich gar nicht wieder ...“ Darin habe ich selbst leidvolle Erfahrungen gemacht: Bei Bewerbungen hatte ich einen Test ausgefüllt und die Ergebnisse schließlich hatten nach meiner Meinung nur sehr wenig mit mir zu tun. Zumindest aber konnte ich sie nicht verstehen.
2.5 Wie ist die soziale Akzeptanz?
Oft wird in eine Auswertung hineingeschrieben: „Herr Meier ist so und so ...“ Dies hat den gravierenden Nachteil, dass die Messergebnisse auf der Ebene der Identität festgeschrieben werden. Ganz bedenklich finde ich da die Werbung eines Profilsystems, das angibt, Hirnpräferenzen zu messen und diese als genetisch bedingt begründet. Hier ist die Botschaft: „Ihnen gefällt das eine oder andere Ergebnis nicht? Pech gehabt! Lässt sich nicht ändern, da genetisch bedingt.“ Es ist schon allein deshalb bedenklich, weil die Gehirnforschung in den vergangenen zwanzig Jahren in immer größerem Maße nachgewiesen hat, inwieweit unser Gehirn bis ins hohe Alter lernfähig ist. Also muss ein gutes Profilsystem auch berücksichtigen, dass Menschen sich verändern können und dies in den Ergebnissen widerspiegeln.
Bei typischen auf dem Markt befindlichen Profilsystemen finden sich Menschen nach meiner Erfahrung zu circa 50 bis 60 Prozent wieder. Das ist für mich in jedem Fall zu niedrig. In einem Profil, das ich persönlich bei einer Bewerbung ausfüllte, kam unter anderem heraus, dass ich sehr umsetzungsstark, aber sehr wenig kreativ sei. Menschen, die mich gut kennen, würden eher das Gegenteil behaupten. Außerdem drückt eine solche „Trefferquote“ die soziale Akzeptanz weit nach unten.
Man sollte daher ein Profilsystem wählen, in dem sich Menschen zu 95 bis 100 Prozent in ihren Profilen wiederfinden. Diese hohe Quote sollte allerdings nicht durch eine schwammige und allgemeine Beschreibung erreicht werden, die auf fast jeden zutrifft, sondern durch eine Messung möglichst vieler einzelner aussagekräftiger Einzelskalen. Dann kann man von einer hohen sozialen Akzeptanz ausgehen.
Der Personalchef eines größeren Unternehmens in Deutschland gab einem Bewerber Feedback zu seinem Profil basierend auf Kognitiven Absichten und erklärte ihm, dass man ihn nicht einstellen wolle, weil er völlig andere Kognitive Absichten habe, als von der Arbeitsstelle gefordert. Er erläuterte noch kurz, wie genau jemand sein müsse, damit er sich an diesem Arbeitsplatz wohlfühle. Der Bewerber hat sich anschließend bedankt, dass man ihn nicht genommen hat. Er konnte nachvollziehen, dass er an diesem Arbeitsplatz nicht glücklich geworden wäre. Diese Geschichte ist übrigens kein Einzelfall, wenn mit zutreffenden und detaillierten Profilsystemen gearbeitet wird.
2.6 „Darf’s auch ein paar Details mehr sein?“
Ein Profilsystem sollte auch detaillierte Ergebnisse liefern, sonst sind die Ergebnisse zu grob und daher nicht aussagekräftig. Man könnte sich ja ansonsten auch auf zwei Unterscheidungen beschränken: männlich/weiblich. Das ist normalerweise sehr leicht zu erkennen. Außerdem ist es sehr lange vorhersagbar, es ändert sich wirklich selten. Die Eigenschaften sind allgemein bekannt: Frauen können nicht einparken und Männer können nicht empathisch sein etc. Die Eigenschaften kennt jeder, und man könnte sich den ganzen Aufwand sparen.
Viele der klassischen Persönlichkeitsprofile messen nur drei bis vier Dimensionen und schreiben diesen dann pauschal bestimmte Eigenschaften zu. Bei den Profilsystemen muss man alle Eigenschaften eines Typus im Hinterkopf haben und dann noch schauen, inwieweit eine Person welche Art von Typus repräsentiert. Es wird noch komplizierter, wenn man Mischtypen hat. Ich bezweifle, ob eine zuverlässige Zuordnung in diesem Fall noch möglich ist.
Die Problematik bei Systemen, die auf wenige Ausrichtungen reduziert wurden, ist, dass jeder Ausrichtung eine ganze Reihe von zum Teil bis zu 20 generischen Eigenschaften zugeordnet wird. Diese können im Einzelfall zutreffen oder auch nicht. Natürlich gibt es Frauen, die nicht einparken können. Ich kenne allerdings auch eine ganze Reihe von Frauen, die es doch können. Ebenso, wie es Männer gibt, die empathisch sind. Einige Profilsysteme erhöhen die Akzeptanz dadurch, dass die Formulierungen so weitgefasst sind, dass sich wirklich jeder darin wiederfinden kann. Das hat dann schnell die Qualität eines Horoskops in der Tageszeitung. (Barnum Effect)4
Wie würde es aussehen, wenn man einen anderen Weg ginge, nämlich solche generischen Eigenschaften direkt zu messen, statt sie gebündelt wenigen Ausrichtungen zuzuordnen? Diese generischen Eigenschaften nennt man auch Kognitive Absichten. Das sind unbewusste Präferenzen im Denken und Handeln, wobei zwischen zwei und fünf Präferenzen eine Denkstruktur ergeben. So bilden die Sinneskanäle „Sehen“, „Hören“ und „Fühlen“ zusammen die Denkstruktur „Sinneskanal“. Es gibt bislang etwas über 60 dieser Kognitiven Absichten. Aus diesen lassen sich wiederum einzelne Typen abbilden, wenn man unbedingt mit Typen arbeiten will.
Die Praxis zeigt jedoch, dass einzelne Kognitive Absichten sehr viel einfacher anzuschauen sind als komplette Typen, da man sich bei den Präferenzen nur auf die einzelnen Eigenschaften konzentrieren muss. Wenn sich die Befragten dann nach Auswertung in einem solchen Profil zu 95 bis 100 Prozent wiederfinden, so ist das ein wichtiger Hinweis auf die Qualität des Systems; denn bei über 60 Ausrichtungen ist es nicht mehr möglich, nebulöse Beschreibungen abzugeben, die kein Mensch mehr versteht. Die Profile müssen dann schon sehr konkret sein.
Über 60 Präferenzen – das ist natürlich sehr komplex. Aber Menschen sind nun mal komplex. Vor allem sollte man nicht den Fehler machen, „komplex“ mit „kompliziert“ gleichzusetzen. Im Gegenteil: Dinge werden dann kompliziert, wenn man bei ihrer Analyse die Komplexität nicht berücksichtigt. Das passiert meist bei der Betrachtung von Mann-Frau-Beziehungen. Berücksichtigt man jedoch, wie komplex etwas ist, dann geschieht so etwas wie ein Wunder: Alles wird auf einmal ganz einfach (im Vergleich zu vorher).
Ich glaube, genau das meinte Albert Einstein, wenn er zu sagen pflegte: „Man sollte die Dinge so einfach wie möglich machen, aber auch nicht einfacher!“
Die Nutzung eines sehr differenzierten Profilsystems hat auch noch andere Vorteile: Angenommen, man hat Mitarbeiter in nur vier Kategorien eingeteilt, beispielsweise in Rot, Gelb, Grün und Blau (andere Profilsysteme benutzen einfach A, B, C und D) und man möchte den Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln, dann steht man vor einem großen Problem. Aus dem einen Typus einen anderen machen? Das ist ein viel zu großer Schritt. Mal ganz abgesehen davon: Welcher Grüne möchte ein Roter werden? Oder welcher Gelbe ein Blauer? Oder umgekehrt? Die Mitarbeiter würden sich wehren und das zu Recht; denn das wäre ein viel zu tiefer Eingriff in ihre Persönlichkeit.
Dagegen ist es etwas ganz anderes, Menschen, die problemorientiert denken, darin unterstützen, künftig mehr zielorientiert zu denken. Dies wäre keine Veränderung der eigenen Persönlichkeit, sondern eine konkrete Hilfe bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten und damit ein persönliches Wachstum. Und das ist es doch, was Menschen wollen.
Man muss einfach wissen, was man betrachten will: ein einfaches, aber nicht sehr detailliertes und wenig aussagekräftiges Bild oder die wirkliche Vielfalt des Lebens in einem Bild mit voller Auflösung, auf dem man viel mehr erkennen kann. Ähnlich ist es bei Profilsystemen: Wenige Ausrichtungen geben ein grobes Bild, viele Kognitive Absichten ergeben ein detailliertes, lebensnahes Bild, in dem sich die Menschen wirklich wiedererkennen und aus dem sich konkrete Schritte zur persönlichen Weiterentwicklung ableiten lassen.
Vergleich: Wenige Typen vs. Volle Auflösung
Die zuvor erwähnten über 60 Präferenzen im Denken und Handeln ergeben rein rechnerisch über 36*1018 Typen (Falls Sie an Wiedergeburt glauben: bei derzeit 8 Milliarden Menschen auf der Erde kann man 4,5 Milliarden mal wiedergeboren werden bevor man ein zuvor genutztes Profil nehmen muss). Dabei gibt es bei den einzelnen Präferenzen nicht nur „schwarz“ oder „weiß“, sondern auch noch jeweils mehrere Abstufungen. Somit ist garantiert, dass jeder Mensch auf diesem Planeten sein ureigenes Profil erhalten kann. Aus diesen Profilen lassen sich dann leicht diverse Weiterentwicklungsmöglichkeiten für den Einzelnen und auch für Gruppen und Unternehmen ableiten.
Nochmals: Komplex heißt nicht kompliziert. Das glatte Gegenteil ist hier der Fall. Es ist wie mit den vier Bildern: Sieht man nur 12 oder weniger Pixel / Typen, ist es sehr kompliziert und schwierig zu erkennen, was das Bild darstellt, hat man die volle Auflösung, ist es ganz einfach. Wenn man die Komplexität eines Menschen berücksichtigt, wird es viel leichter, eine andere Person zu verstehen. Man betrachtet einfach nur die einzelnen Bausteine, um das Ganze zu begreifen. Dadurch fühlt sich der betrachtete Mensch nicht bewertet und damit auch nicht abgewertet, sondern einfach nur wahrgenommen und wertgeschätzt.
Wenn Menschen gut miteinander auskommen, so sagt der Volksmund, dass die „Chemie“ zwischen ihnen stimmt. So sind die meist vier Grunddimensionen klassischer Profilsysteme vergleichbar mit den vier Grundelementen der Antike: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Dagegen ähneln die hier vorgestellten Kognitiven Absichten in ihrer Komplexität mehr dem System der chemischen Elemente (Periodensystem) der Neuzeit. Genau diese Komplexität erlaubt es präzise zu beschreiben und Entwicklungsprozesse anzustoßen.
Grundsätzlich gilt: Je ähnlicher die Präferenzen zweier Menschen sind, umso leichter ist eine gute „Chemie“ zwischen ihnen herzustellen, aber umso weniger ergänzen sie sich. Die Menschen mit den ähnlichen Präferenzen machen aufeinander daher meist den besten Eindruck. Je unterschiedlicher die Präferenzen zweier Menschen, umso größer ist die Herausforderung, eine gute „Chemie“ zwischen ihnen zu erreichen. Genau das ist der Grund, warum Personalverantwortliche häufig „Abbilder“ ihrer selbst einstellen. Das sind aber nicht unbedingt die, die sie tatsächlich brauchen. Daher ist es wichtig, genau zu wissen, was gebraucht wird und anhand dieses Profils die richtigen Mitarbeiter zu identifizieren.
Angenommen, jemand mag sich nicht um Details kümmern, dann macht es normalerweise wenig Sinn, diesem Menschen jemanden zur Seite zu stellen, der dies auch nicht mag. Vielmehr bedarf es jemanden, der Details liebt. Erkennen dann beide aber nicht, dass sie einander ergänzen, so werden sie sich gegenseitig wenig schätzen. Der eine wird als viel zu oberflächlich angesehen und der andere als „Erbsenzähler“. Wissen aber beide, wie komplementär sie zueinander sind, können sie die Arbeit so aufteilen, wie sie einem jedem am besten liegt. Das wird dann von beiden Seiten als Bereicherung empfunden. Dazu ist es notwendig zu verstehen, welche Präferenzen man selbst und welche der andere hat. Diese Präferenzen werden später im Buch erklärt.
KAPITEL 3
Denken heißt tilgen
Bevor hier nun Präferenzen definiert werden, folgt erst einmal eine kurze Übersicht über die Abläufe des Denkens.
Es gibt verschiedene Messungen, die darlegen, dass permanent circa 310 Mio. Informationseinheiten pro Sekunde durch die verschiedenen Sinneskanäle auf uns hereinprasseln (Manfred Zimmermann, 1993; Tor Nørretranders, 1994; David G. Myers, 2008)2. Davon verarbeiten wir unbewusst ca. 11,2 Mio. Informationseinheiten. Unser Bewusstsein kann jedoch nur ganze 40 Einheiten pro Sekunde verarbeiten und laut Untersuchungen in den 1950er Jahren (George Miller, 1956)1 nur 7 +/- 2 Informationseinheiten gleichzeitig.
Dieses massive Tilgen von Informationseinheiten wird von unserem Gehirn kompensiert. Man spricht hier von Filtern, obwohl die Metapher falsch ist. Ein Filter ist etwas, das etwas passiv herausfiltert. Hier findet jedoch eine selektive Wahrnehmung statt. Diese entscheidet, welche Information jetzt gerade ins Bewusstsein gelangt und welche nicht. Man kann sich dies als eine Art Schaltstelle im Vorzimmer des Bewusstseins vorstellen: Ruft man bei einer höhergestellten Führungskraft an, landet man in aller Regel im Vorzimmer. Dort gibt es eine mehr oder minder freundliche Stimme, die fragt, wer gerade anruft und was das Anliegen ist. Aufgrund der Angaben wird entschieden, ob man durchgestellt wird oder nicht.
Genau das passiert die ganze Zeit, während Sie hier in diesem Buch lesen: Die Helligkeit Ihrer Umgebung, die Farbgebung, die Hintergrundgeräusche, der Untergrund, der Sie trägt, und welcher Ihrer Füße gerade wärmer ist, der rechte oder der linke und so weiter – all diese oder zumindest ein Teil dieser Informationen ist erst in Ihr Bewusstsein gekommen, als Sie die entsprechende Stelle gelesen haben. Die Informationen selbst waren die ganze Zeit über da. In dem Moment, in dem Sie es lasen, hat Ihr Bewusstsein im Vorzimmer nachgefragt. Durch das Abfragen wurde dem Vorzimmer sozusagen die Anweisung gegeben, die entsprechende Information durchzulassen. Dies passiert dann auch in aller Regel.
Wenn wir obige Zahlen zugrunde legen und uns dabei das Denken als eine Strecke vorstellen, dann kommt auf einen Meter bewusstes Denken 280 Kilometer (!) unbewusstes Denken, aber 7750 Kilometer (!) Wahrnehmung. Behauptet jemand, er könne die Welt bewusst so wahrnehmen, wie sie wirklich ist, dann wäre das ungefähr so, als wenn jemand durch den Briefkastenschlitz in den Buckingham Palace hereinschaut und daraufhin behauptet, er kenne den Buckingham Palace jetzt in- und auswendig.
Noch anders ausgedrückt: Wäre das, was wir innerhalb einer Sekunde wahrnehmen, ein ganzes Jahr, dann würden wir von diesem ganzen Jahr rund 13 Tage unbewusst und nur ganze 4 Sekunden bewusst mitbekommen.
3.1 Kompensation der Tilgung
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass sowohl beim Abspeichern der Wahrnehmung als auch bei der Wiedergabe stark selektiert wird. Die Kompensation der zuvor erwähnten massiven Tilgung erfolgt durch Fokussierung, Verallgemeinerung und Verzerrung.
1. Fokussierung der Aufmerksamkeit
Da unsere Wahrnehmung als Mensch begrenzt ist, ist die erste Art der Kompensation, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – was auch immer wir für das Wesentliche halten. Menschen, die ihre Aufmerksamkeit in einem Punkt bündeln können, sind in der Lage, sich stark zu konzentrieren. Andere haben einen geringeren Fokus und können sich dadurch weniger stark konzentrieren.
Richtet jemand beispielsweise seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf ein interessantes und spannendes Buch, so hat er keine mentale Kapazität mehr frei für das, was außerhalb des Buchbereiches passiert – es ist ausgeblendet. Dann kann es passieren, dass ihm jemand eine Tasse Tee auf den Tisch stellt, ohne dass es der Leser des Buches mitbekommt. Würde diese Tasse wirklich aus der Wahrnehmung getilgt, so müsste ja eigentlich automatisch eine Art Wahrnehmungsvakuum entstehen. Das kann aber natürlich nicht sein. Daher fügt das Unbewusste automatisch etwas hinzu, nämlich den Rest des Tisches, der jetzt von der Tasse verdeckt ist.
So sind Ausblenden und Hinzufügen zwei Seiten der gleichen Medaille namens „Fokussierung“. Nachfolgend ein extremes Beispiel einer solchen Fokussierung:
Während des Bosnien-Krieges auf dem Balkan führte ein Chirurg über mehrere Stunden eine komplexe und schwierige Operation durch. Er konnte die Operation erfolgreich abschließen und damit das Leben seines Patienten retten. Dann stellte er fest, dass fast die Hälfte des Operationssaales während seines Tuns weggebombt worden war. Der zerstörte Teil wurde von ihm in seiner Wahrnehmung unbewusst bis zum Ende der Operation hinzugefügt.
Das Gehirn belässt einmal wahrgenommene Bilder unverändert und aktualisiert nur sich verändernde Teile. Dazu muss die Veränderung aber in einer gewissen Geschwindigkeit erfolgen. Langsam eingeblendete Gegenstände in einem Film, der ein Standbild zeigt, werden nicht wahrgenommen. Ebenso kann es sein, dass bei starker Konzentration (Fokussierung) auf einen Vorgang, der Rest nicht mehr aktualisiert wird und sich dort abspielende Szenen nicht wahrgenommen werden. Es findet also keine aktive Filterung statt. Es wird schlicht nicht wahrgenommen (es dringt nicht einmal in das Gehirn vor) und wird nicht aktualisiert. Völlig geklärt ist der Vorgang der Wahrnehmung aber bis heute nicht. Interessant zu diesem Thema war die Sendereihe „Die Welt der Sinne“ vom Bayerischen Rundfunk, ausgestrahlt im Jahr 2004.
2. Verallgemeinerung
Den Prozess der Verallgemeinerung habe ich hier nicht weiter unterteilt, da eine genauere Betrachtung des Vorgangs in diesem Kontext und für das Verständnis nicht wirklich relevant ist. Verallgemeinerungen sind eine spezielle Form der Tilgung. Sagt jemand beispielsweise: „Alle Männer sind gleich.“, so werden alle Unterschiede zwischen den einzelnen Männern getilgt. Behauptet jemand: „Jede Frau ist anders.“, so werden alle Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Frauen getilgt. Jedes Mal, wenn wenige Einzelfälle verallgemeinert werden, wie beispielsweise bei der Äußerung: „Das muss unbedingt heute noch fertig werden.“, kann es gut sein, dass dies wirklich wichtig ist. In vielen Fällen löst sich ein solches Muss jedoch in Wohlgefallen auf, wenn es hinterfragt wird. Nur weil es in anderen Fällen besonders wichtig war, dass etwas in einem bestimmten engen Zeitrahmen fertig wurde, muss dies nicht auch in diesem Falle so sein.