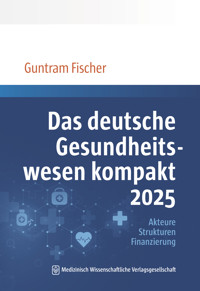
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das deutsche Gesundheitssystem befindet sich in einem stetigen Veränderungsprozess. Krankenhäuser werden geschlossen, Ärzte, Pflegepersonal und Apotheken streiken, Arztpraxen schließen mangels Nachfolgelösungen – und das, obwohl jährlich von den gesetzlichen Krankenversicherungen mehr als 270 Milliarden Euro für die Gesundheitsversorgung ausgegeben werden. Seitens der Politik werden zudem ständig neue sozialgesetzliche Regelungen eingeführt. Doch nach welchen Grundsätzen funktioniert dieses System eigentlich? Handelt es sich überhaupt um ein einheitliches System oder laufen unterschiedliche Strukturen der Finanzierung und Organisation unabgestimmt nebeneinander? Wer plant was und wer ist für welchen Bereich zuständig? Und ist das System „demografiefest“? Die Unübersichtlichkeit in Verbindung mit fehlender Systemkenntnis führt zu Irritationen bis hin zu Frustration sowohl in der Bevölkerung als auch bei den im Gesundheitswesen tätigen Menschen. Dieses Buch stellt in nachvollziehbarer Weise die Finanzierungs- und Organisationsstrukturen der gesamten Akutversorgung dar und klärt über die Zusammenhänge zwischen der gesetzlichen Grundlage im SGB V, der Finanzierung des Gesundheitssystems und der Rolle des Gemeinsamen Bundesausschusses auf. Darauf aufbauend werden potenzielle Entwicklungen und Strukturänderungen aufgezeigt und das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich betrachtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Guntram Fischer
Das deutsche Gesundheitswesen kompakt 2025
Akteure, Strukturen, Finanzierung
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Der Autor
Dr. med. Guntram Fischer
Ludwigshöhe 4
88167 Maierhöfen
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstr. 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-962-2 (eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2025
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Der Verlag kann insbesondere bei medizinischen Beiträgen keine Gewähr übernehmen für Empfehlungen zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen oder für Dosierungsanweisungen, Applikationsformen oder ähnliches. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden.
Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Produkt-/Projektmanagement: Dennis Roll, Berlin
Copy-Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout & Satz: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
Coverbild: berCheck – stock.adobe.com
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Inhalt
1Das deutsche Gesundheitssystem: Ein erster Überblick
2Geschichtlicher Hintergrund des deutschen Sozialversicherungssystems
3Der Gemeinsame Bundesausschuss
4Die 13 Sozialgesetzbücher
5Gesetzliche Krankenversicherung
6Private Krankenversicherung
7Beihilfesystem für Beamte
8Gesetzliche Unfallversicherung
9Die Pflegeversicherung
10Hospize und Palliativversorgung
11Organisation und Finanzierung der Krankenhäuser
12Universitätskliniken
13Gesundheitsberufe
14Organisation und Finanzierung der ambulanten Versorgung in Arztpraxen
15Arzneimittelversorgung
16Sektorenübergreifende Versorgung
17Medizinischer Dienst (MD)
18Hilfs- und Heilmittelversorgung
19Organisation und Finanzierung des Rettungsdienstes
20Rehabilitation
21Prävention im deutschen Gesundheitswesen
22Patientensteuerung im deutschen Gesundheitssystem
23Risiken im deutschen Gesundheitssystem
24Entwicklungspotenziale im deutschen Gesundheitssystem
25Digitale Transformation
26Demografie und Work-Life-Balance
27Ambulantisierung
28Das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich
Literatur
Sachwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Das deutsche Gesundheitssystem: Ein erster Überblick
Für das gesamte System der sozialen Sicherung gelten in Deutschland Grundprinzipien, die für das Verständnis der heutigen Struktur notwendig sind.
1.1Sozialstaatsprinzip/Sozialstaatgebot
Im Grundgesetz unter § 20 Absatz 1 wird definiert:
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
Nach Interpretation des Bundesverfassungsgerichtes ist es Aufgabe des Staates, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen und die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft sicherzustellen.
Die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit bedeutet:
ein menschenwürdiges Dasein sichern,
gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit schaffen,
Schützen und Fördern der Familie und
besondere Belastungen des Lebens abwenden und ausgleichen.
Aus dieser Verpflichtung zur Daseinsvorsorge leitet sich auch die staatliche Aufgabe zur Sicherstellung der Versorgung im Krankheitsfall ab.
Die Grundlagen des Sozialrechts sind im Sozialgesetzbuch mit seinen 12 Kapiteln definiert. Die für die Gesundheitsversorgung relevanten Vorgaben finden sich im SGB im Kapitel V (gesetzliche Krankenversicherung) und für die Pflege in Kapitel XI (soziale Pflegeversicherung).
1.2Solidarprinzip
Die Mitglieder einer Solidargemeinschaft gewähren sich im Krankheitsfall gegenseitige Hilfe und Unterstützung – daraus ergibt sich ein Rechtsanspruch gegenüber der Solidargemeinschaft, welche auch die finanziellen Mittel gemeinsam aufbringen muss. Um diese finanziellen Mittel sicherzustellen, sind die Sozialabgaben in Deutschland verpflichtend von den Bürgern aufzubringen und damit im engeren Sinne staatlich verordnete Zwangsabgaben.
Das wesentliche Kriterium des deutschen Gesundheitssystems ist die Entkoppelung von Beitragssatz und Leistungsumfang. Somit wird in der gesetzlichen Krankenversicherung festgelegt, dass im Krankheitsfall der Bedarf den Leistungsumfang definiert und nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit des Einzelnen, was als Bedarfsdeckungsprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung bezeichnet wird.
Eine weitere Besonderheit stellt die paritätische Finanzierung der Sozialabgaben dar, die neben der Renten- und Arbeitslosen- auch die Krankenversicherungsbeiträge betrifft. So teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte die Versicherungsprämien in der GKV, aktuell betrifft das auch den sog. Zusatzbeitrag, den die Krankenkassen zusätzlich zur Grundprämie erheben können.
1.3Subsidiaritätsprinzip
Der Grundgedanke des Subsidiaritätsprinzips entstammt der katholischen Soziallehre und beinhaltet grob umschrieben: Lasten, die vom Individuum und kleinen Solidargemeinschaften getragen werden können, sollen auch von diesen übernommen werden. Die übergeordnete Solidargemeinschaft tritt erst dann ein, wenn die kleinere überfordert ist.
Dieses Subsidiaritätsprinzip findet sich auch im SGB V unter den Begriffen Solidarität und Eigenverantwortung wieder:
Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern.
Das umfasst auch die Förderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung der Versicherten.
Die Versicherten sind für ihre Gesundheit mitverantwortlich; sie sollen durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden.
Die Krankenkassen haben den Versicherten dabei durch Aufklärung, Beratung und Leistungen zu helfen und unter Berücksichtigung von geschlechts-, alters- und behinderungsspezifischen Besonderheiten auf gesunde Lebensverhältnisse hinzuwirken.
Eingegrenzt wird der Leistungsumfang durch § 12 SGB V, der lautet:
Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen.
1.4Sachleistungsprinzip
Die Gesundheitsleistungen für gesetzlich Krankenversicherte können gegen Vorlage der Versichertenkarte von Leistungserbringern bezogen werden. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt zwischen den Kostenträgern (= GKV) und Leistungserbringern (Krankenhaus, Apotheke, Arztpraxis, Heilmittelerbringern, Pflegediensten etc.). Somit beziehen die Versicherten die Sach- (Medikamente, Heil- und Hilfsmittel) und Dienstleistungen (Untersuchung, Diagnostik und Therapie) gegen Vorlage ihres Versicherungsnachweises, die Vergütung der Leistungserbringer läuft über komplexe Abrechnungssysteme zwischen den Leistungserbringern und den gesetzlichen Krankenkassen im Hintergrund ab.
1.5Versicherungspflicht
Seit 1. Januar 2009 gilt für alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland bei Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung die allgemeine Krankenversicherungspflicht. Ab einem definierten Jahreseinkommen besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen dem Beitritt zur gesetzlichen und einer privaten Krankenversicherung.
1.6Wahlfreiheit
Die Versicherten haben zwischen allen Krankenkassen die freie Wahl und es genügt die Zustellung einer Beitrittserklärung um Mitglied dieser Krankenkasse zu werden. Die Krankenkasse ist im Gegenzug gesetzlich verpflichtet, das beitrittswillige Mitglied aufzunehmen.
1.7Selbstverwaltung
Der Staat erbringt die Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht selbst, sondern delegiert diese, indem er Sicherstellungsaufträge erteilt.
So sind (gesetzliche) Krankenkassen (GKV), die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und der Medizinische Dienst (MD) Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR), die ihre jeweiligen Leistungen im Auftrag des Staates erbringen (= Delegation des Sicherstellungsauftrages).
Die Leistungserbringer sind in den Sektoren zu Selbstverwaltungen zusammengefasst, beispielsweise im stationären Sektor (Krankenhäuser) oder in der ambulanten ärztlichen Versorgung (Kassenärztliche Vereinigungen und gesetzliche Krankenkassen). Die Rechtsaufsicht bleibt jedoch immer bei staatlichen Stellen. Oberstes Gremium der sog. „gemeinsamen Selbstverwaltung“ ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA).
Kennzeichnend für die Struktur des Gesundheitswesens in Deutschland sind somit folgende Grundprinzipien:
SozialstaatsgebotSolidarität über staatlich verordnete Zwangsabgaben, paritätische Finanzierung, Bedarfsdeckungsprinzip und Entkoppelung von Beitragssatz und LeistungsumfangSubsidiaritätSachleistungenAllgemeine Krankenversicherungspflicht mit WahlfreiheitSelbstverwaltung über Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR)1.8Kostendämpfungsmaßnahmen
Um eine Kostenexplosion im deutschen Gesundheitssystem zu vermeiden, werden bereits seit Jahrzehnten an vielen Stellen und über alle Sektoren hinweg Maßnahmen implementiert, die eine übermäßige Inanspruchnahme und damit verbundene Kostensteigerungen verhindern sollen.
Im stationären Bereich sind hier besonders die Einführung der DRGs und der Jahresbudgets der Krankenhäuser, im ambulanten Bereich die Regelleistungsvolumina sowie Regressandrohungen bei Überschreitung von Verordnungen (Medikamente, Heilmittel) und bei der Medikamentenversorgung Rabattvereinbarungen und das Festpreissystem für die pharmazeutische Industrie zu nennen.
Hintergrund ist auch in diesem Zusammenhang der § 12 im 5. Sozialgesetzbuch:
§ 12 SGB V Wirtschaftlichkeitsgebot
(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen.
(2) Ist für eine Leistung ein Festbetrag festgesetzt, erfüllt die Krankenkasse ihre Leistungspflicht mit dem Festbetrag.
(3) Hat die Krankenkasse Leistungen ohne Rechtsgrundlage oder entgegen geltendem Recht erbracht und hat ein Vorstandsmitglied hiervon gewusst oder hätte es hiervon wissen müssen, hat die zuständige Aufsichtsbehörde nach Anhörung des Vorstandsmitglieds den Verwaltungsrat zu veranlassen, das Vorstandsmitglied auf Ersatz des aus der Pflichtverletzung entstandenen Schadens in Anspruch zu nehmen, falls der Verwaltungsrat das Regressverfahren nicht bereits von sich aus eingeleitet hat.
2 Geschichtlicher Hintergrund des deutschen Sozialversicherungssystems
Die Grundlage für den Deutschen Sozial- und Wohlfahrtsstaat in der heutigen Ausprägung wurde in einer Art „Notwehrreaktion“ des damaligen Deutschen Reiches auf eine zunehmende soziale Spaltung innerhalb der Gesellschaft geschaffen.
Im 19. Jahrhundert und insbesondere nach der Reichsgründung 1871, wandelte sich Deutschland von einem Agrar- zu einem Industriestaat. Während das Bürgertum davon profitierte, litt die Arbeiterschaft unter niedrigen Löhnen, überlangen Arbeitszeiten, Kinderarbeit und Wohnungsnot in den Städten, was zu prekären Arbeits- und Lebensbedingungen führte. Als Reaktion darauf bildeten sich politisch aktive Arbeitervereine, die aus Sicht der damaligen Reichsregierung zu einer zunehmenden Gefahr für das politische System der Monarchie wurden. Die daraus entstehende „soziale Frage“ wurde von Otto von Bismarck in Form einer Politik von „Zuckerbrot und Peitsche“ angegangen.
Durch die Sozialistengesetze (Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie) von 1878 wurden die sozialistischen, sozialdemokratischen und kommunistischen Vereine, Versammlungen und Schriften verboten, da deren Zweck der Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung sei. Bei den Reichstagswahlen 1881 kam es zu deutlichen Wahlverlusten der konservativen Parteien und es bedurfte wirkungsvoller Maßnahmen um die Autorität der Regierung gegen das erstarkende Proletariat abzusichern.
Reichskanzler Otto von Bismarck reagierte auf diese soziale Frage mit der Einführung verschiedener sozialgesetzgeberischer Maßnahmen, die er gegen den Widerstand der konservativen und liberalen Kräfte aus Wirtschaft und Bürgertum durchgesetzt hat. Diese Maßnahmen wurden von der Arbeiterschaft zwar als Ablenkungsmanöver betrachtet, begründeten jedoch die Ausrichtung zu einem Sozial- und Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn heute kennen. 1911 wurden die besagten gesetzlichen Regelungen in den Rechtsrahmen der Reichsversicherungsordnung (RVO) zusammengefasst, die seitdem auch die Versicherung der Angestellten beinhaltete. Im Jahr 1927 wurde schließlich noch die Arbeitslosenversicherung eingeführt.
1883: gesetzliche Krankenversicherung
1884: gesetzliche Unfallversicherung
1889: Invaliditäts- und Altersversicherung
1891: gesetzliche Rentenversicherung
1927: Arbeitslosenversicherung
1957: dynamisierte Sozialrente (Orientierung an aktuellen Lohnsummen)
1961: Bundessozialhilfegesetz
1969: Ausbildungsförderung nach BAFöG
1969: Zusammenführung der Sozialversicherung (RVO) mit dem Sozialrecht im SGB V
1975: Kindergeld
1980: Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende
1986: Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub (Elternzeit)
1995: gesetzliche Pflegeversicherung
2003: Grundsicherung für alte Menschen und Erwerbsunfähige
Das heutige Sozialgesetzbuch ist eine Zusammenschau der paritätisch finanzierten Sozialversicherung (Ausnahme: Gesetzliche Unfallversicherung, diese wird ausschließlich von den Arbeitgebern finanziert) und den Leistungen des Sozialrechts, d.h. der aus Steuermitteln finanzierten staatlichen Fürsorge. Sowohl die Sozialversicherungssysteme wie auch das Sozialrecht unterliegen ständiger Anpassungen und damit Veränderungen durch die Politik. Die Herausforderung liegt in einer zukunftsfähigen Ausgestaltung der Sozialgesetzgebung und der darin enthaltenen gesetzlichen Krankenversicherung, sodass auch die durch den demografischen Wandel bedingten Einflüsse, antizipiert, proaktiv angegangen und damit kompensiert werden können.
3 Der Gemeinsame Bundesausschuss
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen und bestimmt in Form von Richtlinien, welche medizinischen Leistungen die ca. 73 Millionen gesetzlich Krankenversicherten beanspruchen können.
Darüber hinaus beschließt der G-BA u.a. auch Maßnahmen im Bereich der Qualitätssicherung für Praxen und Krankenhäuser.
Vertreten sind im G-BA die vier großen Selbstverwaltungsorganisationen: Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband).
Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und umfasst Arzneimittel, Qualitätssicherung und sektorenübergreifende Versorgungskonzepte, Disease-Management-Programme (DMP), Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV), Methodenbewertung und veranlasste Leistungen, Bedarfsplanung, Psychotherapie, zahnärztliche Behandlung, Recht (SGB V), Fachberatung Medizin sowie die Analyse des EBM.
Die vom G-BA bearbeiteten Themenbereiche sind ebenso breit gefächert wie komplex und umfassen u.a.:
Arzneimittel
Qualitätssicherung und sektorenübergreifende Versorgungskonzepte (Qualitätssicherung, Disease-Management-Programme, Ambulante spezialfachärztliche Versorgung)
Methodenbewertung und veranlasste Leistungen (Methodenbewertung, veranlasste Leistungen, Bedarfsplanung, Psychotherapie, zahnärztliche Behandlung)
Recht (SGB V)
Fachberatung Medizin (Analyse EBM, epidemiologische Studien, Orphan Drugs, diagnostische und therapeutische Methoden)
Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Bürokratiekostenermittlung und Fristenmonitoring
Stab der unparteiischen Mitglieder
Stabsstelle Patientenbeteiligung
Die folgenden Institute arbeiten dem G-BA zu:
3.1Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) untersucht den Nutzen und den Schaden von medizinischen Maßnahmen für Patientinnen und Patienten und Informiert über die Vorteile und Nachteile von Untersuchungs- und Behandlungsverfahren in Form von wissenschaftlichen Berichten und allgemein verständlichen Gesundheitsinformationen.
3.2Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut, das den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) dabei berät, wie die medizinische Versorgungsqualität in Deutschland gemessen und verbessert werden kann.
Im Auftrag des G-BA entwickelt das IQTIG hauptsächlich Qualitätsindikatoren, mit denen die Qualität der Gesundheitsversorgung gemessen werden soll. Der G-BA entscheidet, ob diese Indikatoren zur Qualitätsmessung einsetzt werden. Diese externe Qualitätssicherung soll vor allem für die Patienten und für die nützlich sein, die die Patienten versorgen.
Qualitätsberichte
Das IQTIG veröffentlicht jährliche Qualitätsreporte. Diese Bundesqualitätsberichte (BQB) werden einmal jährlich auf Grundlage der „Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung“ (DeQS-RL) erstellt und beinhalten die auf Bundesebene aggregierten Auswertungen der externen Qualitätssicherung.
Hintergrund ist die vom Gesetzgeber erfolgte Beauftragung des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), Qualitätsvorgaben für die Leistungserbringer zu entwickeln. Diese Qualitätsvorgaben sollen von der Selbstverwaltung erarbeitet werden und sich in verbindlichen Richtlinien und Regelungen niederschlagen. Für die Qualitätsbewertung wurden zwischenzeitlich mehr als 200 Indikatoren entwickelt.
Anhand des Qualitätsberichts kann somit indikatorengestützt festgestellt werden, ob sich die betrachteten Verfahren im Zeitverlauf
signifikant verbessert
signifikant verschlechtert oder
ohne signifikante Veränderung
darstellen und besondere Handlungsbedarfe daraus abgeleitet werden können, die Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung bedingen.
Die Auswertungen des Qualitätsberichtes können für die Krankenhausplanung als sog. planungsrelevante Qualitätsindikatoren den Landesbehörden zur Verfügung gestellt werden.
Auch erfolgt ein strukturierter Dialog bei Auffälligkeiten einzelner Krankenhäuser, bei dem die Einrichtungen erklären, entkräften bzw. beschreiben können, wie sie mit diesen Auffälligkeiten und erfassten Abweichungen umgehen werden. Ziel des strukturierten Dialogs ist es, in diesen Einrichtungen Verbesserungsmaßnahmen zu implementieren, sofern dies erforderlich erscheint.
Im Bundesqualitätsbericht des Jahres 2020 für das Jahr 2019 wurden folgende Versorgungsbereiche betrachtet:
Versorgung sehr kleiner Frühgeborener
Als dessen Konsequenz erfolgte eine Erhöhung der Mindestmenge bei der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen (mit einem Aufnahmegewicht unter 1.250 g) von 14 auf 25 pro Jahr und Einrichtung. (Die Versorgungsqualität aller deutschen Perinatalzentren wird auch auf der Website
www.perinatalzentren.org
in laienverständlicher Form dargestellt).
Nosokomiale Infektionen
Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen.
Gefäßchirurgie
Karotis-Revaskularisation.
Hygiene und Infektionsmanagement
Ambulant erworbene Pneumonie
Kardiologie und Herzchirurgie
Leitlinienkonforme Indikation (= Diagnosestellung) für implantierbare Defibrillatoren, Implantation
Sondendislokationen oder -dysfunktionen
Perkutane Koronarintervention und Koronarangiografie
Aortenklappenchirurgie (isoliert) Koronarchirurgie (isoliert) und kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie
Transplantationsmedizin
Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen
Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation sowie Nierentransplantation
Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation
Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation
Lebertransplantation
Leberlebendspende
Nierentransplantation
Nierenlebendspende
Gynäkologie
Prätherapeutische histologische Diagnosesicherung
Zeitlicher Abstand von unter 7 Tagen zwischen Diagnose und Operation
Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparation bei sonografischer Drahtmarkierung
Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)
Perinatalmedizin
Geburtshilfe und Neonatologie (Versorgung von Frühgeborenen)
Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Kaiserschnittentbindung
Neonatologie: Durchführung eines Hörtests
Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate an Kaiserschnittgeburten
Orthopädie und Unfallchirurgie
Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
endoprothetischer Gelenkersatz mit Hüft- und Knieendoprothesenversorgung
Pflege
Dekubitusprophylaxe
Datengrundlagen der Bundesqualitätsberichte
Grundlage der Auswertung waren für die QS-Verfahren nach der Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern (QSKH-RL): Es wurden 1.472 Krankenhäuser mit 1.798 Krankenhausstandorten und für die perkutane Coronarintervention 255 vertragsärztliche Praxen/Medizinische Versorgungszentren (MVZ), 961 Krankenhausstandorte und 19 selektivvertragliche Leistungserbringer, bei der Wundinfektion 2.087 ambulant operierende vertragsärztliche Leistungserbringer, 612 ambulant operierende Krankenhausstandorte und 940 stationär operierende Krankenhausstandorte in die Auswertung mit einbezogen.
3.3Sektorenübergreifende Qualitätssicherung
Der Gemeinsame Bundesausschuss definiert sowohl für die Krankenhäuser wie auch für die Arztpraxen in Deutschland Vorgaben zum Qualitätsmanagement gemäß SGB V § 136:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für die vertragsärztliche Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich einheitlich für alle Patienten durch Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 insbesondere
1. die verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 135a Absatz 2, § 115b Absatz 1 Satz 3 und § 116b Absatz 4 Satz 4 unter Beachtung der Ergebnisse nach § 137a Absatz 3 sowie die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement und
2. Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität der durchgeführten diagnostischen und therapeutischen Leistungen, insbesondere aufwändiger medizintechnischer Leistungen; dabei sind auch Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festzulegen.“
Damit werden sektorenübergreifend die Leistungserbringer im deutschen Gesundheitswesen zu einer nachvollziehbaren und nachweisbaren Qualitätssicherung verpflichtet. Dies betrifft Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser, Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen und Einrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag nach § 111a besteht.
Die o.g. müssen sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung zu beteiligen, um ihre Ergebnisqualität zu verbessern und ein einrichtungsinternes Qualitäts- und Fehlermanagement einführen und weiterentwickeln.
Bei Krankenhäusern kommt explizit auch die Verpflichtung zur Durchführung eines patientenorientierten Beschwerdemanagements dazu. Auch die Krankenhäuser müssen (wie die Vertragsärzte) alle 5 Jahre entsprechend des § 135b im SGB V die Erfüllung der Fortbildungspflichten der Fachärzte und der Psychotherapeuten nachweisen und einen jährlichen Qualitätsbericht im Internet veröffentlichen.
Eine wichtige Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses ist die Durchführung von Bewertungsverfahren, in den Bereichen:
3.4Innovationsausschuss
Das Versorgungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherung muss kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dafür wurde 2016 beim Gemeinsamen Bundesausschuss der Innovationsausschuss eingerichtet. Er fördert Projekte, die innovative Ansätze für die gesetzliche Krankenversicherung erproben und neue Erkenntnisse zum Versorgungsalltag gewinnen sollen, die anschließend in die Regelversorgung übernommen werden können.
Aufgabe des Innovationsausschusses ist es, das Versorgungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. So können neue und innovative Versorgungsverfahren und -strukturen wissenschaftlich überprüft in das deutsche Gesundheitssystem eingebracht und so in der Regelversorgung integriert werden. Über den Innovationsausschuss werden Projekte in den Bereichen neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung gefördert.
Rechtsgrundlage sind die §§ 92a und 92b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V).
Die für den Innovationsausschuss erforderlichen Finanzmittel werden durch den Innovationsfonds bereitgestellt. Sie stammen von den gesetzlichen Krankenkassen und aus dem Gesundheitsfonds. Die Verwaltung der Finanzmittel übernimmt das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS).
Für das Jahr 2024 konnten
160 Millionen Euro für Projekte zu neuen Versorgungsformen und
40 Millionen Euro für Versorgungsforschungsprojekte
verwendet werden.
Der Innovationsausschuss legt in sog. Förderbekanntmachungen die Schwerpunkte und Kriterien zur Vergabe der Mittel aus dem Innovationsfonds fest und entscheidet über die Förderbarkeit der eingegangenen Anträge. Unterstützt wird er hierbei durch einen Expertenpool aus Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft und der Versorgungspraxis.
Besonders gefördert werden insbesondere Projekte, die die sektorenübergreifende Versorgung verbessern und die ein Umsetzungspotenzial in die Regelversorgung aufweisen, sowie auch solche, deren Ziel eine dauerhafte Weiterentwicklung der Versorgung ist.
Eine Förderung durch den Innovationsfonds setzt voraus, dass eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung (Evaluation) der Projekte erfolgt. Das Evaluationskonzept der Projekte muss somit auf einer validen und gesicherten Datengrundlage beruhen, damit sowohl deren Ergebnisse als auch deren Effekte für die Versorgung im Hinblick auf eine dauerhafte Übernahme in die Versorgung beurteilt werden können.
Wurde ein vom Innovationsfonds gefördertes Projekt abgeschlossen und evaluiert, so können sich drei Konsequenzen ergeben:
Empfehlung zur Überführung der neuen Versorgungsform insgesamtEmpfehlung zur Überführung wirksamer Teile in die RegelversorgungKeine Empfehlung zur Überführung in die RegelversorgungAus den ersten beiden aufgeführten Punkten resultiert ein konkreter Vorschlag, wie die Überführung erfolgen soll und welche Organisation der Selbstverwaltung/andere Einrichtung für sie zuständig ist. Ist der G-BA zuständig, muss dieser innerhalb von 12 Monaten nach Beschluss der Empfehlung die Regelungen zur Aufnahme in die Versorgung beschließen und somit umsetzbar machen.
Beispiel: Telenotarzt Bayern – Überführung in die Regelversorgung
Ziel des Projekts Telenotarzt Bayern ist die Optimierung der Notfallversorgung in ländlichen Regionen.
Folgende Maßnahmen werden dazu getroffen:
Der Telenotarzt unterstützt den Rettungsdienst während der Einsätze.
Vor Ort werden Vitalparameter der Patientinnen und Patienten gemessen, aus dem Rettungsfahrzeug an Telenotarzt/-notärztin übertragen und für Diagnosestellung und Erstbehandlung sofort analysiert. So kann die Behandlung der Patientinnen und Patienten früher beginnen.
Der Innovationsausschuss empfahl die Übernahme dieser neuen Versorgungsform zur Überführung in die Regelversorgung und leitete diese Empfehlung an die zuständigen Organisationen (Gesundheitsministerien der Länder, Gesundheitsministerkonferenz und die maßgeblichen Fachgesellschaften) weiter. Über https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/ können die Beschlüsse des Innovationsausschusses eingesehen werden.
Die riesige Bandbreite der vom Innovationsfonds geförderten oder bei ihm eingereichten Projekte beweist das hohe Innovationspotenzial im deutschen Gesundheitswesen, sowohl bei den Leistungserbringern (Krankenhäusern, Arztpraxen und in der ambulanten Versorgung generell) als auch bei den Krankenkassen, welches noch längst nicht ausgeschöpft ist. Auch wird anhand der zwingend vorgesehenen Evaluationen systematisch erfasst und geprüft, ob die Ansätze funktionieren, in strukturell vergleichbare Regionen oder auf andere Patientengruppen übertragen und letztlich in Regelversorgung aufgenommen werden können.
Die Patientenbeteiligung im G-BA wird durch Organisationen gewährleistet, die auf Bundesebene maßgeblich die Interessen von Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen in Deutschland vertreten. Diese Organisationen der Patientenbeteiligung haben Mitberatungs- und Antragsrechte, jedoch kein Stimmrecht bei Entscheidungen des G-BA.
Aktuell sind folgende Patienten- und Selbsthilfeorganisationen im G-BA vertreten:
Deutscher Behindertenrat (DBR)
Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen (BAGP)
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Damit wird deutlich, was für ein mächtiges Gremium der Gemeinsame Bundesausschuss ist und dass dieser zu Recht als höchstes Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen bezeichnet wird. Die Rechtsaufsicht über den G-BA liegt beim Bundesgesundheitsministerium.
4 Die 13 Sozialgesetzbücher
Die gesetzlichen Grundlagen des deutschen Sozialstaates sind im Sozialgesetzbuch zusammengefasst. Genau genommen besteht das SGB aus 13 einzelnen Sozialgesetzbüchern, die den rechtlichen Rahmen für einzelne Rechtsgebiete hinterlegen:
SGB I: Allgemeiner Teil
SGB II: Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB III: Arbeitsförderung
SGB IV: Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung
SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung
SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung
SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
SGB X: Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
SGB XI: Soziale Pflegeversicherung
SGB XII: Sozialhilfe
SGB XIV: Soziales Entschädigungsrecht
Seit dem 01.01.2024 gibt es mit dem SGB XIV ein zusätzliches Sozialgesetzbuch, das die Entschädigung bei Gesundheitsschäden durch Terroranschläge, Katastrophen oder ähnliche Ereignisse regelt. Es wurde am 12.12.2019 im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts verabschiedet. Einige Regelungen traten bereits zu diesem Zeitpunkt in Kraft, während andere schrittweise folgen. Das SGB XIV ergänzt die bisherigen zwölf Sozialgesetzbücher und wird in mehreren Etappen eingeführt. Aufgrund der schrittweisen Umsetzung und der teilweise noch geltenden Übergangsregelungen wird es in der Praxis jedoch noch nicht in vollem Umfang angewendet.
Der sozialgesetzliche Rahmen für die gesetzliche Krankenversicherung findet sich im SGB V, welches wiederum thematisch nach 13 Kapitel unterteilt wird.
Das SGB V
Das fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V) definiert die Rahmendbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Es ist in 13 Kapitel und (derzeit) 426 Paragrafen untergliedert:
1. Kapitel: Enthält allgemeine Vorschriften, wie: Solidarität und Eigenverantwortung, Leistungen, das Prinzip der solidarischen Finanzierung und die Krankenkassen
2. Kapitel: Versicherung Kraft Gesetz, freiwillige Versicherung und Familienversicherung
3. Kapitel: Leistungen der Krankenversicherung, gemeinsame Vorschriften, Leistungen zur Verhütung von Krankheiten (Prophylaxe), betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Förderung der Selbsthilfe, Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten und den Leistungen bei Krankheit (Behandlung, Krankengeld, Selbstbehalt …)
4. Kapitel: Definiert die Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern, die Aufgaben der K(Z)Ven, die Bedarfsplanung, Krankenhäuser, Heil- und Hilfsmittel, Apotheken, Pharmazeutische Unternehmer einschließlich der Qualitätssicherung
5. Kapitel: Behandelt den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
6. Kapitel: Organisation der Krankenkassen
7. Kapitel: Verbände der Krankenkassen
8. Kapitel: Finanzierung (Beitragspflicht, Beitragsbemessungsgrenze, Zusatzbeitrag …)
9. Kapitel: Medizinischer Dienst
10. Kapitel: Versicherungs- und Leistungsdaten, Datenschutz, Datentransparenz
11. Kapitel: Straf- und Bußgeldvorschriften
12. Kapitel: Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands
13. Kapitel: weitere Übergangsvorschriften
Ein zentrales Thema im SGB V ist das sog. Wirtschaftlichkeitsgebot:
SGB V § 12: Wirtschaftlichkeitsgebot:
Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken, dürfen die Krankenkassen nicht bewilligen.
Die Nichtkenntnis des Wirtschaftlichkeitsgebotes in der breiten Öffentlichkeit, bei den Leistungserbringern und der Politik ist möglicherweise einer der wesentlichen Gründe für nicht adäquate Anspruchshaltungen und Leistungsversprechungen.
Zusammenhang: SGB V – G-BA
Während das SGB V mit insgesamt 426 Paragrafen die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland auflistet, ist es Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), die Ausgestaltung und damit den sich daraus ableitenden sog. „Leistungskatalog“ zu definieren.
SGB XI – Die soziale Pflegeversicherung
Die soziale Pflegeversicherung wurde am 01.01.1995 als eigenständiger Zweig der gesetzlichen Sozialversicherung als 11. Sozialgesetzbuch aufgenommen. Es enthält die Regelungen zur sozialen Pflegeversicherung und besteht aus derzeit 16 Kapiteln mit 154 Paragrafen.
1. Kapitel: Allgemeine Vorschriften
2. Kapitel: Leistungsberechtigter Personenkreis, Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und Berichtspflichten, Begriff der Pflegeperson
3. Kapitel: Versicherungspflichtiger Personenkreis
4. Kapitel: Leistungen der Pflegeversicherung
5. Kapitel: Organisation (u.a. Träger der Pflegeversicherung, Zuständigkeiten, …)
6. Kapitel: Finanzierung
7. Kapitel: Beziehungen der Pflegekassen zu den Leistungserbringern
8. Kapitel: Pflegevergütung
9. Kapitel: Datenschutz, Statistik und Interoperabilität
10. Kapitel: Private Pflegeversicherung
11. Kapitel: Qualitätssicherung, sonstige Regelungen zum Schutz der Pflegebedürftigen
12. Kapitel: Bußgeldvorschrift
13. Kapitel: Befristete Modellvorhaben
14. Kapitel: Zulagenförderung der privaten Pflegevorsorge
15. Kapitel: Bildung eines Pflegevorsorgefonds
16. Kapitel: Überleitungs- und Übergangsrecht
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung
Analog zur gesetzlichen Krankenversicherung besteht bei der gesetzlichen Pflegeversicherung eine Versicherungspflicht und eine paritätische Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Die Beitragssätze unterscheiden sich nach Familienstand und betragen im Jahr 2025 3,4% bei Familien mit Kindern und 4% bei kinderlosen Versicherungsnehmern. Dieser Kinderlosen-Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten ist nur von den Arbeitnehmern zu tragen.
Versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung sind nach SGV XI alle versicherungspflichtigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. D.h. die Pflegeversicherung folgt grundsätzlich der Krankenversicherung.
Ausnahmen von dieser Regelung bestehen nur, wenn die betroffenen Personen nachweisen, dass sie bei einem privaten Versicherungsunternehmen gegen Pflegebedürftigkeit versichert sind.
In § 23 SGB XI wird die Versicherungspflicht für Versicherte der privaten Krankenversicherungsunternehmen und der beihilfeberechtigten Personen geregelt.
Damit ist für die gesamte Bevölkerung Deutschlands eine Abdeckung des Pflegerisikos gesetzlich festgelegt.
Allerdings wird nur eine „Teilabsicherung des Pflegerisikos“, ermöglicht, d.h. Eigenanteile der Versicherten sind weiterhin notwendig.
Diese Lücke zwischen den Versicherungsleistungen und den tatsächlichen Kosten kann oft mehrere Hunderte oder gar Tausende Euro betragen. Diese Differenz muss anderweitig ausgeglichen werden, etwa durch ein hohes Alterseinkommen, Ersparnisse oder eine private Pflegezusatzversicherung.
In welchem Umfang pflegebedürftige Menschen in Deutschland Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten, hängt von der Dauer der Pflegebedürftigkeit, dem Pflegegrad und der Art der Pflege ab.
Die Pflegeleistungen werden gewährt für:
Häusliche Pflege:
Pflegegeld für häusliche Pflege sowie pflegefachliche Beratungsbesuche
Pflegesachleistungen für häusliche Pflege
Pflege bei Verhinderung einer Pflegeperson
Pflegeunterstützungsgeld





























