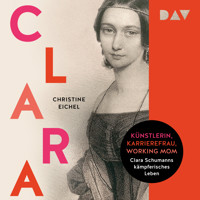12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Eine Pfarrerstochter war Kanzlerin, ein ehemaliger Pfarrer Bundespräsident. Zufall?
Seit Martin Luther den Zölibat verwarf, stieg das deutsche Pfarrhaus zum Paradigma christlichen Zusammenlebens auf. Als Hort der Bildung und Bollwerk gegen säkularen Sinnverlust wurde es auch gesellschaftlich relevant: religiöses Biotop und politischer Gegenentwurf, bürgerliche Enklave und antibürgerlicher Kampfschauplatz. Und nicht zuletzt Heimat so unterschiedlicher Pfarrerskinder wie Albert Schweitzer, Friedrich Nietzsche oder Gudrun Ensslin.
Die Geschichte des deutschen Pfarrhauses erzählt von einem geistigen Reizklima mit hohem Wertepotenzial. Glaube, Liebe, Hoffnung, aber auch Kritik, Einspruch und Radikalität das sind offenbar wieder attraktive Optionen in Zeiten des unverbindlichen Pragmatismus.
Dieses Buch ist ein Streifzug durch die Welt des Pfarrhauses, in dem Dichter wie Lessing und Hesse aufwuchsen, in dem die Künste und die Wissenschaft zu Hause waren und das in der jüngeren Geschichte seine Eigenständigkeit bewies, als es in der DDR zum Schutzraum der Opposition wurde. Zu Wort kommen auch Pfarrer und Pfarrerskinder, die aus dem Kosmos des Pfarrhauses berichten und deutlich machen: Es wird nie ein Haus wie jedes andere sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christine Eichel
DAS DEUTSCHEPFARRHAUS
Hort des Geistes und der Macht
Meiner Familie
Inhalt
Einleitung
Kein Haus wie jedes andere
ETHOS UND IDYLL
Der Mythos des deutschen Pfarrhauses
Das Pfarrhaus als Sehnsuchtsort
Das Pfarrhaus, ein Skandal
Idealisiertes Familienleben
Das offene Pfarrhaus der Gegenwart
Das Pfarrhaus als Asyl
Das Haus als Identität
Kleines Denkmal für die Pfarrfrau
Die Frau im Talar
Die Pfarrersfamilie zwischen Erfüllung und Überlastung
GEIST UND GLAUBE
Das Pfarrhaus als Musentempel
Der geistliche Ackerbauer
Vom Landwirt zum Bildungsbürger
Sprachtempel und Wissensspeicher
Der Pfarrer als Gelehrter
Pfarrerskinder als Wissenschaftler
Klingender Glaube
Der väterliche Auftrag
Das Pfarrhaus als literarisches Sujet
Literatur aus dem Pfarrhaus
Die literarische Emanzipation der Pfarrerssöhne
Pfarrerssöhne im gesellschaftlichen Umbruch
GÄNGELUNG UND REBELLION
Pfarrerskinder im Bann der Gottesvergiftung
Erziehungsgewalt
Erzwungener Gehorsam
Verordnetes Schweigen
Lieber Gott und böser Gott
Ausbruchsversuche
Gudrun Ensslins gewaltsame Revolte
Hass auf das Pfarrhaus
ANPASSUNG UND WIDERSTAND
Das Pfarrhaus im politischen Reizklima
Glaube und Politik
Kirche im Dritten Reich
Kirche in der DDR
Das verdächtige Pfarrhaus
VON DER KANZEL AN DIE MACHT
Politiker vor dem Hintergrund der protestantischen Kultur
Der Mythos der protestantischen Arbeitsethik
Die protestantische Kultur
Pfarrhaustugenden in der politischen Sphäre
Die Renaissance des Predigertons
Ausblick
Das Pfarrhaus heute
Quellen
Register
EinleitungKein Haus wie jedes andere
Eine Pfarrerstochter ist Kanzlerin, ein ehemaliger Pfarrer Bundespräsident. Nichts weiter als ein Zufall?
Immerhin zeigte die Nachfolgediskussion um das Amt des Bundespräsidenten Anfang 2012 eine eigentümliche Symptomatik. Neben Joachim Gauck waren unter anderem die ehemalige Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Margot Käßmann und Altbischof Wolfgang Huber im Gespräch gewesen. Alle drei hatten ein Amt ausgeübt, das man mit einem schönen, altmodischen Begriff als Seelsorger bezeichnet. Und noch ein weiterer Name wurde genannt: Katrin Göring-Eckardt, Politikerin, Theologin und Präses der EKD-Synode. Diesem Quartett traute man zu, gleich ein ganzes Land zu vertreten – glaubensgefestigte Antworten auf den Bankrott politischer Moral, für den der gestrauchelte Präsident Wulff stand.
Woher kam dieser Vertrauensvorschuss? War es die freundliche Unterstellung ethischer Integrität aus dem Geist von Hausmusik und Tischgebet? Sind evangelische Pfarrhäuser die letzten Kaderschmieden für Ämter mit höchstem Symbolwert und moralischer Leuchtturmfunktion?
»Zukunft braucht Herkunft«, diese These Odo Marquards wurde offenbar wörtlich genommen. Bezieht man sie im engeren Sinne auf das Herkunftsmilieu, so wirkt sie wie ein Einspruch gegen das Wort von der durchlässigen Gesellschaft. Das Pfarrhaus erscheint demgegenüber wie ein Gütesiegel in einem politischen Klima, in dem mancher auffallend geschmeidig seine Prinzipien auswechselt. Oder gar nicht erst welche hat.
Pfarrer und kirchliche Würdenträger, das wissen wir nicht erst seit Margot Käßmanns Rücktritt als Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der EKD, sind alles andere als unfehlbar. Offenbar stehen sie jedoch für eine christliche Ethik, die über Korrumpierbarkeiten erhaben ist. Der Kontrast zwischen dem aufrechten Rücktritt Margot Käßmanns und den zähen Rückzugsgefechten Christian Wulffs hätte größer nicht sein können. Luther schrieb einst, Anfechtungen seien Umarmungen Gottes. Margot Käßmann ließ sich umarmen und ging aus einer Niederlage siegreich hervor. Christian Wulff dagegen bestritt jede Anfechtung und lavierte sich damit auf die Position des Verlierers. Er fiel tief, verlor nicht nur sein Amt, sondern auch seine Reputation. Margot Käßmann dagegen konnte verkünden: »Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand.«
Worin aber besteht über solche Haltungsnoten hinaus das Faszinosum des Pfarrhauses? Sicherlich schwingt als Oberton dessen Weltbeglückungspathos mit, die Überzeugung, ein Beispiel geben und ausstrahlen zu können, ja zu müssen. »Ein feste Burg ist unser Gott«, dichtete Martin Luther. Solche Zeilen prägen. Bewohner von Pfarrhäusern wirken denn auch zuweilen wie Felsen in der Brandung, glaubwürdiger als Berufspolitiker. So jedenfalls muss die unausgesprochene Annahme gelautet haben, als Namen wie Gauck, Käßmann, Huber und Göring-Eckardt aus dem Hut gezogen wurden. Und mit ihnen die Hoffnung auf politisch-moralische Erneuerung aus dem Geiste des Pfarrhauses.
Diese Politisierung ist relativ neu. Von jeher traute man dem Pfarrhaus zu, eine ethische Gegenwelt zu repräsentieren. Zur Ressource des politischen Personals wurde es jedoch erst nach der friedlichen Revolution 1989. Pfarrer wie Markus Meckel und Rainer Eppelmann, die sich in der DDR-Opposition engagiert hatten, galten auch nach der Wende als politische Hoffnungsträger. Joachim Gauck, der sich erst spät öffentlich gegen die DDR-Führung gestellt hatte, wurde zu einem Wortführer des Neuen Forums.
So schien es nur konsequent, dass einige Pfarrer ganz auf das Terrain des Berufspolitikers wechselten. Die erste Volkskammer, die 1990 aus freien Wahlen hervorging, nannte man »Pastoren-Parlament« – mit einunddreißig evangelischen Theologen. Im ersten gesamtdeutschen Bundestag waren zwölf Theologen vertreten. Acht stammten aus dem Osten Deutschlands, unter ihnen Richard Schröder, Markus Meckel und Rainer Eppelmann. Mit Pastorentochter Angela Merkel und dem ehemaligen Pfarrer Joachim Gauck erhielt diese Tendenz ihre prominentesten Vertreter.
Das ist neu, denn Glaube und Macht waren nach Luther’schem Verständnis getrennte Sphären. Der Theologe Karl Barth hat diese Grenzziehung als »Lehre von den zwei Reichen« bezeichnet, die letztlich eine politische Einmischung von Christen untersagte. Die Konsequenz war sichtbar als Allianz zwischen Thron und Altar: Loyalität zur Obrigkeit, Solidarität mit den Mühseligen und Beladenen. Macht beanspruchte das Pfarrhaus nicht. Es verstand sich als Ort der Barmherzigkeit, nicht als Taktgeber für politische Veränderungen. So groß sein geistesgeschichtlicher Einfluss auch war, besonders in der Epoche der Aufklärung, von Macht konnte nur indirekt gesprochen werden. Jetzt aber scheint es, als ob das Pfarrhaus als gesellschaftlicher Faktor auch die Sphäre der Macht nicht scheut.
Solche politischen Tangenten des Pfarrhauses werfen ein Schlaglicht auf eine Institution, die keinen offiziellen Charakter, aber immer noch eine große Anziehungskraft besitzt. Der Grund dafür ist unmittelbar in Luthers Hinwendung zum Irdischen zu suchen. Das evangelische Pfarrhaus steht qua definitionem mitten im Leben, verlagert also das Göttliche ins Weltliche und erhebt den Anspruch, sich genau daran zu bewähren. Der evangelische Pfarrer wird nicht nur an dem gemessen, was er glaubt, sondern vor allem daran, wie er handelt – frei nach Martin Luthers Vorgabe, das gesamte Leben solle ein Gottesdienst sein.
Die theologisch begründete »Vergeistlichung« der Welt, wie der Politikwissenschaftler Martin Greiffenhagen sie nennt, reicht weit in die Privatsphäre hinein. Seit Reformator Luther den Zölibat verwarf, stieg das Pfarrhaus zum Paradigma christlichen Zusammenlebens auf. Das Familienleben wurde öffentlich, das Private sichtbar – und musste der Beobachtung durch die Gemeinde standhalten. Keine leichte Aufgabe, erliegen doch auch ein Pfarrer und seine Familie dem Allzumenschlichen. Dennoch wird von ihnen erwartet, dass sie Gelungenheit vorleben, auch und gerade wenn sie Krisen durchmachen. Pfarrer und ihre Familien befinden sich permanent im Praxistest. Scheitern sie, dokumentieren sie damit – von außen betrachtet – die Ermüdungsbrüche ihres Glaubens. Kein Wunder, dass sich starke innere Instanzen ausbilden.
Dass man überhaupt so genau hinsieht, hat vermutlich mit einer Sehnsucht nach Leitbildern zu tun. Ob das Pfarrhaus sie liefern kann, steht auf einem anderen Blatt. Doch in Zeiten metaphysischer Obdachlosigkeit fasziniert es offenbar, wenn sich Menschen zu einer Lebensform bekennen, die auf »Höherem« beruht. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Anachronismus in der Vernunftkultur, ist doch die Vernunft »das größte Hindernis für den Glauben, weil alles Göttliche ihr absurd scheint«, so Luther. Das rationale Zeitalter wurde daher eines der systematischen Glaubensenteignung. Dafür gab es gute Gründe, die nicht zuletzt die Philosophie der Aufklärung formulierte. Die Alternative hieß blinder Glaube oder abgesichertes Wissen – daher wirkte das »sapere aude«, Kants »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!«, als Befreiungsschlag.
Auch hier gilt allerdings die Dialektik der Aufklärung, wie sie Adorno und Horkheimer beschrieben: Die Dekonstruktion von Ideologien durch die Vernunft schlage leicht um in die Bereitschaft, sich neuerlichen Glaubenssätzen auszuliefern. Das Vakuum, das mit der Diskreditierung des religiösen Glaubens einherging, wurde deshalb mit dem Glauben an den Fortschritt gefüllt, mit der Aussicht »auf Unterwerfung der Natur und auf materiellen Überfluss, auf das größtmögliche Glück und auf uneingeschränkte persönliche Freiheit«, wie Erich Fromm aufzählt.
Bekanntlich haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt. Und mehr noch, es kam zu massiven Sinnverwerfungen. Vor diesem Hintergrund erscheint das Pfarrhaus wie eine Projektionsfläche für den gestiegenen Orientierungsbedarf. Zu Recht?
Dieses Buch ist eine Annäherung an den Mythos des deutschen Pfarrhauses. Wie bei jedem Mythos, der besichtigt wird, kommt es dabei auch zu Entzauberungen. Der Anspruch gelebten Christentums, das bis ins Familienleben hinein Vorbildcharakter haben soll, ist zugleich eine Steilvorlage für Widersprüche und Überdehnungen. Gerade das aber machte das evangelische Pfarrhaus zu einem kulturellen Katalysator, der über die Jahrhunderte hinweg bis heute spürbar ist. Es hat immer wieder divergierende Tendenzen in sich vereinigt – und bewies gerade damit seine gesellschaftliche Relevanz. Es ist kein homogenes Gebilde, sondern konnte und kann vielerlei sein: Insel der Frömmigkeit und Geburtsstätte des Zweifels, Arena des Disputs und Schauplatz von Harmoniezwang, bürgerliche Enklave und antibürgerlicher Reflex.
Diese Mehrdeutigkeit ist nicht zuletzt an den Pfarrerskindern abzulesen. Ihr Erbe ist ambivalent, mündet wahlweise in Engagement, Überforderung oder Rebellion. Der Schriftsteller und Pfarrerssohn Benjamin von Stuckrad-Barre sagte mir einmal: »Als Pfarrerskind wird man entweder Terrorist oder Kanzlerin. Schriftsteller liegt vermutlich irgendwo dazwischen.«
Wohl kaum würde man auf den ersten Blick erraten, was sie verbindet, diese Dichter und Denker, Künstler und Politiker: Michael Praetorius, Andreas Gryphius, Georg Philipp Telemann, Johann Christoph Gottsched, Gotthold Ephraim Lessing, Christoph Martin Wieland, Matthias Claudius, Georg Christoph Lichtenberg, Gottfried August Bürger, Jean Paul, die Gebrüder Schlegel, Friedrich Schleiermacher, Friedrich Ludwig Jahn, Karl Friedrich Schinkel, Jacob Burckhardt, Alfred Brehm, Friedrich Nietzsche, C.G. Jung, Albert Schweitzer, Hermann Hesse, Gottfried Benn, Horst Wessel, Ingmar Bergman, Friedrich Dürrenmatt, Christine Brückner, Johannes Rau, Gabriele Wohmann, Meinhard von Gerkan, Gudrun Ensslin, Hans Wilhelm Geißendörfer, Friedrich Christian Delius, Christoph Hein, Rezzo Schlauch, Elke Heidenreich, Angela Merkel, Peter Lohmeyer, Katharina Saalfrank, Benjamin von Stuckrad-Barre.
Alle sind sie Kinder des Pfarrhauses. Was sie trennt, ist offensichtlich. Was aber verbindet sie?
Das Pfarrerskind gibt es so wenig wie das Pfarrhaus. Dennoch haben beide großen Anteil an unserer Mentalitätsgeschichte, weil sie die protestantische Kultur in die Gesellschaft trugen. Mit ihrem Ethos von Verantwortung, Pflicht und Selbstdisziplin prägten sie das Lebensgefühl auch jener, die sich als glaubensfern bezeichnen. Traditionell verstand sich das Pfarrhaus außerdem als Hort der Bildung, in dem Musik und Literatur vermittelt wurden, als Bollwerk des Humanismus in oft geistfeindlicher Umgebung.
Für viele Pfarrerskinder bedeutete das eine innere Verpflichtung, hinaus in die Welt zu gehen und dort zu wirken – wenn auch mit ganz unterschiedlichen Ambitionen. Viele von ihnen grenzten sich konsequent gegen das Elternhaus ab, gegen Glaubenspostulate und Kontrollfantasien. Doch das Pfarrhaus blieb ihr Bezugspunkt: »Kein Pfarrerskind verlässt das Haus, ohne symbolisch immer wieder dorthin zurückzukehren«, resümiert der Theologe Wolfgang Steck.
Das Thema dieses Buches betrifft mich auch persönlich. Als Tochter eines Landpfarrers erlebte ich, wie fröhliches Gottvertrauen und eisernes Pflichtbewusstsein Hand in Hand gingen. Möglicherweise bin ich aber auch Zeugin einer untergehenden Welt. Mein Vater, Jahrgang 1922, war noch rund um die Uhr erreichbar. Oft holte man ihn nachts aus dem Bett, wenn jemand im Sterben lag.
Das Familienleben stand völlig selbstverständlich im Dienst der Gemeinde. Meine Mutter ging in ihrer Aufgabe als Pfarrfrau auf, leitete verschiedene Frauengruppen und den Kirchenchor. Wir Kinder spielten bei Gemeindefesten Klavier und Geige, bastelten für Basare, öffneten die Haustür jedem, der klingelte. Wirklich jedem. Dem Brautpaar, das die Hochzeitspredigt besprechen wollte, ebenso wie dem Obdachlosen, der wusste, dass er im Pfarrhaus immer eine Tasse Kaffee und ein Butterbrot bekam. Wir waren die allzeit bereite Familienfirma. Und alle standen wir unter genauer Beobachtung.
Das wandelt sich heute. Nicht überall sind die Pfarrhäuser noch stets geöffnete Betreuungsofferten, selbst ernannte Vorbilder oder gar Kulturträger. Manche Pfarrersfamilie entzieht sich den allgegenwärtigen Gemeindepflichten. Auch ein intaktes Familienleben, ohne Scheidung, ohne Konflikte, ist längst Illusion.
Andererseits ist der Abgesang aufs Pfarrhaus letztlich eine Stimme mehr im Chor des Kulturpessimismus. Obwohl es in den vergangenen Jahrzehnten einen Bedeutungsverlust verzeichnete, ist das Pfarrhaus doch nicht völlig bedeutungslos geworden. Dagegen spricht, dass es eben immer wieder auch Pfarrer sind, die als gesellschaftliche Instanzen wahrgenommen werden. Wenn man sie nicht gleich für höchste Ämter empfiehlt.
Pfarrer werden vermutlich nie bloße Dienstleister sein. Die theologische Dimension ihres Berufs wird auch dem Pfarrhaus immer eine besondere Rolle zuweisen. Es wird Funktionswechsel geben, wie es sie in seiner Geschichte immer gegeben hat, in der mal biedermeierlicher Rückzug, mal preußisches Leistungsethos, dann wieder Zivilcourage oder politische Einmischung in den Vordergrund traten. Doch nie wird der evangelische Pfarrer seinem Selbstverständnis nach einer weltentrückten Klerikerkaste angehören. Er hat eine lebenspraktische Ausrichtung, auf das Hier und Jetzt. Sein Selbstverständnis ist auf die Konkretion gerichtet, nur sich und seinem Gott verantwortlich.
Ich habe mich auf eine Spurensuche begeben. Neben der Auseinandersetzung mit Martin Luther und Katharina von Bora war es vor allem eine Reise durch die deutsche Kulturgeschichte, mit Ausflügen in europäische Nachbarländer. In Gesprächen mit Pfarrerinnen, Pfarrern und Pfarrerskindern kam oft Überraschendes zutage, jenseits von Mythen und Klischees.
Äußerst hilfreich waren die Untersuchungen von Martin Greiffenhagen, der die Sozialgeschichte des Pfarrhauses und seiner Kinder eindrucksvoll dokumentiert hat. Auch die Interviews, die Anja Würzberg, Pastorentochter und Journalistin, mit Pfarrerskindern geführt hat, waren aufschlussreich. Hervorheben möchte ich darüber hinaus die Radiofeatures von Michael Hollenbach, der dem Thema Pfarrhaus neue Aspekte abgewinnt, sowie die Anthologie Der Pfarrer und das Pfarrhaus in der Literatur, herausgegeben vom Erziehungswissenschaftler und Religionspädagogen Fulbert Steffensky.
Bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeitern des Quadriga Verlags, bei meiner wunderbaren Lektorin Ulla Mothes und bei allen, die mir persönlich Einblick in ihr Selbstverständnis als Pfarrer und Pfarrerskinder gegeben haben. Auch bei jenen möchte ich mich bedanken, die mir auf Fragen zur Rolle des Pfarrhauses in kulturhistorischer und politischer Hinsicht antworteten. Ein Fazit lässt sich ziehen: Auch wenn sich das Pfarrhaus seit seiner Entstehung in einem permanenten Wandel befindet – es wird nie ein Haus wie jedes andere sein.
ETHOSUNDIDYLLDer Mythos desdeutschen Pfarrhauses
Das Pfarrhaus als Sehnsuchtsort
Das deutsche evangelische Pfarrhaus steht singulär in der europäischen Kulturgeschichte. Wohl in keinem anderen Land hat man den Pfarrer und seine Familie derart aufmerksam in den Blick genommen: als Träger der protestantischen Kultur, als geistliches Kraftfeld und künstlerisches Ferment.
Was sich aus Luthers antiklerikalem Impuls heraus entwickelte, war die gleichermaßen profane wie heilige Familie. Und damit das Paradoxon einer idealtypischen Gegenwelt, die zugleich mitten ins weltliche Geschehen hineinwirken sollte. Nur auf diese Weise konnte das Pfarrhaus einflussreich werden, in die Herzkammern der Gesellschaft vordringen, geistiger Schrittmacher sein. Oder wird hier ein bloßer Mythos bestaunt?
»Ohne Pfarrhaus, oder zumindest ohne lutherischen Hintergrund, sind auch die Größten: ein Leibniz, ein Bach, ein Goethe nicht zu verstehen«, behauptete der Germanist Robert Minder. Urteile wie dieses wecken die Erwartung von Superlativen. Und in der Tat gibt es sie, die kulturellen Spitzenfrequenzen, die außergewöhnlichen wissenschaftlichen Leistungen, die dichtenden Pfarrerssöhne, deren Werke Klassiker wurden. Sie erzeugten Legenden, die das Pfarrhaus bis heute überlagern. Vor allem aber wecken sie Neugier.
Ganz im Leben und doch seltsam entrückt, mit hehren Zielen, die die Gefahr des Scheiterns schon in sich tragen: Diese Spannung macht das Pfarrhaus zum Gegenstand von Projektionen. Über die Jahrhunderte delegierte man zunehmend an die Pfarrersfamilie, was andernorts misslang: gottgefälliges Leben, moralische Unbedenklichkeit, musische Affinität. Man wünschte sich das Pfarrhaus als Leitbild. Ganz gleich, ob man es dann mit Bewunderung, Herablassung oder geheimem Neid betrachtete – hier schien ein Leben, das den Unübersichtlichkeiten der Realität trotzte, zumindest denkbar. So geriet das Pfarrhaus in der Außenwahrnehmung zum Versprechen. Es weckte den Möglichkeitssinn für gelingendes Leben.
Wechseln wir die Perspektive und fragen nach Wahrnehmungen aus dem Inneren des Pfarrhauses, so sind die Auskünfte sehr unterschiedlich. Das Pfarrhaus ist keine in sich abgeschlossene Idylle, denn es moderiert Konflikte, die es im Außen vorfindet. Es übernimmt Verantwortung, auch und gerade für das, was nicht gelingt. Hans Egon Holthusen, Jahrgang 1913, schreibt über seinen Vater: »In seiner Sprechstunde herrschte ein Betrieb wie auf dem Wohlfahrtsamt. Er besuchte die Leute in ihren Wohnküchen, hatte dank seines monströsen Gedächtnisses alle ihre Daten, Jubiläen, Familienverhältnisse im Kopf, nahm ihr Gejammer auf sein Gewissen und bekämpfte das hartnäckige Einerlei ihres Elends, so gut er konnte.«
Diese Hingabe kann zur Selbstaufgabe werden. Das ist das Risiko eines Berufs, der die gesamte Familie in Atem hält – und atemlos macht. Wir seien nicht die heilige Familie, sondern die eilige Familie, scherzte mein Vater gern. Denn wir alle, Mutter wie Kinder, fügten uns lückenlos in seine Agenda der Pflichten. Das war erfüllend, konnte aber auch zum Stresstest werden. Nicht überall fällt er positiv aus. »Wir kamen als Familie immer an zweiter Stelle«, urteilt Christian Gauck heute. Joachim Gauck sei »selten der Vater« gewesen.
»Der königlichste, freieste, reichste, aufregendste, sinnvollste Beruf auf Erden ist auch der unbekannteste; auch bei denen, die in der Kirche tätig mitleben und darum ständig mit ihm zu tun haben – selbst bei denen, die ihn sich erwählt haben und deren eigener Beruf es ist«, schrieb der Theologe Helmut Gollwitzer über das Pfarramt. Einige Zeilen später spricht er aber schon vom »trostlosen Beruf«, den manche Pfarrer meinen ergriffen zu haben.
Damit steht der Betrachter vor einem Vexierspiel zwischen Hybris und Demut, Glück und Verzweiflung. Die wohltemperierte Mitte wird man im ambitionierten Pfarrhaus selten finden, vor allem nicht im Pfarrhaus der Vergangenheit. Es neigte zu Extremen, unter einem Dach vereint. Entsprechend unterschiedliche Botschaften erreichen uns aus dem Pfarrhaus. Manchmal sind es Notrufe. Protestantische Fröhlichkeit ist ebenso anzutreffen wie finsterste Depression, karge Strenge wie saturierte Bürgerlichkeit. Das Pfarrhaus gleicht einer Versuchsanordnung unter dem Mikroskop. Alle Facetten des Menschseins werden riesenhaft vergrößert.
Natürlich liegt die Gefahr nahe, das Abweichende mit dem Charakteristischen zu verwechseln. Nicht jeder Pfarrer zweifelt, und nicht jedes Pfarrerskind stürzt sich in die Revolte. Genauso wenig, wie alle Pfarrer mit einem Heiligenschein versehen sind und alle Pfarrerskinder mit außergewöhnlichen Gaben. Die Normalität hinterlässt weniger Spuren als das Herausragende. Dennoch weisen Extreme auf Symptomatisches hin.
»Es ist aber doch das beste Stück idealen Lebens, welches ich wirklich kennen gelernt habe; von Kindesbeinen an bin ich ihm nachgegangen, in viele Winkel, und ich glaube, ich bin nie in meinem Herzen gegen dasselbe gemein gewesen.« Überraschend genug: Diese Sätze über das Christentum seiner Kindheit stammen nicht etwa von einem beseelten Gläubigen. Geschrieben hat sie Pfarrerssohn Friedrich Nietzsche, der Gottes Tod beklagte und Heilsverkünder als »Giftmischer« verhöhnte. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Röcken, im heutigen Sachsen-Anhalt. Es war ein typisches Pfarrhaus des neunzehnten Jahrhunderts, glaubensstark, geprägt von Literatur und Musik.
Obwohl der Vater starb, als Nietzsche vier Jahre alt war, und die Familie daraufhin nach Naumburg zog, blieb die Pfarrhausatmosphäre das Fluidum seiner Kindheit. Er hat es tief eingeatmet. Neben der Mutter, die als Pfarrerwitwe den christlichen Wertekanon weiterlebte, war der Pfarrhof seines Großvaters mütterlicherseits prägend. Schon den Halbwüchsigen nannte man den »kleinen Herrn Pastor«. Es war derselbe Junge, der als Erwachsener gegen die »Sklavenmoral« der Bergpredigt wütete. Warum erinnerte er sich trotzdem an den Glauben seiner Kindheit als das »beste Stück idealen Lebens«?
Was zunächst als Widerspruch erscheint, hat eine gewisse Logik. Es führt uns an einen Ort, wo Widersprüche quasi systemimmanent sind. Die Innenschau des Pfarrhauses offenbart auch Abgründiges. Das Beruhigende und das Verstörende, das Tröstende und das Demütigende gehen Hand in Hand. Erst im Nachhinein wird das vor allem Pfarrerskindern bewusst, deren Emanzipation vom Elternhaus durch Loyalitätskonflikte erschwert wird. Schließlich ist der Ablösungsprozess ohne eine kritische Auseinandersetzung mit göttlicher wie elterlicher Autorität kaum denkbar.
Nicht selten lautet die Schlussfolgerung, dass gerade die heile Welt des Pfarrhauses Unterwerfung oder gar Selbstverleugnung fordere. Befreiung ist dann gleichbedeutend mit Protest. Heinrich Böll sagte einmal: »Wenn ich gelegentlich Literaten oder Philosophen mit einer verbissenen Abwehr gegen Kirche und Christentum treffe, denke ich fast automatisch: Das müssen Pfarrerskinder sein.«
Sinnstiftendes in der Rückschau zu verwerfen, das kann nicht ohne Beschädigung der eigenen Identität geschehen. Ein Ausweg ist Wut, und Nietzsche ist ein grandioses Beispiel dafür. Die Befreiung, nach der er suchte, schien nur durch die Befreiung vom Glauben möglich. »Die Heraufkunft des christlichen Gottes, als des Maximal-Gottes, der bisher erreicht wurde, hat deshalb auch das Maximum des Schuldgefühls auf Erden zur Erscheinung gebracht«, stellt er in Zur Genealogie der Moral fest. Folgerichtig heißt es am Ende des Abschnitts: »Atheismus und eine Art zweiter Unschuld gehören zueinander.«
Dennoch blieb die Erinnerung an das Ideal seiner Kindheitswelt in ihm verankert, ablesbar auch an der Wortgewalt, mit der er sich an seiner religiösen Herkunft rieb – als könne er vom süßen Gift nicht lassen. So wie in allen komplizierten Liebesbeziehungen überdauerten Sehnsüchte, die der Verstand längst verworfen hatte.
Ganz sicher leben wir nicht im Zeitalter der Verklärungen. Umso erstaunlicher ist, dass das Pfarrhaus noch immer eine große Anziehungskraft besitzt, dass man ihm Großes unterstellt und zumutet. Entmystifizierungen sind auch deshalb so schwierig, weil das Pfarrhaus denkbar attraktive Kulissen anbietet. Die pittoresken Fachwerkhäuser, die wehrhaften Sandsteinbauten, umgeben von Gärten, eingeschmiegt in Dorf und Natur, sie wirken, als seien hier Archetypen harmonischen Lebens und Arbeitens möglich.
Selbst für Pastorenkinder, die es unter Protest verließen, hatte das malerische Landpfarrhaus einen verführerischen Sog. Nietzsche schreibt, das Elternhaus habe »gar lieblich« gelegen, umgeben von Büschen und Teichen. »Vor der Wohnung erstreckte sich der Hof mit Scheune und Stallgebäude und geleitete zu dem Blumengarten. In den Lauben und Sitzen verweilte ich fast immer.«
»Dort wuchs ich auf«, erinnert sich Gottfried Benn an das Pfarrhaus seiner Kinderjahre, »ein Dorf mit 700 Einwohnern in der norddeutschen Ebene, großes Pfarrhaus, großer Garten, drei Stunden östlich der Oder. Das ist auch heute noch meine Heimat, obgleich ich niemanden dort mehr kenne. Kindheitserde, unendlich geliebtes Land.« Und diese Lust will Ewigkeit: »Eine riesige Linde stand vorm Haus, steht noch heute da, eine kleine Birke wuchs auf dem Haustor, wächst noch heute dort, ein uralter gemauerter Backofen lag abseits im Garten. Unendlich blühte der Flieder, die Akazien, der Faulbaum.«
Man meint, das Rauschen der Linde und das Zwitschern der Vögel zu hören. Das Pfarrhaus – ein Paradies auf Erden, ein Fluchtpunkt im Weltgetümmel? Jahrzehnte später spricht Pfarrerstochter Gabriele Wohmann vom »herrlichen Garten voller Verstecke und Geheimnisse« und dem Pfarrhaus als »Stätte der Geborgenheit, der Ruhe, der Annehmlichkeiten«. Pfarrerstochter Inge Grolle, Jahrgang 1931, beschreibt »lange Flure, dunkle Vorräume, Kellerfluchten, Bodenkammern mit Requisiten aller Art, Nebengebäude aus der Zeit bäuerlicher Eigenwirtschaft, Gärten im Ausmaß von Parks, teils in verwildert blühender Romantik, teils fleißig zur Obst- und Gemüsezucht genutzt«.
Solche Schilderungen untermauern, was wir durchaus erwarten. Noch heute sind unsere Vorstellungen oft unbewusst verschränkt mit Bildern, die sich unter anderem aus der umfangreichen Pfarrhausliteratur des achtzehnten Jahrhunderts herleiten. Ein Weichzeichner liegt über vielen dieser Darstellungen. In gemütvollem Tonfall erzählen sie von einer Gegenwelt – vom Leben auf dem Dorf, in dem mal gütige, mal skurrile Pfarrer auftreten, unverwundbar in ihrer Glaubensstärke, innig verbunden mit Gottes schöner Natur.
Schon die Anzahl der Landpfarrer übersteigt bei Weitem jene der städtischen Kollegen. Denkt man ans Pfarrhaus, so ist es deshalb auch heute von lieblicher Landschaft und verwunschenen Gärten kaum zu trennen. Damit ist es Sinnbild einer leicht weltfremden, aber auch anziehenden Lebensform. Wer in solch einer Idylle zu Hause ist, muss sich um sein Seelenheil keine Sorgen machen, mag man meinen. Die Idee eines beschaulichen Landpfarrerlebens hat daher großen Anteil an manch magischer Idealisierung. »Ein protestantischer Landgeistlicher«, vermutete schon Goethe nicht ohne leise Ironie, sei »vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Idylle«.
Der Begriff der Idylle weist zurück auf eine Sehnsuchtstradition, die sich seit der Antike auf ein imaginäres Arkadien richtet, auf bukolische Fantasien und Schäferspiele, auf ein besseres Leben. Die lateinische Bedeutung des Wortes »Pastor« – der Hirte – spielt mit der Assoziation des Schäfers, der sich um seine Herde kümmert. Deshalb schien der Pfarrer als Heger und Pfleger seiner Gemeinde auf dem Land seine eigentliche Bestimmung zu finden. Ganz so, wie es im 23. Psalm über den göttlichen Schutz heißt: »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.«
Die Assoziationsketten sind erlernt und verinnerlicht. Sie legen nahe, Pfarrhaus und Landleben zu verschmelzen. Das Buch der Natur, in dem die Romantik las, ist für den Pfarrer demnach eine Quelle religiöser Selbstvergewisserung. Hier ist der Ort, der ihm seine Berufung vor Augen führt. Hier kann er ein guter Hirte sein, im Einklang mit der Schöpfung. Ein Anhauch dieser Vorstellung weht durch Wilhelm Raabes Roman Unruhige Gäste. Darin lädt der Blick aus der Studierstube des Pfarrhauses ein, die Natur als Spiegel der frommen Seele zu deuten. »Über die Eschenwipfel unter diesem Arbeitszimmer Prudens Hahnemeyers hinweg übersah man meilenweit die Tannenberge und – darüber hinaus bis in die blaueste, abendduftigste Ferne die norddeutsche Ebene: Dörfer, Städte, Flüsse und fruchtbares Land mehr oder weniger deutlich, so daß ein feineres Gefühl für Erdenschönheit sofort mit Rührung und Freude sich diesen Auslug in jeglicher Jahreszeit, bei jeglicher Beleuchtung und in jeglicher Lebensstimmung als einen Trost, eine Beruhigung denken konnte.«
Die Pfarrhauswelt vor naturschönem Hintergrund passt bestens in das Lebensgefühl der Gegenwart. Kulturkritik entzündete sich von jeher an der städtischen Zivilisation. Die Antithese Stadt und Land ist eine beliebte Denkfigur. Lange schien es, als ob im Landpfarrhaus die Versöhnung von Natur und Kultur, von Glaube und Leben zu sich selbst komme. Das hatte auch mit der funktionierenden gesellschaftlichen Ordnung zu tun, die man einst auf dem Lande vermutete. Als sei ein hierarchisches System, in dem der Adel regiert und in dem Pfarrer, Lehrer und Arzt für das geistige wie leibliche Wohl sorgen, eine gelebte Utopie.
Pfarrerssohn Jean Paul war sogar überzeugt, dass seine künstlerische Menschwerdung nur auf dem Dorf überhaupt habe stattfinden können. Dort, wo es keine Anonymität gebe, keine Gleichgültigkeit, wo jeder jeden kenne und jeden grüße. »Lasse sich doch kein Dichter in einer Hauptstadt gebären und erziehen, sondern womöglich in einem Dorfe, höchstens in einem Städtchen. Die Überfülle und die Überreize einer großen Stadt sind für die erregbare schwache Kindseele ein Essen an einem Nachtisch und Trinken gebrannter Wasser und Baden in Glühwein.« So argumentiert er in seinem autobiografischen Fragment Selberlebensbeschreibung.
Das elterliche Pfarrhaus feiert Jean Paul als eine Welt natürlicher Harmonie, als »locus amoenus« schlechthin: »Niemand übrigens wundere sich über ein Idyllenreich und Schäferweltchen in einem kleinen Dörfchen und Pfarrhaus. Im schmalsten Beete ist ein Tulpenbaum zu ziehen, der seine Blütenzweige über den ganzen Garten ausdehnt; und die Lebensluft der Freude kann man aus einem Fenster so gut einatmen als im weiten Wald und Himmel.« Liest man diese Sätze, so fühlt man sich an die Rilkezeile erinnert: »Und ihr Gut und Garten grenzt gerade an Gott.«
Zufriedenheit ist das Grundgefühl dieses Kosmos, der vor allem im achtzehnten und beginnenden neunzehnten Jahrhundert beschworen wird. Das Pfarrhausepos Luise. Ein ländliches Gedicht in drei Idyllen von Johann Heinrich Voß, 1795 erschienen, beginnt mit den wunderbaren Zeilen:
»Draußen in luftiger Kühle der zwei breitlaubigen Linden,
Die, von gelblicher Blüthe verschönt, voll Bienengesurres,
Schattend der Mittagsstub’, hinsäuselten über das Moosdach,
Hielt der redliche Pfarrer von Grünau heiter ein Gastmahl.«
Eingebettet in dörfliche Überschaubarkeit, umgeben von Feldern und Wiesen, stand das Pfarrhaus für die urbane Sehnsucht nach unschuldiger Landlust. Auch als Therapeutikum der Seele. »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«, dichtete Pfarrer Paul Gerhardt mit Blick auf die Natur, »Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande« ist der erste Satz von Beethovens Pastorale überschrieben. Diese Erwartung formt das Sehnsuchtsmuster. Für Beethoven war die Natur denn auch nicht nur hübsche Kulisse, sondern religiöses Gegenüber: »Ist es doch, als ob jeder Baum zu mir spräche auf dem Lande: heilig, heilig!«, notierte der Komponist 1815, einige Jahre nach Entstehen der Pastorale.
Selbst im säkularen Zeitalter hat diese Haltung wenig von ihrem Reiz verloren. Speziell in Deutschland, wo das Rousseau zugeschriebene »Zurück zur Natur« mit nationaltypischen Überhöhungen aufgegriffen wurde – von der Wandervogelbewegung und der Reformkultur des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts bis hin zur Politisierung der siebziger Jahre, die zur Gründung der Grünen führte. Bedenkt man die emotionale, fast metaphysische Aufladung des Naturbegriffs hierzulande, wird das Landpfarrhaus als Sehnsuchtsort noch plausibler. Bewohnt von einem Seelenhirten, erzeugt es ein Gefühl naturwüchsiger Verwurzelung und Geborgenheit. Wer spielte da nicht manchmal mit dem Gedanken, darin zu leben? Oder wenigstens eine Weile zu Gast zu sein?
So bleibt vor allem das ländliche Pfarrhaus ein Faszinosum für seine Zaungäste, zumindest an der Oberfläche. Blättert man in der erfolgreichen Zeitschrift Landlust, die vorwiegend städtische Leser erreicht, so wirkt manches Foto wie einem imaginären Katalog alter Pfarrhäuser entnommen. Anmutig verwittert präsentieren sich die Gebäude, in den großen Gärten wird jede kleinbürgerliche Vorgartenakkuratesse vermieden. Lässig verwildert, mit Patina versehen, spiegelt die Ästhetik die Sehnsucht des Publikums. Es träumt sich in jene umblühte Idylle, die man traditionell im Pfarrhaus vorfand.
Nicht der Bauer ist das Vorbild als Bewohner dieser Idyllen, sondern der Pfarrer, der die Schönheit des Landlebens schätzt, unbehelligt vom Lärm der Städte. Mit der Rosenschere in der einen Hand, mit dem Buche in der anderen, so bedient die Figur des Landpfarrers eine Vorstellung frommer Einfachheit im Rhythmus von Jahreszeiten und Kirchenjahr.
Der Hang zur neuen Biedermeierlichkeit, den man dem beginnenden einundzwanzigsten Jahrhundert bescheinigt, findet sein literarisches Pendant in Gedichten wie »Der alte Turmhahn« von Eduard Mörike. Er richtet seine Behaglichkeitsfantasie über das Pfarrhaus mit ähnlichen Zutaten an.
»Hier wohnt der Frieden auf der Schwell’!
In den geweißten Wänden hell
Sogleich empfing mich sondre Luft,
Bücher- und Gelahrtenduft,
Gerani- und Resedaschmack,
Auch ein Rüchlein Rauchtabak.«
Letztlich bleibt auch heute der Wunsch nach geografischer und geistiger Beheimatung bestehen. Das Überzeitliche ist gefragt, so wie die alles überdauernde Linde und der unendlich blühende Flieder Benns. »Gerade der naturhafte Aspekt des Symbols Haus deutet auf lange Frist und heilende Wiederkehr des Gleichen«, meint der Religionspädagoge Fulbert Steffensky.
Auch wenn die Projektion der Wahrnehmung einen Streich spielt – es ändert nichts daran, dass ein Mythos fortlebt, der in tiefe Schichten der deutschen Seele hinabreicht. Von »Pfarrhäusern aus Holz und Stein, von Rosen umblüht, von Reben umrankt, die uns wundersam anheimeln« schwärmte der Theologe Wilhelm Baur. Sein Buch Das deutsche evangelische Pfarrhaus erschien 1884. Mehr als hundert Jahre später ist das Bild noch immer präsent.
Wie außen, so innen. Im Pfarrhaus scheint sich eine Nische aufzutun, in der Anfechtungen wirkungslos bleiben und Zweifel der Fröhlichkeit des Christenmenschen weichen. In vielen Fällen wurden diese hohen Erwartungen eingelöst. Die Geschichte des Pfarrhauses hat charismatische Bewohner vorzuweisen, die im Namen Gottes den Dienst am Menschen versahen. Daneben stehen die Scheiternden, auch die Verweigerer. Ein Ideal zu leben – was könnte unbequemer sein?
Das Pfarrhaus, ein Skandal
Wenn das Pfarrhaus als Idylle und Hort christlicher Tugenden beschworen wird, gerät leicht in Vergessenheit, dass seine Entstehung von wüsten Auseinandersetzungen begleitet wurde. Es war ein Stein des Anstoßes, ins Rollen gebracht von Martin Luther. 1505 hatte er im Augustinerkloster zu Erfurt sein Gelübde abgelegt und war 1507 geweiht worden. Seine Heirat im Jahr 1525 löste einen Skandal aus. Obwohl er seine Kutte schon ein Jahr zuvor ausgezogen hatte – die Wandlung des ehemaligen Mönchs zum Ehegatten schockierte selbst manchen Mitstreiter.
Bereits 1520 hatte sich Luther in der Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung gegen die Ehelosigkeit der Priester gewandt. De facto folgten viele von ihnen ohnehin nicht dem Gebot der Keuschheit. Immer häufiger wurden kaum kaschierte Verhältnisse mit ihren Haushälterinnen ruchbar. Von dieser Sünde konnten sich die Priester freikaufen, mit dem sogenannten Hurenzins. Erkaufte und damit geduldete Laster im Namen der Kirche, diese Doppelmoral sorgte weithin für Empörung.
Noch 1884 ereiferte sich Pfarrhauschronist Wilhelm Baur über den katholischen Priesterstand und sein »Accordieren zwischen Kasteiung und Fleischlichkeit, durch den Mangel der Durchdringung des Sittlichen und Religiösen im Leben«. Mit Schaudern betrachtet er die »immer wieder durchbrechende Zuchtlosigkeit des priesterlichen Lebens«. In der Tat mochte wohl für manchen Priester das Seneca-Wort gegolten haben: »Tagtäglich wächst die Lust zur Sünde, tagtäglich sinkt die Scham.«
Solch unverhohlene Fleischeslust im geistlichen Amt wirkte demoralisierend auf die Gemeinden. Auch die Vielzahl unehelicher Priesterkinder senkte das Ansehen des Priesterstandes. Luther wollte dieser unwürdigen Situation ein Ende bereiten. Er berief sich unter anderem auf den ersten Korintherbrief, in dem es heißt: »Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann.«
Nicht nur der Hang zum Küchenpersonal hatte manchen vorreformatorischen Geistlichen in Verruf gebracht. Deshalb verfügten einige Gemeinden nach Aufhebung des Zölibats die Zwangsheirat von Pfarrern, um erotische Eskapaden ein für alle Mal abzuwehren. »Die Friesen setzten sogar durch, dass ihre Priester heirateten, damit Töchter und Frauen vor den Pfaffen geschützt seien!«, berichtet der Kirchengeschichtler Friedrich Wilhelm Kantzenbach. Die sexuellen Übergriffe müssen ausgerechnet im kühlen Norden bemerkenswert gewesen sein.
Vor diesem Hintergrund war die lutherische Priesterehe auch eine Kapitulation vor der Begierde unter den Talaren. Die Lust sollte, wenn nicht unterdrückt, so doch wenigstens in der Ehe domestiziert werden. Nun durften auch Pfarrer ihre »kleinen Schandstündlein« genießen, wie der sinnenfrohe Luther die Freuden des Ehebetts umschrieb. Damit waren die Reste mönchischen Lebens aus dem geistlichen Stand getilgt. Luther, der das Klosterleben verwarf, ließ den evangelischen Pfarrer in der Wirklichkeit ankommen.
Er selbst hatte lange gezögert, bevor er den Schritt vor den Traualtar wagte. Während Reformatoren wie Ulrich Zwingli und Leo Jud in der Schweiz, Mathias Zell in Straßburg und Johannes Bugenhagen in Wittenberg bereits verheiratet waren und ihre Frauen sich in der neuen Rolle als Pfarrfrau versuchten, blieb Luther zunächst Junggeselle. Dass er seine Haltung änderte, geschah allerdings nicht aus libidinösen Gründen. »Hitzige Liebe oder Leidenschaft« waren es nach seinen Worten nicht, die ihn in die Ehe führten. Wohl eher die Einsicht, dass auch er mit gutem Beispiel vorangehen müsse, wenn er schon so vehement gegen den Zölibat protestiert hatte.
Kinder des Ungehorsams nennt Asta Scheib ihren Roman über Martin Luther und seine Frau Katharina von Bora. Gehorsam war dieses Paar wahrlich nicht. Nicht genug, dass Luther den Zölibat als Irrtum verwarf und damit römische Kirche wie Öffentlichkeit gegen sich aufbrachte. Seine Wahl fiel ausgerechnet auf eine entlaufene Nonne.
Eine aparte Wahl. Und alles andere als standesgemäß. Wer dem Kloster entflohen war, empfahl sich nicht gerade als gottesfürchtige Gattin, so die herrschende Meinung. Aus diesem Grunde war Katharina bereits einmal verschmäht worden. Sie hatte schwärmerische Gefühle für einen Nürnberger Patriziersohn gehegt, der in Wittenberg studierte. Ihr Vorleben hatten die Eltern des jungen Mannes jedoch für so bedenklich gehalten, dass sie die Ehe verhinderten.
Für damalige Verhältnisse muss Katharina eine unerschrockene und selbstbewusste Frau gewesen sein. Schon mit fünf Jahren war sie zunächst in das Benediktinerkloster Brehna, später in das Zisterzienserinnenkloster Marienthron in Nimbschen gesteckt worden. Es war eine damals verbreitete Methode, Kinder unter dem Deckmantel der Frömmigkeit zu entsorgen. Der verarmte sächsische Adlige Jhan von Bora soll seine Tochter weiter nach Nimbschen geschickt haben, als er 1510 seine zweite Ehe einging.
In Kloster Marienthron herrschten strenge Regeln. Die Nonnen unterlagen dem Schweigegebot, einzige Ausnahme waren Gebet und Gesang. Briefwechsel wurden von der Äbtissin kontrolliert, freundschaftliche Kontakte zwischen den Nonnen waren untersagt. Katharina empfand sich wie eingekerkert. Doch sie kapitulierte nicht, sondern bewies Wagemut. Nachdem sie Schriften Luthers gelesen hatte, in denen er gegen das klösterliche Leben Position bezogen hatte, nahm sie heimlich Kontakt mit ihm auf. Daraufhin soll er ihr einen Wagen geschickt haben, beladen mit Heringsfässern, um keinen Verdacht zu erregen. 1523 flüchtete Katharina mit einigen Leidensgefährtinnen ins evangelische Wittenberg. Ein gefährliches Unterfangen, vor allem für die Fluchthelfer, die mit der Todesstrafe rechnen mussten.
Entlaufene Nonnen und Mönche waren zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches. Viele waren wie Katharina unfreiwillig hinter Klostermauern verbannt worden und stahlen sich heimlich davon. Luthers viel gelesener Einspruch gegen das Klosterleben verstärkte diese Fluchtwelle. Weithin aber galten die Abtrünnigen als deklassierte Randgruppe. Mittellos, weil ihr Erbe ans Kloster gefallen war, bettelten sie oder wurden auch schon mal bei Diebstählen erwischt. Eine suspekte Truppe. Noch 1831 nennt Victor Hugo im Glöckner von Notre-Dame »Zigeuner, entlaufene Mönche, versumpfte Studenten, Schurken aller Nationen« in einem Atemzug.
Nonnen traf die soziale Ächtung besonders hart. Mehr noch als ihre Klosterbrüder war es für sie eine Flucht ins Ungewisse. Bei ihren Familien konnten sie nicht auf Aufnahme hoffen, da sie ihr Gelübde gebrochen hatten. Als Frau allein zu leben war gesellschaftlich nicht akzeptiert. Also blieb als einzige sichere Perspektive die möglichst rasche Heirat.
Es war Luther selbst, der nun nach geeigneten Heiratskandidaten Ausschau hielt. Schon seit Längerem setzte er sich für entlaufene Klosterinsassen ein. In den Jahren 1522 und 1523 hatte er in der sächsischen Stadt Leisnig an einer Sozialordnung mitgewirkt, die unter anderem finanzielle Starthilfen für entflohenes Klosterpersonal festschrieb. Seit ihrer Ankunft in Wittenberg hatte er sich auch um die Nonnen aus Nimbschen gekümmert. Katharina kam zunächst bei einer mit Luther befreundeten Familie unter, dann fand sie eine Anstellung als Magd bei Luthers Freund Lucas Cranach dem Älteren.
Weit schwieriger erwies sich das Projekt Eheanbahnung. Im Gegensatz zu ihren Gefährtinnen war die eigensinnige Katharina schwer vermittelbar. Ihr herbes Äußeres entsprach nicht dem gängigen Schönheitsideal, außerdem dachte sie gar nicht daran, der Not gehorchend den Erstbesten zu nehmen. Nachdem sie sich wieder einmal geweigert hatte, einen von Luther ausersehenen Kandidaten zu ehelichen, drehte sie den Spieß kurzerhand um: Sie ließ ihm ausrichten, dass sie ihm einen Antrag mache.
Der verdutzte Luther, eigentlich als Brautwerber angetreten, fand sich unversehens im Stande des Bräutigams wieder. Denn er willigte nach kurzem Zögern ein, etwas, was für den mittlerweile Zweiundvierzigjährigen bis dahin undenkbar gewesen war. Er hatte eine Verheiratung immer abgelehnt, weil er meinte, womöglich früh als Ketzer zu sterben. Nun stand ihm nicht der Tod vor Augen, sondern eine Frau. Noch dazu eine, bei der man vermuten musste, dass es eine Widerspenstige zu zähmen galt. »Wenn ich noch mal freien sollte, wollt ich mir ein gehorsames Weib aus einem Stein hauen, denn ich bin verzweifelt an aller Weiber Gehorsam«, seufzte er später.
Um größeres Aufsehen zu vermeiden, fand die Trauung nur im Kreise der engsten Vertrauten statt. Luther wusste: »Wenn ich nicht alsbald und in der Stille hätte Hochzeit gehalten mit Vorwissen weniger Leute, so hätten sie es alle verhindert, denn alle meine besten Freunde schrien: Nicht diese, sondern eine andre!« Geladen waren nur Gäste, auf deren Diskretion sich Luther verlassen konnte. Dazu gehörten der Maler Lucas Cranach der Ältere, Probst Justus Jonas und der Wittenberger Stadtpfarrer Johannes Bugenhagen.
Als die Heirat bekannt wurde, schlugen die Wellen hoch. Selbst Luthers Freund Melanchthon entsetzte sich über die »unglückliche Tat«. Wie andere Weggefährten Luthers fürchtete er, die ohnehin umstrittenen Ziele der Reformatoren könnten in ein noch ungünstigeres Licht geraten. Genauso kam es. Dass ausgerechnet die Galionsfigur der Reformation eine anrüchige Person zur Frau nahm, diskreditierte Luther in den Augen von Gegnern wie Befürwortern.
Er rechtfertigte sich mit grimmigem Trotz: »Die Welt und ihre Klüglinge erkennen nicht Gottes frommes und heiliges Werk und machens grade bei mir zu einem gottlosen und teuflischen. Daher gefällt es mir desto mehr, dass meine Heirat ihrem Urteil verdammlich und anstößig ist, so lange sie keine Kenntnis von Gott haben.« Im Sommer 1525 spottete er in einem Brief: »Ich habe mich durch diese Heirat so verächtlich und gering gemacht, dass alle Engel, wie ich hoffe, lachen und alle Teufel weinen mögen.«
Zu diesem Zeitpunkt hatten sich seine anfänglichen Zweifel, den Ehestand betreffend, zerstreut. Schon kurz nach der Hochzeit erschien ihm die bekrittelte Mesalliance als göttliche Fügung: »Mein Herr hat mich plötzlich, während ich ganz andere Gedanken hatte, wunderbar in die Ehe geworfen mit Katharina Bora, jener Nonne.« Auch die emotionale Distanz schmolz dahin. Bald sprach er vom »geliebtesten Weib« und empfahl regelmäßige »Schandstündlein«, angeblich »der Woche zweyn«.
Katharina sorgte fortan für ein geregeltes Leben, wie es der oft depressive und kränkliche Junggeselle nie kennengelernt hatte. »Ehe ich heiratete, hat mir ein ganzes Jahr hindurch niemand das Bett zurechtgemacht, in dem das Stroh von meinem Schweiß faulte«, bekannte Luther. »Ich war müde und arbeitete mich den Tag ab und fiel so ins Bett, wusste nichts darum.« Mit solch gelehrter Verwahrlosung war es vorbei. Seine Gemahlin war entschlossen, ihre Rolle als Hausherrin mit Bestimmtheit auszufüllen. Ohne Frage hatte sie die Hosen an, Luther nannte sie manchmal respektvoll »Herr Käthe«.
Die Luthers zogen in das aufgelöste Augustinerkloster Wittenbergs, das Kurfürst Johann der Beständige den Reformatoren überlassen hatte. Das Paar führte ein großes Haus. Neben den vier Kindern – zwei weitere starben früh – wohnten dort bis zu zehn Bedienstete und zahlreiche Verwandte: elf Waisenkinder aus Luthers Familie, dazu eine Tante und eine Großnichte Katharinas, zeitweise auch Studenten, durchreisende Theologen oder ehemalige Klosterinsassen. Alle wurden sie versorgt, manche auch als zahlende Kostgänger aufgenommen, um die Haushaltskasse aufzubessern.
Das tägliche Brot brachte Katharina im Schweiße ihres Angesichts auf den Tisch. Luther fühlte sich unfähig dazu. »Wenn ich mich ums Bauen, Mälzen, Kochen würde kümmern, würde ich bald sterben«, klagte er nicht ohne männliche Larmoyanz. Damit war die Arbeitsteilung geregelt: Luther war der Mann fürs Geistliche, seine Frau war zuständig für die irdischen Bedürfnisse.
Nun konnte Katharina anwenden, was sie im Kloster gelernt hatte. Dort hatte man sie neben dem Bibelstudium auch in die Kunst der Hauswirtschaft eingeführt. Sie legte auf dem Friedhof des einstigen Klosters einen Garten an, hielt Kühe, Schweine und Hühner. Nach und nach ließ sie Luther weitere Ländereien hinzukaufen. Da das Kloster das Braurecht innegehabt hatte, begann sie außerdem, Bier zu brauen. Sehr zur Freude ihres Mannes, der es sich auf längeren Reisen nachschicken ließ.
Um die vielköpfige Familie zu ernähren, musste »die Lutherin« äußerst sparsam sein. Der Reformator lehrte an der Universität Wittenberg. Das schmale Professorengehalt, das der Kurfürst zahlte, reichte kaum fürs Nötigste. Geld war auch deshalb knapp, weil der Hausherr aus seinen vielfach nachgedruckten Schriften kein Kapital schlagen wollte. Nicht einmal für seine Bibelübersetzung, ein Bestseller der damaligen Zeit, nahm er einen Heller an. Es gebühre ihm nicht, Reichtum zu haben, erklärte er und pochte darauf, der ersparte Pfennig sei redlicher als der erworbene.
Seine Großzügigkeit bei der Bewirtung von Gästen und seine Freigebigkeit Bettlern gegenüber brachten Katharina oft an den Rand der Verzweiflung. So waren die Luthers häufig von der Furcht vor Gläubigern gebeutelt, wie ein später Brief Luthers an seine Frau belegt. Mehr als einmal wanderten zwei Silberkelche, Hochzeitsgeschenke des Kurfürsten, ins Pfandhaus. Dennoch hielt Luther an der Gastfreundschaft fest. Ob Familie, Freunde oder völlig Fremde, ein offenes Haus zu haben, in dem jeder Gast an der Tafel willkommen war, war ihm Gottespflicht.
Diese Haltung formte das Bild idealen Lebens, das man später im evangelischen Pfarrhaus erwartete. Das gastfreie Haus war erfunden, ein zugänglicher Ort, ein Debattierklub, eine Zone der Geselligkeit über die sozialen Schichten hinweg. Vieles, was man heute im Pfarrhaus vermutet, hat in Luthers Haus seinen Ursprung: die patriarchal regierte Familie, die großen abendlichen Tafeln mit Disput und Musik, die barmherzige Aufnahme Bedürftiger, die unermüdlich dienende Pfarrfrau – gleichwohl kluge Gefährtin und Beraterin ihres Mannes.
Selten wohl hat ein Hausstand so nachdrücklich Modell gestanden für viele Generationen. Obwohl Luther kein Gemeindepfarrer war, wurde er zum Orientierungspunkt für alle evangelischen Pfarrer nach ihm. Auch für Margot Käßmann. Auf die Frage, ob der Reformator für sie ein Vorbild sei, antwortete sie: »Ja, insofern Luther deutlich gemacht hat: Das Leben als Familie, mit Kindern, Sexualität, den Herausforderungen des Alltags ist vor Gott genauso gelingendes Leben wie das im Kloster oder zölibatären Priesteramt.«
Idealisiertes Familienleben
Denkt man ans Pfarrhaus, so scheint auch sein Familienleben einer versunkenen Welt zu entstammen. Die inneren Illustrationen haben den Sepiaton der Nostalgie. Sie fügen sich zum Genrebild eines Gebäudes, angefüllt mit Büchern, durchzogen vom Klang Bach’scher Fugen, bewohnt von heilignüchternen Gläubigen. Vom nahen Kirchturm ertönt Glockengeläut, während der Pfarrer am Mittagstisch residiert. Sanft mahnt er seine Kinderschar zu sittsamen Tischmanieren, bevor er einen Bibeltext verliest.
Hier ist die Welt in Ordnung. Alles ist an seinem Platz. Die göttliche Weltordnung findet ihre Entsprechung in der Pfarrersfamilie, wo Tugenden wie Frömmigkeit und tätige Nächstenliebe gelebt werden. Auch ein System unhinterfragter Autorität. Der Vater ist das geistige Zentrum, ihm ordnen sich die Pfarrfrau als Hüterin des Hauses und eine folgsame Kinderschar unter.
Solche Vorstellungen kommen nicht von ungefähr. In den nachfolgenden Jahrhunderten wurde das Familienleben Luthers zum Gegenstand staunender Bewunderung und mythischer Verklärung. Besonders im späten achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert erschien Luthers Heim im Licht eines verwirklichten Ideals. In Leitfäden für Pfarrer und in literarischen Darstellungen wurde es ausgeschmückt und besungen. Der evangelische Prälat Karl Gerok erdichtete sich Luther in Hymnen, Pfarrer und Volksschriftsteller Emil Frommel ließ ihn in seinen Erzählungen als fürsorglichen Familienvater auftreten.
Der Reformator und seine Familie wurden auch ein beliebtes Motiv der bildenden Kunst. Ein typisches Gemälde von Ernst Hildebrand zeigt Luther im Kreise seiner Familie musizierend. Am rechten Bildrand sitzt der Hausherr, die Laute spielend, seine vier Kinder stehen singend vor ihm. Umringt sind sie von Ehefrau Katharina, Mitstreiter Philipp Melanchthon und Maler Lucas Cranach dem Älteren. Ähnliche Szenen familiärer Harmonie gestalteten Künstler wie Gustav Adolph Spangenberg oder Gustav König. Dessen Radierung Luthers Winterfreuden im Kreise seiner Familie präsentiert den Familienvater mit Frau und Kindern vorm Weihnachtsbaum. Hell leuchten die Kerzen, auf den Gesichtern liegt das Glück der Geborgenheit; eine Bilderbuchfamilie. Und mancher mag bei dem Anblick seufzen: So könnte es aussehen, das gelungene Leben.
Dieses Idealbild ließ sich auch missbrauchen. Barbara Boys zitiert aus einer Biografie von 1938: »Möchte Luthers Familienleben vorbildlich sein für das häusliche Leben unseres Volkes … Nur die sittlichen und wirtschaftlichen Tugenden des deutschen Mädchens und der deutschen Frau bürgen für den dauernden Aufstieg unseres Volkes im dritten neuen Reiche.« Schnarrend wurde als urdeutsch vereinnahmt, was vorher nur als Idyll besungen wurde.
Von solchen ideologischen Vereinnahmungen abgesehen, blieb es beim Mythos der heilen Pfarrhauswelt. Die Bilder hatten auch demonstrativen Charakter: Seht her, der gelehrte Theologe und Kirchengründer Luther schwebt nicht in höheren Sphären, er darf wie alle evangelischen Pfarrer nach ihm als Familienvater mit beiden Beinen auf der Erde stehen.
Das ist durchaus als Kontrast zum katholischen Geistlichen zu verstehen. Der Erziehungswissenschaftler und Religionspädagoge Fulbert Steffensky schildert diesen Gegensatz mit einer amüsanten Kindheitserinnerung. Die katholischen Priester, schreibt er, »gehörten als geweihte und damit der Normalität enthobene Personen nie ganz in den irdischen Bereich (ich erinnere mich, dass wir als Kinder einmal darüber nachdachten, ob Pfarrer wie gewöhnliche andere Menschen auf die Toilette mussten oder ob es für sie höhere Techniken gab)«.
Dem gleichsam entkörperlichten Geisteswesen katholischer Prägung stand der evangelische Pfarrer gegenüber, der sich im Alltag von Haushalt, Kindererziehung und Ehe bestens auskannte. Ein Mann Gottes mit Familienanschluss. Dies schien eine Garantie dafür zu sein, dass er sich nicht nur der geistlichen, sondern auch der menschlichen Nöte seiner Gemeinde annehmen konnte. Heute würde man vielleicht von familiär erworbener sozialer Kompetenz sprechen. Während der katholische Priester Ehekonflikte und häusliche Erziehungsprobleme nur aus der Perspektive des Beichtstuhls kannte, musste sich sein evangelischer Amtsbruder selbst damit herumschlagen. Im persönlichen Gespräch vertraute man ihm deshalb auch Allzumenschliches an, weniger als Beichtvater denn als Berater.
»Er war in den Häusern seiner Bauern als ein Vater und als ein Rathgeber willkommen. Nie ließ er es dem Bekümmerten an Trost, nie dem Hungrigen an Labsal fehlen.« So schildert der Schriftsteller Christoph Friedrich Nicolai einen evangelischen Pfarrer in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Mit Goethe könnte man hinzufügen, der Pfarrer sei »Vater, Hauslehrer, Landmann und so vollkommen ein Glied der Gemeinde. Auf diesem reinen, schönen, irdischen Grunde ruht sein höherer Beruf.«
Das setzte ein Pfarrhaus voraus, das mit einer untadeligen Lebensführung glänzen konnte. Hier galt nicht das Sprichwort vom Schuster, der selbst die schlechtesten Schuhe trägt. Vielmehr musste sich der Pfarrer den Ruf des kompetenten Ratgebers täglich neu verdienen: durch eine vorzeigbare Familie. Was er am Sonntagmorgen auf der Kanzel von sich gab, konnte rasch ad absurdum geführt werden, wenn sein eigener Haussegen schief hing.
Ohnehin betonte Luther, selbst sprachmächtiger Redner, die Grenzen des gesprochenen Wortes: »Der Prediger steige auf die Kanzel, öffne seinen Mund, höre aber auch wieder auf.« Diese Ermahnung war nicht nur an Pastoren gerichtet, die ihre Schäflein mit endlosen Litaneien langweilten. Sie war auch eine Erinnerung daran, dass der Glaube überzeugend gelebt, nicht nur wortreich verkündigt werden sollte. Lippenbekenntnisse waren schnell entlarvt, wenn der Pfarrer mit seiner Frau stritt oder sich als Trunkenbold hervortat.
Auch im weiteren Sinne unterlag die Verkündigung täglicher Bewährung. Bis heute formt dieser Anspruch das Selbstverständnis evangelischer Pfarrer. »Der Sonntag ist der Tag für Sonntagsreden; aber diese müssen auch alltagstauglich sein«, schrieb Friedrich Schorlemmer anlässlich des Dresdner Kirchentags 2011. »Das Grundsätzliche bewährt sich im Konkreten, das Kritische im Konstruktiven, das Wahre im Wahrhaftigen, das Zeitlose im Zeitbedingten.« Nur so könnten Christen für sich reklamieren, »Salz und Licht in der Gesellschaft« zu sein.
Das ist ein hoher Anspruch, zumal wenn Person und Amt eine Einheit bilden sollen. Das gelang bei Weitem nicht jedem Pfarrer. Allein der ungeratene Nachwuchs sorgte für Kopfzerbrechen, wie der Spruch »Pfarrers Kinder, Müllers Vieh gedeihen selten oder nie« belegt. Der Spott, der das Missverhältnis von Anspruch und Realität trifft, konnte jedoch nicht wirklich an den Bildern pfarrhäuslicher Harmonie rütteln. Seit Luther die Ehe zum »frommen und heiligen Werk Gottes« erhoben hatte, behauptete sich das Pfarrhaus als geordnete, christliche Trutzburg in einer notorisch unaufgeräumten Außenwelt.
Für die Pfarrer nach ihm wurde Luthers Haushalt stilbildend besonders im Hinblick auf seine Offenheit. Ob sich die Tür für jeden auftat oder ob sie unliebsamen Gemeindegliedern vor der Nase zugeschlagen wurde – das war die offensichtlichste Bewährungsprobe. Die Durchlässigkeit des Pfarrhauses machte es zu einem Schmelztiegel von Ideen, als es sich weiter öffnete und zum Salon wurde. Nur so konnten Pfarrhäuser zu geistigen Gravitationszentren werden, wo im Schutzraum der Halbprivatheit debattiert wurde: »Urzelle des Geisteslebens«, wie der Germanist Robert Minder schreibt.
Wie zwanglos diese Offenheit gelebt wurde, erfahren wir von Goethe, der als junger Mann mit einem Freund in der Straßburger Gegend wanderte und ganz selbstverständlich in einem Pfarrhaus im elsässischen Sessenheim aufgenommen wurde. Man empfing ihn mit Wohlwollen, Klaviermusik und Konversation. Dass er sich bei dieser Gelegenheit in die Pastorentochter Friederike Brion verliebte, hatte nicht zuletzt literarische Folgen. Nach längerer Pause schrieb Goethe wieder Gedichte, unter anderem das »Mailied« mit der Zeile »Wie herrlich leuchtet mir die Natur«.
Obwohl bis ins neunzehnte Jahrhundert die Besoldung der Pfarrer gering bis unsicher war und so mancher ausschließlich von den Pfründen der Pfarrstelle leben musste, fühlte man sich der Gastfreundschaft verpflichtet. Mit Verachtung dagegen strafte man das ungastliche Pfarrhaus. Es wurde als unrühmliche Ausnahme von der Regel empfunden, wenn nicht als gotteslästerlich. Erwies sich ein Pfarrer als kleinlich oder abweisend, folgerte die Gemeinde, dass ein Scheinheiliger auf der Kanzel stehe. Mit vergnügtem Sarkasmus schildert deshalb die Schriftstellerin Ottilie Wildermuth zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts »Das geizige Pfarrhaus«: »Die Frau Pfarrerin that ihr möglichstes, die Gäste wenigstens so unschädlich zu machen, als sich mit einigem Schein der Ehrenhaftigkeit vertrug … Sie kaufte ausgezeichnete Tassen, nur dass sie erstaunlich klein waren und nie eine obere zur unteren paßte. Das Brot im Hause war von höchst ehrwürdigem Alter, man konnte sich fast nicht erinnern, wann es gebacken worden; man hätte es auch als Schiffszwieback verkaufen können.« Als Gipfel der Heuchelei wird in der Geschichte beschrieben, wie sich das Pfarrerspaar bei drohendem Besuch versteckt. »Man munkelte stark davon, daß ein ankommender Besuch, der alle Zimmer leer traf, den Schlafrockzipfel des Herrn Pfarrers habe zum Ofenloch herausgucken sehen.«
Derartige Winkelzüge des Geizes wirkten ungehörig. Die Messlatte lag hoch. Im Pfarrhaus zu wohnen war gleichbedeutend mit einer permanent ausgesprochenen Einladung. Das verlangte der gesamten Familie ein hohes Maß an Duldsamkeit und Toleranz ab. Gleichzeitig war es eine Quelle von Anregungen. Während sich andere Familien in der Regel abgrenzten, vor allem im Hinblick auf höhere und niedrigere soziale Schichten, war die Pfarrersfamilie deutlich weltoffener und ist es vielfach heute noch.
Das offene Pfarrhaus der Gegenwart
Befragt man heute Pfarrerskinder nach ihren frühen Erfahrungen, so fällt ihnen zunächst die symbolisch geöffnete Haustür ein – offen für Familie und Freunde, offen aber auch für Gemeindeglieder, Bittsteller und in Not Geratene. Kein Mythos: Über die Zeiten hinweg hat sich das Charakteristikum des offenen Pfarrhauses vielfach erhalten, als Ort des Gemeindelebens, aber auch als Ort des Austauschs.
Der frühere Ministerpräsident Sachsen-Anhalts und Pfarrerssohn Reinhard Höppner erinnert sich: »Es hat sich auch eine Menge in unserer Wohnung abgespielt; gerade als ich noch sehr klein war, in Magdeburg-Vorort. Das war ein kleines Pfarrhaus, die Chorprobe war in unserer Wohnstube, und die Übungen des Kirchenchores haben mich manchmal in den Schlaf gesungen.« Rezzo Schlauch, ehemaliger Fraktionschef der Grünen im Bundestag, betont, er habe davon profitiert. »In diesem Haus war immer etwas los. Wenn man sich heute überlegt, dass da so ein Kind auf dem Sofa sitzt, könnte man auf den Gedanken kommen, es langweilt sich. Aber ich habe mich nie gelangweilt, sondern es war eine hochspannende Zeit.«
Sarah Käßmann, eine der Töchter Margot Käßmanns, erzählt: »Als Kind ist es doch was ganz Tolles, wenn da immer Leute sind. Das ist immer interessant und neu. Und meine Familie war sowieso groß. Es war immer turbulent.«