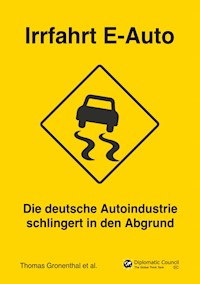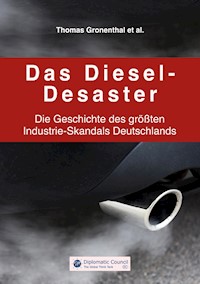
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Jahrzehntelang galt der Diesel als besonders sauberer Motor. Dann kam das Jahr 2015 und der Verbrennungsmotor geriet zum Symbol der automobilen Dreckschleuder. Der größte Industrieskandal, den Deutschland jemals erlebt hat, wird in diesem Buch akribisch nachgezeichnet. Neben der Aufarbeitung der Vergangenheit beleuchtet der Autor auch die Auswirkungen auf die Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Und die sind alles andere als rosig. Mit dem millionenfachen Lug und Betrug an Behörden und Kunden schufen die Autohersteller ungewollt die Grundlage für den unaufhaltsamen Siegeszug der Elektromobilität. Angeführt wird das neue E-Rennen allerdings von amerikanischen Autobauern, allen voran Tesla, und chinesischen Herstellern. Deutschland fährt weit abgeschlagen hinterher. Millionen von Verbrauchern fahren heute noch einen Wagen mit Verbrennungsmotor. Daher bleibt dieses Buch solange aktuell, wie Diesel und Benziner auf unseren Straßen fahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wir werden eine Arbeitslosigkeit erleben, wie wir sie noch nie gehabt haben. Wenn die Politiker hier den Hebel umlegen, wird es zappenduster in Deutschland … Ich warne die Politik, das Thema Klima eindimensional anzugehen und mit dem Wohlstand in Deutschland zu pokern … Was ich in Brüssel erlebe, ist nur verbieten, verbieten, verbieten.“
Manfred Schoch, Vorsitzender des BMW-Betriebsrats, 2021
„Das, was wir gemacht haben, war Betrug, ja.“
Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG 18. Juni 2019
„Die VW-Ingenieure dürften unter massivem Druck gestanden haben und sind an die Grenzen dessen gestoßen, was möglich ist. Tricksen war wohl die einzige Möglichkeit.“
Elon Musk, CEO Tesla, 2015
„Ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen“.
Giovanni P., Audi-Manager, 22. Januar 2008
Inhalt
Vorwort
Dicke Luft durch Diesel
Luftverschmutzung seit den 1950ern
Diesel: Motor mit Selbstzündung
Technik gegen „Todesdiesel“
Mit 600 rasen, wo 100 erlaubt sind
Diesel sind tödlich
CO2 vs. NO2 vs. Feinstaub
6.000 NO2-Tote im Jahr
Fragwürdige Studien
Acht Millionen Feinstaub-Tote pro Jahr
Chronologie eines Desasters
Schicksalstag für VW
Die Aufdeckung
Otto betrügt auch
Manipulationen aller Orten
Nichts getan, nichts geahnt, nichts gewusst
Schummelei auf Vorstandsebene seit 2014
Alle wussten davon – und taten überrascht
TÜV gibt sich unschuldig
Politik für Diesel und deutsche Arbeitsplätze
Der Staat sorgt sich – um sich selbst
VW weltweit im Visier
Die Mutter des Betrugs
„Emission Possible“ – Königsdisziplin des Betrugs
Audi: Manipulation total
Audi: verwöhnt und träge
Krise, welche Krise?
Winterkorn, der schwere Betrüger
Die unethische Firmenkultur bei VW
VW so unethisch wie Facebook
VW unter US-Aufsicht
Steuern wichtiger als Strafen
„Das, was wir gemacht haben war Betrug, ja.“
Boni ohne Reue und Milliardenkosten
Weckruf für alle, Rückruf für viele
Dieselkrise mit Ansage
Das deutsche Autokartell
Zusammenhalt bis zur Vertuschung
„Clean Diesel“ statt Dreckdiesel
Daimler-Diesel und kein Ende
Desaster reloaded: Ein Hacker deckt auf
Fahrverbote aller Orten
Dieselfreiheit gegen Gesundheit
Februar 2018: Startschuss für Fahrverbote
Umstellung im Ruhrpott
Euro 4 und 5 müssen in Stuttgart draußen bleiben
Fahrverbote auf der Autobahn
Neueste Diesel in ganz Europa unerwünscht
Diesel 6 unerwünscht
Benzinerstopp ab 2030
Erst Diesel, dann Benziner, Hybride und Elektro
Dramatische Auswirkungen
Sind die Fahrverbote übertrieben?
München ohne Fahrverbote
Wer misst, misst Mist
Messtechnische Geisterfahrt
Luftmessung im Park
Pollenflug nimmt Einfluss
Leichte Besserung
Straßen wässern gegen Feinstaub
Dieselverbot ist nicht genug
Stauhauptstadt Berlin
Kostenfreier ÖPVN als Abhilfe
Bremer Senat zieht den Stecker
Warnung vor der U-Bahn
Umweltsünder Fahrrad
Gesetzes-Trickserei
Freude an Selbstzerstörung statt Fahren
Euro 6d-ISC-FCM – genaue Kontrolle
Euro 7 – de facto ein Verbot des Verbrenners
Mehr Feinstaub durch E-Autos
Die deutsche Umwelthilfe
DHU – die kommerziellen Umweltschützer
Deutsche Umwelthilfe – Todesstoß für Dieselfahrer
Der Dieselkrieg der DUH
CDU gegen DUH
AKK gegen DUH
Handelt die DUH legal?
Die DUH handelt rechtens
DUH gemeinnützig bis 2023
Zwölf-Punkte-Plan der DUH
Bedrohter Resch
Unterstützer wenden sich ab
Dieselfahrer finanzieren ihren Untergang
Die schmutzigste Straße Deutschlands
Silvester ohne Feuerwerk
DUH gegen Bundesregierung
Beugehaft gegen Landesregierung
Tempo 120 auf der Autobahn
Die vielen Toten
Die Crux mit der Richtgeschwindigkeit
Besser Tempo 80 statt 120
Volvo prescht vor
EU-Tempobremse ab 2022
Tempo 130 bis 150 heute schon
Die bizarre Rolle der Autohersteller
Historischer Einbruch in der Autoindustrie
Die Branche strotzt vor Selbstbewusstsein
Exportquote auf Höchststand
Der Betrug hat Geschichte
Immer dreistere Tricks
Reaktionen aus der Branche
Das Geschäft mit den Dieselgeschädigten
Dieselprämie für alle
Nachrüstung funktioniert, oder?
Ist der Ruf erst ruiniert…
Emissionen steigen immer stärker
VW-Betrug die Zweite
Vertrauen verspielt
Kaufen, kaufen, kaufen
Umweltschutz kostet Arbeitsplätze
Autoproduktion sinkt
Ein Fünftel aller Jobs bedroht
Abbau von Arbeitsplätzen
Continental streicht 20.000 Stellen
Problemfall Autobranche nicht chancenlos
Das Ende der Nettigkeiten bei BMW
Der Unsicherheitsfaktor Kunde
Blaues Auge durch Schummelei
Die unrühmliche Rolle der Politik
Zerrüttetes Verhältnis zwischen Politik und Autobranche
Europa soll sauberer werden
Deutschland schützen
Politik verharrt im Klein-klein
Dieselgipfel der Erste
Dieselgipfel der Zweite
Autogipfel ohne Ergebnisse
Mobilitätsprogramm zur NO2-Reduzierung
VW gegen AfD
NO2-Belastung sinkt langsam
Behörde wirbt für deutsche Hersteller
„Big Brother“ überwacht Dieselverbot
Die CO2-Steuer
Soziale Spaltung durch CO2-Steuer
CO2-Steuer verfassungswidrig
Mehrheit gegen CO2-Steuer
Politik und Justiz entfremden sich
Daimler zersetzt die Demokratie
Dieselkampf der Parteien
Die Grünen überholen die DUH
Der „große Wurf“ gegen den Verbrennungsmotor
Feindbild SUV
Minister in Beugehaft
Gelbwesten auf dem Vormarsch
Wackelpolitik
EU schmettert Deutschland ab
Das schmutzigste Kraftwerk der EU
EU stuft Autokonzerne als illegal ein
EuGH schärft nach
Verkehrswende dauert Jahrzehnte
Nachrüsten oder nicht – das ist hier die Frage
VW & Co. ohne Verantwortung
Millionen für die Nachrüstung
SCR-Katalysatoren
Die Hersteller trödeln
Grenzwertüberschreitung trotz Softwareupdate
Nachrüstungen sind überwiegend wirksam
Kein Schadensersatz wegen Softwareupdate
Die Wut der Kunden
Das Rudel der Anwälte
Rund 400.000 Kläger
Sieg vor Gericht
Porsche kam mit 535 Millionen Euro davon
Audi betrügt bis 2018
Die Rechte der Verbraucher
Musterfeststellungsklage läuft
Autokredit-Widerruf
Entzug der Zulassung ohne Update
Opel im Visier der Anwälte
Ansprüche seit 2019 verjährt
BGH mit Hinweis auf Sachmangel
Hätte-Entschieden-BGH-Urteil als Wegweiser
Schwarze Lkw
Die UNO fährt mit
Die überlastete Erde
Greta Thunberg startet globale Klimabewegung
Globale Klimakoalition
Die UNO macht Druck
Klimanotstand – ein symbolischer Notruf
Utopische UNO-Klimaziele
Ökostrom für die Welt
„Wie können Sie es wagen?“
Generation Anti-Auto
Luxuswagen im Visier
Trend zur Luxusmarke – und zu VW
Die UNO testet Autos
Schummeln auf UNO-Niveau
Ausblick
Dieseldebakel, Elektromobilität und Digitalisierung
Der Verbrenner ist am Ende
2040 Autofahren nur noch mit Sondergenehmigung
Über die Autoren
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Über Jahrzehnte hinweg galt der Diesel als besonders sauberer Motor. Wer sich einen Diesel zulegte, konnte sich geradezu als Umweltschützer wähnen.
Dann kam das Jahr 2015 und der Diesel geriet zum Symbol einer Dreckschleuder, für die man sich schämen sollte. Die Verkehrung ins Gegenteil war verbunden mit dem wohl größten Industrieskandal, den Deutschland jemals erlebt hat.
Dax-Konzerne hatten die Politik, die zuständigen Behörden und ihre Kunden über Jahre hinweg mit falschen Angaben belogen und betrogen. Statt die Motoren immer umweltschonender zu entwickeln, wie sie vorgaben, hatten sie mit Schummelsoftware dafür gesorgt, dass die Wagen bei den behördlichen Fahrzeugtests viel weniger Emissionen ausstießen als im Straßenverkehr.
Als die Sache aufflog, setzten die Automobilkonzerne alles daran, ihr beschämendes Tun zu vertuschen und sich aus der Verantwortung zu stehlen. Die Vorstände gaben sich ahnungslos die Hersteller ließen Millionen von Kunden im Regen stehen. Schnell weitete sich der Skandal über den Diesel hinaus auf alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aus.
Mit dem millionenfachen Lug und Betrug schufen die Autohersteller unbeabsichtigt die Grundlage für um sich greifende Fahrverbote und legten ebenso ungewollt die Basis für den mittlerweile wohl unaufhaltsamen Siegeszug der Elektromobilität. Indes deutet vieles darauf hin, dass die deutschen Autohersteller an diesem Siegeszug kaum noch teilnehmen werden. Tesla führt die Spitze der E-Mobilität an, gefolgt von zahlreichen innovativen chinesischen Automobilherstellern und mutmaßlich in Zukunft von weiteren US-Konzernen wie Apple oder Google. BMW, Daimler, Volkswagen und Co haben sich so lange auf die Vergangenheitsbewältigung kümmern müssen, dass sie über lange Jahre hinweg ihre Zukunft vernachlässigt haben.
Doch während in der Konzernwelt der Kampf um die elektromobile Zukunft in vollem Gange ist, gehören die meisten von uns noch zu den Betroffenen des Skandals, der weit vor 2015 seinen Lauf nahm: Wir besitzen noch einen Benziner oder einen Diesel und viele von uns werden auch noch in den nächsten Jahren einen Wagen mit Verbrennungsmotor fahren.
Daher ist das vorliegende Buch nicht nur eine Geschichte über den größten Industrieskandal Deutschlands, sondern bleibt auch solange aktuell, wie Diesel und Benziner auf unseren Straßen fahren.
Thomas Gronenthal et al.
An diesem Werk haben zahlreiche namhafte Mitglieder der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council mitgewirkt, vornehmlich durch fachliche, technische, visionäre, wissenschaftliche, gesellschaftliche und politische Beiträge. Das vorliegende Buch stellt in diesem Sinne ein Gemeinschaftswerk „et alii“ bzw. „et aliae“ dar. Diesen Gemeinsinn will die Autorengemeinschaft mit dem bibliografischen Kürzel „et al.“, also „und andere“, ausdrücken.
Dicke Luft durch Diesel
„Der Diesel“ steht seit dem Jahr 2015 geradezu als Symbol für Betrug, Umweltverpestung und eine untergehende Ära. Sein Erfinder Rudolf Diesel trägt daran keine Mitschuld. Ganz im Gegenteil war der Dieselmotor seinerzeit besonders innovativ und galt über viele Jahre hinweg als Inbegriff des sauberen und umweltschonenden Fahrens.
Luftverschmutzung seit den 1950ern
Seit dem späten 19. Jahrhundert werden Verbrennungsmotoren in Automobilen eingesetzt. Doch das Problem der dadurch verursachten Luftverschmutzung rückte erstmals in den 1950er Jahren ins öffentliche Bewusstsein, zumindest in den USA, genauer gesagt in Kalifornien.1 Dort wurden 1959 die ersten Standards für die Luftqualität festgelegt, auf deren Grundalge Emissionsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge entwickelt wurden, die ab 1966 eingehalten werden sollten. 1968 trat in Kalifornien das erste Gesetz zur Begrenzung von Abgasemissionen in Kraft. Deutschland folgte 1971 mit der Festsetzung von Abgasgrenzwerten für Ottomotoren. 1973 kam der sogenannte Dreiwegekatalysator auf den Markt, der aber erst ab 1981 in Pkw eingebaut wurde.2 Damals galten Dieselmotoren als besonders umweltfreundlich, weil im Abgas weniger Kohlenstoffdioxid, weniger Kohlenwasserstoffe, weniger Kohlenstoffmonoxid und weniger Stickoxide enthalten sind. Allerdings arbeiten Diesel nicht mit dem Prinzip des Dreiwegekatalysators zusammen und haben daher seit Beginn der 1990er Jahre einen sogenannten ungeregelten Oxidationskatalysator. Dieser wandelt Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid, reduziert die HC- und CO-Emissionen und senkt den Partikelausstoß.3 Anfang des 21. Jahrhunderts geriet der Diesel wegen des Rußausstoßes in die Kritik, wogegen flächendeckend Rußpartikelfilter für die Dieselmotoren eingeführt wurden.
Doch es wurde über die Jahre hinweg zusehends schwieriger, die immer schärferen Umweltauflagen zu erfüllen. Zunächst wurde bei Dieseln versucht mit innermotorischen Maßnahmen wie einer niedrigeren Verbrennungstemperatur den Stickoxidausstoß zu senken und zugleich den dadurch verursachten erhöhten Rußpartikelausstoß durch einen besseren Rußpartikelfilter zu kompensieren. Als auch das nicht mehr genügte, kamen nachmotorische Verfahren wie Speicherkatalysator und die selektive katalytische Reduktion zum Einsatz.
Man kann es auch deutlicher formulieren: Die Hersteller versuchten über Jahre hinweg verzweifelt, die Abgasnormen zu erfüllen und taten sich damit immer und immer schwerer. Die Katastrophe – die Aufdeckung der Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Erfordernissen und dem tatsächlich Ausstoß der Fahrzeuge –, wie sie sich ab 2015 entwickelte, war also schon lange Jahre vorprogrammiert.4 Das galt umso mehr, als insbesondere Pkw-Diesel bis 2015 auf die sogenannten Rollenprüfstandtestzyklen hin optimiert wurden. 5 Anders ausgedrückt: Die Hersteller haben ihre Motoren auf optimale Prüfungsergebnisse nach vorgefertigten Rechenmodellen ausgerichtet, während der tatsächliche Schadstoffausstoß weitaus höher lag. Prinzip: Im Test sauber abgeschnitten, beim normalen Fahrbetrieb unbekümmert dreckig. Die „Optimierung der Optimierung“ gelang den VW-Ingenieuren mit einer Software, die erkannte, ob sich der Motor im Testbetrieb befand und dementsprechend das Abgasreinigungssystem exakt auf die jeweiligen Anforderungen des Testzyklus einstellte. Technisch war diese automatische Zykluserkennung kongenial, jedoch rechtlich verboten, was den Auslöser des VW-Skandals darstellte – und das Ende der Ära von Verbrennungsmotoren einläutete. Seitdem wurde versucht, das Emissionsverhalten nicht mehr im Hinblick auf die Prüfzyklen zu optimieren, sondern im realen Fahrbetrieb zu verbessern. Als auch das an sein Ende stieß und gleichzeitig die gesetzlich vorgeschriebenen Testverfahren immer strenger wurden, blieb nur noch die Umstellung auf elektrisch betriebene Automobile, wie sie sich seit 2020 vehement vollzieht.
Diesel: Motor mit Selbstzündung
Der Dieselmotor ist ein Verbrennungsmotor mit Kompressionszündung. Der Name geht zurück auf den Erfinder Rudolf Diesel, dem es in den Jahren ab 1893 erstmals gelang, das Prinzip der Selbstzündung bei einem Motor anzuwenden.6 Das bedeutet, dass sich der Kraftstoff bei der Einspritzung aufgrund der heißen Luft im Brennraum des Motors von selbst entzündet, also keine Zündkerze notwendig ist im Gegensatz zum Benzinmotor, der auch als Ottomotor bezeichnet wird. Diesel sind sogenannte Vielstoffmotoren, das heißt, sie können im Prinzip mit allen Kraftstoffen betrieben werden, die die bei der Betriebstemperatur des Motors von der Kraftstoffpumpe gefördert werden können, sich gut im Brennraum zerstäuben lassen und sich zünden lassen. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen tatsächlich überwiegend minderwertige Öle als Kraftstoffe zum Einsatz. Bis in die 1930er Jahre waren Petroleum, Schmieröl, Gasöl und Pflanzenöle in Reinform oder Mischungen daraus üblich.7 Erst mit dem Voranschreiten der Motorentwicklung stiegen auch die Ansprüche an den Kraftstoff. So wurde erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg in der DIN-Norm 5160 Landkraftfahrzeuge überhaupt ein Dieselkraftstoff definiert. Erst seit 1993 ist der Dieselkraftstoff im Standard EN 590 genormt; er wird dort schlicht Diesel genannt.8 Im Brennraum des Motors findet zwischen dem Kraftstoff und der angesaugten Luft eine chemische Reaktion statt, welche die im Kraftstoff gebundene Energie in Motorleistung umgewandelt wird. Dabei zerfallen die Kraftstoffmoleküle, so dass Abgase entstehen. Bei einem Idealmotor, wie es ihn in Wirklichkeit allerdings nicht gibt, werden alle brennbaren Bestandteile des Kraftstoffs durch eine optimale Sauerstoffzufuhr vollständig verbrannt. In diesem Fall besteht das Abgas aus Kohlenstoffdioxid, Wasser, Stickstoff und überschüssigem Sauerstoff. Mit anderen Worten: Selbst bei einem idealen Dieselmotor kommt eine ganze Menge Abgas zustande, nämlich aus den schädlichen Bestandteilen CO2 (Kohlenstoffdioxid, auch als Kohlendioxid bezeichnet) und NO2 (Stickstoff) sowie den unschädlichen H2O (Wasser) und O2 (Sauerstoff). In der Realität wird zudem keine vollständige Verbrennung der Kraftstoffmenge erreicht, so dass zusätzlich ein Dieselruß übrig bleibt.9 Darüber hinaus entstehen in einem realen Dieselmotor aus dem Stickstoff Stickoxide (NOx).
Insgesamt kommen aus einem Dieselauspuff: Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2), Kohlenstoffdioxid (CO2), Wasser (H2O), Kohlenstoffmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC), Aldehyde und Rußpartikel (Sulfate und Feststoffe). Die Verteilung hängt vom Lastzustand und von der Luftfeuchtigkeit ab. Auf jeden Fall kommt ein „erheblicher Dreck“ aus den Dieselfahrzeugen heraus, der zweifelsohne gesundheitsschädlich ist – wie und in welchem Maße ist allerdings strittig. Dennoch darf die grundsätzliche Beeinträchtigung der Gesundheit bei allen Diskussionen um das Für und Wider von Fahrverboten nicht übersehen werden. So wurden Ende der 1990er Jahren allein Deutschland jährlich rund 72.000 Tonnen Dieselruß in die Luft geblasen, davon 64.000 Tonnen aus dem Verkehr und 42.000 Tonnen von Nutzfahrzeugen.10
Technik gegen „Todesdiesel“
Auf die Frage, wie gesundheitsschädlich diese Umweltbelastung für den Menschen ist, gab es unterschiedliche Antworten. Ernst zu nehmende aktuelle Studien gingen von jährlich rund 1.000 Todesfällen aus, die auf Dieselemissionen zurückzuführen sind. Dem gegenüber standen Studien aus den USA aus den 1980ern, die zeigten, dass das Risiko, durch die Abgase von Dieselmotoren tödlich zu erkranken, im Grunde vernachlässigbar war. Für Stadtbewohner, die also dem Dieselqualm besonders stark ausgesetzt sind, war es demnach etwa so groß wie die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden und daran zu sterben. Untersuchungen an Straßenarbeitern haben allerdings nachgewiesen, dass diese einem deutlich höheren Todesrisiko durch Diesel ausgesetzt sind. Fazit: Es besteht kein ernsthafter Zweifel, dass Dieselabgase gesundheitsschädlich sind, auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, unmittelbar daran zu sterben. Doch Krankheiten wie Asthma, Bronchitis und Lungenkrebs sind auch auf Dieselabgase zurückzuführen.11
Zur Abhilfe wurden seit 1990 bei Diesel-Pkw sogenannte ungeregelte Oxydationskatalysatoren eingebaut. Damit ließ sich der Ausstoß der Kohlenwasserstoffe um bis zu 85 Prozent, der Kohlenstoffmonoxide um bis zu 90 Prozent, der Stickoxide um bis zu 10 Prozent und der von Rußpartikeln um bis zu 35 Prozent reduzieren.12
Zur Festlegung von Höchstgrenzen beim Dieselabgas wurde in Europa der Ausstoß an Stickoxiden herangezogen. Die Abgasnormen (der Nomenklatur Euro 4, Euro 5, Euro 6 und Euro 7 folgend) legten folgende Höchstwerte fest: 250 Milligramm NOx pro Kilometer für Euro 4, 180 Milligramm NOx pro Kilometer für Euro 5 und 80 Milligramm NOx pro Kilometer für Euro 6. Vereinfacht ausgedrückt war die Euro-6-Norm also dreimal sauberer als Euro 4 und mehr als doppelt so sauber wie Euro 5. Es stellt also einen gravierenden Unterschied dar, ob ein Wagen nach Euro 6, 5 oder 4 fährt – jedenfalls, wenn die Werte eingehalten würden. In Wahrheit stoßen Diesel-Pkw im tatsächlichen Fahrbetrieb in Deutschland in Durchschnitt 674 (Euro 4), 906 (Euro 5) und 507 (Euro 6) Milligramm NOx pro Kilometer aus. Man muss sich die Zahlen vergegenwärtigen: Ein Euro-6-Fahrzeug stößt in der Realität im Mittel doppelt so viele Stickoxide aus als nach der Euro-4-Norm überhaupt zugelassen sind. Das ist mehr als das Sechsfache, wenn man die Euro-6-Norm anlegt, an die sich der Wagen angeblich halten sollen. Seitdem sind Verschärfungen der Euro-6-Norm 6d und 6d-Temp bis hin zu 6d-ISC-FCM (seit 2021) hinzugekommen, die vor allem darauf abzielen, die realen Abgaswerte zu messen13 – statt der utopischen Schummelwerte der Hersteller.
Mit 600 rasen, wo 100 erlaubt sind
Nehmen wir einmal einen anschaulichen Vergleich: Das Straßenschild zeigt 100 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und Sie rasen mit über 600 Kilometern pro Stunde. Hand aufs Herz: 120 wenn nur 100 erlaubt sind fahren viele, 160 einige wenige. Aber 600 fährt niemand, wenn nur 100 erlaubt sind. Eine solche Überschreitung der gesetzlich festgelegten Grenzwerte erlauben sich lediglich die Autohersteller. Nur auf der „Teststrecke“, also während der Prüfung, drosseln sie brav auf 100 Kilometer pro Stunde, danach wird wieder auf 600 erhöht. Das ist schon gelinde gesagt dreist. Man mag darüber diskutieren, wie viele Menschen mehr bei 600 statt 100 sterben, aber wenn sie Ihren Wagen bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde mit 600 Kilometern pro Stunde über die Landstraße rasen lassen, kann man nicht gerade von verantwortungsbewusstem Handeln sprechen, selbst dann nicht, wenn dabei niemand zu Tode kommt. Sie handeln unverantwortlich – und genau das haben die Autohersteller getan.
Diesel sind tödlich
Es ist noch niemand gestorben, weil er neben einem Diesel gestanden hat und die Verteufelung des Diesel ist völlig übertrieben. Mit diesem saloppen „Argument“ wurde der Abgasskandal wahlweise als amerikanischer Angriff auf die deutsche Autoindustrie, als Angriff der Deutschen Umwelthilfe oder als Angriff der EU, die die Grenzwerte festgelegt hat, abklassifiziert.
Doch das war falsch: Es kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass Dieselemissionen erhebliche gesundheitliche Schädigungen nach sich ziehen – auch beim Dieselfahrer selbst, sobald er seinen Wagen verlässt und etwa durch die überbelasteten Innenstädte flaniert. Wissenschaftliche Hochrechnungen gelangen zu dem Schluss, dass jährlich europaweit etwa 5.000 Menschen vorzeitig sterben, weil Dieselfahrzeuge im Straßenverkehr die auf Prüfständen gemessenen Grenzwerte für Stickoxide erheblich überschreiten, oftmals um den Faktor vier bis sieben. Allein die rund 2,6 Millionen in Deutschland verkauften Fahrzeuge der VW-Marken Audi, Seat, Skoda und Volkswagen mit illegalen Abschalteinrichtungen sollen diesen Schätzungen zufolge zwischen 2008 und 2015 in Europa etwa 1.200 vorzeitige Todesfälle verursacht haben. Rund 13.000 Lebensjahre hat der Diesel nach diesen Berechnungen vernichtet, was rechnerisch einem volkswirtschaftlichen Schaden von 1,9 Milliarden Euro gleichkommt.14
Doch sind diese Zahlen überhaupt belegt und halten sie einer Nachprüfung stand? Seit Anfang 2019 tobte genau hierüber eine Debatte der Lungenärzte in Deutschland.
CO2 vs. NO2 vs. Feinstaub
Was ist schlimmer für die Menschheit:15
CO2, also Kohlenstoffdioxid, auch Kohlendioxid oder Kohlensäure genannt, ein unbrennbares, saures und farbloses Treibhausgas, das bei zunehmender Konzentration in der Atmosphäre zu einer Erwärmung des Erdklimas führt,
NO2, also Stickstoffdioxid, ein rotbraunes, giftiges, stechend chlorähnlich riechendes Reizgas, das im menschlichen Körper chemische Reaktionen hervorruft, etwa in den Augen und den Atemwegen, oder
Feinstaub, der sich auf unsere Lungen legt, weil die Partikel so klein sind, dass sie von den Schleimhäuten im Nasen- und Rachenraum nicht vollständig zurückgehalten werden können.
Im Laufe der Diskussionen verlagerten sich die Betrachtungsweisen auf die verschiedenen Schädigungspotenziale. Zunächst wurde vor allem der frühe Tod durch Stickoxide prophezeit und dem Diesel zugeschrieben. Später, als sich herausstellte, dass Fahrverbote nur geringe Wirkung zeigten, wurde die Gefahr durch Feinstaub in den Vordergrund geschoben. Doch Feinstaub entsteht keineswegs nur durch den Autoverkehr. Sowohl bei Stickoxiden als auch beim Feinstaub ging es vor allem um die Reinhaltung der Luft in den Innenstädten. Im Zuge der sich verstärkenden weltweiten Klimadiskussionen rückte die Reduzierung der CO2-Emissionen in den Mittelpunkt. Es ging nicht mehr nur darum, die Städte rein zu halten, sondern den ganzen Planeten oder jedenfalls die Menschheit zu retten.16
6.000 NO2-Tote im Jahr
Nach Untersuchung des Umweltbundesamtes lassen sich jährlich rund 6.000 vorzeitige Todesfälle der hohen NO2-Konzentration zuordnen, etwa durch Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Lungenerkrankungen. Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten und vor allem: Es sind natürlich nicht nur die Autos, die NO2 ausstoßen, wenngleich viele davon offenbar viel mehr als gesetzlich erlaubt ist in die Luft ablassen.17
Den Ausgang nahm der heftige Ärztestreit angesichts einer Studie des Helmholtz-Instituts, in dem die Forscher vor erheblichen Gesundheitsgefahren durch Stickstoffdioxid auch schon in niedrigen Konzentrationen wie dem derzeit gültigen Grenzwert für NO2 von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel warnten. Die Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes hatte ausgerechnet, dass es ungefähr 6.000 Todesfälle in Deutschland sind oder ungefähr 50.000 Lebensjahre, die in der Gesamtbevölkerung verloren gehen durch zu hohe Stickoxide. Das waren erschreckende Zahlen und immerhin gilt das Helmholtz-Institut als wissenschaftlich einwandfrei.18
Aber: Die Ergebnisse basierten nicht auf Messungen, sondern es handelte sich um konstruierte mathematische Modelle, die möglicherweise mit der Realität wenig zu tun haben. Das Umweltbundesamt räumte in der Tat ein, dass ein direkter Nachweis über die Gesundheitsgefahr durch Stickstoffdioxid nicht zu erbringen ist, verwies aber auf dessen Indikator-Funktion: „Es gibt tatsächlich keinen NO2-Toten oder NO2-Erkrankten, weil diese singuläre Verursachung durch diesen einen Schadstoff nicht beobachtbar ist“. Aber immerhin: „Wenn mehr NO2 vorhanden ist, treten die Erkrankungen auf. Aber wir können nicht eine Erkrankung herunterbrechen auf die eine Ursache NO2.“ Das hörte sich jedenfalls ganz anders an als 6.000 Tote durch NO2 jährlich.19
Fragwürdige Studien
Der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP), Dieter Köhler, veröffentlichte Anfang 2019 ein Positionspapier, in dem er einen Großteil der vorhandenen Studien zu den Gesundheitsgefahren durch Luftschadstoffe für fragwürdig erklärte. Mehr als 100 Lungenfachärzte schlossen sich an und forderten, die Grenzwerte zu überprüfen. Das Positionspapier sollte die Debatte versachlichen und wird daher nachfolgend im Wortlaut abgedruckt:20
Stellungnahme zur Gesundheitsgefährdung durch umweltbedingte Luftverschmutzung, insbesondere Feinstaub und Stickstoffverbindungen (NOx).
Nach Daten der WHO und der EU reduziert sich die Lebenserwartung in Deutschland durch die Luftverschmutzung um etwa zehn Monate. Nimmt man die aktuelle Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes zum NOx dazu, so erhöht sich die Zahl nochmals. Daraus sollen, auch von Wissenschaftlern und dem Umweltbundesamt, durch die Bevölkerungszahl und Lebensalter hochgerechnet, beim NOx 6.000-13.000 und beim Feinstaub 60.000-80.000 zusätzliche Sterbefälle im Jahr entstehen.
Nun stirbt etwa die gleiche Anzahl an Menschen in Deutschland im Jahr an Zigarettenrauch-bedingtem Lungenkrebs und COPD. Lungenärzte sehen in ihren Praxen und Kliniken diese Todesfälle an COPD und Lungenkrebs täglich; jedoch Tote durch Feinstaub und NOx, auch bei sorgfältiger Anamnese, nie. Bei der hohen Mortalität müsste das Phänomen zumindest als assoziativer Faktor bei den Lungenerkrankungen irgendwo auffallen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die wissenschaftlichen Daten, die zu diesen scheinbar hohen Todeszahlen führen, einen systematischen Fehler enthalten. Eine genauere Analyse der Daten zeigt, dass diese extrem einseitig interpretiert wurden, immer mit der Zielvorstellung, dass Feinstaub und NOx schädlich sein müssen. Andere Interpretationen der Daten sind aber möglich, wenn nicht viel wahrscheinlicher.
1. Korrelation und Kausalität: Viele Studien zur Gefährdung von Luftverschmutzung begründen sich auf epidemiologische Daten mit ähnlichem Muster (meist Kohorten Studien). Es werden Regionen verglichen mit unterschiedlicher Staub- bzw. NOx Belastung. Man findet mehr oder weniger regelhaft eine sehr geringe Risikoerhöhung in staubbelasteten Gebieten, meistens nur um einige Prozent. Aus dieser Korrelation wird fälschlicherweise eine Kausalität suggeriert, obwohl es viel offensichtlichere Erklärungen für die Unterschiede gibt. Korrelationen dienen nur der Hypothesenbildung, sie sind nie konfirmatorisch.
2. Störfaktoren (Confounder): Die Krankheitshäufigkeit und die Lebenserwartung werden durch zahlreiche Faktoren bestimmt, wie Rauchen, Alkoholkonsum, körperliche Bewegung, medizinische Betreuung, Einnahmezuverlässigkeit von Medikamenten usw. Alle diese Faktoren wirken meist hundertfach stärker als der Risikoerhöhung durch die Luftverschmutzung in den Kohortenstudien zuzuordnen ist. Zudem ist die Störgrößenverteilung zwischen den Gruppen oft sehr unterschiedlich. Ein sogenanntes Adjustieren der Einflüsse in den Studien durch Fragebögen ist deswegen wissenschaftsmethodologisch nicht zulässig. Zudem können Lebensstil und Gesundheitsbewusstsein nicht erfasst werden, obwohl sie erheblich die Mortalität bestimmen. Es ist offensichtlich und auch durch Studien belegt, dass die Lebensart zwischen den unterschiedlich belasteten Regionen deutlich abweicht.
3. Schwellenwert und Toxizitätsmuster: Viele der epidemiologischen Studien zur Luftverschmutzung zeigen keinen Schwellenwert. Das wird in den Studien dahingehend interpretiert, dass es sich um eine besonders große Gefährdung handelt. Nun hat jedes Gift, auch das Stärkste, eine Schwellendosis. Es ist daher viel plausibler, dass alle diese Studien eine konstante Störgröße (Bias) messen, denn eine solche Störgröße hat meist keinen Schwellenwert. Allein die unterschiedliche Lebensart der Menschen, die in staubbelasteten im Vergleich zu weniger staubbelasteten Gebieten wohnen, würde einen solchen fehlenden Schwellenwert zwanglos erklären, denn die Änderungen der Lebensweise verlaufen kontinuierlich.
Die epidemiologischen Studien zeigen auch, dass Feinstaub und NOx zu mehr als zwei Dutzend voneinander sehr verschiedenen bunten Krankheitsbildern führen soll, die praktisch alle Fachgebiete der Medizin betreffen. Wenn nun aber die Luftverschmutzung so gefährlich wäre, so müsste sie ein typisches Vergiftungsmuster verursachen, wie es für jedes Gift mehr oder weniger typisch ist. Das völlige Fehlen dieses Musters spricht gegen eine Gefährdung und für Störfaktoren. Zudem gibt es überhaupt keine plausiblen pathophysiologischen Hypothesen, wie die Luftverschmutzung diese vielen unterschiedlichsten Erkrankungen verursachen soll.
Falsifikation: Das stärkste Argument gegen die extrem einseitige Auswertung der Studien ist jedoch eine Besonderheit, die nur beim Feinstaub und NOx vorliegt. Normalerweise müsste man zur Absicherung eines Grenzwertbereiches eine Expositionsstudie am Menschen durchführen mit höheren und niedrigeren Dosen. Das ist ethisch jedoch nicht vertretbar. Beim Feinstaub und NOx ist die Situation anders, denn die Raucher inhalieren freiwillig außerordentlich hohe Dosen, so dass diese quasi freiwillig an einer riesigen Expositionsstudie teilnehmen.
Die Konzentration an Feinstaub im Hauptstrom des Zigarettenrauches erreicht tatsächlich 100-500 g/m3 und ist damit bis zur 1 Million Mal größer als der Grenzwert. Beim NOx werden bis zu 1g/m3 erreicht, wobei der NOx-Anteil überwiegt. Aus Depositionsstudien kann man die inhalierte Dosis der Raucher berechnen und mit der Dosis der Gesunden vergleichen, die permanent Feinstaub oder NOx im Grenzwertbereich einatmen würden. Dabei erreichen Raucher (eine Packung/Tag angenommen) in weniger als zwei Monaten die Feinstaubdosis, die sonst ein 80-jähriger Nichtraucher im Leben einatmen würde. Beim NOx sind die Unterschiede ähnlich, wenn auch etwas geringer. Hinzu kommt noch, dass der Rauch einer Zigarette um mehrere Größenordnungen toxischer ist als die Luftverschmutzung.
Rauchen verkürzt die Lebenserwartung etwa um zehn Jahre, wenn über 40-50 Jahre eine Packung/Tag geraucht wird. Würde die Luftverschmutzung ein solches Risiko darstellen und entsprechend hohe Todeszahlen generieren, so müssten die meisten Raucher nach wenigen Monaten alle versterben, was offensichtlich nicht der Fall ist.
Die hier vorgestellten Kritikpunkte mögen überraschend sein angesichts der großen Informationsflut über die Gefährlichkeit von Feinstaub und NOx, in den Publikationsorganen, den Medien und in staatlichen Verlautbarungen. Alle diese Informationen stammen im Wesentlichen aus der gleichen Quelle und beziehen sich damit auf die gleichen Inhalte, die oben kritisiert werden.
Natürlich ist es auch das Ziel der Autoren, die Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung zu fördern. Jedoch sehen sie derzeit keine wissenschaftliche Begründung für die aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und NOx. Sie fordern daher eine Neubewertung der wissenschaftlichen Studien durch unabhängige Forscher.
Die oben angeführten Kritikpunkte sind so gravierend, dass im Sinne der Güterabwägung sogar die Rechtsvorschrift für die aktuellen Grenzwerte ausgesetzt werden sollte.
Dieser Beitrag soll der Versachlichung der Diskussion dienen. Er entschuldigt natürlich nicht die unverantwortlichen Manipulationen von Teilen der Autoindustrie bzgl. des Schadstoffausstoßes.
Gerne sind wir bereit, jede der einzelnen Aussagen näher mit Literatur zu belegen.
Korrespondenzadresse: Prof. Dr. med. Dieter Köhler (Dipl. Ing)...
Fazit des Schreibens, das nicht etwa von der Automobilindustrie stammte, sondern von Lungenärzten: Es ist nicht plausibel, dass geringe Konzentrationen von NO2 und Feinstaub die Gesundheitsschäden und die Todesfälle verursachen sollen, wie sie publiziert werden.
Allerdings hatte die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) kurz zuvor ein anderes Positionspapier herausgebracht; in diesem fasste sie „den aktuellen Wissensstand zu den Gesundheitseffekten von Luftschadstoffen zusammen und leitete daraus Empfehlungen für einen umweltbezogenen Gesundheitsschutz ab“. Das offizielle Papier der DGP war deutlich kritischer. Dort hieß es unter anderem:21
Gesundheitsschädliche Effekte von Luftschadstoffen sind sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch bei Patienten mit verschiedenen Grunderkrankungen gut untersucht und belegt. Hierzu gehören Auswirkungen auf Lungenfunktion und Lungengesundheit, auf die Mortalität, das Herz-Kreislauf-System, auf metabolische Prozesse und die fetale Entwicklung. Gesundheitliche Folgen können sowohl akut nach kurzfristigen Erhöhungen der Luftschadstoffkonzentration auftreten, wie sie z. B. von Tag zu Tag zu beobachten sind, als auch infolge einer langfristig erhöhten Luftschadstoffbelastung.
Immerhin mussten die Wissenschaftler einräumen, dass Rauchen viel schädlicher ist:
Obwohl die Risikoerhöhungen im Vergleich zu anderen Risikofaktoren, wie z. B. aktives Rauchen oder schlechte Ernährung, relativ gering sind, ergibt sich ihre Bedeutung aus der Tatsache, dass praktisch die gesamte Bevölkerung davon betroffen ist. Das führt zu einer hohen Anzahl an attributablen Fällen und birgt ein hohes Präventionspotential. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Luftverschmutzung der wichtigste umweltbedingte Risikofaktor weltweit. In Deutschland werden der ambienten Luftverschmutzung durch Feinstaub ca. 600.000 verlorene Lebensjahre pro Jahr zugeschrieben; weitere Belastungen gehen von anderen Komponenten der Luftverschmutzung wie NO2 und Ozon aus.
Wie die DGP dennoch auf die 600.000 verlorenen Lebensjahre kam, wird wohl auf immer ihr Geheimnis bleiben. Gleiches gilt für die sechs Billionen Euro jährlich, die die DGP als „potenziellen ökonomischen Gesundheitsnutzen pro Jahr“ bei einer Absenkung der Schadstoffwerte angab. Wörtlich hieß es:22
Trotz Absenkung der Schadstoffwerte in den letzten Dekaden in Deutschland ist die gesundheitliche Bedeutung der Luftverschmutzung anhaltend hoch. Dies resultiert unter anderem aus der Tatsache, dass bisher keine Wirkungsschwelle identifiziert werden konnte, unterhalb derer die Gesundheitseffekte vernachlässigt werden könnten. Das heißt, dass auch unterhalb der derzeit in Deutschland gültigen europäischen Grenzwerte erhebliche Gesundheitseffekte auftreten können. Als besonders vulnerable Gruppen sind Kinder, ältere Menschen – hauptsächlich vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – sowie multimorbide Patienten zu betrachten, deren Risiko für schwerwiegende Folgen wie die akute Verschlechterung vorbestehender Grunderkrankungen, Krankenhauseinweisungen, kardiovaskuläre Ereignisse, Progression der Erkrankung bis hin zum Tod stark ansteigt. Die erheblichen gesundheitlichen Folgen führen in der Gesellschaft zu relevanten Kosten, die sowohl die Sozialsysteme, z. B. durch mehr Arztbesuche, Medikation oder Fehltage, als auch die Individuen belasten. Eine Reduktion der Luftschadstoffbelastung ist auf der anderen Seite mit einem erheblichen Gesundheitsgewinn verbunden. So wurde für 25 europäische Städte ab 70.000 Einwohnern bei Einhaltung der von der WHO derzeit noch empfohlenen Richtwerte eine Lebenszeitverlängerung um ca. sechs Monate berechnet und der potentielle ökonomische Gesundheitsnutzen in Europa auf 31 Billionen Euro pro Jahr geschätzt.
Bei genauerem Hinsehen ließ sich feststellen, dass die DGP in ihrem Positionspapier vor allem die abenteuerlich anmutenden Zahlen schlichtweg aus anderen Quellen übernommen hatte, wie es schien, weitgehend ungeprüft. Frappierend waren die Schlussfolgerungen, die die DGP daraus zog:23
1 Eine weitere deutliche Reduktion der Luftschadstoffbelastung ist geboten und eine Absenkung der gesetzlichen Grenzwerte erforderlich. Diese notwendige Reduktion der Luftschadstoffbelastung ist nur durch gemeinsames, interaktives und zielorientiertes Handeln auf politischer, technologischer und individueller Ebene erreichbar.
2 Hierzu muss in Deutschland eine „Kultur zur Schadstoffvermeidung“ auf allen Ebenen entwickelt, gezielt gefördert und etabliert werden.
3 Multimodale Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung umfassen
• infrastrukturelle Maßnahmen zur Förderung einer schadstoffarmen Mobilität,
ein Umsteigen auf emissionsarme Technologien in Verkehr, Industrie,
Energieproduktion und Landwirtschaft,
• gezielte Minderungsmaßnahmen bei spezifischen lokalen Emittenten
(Häfen, Flughäfen), verhaltenspräventive Maßnahmen zur Änderung des individuellen Mobilitäts- und Konsumverhaltens sowie
• Vermeidungsstrategien zur Reduktion der eigenen Schadstoffexposition.
Hierfür muss die Politik mit entsprechenden Regularien den Anreiz schaffen. Die Exekutive und Judikative müssen die Verantwortung für deren Einhaltung konsequent übernehmen.
4 Forschungsaktivitäten zur Schließung von Wissenslücken müssen gezielt gefördert werden, z. B. im Bereich der Wirkung weiterer Schadstoffe wie von ultrafeinen Partikeln (UFP, Ultrafeinstaub), Langzeitfolgen einer Exposition im Kindesalter und mögliche protektive Wirkungen durch Ernährung oder, sekundärprophylaktisch bei bereits Erkrankten, durch Medikation.
Viele Maßnahmen zur Luftreinhaltung führen zu erheblichen Co-Benefits durch die gleichzeitige Reduktion von Klimagasen, Lärm, Landverbrauch, innerstädtischer Aufheizung.
Im Resümee der DGP-Dokumentation fiel auf, dass die Ärzte erstens und erstaunlicherweise direkte politische Handlungsempfehlungen gaben, und zweitens, weniger erstaunlich, mehr Forschungsgelder forderten. Beides zusammengenommen machte das Positionspapier des Verbandes nicht glaubwürdiger und dürfte die Hauptursache für das Gegenpapier der über 100 Lungenärzte gewesen sein, die sich damit nicht abfinden wollten.
Zusammengefasst konnte man feststellen: Die Mediziner waren sich nicht einig über die Auswirkungen von NO2 und anderen Umweltbelastungen, zumal Dieter Köhler im Frühjahr 2019 einräumen muss, dass ihm bei seinem Pro-Diesel-Papier signifikante Rechenfehler unterlaufen waren. Zwar blieb unbestritten, dass Belastungen nicht gut für die Menschen sind, die Frage war jedoch, in welchem Ausmaß und welcher Kausalität. Als diese vehemente Diskussion Anfang 2019 unter Mediziner aufkam, hatten die Gerichte allerdings längst über Fahrverbote entschieden. Die EU hatte die Grenzwerte Jahre zuvor festgelegt, der deutsche Gesetzgeber hat sie übernommen und sie stellten die Richtwerte für die Rechtsprechung nicht nur in Deutschland dar. Der Einwurf der Ärzte kam also um Jahre zu spät.
Diese medizinische Betrachtung ist im vorliegenden Buch bewusst vorangestellt, denn alle Dieselkritiker waren und sind losgelöst von politischen, ideologischen und wirtschaftlichen Interessen in einem geeint: Sie vertreten dem Vernehmen nach die Gesundheit der Bevölkerung.
Die Diskussionen, ob die Grenzwerte sinnvoll festgelegt sind, und übrigens auch darüber, ob bei der Messung der tatsächlichen Umweltbelastung in den Städten alles mit rechten Dingen zugegangen ist, entschuldigt allerdings keineswegs das systematische Fehlverhalten der Autohersteller – von der Inkaufnahme der drastisch überhöhten Werte über die millionenfache Schummelei bis hin zur Weigerung, die betrogenen Kunden angemessen zu entschädigen.
Acht Millionen Feinstaub-Tote pro Jahr
2021, also zwei Jahre nach der Diskussion der Lungenärzte 2019, veröffentlichte ein Team von Wissenschaftlern der University of Birmingham in der renommierten Fachzeitschrift Environmental Research eine umfassende Studie über die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf Grundlage von Daten aus dem Jahr 2018.24 Die Ergebnisse waren erschreckend. Laut Studie geht einer von fünf Todesfällen weltweit auf die Luftverschmutzung durch Kohle, Benzin oder Diesel zurück. Pro Jahr sterben demnach mehr als acht Millionen Menschen an Krankheiten, die auf die besonders kleinen Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern zurückgeführt werden, die beim Verbrennen fossiler Energieträger entstehen. Die höchsten Todesraten durch Luftverschmutzung gab es den Angaben zufolge in Indien und China. Aber auch im Osten Nordamerikas und in Europa war der Anteil höher als im globalen Durchschnitt. Für Deutschland schätzten die Forscher, dass jährlich beinahe 200.000 Menschen vorzeitig aufgrund von Feinstaub sterben – rund 22 Prozent aller Todesfälle. Besonders belastet sahen die Wissenschaftler die Luft im Ruhrgebiet, in Berlin, Frankfurt und Hamburg.
Die in der Studie von 2021 genannten Zahlen lagen deutlich höher als vorherige Schätzungen zur Sterblichkeit durch Luftverschmutzung. So gab zum Beispiel die Studie „Global Burden of Disease“ die Anzahl der weltweiten Todesfälle mit 4,2 Millionen an. Für Europa war ein Bericht der EU-Umweltagentur EEA zum Ergebnis gekommen, dass jährlich etwa 400.000 EUBürger vorzeitig aufgrund von Luftverschmutzung sterben, das wäre nur rund jeder zwölfte Todesfall.
Doch über die verschiedenen Zahlen hinweg herrscht in der Wissenschaft Einigkeit darüber, dass Feinstaub – insbesondere die feineren Partikel – selbst in geringer Konzentration Lebenszeit kostet. Belastete Luft schädigt vor allem die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System. Sie kann zu Schlaganfällen, Herzinfarkten, Lungenkrebs und weiteren Krankheiten beitragen.25
Chronologie eines Desasters
Verbrennungsmotoren kommen seit Jahren den gesetzlich vorgeschriebenen Abgasnormen nicht nach. Die Hersteller wissen das und behalten dieses Wissen über Jahre hinweg für sich. Gleichzeitig manipulieren sie die Motorsteuerungssoftware derart, dass sich die Autos beim Testen auf dem Prüfstand sauberer verhalten als im realen Fahrbetrieb. Wie ein Hippie auf Drogen, der lebt, als ob es kein Morgen gäbe, bringt die deutsche Autoindustrie immer neue Modelle heraus und lobt sich selbst in den Himmel für ihren vermeintlich „sauberen Diesel“.
Es kommt, wie es kommen musste – irgendwann fällt der Betrug auf. Daraufhin sind alle völlig überrascht, niemand wusste etwas, auf jeden Fall ist keiner schuld. Zudem prasselt es „Argumente“, die eher an den Hippie auf Entzug als an die Spitze der deutschen Wirtschaftselite erinnern: Die Abgasnormen sind sowieso unrealistisch streng, jede Beeinträchtigung der Autoindustrie gefährdet Arbeitsplätze und es ist ohnehin die eherne Aufgabe der deutschen Politik, die deutsche Industrie zu schützen. Um beim Vergleich mit dem Hippie zu bleiben: So ungesund ist das Koksten gar nicht, und der Dealer hat eine Frau und zwei Kinder zu ernähren.
Kriminalität existiert seit Menschengedenken und Gesetze werden übertreten, seit es sie gibt. Aber noch nie zuvor hatte sich eine ganze Branche, geradezu die Speerspitze der deutschen Industrie, zu einem derartigen gemeinsamen kriminellen Vorgehen hinreißen lassen. Eine Clique angesehener Topmanager verhielt sich wie eine Gruppe gesetzloser Hippies – und VW war der Oberhippie, der Anführer des automobilen Clans.
Schicksalstag für VW
Der 15. November 2006 gilt als der Tag, an dem sich das Schicksal des VW-Konzerns entschied. Der junge Motorenentwickler Peter L. hatte einen heiklen Termin: Er wollte nach oben berichten, dass er in der Steuerungssoftware des neuen Dieselmotors EA 190 ein paar Zeilen Programmcode entdeckt hatte, die ihm verdächtig erschienen. Er wollte die Computerbefehle, die die Abgasreinigung abschalteten, aus dem Programm nehmen. So gab er es später bei der Staatsanwaltschaft zu Protokoll. Gemeinsam mit seinem Abteilungsleiter Karl P. hatte er daher um ein Gespräch mit dessen Chef Martin G. gebeten, dem enge Kontakte bis hin zum Vorstand nachgesagt wurden. Sowohl Peter L. als auch Karl P. schienen das Ziel gehabt zu haben, ein klares Verbot für den Einsatz der Schummelsoftware zu erhalten. Doch genau das passierte nicht. Laut Anklageschrift, die die Staatsanwaltschaft kurz vor Ostern 2019 dem Landgericht Braunschweig vorlegte, begann das Dieseldesaster genau am 15. November 2006 und schmorte bis zum 22. September 2015 im Verborgenen, also beinahe neun Jahre lang, bis VW den Betrug offen zugeben musste.26
Das lag möglicherweise auch daran, dass man 2006 nicht noch einen weiteren Skandal glaubte verkraften zu können. Der VW-Konzern kämpfte zu dieser Zeit nämlich noch mit den Folgen einer anderen Krise: Im Juli 2005 war die sogenannte Betriebsratsaffäre aufgeflogen. Offenbar waren Arbeitnehmervertreter über Jahre hinweg mit überhöhten Gehältern, Fernreisen, Bordellbesuchen und weiteren Leistungen bestochen wurden, um die Kollegen bei Laune zu halten. Der langjährige Betriebsratsvorsitzende Klaus Volkert und Personalvorstand Peter Hartz, Namensgeber der Hartz-IV-Leistungen, wurden deshalb zu Hafttrafen verurteilt.27
Ein erneuter Skandal, bei dem es immerhin um den Betrug an Zulassungsbehörden und Kunden ging, kam der Führungsriege des Konzerns damals also besonders ungelegten. Und so machten letztlich alle mit, das Dieseldesaster nahm seinen Lauf. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bezifferte die Schadenssumme in ihrer Anklageschrift auf beinahe 78 Milliarden Euro – eine gewaltige Summe, die durch eine Fehlentscheidung am 15. November 2006 verursacht wurde und sich zu dem bis dato größten Betrugsfall der Bundesrepublik Deutschland auswuchs.28
Die Entscheidung zum Einbau der Schummelsoftware war wohl bereits während der Amtszeit des damaligen VW-Chefs Bernd Pischetsrieder zwischen 2005 und 2006 gefallen, und zwar entweder in der Motorenentwicklung in der VW-Zentrale in Wolfsburg oder bei der VW-Tochter Audi in Ingolstadt.
Die Aufdeckung
Seit 13. Januar 2013 verbot eine EU-Verordnung die Verwendung von Abschalteinrichtungen genau in der Form, wie sie am 18. September 2015 bei VW aufgedeckt wurden.29
Schon im Mai 2014 stellte das International Council on Clean Transportation (ICCT) in Zusammenarbeit mit der West Virginia University (WVU) erstmals enorme Differenzen beim Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen der VW-Gruppe fest. Zwar erfüllten die Wagen unter Testbedingungen auf einem Prüfstand des California Air Resources Board die Vorgaben der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA). Aber unter realen Bedingungen ermittelten die Experten von der WVU mit einem transportablen Messsystem (PEMS) beim VW Jetta VI Stickoxidwerte 15- bis 35-fach und beim VW Passat fünf bis 20-fach über dem gesetzlichen US-Grenzwert. Man muss sich die Zahlen klarmachen: Wir reden nicht vom doppelten Wert, kaum vom zehnfachen, sondern vom 20-fachen und sogar mehr. Am 18. September 2015 wurde öffentlich, dass die US-amerikanische Behörden ein Ermittlungsverfahren gegen Volkswagen wegen der gesetzeswidrigen Verwendung von Abschalteinrichtungen einleitete. Die US-Umweltschutzbehörde EPA sendete eine Notice of Violation („Mitteilung eines Rechtsverstoßes“) gegen die Volkswagen Group of America und erläuterte darin en detail die juristischen Vorwürfe hinsichtlich des Verstoßes gegen den US-amerikanischen Clean Air Act. Es standen Strafen von bis zu 18 Milliarden Dollar im Raum und das US-Justizministerium und der New Yorker Generalstaatanwalt Eric Schneiderman leitete Ermittlungen gegen VW ein. Am 14. Oktober 2015 schloss sich die Federal Trade Commission (FTC) den Ermittlungen der PEA und des US-Justizministeriums an, und zwar wegen irreführender Werbekampagnen („Clean Diesel“).30
Laut VW war die Schummelsoftware in rund elf Millionen Fahrzeugen mit den Motorenreihen VW EA189 im Einsatz, in den USA darüber hinaus bei der Nachfolgereihe VW EA288. Im November 2015 gab die EPA bekannt, dass auch Fahrzeuge von Audi und Porsche betroffen waren.31
Im Oktober 2014 wurde klar, dass die Branche ebenso wie die zuständigen Behörden bereits gut ein Jahr zuvor im Grunde Bescheid wussten. Mutmaßlich gab es sogar schon einen Hinweis von einem Automobilzulieferer Mitte 2012 an den damaligen EU-Kommissar Antonio Tijana, die Autohersteller würden die Abgaswerte in Zulassungstests elektronisch manipulieren. Jedenfalls forderte Tijani die Verkehrsminister der EU-Staaten damals schon schriftlich dazu auf, die Überwachung der Autoindustrie zu verbessern, allerdings ohne den entscheidenden Hinweis auf die Manipulation der Abgaswerte.32
Hingegen redete sich Volkswagen auf einen Softwarefehler heraus und rief im Dezember 2014 die beinahe 500.000 betroffenen Wagen zurück, um eine neue Software aufzuspielen. Doch es war zu spät, um die Schummelei fortzusetzen. Die Behörden entdeckten, dass die neue Software praktisch keine Verbesserungen mit sich brachte und drohten den 2016er-Fahrzeugen die Zulassung zu entziehen. Erst angesichts dieser Eskalation gab Volkswagen am 3. September 2015 den Betrug zu.33
Spätere Messungen bei anderen Herstellern ergaben, dass auch bei BMW, Daimler, Porsche, Ford, Opel, FiatChrysler, Renault, Nissan und weiteren Anbietern ähnlich extreme Abweichungen zwischen Prüfstand- und Alltagsbetrieb zutage traten, ein klarer Indikator für die Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen.
Der Betrug funktionierte wie folgt: Die in den Fahrzeugen installierte Software erkennt, sobald sich der Wagen in einer Prüfungssituation befindet. Der standardisierte Testbetrieb wird durch ein unnatürliches Fahrverhalten – hohe Raddrehzahlen ohne Bewegung des Fahrzeugs – erkannt und daraufhin die Abgasaufbereitung so umgestellt, dass wenig Stickoxide (NOx) entstehen. Sobald der Wagen jedoch wieder im Alltag über die Straße rollt, wird die Abgaskontrollanlage teilweise außer Betrieb gesetzt, so dass die NOx-Emissionen erheblich höher sind. Clever getrickst – bis es auffiel.
Entwickelt wurde die illegale Software übrigens dem Augenschein nach von Bosch, und zwar bereits im Jahr 2007. Allerdings schien Bosch wohl von Anfang an gegenüber VW klargestellt zu haben, dass der Einsatz der zu Testzwecken bereitgestellten Software gesetzeswidrig war.34 Doch VW blieb keineswegs allein. Um nur ein weiteres Beispiel zu nennen: Im Mai 2017 wurde bekannt, dass beim Modell Fiat 500X die rechtlich festgeschriebene Dauer des Prüfzyklus von 20 Minuten schamlos ausgenutzt wurde. Nach genau 22 Minuten schaltete eine einprogrammierte Abschaltvorrichtung die Filtersysteme ab.35
Sehr umfangreiche Untersuchungen des Emissions-KontrolleInstitut (EKI) der – allerdingst äußerst umstrittenen – Deutschen Umwelthilfe (DUH) kamen zu dem Ergebnis, dass keineswegs nur ältere Dieselfahrzeuge der Euro-5-Norm oder noch älter die Grenzwerte überschritten, sondern auch die überwiegende Mehrzahl der seit 2015 ausgelieferten Euro-6-Modelle weit jenseits der gesetzlichen Grenzwerte lag. Demnach hielten nicht einmal neun Prozent der seitdem zugelassenen Euro-6-Diesel im realen Fahrbetrieb den geltenden NOx-Grenzwert von 80 Milligramm pro Kilometer ein. Im Durchschnitt der vom EKI 1.200 getesteten Fahrzeuge wurde dieser Wert um das 5,5-fache überschritten. 36 Nochmals: Die Wagen stießen nicht doppelt oder dreimal soviel Dreck aus wie angegeben, sondern über fünfmal mehr. Schon eine Untersuchung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) aus dem Jahr 2014 kam zu dem Ergebnis, dass keines der getesteten Fahrzeuge dreier Hersteller außerhalb des Teststands die Euro-6-Grenzwerte einhielt; getestet wurden die Modelle Volkswagen CC 2.0 TD, BWM 320d und Mazda 6.2.2 Skyactiv-D. 37 Im Juni 2018 wurde bekannt, dass das Kraftfahrtbundesamt (KBA) bei Daimler insgesamt fünf illegale Abschalteinrichtungen entdeckt hatte. Betroffen waren offenbar rund eine Million Dieselfahrzeuge, der Großteil davon Euro-6-Diesel. Der Konzern mit dem Stern legte daraufhin eine Liste betroffener Fahrzeuge vor, die für Erstaunen sorgte. Einerseits standen Modelle auf der Liste, die des Amt noch gar nicht angemahnt hatte, andererseits fehlten vom Amt bereits monierte Modelle. Doch Daimler kam es dabei augenscheinlich gar nicht auf solche Details an. Vielmehr wollte der Konzern einen „Deal“ aushandeln und erklärte, man „wolle die Rückrufe beim Vita und den anderen gemeldeten Modelle nur akzeptieren …, wenn im Gegenzug das KBA das Unternehmen nicht weiter mit Prüfungen behelligt“. Es war offenbar der Versuch, eine Art „Amnestie“ herauszuhandeln: Ein letztes Softwareupdate, dann werden alle Ermittlungen eingestellt. Doch der gesamte Skandal war zwischenzeitlich zu stark in der Öffentlichkeit präsent, als dass ein solcher Hinterzimmerdeal noch ernsthafte Chance hatte, durchzukommen.