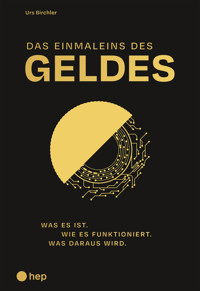
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen. "Von Geld verstehe ich nichts", sagen viele – zum Teil noch stolz. Sie übersehen: Geld und Geldpolitik betreffen uns alle. Ob wir uns die Miete oder die Hypothek noch leisten können, liegt an Entscheidungen, die hinter massiven Eichentüren in den Sitzungszimmern der Notenbanken getroffen werden. Das Einmaleins des Geldes erklärt verständlich und wissenschaftlich fundiert, was Geld ist und was die Geldpolitik für uns bedeutet. Wir begegnen einem König mit roter Nase, plombierten Schweizern und einem bösen Millionär. Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Lehrkräfte im Wirtschaftsunterricht, Medienschaffende und alle, die sich im Geldwesen nichts mehr vormachen lassen wollen, werden das Buch mit Gewinn – ja, mit Genuss – lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Urs Birchler
Des Einmaleins des Geldes
Was es ist. Wie es funktioniert. Was daraus wird.
ISBN Print: 978-3-0355-2318-8
ISBN E-Book: 978-3-0355-2319-5
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten
© 2023 hep Verlag AG, Bern
hep-verlag.com
Inhaltverzeichnis
Vorwort
Einleitung: Was geht mich das an?
TEIL I | WAS ES IST
Kapitel 1: Was ist Geld?
Kapitel 2: Wie viel braucht es?
Kapitel 3: Geld-Katastrophen
Kapitel 4: Die drei Geldarten
Kapitel 5: Silber, Gold, Papier – Verwandlungen des Schweizer Frankens
TEIL II | WIE ES FUNKTIONIERT
Kapitel 6: Geld und Staat
Kapitel 7: Das Geld der Gegenwart – eine Schorle
Kapitel 8: Geld und Wirtschaft
Kapitel 9: Wie funktioniert Geldpolitik?
Kapitel 10: Geldpolitik und Fiskalpolitik
Kapitel 11: Stirbt Bargeld?
TEIL III | WOHIN ES GEHT
Kapitel 12: Digitale Zukunft
Kapitel 13: Das entscheidende Experiment?
Kapitel 14: Das ideale Geld?
Anhang
Ausblick
Literatur
Autor
Vorwort
Albert Einsteins Gehirn wurde nach seinem Tod gestohlen und untersucht. Auch die Gehirne des Mathematikers Carl Friedrich Gauss und vieler anderer Genies wurden von der Nachwelt seziert – ohne nennenswerte Erkenntnisse. Diese Art Forschung wird heute nicht mehr praktiziert, und ich würde wohl auch nicht ihr Interesse wecken, wenn es sie noch gäbe. Trotzdem denke ich, dass es in meinen Hirnwindungen, wenn diese Methode funktionierte, vielleicht etwas Brauchbares zu entdecken gäbe: Gedankenablagerungen zum Thema Geld.
Im Rückblick, nach vielen Jahren Berufstätigkeit unter anderem in der Direktion der Schweizerischen Nationalbank, erkenne ich, dass ich wohl deutlich mehr an Geld gedacht habe als andere. Der erste Kontakt mit Geld war romantisch: das Feriengefühl, das sich schon vor der Grenze einstellte, wenn ich italienische Lira-Münzen betrachtete. Später wurde es nüchterner: Ein vom Bett aus mitgehörtes Gespräch der Eltern über Geldsorgen inspirierte mich zur nächtlichen Frage, ob mein Sparbatzen, zusammengelegt mit dem der Eltern, mehr Zins abwerfen würde als beide allein. (Nein, leider nicht.) Familie und Freunde erzählten, dass ich beim Monopoly-Spiel offenbar ziemlich früh schon ein unangenehmer Gegner war. Noch mehr Glück als beim Spiel hatte ich, als ich nach dem Wirtschaftsstudium eine Stelle bei der Schweizerischen Nationalbank fand und nach einem Vierteljahrhundert Geldpolitik an die Universität Zürich berufen wurde.
Im Laufe der Jahre unterrichtete ich an mehreren Universitäten – auch an der Kinderuniversität und der Seniorenuniversität – und hielt viele Vorträge. Dabei stellte ich oftmals fest: Die Zuhörer und Zuhörerinnen sind aus individuell ganz verschiedenen Gründen sehr interessiert am Thema Geld. Und sie sind äusserst dankbar, wenn ein vermeintlich komplizierter Sachverhalt verständlich dargestellt wird. Diese Dankbarkeit war mir stets der schönste Lohn. Und sie war der Ansporn dazu, dieses Buch zu schreiben.
Das Buch wäre aber nicht entstanden ohne eine gute Portion Selbstüberschätzung. Anfangs glaubte ich, ich müsste das Buch schreiben, weil ich vom Geld etwas verstünde. Es ist aber umgekehrt: Heute glaube ich, vom Geld vielleicht etwas begriffen zu haben, weil ich das Buch geschrieben habe. Ich bilde mir auch ein, es sei eine gute Idee, das Buch zu lesen. Die noch bessere wäre: selber eines zu schreiben.
Dieses Buch ist ohne finanzielle Hilfe durch Dritte entstanden.
Verschiedenen Personen bin ich zu Dank verpflichtet für Anregungen, guten Rat, Ermunterung und kompromisslose Kritik. Ich danke (und ich weiss, es geht immer jemand vergessen) – in alphabetischer Reihenfolge – Sebastian Bott, Carl-Christoph Hedrich, René Hegglin, Sabine Kilgus, Staschia Moser, Inke Nyborg, Daniel Stöckli, Tobias Straumann, Meri Torniamainen, Stefan Wottreng und Nikolaus Wyss. Ein besonderer Dank geht an Jürg Conzett und sein Zürcher Money Museum, dort auch an Heidi Lehner.
Beim hep-Verlag hat mich Stephan Schori mit ungedecktem Anfangsvertrauen aufgenommen, und Christian de Simoni hat mich in vorbildlicher Weise begleitet und mit seinem Team unterstützt.
Meine Familie stand mir stets zur Seite. Sarah und Katharina lieferten bereitwillig zu jeder Tages- und Nachtzeit Zweitmeinungen zur Grafik; Peter und Eugen haben mir erlaubt, verschiedene Episoden aus ihrer Jugend als Beispiele zu verwenden. Zudem haben sie in unserem Haus ein intellektuelles Klima geschaffen, in dem Gedanken keimen und wachsen können. Meine Frau, Monika Bütler, war mir während der Arbeit am Buch nicht nur eine mehr als geduldige Partnerin; als Lektorin hat sie mich mit ihrem ökonomischen Weit- und Scharfblick vor mancher Peinlichkeit gerettet. Einen letzten Dank erwarten die Katzen unseres Quartiers, die mit ungewohnter Grosszügigkeit ihre Namen für meine Theoriebeispiele zur Verfügung gestellt haben.
Urs BirchlerJuli 2023
Einleitung: Was geht mich das an?
1973 gab es einen Staatsstreich in der Schweiz. Davon haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Kein Wunder: Was an jenem 23. Januar eher unfreiwillig und vermeintlich provisorisch geschah, nahm damals auch kaum jemand als Staatsstreich wahr.
Putschistin contre coeur war die Schweizerische Nationalbank. Nach kurzer telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Bundesrat teilt sie den Banken um 08.30 Uhr mit, dass sie «heute darauf verzichtet, ihre Interventionen am Dollarmarkt aufzunehmen. Sie wird sich vom Markte fernhalten, bis eine Beruhigung eingetreten ist». Die Nationalbank verkündete also, dass sie den Kurs des amerikanischen Dollars vorläufig nicht weiter durch Dollarkäufe stützen würde.
Damit verabschiedete sie sich als erste Notenbank einstweilen aus der renommierten internationalen Währungsordnung der Nachkriegszeit, der Währungsordnung von Bretton Woods. Durch den Ausstieg konnte sie den Ankauf weiterer Dollarmillionen und eine massive Inflation gerade noch knapp verhindern. Die anderen europäischen Notenbanken folgten kurz darauf. Damit begann im Januar 1973 das Zeitalter der flexiblen Wechselkurse. Die Herrschaft über den Schweizer Franken ging vom Bundesrat, der bis dahin die Parität des Frankens zum Gold fixiert hatte, zur Nationalbank über. Und diese gewann dadurch – erstmals seit ihrer Gründung im Jahre 1907 – die Kontrolle über die schweizerische Geldmenge. Sie erhielt die Verantwortung für die Preisstabilität, das heisst: auch für Deflation oder Inflation. Zwar war das kein Staatsstreich im eigentlichen Sinne, aber es führte zur grössten Verschiebung von Macht und Verantwortlichkeit innerhalb der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg.
Aus vorläufig wurde ein Dauerzustand. Somit beginnt im Januar 1973 das Zeitalter der unabhängigen Notenbanken. Rund vierzig Jahre später, im Juli 2012, kündigt der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, an, alles zu tun, um den Euro zu retten. Mit diesem «all in» unterzieht er die 1973 gewonnene Macht der Notenbanken einem historischen Experiment: Lässt sich mit der Kontrolle des Geldes die Wirtschaft stabilisieren und gegen Krisen schützen? Oder führt der Versuch früher oder später zu einer massiven Inflation, weil die Notenbank bei jeder Krise tonnenweise neues Geld in Umlauf bringt und dadurch das Geld an Wert verliert?
Wenn das Experiment erfolgreich ist, spricht das deutlich für eine staatlich-demokratische Lenkung des Geldes. Wenn das Experiment hingegen scheitern sollte, würde das die Herrschaft staatlicher Notenbanken über das Geld diskreditieren. Was dann? Müssten wir zurück zu einer Goldwährung? Findet sich im Heuhaufen der 22 000 verschiedenen Krypto-Einheiten eine goldene Nadel als Alternative? Wird uns künstliche Intelligenz vom Geld befreien? Oder müssen wir dennoch, trotz seiner Unvollkommenheit, weiter mit staatlichem Geld leben?
Solche Fragen stellen sich in der direkten Demokratie der Schweiz allen Stimmberechtigten. Die Beispiele Freigeldinitiative (1954), Goldinitiative (2014), Vollgeldinitiative (2018), Bargeldinitiative (2023) und die verschiedenen Verfassungsänderungen auf dem Gebiet des Geldes zeigen, dass das Volk die Leitplanken des Geldwesens mitbestimmt und mitbestimmen will.
Dennoch fehlt es in der Schweiz, oder im deutschen Sprachraum allgemein, an einer verständlichen, aber wissenschaftlich fundierten Einführung ins Geldwesen – für Stimmberechtigte, Schulen und Medienschaffende. Das vorliegende Buch versucht, diese Lücke zu schliessen. Fünfzig Jahre nach dem Staatsstreich ist es dafür vielleicht nicht zu früh.
Denn, kurz bevor das Buch fertig war, folgte ein erneuter Staatsstreich: Der Bundesrat verkündete Notrecht, um die Rettung der Grossbank Credit Suisse durch die noch grössere UBS zu ermöglichen. Unter dem Schirm des Notrechts musste die Nationalbank Liquiditätshilfe versprechen ohne die vom Gesetz geforderte Deckung. Die 1973 errungene Unabhängigkeit der Nationalbank wurde dadurch arg strapaziert. Und sie bleibt eingeschränkt: Bund und Nationalbank bleiben gefangen in einer stillschweigenden Garantieverpflichtung gegenüber dem aus UBS und CS entstandenen Gebilde. Fünfzig Jahre nach der Befreiung vom Joch des Dollars endet der Schweizer Franken unter dem Joch künftiger Bankenkrisen. Und wie damals: unfreiwillig und vermeintlich provisorisch.
TEIL I | WAS ES IST
KAPITEL 1
WAS IST GELD?
TEIL I | WAS ES IST
Kapitel 1: Was ist Geld?
Das weisst Du doch!
«Papa! Was ist Geld?» ...
«Was ist Geld, Paul? Gold, Silber und Kupfer, Guineas,
Schillinge, Halb-Pennies. Das weisst du doch?»
«Oh ja, schon», sagte Paul, «ich meine nicht das. Ich meine,
was ist Geld eigentlich?»
Charles Dickens, Dombey & Sons, Ch. 8 (1848)
Klar, dass Paul mit der Antwort nicht zufrieden war, denn was Geld ist, erfuhr er von seinem Vater nicht, sondern nur, woraus es gemacht ist oder in welchen Einheiten es vorkommt. Auch Sprichwörter wie «Geld verdirbt den Charakter» oder «Geld ist die beste Magd, aber die schlechteste Herrin» (Francis Bacon, 17. Jahrhundert) hätten ihm kaum weitergeholfen, da sie bloss davor warnen, es zu wichtig zu nehmen. Im Jahr 1905, da wäre Paul vielleicht selbst schon Urgrossvater gewesen, erschien erstmals ein Buch, das näher auf seine damalige Frage einging. Es trug den Titel Philosophie des Geldes (Georg Simmel) und verfolgte das Ziel, Geld zu verstehen. Dort hätte Paul den Satz gefunden: «Das Geld ist die Spinne, die das gesellschaftliche Netz webt.» Ob ihm das weitergeholfen hätte?
In diesem Buch versuchen wir, Paul eine Antwort «auf Augenhöhe» zu geben. Vorab müssen wir ein häufiges Missverständnis klären: Geld ist nicht dasselbe wie Reichtum. Die Geschichte The Million Pound Bank Note funktioniert genau wegen dieser Verwechslung. «Jemand hat Geld» meint, die Person ist reich, hat Häuser, Aktien, Gold, aber sie hat nicht unbedingt Geld im Portemonnaie.
The Million Pound Bank Note
1893 veröffentlicht Mark Twain eine Kurzgeschichte unter dem Titel The Million Pound Bank Note. Zwei ältere exzentrische Brüder wetten, ob man mit einer Million-Pfund-Note einen Monat lang gratis leben könne. Sie finden einen ehrlichen, aber mittellosen jungen Mann namens Henry, dem sie eine solche Note, ausgestellt von der Bank of England, in einem Briefumschlag zustecken, ohne mehr dazu zu verraten. Zunächst läuft alles gut. Henry muss nie bezahlen. Im Restaurant nicht, weil kein Herausgeld für eine Million vorhanden ist. Im Kleidergeschäft nicht, weil der Inhaber Geld mit Reichtum verwechselt und Henry als Kunden behalten will. Bald gerät Henry in einen Strudel der Ereignisse: Er verliert die Note, gewinnt die grosse Liebe, und kann die Note am Ende doch noch zurückbringen. Und alles ist bezahlt – allein mit der Ausstrahlung der Note.
Heute würde Paul nicht seinen Vater fragen, sondern zum Beispiel ChatGPT, ein Netzwerk künstlicher Intelligenz. Auf die Frage «Was ist Geld?» antwortete dieses (am 2.1.2023):
Geld ist eine Art von Tauschmittel, das von Menschen verwendet wird, um Waren und Dienstleistungen auszutauschen.
Das Honorar
Der englische Ökonom William Stanley Jevons beschrieb 1889 die Erfahrung einer französischen Opernsängerin, Mademoiselle Zélie, auf einer Konzerttour auf den Gesellschaftsinseln in Französisch-Polynesien. Mademoiselle Zélie trat auf für ihr übliches Honorar von einem Drittel der Einnahmen. Sie erhielt drei Schweine, 23 Truthähne, 44 Hühner, 5000 Kokosnüsse und beträchtliche Mengen Bananen, Zitronen und Orangen. In Paris, rechnet Jevons aus, wäre dies ein gutes Honorar gewesen. So aber musste sie, da sie die Einnahmen nicht selber alle essen konnte, zunächst einmal mit den Früchten die Tiere durchfüttern.
W. Stanley Jevons, Money and the mechanism of Exchange, 1889
Ohne Geld als Tauschmittel funktioniert kaum die primitivste Wirtschaft. Es gäbe ohne Geld kaum Handel, daher keine Arbeitsteilung und damit auch nur wenige spezialisierten Berufe. Ärztin, Fussballstar, Buchhalter, Influencerin – sie alle können ihren Beruf nur ausführen, weil es Geld gibt. Geld entstand deshalb an vielen Orten, so wie das Rad, Waffen und Häuser. Niemand hat es erfunden, es war einfach immer da.
Geld als Brücke zwischen Generationen
Selbst in einer Wirtschaft ohne Arbeitsteilung kann Geld eine wichtige Rolle spielen. Das zeigt folgendes Gedankenexperiment.
Auf einer Insel leben zwei Generationen, Alte und Junge. Die Jungen können fischen; die Alten sind dafür zu alt und haben kein Einkommen mehr. Falls die Jungen nicht freiwillig teilen, leiden die Alten Hunger. Deshalb suchen die Alten seltene glänzende Steine. Sie bieten den Jungen Stein gegen Fisch. «Was sollen wir mit Steinen?», fragen die Jungen. «Sie sind ja hübsch, aber essen können wir sie nicht?» «Wenn ihr selber einmal alt seid, könnt ihr die Steine den künftigen Jungen geben», antworten die Alten. «Dann werdet auch ihr Fisch bekommen.» Den Jungen leuchtet dies ein: Besser heute etwas abgeben, als sich jetzt vollfressen und im Alter verhungern. Das erklären wir dann unseren Jungen ebenso ...
So entsteht dank Steingeld eine Kette über die Generationen hinweg. Dank der Steine können die Generationen miteinander Handel treiben und Altersarmut vermeiden. Die als Geld verwendeten Steine funktionieren als Altersvorsorge, ähnlich wie unsere AHV. Interessant: Die Steine verbessern das Leben der Inselbewohner, obwohl sie für sich genommen völlig nutzlos sind. An sich wertloses Geld kann also den Wohlstand einer Gesellschaft erhöhen.
Was ist Geld eigentlich?
Paul wäre mit dem bisher Gesagten wohl noch immer nicht ganz zufrieden. Denn er will wissen, was Geld, das allgemeine Zahlungsmittel, eigentlich [«after all»] ist. Was steckt hinter einer Münze? Woher wissen wir oder warum glauben wir, dass eine Münze, ein Stück Papier oder sogar ein elektronischer Eintrag Geld ist? Und woher kommt deren Wert?
Steinreich
Den Weltrekord für das unpraktischste Geld hält die Insel Yap, östlich der Philippinen am südlichen Ende des Marianengrabens. Yap ist berühmt für eine der eigentümlichsten Geldarten der Welt – Steingeld. Steinräder, zum Teil mit Durchmessern von über zwei Metern, in der Mitte ein Loch, damit sie an einer Holzstange getragen werden können (notwendig sind dazu allerdings bis zu 20 Männer).
© Public Domain
Das Verrückteste: Die Steine stammen nicht von Yap selbst, sondern wurden auf Flössen von der Nachbarinsel Palau nach Yap gebracht [siehe folgendes Bild], über eine Distanz von immerhin 450 km (das entspricht ungefähr der Strecke Genua–Barcelona). Dieser aufwendige Transport sicherte die Knappheit der Steine und damit ihren Wert.
© Public Domain
Anstatt auf seine Guineas und Schillinge zu verweisen, hätte Pauls Vater seinen Sohn auf eine Reise mitnehmen können mit Ziel Südsee-Insel Yap. Dort hätte er wörtlich steinreiche Menschen gefunden. Auf Yap bestand Geld nämlich aus Steinrädern, teils kleinen, teils grossen, die grössten sind aufgestellt höher als ein Mensch. Steingeld ist aber auch eine einzige Mühsal, da es sich kaum transportieren lässt und es sehr viel Platz benötitgt. Aber gerade weil es so unpraktisch ist, ist das Steingeld von Yap lehrreich. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Insel hätten Paul eine Geschichte erzählt, die die Antwort auf seine Frage enthält, was Geld «eigentlich» sei – die Geschichte vom versunkenen Stein [siehe Kasten].
Der versunkene Stein
Auf dem Transport von Palau nach Yap soll einst ein besonders schöner Stein im Sturm vom Floss gerutscht und in den Tiefen des Ozeans versunken sein. Die Beteiligten einigten sich aber rasch auf Folgendes:
1. Wir alle wissen, wo der Stein liegt.
2. Wir sind uns einig, wem der Stein gehört.
3. Den Eigentümer trifft keine Schuld am Untergang.
Folglich:
Der Stein kann weiterhin zum Zahlen verwendet werden. Später kamen Europäer auf die Insel und verlangten von den Einwohnern Hilfe beim Strassenbau. Als sich diese weigerten, beschlagnahmten die Besetzer die Steine: Sie pinselten mit schwarzer Farbe die Initialen B. A. (= Bezirksamt) drauf. Die Einwohner, die sich unter einem Bezirksamt wohl wenig vorstellen konnten, bauten daraufhin die Strassen, worauf die Besetzer die Zeichen wieder entfernten. Das Geld war gerettet.
Die Behandlung des versunkenen Steins durch die Bewohner zeigt: Zum Nachweis des Eigentums muss ein Stein nicht vor dem Haus des Eigentümers stehen. An die Stelle des physischen Besitzes trat die Erzähltradition des Dorfes: Alle wussten, wo der Stein war und wem er aktuell gehörte. Diese Information war im kollektiven Gedächtnis des Dorfes gespeichert, in der Sprache der Kryptowährungen auf der dörflichen Blockchain.
Mit der Zeit wurden die Steine, gerade die schwereren, bei einem Besitzerwechsel immer seltener physisch transportiert, sondern nur noch virtuell, d. h. mündlich, im Dorfgedächtnis, übertragen. Mit der Schaffung virtuellen Geldes ist den Einwohnern auf Yap eine grossartige Entdeckung gelungen: Geld kommt von gelten. Das Geld kommt also aus den Köpfen der Beteiligten, denen es als Geld gilt. Die Steine sind Geld, weil alle glauben, dass sie Geld sind. Genauer: Weil alle glauben, dass alle andern glauben, … Oder ganz genau: Weil alle glauben, dass alle andern glauben, dass alle andern glauben, dass ... (etc. bis unendlich) ein Stein allen als Zahlungsmittel gilt. Die gesellschaftliche Konvention «Geld» hängt also an einer endlosen Kette des Vertrauens. Dieses Vertrauen oder, wenn man so will: diese Kollektivillusion macht das Geld zu Geld. Das ist, was Geld – mit dem Wort des jungen Paul – «eigentlich» ist.
Wozu der Stoff?
Pauls Vater kannte Geld als Gold, Silber oder Kupfer. Steine? Das hätte ihn verwirrt. Geld muss doch wertvoll sein?! Muss es offenbar nicht, könnte Paul nun mit Hinweis auf die Yap-Steine entgegnen. Diese sind für sich genommen wertlos; sie stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern von Yap gar im Weg. Und sie sind dabei noch nicht mal eine Ausnahme: Auch Schneckenhäuser, Vogelfedern, zerschnittene Spielkarten haben schon als Geld gedient; und unsere Papiernoten und Bankguthaben sind kaum wertvoller.
Nicht der Stoffwert macht also das Geld aus, sondern der kollektive Glaube daran, dass es wertvoll ist. Trotzdem spielt das Material eine Rolle. Eine Geldsubstanz eignet sich nur dann als Geld, wenn es nicht beliebig viel davon gibt. Entscheidend ist, dass die Gewinnung des Geldes etwas kostet. Gold muss gesucht, ausgegraben und geschmolzen, Steingeld von weither transportiert werden. Bitcoin verzehrt Strom und Rechenleistung. Banknoten darf nicht jedermann drucken. Die Knappheit garantiert also den Wert des Geldes und sichert das allgemeine Vertrauen ins Geld. Aber – um es zu wiederholen – ob das Material selbst wertvoll oder wertlos ist, ist Nebensache.
Der Stoff hat allerdings noch eine weitere Funktion: Er macht das Geld haltbar. Niemand verwendet Erdbeeren als Zahlungsmittel. Ein Zahlungsmittel sollte bei der Übertragung keinen Schaden nehmen. Deshalb sind Geldmaterialien gewöhnlich längere Zeit haltbar.
Das Steingeld von Yap weist damit alle drei notwendigen Eigenschaften des Geldmaterials auf: Es ist knapp (infolge der Kosten für den Transport aus Palau), haltbar (aus Stein) und übertragbar (dank dem Loch in der Mitte).
Falschgeld: echter als das echte?
Nicht wenige Ökonomen, eingeschlossen Karl Marx, haben die irreführende «metallistische» Sicht des Geldes vertreten, die Meinung, es sei der Stoff, der das Geld ausmache. Am schönsten aber erscheint sie beim Schweizer Schriftsteller Jean-Ferdinand Ramuz, der dem Walliser Münzfälscher Farinet ein Denkmal setzte:
«Ja», fährt Fontana fort, «denn das sage ich euch, sein Gold ist besser als das Gold der Regierung. Und ich sage, er hat das Recht, falsches Geld zu machen, wenn es echter ist als das echte. Was macht den Wert der Münzen aus – die Bilder, die drauf sind?, die Frauenzimmer, die nackten Weiber, oder die angezogenen, oder die Kronen, die Wappen? Oder vielleicht die Inschriften? Oder etwa die Zahlen», sagte er, «die Zahlen, die von der Regierung draufgetan werden? Wer kümmert sich um die Inschriften? Niemand, und um die Zahlen auch niemand. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Regierung euch den Wert und das Gewicht falsch angäbe, genauso wie irgendein Privater. Fragt nur die Leute, die sich auskennen. Die Regierung sagt euch: ‹Dieses Stück hat so viel gegolten; nun, von jetzt an gilt es so viel …› Das ist vorgekommen, das kann wieder vorkommen. Da ist Farinet anständiger als die Regierungen, ihm zahlt man das, was an dem Geld dran ist, ihnen zahlt man, was draufsteht …»
Ramuz, Charles Ferdinand: Farinet ou la fausse monnaie (1932).
Deutsch: Farinet oder das falsche Geld, Limmat Verlag.
Mit dem Buch von Farinet verbindet mich ein Schreckmoment. Ich wollte vor vielen Jahren in Paris auf dem Weg zum Flughafen auf dem Markt noch ein Stück Gigot kaufen. Die Verkäuferin wies meine 100er-Note (damals noch Französische Francs) zurück: «C’est faux, ce billet !» Gefälscht? Unmöglich, die habe ich doch von der Bank! «C’est faux, monsieur, ça ne brille pas !» Tatsächlich: Unter der unter dem Ladentisch versteckten UV-Lampe leuchtete nichts, vor allem nicht die kleinen Fäserchen, die als Echtheitszeichen hätten blau leuchten müssen. Was jetzt? Wenn sie die Polizei ruft? Bei dem Gedanken fiel mir das Herz in die Hose: In meiner Manteltasche steckte ein Buch: Ramuz, Farinet ou la fausse monnaie. Eine Falschmünzer-Geschichte! Ich sah mich bereits auf dem Polizeiposten statt auf meinem Flug. Ich fand eiligst eine andere Banknote, verschwand mit meinem Einkauf im abendlichen Getümmel und brachte die falsche Note daheim zur Bank (wo sie sich als echt, aber gewaschen erwies).
Was kann Geld?
Als Paul merkt, dass sein Vater nicht recht sagen kann, was Geld eigentlich ist, versucht er es mit einfacheren Fragen:
«Ich meine, Papa, wozu ist es gut, das Geld?»
«Das wirst du besser verstehen, nach und nach, Paul. Geld kann alles.»
«Es kann wirklich alles?»
«Ja, Paul, alles.»
«Warum hat es dann meine Mama nicht retten können?»
Der Vater blamiert sich. Zu Recht: Seine Antwort ist um 180 Grad verkehrt. Geld kann nicht alles. Es kann – eigentlich – nur genau etwas. Das aber kann es gut. Geld, so sagten wir bereits, ist ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel. Aber was bedeutet das? Ein Zahlungsmittel ist ein Transportmittel für Wert. Der Esel bringt das Korn vom Bauern zur Müllerin – im Gegenzug bringt Geld den Wert des Korns von der Müllerin zum Bauern. In den Yap-Steinen ist es das Loch, das macht, dass Geld etwas kann. Das Geld transportiert Wert. Das kann es. Und eigentlich nur das.
Doch das ist nicht wenig. Das Geld hält die Wirtschaft überhaupt erst am Laufen. Es transportiert in der Gegenrichtung der Gütertransporte deren Werte. Während aber die Lastwagen mit ihren Gütern auffallen, läuft das Geld still im Hintergrund um. Doch wehe, es zirkuliert nicht. Dann bleiben auch die Lastwagen stecken. Darum sind die Kosten des Zahlungssystems und der Geldhaltung wichtig. Sind sie tief, ist Geld das Öl im Getriebe der Wirtschaft; sind sie hoch, wird Geld zum Sand im Getriebe [Kap. 3].
Wenn Geld mobil wird
Dank der Verbreitung des Mobiltelefons in ärmeren Ländern können heute Millionen Menschen einander direkt Geld zusenden, auch ohne Bankkonti zu benutzen. Seit 2010 sind zahlreiche Plattformen entstanden, die billige Zahlungsdienste anbieten, wie M-Pesa (Kenia), mKesh (Mosambik), bKash (Bangladesch), Airtel (Uganda, Malawi, Niger) und andere. Die Bill & Belinda Gates Foundation hat die Auswirkungen des «mobile money» untersucht. Sie stellt in den untersuchten Gebieten einen Rückgang der Armut um 40 Prozent fest, einen um rund 8 Prozent höheren Konsum und eine bessere Widerstandsfähigkeit der Konsumausgaben nach Naturkatastrophen. Ein Teil der Verbesserung liegt an den höheren Geldzusendungen aus dem Ausland. Interessant: Mobiles Bezahlen und höhere Zusendungen aus dem Ausland fördern ihrerseits die Migration.
El clásico: Real gegen Nominal
Geld transportiert Wert. Aber wie viel? Wenn bei einem Lastwagen draufsteht «30 Tonnen», weiss man, wie viel er transportieren kann. Wenn auf einer Banknote steht «1 000 000 Bolivares», wissen wir ohne Zusatzinformation nicht, wie viel Wert sie transportieren kann. Den Wert eines Hauses? Eines Pakets Kaugummi? Wir brauchen also ein Mass für die Kapazität des Geldes, für seine Kaufkraft.
Wenn wir als Kinder beim Sammeln von Altpapier ein paar Franken verdienten, dann interessierte uns nur eines: Wie viele Gummikrokodile bekommen wir in der Bäckerei dafür? (Historisch genau: Es handelte sich um Marshmallow-Krokodile.) Damals gab es für einen Franken vielleicht zweieinhalb Gummikrokodile. Die Kaufkraft des Frankens betrug also – in unserem Wertindex – 2,5 Gummikrokodile. Wir dachten uns den Franken deshalb wie auf der folgenden Abbildung. Auf seiner Vorderseite ist der Nominalwert abgebildet. Die Rückseite zeigt die Kaufkraft, den sogenannten Realwert eines Frankens.
Später kamen die Beatles, und wir verwendeten als Wertmass nicht mehr Gummikrokodile, sondern Schallplatten. Das Preisniveau ist also der Preis eines je nach Konsuminteresse ausgewählten Referenzgutes. Heute gilt als offizielles Referenzgut der für Durchschnitts-Schweizer typische Einkaufskorb [folgender Kasten] – sozusagen das nationale Gummikrokodil. Dessen Preis, der sogenannte Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), gilt als das Mass des Preisniveaus und der Kaufkraft des Frankens.
Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) Warenkorb und Gewichte, 2022
Zurück zur Kaufkraft des Geldes. Diese bemisst sich nicht am Nominalwert, sondern am Realwert. Wenn plötzlich alles noch die Hälfte kostet, hat sich der Realwert des Geldes verdoppelt. Die Transportleistung einer 1-Franken-Münze ist doppelt so gross geworden. Wenn Geld doppelt so viel wert ist, ist auch seine Transportkapazität verdoppelt. Anders ist es beim Esel. Wenn der Wert eines Esels steigt, trägt und frisst dieser trotzdem immer noch gleich viel. Deshalb spricht niemand von einem nominellen und einem realen Esel. Beim Geld aber gibt es diese Unterscheidung.
Im Geldwesen ist die Unterscheidung nominell–real matchentscheidend. Sie ist vor allem dann wichtig, wenn man die Wirkungen des Geldes auf die Wirtschaft beschreiben will. Wer eine Lohnerhöhung bekommt, sollte zuerst nachschauen, ob sie real ist oder nur nominell. Ist sie nur nominell, gibt es kein neues Sofa; ist sie real, dann vielleicht schon. Deshalb wirkt eine reale Änderung der im Umlauf befindlichen Geldmenge anders als eine bloss nominelle, d. h. eine, die von Preiserhöhungen gleich wieder aufgefressen wird. Auch für Individuen ist die Unterscheidung wichtig: Wer den Nominalwert für bare Münze nimmt, leidet unter der sogenannten Geldillusion und trifft Fehlentscheide. Im Rest dieses Buches unterscheiden wir deshalb immer streng zwischen nominell und real.
Die Miete des Geldes: der Zins
Geld kann man kaufen. Unsere Bäckerin kaufte unser Geld mit Gummikrokodilen, immer 2,5 davon pro Franken. Geld kann man auch mieten. Ich brauche heute 120 Franken. Jemand bietet mir an: Du kannst die 120 Franken haben, musst mir aber in einem Jahr 126 Franken zurückgeben. Nehmen wir an, ich bin einverstanden; mit dem Geld will ich Lehrbücher kaufen, die werfen pro Jahr mehr als 126 Franken ab. Der Aufschlag von 6 Franken, den ich auf die geborgte Summe von 120 Franken zahle, ist der Zins. Der Zinssatz, der Aufschlag in Prozenten, beträgt 5 Prozent.
Der Zins drückt auch den Preis von gegenwärtigem Geld (120 Franken) in zukünftigem Geld (126 Franken) aus. Der Zins ist in der Wirtschaft, was die Perspektive in der Fotografie: Entferntere Objekte erscheinen bei positivem Zinssatz kleiner als nähere. Bei einem Zinssatz von 5 Prozent sind 250 Franken, die ich in zwanzig Jahren bekomme, gleich viel wert wie 100 Franken jetzt sofort. Je höher der Zinssatz, desto kleiner erscheint die Zukunft. Der Zinssatz ist also gewissermassen das Zoom des Geldes: Man kann künftiges Geld grösser, das heisst wertvoller, oder kleiner erscheinen lassen, indem man einen tieferen oder höheren Zinssatz anlegt.
Der Zins war oder ist in den monotheistischen Religionen verpönt, zum Teil sogar verboten. Geld kriegt keine Kinder; oder Geld ist ein Preis für die Zeit, diese gehört aber Gott – so lauteten die Begründungen. Die mittelalterlichen Banquiers erfanden deshalb Tricks, um den Zins zu verstecken. Zum Beispiel: Ich kaufe bei der Bäckerin im Voraus Gummikrokodile. Für drei Stück, die ich in einem Jahr bekommen werde, zahle ich heute einen Franken. Das bedeutet: Ich gebe der Bäckerin einen Kredit von einem Franken zu einem jährlichen Zins im Betrag eines halben Krokodils. Bezogen auf den gegenwärtigen Preis (den sogenannten Spot-Preis) von zweieinhalb Krokodilen beträgt der Zinssatz also ein Fünftel, d. h. 20 Prozent. Das ist wahrlich ein Wucherzins, aber er ist versteckt. Zudem trage ich ein Risiko: Der Preis der Gummikrokodile könnte in einem Jahr tiefer oder höher sein. Mein voraussichtlicher Gewinn ist also gar kein echter Zins. Denn niemand weiss, dass ich die drei künftigen Krokodile bereits auf Termin in einem Jahr wieder an die Bäckerin verkauft und damit den Zins gesichert habe. Ein solches Geschäft – die Kombination eines Spot- und eines Termingeschäfts – nennt man einen Swap, einen Gummikrokodil-Franken-Swap im vorliegenden Beispiel. Kompliziert? Hoffentlich! Der Swap muss ja den Zins vor den Zinswächtern verstecken.
Der Zins kann auch einfach als die Miete des Geldes gesehen werden. Geld hat also einen Kaufpreis und einen Mietpreis. Der Kaufpreis sind die zweieinhalb Gummikrokodile pro Franken; der Mietpreis sind 5 Prozent pro Jahr. Den Kaufpreis zahle ich, um Geld zu haben, um es definitiv zu erwerben. Den Mietpreis zahle ich, um Geld zu halten. Der Unterschied zwischen Geld haben und Geld halten wird im folgenden Kapitel 2 wichtig. Und wie immer beim Geld muss man auch beim Zins zwischen nominell und real unterscheiden. Wenn der Zins pro Jahr 5 Prozent beträgt, aber das Preisniveau (hier: der Preis des Referenzgutes Gummikrokodil) im selben Zeitraum um 3 Prozent steigt, bleibt real nur ein Zins von 2 Prozent übrig. Wer Geld mietet oder vermietet (borgt oder leiht), wird also genau darauf achten, was dabei unter dem Strich, d. h. real, herauskommt.
Merkpunkte
— Geld ist ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel.
— Ein allgemeines Zahlungsmittel ermöglicht Handel, Arbeitsteilung, Spezialisierung, Berufe.
— Geld gilt, weil alle glauben, dass alle andern glauben, dass alle andern glauben, ... dass Geld gilt.
— Wichtige Eigenschaften des Geldes sind: Knappheit, Dauerhaftigkeit und Übertragbarkeit.
— Wichtig ist, dass Geld in beschränkter Menge vorhanden ist. Sein Materialwert ist Nebensache.
— Stoffwertlose Geldzeichen können den Wohlstand einer Gesellschaft erhöhen.
— Das Geld hat einen nominellen Wert. Er besteht aus der Zahl und der Einheit, die auf den Noten und Münzen stehen.
— Das Geld hat auch einen Realwert. Er besteht aus der Gütermenge, die man damit kaufen kann.
— Zahlungsmittel heisst: Transportmittel für Wert. Die Transportkapazität des vorhandenen Geldes misst sich an dessen realem Wert.
— Die Miete des Geldes heisst Zinssatz.
TEIL I | WAS ES IST
KAPITEL 2
WIE VIEL BRAUCHT ES?
TEIL I | WAS ES IST
Kapitel 2: Wie viel braucht es?
Wir sind nicht Dagobert Duck
«An die Phönizier,
denen es dereinst gelang,
das Geld zu erfinden ...
Sie haben es erfunden. Das ist gut.
Aber warum so wenig?!»
(Marian Załucki, polnischer Dichter)
Das Geld haben zwar nicht die Phönizier erfunden; aber ja: warum so wenig? Kaum jemand klagt, er oder sie habe zu viel Geld. Eine Ausnahme war der Posträuber Domenico Silano. Er lief 1979 nach dem Überfall auf die Fraumünsterpost durch ein Zürcher Aussenquartier, in einem Kehrichtsack seinen Teil der Millionenbeute (immer noch Europarekord in der Sparte Bargeld, wie er stolz erzählt). Jedes Mal zuckte er zusammen, wenn in der Nähe ein Polizeifahrzeug auftauchte. Liebend gerne hätte er sein Geld gegen etwas Unverdächtiges eingetauscht.





























