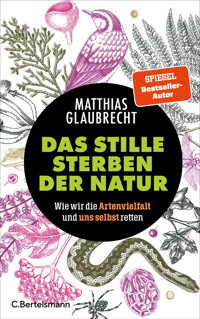12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Artensterben wird zu einer der wichtigsten Zukunftsfragen der Menschheit – Der Bestseller jetzt in einer kompakten, illustrierten Fassung im Taschenbuch
Das weltweite Artensterben bedroht unsere Lebensgrundlagen und wird so zu einer der wichtigsten Zukunftsfragen der Menschheit. Aufgrund vielfacher Nachfrage legt der angesehene Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht, einer der besten Kenner des Themas Artenvielfalt, nun eine kompakte Fassung seines großen, 2019 erschienenen Werkes »Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten« vor, in dem er zeigte, wie sich das Netz des Lebens im Lauf von Jahrmillionen entwickelte und warum es zerreißen könnte. Die kompakte Ausgabe präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse und Fakten des Bestellers in anschaulicher, zugänglicher Form für ein breites Publikum und enthält zudem eine Reihe informativer farbiger Grafiken.
Für seine Bücher wurde Matthias Glaubrecht 2023 mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Autor
Der Evolutionsbiologe und Biosystematiker Matthias Glaubrecht, Jahrgang 1962, ist Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg und wissenschaftlicher Leiter des Projekts Neues Naturkundemuseum Hamburg (»Evolutioneum«) am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Er war zuvor Gründungsdirektor des Centrums für Naturkunde der Universität Hamburg und Leiter der Abteilung Forschung am Museum für Naturkunde Berlin. Glaubrecht schreibt regelmäßig für Zeitungen und Zeitschriften wie »Die Zeit«, »Die Welt« und »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, war an TV-Produktionen beteiligt und hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter »Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten« (2019). 2023 wurde ihm der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung verliehen.
Matthias Glaubrecht
Das Ende der Evolution
Wie die Vernichtung der Arten unser Überleben bedroht
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © dieser Ausgabe 2023 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt
Covermotiv© yulianas/shutterstock
Graphiken: Peter Palm, Berlin
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29369-7V002
www.penguin-verlag.de
Den Erdlingen MCF & NCF gewidmet
Der Mensch ist Teil der Natur,und sein Krieg gegen die Naturist zwangsläufig ein Krieg gegen sich selbst.
Rachel Carson, Der stumme Frühling (1962)
Die biologische Vielfalt ist unsere wertvollste,aber am wenigsten geschätzte Ressource.
Edward O. Wilson, Der Wert der Vielfalt (1992)
Inhalt
Vorwort zur gekürzten und aktualisierten Ausgabe
Einleitung – Der Mensch als Evolutionsfaktor
Teil 1
I. ÜBER UNS
Wir sind alle Pioniere – zur Geschichte des »weisen Menschen«
Evolutionäre Eintagsfliege: Das Werden des Menschen
Die Anfänge einer ganz besonderen Spezies
Wir sind Kinder des klimatischen Wandels
Die Sache mit dem Gehirn – ist Denken Glückssache?
Wir Smartphoner: das soziale Netztier in uns
Ein Zeitalter menschlicher Einsamkeit
Der Mensch als »Unkrautart«
Die Besiedlung der Welt – ein Drama in zwei Akten
Das Megafauna-Paradoxon
Stippvisite zwischen Afrika und Asien
Finaler Auszug aus Afrika
Katastrophe auf zwei Beinen
Kurzfristig erfolgreich
Weltgeschichte einmal anders – die zwei großen Erzählungen
Zur Heldensaga menschlicher Pioniergeschichten
… und von rücksichtslosen Ausbeutern und Kolonisatoren
Warum sind wir hier? – Ein universelles Muster unserer Natur
II. ÜBER-BEVÖLKERUNG
Elf Milliarden: Wann sind wir zu viele für diesen Planeten?
Mission erfüllt: »Seid fruchtbar und mehret euch!«
Zur Biologie der Bevölkerungszunahme
Geschichte – eine Frage der Bevölkerungsarithmetik?
Die Explosion der Weltbevölkerung: Wie konnte es dazu kommen?
»Population bomb« und das Problem von Prognosen
Die Entschärfung der »Bevölkerungsbombe«
Das Baby-Paradoxon: Weniger Geburten, mehr Menschen
Was treibt die Weltbevölkerung?
Ungewollt schwanger oder kluge Familienplanung
Nicht die Zahl ist das Problem: Kein Brot für die Welt?
Der große Hunger – heute und morgen
Wird es genug Wasser geben?
Wird es genug Nahrung geben?
Die Zukunft der Welternährung
Fazit: Von Rettungsbooten und der ewigen Ressourcen-Frage
Teil 2
III. ÜBER ARTEN
Vom vielfachen Verlust des Lebens
Vom Tod der Kindheitstiere
Ein globaler Großversuch des Homo sapiens
Biodiversität – was ist das eigentlich?
Die Illusion eines gründlich erforschten Planeten
Wer kennt die Namen, zählt die Arten – Linnés Vermächtnis
Von der Obsession der Artenzahl
Die größte nicht wiedergutzumachende Dummheit
Das Paradoxon schwindender Arten
Die biologische Vielfalt in der Krise
Das große Sterben im Stillen
Der drohende Verlust von einer Million Arten
Friedhof der Arten. Oder: Das Sterberegister der Natur
Sterben nach Zahlen, Sterben auf Raten
Von den fünf Treibern des Artentods
Fallstudien zum Sterben der großen und kleinen Arten
Vom Tod des Tigers
Auch der König verliert sein Reich
Zum Tod der »Top-Räuber«
Eine Arche nur für die Schönen?
Aktion freie Frontscheibe: Das große Sterben der ganz Kleinen
Die Fakten zu Massenschwund und Massensterben
Wenn die Bestäuber sich aus dem Staub machen
Verarmte Landschaft: Die wahre Botschaft der wilden Bienen
Wenn sich Pflanzen vom Acker machen
Alle Vögel sind schon weg
Vom Tod der Allerweltsarten und Ackerarmutsflüchtlinge
»Missing the bigger picture«: Die Drogentoten des Artensterbens
Eine verheerende Jagd: Vom Wal- und Fischfang
Vom »heldenhaften« Erlegen der Meeresriesen
Töten, bis es sich nicht mehr lohnt: »Frontier« und der Untergang der Wale
Was Wale heute tötet
Die Erschöpfung und Verwüstung der Meere
Der Fisch ist aus, das Meer ist leer
Vier Fakten über Fische
Artenschwund als Kollateralschaden
Kein frischer Fisch mehr
Wenn Wehre die Wanderung verwehren
Teil 3
IV. ÜBER-LEBEN
Von Kettengliedern und Netzwerken
Willkommen im Anthropozän: Das neue Erdzeitalter des Menschen
Das vom Menschen gemachte Neue
Vom Menschen als Raubtier. Oder: Die Lehre eines biologischen Bankenskandals
Der Mensch als globaler Artenkiller
Das sechste Sterben – zur Arithmetik des Artentods
»Defaunation«. Oder: »Death by a thousand cuts«
»Biological annihilation« – die globale Vernichtung der Biodiversität
Vom Ende der Evolution
Räuber und Bestäuber: Keiner stirbt für sich allein
Vom vielfältigen Nutzen der Vielfalt
Bedrohte Bilanz: Wie alles mit allem zusammenhängt
Ökologische Kettenreaktionen
Diversität bedeutet Stabilität
Die Idee von der Natur als Dienstleisterin
Natur als Kapital
Das Ende der Wildnis und der Schutz der Natur
Von der Natur des Menschen
Vom Versagen des Naturschutzes
Vergebliche Fahndung nach der guten Nachricht
Wahre Wildnis: Vom Verlust der letzten Naturräume
Geographie des Artensterbens – das Ringen um regionale Schatztruhen
Was noch übrig ist: Zur Rolle von Schutzgebieten
Half Earth: Die grünere Hälfte der Welt
Ein globales Sicherheitsnetz für die Natur
Ein globales Biodiversitätsabkommen: Der »Montreal-Moment« und das 30 × 30-Ziel
V. ÜBER-MORGEN
Von der Zukunft der Arten und unserer eigenen
Eine kurze Erfolgsgeschichte der Menschheit
Von den drei Naturen des Menschen
Kumulative kulturelle Evolution
Die Natur der Kultur des Menschen
Schlau denken, blöd handeln: Unsere Vernunftnatur und ihre kognitiven Konflikte
Ist der Mensch doch ein vernunftloses Tier?
Erkenntnis, Einsicht und Verantwortung
Unser »grandioser ökologischer Erfolg«
EPILOG – EARTHRISE. ODER GLÜCKSFALL ERDE
DANKSAGUNG
BILDTEIL
ANMERKUNGEN
REGISTER
LITERATUR
Vorwort zur gekürzten und aktualisierten Ausgabe
»All nature is at war« – die gesamte Natur befinde sich im Krieg, meinte vor mehr als anderthalb Jahrhunderten der britische Naturforscher Charles Darwin und beschrieb damit in seinem epochalen Werk Über den Ursprung der Arten die Auseinandersetzung aller Organismen mit der Natur und den immerwährenden Kampf ums Überleben.[1] Von einem Krieg des Menschen gegen die Natur, der zugleich ein Krieg gegen sich selbst sei, schrieb 1962 die amerikanische Biologin Rachel Carson in ihrem Buch Der stumme Frühling. Ihre düsteren Warnungen vor einem Frühling, in dem kein Vogel mehr zu hören ist, trugen maßgeblich zum Entstehen der modernen Umweltbewegung bei – gleichzeitig wurde das von Carson prophezeite Verschwinden der Arten in Teilen Realität.[2]
Tatsächlich führen wir Menschen schon seit Langem Krieg gegen die Natur, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber in neuerer Zeit ist dieser Krieg brutaler, radikaler und ausufernder geworden, vor allem ist er längst geradezu selbstmörderisch. Eine stetig wachsende und ressourcenhungrige Menschheit führt ihn gegen unsere Umwelt und Mitwelt, gegen die biologische Vielfalt dieses Planeten, die Biodiversität, aber im Kern führen wir ihn gegen uns selbst. Denn »Natur«, das sind wir, und damit geht die Artenkrise uns alle an. Arten sichern unsere Lebensgrundlage, und die biologische Vielfalt ist gleichsam unsere Lebensversicherung. Schließlich leben wir von der Natur und verdanken ihr unsere Nahrung – von sauberem Wasser und frischer Luft, vom Brot bis zum Fisch, vom Fleisch der Tiere, von den Bäumen der Wälder bis zum Obst und Gemüse der Gärten. Überall brauchen wir die Rohstoffe und unentgeltlichen »Dienste« einer gesunden Natur. Die indes sind nicht im Übermaß vorhanden, unser Planet hat Grenzen, und seine Ressourcen sind endlich.
Wir jedoch plündern den einzigartigen biologischen Schatz dieses Planeten, ohne den unsere Ökosysteme nicht funktionieren, auf die wir wiederum angewiesen sind. Überall geht Natur verloren – schneller als je zuvor, mit Folgen für uns, unsere Kinder und Kindeskinder. Millionen Hektar Urwald sind bereits verschwunden, in Rinderweiden und riesige Ackerflächen umgewandelt oder zu Holzplantagen degradiert; weltweit haben wir an die Hälfte der Wälder die Axt und die Kettensäge gelegt und beinahe die Hälfte der terrestrischen Oberfläche unter den Pflug genommen, vielerorts in industrieller Weise. Viele Flächen sind durch unsere Städte, Siedlungen und Straßen versiegelt. Flüsse sind verbaut und im Meer viele Bestände überfischt.
Doch Natur und Umwelt sind mehr als bloß unentgeltliche Ressourcen zur Profitsteigerung. Unzählige Arten von Organismen bauen das komplexe Netzwerk irdischer Ökosysteme auf, von denen wir alle profitieren. Je mehr biologische Arten wir verlieren, desto mehr ökologische Maschen gehen verloren, bis das Netz irgendwann reißt. Anders ausgedrückt: Wenn wir Ökosysteme als das Kapital unserer Erde betrachten, dann sind Arten wie Anleihen, die Geld und Gold wert sind. Ihr massenhaftes Verschwinden kommt einem biologischen Börsencrash gleich, der auch das Unternehmen Menschheit in den Bankrott treiben wird. Deshalb geht es beim Verlust der Biodiversität keineswegs nur um das Sterben der anderen Arten, es geht dabei letztlich um unser eigenes Überleben. Der Mensch ist Teil dieser Natur, keineswegs steht er über ihr, auch wenn wir dies in unserer Überheblichkeit lange glaubten und in einer Ignoranz und Naturblindheit, die unsere Zeit und die heutigen Gesellschaften prägen, weiterhin annehmen.
Nach Rachel Carsons aufrüttelndem Tatsachenbericht hat es an Warnungen vor den vielfältigen Zerstörungen der Natur nicht gefehlt. Bereits vor einem halben Jahrhundert, ein Jahrzehnt nach dem Stummen Frühling, mahnte der Club of Rome die Grenzen des Wachstums an.[3] Spätestens damit wussten wir um den grundlegenden Konflikt von Ökonomie und Ökologie; bereits damals wäre es folgerichtig gewesen, das Ruder umzulegen und den Kurs einer nachhaltigen Weltwirtschaft einzuschlagen. Statt Zeichen einer wirklichen Transformation unserer Gesellschaften haben sich seitdem aber die Horrorszenarien vom Untergang der Welt und der Menschheit vermehrt, warnen diverse Reports immer wieder vor dem Wachstumsdogma, vor der Abhängigkeit unserer Zivilisation von fossilen Energieträgern und vor anderen ökologischen Krisen.
Der Erhalt der biologischen Vielfalt hatte dabei lange keinen besonderen Stellenwert. Viel zu lange galten Arten- und Naturschutz als eher abseitige Spezialgebiete, als ein Thema nur für Biologen, gar für einige Vogelkundler und Insektenforscher. Obgleich der Schutz der Um- und Mitwelt nie allein den Erhalt von Adlern und Ameisen, von Nashörnern und Nebelpardern, von arktischen Bären und tropischen Korallen meinte, sondern auf uns Menschen selbst zielte, wurde er allzu stiefmütterlich behandelt.
Noch bis vor Kurzem spielte die Krise der Biodiversität in der öffentlichen Wahrnehmung keine annähernd so prominente Rolle wie die des Klimas. Doch ist das Artensterben keineswegs eine Begleiterscheinung des Klimawandels, so wichtig Klimaschutz ist und so sehr beide zusammenhängen und sich positiv wie negativ verstärken. Tatsächlich verstehen wir erst jetzt die Bedeutung der Biodiversität für das Leben auf unserem Planeten – und dass das Artensterben ein eigenständiges Problem darstellt, zu dem es auch ganz unabhängig vom Klimawandel kommt.
Ebenso hat uns unlängst die Corona-Pandemie vor Augen geführt, was passiert, wenn natürliche Lebensräume zerstört werden und der Mensch dadurch immer häufiger in Kontakt mit Wildtieren und deren Erregern gerät.[4] Tatsächlich leidet der Planet angesichts einer stetig wachsenden Menschheit mit ihrem enormen Ressourcenverbrauch gleichsam an multiplem Organversagen, bei dem zum Klimawandel noch Artensterben und Pandemien hinzukommen – und die für sich allein schon gefährlich genug sind.
***
In der hier vorliegenden, deutlich gekürzten, zugleich aktualisierten und illustrierten Fassung vom Ende der Evolution geht es mir darum, in einem leichter zugänglichen Band einerseits auf das Problem des Artensterbens in seiner ganzen Tragweite aufmerksam zu machen und dabei aufzuzeigen, was wir wissen und was sich absehen lässt. Andererseits soll diese Krise der Biodiversität in einen größeren, evolutionsbiologischen Zusammenhang gestellt werden, indem wir einen Blick auf die Natur des Menschen, auf unser evolutives Erbe und die Entwicklung unserer Spezies sowie unseres Umgangs mit der Umwelt werfen.
Ein durchaus wohlmeinender Rezensent der Erstausgabe dieses Buches hatte seinerzeit angemerkt, »die geballte Empirie sämtlicher Evidenzen in der ausführlichen Edition eines dicken Wälzers zu verarbeiten – dessen Seitenzahl sich als sinnfälliger Protest gegen die politische Ignoranz angesichts der Artenapokalypse verstehen lässt« –, sei kaum zur Nachahmung geeignet.[5] Dieser Kritik entsprechend habe ich den »Wälzer« nicht nur um einige erzählerische Passagen und historische Perspektiven erleichtert, sondern an vielen Stellen weitere verfügbare Fakten und Fallbeispiele weggelassen. Ich hoffe, dass die handlichere Form nun tatsächlich »kaum etwas von der Gewichtigkeit des Themas und der Tiefe der Argumente« eingebüßt hat, den Zugang zum Problem des Artensterbens aber sehr viel einfacher macht.
Schließlich können »Ideen nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden«, wie der große Naturforscher Alexander von Humboldt immer wieder zitiert wird. Die Bewältigung der Biodiversitätskrise ist zweifellos eine solche Idee, deren Vervielfachung und Belebung man sich in möglichst vielen Köpfen wünscht.
Einleitung – Der Mensch als Evolutionsfaktor
Es gehört zu den Paradoxien unserer Gegenwart, dass wir zwar den Weltraum erreicht und unseren Erdtrabanten erkundet haben, tatsächlich aber auf einem in biologischer Hinsicht noch weitgehend unbekannten Planeten leben. Denn noch immer ist der Großteil der irdischen Tier- und Pflanzenarten unentdeckt und unerforscht, wissenschaftlich weder benannt noch beschrieben. Das gilt zwar kaum mehr für die auffälligeren, aber weitaus weniger artenreichen Wirbeltiere, wie etwa Vögel oder Säugetiere, umso mehr aber für das namenlose Heer unscheinbarer Wirbelloser – also insbesondere für Gliedertiere wie Insekten, aber auch Spinnen, Krebse oder Schnecken. In erster Näherung sei beinahe jedes Tier ein Insekt, sagen Wissenschaftler, die sich mit Biosystematik beschäftigen, gerne mit einem Augenzwinkern angesichts der tatsächlichen Artenfülle just jener Arthropoden. Aktuelle Schätzungen gehen von insgesamt mehr als 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit aus. Nicht einmal ein Viertel dieser ungeheuren biologischen Vielfalt dürfte bislang erfasst worden sein. Aber die gesamte biologische Vielfalt, die Biodiversität mit all ihren Facetten, steht gegenwärtig auf dem Spiel.
Fokussiert auf die jeweils gerade aktuellen Krisen – sei es die Corona-Pandemie oder der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die sich verschärfende Energiekrise – verlieren wir immer wieder aus dem Blick, welche Gefahren die gesamte Menschheit tatsächlich am stärksten bedrohen. Angesichts der jüngsten Krisen wurde zeitweilig sogar die Klimakrise aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt. Immer scheint etwas anderes wichtiger zu sein, und wir geben uns leicht der gefährlichen Illusion hin, dass schon alles wieder gut werden wird – etwa, wenn wir nur alle unsere Hände waschen und Masken tragen oder endlich Elektroautos und besser noch Fahrrad fahren. Dabei werden Dimension und Dynamik des Artensterbens aber weiterhin unterschätzt, der Verlust der Biodiversität als weitere große ökologische Krise neben dem Klimawandel ist immer noch nicht wirklich im Bewusstsein der Menschen, und auch nicht der Politik, angekommen.
Schon das Wort »Artensterben« signalisiert für viele eher Normalität. Müssen wir nicht alle irgendwann sterben, und sind Arten nicht immer schon natürlicherweise ausgestorben, während wieder neue entstanden? Müssen nicht sogar die einen erst verschwinden, damit andere nachkommen und sich entfalten können? Bekamen die Säugetiere ihre evolutive Chance nicht erst, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren? Und sterben schließlich nicht – die Evolution bestraft ihre Kinder – immer jene aus, die sich nicht anzupassen vermögen?
Doch sosehr das Thema inmitten der aktuellen Weltkrisen an den Rand rückt, tatsächlich ist die gegenwärtige globale Biodiversitätskrise – der massenhafte Artenschwund und das sich damit abzeichnende Artensterben – die wohl größte Herausforderung für die Menschheit im 21. Jahrhundert. Sie legt fundamentale Fragen unserer Zeit und nach der Existenz zukünftiger Generationen offen. Wie wir die Artenvielfalt bewahren, die Natur schützen und mit ihr unsere Existenz sichern, wird deshalb neben dem Klimawandel nicht nur für Forschung und Politik, sondern für unseren Alltag die zentrale und wichtigste Frage dieses Jahrhunderts werden.
Der Mensch ist, nicht nur durch seine schiere Zahl, zum größten Raubtier dieser Erde geworden. Wir fressen uns bereits jetzt regelrecht durch die Nahrungsketten an Land und in den Meeren; bereits jetzt schon plündern wir die natürlichen Ressourcen überall über Gebühr. Das wirft Fragen nicht nur danach auf, wie der Mensch überhaupt zu diesem weltenprägenden Wesen wurde und wie er die Erde bisher verändert hat; vielmehr auch nach der Zukunft der Menschheit und danach, welche Perspektive es für uns gibt. Obgleich wir nur diese eine Erde haben (und für unabsehbare Zeit haben werden), leben wir längst über unsere ökologischen und ökonomischen Verhältnisse. Und zwar in einer Weise, die befürchten lässt, dass es das Ende der Evolution auf der Erde sein wird – jener Evolution, wie wir Menschen sie kennen; das Ende nicht nur für einen Großteil aller anderen Organismenarten, mit denen wir diese Welt teilen, sondern auch für unsere eigene Evolution.
Das ist die zentrale These dieses Buches.
***
Was lange übersehen wurde: Längst ist der Mensch selbst zu einem entscheidenden Evolutionsfaktor auf der Erde geworden – zu einer in der Natur wirksamen Kraft sui generis. Dabei ist der von ihm verursachte Klimawandel nur eine der vielen Konsequenzen. Wie keine andere Spezies prägen wir – unsere Art Homo sapiens – mittlerweile die Erde, verändern dabei alle Bereiche zwischen der oberen Erdkruste und der unteren Atmosphäre. Damit beeinflussen wir nicht nur die Geosphäre unseres Planeten, sondern auch dessen gesamte Biosphäre. Hier nur drei Fakten: Zum einen nutzen wir mittlerweile drei Viertel der Erdoberfläche für unsere Zwecke, für Städte, Siedlungen, Fabriken und Straßen, vor allem aber für Land- und Forstwirtschaft. Wir hinterlassen dadurch einen gigantischen ökologischen Fußabdruck auf unserem Heimatplaneten, eindrücklich zu erkennen etwa aus der Perspektive erdnaher Satelliten, die des Nachts die Lichtspuren unserer Zivilisation überall auf der Erdoberfläche aufzeichnen. Zum anderen hat die »anthropogene Masse« – also alles vom Menschen erzeugte Material, wie etwa Beton, Zement, Steine und Metall oder auch Plastik – seit dem Jahr 2020 das Gewicht der von sämtlichen Pflanzen, Tieren und anderen Organismen erzeugten Biomasse erreicht. Alle von uns hergestellten Bauwerke und Güter wiegen also sämtliche biologischen Produkte der Natur auf. Und schließlich: Seit Ende 2022 leben mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde, jährlich kommen viele Millionen hinzu; bis etwa Mitte des 21. Jahrhunderts dürften wir laut aktueller Prognosen knapp 9 Milliarden Menschen sein, und es ist absehbar, dass wir gegen Ende dieses Jahrhunderts 10 oder gar 11 Milliarden Menschen sein werden. Und alle nicht nur mit höchst legitimen, natürlichen Ansprüchen an Wasser und Nahrung, sondern auch mit ökonomischen Forderungen und ökologischen Folgen.[6]
Homo sapiens ist damit zu einem entscheidenden Umweltfaktor geworden, so einflussreich, dass er nicht nur die Zukunft seiner eigenen Art, sondern auch die vieler anderer Tier- und Pflanzenarten aufs Spiel setzt. Daher lautet die Leitfrage dieses Buches: Haben wir das Ende der Evolution erreicht – unserer eigenen Evolution und der vieler anderer Arten? Oder anders gefragt: Haben wir unseren Planeten bereits derart geplündert, dass die Biosphäre sich davon nicht mehr erholen wird? Müssen wir fürchten, dass das Leben und die Arten, wie wir sie heute kennen, bald von ihm verschwunden sein könnten? Wird damit auch der Mensch verschwinden? Schafft sich die Menschheit in ihrer selbstbezogenen Allmachtfantasie, in ihrem irrigen Machbarkeitswahn und ihrer unheilbaren Fortschrittsgläubigkeit also selbst ab?
Diesen Fragen werden wir im Folgenden nachgehen.
Sicher kann man nicht behaupten, die Frage nach dem Überleben des Menschen sei nicht bereits oft gestellt worden; freilich, ohne dass sich etwas verändert hätte. Und auch die Vorhersage, dass der Mensch viele Lebensformen dieser Erde unwiederbringlich vernichten wird, dass er das Aussterben einzelner Arten und ganzer Artengemeinschaften verantwortet und letztlich damit auch sein eigenes Überleben gefährdet – all das ist durchaus nicht neu. Ebenso wenig neu ist, dass sämtliche Mahnungen dazu kaum wirklich ernst genug genommen wurden und weitgehend ungehört verhallten. Nein, an frühen Warnungen hat es durchaus nicht gefehlt. So ist weder der Raubbau des Menschen an der Natur noch dass er damit sein eigenes Überleben gefährdet, eine neue Erkenntnis. Ökonomische Unkenrufe von den Grenzen des Wachstums und ökologische Horrorszenarien haben mittlerweile Tradition. Zwar ist der drohende Kollaps der Erde somit bereits vielfach verkündet worden; eine regelrechte Besorgnisindustrie hat sich etabliert. Gleichwohl haben ökologisch verbrämte Endzeitszenarien keine wirkliche Fangemeinde. Doch während lange niemand vom allgegenwärtigen Artentod sprach, erreichen nun entsprechende Meldungen zunehmend die Abendnachrichten.
Viele nehmen die weit verstreuten Hinweise auf das Verschwinden der Arten wahr; schwerer fällt es, diese nicht nur als isolierte Begebenheiten zu sehen, sondern in ihrer Bedeutung wirklich einzuordnen. Es ist nicht übertrieben: In 20 oder 30 Jahren könnte es sein, dass es weltweit keine größeren Säugetiere mehr in der Wildnis gibt, keine von der Größe und Art eines Elefanten, Nashorns, Tigers oder Jaguars jedenfalls; es könnte sein, dass es gar keine Wildnis mehr gibt. Bis Ende des 21. Jahrhunderts könnte die Hälfte oder gar mehr aller Tier- und Pflanzenarten verloren sein. Jedenfalls wird die Vielfalt an Vögeln und Fröschen, an Schmetterlingen und Samenpflanzen drastisch geschrumpft sein; ganze Areale könnten abgesehen von Allerweltsarten verarmt sein. Der Mensch, der sich zum Beherrscher der Welt aufgeschwungen hat, verprasst das evolutive Erbe dieser Erde. Aus Kurzsichtigkeit und Unkenntnis, sicher; aber auch, weil er es in seiner Evolution nicht anders gelernt hat, den Nutzen von Nachhaltigkeit nicht wirklich versteht und lebt. Dadurch kommt es zu einer Krise von planetarer Dimension.
Nein, hier geht es nicht einmal mehr darum, in alarmistischer Weise Panik zu verbreiten und Ängste zu schüren. Und ja, natürlich gibt es auch die gute Nachricht und die Erfolge im Umweltschutz. In den Industriestaaten verpesten wir die Luft weniger mit Schadstoffen, Flüsse werden wieder sauberer. Seit der Ausstoß von schädigendem FCKW drastisch reduziert wurde, hat sich das Ozonloch wieder verkleinert; niemand spricht mehr davon. Wovon alle reden: Wir produzieren viel mehr Strom aus regenerativen Energien als noch vor wenigen Jahren; wir recyceln in Deutschland wie die Weltmeister und verbrauchen weniger Trinkwasser. Noch nie gab es so viele Vögel gerade in großen Städten, so hört man. Viele Menschen hierzulande engagieren sich im Naturschutz; viele sind für »bio« und »öko« zu haben, alles chic.
Nur ändert das alles nichts an der globalen Lage, um die es hier geht. Natürlich sind immer schon Arten in der Erdgeschichte ausgestorben; auch entdecken und beschreiben Biosystematiker beinahe täglich neue, ihnen bislang unbekannte Tier- und Pflanzenarten. Nur ändert auch das nichts an der derzeit rasant schwindenden Biodiversität.
***
Um die verfügbaren Fakten besser einordnen zu können, hilft durchaus eine in diesem Fall im Wortsinn natur-historische Perspektive. Als Erstes werden wir Über uns sprechen, darüber, wie wir wurden, was wir heute sind, denn an diesen kritischen Punkt kam der Mensch nur, weil er so ist, wie er ist, wegen seiner Natur und seines evolutionsbiologischen Erbes (was eine Erklärung, aber keine Entschuldigung sein soll). Menschen sind, wie alle anderen Lebewesen dieses Planeten, das Produkt eines einmaligen Evolutionsablaufs auf der Erde. Ausgerüstet mit dem Wissen des Evolutionsbiologen und des Biodiversitätsforschers wollen wir die Wurzeln des Menschen in der Natur und die Entwicklung seiner Kultur unter die Lupe nehmen und schließlich eine Antwort auf die Frage suchen, wohin uns das zukünftig führt. Darüber hinaus sollen die wissenschaftlichen Befunde auch unter dem Aspekt betrachtet werden, was wir aus ihnen lernen können. Nur in einer Zusammenschau der Ergebnisse von Biodiversitätsforschung und Evolutionsbiologie des Menschen lassen sich belastbare Vorhersagen für die Zukunft der Arten und auch für unsere eigene Zukunft ableiten, dies durchaus in der Hoffnung und mit dem Ziel, dass wir am Artenschwund etwas ändern können.
Im Kern geht es dabei um zutiefst menschliches Verhalten; denn letztlich stehen uns bei der Biodiversitätskrise alte Verhaltensmuster im Weg. Der Mensch ist evolutiv auf das jeweilige Hier und Jetzt programmiert, doch wir haben es mit einem Problem zu tun, dessen Folgen die Welt langfristig betreffen. Wir beginnen daher mit einem Blick in die Frühphase unserer Spezies, noch weit vor den Anfängen der Kulturgeschichte dieses höchst eigenartigen Säugetiers Homo sapiens – des weisen oder wissenden, in jedem Fall einsichtsreichen Menschen. Wir entdecken dabei einen Pfadfinder mit einer ausgeprägten Pioniermentalität, die ihn zu einer der erfolgreichsten und nunmehr global agierenden Lebensformen hat werden lassen. Nur zum geborenen Naturschützer hat sich der Mensch nicht von sich aus entwickelt. Er besitzt vielmehr die Natur eines biologischen Ausbeuters, dessen evolutives Erbe es ist weiterzuziehen, sobald die Ressourcen an einem Ort erschöpft sind. Wo immer wir bis in unsere jüngste Vergangenheit hinkamen, haben wir die Natur und die von ihr bereitgestellten Produkte als freies Gut gesehen. Wir haben uns genommen, was wir brauchten, als ob diese natürlichen Ressourcen niemals versiegen könnten. Natur war und ist ein Gut, das nichts kostet; das zudem unerschöpflich scheint.
Anschließend werden wir Über Bevölkerung sprechen und darüber, was die schiere Zahl an Individuen unserer Art mit all ihren Bedürfnissen für diesen Planeten bedeutet. Im Zusammenhang mit der Natur des Menschen müssen wir auch die bisherige Entwicklung der Bevölkerungszahl untersuchen und vor dem Hintergrund der demoskopischen Prognosen die Frage nach dem wichtigsten biologischen Einzelfaktor für die Zukunft unseres Planeten aufwerfen: Sind wir zu viele bzw. wann sind wir zu viele? Bis gegen Ende dieses Jahrhunderts drohen es 10 oder gar 11 Milliarden Menschen zu werden. Bereits vorher werden vor allem in Afrika, so die Vorhersagen, mit etwa 2,5 Milliarden doppelt so viele Menschen leben wie heute; die meisten davon in immer größer werdenden urbanen Ballungsräumen. Ihre Versorgung wird immer mehr Ressourcen, nicht zuletzt Fläche und Land beanspruchen.
Derweil melden die Gazetten im irrigen Ton, das Wachstum der Weltbevölkerung nehme ab. Tatsächlich hat es sich verlangsamt, ist in den vergangenen drei Jahrzehnten um ein Drittel zurückgegangen, von durchschnittlich 3,2 Kindern pro Frau auf 2,3 Kinder. Erstmals ist im Jahr 2020 die Wachstumsrate auf 0,8 Prozent pro Jahr gesunken. Aber die Weltbevölkerung wächst dennoch, wenn auch langsamer. Nicht vergessen dürfen wir dabei, dass noch immer knapp 66 Millionen Menschen pro Jahr dazukommen; das sind etwa so viele wie allein in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg lebten oder heute in Frankreich leben. Und in Afrika ist die durchschnittliche Kinderzahl mit 4,6 Kindern pro Frau noch immer doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Auch das gehört zu den Fakten, die es zu bedenken gilt, wenn da leichthin nach dem Motto »Die gute Kurve« verkündet wird, die Geburtenrate sinke. Denn diese allein, so objektiv richtig es ist, wird noch auf viele Jahrzehnte hinaus kaum einen Effekt haben. Selbst wenn sich also das Tempo des globalen Bevölkerungswachstums verlangsamt, sollte es uns noch auf längere Zeit große Sorge bereiten.[7]
Denn es wirft die Frage nach den Ressourcen und deren Verteilung auf. Mehr Menschen bedeuten zwangläufig auch einen größeren ökologischen Fußabdruck, und der besteht eben nicht allein in den überwiegend im globalen Norden verursachten CO2-Emissionen.
Deshalb müssen wir als Nächstes Über Arten sprechen, genauer die anderen Arten, die von unserer Spezies zum Teil bereits an den Rand der Ausrottung gebracht wurden. Zwar stellt die Bevölkerungszunahme, gerade im globalen Süden, eine der wesentlichen Ursachen des allgemeinen Artenschwundes dar, doch noch mehr trägt unsere moderne Lebensweise mit ihrem überzogenen und unstillbaren Ressourcenverbrauch infolge zunehmenden Konsums, insbesondere aber unsere heimische Landwirtschaft, deren Effekte wir externalisieren und globalisieren, zur weltumspannenden Biodiversitätskrise bei. Damit haben wir im Grunde gleich zwei Bevölkerungsprobleme, die große Individuenzahl und den hohen Pro-Kopf-Verbrauch. Durch die Plünderung der Rohstoffe und die Übernutzung der biologischen Reserven werden direkt und indirekt zahllose andere Lebewesen vernichtet.
Überall auf der Erde verändern wir Menschen Lebensräume in großem Stil, meist durch unsere Landwirtschaft und unsere Art des Zusammenlebens. An vorderster Front steht dabei im terrestrischen Bereich der Verlust an Wäldern weltweit, viele Waldökosysteme wird es bald nicht mehr geben. »Landnutzungsänderung« heißt es schönfärberisch, wenn ursprünglicher Wald vor allem landwirtschaftlicher Nutzfläche oder auch Infrastrukturprojekten weicht. Doch Entwaldung (»Deforestation«) und in der Konsequenz der damit einhergehende Artenschwund (»Defaunation«) sind die beiden hässlichen Seiten einer Medaille.
Und der Artenverlust setzt sich im aquatischen Bereich fort, wo wir die Meere seit Langem durch übermäßige Fischerei entvölkern und mit unseren anthropogenen Produkten, allem voran dem kaum vergänglichen Plastik, die Lebensräume verpesten. Ohne die vielen bislang noch darin lebenden Organismen aber werden Ozeane biologisch weitgehend zu Wasserwüsten werden.
So verlieren wir gegenwärtig auf dramatische Weise Biodiversität, jene biologische Vielfalt, die gleich auf drei Ebenen ihren Ausdruck findet: in der genetischen Zusammensetzung einzelner Populationen, in den Organismen und Arten selbst und in den Lebensgemeinschaften und Ökosystemen. Seit dem Jahr 1800 haben wir etwa 80 Prozent der heimischen Vögel verloren, rechnen Experten vor, die diesen sich beschleunigenden Zusammenbruch in einer immer vollständiger »ausgeräumten« Landschaft genauer analysiert haben. »Wo früher 100 Vögel umherflogen und sangen, sind es heute nur noch 20.«[8] Weltweit sind bereits insgesamt ein Drittel aller erfassten Arten vom Aussterben bedroht, ein Viertel aller Säugetiere, 13 Prozent aller Vögel und beinahe die Hälfte aller Amphibien.[9] Längst schon geht es nicht mehr um Einzelfälle wie den flugunfähigen Dodo auf der abgelegenen Insel Mauritius. Längst liegen Hunderte von Lebewesen auf dem Friedhof der Arten, wird das Sterberegister der Natur immer länger. Es ist eine Artenkrise planetaren Ausmaßes.
***
Aus der Erdgeschichte kennen wir fünf katastrophale Artensterben während der vergangenen 540 Millionen Jahre; jetzt droht ein weiteres, dieses Mal menschengemachtes Massenaussterben. Jedes der früheren Naturereignisse war von dramatischer Brisanz für das Leben auf der Erde, jedes eine Gefahr für die irdische Evolution, deren Ende es hätte bedeuten können. Auch dieses Mal ist das Sterben von globalem Ausmaß, es geschieht zudem in erdgeschichtlich kürzester Zeit. Vor allem aber passiert es auf einem dicht mit Menschen besiedelten Planeten, die – selbst wenn ihnen dies nicht immer bewusst ist – von funktionierenden Lebensräumen und den darin eingepassten Arten abhängig sind.
Bei dem von uns verursachten Artensterben geht es eben nicht um die letzte Mönchsrobbe im Mittelmeer, um den letzten Flussdelfin im Mekong, den Nebelparder in Nepal oder den Jaguar am Amazonas. Es geht vielmehr um ein weitgehend anonymes Heer an Arten, das unbemerkt für immer von der Erde verschwindet. Es geht darum, dass beispielsweise bereits drei Viertel der bei uns heimischen Insekten verschwunden sind.[10] Darunter sind zahllose Schmetterlinge und Wildbienen als die noch bekanntesten Verlierer einer bisher kaum hinreichend beachteten globalen Veränderung. Wir müssen den Artenschwund der meist bekannteren Ikonen des Naturschutzes als nur die vordergründig sichtbarsten Zeichen dieser unheilvollen Entwicklung erkennen. Dahinter verbirgt sich die eigentliche Biodiversitätskrise – die organismische Insolvenz ganzer Lebensräume und der Bankrott evolutionärer Vielfalt. Wir aber sind Teil dieser biologischen Vielfalt; ihr Verschwinden ist unser Verlust.
Die Artendiversität ist bereits heute auf knapp 60 Prozent der Erdoberfläche so geschrumpft, dass Ökosysteme nicht mehr richtig funktionieren, haben Forscher ermittelt.[11] Mit jeder neuen Erkenntnis zur Biodiversität erahnen wir die eigentliche Komplexität der Ökosysteme, deren Arten voneinander abhängig sind. Diese sind Kettenglieder komplizierter ökologischer Beziehungsgeflechte, deren Stabilität wir umso dramatischer einschränken, je mehr ihrer Teile wir schwächen oder gar entfernen. Weil stabile Ökosysteme eine Vielfalt und Vielzahl von Arten aufweisen, widerstehen sie äußerem Druck. Biodiversität sorgt dafür, dass ökologische Funktionen von vielen Arten übernommen werden. Fällt eine aus, übernimmt eine andere. Das funktioniert, solange ausreichend Arten da sind. Fallen indes zu viele Arten aus und wird der Druck zu groß, zerreißt dieses ökologische Gewebe irgendwann. Ökologen sprechen vom sogenannten »tipping point«, jener Situation, bei der die Lage plötzlich kippt und ein System zusammenbricht. Ökosysteme sind darin vergleichbar anderen sich selbst regulierenden Systemen wie etwa Märkten. Auch sie können sich trotz krisenhafter Tendenzen immer wieder selbst in Balance bringen – bis sie jenen gefährlichen Punkt des plötzlichen Umschlags erreicht haben, an dem die Eigenregulierung nicht mehr greift. Oft reicht dazu ein an sich unbedeutender quantitativer Zuwachs oder ein eher marginales Ereignis, um diesen Effekt des »Zuviel« zu bewirken. Wir kennen das als den sprichwörtlichen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Anschein, dass es trotz Verschlechterung immer auf gleiche Weise weitergeht, sollte nicht endlose Stabilität suggerieren, auch nicht bei Ökosystemen. Vom Funktionieren solcher mehrfach gepufferten Sicherungssysteme des irdischen Lebens sind letztlich auch wir Menschen abhängig.
Sitzen wir angesichts des allgemeinen Verlustes der Arten also längst alle in einem Boot kurz vor dem Wasserfall? Ist unsere Lage in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts bereits ausweglos oder ein Umsteuern noch möglich? Wie werden wir und unsere Kinder zukünftig leben? Sind wir und mit uns jene Artenvielfalt, wie wir sie heute kennen, tatsächlich am Ende der Evolution? Vor allem aber: Werden wir überleben? Oder fehlen uns am Ende dafür doch die Mittel, die biologische Konstitution und die kulturellen Gegebenheiten? Ist der Mensch also letztlich ein vernunftloses Tier, wie viele andere dem Untergang geweiht?
Diesen Fragen werden wir am Schluss nachgehen, wenn wir Über Morgen reden. Im dritten Teil des Buches wird es darum gehen, die verschiedenen hier nur skizzierten thematischen Stränge zusammenzuführen, um die Fakten in der Zusammenschau zu bewerten. Damit werden wir einen Blick nach vorn werfen, zum einen auf die Zukunft der Arten, zum anderen auf unsere eigene Zukunft. Die zentrale Frage wird dabei sein, warum das allgegenwärtige Artensterben bedenklich und bedrohlich auch für das Überleben des Menschen ist. So viel sei hier bereits gesagt: Mit der biologischen Fülle des Lebens, der uns umgebenden Vielfalt der Arten derart rücksichtslos umzugehen, wie dies gegenwärtig geschieht, ist ein mindestens ebenso gewaltiger Fehler wie den menschengemachten Klimawandel zu ignorieren; vielleicht ist es sogar der größte Irrtum der Menschheit.
Auch wenn es nicht der erste und einzige Irrweg des Homo sapiens ist, er ist, das wird nun im Folgenden zu zeigen sein, von ähnlich großer Brisanz wie ein anderer, früherer Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit – der Übergang vom Jäger und Sammler zu mit Sesshaftigkeit verbundenem Ackerbau und Viehzucht.
Teil 1
I. ÜBER UNS
Wir sind alle Pioniere – zur Geschichte des »weisen Menschen«
Evolutionäre Eintagsfliege: Das Werden des Menschen
Beginnen wir mit einem Parforceritt durch die Menschheitsgeschichte, zuerst durch die Naturgeschichte, dann die Kulturgeschichte jener Tierart, für die der schwedische Systematiker Carl von Linné 1758 den Namen Homo sapiens – der »weise Mensch« – in die zoologische Nomenklatur einführte. Wer sind wir wirklich? Was macht uns aus? Woher kommen wir? Was unterscheidet uns vom Tier, was von unseren australopithecinen und homininen Ahnen? Wie wurden wir, was wir sind? Waren wir immer so, wie wir sind? Was treibt uns an? Warum und seit wann sind wir so erfolgreich? Warum haben nur wir unter all den anderen Hominiden überlebt? Und schließlich: Warum sind wir heute so viele?
Wir stellen uns diese Fragen hier, weil wir verstehen wollen, welchen Platz wir in der Natur einnehmen und in welchem Verhältnis wir zu anderen Lebewesen stehen; wie wir mit unserer Umwelt umgehen, mit der Natur und mit unseren Mitgeschöpfen. Wenn wir wissen, woher wir kommen und wie wir wurden, was wir sind, verstehen wir besser, was Natur und Umwelt für uns wirklich sind und welche Rolle uns als einer Art von vielen darin zukommt.
Keine Frage: Wir haben es wahrlich weit gebracht. Eine evolutive Erfolgsgeschichte einerseits, obgleich wir andererseits im kosmischen Maßstab kaum mehr sind als eine Eintagsfliege der irdischen Evolution. Vor rund 14 Milliarden Jahren entstand mit dem Urknall das Universum, vor etwa 4,6 Milliarden Jahren formte sich gemeinsam mit den übrigen Planeten unseres Sonnensystems die Erde. Seit etwa 3 Milliarden Jahren gibt es erste Spuren des Lebens auf unserem Planeten, doch erst seit etwa 1 Milliarde Jahren nachweislich erste fossile Zeugnisse einer vielfältigen Organismenwelt in den Ozeanen. Dinosaurier, unter denen die Evolution die gewaltigsten Kreaturen hervorbrachte, die je auf der Erde lebten, beherrschten die Kontinente über 170 Millionen Jahre und damit zehnmal länger, als es überhaupt menschenaffenähnliche Linien gibt. Dagegen bemisst sich die für den Menschen unmittelbar relevante Zeitspanne nach nur wenigen Millionen Jahren; und dies auch nur dann, wenn wir unsere australopithecinen Ahnen großzügig mit einbeziehen.[1] Der moderne Mensch, Homo sapiens, erschien vor etwas mehr als 300000 Jahren in Afrika; vor knapp 70000 Jahren verließ er seine afrikanische Heimat und besiedelte innerhalb weniger Generationen und weniger Jahrzehntausende schließlich die gesamte Erde mit ihren höchst unterschiedlichen Lebensräumen.
Deren Antlitz sollte er grundlegend verändern, nachdem die einstigen Sammler und Jäger vor knapp 12000 Jahren sesshaft geworden waren und begonnen hatten, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Heute sind wir die dominierende Lebensform auf diesem Planeten. Mit seinen Feldern und Wäldern, Äckern und Weiden, mit seinen Städten und Straßen, Industrien, Tagebaustätten und Stauseen hat der Mensch weit mehr als die Hälfte der Landoberfläche der Erde intensiv verändert. Unsere Nutztiere, allen voran Rinder, stellen inzwischen um ein Vielfaches mehr Lebendmasse als alle Wildtiere an Land zusammen.[2] Wilde, unberührte Natur ist überall auf der Erde an den Rand gedrängt. Der Mensch beherrscht die Welt.
Die Anfänge einer ganz besonderen Spezies
Unsere Geschichte ist die einer Tierart, deren Ahnen einst auf Bäumen lebten, die sich dann auf den Boden stellte und die sehr viel später großartige Kulturen hervorgebracht hat. Es ist die Geschichte des Aufstiegs eines tierischen Wesens aus den Anfängen in der Natur, das schließlich gelernt hat, diese Natur zu beherrschen. Dabei verlief unsere Evolution keineswegs so linear und folgerichtig, wie es rückblickend erscheinen mag. Sie führte zwar zu Vielfalt und Fülle, zu Kultur und Komplexität, und doch handelt es sich dabei keineswegs um »Fortschritt« oder gar eine zielgerichtete Weiterentwicklung. Evolution verläuft unvorhersehbar, sie schlägt oft überraschende Wege ein. Das Erscheinen unserer Spezies ist nicht der unvermeidliche Höhepunkt einer Entwicklung; stattdessen liegen all unseren Errungenschaften und unserer heutigen Zivilisation viele glückliche Zufälle zugrunde.
Der Mensch ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ein historisches Produkt seiner Ahnenreihe, indes springen viele Versuche, die Geschichte der Menschheit zu erzählen, allein schon deshalb zu kurz, weil sie diese Geschichte lediglich als die der kulturellen Evolution des Menschen verstehen wollen. Doch in unserer Entwicklung geht es eben nicht nur um das erste gesprochene Wort, um die Erfindung der Schrift oder der Kunst. Wer nur dies in den Blick nimmt, der verengt ihn und lässt die viel längere, vielfältigere und bedeutende biologische Vorgeschichte außen vor. Die Fokussierung auf einige spezielle Attribute der Menschwerdung verstellt den Blick auf die äonenlange Evolution des Menschen innerhalb des Tierreichs und aus ihm heraus.
»Vor dem Menschen war das Tier« – selbst dieses Zugeständnis, das sich erst einmal richtig anhört, erweist sich als irreführend und offenbart gleichermaßen Arroganz wie Ignoranz. Wir sind eine von Millionen von Tierarten, an sich unbedeutend und unerheblich, weder Ziel noch Zweck der Evolution, eine arrivierte Affenart, deren Ahnen mehr als Glück hatten, überhaupt zu überleben.
Tatsächlich waren die Vorfahren des Menschen die längste Zeit ihrer Evolution selbst Tiere; zunächst huschten sie als spitzmaus-, dann eichhörnchenähnliche Wesen durchs Geäst tropischer Regenwälder, bevor – sehr viel später – menschenaffenähnliche Vertreter unserer Ahnen den Boden weniger bewaldeter Regionen als Lebensraum entdeckten. Erst unlängst, erdgeschichtlich gesehen vor nur einem kurzen Moment, haben sie sich – und das ist das Besondere – buchstäblich aufgemacht; sie haben sich aufgerichtet und gelernt, auf zwei Beinen zu gehen; sie begannen, Werkzeuge und das Feuer zu nutzen, bekamen größere Gehirne. Doch erst nach weiteren Millionen Jahren wurden sie zum bedeutenden Evolutionsfaktor auf diesem Planeten. Dabei kamen unsere Vorfahren die längste Zeit ohne artikulierte Sprache aus, ohne Wort und Schrift. Und erst nachdem sie schon lange ohne raffinierte Werkzeuge und ohne Feuer überlebt hatten, entwickelte sich ein modifiziertes Gehirn. Es ist diese viel längere biologische Evolution, die unser eigentliches Erbe ausmacht, die uns als Lebewesen geprägt und geformt hat – und eben nicht nur unser Äußeres, sondern auch unser »Inneres«, unsere Anlagen und Veranlagungen. Und sie hält uns noch immer fest im Griff, trotz der jüngsten kulturellen Entwicklung.
Wir sind Kinder des klimatischen Wandels
Die von den äußeren Umständen her wohl entscheidendste Wende in unserer Evolutionsgeschichte ging – nach allem, was wir wissen – mit paläoklimatischen Veränderungen in unserer Urheimat im östlichen Afrika einher. So komplex dieser natürliche Klimawandel in seinen Details ist, so sicher entstand dabei ein Lebensraumtyp offenen Graslands, mit einem Mosaik aus mehr oder auch weniger bewaldeten Habitaten, der gemeinhin als Savanne bezeichnet wird – und den wir hier in der Vereinfachung als den Urlebensraum aufrecht gehender Menschenahnen ansehen.
Während die frühen Vertreter der zum Menschen führenden Evolutionslinie noch im Waldland lebten, haben zum Bodenleben übergehende frühe Vorfahren des Menschen offene, von saisonalen Regenfällen abhängige Wälder statt der ständig feuchten Tropenwälder bewohnt. Da Nahrung in den von wechselnden Regenfällen geprägten offenen Wäldern deutlich weniger verlässlich zur Verfügung stand, war eine weit größere Flexibilität in der Ernährung und im Verhalten erforderlich, um die sich beständig ändernde Umwelt erfolgreich für sich zu nutzen. Dieser klimatisch bedingte neue Lebensraum stellte eine Herausforderung dar, aber er bot einem flexiblen und anpassungsfähigen Lebewesen auch neue evolutive Chancen. Und wenn wir etwas von uns Menschen wissen, dann wie äußerst flexibel und anpassungsfähig wir gerade in unserem Verhalten sind. Sich jenen Herausforderungen zu stellen, die der neue Lebensraum am Übergang des Waldes zur Savanne bot, das klingt ganz nach einer Rolle im Evolutionsgeschehen, die dem Menschen und seinen Ahnen wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint. Das bringt viele Forscher dazu, im Menschen vor allem eines zu sehen: ein Kind des klimatischen Wandels.
Wenn es in Afrika südlich der Sahara in den vergangenen etwa 10 Millionen Jahren einen langfristigen klimatischen Trend gab, dann den sinkender Temperaturen und geringerer Niederschläge. Als es im östlichen Afrika trockener wurde, verschwanden Waldländer, und Grasland breitete sich aus. Auf diese Weise klimabedingt ihrer Heimat in den Regenwäldern beraubt, wagten unsere Ahnen den Schritt in die entstandene Savanne und ließen ihre den Schimpansen ähnlichen Vettern im feuchteren Wald westlich des ostafrikanischen Grabenbruchsystems zurück.
So entfalteten Veränderungen seiner Umwelt, vom klimatischen Wandel angetrieben, in der Evolution des Menschen machtvolle Kräfte. Sie sorgten dafür, dass sich vor etwa 7 oder 8 Millionen Jahren Menschenaffen und Menschenahnen voneinander trennten, sie ließen vor 4 Millionen Jahren die aufrecht gehenden australopithecinen Frühmenschen entstehen. Mögen die Anfänge des aufrechten Gangs und die näheren Umstände auch weiterhin vage und umstritten sein, so besteht kein Zweifel daran, dass mit dem neuen Lebensraum der Savannen und dem aufrechten Gang schließlich etwas Neues und spezifisch Menschliches entstand. Es ist der entscheidende Meilenstein der Menschwerdung.[3] Unter ähnlich wechselnden klimatischen Bedingungen entstand dann vor rund 2 Millionen Jahren jene Evolutionslinie, die zur Gattung Homo führte. Schließlich könnte der Auszug des Homo erectus aus Afrika kurz darauf und später der des Homo sapiens ebenfalls mit klimatischen Veränderungen während der sich abwechselnden Eis- und Zwischeneiszeiten im Zusammenhang gestanden haben.
Vom Beginn seiner Evolution an ließen Schwankungen der Erdumlaufbahn und andere physikalische Veränderungen des Erdsystems den Menschen daher auf einer regelrechten Klimaschaukel Platz nehmen. So sind wir ebenso wie andere Organismen auch ein Ergebnis der natürlichen Veränderungen auf der Erde, einer sich stetig wandelnden Umwelt, einschließlich der Schwankungen des Klimas. Diesen äußeren Umständen verdanken wir es, dass unsere Ahnen sich einst jene neue ökologische Nische erschlossen, die wir bis heute in uns tragen. Wir mögen heute als Menschheit noch so weit gekommen sein – im Grunde sind wir immer noch Abkömmlinge der afrikanischen Savanne, deren Spuren uns buchstäblich in den Knochen stecken. Ihr verdanken wir unseren besonderen Körperbau, samt Rückenschmerzen, deren Ursprung mehr als 4 oder gar 6 Millionen Jahre zurückreicht.[4] Und wir trugen auch Spuren davon, die sich tief in unsere Psyche eingegraben haben.
Die Sache mit dem Gehirn – ist Denken Glückssache?
Ebenso wenig wie unser spezifischer Körperbau kam unser Gehirn samt seiner Erkenntnisfähigkeit aus dem Nichts, beide sind vielmehr als evolutionäre Anpassung auf natürlichem Weg entstanden. Und zu dieser Erkenntnisfähigkeit gehört auch, dass sie ihre Grenzen hat; denn sie diente einst dazu, in einer realen Welt zu überleben, nicht dazu, neue Welten zu denken. Die reale Welt vollständig abzubilden oder gar zu verstehen, war nicht ihr Ziel. Eine dadurch eingeschränkte Erkenntnisfähigkeit, die stets unmittelbar und lokal fokussiert ist und eben nicht global sinniert und agiert, stellt uns heute mehr denn je vor Probleme.
Bisher waren es vor allem Philosophen, die darüber spekulierten, wie unsere Vernunft und – wenn man das große Wort nicht scheut – unser Geist in die Welt gekommen ist. Doch auch als Biologen (die wir dabei dem Kosmos und der Natur jede Zielgerichtetheit absprechen, die diese nicht besitzen und deren Annahme die Naturwissenschaft seit Längerem überwunden hat) müssen wir fragen: Woher kommen Gehirn und Geist, Welt-Erkenntnis und Welt-Anschauung? Nach dem hier vorgestellten naturalistischen Weltbild verdankt sich die Entwicklung des Menschen seiner Anpassung an die jeweilige Umwelt: jene Urumwelt unserer australopithecinen Ahnen im einstigen afrikanischen Lebensraum. Letztlich sind auch unser Gehirn und dessen mentale Möglichkeiten der »reproduktiven Fitness« unserer Vorfahren geschuldet, oder anders gesagt: Auch unser Geist ist als nützlicher Helfer im Überlebenskampf ein Resultat der Evolution durch natürliche Selektion. Was für die einen einzigartig ist, an ein Wunder grenzt, das sich der menschlichen Ratio nicht erschließt, oder sich einem kaum weniger geheimnisvollen, auslegungsbedürftigen Schöpfer verdankt, das erklärt sich für andere auf natürliche Weise und schlicht evolutionistisch.
Natürlich ist gerade die Sache mit Gehirn und Geist kompliziert, und die Frage nach der Evolution der mentalen Möglichkeiten des Menschen ist gleich mit einer ganzen Serie von noch immer nicht aufgelösten Paradoxien verknüpft. Wie kann unser Gehirn, das doch erst spät in einer relativ großen Ausprägung auftritt, für die uns eingeräumte Sonderstellung verantwortlich sein, deren Ausgangspunkt bereits bei den Menschenaffenähnlichen der afrikanischen Urzeit liegt? Die Gehirnvergrößerung erfolgte eben nicht zeitgleich und allmählich mit der Entstehung des aufrechten Gangs, sondern erst Millionen Jahre nach dem Übergang zur Zweibeinigkeit; zwischen den beiden Schlüsselanpassungen gibt es mithin keinen Funktionszusammenhang, wie lange unterstellt wurde. Erst lange nach dem Dauerlauf kam das Denken, lange nach dem Aufrichten die Aufklärung. Zudem dürfte das Gehirn nicht maßgeblich für die Entstehung der direkten Ahnen des Menschen innerhalb der Gattung Homo verantwortlich sein, obwohl es ihn doch angeblich auszeichnet und von allen anderen Tieren abhebt. Es mag naheliegen, die Vergrößerung des Gehirns mit der Lebensweise des Menschen und seinen besonderen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verknüpfen, und so ist auch vielfach ein Zusammenhang vermutet worden, insbesondere mit unserer Ernährung, mit unserer Handfertigkeit, mit Werkzeuggebrauch, Sprache, Kultur und Kunst. Und doch ist bislang nicht überzeugend geklärt, was das Gehirn wirklich zu einem so besonderen Organ beim Menschen gemacht hat.[5]
Zugleich gehört es zweifelsohne zu den erstaunlichsten Paradoxien in der Natur, dass ausgerechnet wir als an sich anderweitig unspezialisierte Generalisten ein sehr spezielles Organ spazieren tragen, bei dem offenkundig mehr geliefert wurde, als bestellt war. Da es in energetischer Hinsicht alles andere als »verbrauchsneutral« kam, muss unser Gehirn einen hohen Auslesewert gehabt haben. Immerhin dienen in ihm heute 86 Milliarden Nervenzellen der Weiterleitung und Verarbeitung von Reizen. Es ist eine hochkomplexe Steuerzentrale, nicht nur um eine Vielzahl von Sinneseindrücken zu vergleichen, sondern auch um wichtige Informationen zu speichern und Denkaufgaben zu verrichten. Und doch erscheint dieses Denkorgan gleichsam als nette Zusatzausstattung, die eines Tages im Menü der Evolution bei einem Wesen auftauchte, das dadurch in die Lage versetzt wurde, die Welt zu begreifen.[6]
Keine Frage: Wir sind ein höchst merkwürdiges, ein höchst bemerkenswertes Tier. Nach Lage der Dinge handelt es sich beim Menschen um eine singuläre Erscheinung (wenigstens seit einigen Zehntausend Jahren, wie wir gleich noch sehen werden), und dies sicherlich nicht zuletzt, weil er etwas hat, was wir mit »Geist« und »Ratio« in Begriffe zu fassen versuchen. Die Suche nach den Besonderheiten des Menschen zeigt, dass er nur wenige Alleinstellungsmerkmale im Bereich des Biologischen hat, etwa den aufrechten Gang mit all seinen körperbaulichen Anpassungen. Oder eben das Gehirn, das uns zweifellos zu etwas Besonderem macht. Nur wir haben ein in dieser Weise entwickeltes bewusstes Innenleben, nennen wir es »Geist« oder »Seele«, nur wir verfügen über Vernunft oder Ratio, über Sprache und Kultur. Als Zweibeiner und Kulturwesen hat der Mensch sich dadurch scheinbar derart weit vom Tierreich entfernt, dass seine Sonderstellung lange gerechtfertigt erschien. Erst sein Geist und die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis haben den Menschen über seine tierischen Vorfahren hinausgehoben und zu dem werden lassen, was wir heute sind. Noch immer haben wir Descartes’ zentrale Einsicht »cogito ergo sum« (»Ich denke, also bin ich«) im Kopf. Nur der Mensch besitzt angeblich diesen zur Selbsterkenntnis befähigten Geist, die übrigen Tiere lediglich einen Körper, so der schier unerschütterliche Glaube vieler Menschen an sich selbst.
Allerdings erwies sich die Klärung der Frage, was den Menschen vom Tier unterscheidet, insgesamt als ein Rückzugsgefecht, je mehr die Verhaltensforschung über andere Tiere herausfand. Gleichwohl ist es die vorherrschende Sicht des Menschen auf sich selbst, dass wir ein sehr besonderes Tier sind. Über die physischen Fähigkeiten und Besonderheiten des Menschen ist viel bekannt. Allein ihm, so ist oft festgestellt worden, ist die Fähigkeit zu Sprache und Kultur gegeben, allein er beherrscht die Herstellung von Werkzeugen und komplexe Technologien, die maßgeblich auch über seine evolutionäre Zukunft entscheiden. Doch tatsächlich sind Menschenaffen durchaus ebenfalls für ihr Geschick bekannt: Orang-Utans öffnen Früchte mit einem Stock und schützen sich mit großen Blättern vor Regen. Gorillas wurden beobachtet, wie sie durch Tümpel wateten und mit einem Stock die Wassertiefe testeten. Schimpansen angeln mit kleinen, selbst gefertigten Stöckchen Termiten aus deren Bauten, sind somit in der Lage, Werkzeuge nicht nur zu gebrauchen, sondern auch herzustellen; zudem vermögen sie Nüsse mit Steinen zu knacken, wobei ihnen diese als Hammer und Amboss dienen. Keine Frage: Unsere haarigen Vettern sind schlau, sie erkennen sich sogar selbst im Spiegel, sind sich also wie wir Menschen ihrer selbst bewusst. Und obwohl Roboter regelmäßig beim Schach gewinnen, Computeralgorithmen inzwischen sogar Essays, Gedichte im Stil Goethes und alle möglichen anderen Textsorten verfassen, schlummert wahrer schöpferischer Geist angeblich nur in der vermeintlichen Krone der Schöpfung, im Hirn des Homo sapiens.[7]
Viele Verhaltensforscher, zumal in Gestalt von Primatologen, sind mit solchen Annahmen und Aussagen inzwischen mehr als vorsichtig. Man könne den Affen aus dem Urwald nehmen, aber nicht den Urwald aus dem Affen, so ist einer von ihnen, Frans de Waal, überzeugt, und er meint damit durchaus uns zweibeinige Affen. Was unser ureigenes Verhalten angeht, machen wir uns schließlich oft genug buchstäblich zum Affen. Wer auch nur etwas vom Verhalten von Schimpanse, Gorilla und Orang-Utan weiß (und de Waal selbst hat mit seinen Studien maßgeblich dazu beigetragen), kann diese simple Botschaft vom Affen in uns unmöglich übersehen.[8] Der gegenteilige Eindruck vom Menschen als rationalem Kulturwesen ist eine irrige Illusion. Oft genug übernehmen bei uns Triebe und Emotionen die Regie und lassen uns alle Regeln und Ratio vergessen. Wir entscheiden als gefühlsbetonte Kreaturen und zeigen wilde Aggression, als hätte es nie Kultur, Erziehung, »Zivilisation« gegeben. Der Mensch hat mehr vom Menschenaffen in sich, als wir wahrhaben wollen.
Wir Smartphoner: das soziale Netztier in uns
Genauso wie die Wurzeln für Emotionen und Instinkte liegen auch die Anfänge unseres intelligenten Verhaltens weit zurück in der Evolution. Wobei wir Intelligenz hier als Lernfähigkeit und Neugier verstehen, als Fähigkeit, sich Handlungen im geistigen Raum vorzustellen und zu planen. Zwar ist Intelligenz kein exklusives Merkmal des Menschen, wir teilen es mit unseren unmittelbaren Verwandten im Tierreich, den Menschenaffen. Und nicht nur diese, sondern auch andere Tiere sind lernfähig. Bei diesen wurden entsprechende mentale Fähigkeiten, je nach Umwelt, ebenso sukzessive optimiert und die Veranlagung zu bestimmten Verhaltensweisen und assoziativem Lernen im Erbgut verankert. Allerdings leben viele dieser anderen mental befähigten Tiere in der Regel einzelgängerisch, sie müssen sich weniger mit Gruppenmitgliedern »arrangieren« als unsere unmittelbaren Vorfahren und wir selbst. Das wirklich Besondere an uns und unserer engsten Verwandtschaft australopithecinenhafter Ahnen besteht darin, dass der Mensch ein erfolgreicher Affe ist, ein Affe mit einem komplex gebauten Gehirn, einem ebenso komplexen Sozialverhalten und vor allem der Fähigkeit zur Kooperation. Wir sind ein Zoon politikon – ein sozial höchst kompliziertes und komplex interagierendes Wesen, verstrickt im Geflecht des menschlichen Mit- und Gegeneinanders der Familiengruppe, in der wir gleichsam evolutiv aufgewachsen sind.
Betrachten wir die kognitiven Fähigkeiten und Leistungen jedes Einzelnen von uns, finden wir schwerlich einen prinzipiellen Unterschied zu anderen kognitiv hochentwickelten Tieren, zu Schimpansen, zu Elefanten und Delfinen etwa. Heute sind Verhaltensforscher überzeugt, dass auch viele andere Tierarten abstrakt und logisch denken und sogar über ihr Wissen und Denken reflektieren, dass sie Gefühlsleben, Selbstbewusstsein und in dem Sinne eine Biographie besitzen, dass sie wissen, wer sie sind und wie sie sich im Laufe ihrer Lebensspanne entwickelt haben, und sogar ihre Zukunft planen.[9]
Was uns aber so intelligent und smart, so einmalig macht, waren letztlich wir selbst. Unseren evolutiven Erfolg, vor allem aber unser ausgeprägtes Gehirn, seine Größenzunahme und unsere geistigen Fähigkeiten verdanken wir den sozialen Bindungen und Beziehungen untereinander. Viele Verhaltensforscher und Primatologen sind heute überzeugt, dass die Entwicklung sozialer Fähigkeiten die Vorbedingung zum kooperativen Verhalten war und dass diese Kooperation wiederum eine unverzichtbare Voraussetzung war, um in einer bedrohlichen und mit vielfältigen Gefahren und mächtigen Gegnern aufwartenden Umwelt zu überleben. Ein auf diese Weise »soziales Gehirn« und die ausgeprägte Fähigkeit zur Kooperation waren ursächlich verantwortlich dafür, dass sich Vor- und Frühmenschen überhaupt entwickelten und schließlich durchsetzen konnten; zugleich war dies für die beginnende kulturelle Evolution des Menschen verantwortlich.[10]
Wir haben unser großes Gehirn also nicht, um besser denken zu können, vielmehr um unser komplexes Sozialleben zu meistern. Die natürliche Auslese hat unter dem hohen Konkurrenzdruck anderer Lebewesen just den kooperierenden Menschen hervorgebracht, so ist etwa der australische Zoologe Tim Flannery überzeugt (woraus er auch Hoffnung für unsere Zukunft ableitet): »Wenn der Konkurrenzkampf die Antriebsfeder der Evolution ist, dann ist die Welt der Kooperation ihr Erbe.«[11]
Tatsächlich liegt es nahe zu vermuten, dass wir – im Vergleich zu den eigentlichen, mit Zähnen und Klauen ausgestatteten Raubtieren anfangs recht hilflos oder zumindest ohne besondere Verteidigungswaffen – einzig in der Gruppe gute Überlebenschancen hatten. Die Gruppe bot, wie bei vielen anderen der heutigen Primaten, ein gewisses Maß an Sicherheit. Dass wir Gruppen bilden und innerhalb dieser gelernt haben zu kooperieren, hat Vorteile für jeden Einzelnen; es ermöglichte erst unser Menschsein und ist verantwortlich für unseren evolutiven Erfolg. Doch unsere Form des Zusammenlebens ist zugleich anstrengend, vor allem für das Denken, mit dem wir die Übersicht über Beziehungen innerhalb der Gruppe behalten, das Verhalten anderer interpretieren und eigenes Handeln planen. Daher haben bereits unsere frühen Vorfahren ein großes Gehirn entwickelt, um den neuen Herausforderungen dieses Gruppenlebens gewachsen zu sein.
Wer macht was mit wem, wer kennt die besten Wasserstellen, wer findet wo Nahrung, wem folgt die Gruppe wohin, wer paart sich mit wem, wer ist Kind und Geschwister von wem? Wir müssen eine Menge sozialer Beziehungen verrechnen, um unseren Platz in der Gruppe zu finden. Und wir mussten stets und immer auf der Hut vor denen sein, die versuchen, sich soziale Vorteile zu erschleichen, indem sie mogeln und andere hinters Licht führen. Auch wer stibitzt und auf Kosten anderer Vorteile ergattert, musste eine besondere Art des Verhaltens entwickeln; andere mussten es erkennen und Antworten darauf finden, sich entsprechend verhalten. Die dazu erforderliche Rechenleistung lässt sich nur mit einem komplexen, mithin großen Gehirn bewältigen.
Nichts beschäftigt den Menschen – seit grauer Vorzeit und bis in unsere Tage – mehr als Fragen der zwischenmenschlichen Interaktion und Kommunikation. Von den ersten schriftlichen Dokumenten und antiken Dossiers über die Briefkorrespondenz, von den Anfängen der Erzählung über Romane bis zu Smartphone und Social Media dominiert das soziale Mit- und oft genug Gegeneinander unsere menschliche Kultur. Immer ging es und geht es um die Frage: Wer macht was mit wem? Wir sind eine unersättlich neugierige Spezies, sofern es dabei um uns als Person geht und um Menschen, die wir kennen oder gern kennenlernen würden. Womit verbringen wir die meiste Zeit, wozu brauchen wir heute am häufigsten jenes hochtechnisierte Telefon (mit einer Leistung, mit der sich früher Mondlandefähren hätten steuern lassen): mit Kommunikation auf dem Niveau von: »Hast du schon gehört …?« Im Grunde genommen geht es bei uns Menschen immer um uns selbst und die anderen um uns herum; darum, was wir machen, und um das, was die anderen gerade machen. Wir sind ewige Smartphoner und waren es bereits, lange bevor wir dazu die neuesten technischen und medialen Möglichkeiten entwickelt hatten. Unser soziales und kommunikatives Verhalten, das unseren Alltag bis heute mehr beherrscht als irgendetwas anderes, ist uraltes Primatenerbe. Ihm verdanken wir letztlich unsere Evolution. Was am Anfang das Lagerfeuer der nomadisierenden Gemeinschaft war, ist heute die WhatsApp-Gruppe, das Gespräch wird zum Chat.
In erster Linie ist der Mensch ein soziales Wesen; dazu hat er hochkomplexe Formen der Kommunikation, der Kooperation und der Imagination entwickelt. Das sicherte anfangs sein evolutives Überleben und machte ihn anderen Tieren überlegen. Inzwischen wird im hohen Grad der Bereitschaft des Menschen zur Kooperation der einzige wirkliche Unterschied zu den Tieren gesehen. Und es geht noch weiter: Mit der Intelligenz und sozialen Kompetenz unserer homininen Ahnen kamen auch Lüge und Täuschung in die Welt, so glauben einige Verhaltensforscher. Dass die Lüge eine animalische Mitgift des Menschen ist und die Täuschungsabsicht in uns angelegt ist, ja, dass Täuschung und Betrug sogar wichtige Antriebsfedern für die Evolution menschlicher Intelligenz und unserer Emotionen waren, davon ist etwa Volker Sommer überzeugt.[12] Er sieht Lug und Trug als eine wichtige gestalterische Kraft unserer mentalen und emotionalen Landschaften – nicht etwa als Ausdruck der allmählichen Degeneration komplexer Zivilisation, sondern als uraltes Naturerbe. Es sind gerade die Lügen und Täuschungen, Heimlichtuereien und Intrigen, die uns erst zu Menschen machen. Die üble Lüge habe dabei zugleich ihr Gutes, so Sommer; sie bescherte uns nämlich jene ausbeuterische Fähigkeit, uns in andere hineinversetzen zu können. So können wir fühlen, wie es um jemanden steht. Daher kommt Volker Sommer aber auch zu dem Schluss, dass »auf dem Mist der Lüge auch die schöne Blume des Mitleids und der Sympathie gewachsen« sei. Die herausragende Eigenschaft der menschlichen Intelligenz, nämlich dass wir anderen helfen, sei erst auf diese Weise entstanden.
Wo Schatten ist, muss auch Licht sein, oder umgekehrt. Weil wir uns streiten und Konflikte austragen, gibt es überhaupt Versöhnung. Weil wir egoistisch sind, kommt es zur Kooperation. Weil wir betrügen, fühlen wir miteinander und helfen einander. Leider gehört indes noch etwas anderes zu uns als sozialen und an sich kooperierenden Wesen. Die Bildung stabiler sozialer Gruppen – anfangs als biologisches Verhalten, später auch als kultureller Prozess – barg bereits den Keim für Ausgrenzung, Unterdrückung und Ausbeutung von Angehörigen anderer, fremder Gruppen in sich. In diesem Sinne ist Afrika nicht nur der Ursprung der biologischen, sozialen und kulturellen Evolution der Menschen; der Kontinent ist zugleich auch Ursprung von Unterschieden und Ungleichgewichten, die Ungerechtigkeiten und Unterdrückung mit sich bringen.[13]
Heute leben wir in einer von uns geschaffenen Umwelt und Kultur, die mit nichts im Tierreich zu vergleichen ist. Ohne Frage ist es höchst beachtlich, was dieses Zoon politikon mit seinem biologischen Vermächtnis von Konflikt und Kooperation, sozialer Intelligenz samt Trug und Täuschung geschaffen und aufgebaut hat. Nicht vergessen dürfen wir aber, gerade wenn wir die Kooperation betonen, dass jedes einzelne Individuum nur einen Bruchteil dessen beherrscht, was zu dieser Kulturleistung nötig ist. Der Einzelne ist heute ohne die anderen nicht überlebensfähig. Vielfach wissen wir nicht einmal mehr, wie wir uns in der modernen, hochtechnisierten Welt auf uns allein gestellt Nahrung verschaffen sollten. Auf Gedeih und Verderb sind wir mehr denn je auf Kooperation und immer komplexere Formen des Miteinanders angewiesen.[14]
Ein Zeitalter menschlicher Einsamkeit
Eine »kurze Geschichte der Menschheit« ist inzwischen mehrfach geschrieben worden.[15] Sie lässt sich hier als noch kürzere Geschichte erzählen, denn uns interessiert dabei in erster Linie die Frage, was uns zu einer so derart erfolgreichen Spezies machte und uns zudem als einzige der verschiedenen früheren Menschenformen überleben ließ. Wir sind eine Art, die sich selbst als etwas so Besonderes ansieht, dass sie von sich lange als der »Krone der Schöpfung« sprach, die sich als »weise« (lateinisch sapiens) bezeichnet und die neuerdings sogar ein ganzes Erdzeitalter, das Anthropozän (von griechisch anthropos, der Mensch), nach sich benennt.
Der amerikanische Biologe Edward O. Wilson hat vorgeschlagen, statt von der »Menschenzeit« besser vom »Eremozän« zu sprechen – dem Zeitalter der eremitischen Einsamkeit.[16] Er meinte dies zwar vor allem mit Blick auf die drohenden Verluste der Artenvielfalt auf der Erde, die es zunehmend einsamer um den Menschen werden lassen. Tatsächlich ist es jedoch auch ein passender Ausdruck für den oft übersehenen, aber durchaus beachtenswerten Umstand, dass wir erstmals seit den letzten 30000 oder 40000 Jahren – jedenfalls erst seit vergleichsweise kürzester Zeit – als Menschen allein auf der Welt sind. Nach über 7 Millionen Jahren Menschheitsevolution gibt es mit Homo sapiens weltweit nur noch eine einzige Hominidenart. Nur wir haben überlebt; alle anderen Menschenformen sind ausgestorben. Vieles deutet darauf hin, dass unser Werdegang als Art begleitet ist vom Verschwinden anderer Menschenformen.
Ob überhaupt und inwieweit wir aktiv daran beteiligt waren, ist hochspekulativ. Sicher ist derzeit nur: Wir sind die einzigen Überlebenden einer einst breit mäandrierenden Stammeslinie, die sich schließlich aus Afrika über die Welt ergoss, aus der alle anderen Menschenformen verdrängt wurden. Während Homo erectus unterging, hat Homo sapiens überlebt. Während der Neandertaler und die noch immer mysteriösen Denisova-Menschen ausstarben, haben wir uns durchgesetzt. Erstere waren kräftiger als wir, hatten sogar größere Gehirne; sie fertigten Werkzeuge und Schmuck und waren in ihren Kulturleistungen kaum weniger entwickelt als wir; vor allem waren sie anfangs besser an das kältere Klima des Nordens angepasst als unsere wärmeliebenden afrikanischen Ahnen. Welche Faktoren lassen sich benennen, die uns hervorgebracht und befördert haben? Was ist es, das uns zum alleinigen Sieger machte? Es war schließlich kein Naturgesetz, dass Homo sapiens