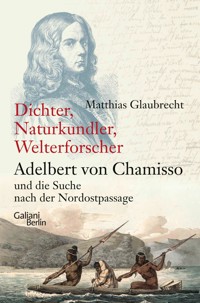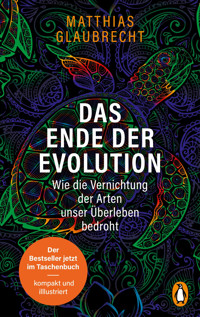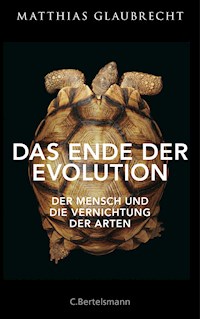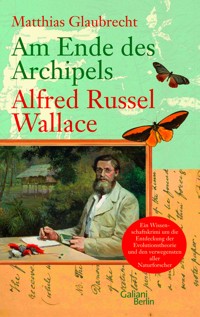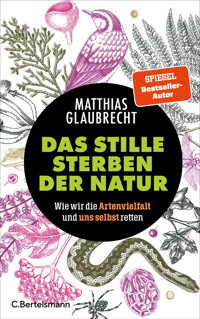
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gefährliche Ignoranz: Wir befinden uns mitten in einem weltumspannenden Artensterben – Wie falsche Weichenstellungen in Politik und Gesellschaft unsere natürlichen Lebensgrundlagen bedrohen und was wir tun sollten
Von vielen unbemerkt verschwinden immer mehr Tiere und Pflanzen aus unserer Umwelt, was unsere Lebensgrundlagen zunehmend gefährdet. Der bekannte Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht klärt seit Jahren über die Bedeutung der Artenvielfalt und die verheerenden Folgen des Artensterbens auf. Hier beschreibt er Gründe, warum wir die Krise der Biodiversität zu wenig wahr- und zu wenig ernst nehmen: Wir fokussieren zu sehr auf den Klimawandel, hinzu kommen das Versagen des klassischen Naturschutzes und eine oft verfehlte Wissenschaftspolitik, die ökologische und biosystematische Forschung zu wenig fördert. Glaubrecht ruft dazu auf, endlich zu handeln: das heißt, ausreichend große Naturschutzgebiete konsequent für funktionierende Lebensgemeinschaften zu schützen, zu renaturieren und die Biodiversitätsforschung voranzutreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gefährliche Ignoranz: Wir befinden uns mitten in einem weltumspannenden Artensterben – wie falsche Weichenstellungen in Politik und Gesellschaft unsere natürlichen Lebensgrundlagen bedrohen und was wir tun sollten.
Von vielen unbemerkt verschwinden immer mehr Tiere und Pflanzen aus unserer Umwelt, was unsere Lebensgrundlagen zunehmend gefährdet. Matthias Glaubrecht gehört zu den bekanntesten Evolutionsbiologen in Deutschland. Seit Jahren klärt er über die Bedeutung der Artenvielfalt und die verheerenden Folgen des Artensterbens auf. Hier beschreibt er Gründe, warum wir die Krise der Biodiversität zu wenig wahr- und zu wenig ernst nehmen: Wir fokussieren zu sehr auf den Klimawandel, hinzu kommen das Versagen des klassischen Naturschutzes und eine oft verfehlte Wissenschaftspolitik, die ökologische und biosystematische Forschung zu wenig fördert. Glaubrecht ruft dazu auf, endlich zu handeln: das heißt, ausreichend große Naturschutzgebiete konsequent für funktionierende Lebensgemeinschaften zu schützen, zu renaturieren und die Biodiversitätsforschung voranzutreiben.
Über den Autor
Der Evolutionsbiologe und Biosystematiker Matthias Glaubrecht, Jahrgang 1962, ist Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg und wissenschaftlicher Leiter des Projekts Evolutioneum / Neues Naturkundemuseum Hamburg am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Er war zuvor Gründungsdirektor des Centrums für Naturkunde der Universität Hamburg und Leiter der Abteilung Forschung sowie Kurator am Museum für Naturkunde Berlin. Glaubrecht schreibt regelmäßig für Zeitungen und Zeitschriften wie Die Zeit, Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung, war an TV-Produktionen (z. B. TerraX) beteiligt und hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter den Spiegel-Bestseller Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten (2019). Für seine Arbeit erhielt er 1996 den Werner und Inge Grüter-Preis für Wissenschaftsvermittlung, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung zeichnete ihn 2023 mit dem renommierten Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa aus.
www.cbertelsmann.de
MATTHIAS GLAUBRECHT
DAS STILLE STERBEN DER NATUR
Wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 C. Bertelsmann
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Lektorat: Susanne Warmuth
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildungen: Shutterstock / Yevheniia Lytvynovych
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32547-3V001
www.cbertelsmann.de
Für Nora
Wenn unser Planet uns am Herzen liegt, und mit ihm die Menschen und Tiere, die darauf leben, können wir zwei Haltungen dazu einnehmen. Entweder wir hoffen weiter, dass sich die Katastrophe verhindern lässt, und werden angesichts der Trägheit der Welt nur immer frustrierter oder wütender. Oder wir akzeptieren, dass das Unheil eintreten wird, und denken neu darüber nach, was es heißt, Hoffnung zu haben.
Jonathan Franzen[1]
Inhalt
Am Anfang vom Ende? – Worum es wirklich geht
Klimawandel und Artenkrise – ein fatales Missverständnis
Was wir dennoch aus der Klimadebatte lernen
Was wir auch lernen – Kipppunkte gibt es nicht
Tödliche Listen – hat der Naturschutz bisher versagt?
Das Aussterben der Artenforscher
Inventur der Natur als NASA-Unternehmung
Wie wir die Artenkrise noch abwenden können
Dank
Anmerkungen
Zitierte Literatur
Am Anfang vom Ende? – Worum es wirklich geht
Am letzten Tag im vergangenen Mai stand ich am Fuß des Vesuvs, inmitten der Ruinen des antiken Herculaneum. Dieser Ort rangierte lange schon ganz oben auf meiner Liste jener Ziele, zu denen ich unbedingt reisen wollte, um sie mit eigenen Augen zu sehen. Nun gab es endlich einen willkommenen Anlass, einen Vortrag an der Stazione Zoologica in Neapel. Am nächsten Tag fuhr ich entlang der Bucht bis nach Ercolano, wo ich mitten in der Ortschaft das archäologische Grabungsgelände der antiken Stätte fand. Zeitgleich mit dem nahe gelegenen Pompeij war auch die kleine Stadt Herculaneum vor zweitausend Jahren beim Ausbruch des Vulkans durch vulkanische Asche, Bimssteinregen und Lava zerstört worden, Tausende Menschen starben. Offenbar hatte der Vesuv damals seinen Gipfel gesprengt und vielen Bewohnern der Ansiedlung keine Zeit mehr zur Flucht gelassen.
Jetzt, an diesem warmen Frühsommertag, breitete sich eine unbeschwerte Ruhe über den Ruinen der antiken Stadt aus, die vor dreihundert Jahren unter den meterhohen Ablagerungen wiederentdeckt wurde. Mittlerweile ist Herculaneum wenigstens teilweise freigelegt und zählt, zusammen mit den archäologischen Stätten von Pompeji, zum UNESCO-Welterbe. Von hier schweifte mein Blick immer wieder hinauf zum wolkenumkränzten Kegel des Vulkanbergs, der sich so scheinbar friedlich im Hintergrund erhob. Doch ich wusste, dass der Schein trügt: Der Vulkanismus am Vesuv ist einer der aktivsten weltweit. Bereits im September und Oktober des Vorjahres hatte die Erde über einige Wochen hinweg wiederholt gebebt, und lautes Grollen und Krachen versetzte die in diesen Dingen eher unerschrockenen Neapolitaner in Angst. Die Beben nahmen zu, im März, April und Mai 2024 rumorte es wieder, Erdstöße bis zur Stärke 4,4 wurden rund um die sogenannten Campi Flegrei, die »brennenden Felder«, im Westen der Stadt gemessen.
Am Rande der Metropolregion Neapel gelegen, in der mehr als vier Millionen Menschen leben, gelten die über hundert Quadratkilometer großen Phlegräischen Felder bei Geologen als größter aktiver Supervulkan – und als einer der gefährlichsten. Kaum mehr als eine Woche vor meiner Reise nach Neapel hatte es in der Region eines der schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten gegeben. Die Gefahr eines erneuten Ausbruchs ist inzwischen eindeutig gestiegen, zumal Experten zuletzt Hinweise fanden, dass sich Magma und Gase in nur wenigen Kilometern Tiefe unter den Phlegräischen Feldern ansammeln. Doch das verdrängen die Neapolitaner meistens erfolgreich.
Als ich wenig später oben auf dem Gipfel des Vesuvs am Kraterrand stand und von dort über die dichten Ansiedlungen blickte, die sich bis zur im Dunst verschwindenden Großstadt erstreckten, fragte ich mich mit leichtem Schaudern, wie die Menschen wohl auf den nächsten größeren Ausbruch des schlummernden Vulkans reagieren. Niemand weiß, wann dies sein wird; doch er wird kommen. Eine Evakuierung der gesamten gefährdeten Region wird eine Herkulesaufgabe sein. Und wenn der rumorende Vesuv oder die »brennenden Felder« wieder aus- und aufbrächen, wäre dies nicht nur eine Katastrophe für Neapel und die nähere Umgebung. Die zu erwartenden meterdicken Ascheschichten, unter denen Mittelitalien versinken würde, wären dabei nur ein kleiner Teil der Katastrophe; betroffen wären außerdem die Infrastruktur und die Ernährung von vielen Millionen Menschen in Europa und vielleicht darüber hinaus. Ein großer Vulkanausbruch im Mittelmeerraum dürfte wegen seiner Auswürfe und Gase, die kilometerweit hinauf in die Atmosphäre ziehen, weitreichende Konsequenzen haben und könnte unter Umständen sogar unser Klima, die Umwelt und damit das Leben rund um den Erdball massiv beeinflussen.[1]
Aber die Bewohner der Stadt und der Umgebung des Vesuvs sind, wie mir schien, geradezu demonstrativ gelassen und erfreuen sich ihres mediterranen Lebens am Golf von Neapel. Wenn sie doch einmal, wie unlängst, eines der stärkeren Beben beunruhigt, ist dies bald darauf wieder vergessen – ebenso, dass sie wie ihre Vorfahren seit Tausenden von Jahren mitten in einer der tektonisch gefährlichsten Regionen Europas und der Erde leben.
Ähnlich wie die Neapolitaner, das wurde mir dort am Vesuv inmitten der Zeugnisse historischer Zerstörung einmal mehr klar, verdrängen wir alle – die inzwischen mehr als acht Milliarden zählende Menschheit – uns drohende Gefahren; jedenfalls, solange sie uns nur potenziell und eben nicht ganz unmittelbar bedrängen. Als Spezies, so formulierte es der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen einmal treffend, seien wir Menschen darauf programmiert, nicht vorausschauend zu denken und eine Zukunft, die vielleicht nie eintritt, einfach abzutun.[2] Mag sein, dass der Mensch seit Langem im Leugnen selbst des Lebensbedrohlichen erprobt ist, doch weil wir einen bereits dicht besiedelten Planeten bewohnen, hat dies heute sehr viel fatalere Folgen. Natürlich sind wir gern sorglos und bequem. Wie aber ist es möglich, dass wir – obwohl wir nicht erst seit gestern und immer besser wissen, dass akuter Handlungsbedarf besteht – doch einfach so weitermachen wie gehabt, als spürten wir das Rumoren und das Beben unter unseren Füßen nicht? Ohne Frage besteht eine ebenso erhebliche wie erstaunliche Diskrepanz zwischen der Dringlichkeit und der Wahrnehmung eines Problems. Offenkundig haben wir Menschen ein Problem damit, Risiken realistisch einzuschätzen und entsprechend Vorsorge zu treffen.
Fokussiert auf die jeweiligen Augenblickskrisen der Zeit leiden wir unter akuter Amnesie, sobald keine direkte Gefahr für unser Wohlbefinden mehr droht. Und genauso gehen wir auch mit der wohl größten Gefahr für das Überleben der Menschheit um – dem schleichenden Artenschwund und Artensterben, der Krise der Biodiversität, die zunehmend unsere Lebensgrundlagen bedroht. Denn wir Menschen greifen nicht nur in die Geosphäre ein, indem wir einen signifikanten Anstieg der Temperatur der Atmosphäre und der Oberfläche der Meere herbeiführen. Vielmehr beeinflussen wir längst auch in vielfältiger Weise die Biosphäre und sind selbst zu einem Evolutionsfaktor des Lebens auf unserem Planeten geworden. Bedingt dadurch nehmen die Vielfalt und Vielzahl der Lebewesen auf der Erde in dramatischer Weise ab, und zwar stärker noch, als bisher ohnehin schon vermutet wurde. Demnach sind im Durchschnitt mehr als zwei Drittel aller untersuchten Tierbestände in den vergangenen Jahrzehnten verloren gegangen.[3]
Der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) warnt davor, dass in wenigen Jahrzehnten eine Million von schätzungsweise acht oder neun Millionen auf der Erde existierenden Tier- und Pflanzenarten ausstirbt. Jüngste Hochrechnungen zeigen für Europa, dass im Schnitt etwa ein Fünftel der untersuchten Arten vom Aussterben bedroht ist. Rechnet man diese Daten weltweit hoch, wären sogar zwei Millionen Arten in Gefahr, für immer zu verschwinden – beinahe doppelt so viele, wie vom IPBES angenommen.[4] Das kann und darf uns keinesfalls gleichgültig sein. Denn jede Art ist ein wichtiger Bestandteil des Werkzeugkastens der Natur, der sich über einen sehr langen Evolutionszeitraum perfektioniert hat. Diese aufeinander abgestimmte Vielfalt an Arten baut sämtliche uns umgebende Ökosysteme auf; sie sind wie die Maschen eines ökologischen Netzes, die nicht beliebig entfernt werden dürfen, wenn es noch seine Funktion erfüllen soll. Es sind die Ökosysteme, die diesen Planeten erst zu einem belebten und für uns und andere bewohnbaren Ort im Universum machen – dem einzigen, von dem wir dies mit Sicherheit wissen und sagen können.
Aber vielen Menschen scheint immer noch nicht klar zu sein, dass Biodiversität mehr ist als das Steckenpferd verschrobener Biologen oder das ästhetische Sahnehäubchen einer uns nun einmal umgebenden natürlichen Umwelt. Die Artenvielfalt ist vielmehr unsere Lebensversicherung; denn einer funktionierenden Biodiversität in den Böden und der darauf gedeihenden Vegetation, in Gewässern und Meeren verdanken wir sauberes Wasser und Luft sowie sämtliche Nahrungsmittel und unsere Gesundheit. Alles, was wir sind und was wir tun, hängt von der Natur ab.
Diese Natur aber müssen wir neu denken, das Leben auf der Erde neu sehen. Denn ohne Übertreibung und ohne jedes Pathos können wir sagen: Der enorme, wachsende Verlust irdischer Lebensformen stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar; und wie wir damit umgehen, ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen – mehr noch als der und unabhängig vom gegenwärtig so viel debattierten Klimawandel. So meine Behauptung hier. Wir müssen erkennen und anerkennen, dass hinter jedem Wachstum der Wirtschaft, hinter unserem Wohlstand und dem Wohlergehen wenigstens der meisten in der westlichen Welt, hinter unserer Selbstzufriedenheit und Selbstgefälligkeit im globalen Norden der Niedergang der Natur lauert. Wir sehen zu, wie unsere moderne Zivilisation den Planeten entwaldet, die Ozeane entleert und wie wir Krieg gegen die Natur führen. Wir erleben ein weiteres naturhistorisches Massensterben der Tier- und Pflanzenwelt – das sechste Artensterben, das dieses Mal allerdings allein menschengemacht ist. Doch immer noch verweigern wir uns dieser Erkenntnis, ignorieren wir die globale Artenkrise und schenken dem Leben um uns herum nicht ausreichend Aufmerksamkeit.
Haben sich unsere Lebensbedingungen in den zurückliegenden Jahrzehnten global gesehen nicht insgesamt erheblich verbessert? So könnte man durchaus einwenden. Nach wie vor scheint die Natur auf diesem Planeten einigermaßen intakt zu sein, nach wie vor erscheint alles weitgehend normal, und die anderen Krisen dieser Welt kommen uns stets wichtiger und dringlicher vor. Tatsächlich aber kämpft die Natur vielerorts auf der Erde längst ums Überleben, im Würgegriff von intensiver Landwirtschaft und einem gierigen Welthandel, vorangetrieben von Rohstoffhunger und Ressourcenverbrauch. Diese ließen eine Welt von unserer Hand entstehen, das Anthropozän oder die Menschen-Zeit. Genau genommen kein Titel, auf den wir stolz sein können, sägen wir doch munter an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Damit hier gar nicht erst Zweifel aufkommen: Ohne Frage ist auch die Klimakrise real, sind die Extremwetter und ihre Folgen eine existenzielle Bedrohung unserer Zivilisation. Aber ist die Erderwärmung wirklich »das Problem unserer Zeit, vielleicht das größte Problem in der Geschichte der Menschheit«?[5] Allein darauf zu fokussieren und unser Handeln zu fixieren, wie es derzeit geschieht, ist eine fatale Fehleinschätzung und ein folgenschwerer Irrtum. Wir haben nicht nur mit dem Klima ein Problem, sondern auch und vor allem mit der Biodiversität. Selbst ohne Zutun des Klimawandels gibt es ein massenhaftes Sterben der Arten. Denn die verdrängen wir in gleich zweifacher Hinsicht.
Darum geht es in diesem Buch ebenso wie um jene Faktoren, die uns daran hindern, weitere Verluste der Artenvielfalt zu vermeiden und die globale Krise der Biodiversität zu meistern. Es geht dabei nicht darum, den Klimaschutz zu negieren oder gegen die Artenkrise auszuspielen. Doch Ökosysteme wie etwa Wälder oder Wiesen sind weit mehr als nur Dienstleister der Dekarbonisierung und Hausburschen der Kohlenstoffbilanz, sie dürfen nicht einfach auf dem Altar neuer Energieformen geopfert werden. Das Thema Artenvielfalt muss aus dem Schatten der Klimadebatte heraustreten, es darf nicht länger an den Rand des Diskurses um den Erhalt der Umwelt gedrängt werden. Sonst zerstören wir die Natur in der Absicht, sie zu retten.
Wir müssen dazu einseitige Festlegungen infrage stellen und allgemeine Annahmen überprüfen, wie etwa jene zu den oft bemühten Konzepten der Kipppunkte des Klima- und Erdsystems und zu planetaren Belastungsgrenzen. Wir müssen zugleich über Maßnahmen und das bisher Erreichte im Natur- und Umweltschutz nachdenken, über die Wirksamkeit von Nationalparks und anderen Naturschutzgebieten, und schließlich auch den Fetisch der Roten Listen bedrohter Arten hinterfragen. Ich werde hier eine Lanze für Artenforscher brechen – jene Fachleute oder »Bionauten« (wir kommen dazu), die Tiere und Pflanzen erkennen, erfassen und erforschen und die mittlerweile selbst schon auf einer Roten Liste stehen müssten.
Dabei werde ich auch untersuchen, warum wir den Artenschwund nicht genauer beziffern können und inwieweit moderne Technologie einschließlich künstlicher Intelligenz uns zukünftig bei der Taxonomie und einer vollständigen Inventur der Natur helfen kann – oder auch nicht. Vor allem ist dieses Buch ein Plädoyer dafür, der Natur wieder mehr Raum zu geben und so die Vielfalt der Arten zu erhalten, um die Funktionalität der Lebensräume zu gewährleisten – und damit last, not least auch unser eigenes Überleben; was hier sowohl menschliches Wohlergehen wie stabile Gesellschaften und wirtschaftliche Entwicklung meint. In diesem Zusammenhang plädiere ich dafür, auch in der Wissenschaft nicht länger Milliardenbeträge buchstäblich zum Mond und Mars zu schießen, statt sie hier auf der Erde endlich unmittelbar nutzbringend in ein biologisches Großforschungsvorhaben zum Erhalt unserer Um- und Mitwelt zu investieren. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir haben nur eine Erde – und wir können nicht Millionen oder gar Milliarden Menschen auf andere Himmelskörper schicken, wenn ihr Überleben hier nicht mehr gesichert ist.
Leicht kann man angesichts der Krise der Biodiversität die Hoffnung verlieren. Mit dieser essayistischen Intervention möchte ich zeigen, wo wir derzeit in Sachen Natur- und Umweltschutz und der Erforschung der Artenvielfalt und ihrer Funktionalität stehen und was wir dringend tun müssen, um einer »biological annihilation« entgegenzuwirken – jener von Fachleuten befürchteten Entleerung des Lebens auf unserer Erde. Denn noch kann uns das gelingen, noch ist weder unsere Erde noch das Leben darauf verloren.
Noch ist der Vulkan nicht ausgebrochen.
Klimawandel und Artenkrise – ein fatales Missverständnis
Mich hat es immer in die Wärme gezogen. Als Wissenschaftler beschäftige ich mich seit dreißig Jahren vornehmlich mit Evolution und Biosystematik, und das – ausgerechnet – am Beispiel tropischer Süßwasserschnecken. In meiner Arbeitsgruppe, zuerst in Berlin am Naturkundemuseum, dann am Zoologischen Museum in Hamburg, haben wir bis dahin unbekannte Arten und ihre Vorkommen vor allem in Südostasien und Australien beschrieben und das alte Mysterium Darwins untersucht, wie neue Arten entstehen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. So kurios das im ersten Moment erscheinen mag, an Schnecken lassen sich solche grundsätzlichen Fragen der Biologie ideal erforschen. Und daher sind etwa die Hochlandseen der indonesischen Insel Sulawesi, die Bäche in Thailand und die Flüsse im Norden des australischen Outback jene Orte, die ich aus eigenem Erleben am besten kenne. Diese tropisch-warmen Gefilde und Gebiete in der äquatornahen Zone sind auch jene, in denen es weltweit von den meisten der vielen verschiedenen Arten an Tieren und Pflanzen nur so wimmelt – an Land wie im Wasser, Schnecken eingeschlossen.
Ich habe mich gefragt, ob es möglicherweise mit diesem spezifischen Forschungsfokus zusammenhängt, dass ich den rasanten Verlust der biologischen Vielfalt als eine ebenso akute wie weithin unterschätzte Gefahr ansehe, und eben nicht allein den Klimawandel, den so viele mit dem schmelzenden Eis der Polarregionen und der Gletscher assoziieren. In beiden Fällen sind wir Menschen keineswegs nur Zaungast, sondern zugleich Zeuge und Verursacher, also auch der Grund für den vielleicht größten Rückgang der Biodiversität seit dem Ende der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren. In sämtlichen Lebensräumen weltweit verschwinden einmalige und unwiederbringliche Tier- und Pflanzenformen – und das massenhaft. Doch anders als allenthalben angenommen hat dies nichts mit dem Klimawandel zu tun.
Dass sich das Klima ändert, steht außer Frage. Nur übersehen wir darüber den rasanten Artenschwund, der vor allem durch unsere Bewirtschaftung des Landes verursacht wird. Wenn wir weiterhin sämtliche Lebensräume der Erde übernutzen, insbesondere in den Tropen die Wälder vernichten und die Ozeane plündern, aber auch der Natur bei uns keinen Raum mehr lassen, dann wird die menschengemachte Klimaveränderung kaum noch etwas zur ökologischen Apokalypse beitragen, was die Artenkrise nicht schon mit sich gebracht hätte. Wir Menschen sind aufgrund unserer (nach wie vor) nach oben gerichteten Bevölkerungskurve, unserer Wirtschaftsweise und unseres Umgangs mit Ressourcen inzwischen zu einem eigenen Evolutionsfaktor geworden, zum stärksten Treiber sowohl geologischer wie biologischer und insbesondere ökologischer Prozesse. Das ist der Grund für die aktuelle Artenkrise, ganz unabhängig vom Klimawandel.
Bildhaft wird dieses Missverständnis um Klima und Arten, wenn wir uns die eindrücklichen Aufnahmen etwa von Eisbären auf winzigen Eisschollen vor Augen rufen. Unlängst wurde ein britischer Fotograf namens Nima Sarikhani als Wildlife Photographer of the Year 2024 ausgezeichnet, dessen Foto einen an einen kleinen driftenden Eisberg geschmiegten schlafenden Eisbären zeigt. Dieses Bild berühre uns emotional, weil wir es als friedlich, aber zugleich auch als melancholisch ansehen, heißt es in der Begründung der Jury des Londoner National History Museum. Mir dagegen wurde beim Betrachten bewusst, wie trügerisch der hier ikonenhaft dokumentierte Eindruck des von uns verursachten Klimawandels ist, der Eis schmelzen und dadurch vermeintlich Arten verschwinden lässt. Denn die zusammen etwa 25 000 Eisbären in den knapp zwanzig Populationen rund um die Arktis sind keineswegs unmittelbar vom Aussterben bedroht; sie waren es in der Vergangenheit nicht und sind es auch zurzeit nicht. Beinahe alle Bestände sind stabil, einige legen sogar zu, lediglich eines der südlichsten Vorkommen – ein indes vielbeachteter Bestand an der westlichen Hudson Bay – verzeichnet sinkende Zahlen. So weist auch die renommierte Naturschutzorganisation WWF zu Recht darauf hin, dass Eisbären zu den wenigen großen Fleischfressern gehören, die noch ungefähr in ihrem ursprünglichen Lebensraum und Verbreitungsgebiet zu finden sind – und deren Zahl sogar gegenüber früheren Zeiten, als sie noch bejagt wurden, zugelegt hat.[1]
Keine Frage, dass sich die klimatischen Bedingungen – gerade auch in der Arktis – verschoben haben, wie verschiedene neuere Studien einmal mehr zeigen. Demnach kam es in den beiden vergangenen Jahrzehnten zu knapp einem Dutzend Hitzewellen in den Randgebieten des Arktischen Ozeans mit durchschnittlich um mehr als zwei Grad wärmeren Meerestemperaturen an der Oberfläche.[2] Auch in der Arktis waren 2023 und 2024 die wärmsten Jahre seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen vor anderthalb Jahrhunderten, wobei die fünf wärmsten je registrierten Jahre alle nach 2016 auftraten und zu einer unterdurchschnittlichen Ausdehnung des Meereises führten.[3]
Und keine Frage, dass sich dadurch die Umwelt der Eisbären ändert. Das wärmere Wasser und der anhaltende Verlust des Meereises beeinflussen das gesamte arktische Ökosystem, in dem es etwa zum Abriss von Nahrungsketten kommt und das Fundament der Nahrungspyramide ins Wanken gerät. Mit dem Klimawandel verschlechtern sich beispielsweise die Lebensbedingungen für Planktonorganismen in der Arktis, wie Studien von Meeresbiologen zeigen. Vom Plankton aber ernähren sich viele Fische, deren Bestände ebenso wie die anderer Arten in der Folge abnehmen, was zum Rückgang der biologischen Vielfalt vor allem im und am Meer führt. Von Fischen ernähren sich mit Vorliebe die Robben, die wiederum bevorzugte Nahrung der Eisbären sind.
Allerdings wird die Jagd auf ihre Hauptbeute und damit auch die Versorgung ihres Nachwuchses für Eisbären derzeit nur in einigen Gebieten schwieriger. So ist keineswegs ausgemacht, dass bei fortschreitendem Klimawandel langfristig das Überleben der Eisbären insgesamt gefährdet ist, selbst wenn einige ihrer südlichen Vorkommen verschwinden werden, während sie weiterhin im hohen Norden etwa der kanadischen Arktis-Inseln und im nördlichen Grönland vorkommen. Daher können wir festhalten: Wenn es um den Erhalt von Arten und Artenvielfalt weltweit geht, gibt es wahrlich andere Probleme, und dabei spielt das Klima, man muss es nochmals betonen, in den allermeisten Fällen nachweislich allenfalls eine untergeordnete Rolle.
Dennoch reden gegenwärtig alle nur noch vom menschengemachten Klimawandel, wenn es um Umwelt und Natur geht. Das Thema war spätestens 2019 in Gesellschaft und Politik angekommen, als Hunderttausende freitags auf die Straße gingen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, und eine 16-jährige Schwedin beim Klimagipfel der UN in New York den Staatenlenkern vorwarf, mit leeren Versprechungen ihre Kindheit gestohlen zu haben.[4] Zwar steht das Klima nach den Schocks von Pandemie und Inflation, Krieg in der Ukraine und der durch russische Aggression und chinesische Expansion ausgelösten geopolitischen Sachlage nicht mehr allein im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dafür rücken die Wettersysteme umso nachdrücklicher in den Blick, wenn sie uns mit ihren Extremen wie Hitze, Starkregen oder Stürmen buchstäblich um die Ohren fliegen. Kein Wunder bei Rekordwerten sowohl der Treibhausgas-Emissionen in der Atmosphäre, wo der Anteil CO2 inzwischen bei 426 ppm (parts per million) liegt, wie auch der Temperaturen von global zuletzt knapp 1,5 Grad Celsius mehr gegenüber dem vorindustriellen Niveau.
Tatsächlich, so die aktuellen Meldungen, waren nicht nur das Jahr 2023, sondern auch 2024 die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und zugleich die nassesten. Die drei wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung vor etwa anderthalb Jahrhunderten wurden in Europa alle nach dem Jahr 2020 verzeichnet, die zehn wärmsten seit 2007. Und auch das Oberflächenwasser erreichte 2023 im Nordatlantik wie im Pazifik vielfach Temperaturen auf Rekordniveau. Die Folgen in Form von Extremwetterereignissen – Dürren und Waldbränden hier sowie Stürmen und Überschwemmungen dort – sind mittlerweile hinreichend bekannt und vielfach beklagt; sie müssen hier nicht beschrieben werden. Unübersehbar ist überdies, dass mit fortschreitender globaler Erwärmung die Lebensbedingungen auf der Erde beeinträchtigt werden, wovon bereits jetzt weltweit Millionen Menschen betroffen sind. So stellt der Klimawandel nicht nur die Landwirtschaft und die Wasserwirtschaft vor große Herausforderungen, er belastet auch die Gesundheit der Menschen und die Ernährungssicherheit. Und natürlich setzt er den Ökosystemen zu, da Pflanzen und Tiere sich innerhalb kürzester Zeit an steigende Temperaturen und damit einhergehende Veränderungen anpassen müssen. Wenig überraschend, dass laut einer aktuellen Umfrage in Europa die Menschen den Klimawandel im kommenden Jahrzehnt als die größte unmittelbare Bedrohung für ihre Lebensweise ansehen.[5]
Immer wieder fiel mir auf, dass in den vielen Berichten zum Klimawandel ein Umstand meistens untergeht, der mir aber durchaus bemerkenswert erscheint: Weltweit ist es bereits um knapp 1,5 Grad Celsius wärmer geworden, womit die Erwärmung historische Höchststände erreicht und wir nun erstmals die im Pariser Klimaabkommen von 2015 beschlossene Grenze überschritten haben. So lag die Durchschnittstemperatur im Sommer 2024 auf der Nordhalbkugel mit 16,8 Grad um beinahe 0,7 Grad über dem Mittel der vergangenen drei Jahrzehnte und um mehr als 1,6 Grad über dem vorindustriellen Mittel von 1850 bis 1900; bezogen nur auf Europa lag die Temperatur nach Erkenntnissen des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus um 1,54 Grad über diesem Mittel – es war in beiden Fällen der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.[6]
Fest steht, dass sich die Temperaturen auf der Erde in die falsche Richtung bewegen, und das schneller als je zuvor. Was insofern kein Wunder ist, als sich seit Jahrzehnten nichts daran geändert hat, dass massiv Treibhausgase, insbesondere Kohlendioxid, durch das Verfeuern fossiler Brennstoffe und die Abholzung von Wäldern in die Atmosphäre gelangen, wodurch sich die Erde in einer mathematisch berechenbaren linearen Abhängigkeit von Emission und Temperatur erwärmt.[7] Seit Jahrzehnten wissen wir um diese Korrelation und Kausalität, können inzwischen sogar den Grad der Erwärmung und seine weltweiten Folgen für die kommenden Jahrzehnte mit wenigstens einiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Eine Trendumkehr der berühmten Keeling-Kurve, die den unverminderten Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre aufzeigt, ist dennoch nicht absehbar, ziemlich unabhängig davon, was wir bisher dagegen unternommen haben.[8] Das heißt, sämtliche Dekarbonisierungsbemühungen haben diesem Kurvenverlauf keine neue Richtung gegeben. Obwohl die Faktenlage mittlerweile ebenso überwältigend wie beängstigend ist, kriegen wir dennoch buchstäblich nicht die Kurve.
Das sind die ernüchternden Tatsachen – und hinzu kommt die Frage, ob wir nicht den falschen Fokus in Sachen Umwelt haben, spielt doch die andere große Krise – die der Arten – in der Wahrnehmung der meisten Menschen bisher kaum eine Rolle. Dabei ist das Artensterben keineswegs, wie häufig angenommen und irrigerweise unterstellt, nur eine Begleiterscheinung und ein Nebenschauplatz des Klimawandels, dem nun leichtfertig alles untergeschoben wird. Vielmehr ist der Verlust der biologischen Vielfalt ein ganz eigenes Problem – und eines von enormer ökologischer wie ökonomischer Brisanz, das erhebliche gesellschaftliche Sprengkraft besitzt. Denn es hat mit uns, unserem Wirtschaften und dem Verbrauch von Ressourcen zu tun.
Zwar ist unbestritten, dass sich das Risiko des Artensterbens durch den Klimawandel noch weiter verschärft.[9] Aber die Hauptursache der Biodiversitätskrise ist der Verlust an Lebensraum für andere Arten. Darum ist es so wichtig, die richtigen Prioritäten beim Schutz der Natur zu setzen. Paradoxerweise bringen wir gleichzeitig viele Arten und ihre Umwelt in Bedrängnis, die wir doch eigentlich retten wollen, und dies ausgerechnet mit jenen Maßnahmen, die wir endlich ergriffen haben, um eine Energiewende einzuleiten (wir kommen später dazu). Wir laufen damit Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten, schlimmer noch: die Natur auf dem Altar der Eindämmung des Klimawandels zu opfern, gerade weil wir für einige dieser Maßnahmen noch mehr Raum nutzen und noch mehr Rohstoffe schürfen, zum Schaden der Natur und der Artenvielfalt. Die Begrenzung der Erderwärmung ist aber nicht das Einzige, was getan werden muss und das lohnt, getan zu werden. Mindestens so entscheidend für unsere Zukunft ist es, Natur und Umwelt insgesamt zu erhalten – und dazu gehört in erster Linie die Biodiversität. Sie geht nicht nur in der vom Klima dominierten Debatte unter, sondern ganz real; und zwar umso mehr, je verzweifelter wir den Klimawandel zu bekämpfen versuchen.
Das Ende … der Geschichte, der Evolution, der Natur?
Anfang Dezember 2019 erschien das Buch vom Ende der Evolution, an dem ich fünf Jahre gearbeitet hatte, um vor dem Hintergrund der Evolution des Menschen und der Geschichte seiner Überbevölkerung die akute und aktuelle Vernichtung der Arten zu beschreiben.[10] Neben einem wenigstens kurzzeitigen Platz auf der Bestsellerliste des Spiegel brachte es mir die Schelte einiger Kollegen und Leser sowie von nicht wenigen Zuhörern meiner Vorträge ein, die zwar um die Krise der Artenvielfalt wussten, aber meinten, sie führe doch nicht wirklich dazu, dass die Evolution jemals an ein Ende käme. Was natürlich stimmt, aber die Aussage war anders gemeint, nämlich so, dass der Mensch aufgrund seiner Natur, seiner evolutionsbiologischen Wurzeln und seiner Kultur mittlerweile globale Probleme für sich selbst sowie andere Arten verursacht. Indem er zunehmend jene Artenvielfalt und gegenwärtige Lebewelt – die Zeugnisse der bisherigen Evolution, wie wir sie kennen – verdrängt, wird er selbst zum neuen Faktor der Evolution und droht die Evolution zahlloser anderer Arten zu beenden. Obgleich es für uns nur diese eine Erde gibt, leben wir längst über unsere ökologischen wie ökonomischen Verhältnisse, in einer Weise, die befürchten lässt, dass es nicht nur für einen erheblichen Teil der anderen Organismenarten, mit denen wir diese Welt teilen, das Ende ist, sondern auch das unserer eigenen Evolution. Dass die Evolution neue, andere Wege finden und aus den Resten und Ruinen des Lebens auf der Erde wieder Neues hervorbringen wird, wenn wir nicht mehr existieren, ist dabei nur ein schwacher Trost.
Seinerzeit war mir die Titelähnlichkeit zum Ende der Geschichte des amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama noch gar nicht aufgefallen, der in seinem 1992 erschienenen Buch die These vertrat, dass die Welt keine grundlegenden Konflikte mehr kenne und es daher keinen interessanten historischen Wandel mehr gebe. Das mag man zwar bezweifeln, mir erscheint aber der Umstand wichtig, dass die inzwischen von der Natur unabhängige Wirkungsmacht des Menschen noch deutlich weiter reicht, sodass unser Tun nicht nur historische, sondern faktisch evolutive Auswirkungen hat. Daher halte ich den Titel meines Buches nach wie vor für zutreffend und gerechtfertigt. Wie ich dann feststellte, gab es noch eine weitere von mir zuvor übersehene Titelähnlichkeit, die auf andere Weise bemerkenswert ist. Kurz vor Fukuyama, im Jahr 1989, hatte der amerikanische Journalist und Umweltaktivist Bill McKibben sein Buch The End of Nature veröffentlicht. Darin ging es aber nicht um das Ende der Artenvielfalt, vielmehr war es eine der ersten öffentlichkeitswirksamen Zusammenfassungen zum drohenden Klimawandel durch die Zunahme von Treibhausgasen und den Anstieg der Temperatur.[11]
Drei Jahrzehnte später erschien es mir dagegen wichtig, darauf hinzuweisen, dass nun das Artensterben der »neue Klimawandel« ist und der Verlust der Biodiversität die wahre Krise und Herausforderung des 21. Jahrhunderts darstellt. Der Wohlstand unserer Welt und das Wachstum der Wirtschaft waren zumindest über die vergangenen hundert Jahre unmittelbar mit der Nutzung fossiler Brennstoffe – erst mit Kohle, dann mit Erdöl und Erdgas – verknüpft. Aber sehr viel länger schon sind Wachstum und Wohlstand an die Ausbeutung natürlicher Ressourcen gekoppelt, vom Holz der Wälder über die gesamte Palette tierischer und pflanzlicher Produkte bis hin zu den Leistungen ganzer Ökosysteme. Diese natürlichen Ressourcen aber sind endlich, ihre fortgesetzte Plünderung und der nicht nachhaltige Umgang mit ihnen sind die Ursache für die alarmierende biologische Verarmung weltweit. Ohne diesen einzigartigen biologischen Schatz der Artenvielfalt aber funktionieren die Ökosysteme der Erde nicht, auf die wir alle letztlich angewiesen sind. Von ihnen hängt unsere Ernährung ab, angefangen von sauberem Wasser und gesunden Böden bis hin zu den unentgeltlichen Bestäuberdienstleistungen der vielen Insekten, die so für Kaffee und Kakao, für Äpfel, Birnen und Tomaten sorgen. Wenn wir weiterhin Obst und Gemüse essen wollen, Fisch und Fleisch, das wir möglichst regional produzieren sollten, dann brauchen wir dazu überall auf der Erde intakte Lebensräume mit funktionierenden Artengemeinschaften. Ohne eine vielfältige Natur werden daher auch wir nicht überleben können. Aber den wenigsten Menschen ist bewusst, in welchem Ausmaß wir von der Natur und der vielfach vernetzten Vielfalt ihrer Organismen abhängig sind, obgleich sie uns täglich begegnet – vom Brot zum Frühstück bis zum Wein oder Bier am Abend. Deshalb ist die Biodiversität, also der Schutz der Arten und der Erhalt der natürlichen Ökosysteme, das zentrale Zukunftsthema.
Doch es ist verrückt: Kurz nachdem mein Buch Das Ende der Evolution erschienen war, weiteten sich Anfang 2020 an der Ostküste Australiens die bisher verheerendsten Buschbrände aus, die der feueradaptierte Kontinent gesehen hat. Und obgleich ich in meinem Buch gerade nicht den Klimawandel, sondern die absehbare Artenapokalypse thematisiert habe, griffen Fernsehsender, Zeitungen und Magazine diesen aktuellen Anlass einer weiteren Extremwetterlage auf, um über das Artenbuch zu berichten. Ausgerechnet dank der augenfällig verheerenden Folgen des bereits hinreichend benannten Klimawandels wurde so – immerhin – auf das ebenfalls globale Problem des Artenschwunds aufmerksam gemacht.[12]