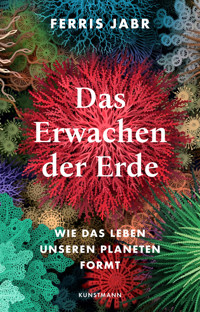
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine der ältesten Überzeugungen der Menschheit ist, dass unsere Welt lebendig ist. Das Konzept der Erde als vernetztes lebendes System wurde über Jahrzehnte hinweg von vielen Wissenschaftlern verachtet, jetzt ist es dabei, sich durchzusetzen. Wir und unsere Umwelt haben sich über Milliarden von Jahren gemeinsam entwickelt und einen Klumpen Gestein im All in eine kosmische Oase verwandelt - einen Planeten, der atmet, Stoffwechsel betreibt und sein Klima reguliert. Ferris Jabr zeigt, wie Wälder Wasser, Pollen und Bakterien ausspucken, um Regen herbeizurufen; riesige Tiere die Landschaften, die sie durchstreifen, selbst gestalten; Mikroben Felsen zerkauen, um Kontinente zu formen; und mikroskopisch kleines Plankton die Luft und das Meer verändert. Auch wir Menschen beeinflussen die Gestaltung der Erde und haben sie in eine tiefe Krise gestürzt. Aber wir sind auch in der Lage, die wundersame Ökologie und die selbststabilisierenden Prozesse des Planeten zu verstehen und zu schützen – und so darüber zu entscheiden, welche Erde wir unseren Nachkommen vererben werden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
FERRIS JABR
DAS ERWACHEN DER ERDE
Wie das Leben unseren Planeten formt
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel
Verlag Antje Kunstmann
FÜR LUFT, WASSER UND STEIN. FÜR FEUER, EIS UND SCHLAMM.
Für nagende Gletscher, wogende Dünen, prismatische heiße Quellen und abgründige Tiefseebecken.
Für sengende Unterwasservulkane, explosive Magmakammern, uralte Berge und neugeborene Inseln.
Für die großen grünen Wälder, wogenden Graslandschaften und schwammigen Moore.
Für schroffe Plateaus, baumlose Tundren und salzgetränkte Mangroven.
FÜR DINOSAURIER, MAMMUTBÄUME, MAMMUTS UND WALE.
Für Schleimpilze, Insekten, Pilze und Schnecken.
Für die Mikroben, die Sonnenlicht fressen, Wolken säen und Gold abbauen.
Für die Wurzeln, die uns Erde schenkten und Flüsse fließen ließen.
Für die Herden ausgestorbener Riesen und all jene, die noch wandern.
Für den Ozean in unserem Blut und unsere Skelette aus Stein.
FÜR JENE, DIE PFLANZEN, BAUEN, DENKEN UND LEHREN.
Für die Entdecker, Schöpfer, Hüter und Heiler.
Für alle Lieder, die wir kennen, und all jene, die noch ungehört sind.
Für unseren lebendigen Planeten. Für unser Wunder.
Für die Erde.
Beispiel: Ob man ein Mensch ist, ein Insekt, eine Mikrobe oder ein Stein, diese Verse sind wahr:
Alles, was du berührst, veränderst Du.
Alles, was du veränderst, Verändert dich.
Octavia Butler: Die Parabel vom Sämann
Was wäre, wenn wir begreifen würden, dass der Herzschlag aller Lebewesen in unserem eigenen Herzschlag zu hören ist, dass in diesem Trommeln der Puls der Erde widerhallt, der durch unser aller Adern fließt, Pflanzen und Tiere eingeschlossen?
Terry Tempest Williams,»Das Geschehen«, The Paris Review
Die Erde ist ein Land. Wir sind alle Wellen desselben Meeres, Blätter desselben Baumes, Blumen desselben Gartens.
Die Botschaft der Brüderlichkeit, wahrscheinlich aus denSchriften von Bahá’u’lláh, dem Propheten und Begründerdes Bahá’í-Glaubens, und seinem Sohn ’Abdu’l-Bahá
INHALT
EINLEITUNG
GESTEIN
KAPITEL 1: Innerirdische
Wie unterirdische Mikroben die Erdkruste verändern
KAPITEL 2: Die Mammutsteppe und die Fußspur des Elefanten
Wie Tiere die Landmassen der Erde formen
KAPITEL 3: Ein Garten im Nichts
Wie man den Boden des Planeten wieder zum Leben erweckt
WASSER
KAPITEL 4: Zellen im Meer
Wie Plankton die modernen Ozeane definiert
KAPITEL 5: Die großen Wasserwälder
Wie die Meeresvegetation die Welt bewohnbarer macht
KAPITEL 6: Der Plastikplanet
Wie man am besten mit dem Plastikmüll umgeht, der das Ökosystem der Ozeane zerstört
LUFT
KAPITEL 7: Eine Blase Atem
Wie Mikroben das Wetter beeinflussen und zur Schaffung einer atembaren Atmosphäre beitragen
KAPITEL 8: Die Wurzeln des Feuers
Wie die Koevolution von Feuer und Leben den Planeten veränderte
KAPITEL 9: Wind des Wandels
Wie sich Treibhausgasemissionen reduzieren lassen und eine lebenswerte Welt erhalten bleibt
EPILOG
DANKSAGUNGEN
ANMERKUNGEN DES AUTORS
AUSGEWÄHLTE QUELLEN
EINLEITUNG
❖
ALS ICH KLEIN WAR, glaubte ich, ich könne das Wetter verändern. An heißen Sommertagen, wenn die Gärten in unserer kalifornischen Vorortsiedlung verdorrten und man sich am Asphalt die nackte Haut verbrannte, zeichnete ich eine dicke blaue Regenwolke, marschierte damit über den Rasen und bespritzte ihn mit einem Gebräu aus Wasser und Gartenabfällen. Wahrscheinlich sang ich dabei sogar bruchstückhaft eine Art Beschwörung vor mich hin – eine Umkehrung des beliebten Kinderliedes, in dem es heißt, der Regen solle verschwinden.
Als ich heranwuchs, wuchsen auch meine Kenntnisse über Meteorologie. In der Schule lernte ich, wie Wasser aus Seen, Flüssen und Ozeanen verdunstet, in die Atmosphäre aufsteigt und sich dort abkühlt, sodass es zu winzigen Tröpfchen kondensiert. Diese schwebenden Wasserperlen stoßen zusammen und vereinigen sich, bleiben an Staubkörnern in der Luft kleben und wachsen so zu den wattigen Massen heran, die wir Wolken nennen, bis sie schließlich schwer genug sind und wieder zur Erde fallen. Regen, so brachte man mir bei, ist eine unvermeidliche Folge der physikalischen Verhältnisse in der Atmosphäre, ein Geschenk, das wir und andere Lebewesen ohne unser Zutun empfangen.
Vor einigen Jahren erfuhr ich dann aber von einer verblüffenden Tatsache, die mein Denken über das Wetter und letztlich meine Wahrnehmung unseres gesamten Planeten veränderte; sie versetzte mich in ein Staunen darüber, was alles möglich ist, wie ich es seit meiner Kindheit nur noch selten erlebt hatte. Ich erfuhr, dass Lebewesen den Regen in vielen Fällen nicht einfach aufnehmen, sondern ihn herbeiführen.
Betrachten wir einmal den Amazonas-Regenwald. Er wird jedes Jahr mit ungefähr 2400 Millimetern Regen durchtränkt. In manchen Teilen des Waldes liegt die jährliche Regenmenge eher bei 4500 Millimetern, mehr als dem Fünffachen des durchschnittlichen jährlichen Niederschlages in den kontinentalen Vereinigten Staaten. Zum Teil ist diese Flut eine Folge geografischer Zufälle: Die intensive Sonneneinstrahlung am Äquator verstärkt die Verdunstung des Wassers aus dem Meer und an Land, sodass es in den Himmel steigt, Passatwinde transportieren Feuchtigkeit vom Ozean heran, und die umgebenden Gebirge zwingen die einströmende Luft dazu, aufzusteigen, sich abzukühlen und zu kondensieren. Und wo es dann regnet, entstehen die Regenwälder.
Aber das ist nur die halbe Geschichte. Innerhalb des Waldbodens lenken riesige symbiotische Netzwerke aus Pflanzenwurzeln und fadenförmigen Pilzen das Wasser aus dem Boden in Stämme, Stängel und Blätter. Während die nahezu 400 Milliarden Bäume im Amazonaswald sich satt trinken, geben sie eine Menge Feuchtigkeit ab und sättigen die Luft jeden Tag mit 20 Milliarden Tonnen Wasserdampf. Gleichzeitig scheiden Pflanzen aller Arten Salze aus und setzen ein Bukett aus stinkenden gasförmigen Verbindungen frei. Pilze, filigran wie Papierschirmchen oder rundlich wie Türknäufe, atmen Rauchfahnen aus Sporen aus. Der Wind weht Bakterien, Pollenkörner und Blatt- oder Rindenpartikel in die Atmosphäre. Der feuchte Hauch des Waldes, gewürzt mit mikroskopischen Lebensformen und organischen Resten, schafft die idealen Voraussetzungen für den Regen. Wenn so viel Wasser in der Luft ist, das an so vielen winzig kleinen Teilchen kondensieren kann, bilden sich sehr schnell Wolken. Manche in der Luft schwebenden Bakterien können die Wassertröpfchen sogar veranlassen zu gefrieren, wodurch die Wolken größer und schwerer werden, sodass sie schneller bersten. Der Amazonaswald erzeugt in einem durchschnittlichen Jahr ungefähr die Hälfte seiner eigenen Regenmenge selbst.
Letztlich beeinflusst der Amazonas-Regenwald mehr als nur das Wetter über seinen Baumkronen. Das viele Wasser, die biologischen Abfälle und mikroskopisch kleinen Lebewesen, die von dem Wald abgegeben werden, bilden einen gewaltigen schwebenden Strom – den luftigen Widerhall des Flusses, der sich durch das Unterholz windet. Dieser fliegende Strom transportiert Niederschlag zu Bauernhöfen und Städten in ganz Südamerika. Manche Fachleute sind zu dem Schluss gelangt, dass der Amazonas über seine atmosphärischen Fernwirkungen sogar in weit entfernten Regionen wie Kanada zum Niederschlag beiträgt. Ein Baum, der in Brasilien wächst, kann das Wetter in Manitoba verändern.
Die geheimnisvolle Wirkung des Amazonas auf den Regen stellt unsere herkömmliche Denkweise über das Leben auf der Erde infrage. Der hergebrachten Weisheit zufolge ist das Leben auf seine Umwelt angewiesen. Würde die Erde nicht um einen Stern mit der richtigen Größe und im richtigen Alter kreisen, oder wäre sie zu dicht bei diesem Stern oder zu weit davon entfernt, sie besäße keine stabile Atmosphäre, kein flüssiges Wasser und kein Magnetfeld, das schädliche kosmische Strahlung ablenkt, und wäre unbelebt. Das Leben hat sich auf der Erde entwickelt, weil die Erde sich für Leben eignet. Seit Darwin betonen die vorherrschenden wissenschaftlichen Lehrmeinungen immer wieder, dass die sich ständig wandelnden Anforderungen aus der Umwelt im Wesentlichen darüber bestimmen, wie die Evolution des Lebendigen verläuft: Arten, die mit Veränderungen in ihrem jeweiligen Lebensraum am besten zurechtkommen, hinterlassen die meisten Nachkommen, und solche, die sich nicht anpassen können, sterben aus.
Aber Darwins Erkenntnis hat eine weithin unterschätzte Kehrseite: Das Leben verändert auch seine Umwelt. Größere Anerkennung erlangte diese Tatsache in der abendländischen Wissenschaft Mitte des 20. Jahrhunderts, als die Ökologie sich als formelles Fachgebiet durchsetzte. Dennoch konzentrierte man sich auf relativ kleine, räumlich begrenzte Veränderungen: beispielsweise durch den Biber, der einen Damm baut, oder durch Regenwürmer, die den Boden durchmischen. Die Vorstellung, dass Lebewesen aller Arten ihre Umwelt auch auf viel umfassendere Weise verändern können – dass Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen und Tiere die Topografie und das Klima eines Kontinents oder sogar der ganzen Erde beeinflussen –, wurde nur selten zum Gegenstand ernsthafter Betrachtungen. »Gestalt und Lebensweise der Pflanzen wie der Tiere der Erde wurden von der Umwelt geprägt«, schrieb Rachel Carson 1962 in Der stumme Frühling. Etwas Ähnliches erklärte E. O. Wilson in seinem 2002 erschienenen Buch Die Zukunft des Lebens: »Homo sapiens ist zu einer geophysikalischen Kraft geworden und stellte damit die erste Spezies in der Geschichte des Planeten dar, die sich dieser zweifelhaften Auszeichnung rühmen kann.«
Als ich zum ersten Mal etwas über den Regentanz des Amazonas erfuhr, war ich begeistert und verwirrt zugleich. Ich wusste, dass Pflanzen dem Boden Wasser entziehen und Feuchtigkeit in die Luft abgeben, aber dass Bäume, Pilze und Mikroorganismen im Amazonasgebiet gemeinsam einen so großen Teil des Regens erzeugen, nach dem ihre Heimat benannt ist, und dass die Tätigkeit der Lebewesen auf einem Kontinent das Wetter auf einem anderen verändert, rüttelte mich auf. Die Vorstellung vom Amazonasregenwald als Garten, der sich selbst bewässert, verfolgte mich. Wenn das für ein so großes Ökosystem wie den Amazonaswald gilt, stellte sich für mich die Frage: Könnte es auch in noch größerem Maßstab gelten? Auf welche Weise und in welchem Umfang hat das Leben unseren Planeten im Laufe seiner Geschichte verändert?
Als ich Antworten auf solche Fragen suchte, stellte ich fest, dass die wissenschaftlichen Kenntnisse über die Beziehung des Lebens zu unserem Planeten schon seit einiger Zeit eine größere Umwälzung erleben. Anders als hergebrachte Lehrsätze es behaupten, war das Leben in der Erdgeschichte immer eine beträchtliche geologische Kraft, die häufig an die Kräfte von Gletschern, Erdbeben und Vulkanen heranreichte oder sie sogar übertraf. Im Laufe der Jahrmilliarden haben alle möglichen Lebensformen, von Mikroorganismen bis zu Mammuts, die Kontinente verändert, Ozeane und Atmosphäre umgestaltet und einen um die Sonne kreisenden Gesteinsbrocken zu der Welt gemacht, die wir heute kennen. Lebewesen sind nicht einfach nur die Produkte unausweichlicher Evolutionsprozesse in ihren jeweiligen Lebensräumen; sie arrangieren auch ihre Umwelt und sind an ihrer eigenen Evolution beteiligt. Wir und andere Lebewesen sind mehr als nur Bewohner der Erde; wir sind die Erde – das Ergebnis ihrer physikalischen Struktur und ein Motor ihrer globalen Kreisläufe. Die Erde und ihre Geschöpfe sind so eng miteinander verwoben, dass wir sie uns als ein Ganzes vorstellen können.
Belege für dieses neue Weltbild finden sich überall um uns herum, vieles wurde allerdings erst vor kurzer Zeit entdeckt und muss noch ebenso weit ins Bewusstsein der Öffentlichkeit vordringen wie beispielsweise egoistische Gene oder das Mikrobiom. Vor fast zweieinhalb Milliarden Jahren veränderten Cyanobakterien, Mikroorganismen in den Ozeanen, die Fotosynthese betrieben, unseren Planeten ein für alle Mal: Sie entließen Sauerstoff in die Atmosphäre, verliehen dem Himmel die vertraute blaue Farbe und setzten die Ausbildung der Ozonschicht in Gang, die eine Fülle immer neuer Lebensformen vor der schädlichen Ultraviolettstrahlung schützte. Heute tragen Pflanzen und andere fotosynthetisch tätige Organismen dazu bei, in der Atmosphäre eine Sauerstoffkonzentration aufrechtzuerhalten, die hoch genug ist, dass komplexe Lebensformen gedeihen können, aber nicht so hoch, dass die ganze Welt beim kleinsten Funken in Flammen aufgehen würde. Mikroorganismen sind wichtige Mitspieler in vielen geologischen Prozessen und zu einem großen Teil für die Vielfalt der Mineralien verantwortlich; nach Ansicht mancher Fachleute spielten sie eine entscheidende Rolle für die Entstehung der Kontinente. Meeresplankton treibt chemische Kreisläufe an, auf die alle anderen Lebewesen angewiesen sind, und gibt Gase ab, die für eine größere Wolkendecke sorgen und damit das Weltklima beeinflussen. Tangwälder, Korallenriffe und Schalentiere speichern gewaltige Kohlenstoffmengen, puffern den Säuregehalt der Ozeane, verbessern die Wasserqualität und schützen die Küsten vor Extremwetter. Und ganz unterschidliche Tiere, darunter Elefanten, Präriehunde und Termiten, bauen die Kruste unseres Planeten ständig um, erleichtern die Wasser-, Luft- und Nährstoffströme und verbessern damit die Lebensverhältnisse von Millionen Arten.
Das Extrembeispiel für eine Lebensform, die in der jüngeren Vergangenheit – und nach manchen Maßstäben zu allen Zeiten – die Erde verändert hat, sind natürlich die Menschen. Indem die Industrieländer die kohlenstoffreichen Überreste urzeitlicher Wälder und Meereslebewesen in Form fossiler Brennstoffe ausgraben und verbrennen, aber auch durch die Zerstörung und den Abbau von Ökosystemen, überschwemmen wir die Atmosphäre mit Kohlendioxid und anderen wärmespeichernden Treibhausgasen, sodass die globale Temperatur wie auch der Meeresspiegel stark ansteigen, Dürre und Waldbrände wie auch Stürme und Hitzewellen häufiger werden und letztlich Milliarden Menschen und unzählige andere biologische Arten in Gefahr geraten. Eines der vielen Hindernisse für die öffentliche und politische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel war die halsstarrige Vorstellung, die Menschen besäßen nicht genügend Macht, den ganzen Planeten zu verändern. In Wirklichkeit sind wir bei Weitem nicht die einzigen Lebewesen, die über solche Fähigkeiten verfügen. Die Geschichte des Lebens ist eine Geschichte darüber, wie das Leben die Erde umgestaltet hat.
Als ich mich näher mit der Wechselbeziehung zwischen Erde und Leben beschäftigte, kam ich immer wieder auf einen alten, umstrittenen Gedanken zurück: dass die Erde selbst lebendig ist. Der Animismus ist eine der ältesten und am weitesten verbreiteten Glaubensüberzeugungen der Menschheit. Im Verlauf der Geschichte haben die verschiedensten Kulturen die Begriffe von Leben und Geist auf den Planeten und seine Bestandteile übertragen. In vielen Religionen wird die Erde als Gottheit personifiziert, und zwar häufig als Göttin, die dann Mutter, Ungeheuer oder auch beides sein kann. Die Azteken beteten Tlaltecuhtli an, eine riesige, mit Klauen bewehrte Chimäre, deren zergliederter Körper zu den Bergen, Flüssen und Blumen der Welt wurde. In der nordischen Mythologie waren Name und Identität der Riesin Jörd gleichbedeutend mit der Erde. In mehreren Kulturkreisen stellte man sich die Erde als Garten vor, der auf dem Rücken einer gewaltigen Schildkröte heranwächst. Die alten Polynesier verehrten Rangi und Papa, Himmel und Erde, die in einer liebenden Umarmung gefangen blieben, bis sie von ihren Kindern getrennt wurden. Schließlich weinten sie um einander in Form des aufsteigenden Nebels und des fallenden Regens.
Aus Mythen und Religion sickerte der Gedanke, dass die Erde lebendig ist, auch in die frühe abendländische Wissenschaft ein und blieb dort über Jahrhunderte erhalten. Viele Philosophen der griechischen Antike betrachteten die Erde und andere Planeten als belebte Gebilde mit einer Seele oder Lebenskräften. Leonardo da Vinci schrieb über die Parallelen zwischen der Erde und dem menschlichen Körper, verglich die Knochen mit Gestein, das Blut mit Wasser und die Atmung mit den Gezeiten. Der schottische Wissenschaftler James Hutton, der im 18. Jahrhundert zum Mitbegründer der modernen Geologie wurde, beschrieb den Planeten als »lebende Welt«, die eine »Physiologie« besitzt und in der Lage ist, sich selbst zu reparieren. Wenig später bezeichnete der deutsche Naturforscher und Entdecker Alexander von Humboldt die Natur als »lebendiges Ganzes«, in dem die Lebewesen durch ein »netzartiges, dichtes Gewebe« verbunden sind.
Hutton und Humboldt waren aber Ausnahmeerscheinungen unter ihresgleichen, insbesondere unter denen, die an einem strengen Empirismus festhielten. Mitte des 19. Jahrhunderts waren selbst metaphorische Beschreibungen der Erde als lebendes Gebilde in den mahagonigetäfelten Hallen der europäischen Wissenschaft weitgehend aus der Mode. Die Fachgebiete spezialisierten sich immer weiter und wurden immer reduktionistischer. Man organisierte Materie und Naturerscheinungen in zunehmend engeren Kategorien, die das Belebte noch stärker vom Unbelebten trennten. In Verbindung damit begünstigten die weitreichenden Folgen der industriellen Revolution und die Ausdehnung der Kolonialreiche eine Sprache und Weltanschauung, deren Grundlagen Mechanisierung, Profit und Eroberung waren. Man betrachtete die Erde jetzt nicht mehr als riesiges, anbetungswürdiges Lebewesen, sondern als Gebilde aus unbelebten Ressourcen, die nur darauf warteten, ausgebeutet zu werden.
Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts fand die Vorstellung von einem lebenden Planeten im Kanon der abendländischen Wissenschaft ihren beliebtesten und dauerhaftesten Ausdruck: in Form der Gaia-Hypothese. Sie wurde in den 1960er-Jahren von dem britischen Wissenschaftler und Erfinder James Lovelock erdacht und später von ihm zusammen mit der amerikanischen Biologin Lynn Margulis weiterentwickelt. Die Gaia-Hypothese geht davon aus, dass alle belebten und unbelebten Elemente der Erde »Teile und Partner in einem riesigen Wesen sind, das in seiner Gesamtheit die Macht hat, unseren Planeten als geeigneten, angenehmen Lebensraum zu erhalten«.1 Aus der Gaia-Perspektive, so schrieb Lovelock, gleicht die Erde einem riesigen Wald von Mammutbäumen. Nur wenige Teile eines Baumes, nämlich die Blätter und die dünnen Gewebeschichten in Stamm, Zweigen und Wurzeln, enthalten lebende Zellen. Ein ausgewachsener Baum besteht zum allergrößten Teil aus totem Holz. Ähnlich unser Planet: Er ist zum größten Teil unbelebtes Gestein, das in eine blühende Haut des Lebendigen eingehüllt ist. Und wie die Streifen aus lebendem Gewebe, die unentbehrlich sind, damit ein ganzer Baum am Leben bleibt, so trägt auch die lebendige Haut der Erde dazu bei, eine Art globales Wesen zu erhalten.
Zwar war Lovelock nicht der erste Wissenschaftler, der die Erde als lebendes Gebilde beschrieb, aber mit seiner kühnen, umfassenden und beredt vorgetragenen Vision gab er den Anlass zu einer ungeheuren Welle von Beifall und Spott. Sein erstes Buch über Gaia brachte Lovelock 1979 inmitten der wachsenden Umweltbewegung heraus. Er fand in der Öffentlichkeit ein begeistertes Publikum, in der wissenschaftlichen Welt dagegen wurden seine Ideen bei Weitem nicht so freundlich aufgenommen. Im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte kritisierten viele Fachleute die Gaia-Hypothese und machten sie lächerlich. »Mir wäre es lieber, die Gaia-Hypothese würde auf ihren natürlichen Lebensraum der Bahnhofsbuchhandlungen beschränkt bleiben, statt die Werke der ernsthaften Wissenschaft zu verunreinigen«, schrieb der Evolutionsbiologe Graham Bell in einer Rezension. Robert May, der spätere Präsident der Royal Society, erklärte Lovelock zu einem »heiligen Dummkopf«. Besonders energisch äußerte sich der Mikrobiologe John Postgate: »Gaia – die große Mutter Erde! Der planetare Organismus! Bin ich der einzige Biologe, den ein unangenehmes Zucken überkommt, ein Gefühl der Irrationalität, wenn die Medien mich wieder einmal auffordern, so etwas ernst zu nehmen?«
Im Laufe der Zeit jedoch schwand der wissenschaftliche Widerstand gegen Gaia. In seinen ersten Schriften gestand Lovelock Gaia zu viel Handlungsmacht zu, was der falschen Vorstellung Vorschub leistete, die lebendige Erde strebe nach einem Optimalzustand. Das Wesentliche an der Gaia-Hypothese jedoch – der Gedanke, dass das Leben den Planeten verändert und unentbehrlich für seine Selbstregulationsprozesse ist – war seiner Zeit voraus. Manche Fachleute zucken zwar bei der Erwähnung von Gaia noch heute zusammen, solche Erkenntnisse sind aber zu Grundlagen der modernen Erdsystemwissenschaft geworden, eines relativ jungen Fachgebietes, das sich ausdrücklich mit den belebten und unbelebten Bestandteilen des Planeten als zusammenhängendes Ganzes beschäftigt.2 Der Erdsystemwissenschaftler Tim Lenton schrieb von sich und seinen Kollegen: »Wir denken heute in den Begriffen der gekoppelten Evolution von Leben und Planeten und erkennen an, dass die Evolution des Lebens den Planeten geprägt hat, dass Veränderungen der planetaren Umwelt das Leben geprägt haben und dass man sie gemeinsam als einen einzigen Prozess betrachten kann.«
Die Vorstellung, die ganze Erde sei ein lebendiges Gebilde, ist zwar bis heute umstritten, manche Fachleute machen sie sich aber zu eigen, und andere stehen ihr zunehmend aufgeschlossen gegenüber. »Dass unser Planet lebendig ist, steht außer Frage«, sagt der Atmosphärenforscher Colin Goldblatt. »Für mich ist das eine schlichte Tatsachenaussage.« Der Astrobiologe David Grinspoon hat geschrieben, die Erde sei nicht einfach ein Planet, auf dem es Leben gibt, sondern vielmehr ein lebender Planet. »Leben ist nicht etwas, das sich auf der Erde abspielt, sondern es ist der Erde zugestoßen«, sagt er. »Zwischen den lebenden und den unbelebten Teilen unseres Planeten bestehen Rückkopplungsbeziehungen, und die machen die Erde zu etwas ganz anderem als das, was sie sonst wäre.« Selbst einige besonders heftige Kritiker der Gaia-Hypothese haben ihre Ansichten geändert. »Ich muss ein Geständnis machen«, schrieb der Evolutionsbiologe W. Ford Doolittle 2020 in Aeon. »Ich bin im Laufe der Jahre mit Gaia warm geworden. Anfangs habe ich lautstarke Einwände gegen die Theorie von Lovelock und Margulis erhoben, aber mittlerweile vermute ich, dass sie vielleicht nicht ganz unrecht haben.«
Diejenigen, die sich gegen die Vorstellung von einem lebenden Planeten sträuben, bringen die üblichen Einwände vor: Die Erde kann nicht lebendig sein, weil sie im Gegensatz zu »echten« Lebewesen nicht frisst, nicht wächst, sich nicht fortpflanzt und keine Evolution durch natürliche Selektion durchmacht. Wir sollten aber bedenken, dass es nie einen objektiven Maßstab oder eine genaue, allgemein anerkannte Definition für das Leben gegeben hat. Die Lehrbücher führen stattdessen in der Regel eine lange Liste von Eigenschaften auf, die das Belebte angeblich vom Unbelebten unterscheiden. Dennoch kann man beides nicht scharf trennen. Es gibt zahlreiche Beispiele für Dinge, die wir für unbelebt halten und die doch Merkmale des Lebens aufweisen und umgekehrt. Feuer beispielsweise wächst, wenn es Brennstoff verbraucht, und Kristalle verdoppeln originalgetreu ihre hoch organisierte Struktur, wenn sie heranwachsen – und doch würden die meisten Menschen beides nicht als lebendig betrachten. Umgekehrt können manche Lebewesen, darunter Salinenkrebse oder die mikroskopisch kleinen Bärtierchen (Tardigrada) in einen extremen Ruhezustand übergehen, in dem sie nicht mehr fressen, nicht wachsen und sich in keinerlei Hinsicht verändern, und doch gelten sie als Lebewesen. Die meisten Fachleute zählen Viren nicht zum Bereich des Lebendigen, weil sie sich nur dann fortpflanzen und eine Evolution durchmachen können, wenn sie Zellen kapern, und doch schreiben sie ohne Zögern allen parasitischen Tieren und Pflanzen ein Leben zu, obwohl sie ebenso wenig dazu fähig sind, ohne einen Wirt zu überleben oder sich zu vermehren.
Leben ist also mehr ein Spektrum als eine Kategorie, mehr Verb als Substantiv. Es ist weder eine bestimmte Art von Materie noch eine Eigenschaft der Materie, sondern vielmehr ein Prozess – eine Leistung. Leben ist etwas, was die Materie tut. In der Wissenschaft hat man sich zwar bisher weder auf eine Definition noch auf eine grundsätzliche Erklärung des Lebens geeinigt, im vergangenen Jahrhundert bevorzugten aber viele Experten in irgendeiner Form den Grundsatz: Leben ist ein System, das sich selbst erhält.3 Lebende Systeme können freie Energie nutzen, um ein unwahrscheinlich hohes Organisationsniveau in einem Universum aufrechtzuerhalten, das unausweichlich auf die maximale Entropie zusteuert – auf die völlige Auflösung. Theoretisch kann jedes System aus Materie mit ausreichender Komplexität und einer geeigneten Energiezufuhr an dem Phänomen, das wir Leben nennen, teilhaben. Wir müssen uns mit der Idee anfreunden, dass Leben sich in vielen verschiedenen Maßstäben abspielt: im Maßstab der Zelle, des Organismus, des Ökosystems und – ja – des ganzen Planeten.
Wie viele Lebewesen, so nimmt auch die Erde Energie auf, speichert sie und wandelt sie um. Die Erde hat einen Körper mit organisierten Strukturen, Membranen und Tagesrhythmen. Aus den Rohstoffen unseres Planeten sind unzählige Millionen von biologischen Gebilden hervorgegangen, die Gestein, Wasser und Luft unaufhörlich vertilgen, verwandeln und wieder auffüllen. Solche Organismen leben nicht einfach auf der Erde, sondern sie sind buchstäblich Erweiterungen der Erde. Außerdem sind Organismen und ihre Umwelt untrennbar in gegenseitiger Evolution verbunden, wobei sie häufig in sich selbst stabilisierenden Prozessen zusammenfließen, die eine gegenseitige Erhaltung begünstigen. Insgesamt betrachtet, statten solche Prozesse die Erde mit einer Art planetarer Physiologie aus, mit Atmung, Stoffwechsel, Temperaturregulation und ausgewogenen chemischen Verhältnissen. Die Erde ist kein einzelner Organismus und auch kein Produkt der normalen darwinistischen Evolution, aber sie ist dennoch ein echtes lebendes Gebilde – ein riesiges, verflochtenes lebendes System. Die Erde ist ebenso lebendig wie wir.
Die wissenschaftliche Welt hätte Lovelocks Hypothese anfangs vielleicht weniger abfällig aufgenommen, wenn er ihr einen anderen Namen gegeben hätte. Auf den Rat seines Freundes William Golding, des Autors von Der Herr der Fliegen, benannte Lovelock sein globales Wesen nach der griechischen Göttin Gaia, der Personifizierung der Erde, womit er seine Gedanken ein für alle Mal mit dem wissenschaftlichen Tabu des Anthropomorphismus brandmarkte. Ob Lovelock es wollte oder nicht: die Wahl der Namensgeberin verlieh seiner Hypothese ein mütterliches Antlitz und einen gewissen Mystizismus, womit er sie zu einer leichten Zielscheibe für Kritiker machte, die wenig Toleranz für Metaphern aufbrachten und eine Feindseligkeit gegenüber allem hegten, was an Religion oder Mythen denken ließ. Wenn wir das Konzept des lebendigen Planeten für das 21. Jahrhundert noch einmal überprüfen und reaktivieren, müssen wir uns vielleicht nicht die alten Namen zu eigen machen oder neue Bezeichnungen erfinden. Unser Planet ist ein außergewöhnliches lebendes Gebilde und hat bereits einen allgemein bekannten Namen. Er ist das Wesen namens Erde.
Die Erde ist nicht nur die größte und komplexeste Lebensform, die wir kennen, sie ist auch am schwierigsten zu verstehen. Rein mechanistische Metaphern fangen die Vitalität und Üppigkeit unseres Planeten nicht ein. Vergleiche mit dem Körper von Tieren wirken zu eng gefasst für einen Planeten, dessen lebende Materie vorwiegend aus Pflanzen und Mikroorganismen besteht. Vielleicht gibt es keine ideale Metapher, aber während ich dieses Buch verfasste, bin ich auf eine gestoßen, die sowohl nützlich ist als auch das Konzept einer lebendigen Erde ergänzt: die Musik.4
Lynn Margulis schrieb, die belebte Erde sei »eine emergente Eigenschaft der Wechselbeziehungen zwischen Organismen, dem kugelförmigen Planeten, auf dem sie wohnen, und einer Energiequelle, nämlich der Sonne«. Auch Musik ist ein emergentes Phänomen: Sie lässt sich nicht auf die Noten auf dem Papier, die Form eines Instruments oder die geläufigen Handbewegungen eines Musikers oder einer Musikerin reduzieren, sondern erwächst aus den Wechselbeziehungen zwischen allen Bestandteilen. Wenn die richtige Abfolge von Tönen gespielt und auf die genau richtige Weise mit anderen Tonfolgen kombiniert wird, hören wir nicht nur Geräusche, sondern wir erleben die Musik. Ebenso erwächst auch das lebende Gebilde, das wir Erde nennen, aus einer höchst komplizierten Masse von Wechselbeziehungen: aus den wechselseitigen Umwandlungen der Organismen und ihrer Umwelt.
Während der ersten halben Milliarde Jahre seines Daseins war unser Planet ausschließlich ein geologisches Gebilde. Als sich die ersten Lebewesen an seine urtümlichen Eigenschaften und Rhythmen anpassten, entstand ein Zusammenspiel, und das eine veränderte das andere. Seither sind Biologie und Geologie, Belebtes und Unbelebtes in einem ständigen, zunehmend raffinierten Duett gefangen. Im Laufe der Zeitalter entdeckten die Erde und ihre Lebensformen trotz ständiger Umwälzungen weitreichende Harmonien: Sie regulierten das Weltklima, kalibrierten die Chemie von Atmosphäre und Ozeanen und hielten die Kreisläufe von Wasser, Luft und lebenswichtigen Nährstoffen durch die vielen Schichten des Planeten in Gang. Ausbrüche von Megavulkanen, Asteroideneinschläge, schrumpfende Meere und andere unvorstellbare Katastrophen verwüsteten den Planeten viele Male und wirbelten lange eingespielte Rhythmen in einem Hexentanz durcheinander. Und doch zeigte unser lebender Planet immer wieder eine erstaunliche Resilienz – die Fähigkeit, sich im Gefolge verheerender Katastrophen neu zu beleben und neue Formen des ökologischen Gleichklangs zu finden.
Wenn wir lernen, in unserer Spezies einen Teil einer viel größeren Lebensform – ein Mitglied einer planetaren Gesamtheit – zu sehen, zeigt sich unsere Verantwortung für die Erde deutlicher als je zuvor. Die Tätigkeit der Menschen hat nicht einfach nur die globale Temperatur ansteigen lassen oder »die Umwelt geschädigt«, sondern sie hat das größte Lebewesen, das wir kennen, in ein schweres Ungleichgewicht gebracht und in einen Zustand der Krise gestürzt. Tempo und Ausmaß dieser Krise sind gewaltig: Wenn wir nicht eingreifen, wird die Erde einige Tausend bis Millionen Jahre brauchen, um sich von selbst vollständig zu erholen. Währenddessen wird sie zu einer Welt werden, wie wir sie noch nie gekannt haben – einer Welt, die weder die moderne menschliche Zivilisation noch die Ökosysteme, auf die wir derzeit angewiesen sind, aufrechterhalten kann.
Unsere Spezies ist als einzige in der Lage, das System Erde als Ganzes zu erforschen und gezielt zu verändern. Aber der Versuch, ein solches ungeheuer kompliziertes System in seiner Gesamtheit zu steuern, wäre vermessen. Stattdessen müssen wir uns bewusst werden, welch unverhältnismäßig großen Einfluss wir auf den Planeten haben, und gleichzeitig die Grenzen unserer Fähigkeiten anerkennen. Das lebenswichtigste Projekt ist klar: Um die schlimmstmöglichen Folgen der Klimakrise abzuwenden, müssen die wohlhabenden industriell und postindustriell geprägten Staaten sich an die Spitze einer weltweiten Anstrengung stellen, fossile Brennstoffe so schnell wie möglich durch saubere, erneuerbare Energieträger zu ersetzen. Die Erdsystemforschung unterstreicht aber auch, wie wichtig ein ergänzender Ansatz ist. In der Evolution unseres lebenden Planeten haben sich viele Wege entwickelt, um Kohlenstoff zu speichern und das Klima zu regulieren. Im Laufe der letzten Jahrhunderte haben die Ozeane und Kontinente mit ihren Ökosystemen einen großen Teil der Treibhausgasemissionen der Menschen aufgenommen und gespeichert. Wenn wir aber die Wälder, Graslandschaften und Feuchtgebiete der Erde – ihre unterseeischen Wiesen, abgrundtiefen Ebenen und Riffe – schützen und wiederherstellen, können wir solche Prozesse, die den Planeten stabilisieren, verstärken und die ökologischen Gleichklänge, die sich im Laufe der Erdzeitalter entwickelt haben, aufrechterhalten.
Das Erwachen der Erde geht der Frage nach, wie das Leben unseren Planeten verändert hat, und äußert Gedanken darüber, was die Aussage, die Erde als solche sei lebendig, eigentlich bedeutet. Außerdem feiert es die großartige Ökologie, die unsere Welt am Leben erhält. Das Buch handelt davon, wie ein Planet zu der Erde werden konnte, die wir heute kennen, wie sie schnell zu einer vollkommen anderen Welt wird und wie wir, die wir zu diesem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte unseres Planeten lebendig sind, letztlich mit darüber bestimmen werden, was für eine Erde unsere Nachkommen in den kommenden Jahrtausenden erben werden. Die drei Abschnitte des Buches – Gestein, Wasser und Luft – spiegeln die drei Hauptbestandteile des Planeten und seine wichtigsten Sphären wider – die Lithosphäre, die Hydrosphäre und die Atmosphäre. Diese Reihenfolge wiederum spiegelt ihre Mengenverhältnisse wider. Was die Masse angeht, enthält die Erde wesentlich mehr Gestein als Wasser und bedeutend mehr Wasser als Luft. Jeder Abschnitt besteht aus drei Kapiteln; das erste handelt davon, wie Mikroben, die ältesten und kleinsten Organismen auf der Erde, die jeweilige Schicht des Planeten verändert haben. Das zweite konzentriert sich auf entscheidende Wandlungen, die durch aufeinanderfolgende Wellen immer größerer, komplexerer Lebensformen – Pilze, Pflanzen und Tiere – ausgelöst wurden und wie diese Veränderungen von den vorherigen Prozessen abhängig waren. Das dritte gibt einen Überblick darüber, wie schnell unsere Spezies die Erde in ihrer relativ kurzen Geschichte verändert hat, und untersucht, wie wir unsere Beziehung zum Planeten am besten neu gestalten können.
Unser Weg beginnt tief in der Erdkruste, und dann arbeiten wir uns nach außen vor; wir streifen über die Kontinente, tauchen in die flüssigen Weiten des Planeten ein und erreichen schließlich die zarteste der drei Sphären, die Hülle aus Luft, die sich mehr als 90 Kilometer über uns erstreckt. Auf unserem Weg werden wir durch Unterwasserwälder schwimmen, einen experimentellen Naturpark besuchen, in dem Tiere die Landschaft neu gestalten, und zu einem Observatorium hinaufklettern, das auf halbem Weg zwischen Baumwipfeln und Wolken liegt. Wir werden eine bunte Besetzung faszinierender Protagonisten kennenlernen – Wissenschaftlerinnen, Künstler und Erfinderinnen, Feuerwehrleute, Höhlenforscher und Strandläuferinnen; viele von ihnen haben ihr Leben der Erforschung und dem Schutz unserer lebendigen Heimat gewidmet. Wir werden bis zu einigen besonders prägenden Ereignissen in der turbulenten, 4,54 Milliarden Jahre alten Geschichte unseres Planeten zurückreisen und uns seine vielen verschiedenen Zukunftsaussichten ausmalen. Und wir werden lernen, die Spuren des Lebendigen auf allen Teilen des heutigen Planeten zu erkennen, vom Herz des Amazonas-Regenwaldes bis zu der Erde in unserem Garten.
1 Lovelock und Margulis entwickelten die Gaia-Hypothese während ihrer Laufbahn ständig weiter. Viele andere Fachleute gelangten zu eigenen Interpretationen. Beispiele für die verschiedenen Versionen der Gaia-Hypothese und eine wissenschaftliche Einteilung finden sich in den ergänzenden Anmerkungen am Ende des Buches
2 Im Jahr 2001, 33 Jahre nachdem Lovelock auf einer Tagung in Princeton in New Jersey erstmals über das gesprochen hatte, was er später Gaia nannte, unterzeichneten mehrere bedeutende internationale Wissenschaftsorganisationen die historische Amsterdam Declaration on Global Change (Amsterdamer Erklärung über den globalen Wandel). Darin heißt es unter anderem: „Das System Erde verhält sich wie ein einziges, sich selbst regulierendes System aus physikalischen, chemischen, biologischen und humanen Bestandteilen, wobei zwischen den Bestandteilen komplexe Interaktionen und Rückkopplungen ablaufen.«
3 In der Systemforschung definiert man ein System als organisiertes Netzwerk von Bestandteilen, die als Ganzes funktionieren. Ein System kann klein und einfach sein wie ein Molekül, aber auch groß und komplex wie der Kosmos. Manche Fachleute vertreten die Ansicht, alle Lebensformen, ob Mikroorganismus, Wald oder Planet, seien definitionsgemäß lebende Systeme.
4 In der Wissenschaft gibt es eine lange, faszinierende Tradition musikalischer Metaphern. In der Wahrnehmung der alten Griechen war die geordnete Bewegung der Planeten eine »Musik der Sphären«. Die Stringtheorie postuliert »winzige Strings, deren Schwingungsmuster die Evolution des Kosmos koordinieren«. Genome werden häufig mit Musikinstrumenten und die Genexpression mit Liedern verglichen. Organ, die Bezeichnung für einen lebenswichtigen Körperteil – das Wort bedeutet im Englischen auch »Orgel« –, und Organismus gehen auf die gleiche Wurzel zurück, die »Arbeit« bedeutet.
TEIL I
GESTEIN
KAPITEL 1
❖
INNERIRDISCHE
DIE HAUT DER ERDE IST VOLLER POREN, und jede Pore ist das Tor in eine innere Welt. Manche sind nur groß genug für ein Insekt, durch andere würde ohne Weiteres ein Elefant passen. Manche führen nur in kleine Hohlräume oder flache Spalten, andere erstrecken sich bis in die unerforschten Winkel im felsigen Inneren der Erde. Jeder Mensch, der den Versuch unternehmen will, zum Mittelpunkt unseres Planeten zu reisen, braucht dazu einen ganz besonderen Eingang: Er muss groß genug sein, das schon, aber auch sehr tief und auf seiner ganzen Länge stabil – und im Idealfall ist er mit einem Aufzug ausgestattet.
Ein solches Portal liegt in der Mitte Nordamerikas. Die gefurchte Grube ist ungefähr einen knappen Kilometer breit, erstreckt sich in Spiralen mehr als 400 Meter in den Boden und gibt ein Marmormosaik aus jungem und uraltem Gestein frei: graue Streifen aus Basalt, milchige Adern aus Quarz, blasse Säulen aus Rhyolit und schimmernde Landschaften aus Gold. Unter der Grube winden sich Tunnel mit einer Länge von rund 500 Kilometern durch festes Gestein und erstrecken sich mehr als zweieinhalb Kilometer unter die Oberfläche. Die Stelle in Lead in South Dakota beherbergte 126 Jahre lang die größte, tiefste und produktivste Goldmine Nordamerikas. Als die Homestake Mine Anfang der 2000er-Jahre den Betrieb einstellte, hatte sie mehr als 900 Tonnen Gold geliefert.
Im Jahr 2006 stiftete die Barrick Gold Corporation die Mine dem Bundesstaat South Dakota, und der machte daraus letztlich die Sanford Underground Research Facility, das größte unterirdische Labor der Vereinigten Staaten. Nachdem man den Bergbau eingestellt hatte, füllten sich die Tunnel allmählich mit Wasser. Die untere Hälfte der Anlage steht noch heute unter Wasser, man kann aber immer noch fast eineinhalb Kilometer unter die Erde gelangen. Die Forschenden, die das tun, sind in ihrer Mehrzahl Physiker und führen höchst sensible Experimente durch, die man vor Störungen durch kosmische Strahlung abschirmen muss. Während sie sich, eingehüllt in Ganzkörperanzüge, in hochglanzpolierten Labors einschließen, die mit Detektoren für dunkle Materie ausgestattet sind, suchen Biologinnen, die sich in das unterirdische Labyrinth wagen, in der Regel die feuchtesten, schmutzigsten Winkel auf, Orte, an denen geheimnisvolle Lebewesen Metall ausscheiden und das Gestein umwandeln.
An einem schneidend kalten Dezembermorgen folgte ich drei jungen Wissenschaftlern und einer Gruppe von Mitarbeitenden der Sanford Facility in den »Käfig«, einen nackten Aufzug aus Metall, der uns mehr als 1400 Meter tief in die Erdkruste befördern sollte. Wir trugen neonfarbene Schutzwesten, Stiefel mit Stahlspitzen, Schutzhelme und, an unserem Gürtel befestigt, persönliche Atemgeräte, die uns im Fall eines Brandes oder einer Explosion vor dem Kohlenmonoxid schützen sollten. Der Käfig sank schnell und erstaunlich geschmeidig in die Tiefe, wobei sein nacktes Gerüst Blicke auf die vielen Ebenen der Mine freigab. Unser albernes Geplapper und Gelächter waren im Lärm der abgewickelten Stahlseile und der rauschenden Luft gerade noch zu hören. Nach einem kontrollierten Absturz erreichten wir nach etwa zehn Minuten den Boden der Anlage.
Unsere Führer, zwei frühere Bergleute, dirigierten uns zu zwei kleinen, miteinander verbundenen Loren und fuhren uns auf Schienen durch eine Reihe enger Tunnel. Die Wagen ruckelten vorwärts und machten dabei ein Geräusch, als würden schwere Metallketten rasseln; die dünnen Strahlen unserer Stirnlampen beleuchteten gewölbte Wände aus dunklem Gestein, die von Fäden aus Quarz durchzogen und silbern gesprenkelt waren. Unter uns sah ich aufblitzende alte Geländer, flache Wasserpfützen und Gesteinstrümmer. Auch wenn ich wusste, dass wir uns tief unter der Erde befanden, wirkten die Tunnel wie Scheuklappen und schränkten meinen Blickwinkel auf eine schmale Rinne aus Gestein ein. Als ich zur Tunneldecke blickte, fragte ich mich, wie es wäre, die Kruste unseres Planeten über uns in ihrem vollen Ausmaß zu sehen – eine Säule aus Gestein, mehr als dreimal so hoch wie das Empire State Building. Würde die Tiefe ebenso greifbar werden wie die Höhe, wenn man über den Rand einer Klippe blickt? Ich spürte, wie mir schwindelig wurde, und wandte meinen Blick schnell wieder geradeaus.
Nach 20 Minuten hatten wir von dem relativ kühlen, gut belüfteten Bereich in der Nähe des Käfigs in einen heißen, schwülen Korridor gewechselt. Während die Welt an der Oberfläche von Schnee bedeckt war und weit unter dem Gefrierpunkt lag, herrschten eineinhalb Kilometer weiter unten – viel näher am geothermischen Herz der Erde – rund 32 Grad und fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Es war, als würde die Wärme durch das Gestein um uns herum pulsieren, die Luft wurde dick und klebrig, und der Geruch von Kalkstein stieg uns in die Nase. Es kam mir vor, als hätten wir den Vorhof zur Hölle betreten.
Die Wagen hielten an. Wir stiegen aus und gingen ein kurzes Stück bis zu einem großen Kunststoffrohr, das aus dem Gestein ragte. Aus der Wand am Ansatz des Zapfhahns perlte ein Wasserrinnsal, das kleine Bäche und Pfützen bildete. Das Wasser roch nach Schwefelwasserstoff – von hier aus strömte der Gestank in den Stollen. Als ich mich hinkniete, erkannte ich in dem Wasser ein faseriges weißes Material, das der Haut eines pochierten Eies ähnelte. Die Geobiologin Caitlin Casar erklärte es mir: Die weißen Fasern waren Mikroorganismen der Gattung Thiothrix. Sie verbinden sich zu langen Fäden und speichern Schwefel in ihren Zellen, was ihnen den gespenstischen Farbton verleiht. Da waren wir nun tief im Inneren der Erdkruste an einem Ort, an dem es ohne Zutun der Menschen kein Licht und nur sehr wenig Sauerstoff gäbe, und doch quoll das Leben buchstäblich aus dem Gestein. Dieser ökologische Hotspot trug den Spitznamen »Thiothrix-Fälle«.
Als ich mit einem Bleistift behutsam in den Strängen aus Mikroorganismen stocherte, öffnete die Biogeochemikerin Brittany Kruger einen von mehreren Hähnen an dem Rohr vor uns und unterzog die austretende Flüssigkeit verschiedenen Untersuchungen. Unter anderem ließ sie ein wenig Wasser in ein tragbares blaues Gerät fließen, das an einen Tricorder aus Star Trek erinnerte. Damit maß sie pH-Wert, Temperatur und die gelösten Feststoffe. An einigen Hähnen befestigte sie extrem feinporige Filter, um alle eventuell im Wasser schwebenden Mikroorganismen festzuhalten. Zur gleichen Zeit untersuchten Casar und der Umweltingenieur Fabrizio Sabba eine Reihe mit Gestein gefüllter Kartuschen, die man an dem Auslaufrohr angebracht hatte. Zu Hause im Labor würden sie den Inhalt analysieren und der Frage nachgehen, ob wirklich Mikroorganismen in die Stollen geflossen waren und trotz der dort herrschenden völligen Dunkelheit, trotz Nährstoffmangel und ohne Atemluft überlebt hatten.
In einer anderen Etage der Mine stapften wir durch Schlamm und wadentiefes Wasser, wobei wir unsere Schritte sorgfältig setzten, um nicht über Schienen und verstreute Steine zu stolpern. Hier und da zierten zarte weiße Kristalle den Boden und die Wände – die meisten von ihnen, wie die Wissenschaftler mir erklärten, aus Gips oder Calcit. Wenn unsere Stirnlampen die Tunnel aus pechschwarzem Gestein im richtigen Winkel beleuchteten, schimmerten die Kristalle wie Sterne.
Nach weiteren 20 Minuten erreichten wir – dieses Mal zu Fuß – einen zweiten großen Abfluss, der aus dem Gestein ragte. Diese Nische befand sich nur einen knappen Kilometer unter der Erde, war besser belüftet und deshalb auch viel kühler als die vorherige. Das Gestein rund um den Auslasshahn war mit einer Substanz bedeckt, die wie feuchter Ton aussah, ihre Farbe changierte von blassem Lachsrosa bis zu Ziegelrot. Auch das, so erklärte Casar, war das Werk von Mikroorganismen, in diesem Fall der Gattung Gallionella, die in eisenhaltigem Wasser gedeiht und verdrillte metallische Anhänge bildet. Auf Casars Bitte füllte ich ein Gefäß mit Gesteinswasser aus dem Auslassrohr, löffelte mikroorganismenreichen Schlamm in Plastikröhrchen und brachte diese in Kühlboxen unter, wo sie auf die weitere Analyse warten konnten.
Kruger und Casar kommen schon seit vielen Jahren mindestens zweimal im Jahr in die frühere Homestake-Mine. Dabei stoßen sie jedes Mal auf rätselhafte Mikroorganismen, die noch nie zuvor erfolgreich im Labor gezüchtet wurden und noch nicht einmal einen Artnamen haben. Die Studien sind Teil eines Gemeinschaftsprojekts, das unter anderem von Magdalena Osburn geleitet wird, einer Professorin an der Northwestern University und führenden Vertreterin des relativ neuen Fachgebietes der Geomikrobiologie.
Osburn und ihre Kollegen konnten zeigen, dass das Erdinnere im Gegensatz zu althergebrachten Annahmen keineswegs leblos ist. Möglicherweise lebt sogar die Mehrzahl aller Mikroorganismen unseres Planeten – vielleicht mehr als 90 Prozent – tief unter der Erde. Diese innerirdischen Mikroben sind meist ganz anders als ihre Vettern an der Oberfläche. Sie sind uralt und langsam, pflanzen sich nur selten fort und leben möglicherweise über Jahrmillionen. Ihre Energie beziehen sie häufig auf ungewöhnlichen Wegen: Sie atmen keinen Sauerstoff, sondern Gestein. Außerdem überstehen sie offensichtlich geologische Katastrophen, von denen die meisten anderen Lebewesen vernichtet würden. Wie viele winzige Lebewesen in Ozean und Atmosphäre bewohnen die einzigartigen Mikroorganismen in der Erdkruste nicht einfach nur ihre Umgebung, sondern sie verändern sie auch. Unterirdische Mikroben schaffen riesige Hohlräume, reichern Mineralien und kostbare Metalle an und steuern die globalen Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufe. Mikroorganismen dürften sogar dazu beigetragen haben, die Kontinente aufzubauen, indem sie ganz buchstäblich die Grundmauern für alle anderen terrestrischen Lebensformen schufen.
Die Geschichte des lebenden Steins, den wir Erde nennen, ist eine Geschichte ständigen Wandels. Die Welt, die wir Menschen kennen, ist nur eine der vielen aufeinanderfolgenden, oftmals grundlegend unterschiedlichen Identitäten unseres Planeten. Viele frühere Erscheinungsformen der Erde wären unbewohnbar und mehr oder weniger nicht wiederzuerkennen gewesen, und das nicht nur für Menschen, sondern auch für alle anderen Lebewesen außer urtümlichen Mikroorganismen.
Als die Erde entstand, war sie zunächst einmal eine glühend heiße Kugel aus geschmolzenem Gestein. Wahrscheinlich war sie zu klein, zu heiß und zu unstet, als dass sie flüssiges Wasser oder eine Atmosphäre über längere Zeit hätte festhalten können. Wenn es eine Uratmosphäre gab, wurde sie vermutlich vor rund 4,5 Milliarden Jahren durch eine unvorstellbar heftige Kollision zwischen der Erde und einem ihrer kleineren Nachbarplaneten vernichtet. Bei dem Zusammenstoß entstand eine riesige Wolke aus Gesteinstrümmern, von denen einige sich schließlich zusammenfanden und den Mond bildeten. Im Laufe der nächsten 100 Millionen Jahre kühlte sich die geschmolzene Oberfläche der Erde ab und bildete eine Kruste, die Dampf und andere Gase ausstieß, darunter Kohlendioxid, Stickstoff, Methan und Ammoniak. Dieser Gasmantel verdichtete sich durch ständige Vulkanaktivität. Ein ununterbrochener Asteroiden- und Meteoritenhagel lieferte weiteren Wasserdampf, Kohlendioxid und Stickstoff.
Gemeinsam ließen die Gase, die entweder aus dem Inneren des Planeten freigesetzt wurden oder von einschlagenden Gesteinsbrocken aus dem Weltall stammten, eine neue Atmosphäre entstehen. Ungeheure Wasserdampfmengen kondensierten zu Wolken und strömten als Starkregen, der über Jahrtausende dauerte, zurück auf die Oberfläche. Vor vier Milliarden Jahren oder vielleicht auch noch früher war das flüssige Wasser, das sich auf der entstehenden Erdkruste gesammelt hatte, zu einem flachen Weltmeer geworden, unterbrochen von Vulkaninseln, die nach und nach zu den ersten Landmassen heranwuchsen.
Wo und wann der Planet zum ersten Mal zum Leben erwachte, ist wie so vieles aus der Frühgeschichte unseres Planeten nicht genau bekannt. Irgendwann, nicht allzu lange nach der Entstehung der Erde, ordneten sich Stückchen aus ihrer Materie in irgendeiner warmen, feuchten Nische, in der die richtigen chemischen Verhältnisse und Energieströme herrschten – vielleicht in einer heißen Quelle, einem Einschlagkrater oder einem hydrothermalen Schlot am Meeresboden –, zu den ersten Gebilden an, die sich selbst verdoppeln konnten und sich schließlich zu Zellen entwickelten. Fossilfunde und die chemische Analyse des ältesten jemals entdeckten Gesteins deuten darauf hin, dass es lebende Mikroorganismen bereits vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren gab, vielleicht sogar schon vor 4,2 Milliarden Jahren.
Unter allen Lebewesen ähneln die sonderbaren Mikroorganismen, die tief in der Kruste unseres Planeten leben, heute vielleicht am stärksten einigen der ersten einzelligen Organismen, die es gab. Zusammen machen diese unterirdischen Mikroorganismen nach Schätzungen 10 bis 20 Prozent der gesamten Biomasse – der lebenden Materie – auf der Erde aus. Und doch hielt in der Wissenschaft bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts fast niemand unterirdisches Leben in Tiefen von mehr als ein paar Metern auch nur für plausibel.
In geringer Tiefe begegneten Menschen den auffälligsten Formen des unterirdischen Lebens zweifellos bereits zu einer Zeit, als sie erstmals Höhlen erkundeten und bewohnten, aber die ältesten erhaltenen Berichte über solche Begegnungen gehen nicht weiter als bis ins 17. Jahrhundert zurück. Der Naturforscher Janez Vajkard Valvasor reiste 1684 durch Zentralslowenien und ging Gerüchten über eine rätselhafte Quelle in der Nähe von Ljubljana nach, in deren Tiefen angeblich ein Drache lebte. Die Einheimischen glaubten, der Drache würde jedes Mal, wenn er seinen Körper bewegte, Wasser an die Oberfläche drücken. Nach starkem Regen, so erklärten sie, fanden sie manchmal Drachenbabys, die in der Nähe an die Felsen gespült worden waren, schlanke, geschlängelte Wesen mit stumpfer Schnauze, gekräuseltem Hals und einer nahezu durchscheinenden, rosafarbenen Haut. Auf der Grundlage dieser Berichte beschrieb Valvasor die Tiere als »kurz gesagt, einer Echse ähnlich, einem Wurm und dem Ungeziefer, von dem es hier in der Gegend vieles gibt«. Noch ein weiteres Jahrhundert musste vergehen, bevor Naturforscher die Tiere offiziell als Wassersalamander einstuften, die ausschließlich unter der Erde in dem aus Kalksteinhöhlen fließenden Wasser lebten. Heute nennen wir sie Grottenolme.
Im Jahr 1793 veröffentlichte Alexander von Humboldt eine seiner ersten wissenschaftlichen Studien, ein Buch über Pilze, Moose und Algen, die in sächsischen Bergwerken ihr Leben fristeten. Fast 40 Jahre später, im September 1831, fand der Höhlenführer und Laternenanzünder Luka Čeč einen winzigen, rund sieben Millimeter langen, kupferfarbenen Käfer, der sich im Südwesten Sloweniens in Höhlen herumtrieb. Im Aussehen ähnelte er ein wenig einer Ameise mit gewölbtem Hinterleib, einem schmalen Kopf und dünnen Beinen. Bei näherer Untersuchung stellte der Insektenforscher Ferdinand Schmidt fest, dass es sich bei dem Käfer um eine bis dahin unbekannte Spezies handelte, die sich an das Leben unter der Erde angepasst hatte: Er besaß weder Flügel noch Augen, sondern fand sich in seiner Umgebung mit seinen langen, borstenbesetzten Antennen zurecht. Die Nachricht über diese Entdeckung setzte eine Fülle wissenschaftlicher Untersuchungen in Gang. Zwischen 1832 und 1884 dokumentierten Naturforscher zahlreiche Arten, die in Höhlen lebten und in der Wissenschaft neu waren, darunter verschiedene Zikaden, Pseudoskorpione, Asseln, Spinnen, Doppelfüßer, Hundertfüßer und Schnecken.
Eine erste Ahnung von der wahren Fülle des Lebens tief unter der Erde machte sich in der Wissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts breit. Um 1910 wollten deutsche Mikrobiologen wissen, woher das Methangas in Bergwerken stammt, und isolierten Bakterien aus Kohle, die man in einer Tiefe von rund 1000 Metern gewonnen hatte. Der russische Wissenschaftler V. L. Omelianski entdeckte 1911 im Permafrost lebensfähige Bakterien, die sich neben einem ausgegrabenen Mammut erhalten hatten. Wenig später berichtete der Bodenforscher und Mikrobiologe Charles B. Lipman von der University of California in Berkeley, er habe uralte Bakteriensporen wiederbelebt, die in Kohlebrocken aus einem Bergwerk in Pennsylvania eingeschlossen waren.
Solche frühen Studien waren zwar faszinierend, sie überzeugten aber die meisten Fachleute nicht davon, dass Mikroorganismen tief in der Erdkruste leben – immer bestand die Möglichkeit, dass die Proben durch Mikroben von der Oberfläche verunreinigt waren. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte fand man aber immer wieder Mikroorganismen in Gestein und Wasser, das man in Asien, Europa und Amerika aus Bergwerken und Bohrlöchern gewonnen hatte. Sowjetische Biologen bedienten sich irgendwann sogar des Begriffs »geologische Mikrobiologie«. Bis zu den 1980er-Jahren hatten sich die Einstellungen in der wissenschaftlichen Welt gewandelt. Studien an Grundwasserhorizonten – unterirdischen Reservoiren von in Gestein eingeschlossenem Wasser – deuteten darauf hin, dass Bakterien auch mehrere Tausend Meter unter der Oberfläche das Grundwasser bevölkerten und seine chemische Zusammensetzung veränderten. Das US-Energieministerium rief ein wissenschaftliches Programm ins Leben, um die Verunreinigung des Grundwassers zu überwachen und die Frage zu klären, ob Mikroorganismen zum Herausfiltern von Giftstoffen beitragen können. Frank J. Wobber, der Leiter des Programms, entwickelte zusammen mit seinen Kollegen strengere Methoden, um das versehentliche Einschleppen von Oberflächenmikroben zu verhindern: Unter anderem wurden Bohrer und Gesteinsproben desinfiziert, und man verfolgte den Weg der Flüssigkeiten durch die Erdkruste, um sicherzustellen, dass Oberflächenwasser sich nicht mit den gewonnenen Proben vermischte.
Letztlich bestätigten die Ergebnisse solcher Forschungsarbeiten und ähnlicher Studien, dass die ersten Fürsprecher einer unterirdischen Biosphäre in ihren Schätzungen, wenn überhaupt, zu vorsichtig gewesen waren. Wo man sich auch umsah, ob in der kontinentalen Kruste, unter dem Meeresboden oder unter dem Eis der Antarktis, überall fand man Gemeinschaften von Mikroorganismen, die insgesamt Tausende nicht identifizierte Arten enthielten. Manchmal waren Mikroorganismen eindeutig vorhanden, aber weit verstreut: in bestimmten Nischen der Kruste gab es anscheinend weniger als eine Mikrobe pro Kubikzentimeter, was einem Land entspräche, in dem nur alle 700 Kilometer ein Mensch anzutreffen ist. Die Unterwelt war echt, aber ihre Bewohner waren viel kleiner und seltsamer, als man es sich vorgestellt hatte.
In den 1990er-Jahren veröffentlichte der Astrophysiker Thomas Gold von der Cornell University eine Reihe provokativer Behauptungen über die Unterwelt der Mikroorganismen. Er vertrat die Ansicht, Mikroorganismen seien überall unter der Oberfläche vorhanden, lebten in flüssigkeitsgefüllten Poren zwischen den Körnern des Gesteins und bezögen ihren Lebensunterhalt nicht aus Licht und Sauerstoff, sondern vorwiegend aus Methan, Wasserstoff und Metallen. Zwar hatte man bis dahin noch keine Mikroorganismen gefunden, die mehr als drei Kilometer unter der Erde lebten, Gold hatte aber die Vermutung, dass es sie auch in viel größeren Tiefen von bis zu zehn Kilometern geben könnte; ihre Biomasse innerhalb der Erdkruste war demnach mindestens ebenso groß wie die auf der Oberfläche oder sogar größer. Außerdem äußerte er den Verdacht, alles Leben auf der Erde oder zumindest manche seiner Ausprägungen könnten ihren Ursprung im Inneren des Planeten haben; demnach gebe es vielleicht auch auf anderen Planeten und Monden unterirdische Ökosysteme; und Mikroorganismen, die in der Tiefe wohnen und vor den Unwägbarkeiten der Oberfläche geschützt sind, seien wahrscheinlich im Kosmos die am weitesten verbreitete Lebensform überhaupt.
Motiviert unter anderem durch Golds Vision, hatte man Anfang der 2000er-Jahre in der Wissenschaft begonnen, mit neuen Methoden noch weiter in die Erdkruste vorzudringen. Besonders vielversprechend waren Bergwerke, denn sie ermöglichten den Zugang zu tiefen unterirdischen Regionen, ohne dass man in großem Umfang weitere Bohrungen oder andere Infrastruktur brauchte. Tullis Onstott, ein Professor für Geowissenschaften an der Princeton University, reiste zusammen mit Kollegen zu besonders tiefen Goldminen in Südafrika und entnahm Grundwasserproben aus fast drei Kilometern Tiefe. In einigen Proben aus besonders tiefen Bereichen fanden sie eine einzige Spezies: ein Bakterium mit der Form eines Baguettes und einem peitschenähnlichen Schwanz, das Temperaturen von bis zu 60 Grad Celsius aushielt und seine Energie aus den chemischen Nebenprodukten des radioaktiven Zerfalls von Uran bezog, das in seiner lichtlosen Heimat vorkam.
Onstott und seine Kollegen entschlossen sich, dem Mikroorganismus den Namen Desulforudis audaxviator zu geben; ihre Anregung bezogen sie dabei aus dem Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne, in dem es heißt: »descende, Audax viator, et terrestre centrum attinges« – »steig hinab, kühner Wandrer, und du gelangst zum Mittelpunkt der Erde«. Das Wasser, in dem man D. audaxviator entdeckt hatte, war seit mindestens einigen Dutzend Millionen Jahren nicht aufgerührt worden, was darauf schließen ließ, dass die Population dieser wagemutigen, mikroskopisch kleinen Terranauten sich ebenso lange selbst ihren Lebensunterhalt gesichert hatte. »Normalerweise gehen wir nicht davon aus, dass Gestein etwas Lebendiges beherbergt«, schreibt Onstott in seinem Buch Deep Life. »Ich bin ausgebildeter Geologe, und wie die meisten Geologen habe ich Gestein immer für etwas Unbelebtes gehalten.« Jetzt aber, so fährt er fort, sei er Geomikrobiologe und betrachte jedes Gestein als eine eigene kleine Welt aus Mikroorganismen, »von denen manche vielleicht schon in dem Gestein leben, seit es sich vor Hunderten von Jahrmillionen gebildet hat«.
Manche Lebensgemeinschaften unterirdischer Mikroorganismen dürften sogar noch älter sein. Die Kidd Creek Mine in der kanadischen Provinz Ontario ist eines der ältesten und tiefsten Bergwerke der Welt: Es erstreckt sich in fast drei Kilometern Tiefe und enthält reichhaltige Kupfer-, Silber- und Zinkadern, die sich vor fast drei Milliarden Jahren am Meeresboden gebildet haben. In einer 2013 erschienenen Studie wies die Geologin Barbara Sherwood Lollar von der Universität in Toronto nach, dass einige Wasserblasen in der Kidd Creek Mine seit mehr als einer Milliarde Jahre unberührt und von der Oberfläche isoliert waren – das älteste Wasser, das man bis dahin auf der Erde entdeckt hatte. Das eisenhaltige Wasser war kurz nach der Gewinnung durchsichtig, nahm aber bei Einwirkung von Sauerstoff ein blasses Orange an; es hat die Konsistenz von leichtem Ahornsirup, enthält mindestens doppelt so viel Salz wie heutiges Meerwasser und nach Sherwood Lollars Urteil »schmeckt es schrecklich«. Im Jahr 2019 bestätigten Sherwood Lollar, Magdalena Osburn und mehrere Kolleginnen, dass das eine Milliarde Jahre alte Wasser aus der kilometertiefen Kidd Creek Mine wie die viel jüngeren Flüssigkeiten, die weniger als 1000 Meter unter der Oberfläche durch die Poren und Spalten des Gesteins kreisen, von Mikroorganismen bevölkert ist. Wie viele Mikroben aus den Tiefen der Erde, so sind auch sie auf die molekularen Nebenprodukte der von Strahlung angetriebenen chemischen Reaktionen zwischen Gestein und Wasser angewiesen. Ob manche dieser Mikroorganismen auch selbst fast so alt sind wie die ganze Erde, ist bisher nicht nachgewiesen, aber es wäre plausibel.
»Diese Forschung ist wirklich eine Art Entdeckungsreise«, sagt Sherwood Lollar. »Manche Befunde sind für uns ein Anlass, die Lehrbücher über die Funktion dieses Planeten neu zu schreiben. Sie verändern unsere Vorstellungen von der Bewohnbarkeit der Erde. Wo das Leben seinen Ursprung hat, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob es auf der Oberfläche entstanden ist und dann in die Tiefe wanderte, oder ob es in der Tiefe entstanden und dann nach oben gestiegen ist. Man ist geneigt, an Darwins kleinen warmen Tümpel zu denken, aber wie mein Kollege T. C. Onstott gern sagt: Es könnte ebenso leicht irgendeine kleine warme Felsspalte gewesen sein.
Auch in fast drei Kilometern Tiefe, in den Innereien der Erde, sind Mikroorganismen nicht das Einzige, was lebt. Man hat auch Pilze, Plattwürmer, Gliederfüßer und Rotiferen (Rädertierchen) gefunden, mikroskopisch kleine Wassertiere, die in südafrikanischen Goldminen rund einen bis drei Kilometer unter der Oberfläche leben. Im Dezember 2008 machte Onstotts Kollege, der belgische Zoologe Gaëtan Borgonie, eine Entdeckung, die gespenstisch an das von Valvasor im 17. Jahrhundert beschriebene »Ungeziefer« erinnerte. Knapp eineinhalb Kilometer tief, in der Beatrix Gold Mine nicht weit von der Ortschaft Welkom in Südafrika, fand er in dem gefilterten Wasser aus einem Bohrloch einen Nematoden – einen winzigen Fadenwurm. Bei geringer Vergrößerung sah er einfach nur nach einer gewundenen, einen halben Millimeter langen Nudel aus, die rund 500-mal größer war als ein Bakterium. Unter einem leistungsfähigen Rasterelektronenmikroskop erinnerte das Tier an einen unbeholfenen Egel, dessen Gesicht mit Mundplatten und Sinnesknospen ausgestattet war.
Im Labor fand Borgonie heraus, dass der Fadenwurm eine Ernährung mit unterirdisch lebenden Mikroorganismen gegenüber der eher typischen Ernährung von Fadenwürmern bevorzugte. Am Ende brachte er zwölf Eier hervor; aus allen schlüpften Junge und bildeten eine neue Population. Die Vorfahren des Fadenwurmes hatten zwar ihren Ursprung mit ziemlicher Sicherheit nicht unter der Oberfläche, sondern waren vom Regen dorthin gespült worden, sie hatten sich aber offensichtlich an das unterirdische Leben angepasst. Borgonie, Onstott und ihr Kollege Derek Litthauer tauften die neue Spezies auf den Namen Halicephalobus mephisto nach Mephistopheles, der Verkörperung des Teufels in der Legende von Faust. Er ist bis heute eine der erstaunlichsten Entdeckungen in der Geschichte der Biologie. Ein vielseitiges Tier von dieser Größe und Komplexität zu finden, das so tief in der Erdkruste in einem Wasserrinnsal lebte, war nach Onstotts Worten so, »als würde man Moby Dick im Ontariosee herumschwimmen sehen«.
Magdalena Osburns Regale sind voller Steine, und jeder Stein ist das Fossil einer Geschichte. Als wir uns in ihrem Arbeitszimmer an der Northwestern University trafen, zeigte sie mir den Basalt aus Hawaii, den sie mit einem Stock aufgesammelt hatte, als er noch fließende Lava war. Einen riesigen Quarzkristall hatte sie auf einer Reise nach Hot Springs in Arkansas aus einer Felsspalte gezogen; und den Pyrit hatte sie auf einer Rundfahrt durch eine Mine in Kanada in ihren Overall gestopft. Neben ihrem Schreibtisch bewahrte sie das geriffelte Segment einer 580 Millionen Jahre alten Matte aus Mikroorganismen auf, außerdem einen Smithsonit, ein milchig blaues Mineral, das bei Magdalena in New Mexico abgebaut wird, dem Ort, der so hieß wie sie. In einer anderen Ecke ihres Arbeitszimmers drückte sie mir einen orangefarbenen Stein mit einer Oberfläche wie von trockenem Sesam in die Hand. »Das sind Ooide«, sagte sie. »Das sind gewissermaßen winzige Meeres-Dauerlutscher aus Carbonat. Wenn du auf die Bahamas fährst und dich auf den Sandbänken herumtreibst, findest du vor allem Ooide.« Sie griff nach einem großen grauen Brocken aus Amphibilit. »Dieser Stein hier wollte mich umbringen. Als Studienanfängerin war ich in einem Freilandlager bei einem Felssturz dabei. Dieser Stein hat buchstäblich mein Zelt durchschlagen.« »Und er hat dich verfehlt?«, fragte ich. »Na ja, ich bin davongelaufen wie der Teufel«, erklärte sie. »Und als ich wieder zu meinem Zelt kam, lag da dieser Stein. Deshalb nenne ich ihn den Todesstein.«
Steine und die Geschichten, die sie erzählen, sind seit Osburns Kindheit ein wichtiger Teil ihres Lebens. Ihr Vater war Laborverwalter am Institut für Erd- und Planetenforschung der Washington University in St. Louis. Häufig begleitete sie ihn bei Universitätsexkursionen und sah in Missouri Klippen, Schluchten, Milliarden Jahre altes Lavagestein, riesige, von Gletschern abgelagerte Felsbrocken und andere geologische Besonderheiten. »Da war immer eine Bande von Studierenden der Washington University, und dann ich, ein 17-jähriges Küken«, erinnerte sie sich. »Und ich war immer diejenige, die bis dicht an die Kliffkante ging oder am Kliff zu hoch hinaufkletterte oder den Kopf über die Kante hängen ließ.« Einmal schürfte sie sich die Hand an einem Stein auf, sodass sie stark zu bluten anfing. Unter den entsetzten Blicken der Collegestudenten kletterte sie hinauf zu ihrem Vater und verlangte beiläufig nach einem Verband.
Osburns prägende Erfahrungen mit der wissenschaftlichen Forschung konzentrierten sich meist auf die Schnittstelle zwischen Geologie und Mikrobiologie. Als Studienanfängerin an der Washington University beschäftigte sie sich mit heißen Quellen und hydrothermalen Schloten in flachen Gewässern, Stellen, an denen bestimmte wärmeliebende Bakterien gedeihen. In ihrer Abschlussarbeit am California Institute of Technology kombinierte sie Untersuchungen an vorzeitlichem Gestein mit neuartigen Analysen der chemischen Spuren, die heutige Mikroorganismen in ihrer Umwelt hinterlassen; damit ebnete sie letztlich den Weg für neue Erkenntnisse über die Veränderungen, die Mikroorganismen im Laufe der Erdgeschichte bewirkt haben.
Während ihrer Postdoc-Arbeit an der University of Southern California wurde Osburn zur wissenschaftlichen Leiterin einer von der NASA finanzierten Studie über unterirdische Lebensformen, und dabei besuchte sie zum ersten Mal die einstige Homestake Mine. Früher hatten Bergleute auf der Suche nach hochwertigem Erz Erkundungsbohrungen vorgenommen, und dabei hatten sie in einigen Fällen unterirdische Wasserreservoire angestochen. Nachdem man die Bohrkerne zur Analyse entnommen hatte, wurden die Bohrlöcher mit Beton verschlossen, einige von ihnen waren aber nach wie vor undicht. Als Osburns Arbeitsgruppe entdeckte, dass mehrere solche undichten Wasseradern Mikroorganismen enthielten, sorgten sie dafür, dass die Bergleute die Bohrlöcher mit Diamant-Industriebohrern freilegten. Anschließend tauschten sie den Beton gegen Kunststoffröhren aus, die mit Ventilen versehen waren, sodass man in regelmäßigen Abständen neue Proben entnehmen konnte. Auf diese Weise richtete die Arbeitsgruppe ein funktionsfähiges Untergrund-Observatorium ein.
Nachdem ich die Steinsammlung in ihrem Arbeitszimmer bewundert hatte, ging Osburn mit mir hinüber in ihr mikrobiologisches Labor. Dort bewahrt sie Wasser, Sedimente und Mikroorganismen auf, die an verschiedenen Untersuchungsorten gewonnen wurden. Osburn und Caitlin Casar fertigten mehrere mikroskopische Präparate an, indem sie ein wenig Wasser aus der Mine auf das Glas strichen. Osburn nahm ihre Schildpattbrille ab und strich die gewellten braunen Haare beiseite; dann setzte sie sich vor das Mikroskop und drehte an verschiedenen Knöpfen, um das Bild scharf zu stellen. »Hier sehen wir ein paar Exemplare von Gallionella





























