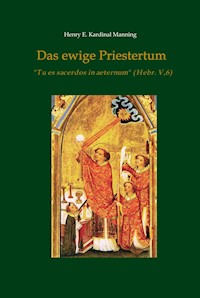
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist gewissermaßen das Testament eines Mannes, der am Ende einer langjährigen bischöflichen Laufbahn seinem Klerus, mit dem vereint er Not und Armut, Kampf und Widerspruch, Verdemütigung und Mühseligkeit getragen hat, seine letzten Ermahnungs- und Trostworte hinterlässt. Ausgehend vom Wesen und der Natur des katholischen Priestertums legt Kardinal Manning sowohl die Verpflichtung zum Heiligkeitsstreben als auch die dazu erforderliche Tugendübung für den Priester in einer Weise dar, wie der Vater zu seinen Söhnen spricht. Das Buch soll aber nicht nur ein Tröster, Wegweiser und Mahner sein für die in der Seelsorge Beschäftigten, sondern auch ein Betrachtungsbuch für Seminaristen und ein Handbuch für diejenigen, welche die verantwortungsvolle Arbeit übernehmen, Priesterexerzitien abzuhalten. Möge das Buch in seiner deutschen Übersetzung allen Mitbrüdern im Seelsorgeamt reichlichen Halt und Kraft geben, insbesondere, wo so viele Priester unter schwierigen Umständen das Hirtenamt verwalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sr. Bischöflichen Gnaden
dem hochwürdigsten Herrn
Johannes Josephus Koppes
Bischof von Luxemburg
in
kindlicher Verehrung und dankbarer Liebe
Der Übersetzer
Henry E. Kardinal Manning
Das Ewige Priestertum
„Tu es sacerdos in aeternum“ (Hebr V,6)
Autorisierte Übersetzung von E. M. Schmitz, Missionspriester,Auflage 1884.
Neuauflage 2019
© 2019
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN:
Paperback:
978-3-7482-3443-2
Hardcover:
978-3-7482-3444-9
e-Book:
978-3-7482-3445-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
I. Die Natur des Priestertums
II. Die Gewalten des Priestertums
III. Das dreifache Verhältnis des Priestertums
IV. Die Verpflichtungen zur Heiligkeit im Priestertum
V. Die Hilfsmittel zur Vollkommenheit
VI. Das Ende des Priesters
VII. Des Priesters Gefahren
VIII. Des Priesters Stützen
IX. Das Seelsorgeramt, eine Quelle des Vertrauens
X. Der Wert der Zeit des Priesters
XI. Des Priesters Leiden
XII. Der Priester unter falscher Anklage
XIII. Der Freund des Priesters
XIV. Der Priester als Prediger
XV. Die Freiheit des Priesters
XVI. Des Priesters Gehorsam
XVII. Des Priesters Belohnungen
XVIII. Des Priesters Haus
XIX. Des Priesters Leben
XX. Des Priesters Tod
Hochw. Kardinal Manning
Oratio S. Gregorri Magni, Anglorum Apostoli.
Deus, qui nos pastores in populo vocare voluisti, praesta quaesumus, ut hoc quod humano ore dicimur, in tuis oculis esse valeamus, per Dominum nostrum Jesum Christum, qui vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
(Opp. tom. I. p.1400)
Einleitung
ndem wir der hochw. Geistlichkeit Deutschlands die Übersetzung dieses Werkes Seiner Eminenz des Kardinals Manning unverändert vorlegen, glauben wir hoffen zu dürfen, unseren deutschen Mitbrüdern im Seelsorgeramt einen Dienst zu erweisen.
Das Buch kann mit Recht eine Fundgrube genannt werden und dürfte wohl den Titel: „Liber aureus“ verdienen. Es ist gewissermaßen das Testament eines Mannes, der am Ende einer langjährigen, bischöflichen Laufbahn seinem Klerus, mit dem vereint er Not und Armut, Kampf und Widerspruch, Verdemütigung und Mühseligkeit getragen, in diesem Buch seine letzten Ermahnungs- und Trostworte niedergelegt.
Es soll das Buch aber nicht nur ein Trost, Wegweiser und Mahner sein für die in der Seelsorge Beschäftigten, sondern auch ein Betrachtungsbuch für Seminaristen und ein Handbuch für diejenigen, welche die verantwortungsvolle Arbeit übernehmen, Priesterexerzitien abzuhalten.
Wir geben das Buch in seiner Ganzheit, obschon Kapitel 18 und 19 speziell für England berechnet sind. Die darin enthaltenen Ermahnungen der Provinzialkonzilien von Westminster und die daran geknüpften Gedanken des hochwürdigsten Verfassers können für alle von Nutzen sein.
Möge das Buch in seiner deutschen Übersetzung allen Mitbrüdern im Seelsorgeamt reichlichen Trost und Kraft geben, besonders jetzt, wo, infolge des Kulturkampfes, in Deutschland unsere Verhältnisse denen Englands in so mancher Beziehung ähnlich geworden sind, und wo so viele Priester, die in den seit langen Jahren verwaisten Pfarreien unter schwierigen Umständen das Hirtenamt verwalten, in der Tat Missionare sind. Das Bewusstsein, dem deutschen Klerus diesen Dienst erwiesen zu haben, würde unsere Mühe überreich lohnen.
Brüssel im Juli 1884.
Der Übersetzer
Das ewige Priestertum
ERSTES KAPITEL
Die Natur des Priestertums
nsofern kein Akt erhabener sein kann, als die Konsekration des Leibes Christi, kann es keinen höheren Ordo als den des Priestertums geben.1 „Kein Akt ist erhabener, als die Konsekration des Leibes Christi.“2 „Es gibt zwischen Bischof und Priester, was die Konsekration der hl. Eucharistie anbelangt, keinen Unterschied.“ Der hl. Johannes Chrysostomus findet die Heiligkeit des Priestertums, welche in Bischof und Priester eine und dieselbe ist, in der zweifachen Jurisdiktion über den natürlichen und den mystischen Leib Christi - nämlich in der Konsekrations- und in der Absolutions-Gewalt.3
Es ist Glaubenslehre, dass unser göttlicher Heiland die Apostel zu Priestern weihte, als er bei den Worten „hoc facie in meam commemorationem“, ihnen die Gewalt zu opfern übertrug.4 Ebenso ist es Glaubenslehre, dass, als er drei Tage später sie anhauchte und sprach: „Empfanget den Hl. Geist", er ihnen die Gewalt loszusprechen gab.5 In diesen zwei Gewalten war das Priestertum vollendet. Bis jetzt hatten die Apostel noch nicht die Pastoral-Autorität erhalten und auch noch nicht den Auftrag, der ganzen Welt das Evangelium zu predigen. Sie hatten nur die zweifache Jurisdiktion über seinen natürlichen und seinen mystischen Leib erhalten, mit der Gewalt, dieselbe durch Ordination auf andere zu übertragen; denn ihr Priestertum war das „sacerdotium Christi ad Ecclesiam regendam a Spiritu sancto positum.”
Als sie später andere weihten, übertrugen sie einigen dieses priesterliche Amt in seiner ganzen Fülle - das heißt, mit der Gewalt, es wieder auf andere zu übertragen: anderen aber mit der Beschränkung, dass der geweihte Priester die erhaltene priesterliche Gewalt auf andere nicht übertragen könne. Dieses allein ausgenommen, ist das Priestertum des Bischofs, und das Priestertum des Priesters ein und dasselbe, und dennoch ist, durch die göttliche Macht der Ordination, der Episkopat größer als das Priestertum. Dieser Unterschied aber ist göttlich und nicht mitteilbar. Der hl. Hieronymus sagt: „Quid enim facit, excepta ordinatione, Episcopus quod presbyter non faciat.“6
Es ist Glaubenslehre, dass der Episkopat der von Jesus Christus eingesetzte Stand der Vollkommenheit ist. Es ist gleichfalls sicher, dass das Priestertum in diesem Stande einbegriffen ist. Was immer vom Priestertum wahr ist, das ist wahr vom Bischof und vom Priester. Dieses erklärt uns auch, warum im Anfang die Namen Bischof und Priester dieselbe Bedeutung hatten, und der eine mit dem anderen verwechselt wurde. Die Ermahnungen des hl. Paulus an den Timotheus und Titus galten für den Bischof und den Presbyter oder Priester.7 Und das ganze Buch des hl. Johannes Chrysostomus De Sacerdotio bezieht sich ausdrücklich und gleichmäßig auf beide.
Der hl. Thomas sagt, dass die Priester an dem Priestertum unseres göttlichen Heilandes teilnehmen, und dass sie sein Abbild sind. Erwägen wir also jetzt, was die Worte Priestertum Christi (sacerdotium), Teilnahme an demselben (participatio), Abbild desselben (configuratio) bedeuten.
1. Welches also ist das Priestertum des menschgewordenen Sohnes?8 Es ist das Amt, welches er für die Erlösung der Welt übernahm durch die Aufopferung seiner selbst in der Hülle unserer Menschheit. Er ist Altar, Opfer und Priester durch eine ewige Konsekration seiner selbst. Dieses ist das ewige Priestertum nach der Ordnung Melchisedechs, das „weder Anfang der Tage, noch Ende des Lebens hat"9 - ein Vorbild des ewigen Priestertums des Sohnes Gottes, des einzigen Friedensfürsten.
2. Unter dem Wort Teilnahme (participatio) versteht der hl. Thomas, dass, da das Priestertum Jesu Christi das eine, alleinige, immerwährende und universale Priestertum ist, alle Priester, welche im Neuen Bund geweiht sind, mit ihm vereinigt sind und an seinem Priestertum teilnehmen.10
Es gibt keine zwei Priestertümer, wie es auch keine zwei Sühnopfer gibt. Ein Opfer allein hat für immer die Welt erlöst und wird beständig im Himmel und aus Erden dargebracht; im Himmel von dem alleinigen Priester auf dem ewigen Altar, auf Erden von der Menge und der immerwährenden Nachfolge der Priester, welche mit ihm an seinem Priestertum teilnehmen; nicht nur als Stellvertreter, sondern in Wirklichkeit, sowie auch das Opfer, welches sie darbringen, nicht bloß eine Darstellung ist, sondern sein wahrer, wirklicher und wesentlicher Leib und sein Blut.
Dieses ist auch der Hauptgedanke des Briefes an die Hebräer. Das Priestertum des Alten Bundes war ein Schatten; das Priestertum des Neuen Bundes ist die Wirklichkeit. Es ist erfüllt in dem einen Priester und dem einen Opfer, welche beständig fortdauern in dem mit ihm auf Erden verbundenen Priestertum.
Diese Teilnahme aber hat noch eine andere und mehr persönliche Bedeutung. Die Aufopferung unseres Heilandes für uns legt uns die Verpflichtung auf, auch uns ihm gänzlich aufzuopfern. „Christus … victima sacerdotii sui et sacerdos suae victimae fuit … Ipsi sunt Hostinae sacerdotes.“11 Der hl. Ambrosius, von dem Opfer Abels sprechend, sagt: „Hoc est sacrificium primitivum, quando unusquisque se offert hostiam, et a se incipit, ut postea munus suum possit offerre.“ 12 Die Priester opfern das wahre Lamm und „das Blut, welches besser redet als Abel.“13 Jeder Priester opfert jeden Morgen dem Vater das ewige Opfer Jesu Christi auf; aber in dieser Opferhandlung soll er sich auch selbst opfern. Wenn er die Worte spricht: Hoc est corpus meum, soll er seinen eigenen Leib opfern; wenn er sagt: Hic est calix sanguinis mei, soll er sein eigenes Blut opfern, d. h. er soll sich selbst als ein Opfer seinem göttlichen Meister darbringen, mit Leib, Seele und Geist, mit allen seinen Fähigkeiten, Kräften und Neigungen, im Leben und im Sterben.
Der hl. Paulus schreibt an die Philipper: „Und wenn ich auch ein Schlachtopfer werde über dem Opfer und Dienste eures Glaubens, so freue ich mich und frohlocke mit euch allen.14 Es kann sein, dass er dies auch von dem Märtyrertum sagt, welches ihn erwartete; aber es wurde auch gesagt im Bewusstsein, dass er lange und täglich sich seinem göttlichen Meister ausopferte, als ein Teilnehmer an seinem Leiden für die Erlösten.15 Dieselben Worte könnte auch der hl. Johannes geschrieben haben, der immer das Verlangen nach dem Martyrium hatte, obschon er auf natürliche Weise starb; dasselbe ist auch enthalten in dem hl. Messopfer eines jeden Priesters, der sich selbst darbringt bei dem Opfer des Altares. Die Teilnahme des Priesters an dem Priestertum Christi erfordert auch von ihm eine Teilnahme am Gesetze der Selbstaufopferung, von welchem der Prophet schreibt: Oblatus est, quia ipse voluit, und der hl. Paulus, der von unserem Heiland sagt, dass er im Hl. Geist sich selbst als ein unbeflecktes Opfer dargebracht.16 Und, wie der hl. Johannes sagt, „daran haben wir die Liebe Gottes erkannt, dass er sein Leben für uns dahingab: und auch wir sollen für die Brüder das Leben lassen".17 Das Opfern des Leibes und des Blutes Christi erfordert von dem Priester einen Geist der Selbstentsagung und der Selbstaufopferung ohne Rückhalt. Das Gesetz der Nächstenliebe, welches alle Christen verbindet, im Notfall ihr Leben für ihre Brüder hinzugeben, und die Hirten, ihr Leben für ihre Schafe zu lassen, ist in besonderer Weise jedem Priester zur Pflicht gemacht in dem Selbstopfer der hl. Messe, welches das Opfer Jesu Christi ist.
3. Endlich bedeutet das Wort Abbild (configuratio) die Gleichförmigkeit des Priesters mit dem großen Hohenpriester. Der hl. Paulus sagt, der Sohn sei figura substantiae ejus - d. h. die Gestalt oder das genaue Ebenbild des Wesens des Vaters. Der griechische Text lautet: χαρακτήρ της ύπαρξής τους, das Ebenbild seines Wesens".18 Der Priester ist demnach die figura Christi, das genaue Abbild Christi, der χαρακτήρ oder das Wesen Christi, weil ihm das Bild seines Priestertums aufgedrückt, und ihm eine Teilnahme daran gegeben ist. Er ist, wie der hl. Paulus sagt, configuratus morti ejus19 - ihm ähnlich im Tode. In jeder Messe verkündigen wir „den Tod des Herrn, bis er kommt",20 Und wir opfern uns selbst auf in Übereinstimmung mit ihm, der sich dem himmlischen Vater geopfert. Albert der Große und der hl. Thomas haben die volle Wahrheit gesagt, als sie behaupteten, eine größere Gewalt oder Würde, als die Gewalt und Würde der Konsekration des Leibes Christi sei nie dem Menschen gegeben worden; und keine größere Heiligkeit und Vollkommenheit könne man sich denken, als die Heiligkeit oder Vollkommenheit, die in dem Priester für einen so göttlichen Akt erfordert ist. Der hl. Thomas lehrt uns, dass die Weihe einen Charakter einprägt und dass dieser Charakter ein geistig und unauslöschliches Merkmal oder Siegel ist, durch welches die Seele ausgezeichnet ist, den Gottesdienst auszuüben und denselben andere zu lehren.21
Das Priestertum Christi ist die Quelle aller Gottesverehrung.22 Alle Gläubigen werden Christo ähnlich durch den Charakter, der ihnen in der Taufe und Firmung mitgeteilt wird; die Priester desgleichen in der Ordination.23 In Christo selbst aber war kein Charakter, weil er das Vorbild aller Merkmale ist; denn Christus ist der Charakter oder die Gestalt des Vaters. In ihm ist alle göttliche Vollkommenheit, während der Charakter in uns nur eine teilweise Ähnlichkeit ist.24 Das Merkmal, das wir empfangen, ist ausgedrückt, nicht auf das Wesen, sondern auf die Fähigkeiten der Seele - d. h. auf die intellektuellen und affektiven Fähigkeiten - und ist entweder aktiv oder passiv.25 - Das Merkmal der Taufe ist eine passive Gewalt für den Empfang aller anderen Sakramente und für Gleichförmigkeit als Söhne mit dem Sohne Gottes. Der Charakter der Firmung ist eine aktive Gewalt für das öffentliche Zeugnis des Glaubens und für das Leben der Tätigkeit und Geduld als gute Soldaten Christi. Das Merkmal der Priesterweihe ist eine aktive Gewalt, welche zur Ausübung und Verwaltung des göttlichen Kultus befähigt.26 Der priesterliche Charakter ist daher eine Teilnahme am Priestertum Christi und die innigste Verähnlichung mit ihm in seinem Mittleramt. Endlich ist dieses Merkmal die Ursache und Quelle der sakramentalen Gnade, jedem der drei Sakramente, welche es ausdrücken, eigen, und ihrem Zweck und ihren Verpflichtungen angemessen.
Das Wort „character" Merkmal bedeutet, dass das Sakrament ein Zeichen auf unserer Seele zurücklässt, vergleichbar dem Eindruck, den ein Siegelring auf dem Papier hinterlässt. Dieses natürlich ist eine Metapher, ähnlich der in der Apokalypse vorkommenden Metapher bezüglich der hundertvierundvierzigtausend Bezeichneten. Wenn der hl. Thomas sagt, der Charakter sei aufgedrückt, nicht dem Wesen der Seele, sondern deren Fähigkeiten, so meint er dem Verstand vermittels Erleuchtung und den Neigungen vermittels Liebe.
Es bedeutet also ein Werk des Hl. Geistes, des Erleuchters und Heiligmachers, an unserer Seele. Aber es bedeutet nicht nur das allgemeine und gleichförmige Werk des Hl. Geistes, wie in der Taufe und in der Firmung, sondern ein eigenes und besonderes Werk, hervorgebracht in der Seele derjenigen, welche durch die Priesterweihe an dem Priestertum Jesu Christi teilnehmen. Die drei Sakramente, welche ein Merkmal aufdrücken, schaffen und bilden jedes für sich eine besondere Verwandtschaft der Seele mit Gott: die Taufe macht aus uns Söhne; die Firmung Soldaten; die Priesterweihe Priester; und diese drei geistigen Verwandtschaften, einmal eingegangen, sind ewig und bleiben unauslöschlich. Ob im Licht der Glorie oder in der äußersten Finsternis, ob gerettet oder ewig verworfen, wir bleiben Söhne, Soldaten und Priester. Und an diese drei geistigen Verwandtschaften ist eine besondere und entsprechende Gnade des Hl. Geistes geknüpft. Darum sagt der hl. Thomas, dass der Charakter die formelle Ursache oder Quelle der sakramentalen Gnade sei.27 Das Merkmal des Sohnes hat in sich alle Gnaden, welche nötig sind für das Leben eines Sohnes Gottes; das Merkmal der Firmung alle nötigen Gnaden für den Kampf eines Soldaten Jesu Christi, selbst bis zum Bekenner- und Märtyrertum; der Charakter des Priestertums hat in sich alle Gnaden der Erleuchtung, der Kraft und der Heiligkeit, welche nötig sind für das priesterliche Leben mit seinen vielfachen Verpflichtungen, Heimsuchungen und Gefahren. Dieses war es, woran der hl. Paulus den Timotheus erinnerte, als er schrieb: „Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden durch die Prophezeiung mit Handauflegung der Priester."28
Solcher Art ist das Priestertum des Sohnes Gottes, die Konsekration und Aufopferung seiner selbst; und solcher Art ist dessen Mitteilung an seine Priester durch ihre Teilnahme an seinem Amt, durch ihre Nachbildung nach ihm und durch die Aufnahme des priesterlichen Charakters in die Fähigkeiten ihrer Seele.
1 Albertus M. in lib.IV. Sent. dist. XXIV. art. 30
2 Thom. Summa Theol. lib. III. in Suppl. q. 40 a. 4, 5.
3 De Sacerdotio, lib. III. § 4, 5.
4 Conc. Trid. sess. XX. c. IX. canon 2
5 Con. Trid. sess. XIV. c. III. canon 5.
6 S. Hieron. Epist. Cl. ad Evangelum, tom. IV. p.803
7 Theodoret. in Ep. ad Phil. I, 1.
8 „Proprie officium sacerdotis est esse mediatorem inter Deum et populum, in quantum scilicet divina populo tradit“ - Summa S. Thomae P.III q. XXII. a.1. - „Et ideo Christus, inquantum homo, non solum fiut sacerdos, sed etiam hostia perfecta, simul existens hostia pro peccato, et hostia pacifica et holocaustum.“ -Ibid a. 2.
9 Hebr. VII, 3
10 P. III. q. LXIII. 6. et q. XXII. 5, 6.
11 St. Paulinus, Ep. XI § 8 ad Severum.
12 De Abel. lib. II. c. VI, tom. I. p. 215
13 Hebr. XII, 24.
14 Phil. II, 17
15 2. Tim. IV, 6. 7. 8.
16 Hebr. IX, 14.
17 1. Joh. III, 16.
19 Phil. III, 10.
20 1 Kor. XI, 26.
21 „Per omnia Sacramanta fit homo particeps sacerdotti Christi, utpote percipiens aliquem effectum ejus; non tamen per omnia sacramenta aliquis deputatur ad agendum aliquid, vel recipiendum quod pertineat ad cultum sacerdotii Christi; quod quidem exigitur ad hoc quod Sacramentum characterem imprimat.“ -Summa. S. Thomae P. III. q. LXIII. a. 6. - „Character proprie est signaculum quoddam quo aliquid insignitur, ut ordinatum in aliquem finem.“ - Ibid. a. 3. -„Character ordinatur ad ea quae sunt divini cultus.“ - Ibid. a. 4.
22 „Totus autem ritus Christianae religionis derivatur a sacerdotio Christi“ - Ibid a.3.
23 „Pertinet autem aliquod sacramentum ad divinum cultum tripliciter: uno modo per modum ipsius actionis; alio modo per modum agentis; tertio modo per modum recipientis.. . Sed ad agens in Sacramentis pertinet Sacramentum ordinis…. Sed ad recipientes pertinet Sacramentum baptismi, ad idem etiam ordinatur quoddammodo confirmatio… Et ideo per haec tria sacramenta character imprimitur, scilicet per baptismum, confirmationem et ordinem.“ - Ibid. a. 6.
24 „Et propter hoc etiam Christo non competit habere characterem; sed potestas sacerdotii ejus comparatur ad characterem sicut id quod est plenum, et perfectum ad aliquam sui participationem.“ - Ibid. a. 5.
25 „Character est quoddam signaculum quo animo insignitur ad suscipiendum, vel aliis tradendum ea qua sunt divini cultus. Divinus autem cultus in quibusdam actibus consistit. Ad actus autem proprie ordinantur potientiae animae, sicut essentia ordinatur ad esse. Et ideo character non est sicut in subjecto in essentia animae, sed in ejus potentia.“ - Ibid. a. 4.
26 „Divinus autem cultus consistit vel in recipiendo aliqua divina vel in tradendo aliis. Ad utrumque autem horum requiritur quaedam potentia: nam ad tradendum aliquid aliis requiritur quaedam potentia activa; ad recipiendum autem requiritur potentia passiva. Et ideo character importat quamdam potentiam spiritualem ordinatam ad ea quae sunt divini cultus.“ - Ibid. a. 3. u. q. LXXII. a. 5.
27 P. III. LXIX, 10.
28 1. Tim. IV,14
ZWEITES KAPITEL
Die Gewalten des Priestertums
er hl. Chrysostomus fasst alle Gewalten eines Priesters in diesen zwei zusammen: nämlich in der Konsekration des Allerheiligsten Altarssakramentes und der Lossprechung von der Sünde, oder wie wir theologisch uns ausdrücken, in der Jurisdiktion über den natürlichen und über den mystischen Leib Christi. Das Wort Jurisdiktion hat hier eine besondere Bedeutung. Gewöhnlich bezeichnet es die Autorität kraft welcher ein Priester seine ihm anvertraute Herde regiert durch die richterliche Gewalt des Bindens und Lösens von der Sklaverei der Sünde. Inwiefern können wir also von Jurisdiktion über das Allerheiligste Altarssakrament sprechen? Jurisdiktion bedeutet, die in der Ordination erhaltene priesterliche Gewalt; aber deren Ausübung ist suspendiert, bis der Priester die Erlaubnis erhält, diese seine priesterlichen Gewalten auszuüben. Diese Jurisdiktion erhält er von seinem Bischof, und sein Bischof vom Stellvertreter Jesu Christi, der allein die Fülle der Jurisdiktion über die ganze Kirche besitzt. Der erste und höchste Akt dieser Jurisdiktion besteht in der Konsekration und Darbringung des Allerheiligsten Altarssakramentes. Daraus entspringt der Ausdruck Jurisdictio in corpus verum, welche Worte dessen ungeachtet mannigfache Bedeutung haben.
1. Erstlich stellen sie uns die Demut unseres göttlichen Meisters vor. Die Menschwerdung war eine Erniedrigung, die viele Stufen hatte. Er vernichtete sich selbst, indem er seine Glorie verschleierte; er nahm die Gestalt eines Dieners an; er ward Mensch: er erniedrigte sich selbst; und das bis zum Tod; um in Schande zu sterben. Wir haben hier sechs Grade von Verdemütigung. Und als genügten diese nicht, verewigt er noch seine Verdemütigung in der hl. Eucharistie und legt sich in die Hände seiner Geschöpfe und wird täglich auf ihr Wort herabgerufen,29 um auf dem Altar gegenwärtig zu sein; wird von ihnen in die Höhe gehoben, hin und her getragen, und endlich wird er vom Würdigen sowohl wie vom Unwürdigen empfangen. In dieser göttlichen Weise unterwirft er sich der Jurisdiktion der Priester jetzt, wie er in den Tagen seines irdischen Lebens dem Gesetz unterworfen war und denen, welche mit Autorität bekleidet waren, selbst dem Kaiphas und Pilatus. Demut ist die Wurzel alles Gehorsams, und Geduld ist die Vollendung des Gehorsams. Die Darbringung seiner selbst ist ein fortgesetzter Gehorsam, seinen Priestern zum Gesetz und Beweggrund.
2. Zweitens schließt diese Jurisdiktionsgewalt die göttliche Verwaltung ein, welche dem Priester über seine Herde anvertraut ist. Die Kirche wendet auf den hl. Joseph, den Nährvater des göttlichen Kindes, die Worte des Hl. Geistes an: „Wer seinen Feigenbaum hütet, der isst von seinen Früchten: und wer auf seinen Herrn Acht hat, gelangt zu Ehren." 30 Der Hüter des Allerheiligsten Altarssakramentes ist der Priester. Ihm ist der Schlüssel des Tabernakels anvertraut. Von ihm kann man sagen, wie von seinem Herrn und Meister gesagt wurde, dass „er öffnet und niemand schließt, er schließt und niemand öffnet." 31 Der Priester ist im wahrsten Sinne des Wortes der Bewahrer seines Herrn, und größerer Ruhm kann ihm nicht zu teil werden; ein innigeres, vertrauteres und andauernderes Verhältnis kann man sich nicht denken.
Und diese Verwaltung ist zu gleicher Zeit eine Gewalt, das Brot des Lebens auszuteilen. Die Jünger haben es den Fünftausend in der Wüste gegeben. „Sie waren Diener Christi und Ausspender der Geheimnisse Gottes."32 Und darin waren sie der Schatten und das Vorbild der göttlichen Wirklichkeit der hl. Kommunion, deren Ausspender wir sind.
3. Drittens, zeigt diese Jurisdiktion die dem Priestertum eigene Gewalt. Die Worte, welche wir sprechen, sind nicht die unsrigen, sondern die seinigen; keine menschlichen Worte, sondern göttliche. Die Worte „Dieses ist mein Leib" haben nicht ihres Gleichen, ausgenommen die Worte: „Es werde Licht." Diese haben das Licht geschaffen. Die anderen schaffen nicht, sondern sie rufen das menschgewordene Wort auf den Altar herab. Sie erheben das Brot und den Wein von der natürlichen zur übernatürlichen Ordnung. Dies ist keine schöpferische, aber eine allmächtige Gewalt. Das Brot und der Wein sind den Bedingungen oder den Gesetzen der Natur unterworfen, nicht mehr in ihrem Wesen, sondern in ihren wahrnehmbaren Erscheinungsformen. Eine göttliche Veränderung geht mit ihnen vor; und dennoch keine natürliche Veränderung; denn sie verschwinden in ihrem Wesen und bleiben dennoch in ihren wahrnehmbaren Erscheinungen. Eine derartige Veränderung gibt es nicht in der Ordnung der Natur; denn dort bleibt entweder das ganze natürliche Wesen mit seinen Erscheinungsformen, oder beides verschwindet zugleich. Hier aber bleiben die wahrnehmbaren Erscheinungsformen, als ob sie der natürlichen Ordnung angehörten, während das Wesen in die übernatürliche Ordnung der neuen Schöpfung übergeht. Die Worte „Es werde Licht" hatten ihren Effekt in der ersten Schöpfung der Natur; die Worte „Dieses ist mein Leib" haben ihre Wirkung auf die erste Schöpfung und in der zweiten, zugleich in der alten und in der neuen. Sie nehmen den ersten Rang ein nach den Worten: „Der Hl. Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, welches aus dir geboren werden soll, Sohn Gottes genannt werden."33 Aus diesem Grunde sind Konsekration und Inkarnation miteinander verwandt.
Nach der Menschwerdung gibt es keinen Akt so erhaben, so rein göttlich, als die Konsekration und das hl. Opfer. Es ist die Fortsetzung der Inkarnation und die Aufopferung des fleischgewordenen Sohnes. Die Stimme, welche die Worte ausspricht, ist menschlich; die Worte aber und ihre Wirkung find die des allmächtigen Gottes.
4. Viertens drückt diese Jurisdiktion die innigste Verwandtschaft zwischen dem Priester und dem Sohne Gottes aus. Es könnte scheinen, dass nach der Teilnahme an seinem Priestertum, nach der Ausnahme seines Charakters und der Verähnlichung des Priesters mit seinem göttlichen Meister, keine weitere Verwandtschaft mehr denkbar ist. Und dennoch bleiben uns noch zwei zu behandeln übrig, nämlich: erstens der immerwährende, tägliche Umgang des Jüngers mit seinem Meister und des Dieners mit seinem Herrn. Er ist Diener, Freund und Genosse. Wie Petrus, Jakobus und Johannes von allen Jüngern dem Heiland am nächsten auf Erden waren, so sind es jetzt die Priester unter allen Gläubigen. Sie sind ihm beständig nahe, ihr ganzes Leben ist mit ihm verbunden. Von ihm gehen sie aus am Morgen, und zu ihm kehren sie am Abend zurück.
Dann kommt das Verhältnis einer wahren, wesentlichen und lebendigen Berührung in dem hl. Messopfer ebenso wahrhaft, wie dasjenige des hI. Johannes, als er beim letzten Abendmahl an seinem Busen lag, oder als der Herr dem Petrus die Füße wusch. Wenn wir das Allerheiligste Altarssakrament in unseren Händen halten, so sind wir in Berührung mit Gott, mit dem Menschgewordenen Gott, dem Schöpfer, dem Erlöser und dem Heiligmacher. Viel wahrhafter, als die Erde unter unseren Füßen, die doch vergehen wird, ist die Gegenwart des menschgewordenen Gottes, welcher nicht vergehen wird. Wir stehen mit seinem Wesen in steter Berührung. „Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm." Wir sind aber auch mit dem Wesen seines Leibes verbunden, und wir sind Glieder desselben, kraft einer wirklichen und wesentlichen Teilnahme. Der hl. Paulus sagt, wir seien „Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein“,34 und er fordert uns auf. „Gott in unserem Leibe zu tragen." 35 Diese Berührung und Vereinigung sind das ewige Leben. Würden, während wir das Allerheiligste Sakrament in unseren Händen halten, unsere Augen geöffnet, wie die des Kleophas zu Emmaus, so würden wir erkennen, dass es über diese sakramentale und wesentliche Berührung hinaus nichts Innigeres gibt, als die Vereinigung mit ihm im Lichte der Herrlichkeit.
Solcher Art sind also die Gründe, welche die Gottesgelehrten der Kirche erleuchteten, um zu erkennen, dass man sich kein höheres Amt, keine größere Gewalt denken könne, als das Amt und die Gewalt eines Priesters. In der Ordnung der göttlichen Handlungen setzt es den Priester, was die Konsekrationsgewalt anbelangt, nach der Mutter Gottes, dem lebendigen Tabernakel des menschgewordenen Gottes, zuhöchst; und was die Verwaltung oder Hüterschaft des Allerheiligsten Sakramentes anbelangt, steht er zunächst dem hl. Joseph, dem Nährvater und Vormunde des Sohnes Gottes. Was kann dem Priester Höheres mitgeteilt werden? Welche Verpflichtung zur Vollkommenheit kann größer sein, als die, welche entspringt einer solchen Gewalt, einem solchen Amt, einer solch lebendigen Berührung des menschgewordenen Wortes? Der hl. Johannes Chrysostomus sagt, die Hand, welche konsekriert, soll reiner sein, als das Sonnenlicht. Und wenn das von der Hand gilt, was sollen dann die Augen sein, welche die göttliche Gegenwart betrachten, welche wohl vor unseren Augen verschleiert, aber kaum verborgen ist; was dann unsere Lippen, welche sagen: „Dieses ist mein Leib," und unsere Ohren, die unsere eigene Stimme hören, wenn wir diese Worte einer neuen Schöpfung Gottes aussprechen? Und wenn der Leib so geheiligt werden muss, was soll dann die Heiligkeit der Seele des Priesters sein: in seinem Verstande mit all seinen Fähigkeiten, seinem Gedächtnis und seiner Einbildungskraft; in seinem Herzen mit allen seinen Affekten und Wünschen; in seinem Gewissen mit all seiner Unterscheidungskraft und seiner Oberherrschaft; in seinem Willen mit all seinen festen Entschlüssen und seiner beständigen Herrschaft über das äußere und innere Leben?
Sicherlich ist daher das Priestertum durch seine Natur, seine Erfordernisse und seine Verpflichtungen eine wesentliche Regel und der höchste Stand der Vollkommenheit, von unserem göttlichen Heiland selbst eingesetzt.
Dieses aber ist noch nicht alles. Der Priester hat auch Jurisdiktion über den mystischen Leib Christi, d. h. über die Seelen derjenigen, welche wiedergeboren sind aus dem Wasser und dem Hl. Geiste. Der hl. Paulus sagt: „Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die zu Grunde gehen: dem einen nämlich ein Geruch des Todes zum Tode, dem andern ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist dazu tauglich?"36 Das heißt, wer wird nicht fürchten? Was kann es Furchtbareres geben, als mit dem priesterlichen Amt betraut, zwischen den Lebendigen und den Toten zu stehen, um über die uns anvertrauten Seelen Rechenschaft zu geben? Die Väter nennen es ein Amt, welches die Engel zu tragen fürchten müssten. König zu sein über ein Volk, oder Anführer eines Heeres, dessen irdisches Leben auf dem Spiel steht, ist furchtbar. Um wieviel furchtbarer ist ein Vorrecht, das ewige Folgen mit sich bringt. Welche Heiligkeit, welche Nächstenliebe, welche Demut, welche Geduld, welche Weisheit, welche Festigkeit und welche Gerechtigkeit genügen dazu? Wenn das Verhältnis, in welchem der Priester zu seinem göttlichen Heiland im Hl. Messopfer steht, geistige Vollkommenheit erfordert, dann erfordert gewiss auch das Verhältnis als Lehrer, Führer und Richter der Menschen dasselbe. Der Priester ist gesetzt, exercere perfectionem, - d. h. die wahrnehmbare Vollkommenheit in sich selbst zu üben, und um die Seelen der Menschen nach demselben Gesetze und Gleichnisse zu bilden. Er muss darum vor allem selbst vollkommen sein.
Die Titel, durch welche dieses Verhältnis angedeutet ist, sind mannigfach und erklären dessen vielfache Verpflichtungen. Selbst im Alten Bunde wurden die vorbildlichen Priester als „Fischer" 37 und „Jäger" 38 und „Hirten"39 bezeichnet. Im Neuen Bunde aber werden sie Menschen-Fischer40 und Hirten 41 der Herde genannt. Aber sie sind mehr, denn dieses.
Sie sind Verwalter, welche über den Haushalt gesetzt sind, jedem Menschen Fleisch zu geben zur rechten Zeit - d. h. den Haushalt Gottes zu leiten und zu regieren.
Sie sind Gesandtes42 Gottes, welche darum die Vollmacht haben, in seinem Namen zu unterhandeln und zu beschließen. Sie haben die Beglaubigung einer göttlichen Gesandtschaft, mit der ausdrücklichen Bedingung, die Menschen aufzufordern, sich mit Gott zu versöhnen, und haben die Vollmacht, zu richten und zu entscheiden, welche, und welche nicht in die Grenzen und Bedingungen ihrer Vollmacht fallen.
Sie sind Mitarbeiter Gottes43 aus dem Felde der Welt und in dem Weinberge der Kirche. Sie sind „Pflüger"44 und „Säer"45 und „Schnitter"46. Des Priesters Amt ist es, den Brachacker der Nationen aufzubrechen und die Wurzeln des Unglaubens,47 welche den Pflug hindern, auszurotten. „Siehe, ich mache dich wie zu einem neuen Dreschwagen, der scharfe Zacken hat; du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel wie zu Staub machen: Du wirst sie worfeln, dass sie der Wind verweht.“48 Sie find die Säer, die den Samen des Wortes auf alles Land und auf alle Wasser säen.49 Sie sind Schnitter, welche weinend inmitten einer unfruchtbaren, sterbenden Welt einhergehen, welche eines Tages mit Jubel kommen und ihre Garben tragen.50 Aber alle diese Benennungen, obschon sehr ausdrucksvoll, sind nur geistig und bildlich zu verstehen.
Priester sind auch Mitbauer Gottes am Baue der Kirche und dem Tempel des Hl. Geistes, aus dem einen, alleinigen Fundament, welches Christus, der Baumeister, gelegt hat. Sie sind Vater all derjenigen, welche wiedergeboren sind aus dem Wasser und dem Hl. Geiste; aber in einer besonderen Weise, und in einer vertrauteren und ewigen Verwandtschaft sind sie die Väter derjenigen, welche sie getauft haben. Der hl. Paulus schreibt an die Korinther: „Wenn ihr zehntausend Lehrmeister hättet in Christo, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich euch durch das Evangelium gezeugt."51 Diese Benennung ist die einfachste und begreiflichste für alle, für Alt und Jung, Gelehrt und Ungelehrt. Das Verhältnis des Vaters zu seinem Kinde ist allgemein in der Naturordnung, und es wird ein geistiger Instinkt in der Gnadenordnung. Der Titel „Vater" ist der erste, der oberste, der höchste, der mächtigste, der überzeugendste, der ehrendste unter allen Titeln eines Priesters. Mag er von der Welt und ihren Ehrenquellen viele Benennungen erhalten, von den gelehrten Schulen viele Grade, von dem Kirchenrechte viele Würden, keine hat eine so tiefe und so hohe Bedeutung, als die Benennung „Vater" und keine, außer der geistigen Vaterschaft, wird in die Ewigkeit übergehen. Die Welt hat den Titel „Vater" mit ihrer eigenen reichen Schmeichelei überhäuft, und Priester haben zugestimmt, dieses Titels sich berauben und mit anderen sich benennen zu lassen. Mit dem Titel wurde das Bewusstsein der väterlichen oder kindlichen Verwandtschaft zuerst verdunkelt, bis es vergessen wurde, und dann endlich verloren ging. Das engste Band gegenseitiger Innigkeit und Liebe zwischen dem Priester und dem Gläubigen wurde dadurch gelockert und Entfernung und Misstrauen trat an die Stelle.
Die Priester sind auch Richter der Menschen. Die Juden verboten jedem Manne, der nicht „Vater" war, Richter zu werden; denn Gerechtigkeit muss mit Milde gepaart sein. Aber der geistige Richter hat größere Milde nötig, als der weltliche. Er bedarf der Milde Gottes, nach welchem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird. Ein Richter muss gerecht sein und Gerechtigkeit schließt Milde ein. Der hl. Gregorius der Große in der Erklärung der himmlischen Hierarchie sagt, die „Throne" seien die Gerechten, in welchen Gott bleibt und regiert, wie auf dem Sitze feiner Oberherrschaft. Unser göttlicher Meister sagte: „Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiederkunft, wenn der Menschensohn auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen, und die zwölf Stämme Israels richten."52 Dieses wurde den Aposteln gesagt und den Bischöfen, welche jetzt ihnen im geistigen Richteramt der Welt nachfolgen. Jeder Bischof auf seinem Thron, umgeben von seinen Priestern, richterlich die Seelen der Menschen mittels der Schlüsselgewalt bindend oder lösend, ist der Schiedsrichter, der das Gericht des letzten Tages abwendet.
Endlich sind sie Ärzte. Die Priester des Alten Gesetzes waren belehrt, zu unterscheiden zwischen Aussatz und Aussatz. Die Priester des Neuen Bundes sollen unterscheiden zwischen Sünde und Sünde. Und für dieses Amt find vor allem zwei Dinge nötig — Wissenschaft und Nächstenliebe; Kenntnis Gottes, Kenntnis der Heiligen und Kenntnis seiner selbst; und Nächstenliebe, welche, obschon sie das gebeugte Rohr nicht brechen will, oder den glimmenden Docht nicht auslöschen will, dennoch nie ruhig sein wird, so lange es eine tödliche Krankheit gibt, oder lässliche Sünden in Todsünden übergehen, und die Seele in Todesgefahr bringen können. Wohl kann darum der hI. Paulus fragen, „wer ist diesen Dingen gewachsen"? In so naher Beziehung zu dem menschgewordenen Worte zu stehen; über die Seelen gesetzt zu sein, für welche der Sohn Gottes sein kostbares Blut vergossen hat; mit ihrer Rettung betraut zu sein, und zwar so, dass, im Falle wir untreu sind, deren Seelen von unseren Händen gefordert werden; all dieses verlangt gewiss im Priester eine persönliche Heiligkeit, angemessen der Ausgabe, die Seelen von der Sünde zur Buße, und von der Buße zur Vollkommenheit zu führen. Wie können die führen, welche selbst den Pfad nie gewandelt sind? Einige Theologen sagen uns, kein Mann könne Vollkommenheit pflegen, d. h. andere sie lehren, der nicht selbst vollkommen sei. Der Unvollkommenheiten der Vollkommenen selbst sind viele, wie der beste Priester besser weiß, als irgendein Mensch. Aber desungeachtet, um in anderen die Vollkommenheit zu pflegen, muss der Priester selbst im Stande der Vollkommenheit sein, und stände er auch nur an der Grenzlinie. Aber kein Priester sollte sich mit einem so wenig großmütigen und freigebigen Herzen begnügen. Der Hl. Paulus war nicht so gesinnt, als er sagte: „Brüder, ich bilde mir nicht ein, es ergriffen zu haben: Aber eines (tue ich), ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt: dem vorgesteckten Ziele eile ich zu, dem Preise der von oben erhaltenen Berufung Gottes in Christo Jesu."53
29 „Obediente Domino voci hominis.“ Josue X, 14.
30 Prov. XXVII, 18.
31 Apoc. III, 7.
32 1. Kor. IV, 1
33 Lk. I, 35
34 Eph. V, 30
35 1 Kor. VI, 20
36 2. Kor. II, 15. 16.
37 Jerem. XVI, 16.
38 Ibid.
39 Ez. XXXIV, 23
40 Mk. I, 17.
41 1. Petr. V, 2.4.
42 2. Kor. V, 20
43 1. Kor. III. 9
44 Ibid. IX. 10
45 Mk. IV, 14
46 Joh. IV, 38.
47 Hebr. XII, 15,
48 Isai. XLI, 15, 16.
49 Ibid. XXXII, 20.
50 Ps. CXXV, 5-7.
51 1. Kor. IV, 15
52 Mt. XIX, 28.
53 Phil. III, 13, 14.
DRITTES KAPITEL
Das dreifache Verhältnis des Priestertums
in Priester steht in drei Verhältnissen, von welchen ein jedes ihn zu innerer geistiger Vollkommenheit verpflichtet.
1. Das erste Verhältnis verbindet ihn mit dem großen Hohenpriester, an dessen Priesterschaft er teilnimmt. Er ist unsere Quelle der Heiligkeit; aber er ist auch unser bindendes Gesetz. Denen, welche sich ihm im Alten Bunde näherten, sagte Gott, Sancti estote, quia ego sanctus sum.54 Die unerschaffene Heiligkeit Gottes erfordert Heiligkeit in allen, die sich ihm nähern. Vom brennenden Dornbusch aus in Horeb befahl Gott dem Moses, die Schuhe von seinen Füßen zu losen; denn der Ort, worauf er stand, war heiliges Land.55 Ein unheiliger Mann, der der Priesterwürde nachstrebt, sucht den ewigen Tod. denn „wer mag wohnen bei den ewigen Gluten"56 Die Heiligkeit, die Reinheit, die Eifersucht, die Gerechtigkeit Gottes sind wie die Flammen eines Feuerofens, in welchem die Reinen noch mehr gereinigt, die Unreinen aber verzehrt werden; denn „Gott ist ein zehrendes Feuer"57 Nur die, welche dem Hohenpriester ihrer Erlösung nachgebildet sind, und durch einen aufrichtigen Willen suchen, vollkommen geheiligt zu werden an Leib, Seele und Geist, können vor ihm stehen. Auf sie übt seine Heiligkeit eine Verähnlichungskraft aus, welche das Werk vervollkommnet, das er in ihnen begann, als er sie berufen hat. Als Isaias den Herrn der Heerscharen in seiner Glorie sah, war er sich nur seiner Unreinheit vor ihm bewusst. Aber einer der Seraphim flog mit einer glühenden Kohle vom Altar und berührte seine Lippen, und seine Sünde war entfernt.58 Je näher die Reinen Gott kommen, desto mehr werden sie gereinigt. Von der Zunahme der Heiligkeit in der Seele seiner unbefleckten Mutter während ihres irdischen Lebens in Vereinigung mit ihrem göttlichen Sohne, sowohl vor, als nach seiner Himmelfahrt, wollen wir nicht sprechen; denn sie war außergewöhnlich in allen Dingen, da sie ohne Sünde war und über alle Seraphim geheiligt. Aber wir können über die Heiligkeit des hl. Johannes und des hl. Petrus, nach ihrer Berufung von unserem göttlichen Erlöser unsere Erwägung anstellen. Die bewusste Unwürdigkeit des hl. Petrus bewog ihn auszurufen: „O! Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr."59





























