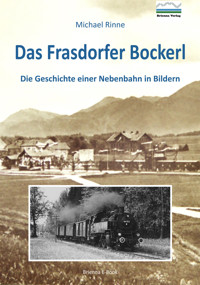
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Brienna Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Bahnstrecke Rosenheim – Frasdorf wurde nach fast 40 Jahren Planung und Diskussionen um das »Für und Wider« und die Trassenführung am 7. Mai 1914 eröffnet. Sie zweigt kurz nach der Brücke über den Inn in Landl von der Hauptstrecke nach Salzburg ab und verläuft über Thansau, Rohrdorf und Achenmühle bis Frasdorf. Mit dem Bau der Autobahn in den frühen 1930er Jahren und der zunehmenden Massenmotorisierung nach dem Krieg verlor die Strecke allmählich an Bedeutung für die Menschen und die Wirtschaft an der 19 km langen Bahnlinie. Bereits 1970 kam das schnelle »Aus« für den Abschnitt zwischen Rohrdorf und Frasdorf. Die Reststrecke rettete allein der enorme Transportbedarf des Rohrdorfer Zementwerks, der Personenverkehr wurde aber vollkommen eingestellt. Michael Rinne zeichnet die wechselvolle Geschichte dieser Nebenstrecke von den Anfängen bis in die heutige Zeit nach und dokumentiert das Geschehen mit über Jahre hinweg mit Leidenschaft und großer Ausdauer gesammeltem Material. Dazu stöberte er in Archiven, er fand und sprach mit Zeitzeugen, schrieb deren Erinnerungen nieder, er sammelte Dokumente und weit mehr als 300 – teilweise hier erstmals veröffentlichte – Bilder. Dieses Buch ist ein »Muß« für Eisenbahnliebhaber und Technikinteressierte im allgemeinen und besonders für Freunde der Heimatgeschichte im Chiemgau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Michael Rinne
Das Frasdorfer Bockerl
Die Geschichte einer Nebenbahn in Bildern
Brienna E-Book
Michael Rinne
Das Frasdorfer Bockerl
Die Geschichte einer Nebenbahn in Bildern
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.deabrufbar.
Bibliographical information of the Deutsche Nationalbibliothek:The German National Library lists
this publication in the Deutsche Nationalbibliothek;
Detailed bibliographic data is available on the Internet at https://dnb.dnb.de
Michael Rinne
Das Frasdorfer Bockerl
Die Geschichte einer Nebenbahn in Bildern
E-Book (E-PUB-Format)
ISBN 978-3-942318-40-2
Copyright © Brienna Verlag Thomas Clement, 2024
Speckbacher Leiten 24,
D-83101 Achenmühle
www.brienna.de
Der Brienna Verlag verwendet die deutsche Rechtschreibung, wie sie vor 1998 üblich und verbindlich war. Für dieses Buch haben wir ausführlich und so genau wie möglich recherchiert, können aber für den Inhalt keinerlei Haftung über-nehmen. Sollte dieses Werk Verweise (Links) auf Webseiten Dritter enthalten, so machen wir uns die Inhalte nicht zu eigen und übernehmen für die Inhalte keine Verantwortung. Für den Fall, daß sich jemand in seinen Urheberrechten an Texten oder Bildern verletzt sehen sollte, bitten wir um schriftliche Kontaktaufnahme zur Klärung der Sachlage.
Der erste regelmäßig verkehrende Zug auf der neuen Strecke Rosenheim – Prien mit sechs neuen Wagenwurde mit einer Dampflokomotive der Gattung bayerische D XI von Krauss oder Maffei (damals noch nicht zu Krauss-Maffei fusioniert) mit ca. 310 PS bespannt. Die maximale Höchstgeschwindigkeit betrug auf gerader Strecke 45 km/Std. Von diesen einstmals zwischen 1895 bis 1914 meistgebauten Lokal-bahn-Loktypen, die später bei der Deutschen Reichsbahn unter der Gattung 984-5 betrieben wurden, ist leider nach der Ausmusterung zwischen 1931 und 1960 keine einzige Fahrfähige mehr vorhanden. Das letzte Exemplar mit der Nummer 98 507 steht seit 1968 als Denkmal vor dem Bahnhof Ingolstadt.
Seite 3: Der „Wies’n-Express“ im September 2022 im Rohrdorfer Zementwerk. Bild: Thomas Clement.
Seite 5: Lok 98 507 am Bahnhof Ingolstadt. Bild: Michael Rinne. Seite 5:Wahrscheinlich der VT 95 9327 nach 1960, bereit zur Abfahrt aus Frasdorf in Richtung Rosenheim. Bild: GA Frasdorf, Josef Gasbichler
Ein leider notwendiger Begleittext des Verlags:
Im Januar 2023 lernten Michael Rinne und ich uns über unser gemeinsames Interesse an der Geschichte der Nebenbahn Rosenheim – Frasdorf kennen. Damals hatte er ein Buchprojekt darüber praktisch schon fertig im Kopf, war jedoch noch mit keinem Verlag zusammengekommen. Mir war lange nicht bewußt, daß für ihn die Zeit drängte... Im Oktober schickte er mir sein gesamtes, sehr gut aufbereitetes Material, und wir hatten bis Dezem-ber nur noch wenig Zeit, Einzelheiten zu besprechen. Bitte sehen Sie es, nach daß vielleicht nicht alles im Buch perfekt stimmt, da ich als Verleger, Textlektor und Gestalter nicht mehr alles mit dem Autor klären konnte. Ins-besondere beim überreichen Bildmaterial war vieles schwer nachvollziehbar. Das Buch auf jeden Fall erscheinen zu lassen, war ein dringender Wunsch von Michael. Thomas Clement, Brienna Verlag
Über den Autor:
Michael Rinne(Jahrgang 1961) absolvierte nach dem Abitur (Gymnasium
Miesbach) und dem Wehrdienst (Lenggries) zunächst eine Zimmererlehre.
Außerdem studierte er an der FH München Bauingenieurwesen mit Schwer-punkt Baubetrieb. Nach einigen Jahren als angestellter Bauleiter machte er sich mit einem eigenen Ingenieurbüro in Frasdorf (Kreis Rosenheim)selb-ständig. Sein Interesse an der Eisenbahn im allgemeinen und an historischen Eisenbahnthemen im besonderen entwickelte sich schon früh: Spätestens seit er 1995 nach Frasdorf gezogen war, begeisterte er sich für die Geschichte der Nebenstrecke Rosenheim – Frasdorf. Über Jahre hinweg trug er in seiner Freizeit mit Leidenschaft und großer Ausdauer die Fakten zusammen. Dazu stöberte er in Archiven, er fand und sprach mit Zeitzeugen, schrieb deren Erinnerungen nieder, er sammelte Dokumente und Bilder. Das Ergebnis der akribischen Recherche faßte er in einem Exposé zum vorlie-genden Buch „Das Frasdorfer Bockerl“ zusammen. Der Leser erhält einen umfassenden, sehr leben-digen und authentischen Eindruck von der Geschichte dieser Nebenbahn. Das Buch erscheint im Mai 2024 – zum 110jährigen „Bockerl“-Jubiläum. Michael Rinne konnte die Veröffentlichung leider nicht mehr erleben, er verstarb im Dezember 2023 nach schwerer Krankheit.
Inhalt
Dank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Die Anfänge der Eisenbahn. . . . . . . . . . . . . 10
Die Entstehungsgeschichte der Strecke. . . . . . 12
Die Einweihung der Strecke. . . . . . . . . . . . . 25
Die Strecke und Stationen. . . . . . . . . . . . . . 37
Der Betrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Niedergang und Teileinstellung. . . . . . . . . . 121
Spurensuche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Literaturverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . 158
8
9
Dank
Das Reizvolle am Hobby „Eisenbahn“ ist die Tatsache, daß es sich nicht im spielerischen „Kreisfah-ren“ von Modellzügen auf „Teppichbahnen“ erschöpfen muß, sondern sich von der historischen Recherche von ehemaligen Bahnverbindungen, der alten und neuen Technik in Original und Modell über das Beobachten, Nachempfinden und Modellieren von Bahnhöfen, Ort- und Landschaften und Szenerien erstrecken kann.
Die Recherche von historischem Kontext ist aber nicht einfach, zumal für ortsfremde „Zuagroaste“ (Zugezogene) wie mich. Da ist man dann auf die Hilfe von „Doigen“ (Hiesigen) angewiesen, die sich entweder noch selber erinnern können, oder Zugriff haben auf Bilder, alte Planunterlagen und Kontak-te zu Dritten, die gegebenenfalls noch Bildmaterial auf ihren Dachböden schlummern haben.
Da ich selber unmittelbar neben dem früheren Lokschuppen in Frasdorf logiere, hat im Mai 2014 eine kleine Ausstellung dort zum 100jährigen Jubiläum der Bahneröffnung mein Interesse an der ver-gangenen Lokalbahn geweckt. Neben zahlreichen Bildern aus der „Topothek“ Frasdorf hat mir zunächst Herr Günter Gebauer als Sammler von Postkarten geholfen. Er hat 2014 einen Vortrag über die Bahn gehalten. Über ihn kam auch der Kontakt zu seinem ehemaligen Schulkameraden und jetzigen Archivar und Heimatpfleger Herrn Rupert Wörndl zustande, der mir vorbehaltlos das Gemeindearchiv in Fras-dorf geöffnet hat. Neben weiteren Bildern kamen interessante Zeitungsausschnitte und Gebäudeplä-ne zutage. Weil wegen der Fülle des aufgefundenen Materials der Wunsch nach Mehr hinsichtlich der gesamten Bahn aufkam, war aufgrund der guten Erfahrung der Schritt zur Nachbargemeinde Rohrdorf naheliegend. Hier war es auch und vor allem der Gemeindearchivar, Herr Hermann Silichner, der – un-erschöpflich und unendlich geduldig – mir immer mehr Material ausgegraben hat. Neben weiteren Bildern, und dem Kontakt zu Herrn Werner Graxenberger, Sohn des ehemaligen Stationsvorstehers Stephan Graxenberger in Frasdorf in den 1950er Jahren, und Zeitungsartikeln hat er mir handschriftli-che Gemeindeprotokolle auf Band gelesen. Auch die Memoiren von Herrn Hans Kurfer jun., Sohn des gleichnamigen ehemaligen Bahnhofsvorstehers in Rohrdorf in den 1940er Jahren, habe ich von ihm erhalten. Dessen Witwe, Frau Gisela Kurfer, hat dankenswerterweise spontan der Veröffentlichung zu-gestimmt. Weiterer Dank gebührt Frau Marie-Luise Voggenauer, die mir Bilder und Erinnerungen über den Abbruch des Kioskes und Neubau des „Spritzenhäusls“ in Frasdorf zur Verfügung gestellt hat. Von Alexander Schauer aus Achenmühle stammen drei Original-Fahrkarten vom letzten Fahrtag des „Boc-kerls“ am 26. September 1970. Besonders danken möchte ich auch Frau Julia Hübsch vom Zementwerk in Rohrdorf, Herrn D. Fischbacher vom mefo-Metallbau in Rohrdorf und Herrn Julian Richter von Fa. Richter Spielgeräte GmbH in Frasdorf.
Was die Bilder betrifft, danke ich stellvertretend für alle Eigentümer, die mir Material freigegeben haben, namentlich Herrn Karl Mair aus Stephanskirchen und Frau Elfriede Mohr, Witwe von Herrn Peter Mohr, sowie Herrn Siegfried Bufe und Herrn Andreas Knipping für die Freigabe von Bildern aus
10
ihren Büchern. Etliche sehr interessante Bilder habe ich zudem von Frau Jutta Strigl in Achenmühle er-halten. Auch der „Streckengeher“, Herr Frank Zimmermann, hat mir spontan ein Bild aus seiner Samm-lung im Original übersandt. Weitere Ansichtskarten hat mir Herr Uli Volner zur Verfügung gestellt. Von Herrn Josef Haselsberger, Rangierer in Rohrdorf, habe ich interessante Einblicke in die laufenden Wa-renanlieferungen für das Zementwerk in Rohrdorf erhalten.
Besonderer Dank gebührt auch meinem Verleger, Herrn Thomas Clement, für die umfassende Über-arbeitung und Formatierungen meiner Textentwürfe.
Ohne diese vorbehaltslosen Hilfen hätte dieses Büchlein nie entstehen können.
Die Anfänge der Eisenbahn
Die Geschichte der für den öffentlichen Raum freigegebenen Eisenbahn in Deutschland begann am 7. Dezember 1835 mit der Eröffnung der Eisenbahn Nürnberg – Fürth. Sehr schnell erkannte man den Wert des neuen Verkehrsmittels für den wirtschaftlichen Aufschwung. Die fest an einen vorgege-benen Fahrweg gebundenen Eisenbahnen erschlossen zunächst einmal als Linienverkehrsmittel wich-tige Ballungs- und Industriezentren. Die große Fläche der meist landwirtschaftlich genutzten Gebiete mit vielen Kleinstädten lag abseits der Schienenstränge. Hier blieben zumeist Fuhrwerke die einzigen Verkehrsträger. In einigen Regionen wurden diese durch einen bescheidenen Schiffsverkehr ergänzt.
So klagt etwa Pfarrer Josef Dürnegger in seiner Chronik „Rohrdorf einst und jetzt“ 1913:
„…Die Wege, auch die neuangelegten Straßen, waren bodenlos. Das Gewicht, das man auf einem Wagen verladen konnte, war kaum so groß, als früher ein Samer mit seinen 6 Pferden beförderte. Noch 1794 konnten von 9 Rohrdorfer Fuhrwerken auf der Hauptstraße von Salz-burg über Teisendorf, Traunstein und Seebruck nach Rohrdorf nur 141 Zentner Pflastersteine befördert werden.“
Dies sollte sich aber bis zum Ende der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts ändern. Bereits 1840 gab es in Deutschland rund 500 Kilometer Eisenbahnstrecken. Bald entfielen die innerdeutschen Zollgren-zen, und die zunehmende Industrieproduktion beendete allmählich die deutsche Kleinstaaterei. Man erkannte, daß ohne weiteren Ausbau des Eisenbahnwesens eine bedeutende Entwicklung in den Län-dern kaum möglich war.
In der Regel wurden die Bahnen durch private Aktiengesellschaften gebaut und betrieben. Den-noch behielten sich die einzelnen Staaten Eingriffe in die Privatunternehmen vor, etwa bei der Lini-enführung, Tarif- und Fahrplangestaltung. Der ständige Güterwagenaustausch und die durchgängige
Die Anfänge der Eisenbahn
11
Abwicklung von Reisezügen erforderten Vereinheitlichungen technischer Normen, rollendem Material, Bahnanlagen und Sicherungstechnik, wie auch Regeln für die durchgängige Abfertigung von Personen und Gütern. Der am 7. Dezember 1847 gegründete „Verein Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen“ gab Ende Februar 1850 die „Grundzüge für die Gestaltung der Eisenbahnen Deutschlands“ und die „Ein-heitlichen Vorschriften für den durchgehenden Verkehr auf den bestehenden Vereinsbahnen“ heraus.
Trotz der Bemühungen des ersten deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck, die großen Pri-vatbahn-Gesellschaften schnellstmöglich in ein einheitlich geleitetes Staatsbahnsystem umzuwandeln, gelang erst zu Beginn der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts eine Übernahme der einzelnen großen Ei-senbahngesellschaften auf Länderebene.
Am 22. Dezember 1871 wurde für alle Bahnen Deutschlands das erste einheitliche Betriebsregle-ment erlassen, am 27. Juni 1873 entstand das Reichseisenbahnamt. Es sollte das in der Reichsverfas-sung festgelegte Aufsichtsrecht über die deutschen Eisenbahnen wahrnehmen. Unter seiner Obhut kamen am 4. Januar 1875 eine einheitliche Signalordnung und ab 20. Dezember 1875 das Reichspost-gesetz dazu, das exakt die Aufgaben der Eisenbahn bei der Beförderung von Postsachen regelte.
Nach nun weitestgehend erfolgter Erstellung des Eisenbahngrundnetzes (heute „Hauptbahnen“) als Verbindungen zwischen den Metropolen drängten nun auch die wenig besiedelten Gebiete auf Anschluß an das Schienennetz. Wegen des geringeren Verkehrsaufkommens waren aus finanziellen Gründen Erweiterungen mit den hohen Anforderungen an den bisherigen Bahnbau nicht zu rechtfer-tigen. So entstanden erste Überlegungen zu vereinfacht ausgeführten Eisenbahnen. Um abgelegene Regionen anbinden und das Streckennetz kostengünstig durch Verteiler- und Zubringerstrecken in die Städte verdichten zu können, wurden gesetzliche Grundlagen für vereinfachte Ausführungen geschaf-fen, verbunden mit Regelungen, die einen geringeren Personalaufwand ermöglichen sollten. Als Ergeb-nis wurden von der technischen Kommission des „Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen“ (VDEV) „Grundzüge für die Gestaltung der sekundären Eisenbahnen“ erarbeitet, am 26. Mai 1876 in Konstanz während einer Technikerversammlung zur Diskussion gestellt und mit wenigen Änderungen am 31. Juli 1876 in München der Generalversammlung des VDEV vorgestellt und von dieser befürwortet. In Folge entstanden die Bahnpolizei- und Signalvorschriften für den Sekundärbahnbetrieb, am 1. Juli 1878 trat die „Bahnordnung für die Bahnen untergeordneter Bedeutung“ als Gesetz mit einigen wichtigen Er-leichterungen für den Bahnbau und Streckenbetrieb in Kraft.
Das Königreich Bayern erließ bereits am 29. April 1869 ein entsprechendes Gesetz über den Bau und Betrieb von Vizinalbahnen* – später mit einigen der Festlegungen der Ordnung von 1878. In Bay-ern und Sachsen setzte man anstelle von Privatbahnen wie in Preußen und Mecklenburg auf Staats-bahnbau.
*Als Vizinalbahn wurden Eisenbahnen zur Erschließung des ländlichen Raums bezeichnet. Der Name leitet sich ab vom lateinischen Wort vicinus(„benachbart, nahe“).
12
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
Bereits 1876 unternahm ein „Eisenbahnkomitee Rosenheim“ mit Bürgermeister Josef Haimmerer und Pfarrer Taubenberger einen Anlauf, eine Eisenbahnverbindung von Rosenheim nach Aschau zu bauen, um die Gegend mit vielen Sägewerken, Ziegeleien und Steinbrüchen an Stelle der teuren Trans-porte durch Fuhrwerke für den Verkehr zu erschließen. Erste Überlegungen schwankten zwischen den Linien Bernau – Aschau, Prien – Aschau und Rosenheim – Aschau. Stark befürwortet wurde vor allem Letztere, da sie mehr Gemeinden einband und damit einer ganzen Reihe von Betrieben kostengünsti-gere Transporte ermöglicht hätte.
Die Trasse sollte, bei Landl von der Hauptbahnlinie Rosenheim nach Salzburg abzweigend, über Holzen und Immelberg nach Lauterbach führen. Die Strecke hätte über die Ortschaften Heiglmühle, Sonnleiten, Gugggenbichl, Hofmühle, Achenmühle und Daxa nach Frasdorf führen sollen, wo ein Bahn-hof vorgesehen war. Von dort sollte sie nach Aschau weiterführen. Für die etwa 20,5 km lange Strec-ke sollten die Kosten einschließlich des rollenden Materials, also der Lokomotiven und Wagen, rund 3 Millionen Mark betragen. Davon sollten rund 940.000 Mark von privater Seite aufgebracht werden. Für die Bauzeit wurden zwei Jahre angenommen. Wegen des hohen Kostenaufwandes und den zudem erforderlichen Umbauten am Rosenheimer Bahnhof scheiterte das Vorhaben jedoch an einer Ableh-nung der Bayerischen Staatsregierung. Mit dem Bau der im Jahre 1878 eröffneten Vizinalbahn von Pri-en nach Aschau, die insbesondere durch Baron von Cramer-Klett vorangetrieben und gefördert wurde, war dieser Plan hinfällig.
Planstand 1906 (wie 1914 ausgeführt): gelbe Trasse Rosenheim – Frasdorf, grüne Trasse Prien – Aschau.
Quelle (ohne Colorierung): Deutsche Bundesbahn Oberbetriebsleitung West, Kursbuch Sommer 1959
13
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
Einen erneuten Anlauf gab es erst 20 Jahre spä-ter mit Neugründung eines Eisenbahnkomitees im Jahre 1896. Auch dieser sah die Planung einer Trassierung abzweigend von der Hauptlinie bei Ste-phanskirchen in Richtung Süden vor, jedoch mit verkürzter Länge von Rosenheim nach Frasdorf. Al-ternativ wurde sogar eine private Finanzierung er-wogen. Auch sollte durch den Abzweig bei Landl der im ersten Entwurf vorgesehenen Bau einer zweiten Brücke über den Inn entfallen und so erhebliche Ko-sten sparen. Die Unterstützung scheiterte am Widerstand einiger einflußreicher Industrieller, die sich durch die zur Diskussion stehende Streckenführung nicht an das Schienennetz angebunden sahen, und so wurde auch aus Kostengründen die Planung für einen Bau über Privatfinanzierung aufgegeben. Da-her wandte sich das Komitee an die Staatsregierung mit der Bitte, die Lokalbahn Rosenheim – Frasdorf in das staatliche Bauprogramm aufzunehmen. Jedoch waren andere Bahnprojekte zunächst dringli-cher, erst am 26. Juni 1908 fand das Projekt Aufnahme in ein Lokalbahngesetz.
Erst 1906 wurden die Pläne wieder aufgegriffen, doch nun regte sich wegen Konkurrenzängsten zur unweit bestehenden Strecke Prien – Aschau plötzlich Widerspruch von Priener Seite. Insbesondere die Priener Geschäftsleute befürchteten einen Verlust von Kunden, wenn es eine konkurrierende Bahn von Frasdorf nach Rosenheim gäbe. Am 10. April 1906 berichtete der Rosenheimer Anzeigerüber eine öf-fentliche Versammlung im Saal des Gasthauses „Bayerischer Hof“:
„Rosenheim, 9. April. (Lokalbahn Rosenheim – Frasdorf) In Prien fand gestern eine öffentli-che Versammlung statt, welche sich hauptsächlich mit der Frage der Erbauung der Lokalbahn Rosenheim – Frasdorf befaßte. Zu dieser Versammlung waren auch viele Interessenten vom Fuße des Samerberges, von Frasdorf und vom Eisenbahn Komitee Rosenheim erschienen. Diese gaben eingehende Aufklärung über den Stand der Lokalbahnangelegenheit und erklär-ten bestimmt, daß nach Lage der Sache ein Abweichen von dem bestehenden Projekte ein Ding der Unmöglichkeit sei; es wurde auch besonders betont, daß die Weiterführung der geplanten Lokalbahn über Frasdorf hinaus nach Aschau weder vom Eisenbahn Komitee noch von einer anderen Vereinigung angestrebt worden sei. Zum Schluße bildete sich aus den Reihen der Priener Bürgerschaft ein Komitee von 9 Herren mit der Aufgabe, in weitere Unterhandlungen mit dem Rosenheimer Komitee einzutreten, eventuell Gegenvorschläge zu machen oder einen Anschluß von Prien nach Frasdorf anzustreben, sowie anderweitige gemeindliche Projekte aufzugreifen und zu unterstützen.“
Auch die Chiemgau=Zeitungberichtete in ihrer Ausgabe vom 10. April ausführlich. Sie bezifferte die Zahl der Besucher der Versammlung auf „an 300 Männer“ und benannte die Herren Dr. Paul Wein-hardt, Apothekenbesitzer, als zum 1. Vorsitzenden und J. B. Haas, Kaufmann, als zum 2. Vorsitzenden Gewählte.
14
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
In der Folge entspann sich ein erbitterter Disput, der auch in den Zeitungen in seltenem Ausmaß öffentlich geführt wurde. Unter anderem versuchte Dr. Weinhardt im Mai 1906 die Abgeordneten des Landtages zu beeinflussen, um den Bahnbau nach Frasdorf zu verhindern, was jedoch mit Schreiben vom 22. August 1906 abgelehnt wurde.
Am 17. Oktober 1907 veröffentlichte die Chiemgau=Zeitungeinen Artikel, der den geplanten Ver-lauf aus wirtschaftlichen Gründen anzweifelte und eine weitere Variante vorschlug.
„Um nicht wieder eine abscheuliche Sackbahn zu bauen, müßte die neue Lokalbahn begin-nen im Bahnhofe zu Umrathshausen (oder Aschau). Von da an müßte sie geführt werden nach Frasdorf, dann an der Gebirgskette entlang nach Grainbach, von da mitten durch den Samer-berg nach Mühlthal und Nußdorf (,) von da nach Neubeuern, wo sie sich dann in einem Bogen Rohrdorf nähert und mit einer Ueberführung über den Inn in Raubling in die Staatsbahn (Ro-senheim –Kufstein) einläuft. Da auf der ganzen Strecke bedeutende Steigungen zu überwinden sind, liegt der Gedanke nahe, die Bahn durch elektrische Kraft betreiben zu lassen, zumal die Wasserkraft des Inns bis jetzt noch unbenutzt ist.“
Das hier skizzierte Ergebnis wäre somit eine parallel des Voralpenkammes verlaufende, landschaft-lich reizvolle Trassierung, welche auch eine kurze Verbindung zwischen Traunstein und Kufstein in Tirol ermöglicht hätte. Hinter diesem Vorschlag ist wohl der Törwanger Koadjutor Michael Mayer als Sohn eines gebürtigen Prieners zu vermuten, der, vorliegenden Unterlagen nach, insbesondere im Novem-ber 1906 mehrfach Schriftwechsel mit Dr. Weinhardt hatte.
Am 22. Oktober 1907 erschien in der Lokalausgabe „Wendelstein“ des Rosenheimer TagblattWi-derspruch:
„ … Ein neues Projekt sollte aber schon aus Gründen der Nachbarlichkeit nicht in Gegnerschaft mit einem alten, der endlichen Ausführung nahen Unternehmen, sondern selbständig und ne-benher laufend behandelt werden. …“
Hinter diesem Beitrag steckte mit großer Wahrscheinlichkeit das „Rosenheimer Eisenbahn-Komi-tee“, welches die Interessen der Stadt Rosenheim und der an der alten Trassierungsvariante liegenden Gemeinden vertrat.
Es wären hierfür aber aufwendige Kunstbauten erforderlich geworden. So hätte die Verbindung zwischen Raubling und Neubeuern den Bau einer neuen Innbrücke erforderlich gemacht, da die beste-hende hölzerne Brücke nicht ausreichend Tragkraft gehabt hätte. Außerdem hätten im Steinbach- und Achental mindestens zwei Viadukte erstellt werden müssen, sowie ein großes Elektrizitätswerk am Inn oder einem der Bergbäche. Die Strecke wäre um fast zehn Kilometer länger und rund eine Million teu-rer geworden. Die Mehrkosten hätten sich nicht rentiert, zumal der Wertzuwachs im Wesentlichen nur aus Holztransporten resultiert hätte. Diese Variante wurde mit Schreiben vom 2. November 1907 des K. Staatsministeriums für Verkehrsangelegenheiten und vom 5. November 1907 des „Vereins zur För-derung des Fremdenverkehrs in München und im bayer. Hochland (e.V.)“ abgelehnt.
15
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
Trotz weit in das Jahr 1908 reichenden Störaktionen mit beinahe täglichen Disputen in den Tages-zeitungen wurde am 26. Juni 1908 per Gesetz der Lokalbahnbau Landl – Frasdorf genehmigt. Noch im Juni 1908 fand in Rohrdorf eine Festveranstaltung statt. Der Wirt und Posthalter Andreas Stocker hielt eine Festrede, in der die Freude zum Ausdruck kam, letztendlich doch das Ziel erreicht zu haben: „Auch haben wir unserem Fest den Namen Siegesfeier gegeben; wissen wir doch alle, daß in letzter Zeit noch gewaltige Kampfeswogen an uns herangebraust sind und daß uns noch von gewissen Herren die Palme streitig gemacht wurde, doch die Pforten der Hölle, die hat uns nicht überwältigt, der Sieg ist vollständig unser.“ (Rosenheimer Anzeigervom 12. Juni 1908; Sdt AR.)
Diese harschen Worte verdeutlichen, wie groß der Zwiespalt zwischen Rohrdorf und Neubeuern in der Frage der Trassenführung der neuen Eisenbahn war. Sahen die Rohrdorfer den Eisenbahnan-schluß als dringend ersehnte Alternative für ihre unter Stein- und Ziegeltransporten leidenden, oh-nehin schlechten Straßenverbindungen, erhofften sich die Neubeurer von einem Bahnanschluß eine weitere Entwicklung des beginnenden Fremdenverkehrs. Für sie als die „feinen Leute“ waren die Rohr-dorfer „nur“ Bauern, Steinbrüchler, Lehm- und Torfstecher und -lieferanten. Dies gipfelten u.a. in Thea-terstücken und Gedichten wie:
„Und ob wir unsern Zug beladenmit Holz, Torf, Steinen oder Schafenist mehr rentabel als da drenten (drüben)in Neubeuern mit den Fremden.“
Postkarte von Unbekannt an „das Bahnhintertreibungs Comité Prien, Amtssitz in der Apotheke“, 20. Mai 1906
16
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
Dazu noch einmal ausführlich der Rosenheimer AnzeigerNr. 129 vom 5. Juni 1908:
„Rohrdorf, 3. Juni. Wer sich am Abend des 1. Juni der Ortschaft Rohrdorf näherte, der hätte wohl meinen können, es sei der Belagerungszustand darüber verhängt worden. Tatsächlich war denn auch auf einer Wiese außerhalb des Dorfes eine ansehnliche Kanone postiert, bedient von der „Bürgerwehr“, die wohl während zirka 3 Stunden unabläßig bemüht war, dem Feind den nötigen Respekt einzuflößen. Mit wahrem „Feuereifer“ donnerte man bald nach Westen, bald nach Osten; dazwischen hinein mischten sich die weithin tönenden Schüsse in den Steinbrü-chen Rohrdorfs, und abends verkündeten Bergfeuer, daß schon etwas ganz Besonderes heute die ganze Gegend zu einer solch feierlichen Kundgebung veranlaßte. Traf ja doch gegen 5 Uhr nachmittags die telephonische Nachricht ein, daß endlich – nach jahrelangem Bangen Ringen, Kämpfen und Hoffen – die Lokalbahn Rosenheim – über Rohrdorf nach Frasdorf im Landtage einstimmig genehmigt wurde. Eine förmliche „Siegesfeier“ also war sofort nach Eintreffen die-ser Nachricht durch 3 kräftige Kanonenschüsse eingeleitet und der ganzen Gemeinde verkündet worden. Allmählich kam die Nacht: die Kanoniere stellten ihre Tätigkeit ein; man zog ins Dorf und versammelte sich im Stoderschen Garten, zumal man sich ja auch das Wetter an diesem Abend nicht schöner hätte wünschen können. Eine eigentlich gemeindliche Feier begann nun in dem dicht besetzten Garten. Herr Bürgermeister Urscher ergriff das Wort zu einer längeren Rede und gab seiner Freude über das Gelingen des seit langem angestrebten Werkes, wie auch seinem Danke beredten Ausdruck. – (schon bald nach Eintreffen der Telephonnachricht wurden 3 Dankestelegramme abgesandt an Se. Exzellenz den Herrn Verkehrsminister v. Frauenhofer, an die Landtagsabgeordneten Dr. von Daller und Ruedorffer; ferner beschloß der zu einer au-ßerordentlichen Sitzung noch am selben Abend zusammengerufene Gemeindeausschuß, an die beiden Herren Abgeordneten unseres Wahlkreises noch eine Dankadresse absenden zu wollen.) – Sein Dank galt allen, die in hervorragender Weise sich um das Zustandekommen unserer Lokalbahn bemüht und verdient gemacht haben und gedachte er außer den 3 Vorgenannten auch noch des Herrn Oberinspekt. Mayer von Rosenheim, dann des derzeitigen Herrn Bezirksamt-manns königlichen Baur, ferner aber auch des unermüdlichen Vorsitzenden vom Eisenbahn-komitee, Herrn Finsterwalder und endlich allen jenen, welche durch erhebliche Zuschüsse und Freigabe der Grundstücke das Werk wesentlich förderten. Schließlich gab er der Hoffnung Aus-druck: Es möchte die Bahn aber auch bald in Angriff genommen werden und die Bahn selbst für die ganze Gemeinde Nutzen bringen. – Im weiteren Verlaufe des Festes dankte sodann Herr Lehrer Stühler namens des anwesenden Gemeindeausschusses, dann Herrn Bürgermeister Urscher für dessen jahrelange, aufopfernde Tätigkeit als Vertreter der Gemeinde Rohrdorf im Eisenbahnkomitee, wie auch dem Herrn Gastwirt Stocker als Vertreter der hiesigen Eisen-bahn-Interessenten. Redner hob hervor, daß heutzutage wohl jeder Ort bemüht ist, so weit wie möglich sich die Wohltaten und Segnungen des Verkehrswesens nutzbar zu machen. Telephon, Post und Eisenbahn sind es, was man anstrebt, doch kostet’s Mühe und Geduld. Die Gemeinde Rohrdorf ist nun so glücklich, dieses letzte Ziel endlich erreicht zu haben. Groß ist darum auch die Freude heute bei uns, wie nicht minder überall im ganzen weiten Bayerlande, wohin die Kun-
17
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
de von der Genehmigung einer der vielen neuen Lokalbahnen gedrungen ist. Noch ist das Werk ja nicht abgeschlossen. Möchte Herr Bürgermeister auch noch alles das, was die Zukunft noch an Mühen und Arbeiten betreffs unserer Bahn mit sich bringen wird, in Geduld auf sich neh-men und das ganze auch der Vollendung entgegenführen helfen, die uns, wie wir hoffen wollen, in nicht all zu ferner Zeit bestimmt sein möge zum Nutzen und Segen unserer Gemeinde, wie der ganzen Umgegend.“
Diesem Artikel vorgelagert in der gleichen Ausgabe:
„Lokalbahn Rosenheim – Frasdorf.
Herr Baron von Crailseim auf Amerang, der Vorsitzende des Eisenbahnkomitees „Endorf – Obing“ übermittelt dem „Rosenheimer Anzeiger“ die herzlichen, freundnachbarschaftlichen Glückwünsche des Obinger Komitees zur Genehmigung der so lange Jahre angestrebten Lo-kalbahn „Rosenheim – Frasdorf“ in der Abgeordnetenkammer, indem anliegend Nachfolgendes weiter ausgeführt ist: Die außerordentlich freudig erregten Gefühle, von denen die ganze Bevöl-kerung im Verkehrsgebiet des Samerberges ergriffen ist, legen das beste Zeugnis dafür ab, daß die Rosenheim–Frasdorf-Bahn ein wirkliches Bedürfnis ist, und daß die, längs des Samer-berges, bis hinab nach Rosenheim lebenden Gemeindebürger wohl zu würdigen wissen, welche außerordentlich hohen Förderungen ein Schienenstrang im wirtschaftlichen Leben zu gewähr-leisten vermag! Mit bewegtem Herzen gedenken wir der aufopfernden Tätigkeit des langjährigen Vorkämpfers für die nun in der nächstkommenden Zeit verwirklichte Idee, nach Rosenheim zwei neue Eisenbahnlinien zu führen – die eine aus dem Samerbergerverkehrsgebiet, die andere aus dem westlichen Chiemgau – des nie rastenden, nun in Gott ruhenden kgl. Oberinspektors Mayr. – Die Stadtgemeinde Rosenheim hat mit der Schmückung der letzten Ruhestätte dieses rast-losen Vorkämpfers Eduard Mayr einen feinsinnigen Akt edler Dankbarkeit manifestiert. Aber speziell auch der werktätigen und weitblickenden Fürsorge des rechtskundigen Bürgermeisters Herrn Hofrat Wüst und der löblichen Gemeindeverwaltung von Rosenheim, verdanken diese beiden neuen Eisenbahnlinien „Endorf–Obing“ und „Rosenheim–Frasdorf“ einen guten Teil ihres Zustandekommens nicht minder dem Vorstand des Rosenheimer Bezirksamtes, Herrn Regierungsrat Baur, welcher ausgezeichnete Beamte in seltener Berufsfreudigkeit, seine ganze Energie in den Dienst dieser beiden Verkehrswege, dem Gemeinwohl zulieb, gestellt hat. Daß in der Volksvertretung unser alter Vater Daller und die ehrenwerten Landtagsabgeordneten Ru-edorffer und Eisenmann, wie uns persönlich wohl bekannt ist, kraftvoll für diese wichtige Eisen-bahnerrungenschaft eingetreten sind, ist in die Herzen aller beteiligten Interessenten bleibend eingegraben! Ohne Kampf kein Sieg – dies Wort ist vielleicht nirgendwo besser als in Eisen-bahnfragen anwendbar. – Wer das nur halbwegs weiß, mit welchen, manchmal gar nicht mehr überwindbar scheinenden Hindernissen, Gegenagitationen und persönlichen Angriffen derjenige zu kämpfen hat, der es auf sich nimmt, eine neue Eisenbahntrace ins Leben zu rufen, den wird es gewiß mit Genugtuung erfüllen, wenn er, nach dem jung errungenen Sieg, Böllersalven krachen hört und auf den Bergeshöhen Freudenfeuer aufblitzen sieht.
18
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
Die Eröffnung der Lokalbahn „Endorf–Obing“ wird, gemäß bindender Zusage der kgl. Ver-kehrsstelle, am 1. Oktober stattfinden; hoffen wir alle, daß auch mit dem Bahnbau nach Frasdorf nunmehr in großer Bälde begonnen werde!
Beide neuen Bahnen werden der Bevölkerung der Verkehrsgebiete wirtschaftlich große Vor-teile, der wackeren Stadt Rosenheim neuen Zugang, allen jenen Männern aber, welche mutig und unentwegt, nur das Ziel im Auge, den endgültigen Sieg errungen zu haben, ein bleibendes Angedenken sichern.“
Fast zwei Jahre später konnte man im Rosenheimer AnzeigerNr. 67 vom 24. März 1910 lesen:
Lokalbahn Rosenheim–Frasdorf. er. Rohrdorf, 23. März
Die von der Firma Sager u. Wörner-München entsendeten Ingenieure – darunter der Vor-stand der Messungssektion, Herr Rieker, und 2 Söhne der Firma – mit 7 Hilfsarbeitern sind, wie bereits kurz erwähnt, seit ca. 6 Wochen eifrig an der Ausarbeitung einer Detailaufnahme, d. i. endgültigen Aufnahme für die Ausführung des Bahnbaues, tätig und sieht man längs der Straße von Rosenheim nahe Rohrdorf die Markierungspflöcke. Diese geben die von der K. Eisenbahn-direktion gedachte Linienführung an und stehen ungefähr in der Mitte eines 60 – 80 Meter brei-ten, profilierten Terrainstreifens. Die Pläne werden dann der K. Eisenbahndirektion übergeben, die eventuelle Aenderung innerhalb dieses Terrainstreifens vornehmen kann.
Erfreulich ist es für die hiesige Gegend, daß die Vorarbeiten zum längst ersehnten Bahnbau endlich einmal in Angriff genommen wurden, und ist es namentlich der Initiative unseres Herrn k. Regierungsrates Baur zu danken, daß die Sache so viel gefördert ist. Nicht minder haben die beiden Interessengemeinden Rohrdorf und Frasdorf, Stadtmagistrat Rosenheim, die Distrikt-gemeinden Rosenheim und Prien, sowie die Privatinteressenten treulich mitgewirkt, zur För-derung der Angelegenheit, indem in kurzer Zeit die Zuschüsse zu den Grunderwerbungskosten zu insgesamt 109 630 Rk. an das K. Bezirksamt einbezahlt und der Eisenbahndirektionskasse München abgeliefert wurden. Möge ihre Opferwilligkeit auch baldigst entlohnt werden, nach-dem nunmehr die finanzielle Frage erledigt ist und hoffentlich auch die Vorarbeiten bald zu Ende geführt werden, noch dazu, da den Vertretern der Gemeinden Rohrdorf und Frasdorf von maß-gebender Stelle seinerzeit die Versicherung gegeben wurde, daß dem Bahnbau sonst kein Hin-dernis mehr entgegenstehe.
In der Gemeinde Höhenmoos, zu der damals die „Einöde Achenmühl“ gehörte (heute Gemeinde Rohr-dorf), wurde gemäß Gemeinderatsprotokollen vom 12. Juni und 15. August 1912 die Forderung nach Umbenennung der Station Achenmühl in Höhenmoos befürwortet mit dem Beschluß, um eine Ände-rung unter Berufung auf entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse am 27. Juni 1906 und 1907 beim Kgl. Bezirksamt Rosenheim zu ersuchen. Dies geschah mit Gemeindebeschluß am 10. Dezember 1912 mit Schreiben an die Generaldirektion der Kgl. Bayer. Staatseisenbahnen mit Verweis auf andere Strecken wie etwa Grafing, wo auch die gleichnamige Station nicht am Ort, sondern bei der abgelegenen Ort-
19
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
schaft Nettelkofen läge (heute Grafing Bahnhof) „…und erst nach halbstündiger Wanderung an der Ortschaft Gindelkofen vorbei, kommt man in eine Ortschaft Grafing“. Auch wiesen die Fahrpläne und Kursbücher und der Lageplan, welche die künftige Bahn Rosenheim – Frasdorf vermerken, als Stations-namen „Höhenmoos“ aus. In einem weiteren Protokoll vom 27. Juli 1913 wird im Zusammenhang mit der Finanzierung von Zufuhr- und Ladestraßen durch die Erhebung eines Bieraufschlages wieder vom Bahnhof Achenmühle gesprochen.
Die Bauarbeiten konnten erst Ende 1911 mit der Erstellung von Erd- und Kunstbauten begonnen wer-den. Es mußten 148.000 m3 Erdmassen bewegt werden, was ca. 8,1 m3 pro Meter Betriebslänge ent-spricht. 1912 wurden ein erstes Betriebshaupt-, Dienstwohn- und Nebengebäude in Landl errichtet. Die ursprüngliche Bausumme des ersten Loses der Lokalbahn war mit 330.708 Mark ermittelt worden. Die Summe wurde im Februar 1912 um 33.400 auf 364.108 Mark korrigiert, um aus wirtschaftlichen Gründen die „Ausschaltbarkeit der Zwischenblockstrecke Landl“ zu ermöglichen, da auf diese Weise Personal eingespart werden konnte. Ab 1913 entstanden die anderen Hochbauten an der Strecke. Der Jahres-bericht der Königlichen Bayerischen Staatseisenbahnen wies für die Frasdorfer Lokalbahn Investi-tionen in Höhe von 407.790,71 Mark aus.
Die Anlage der Abzweigung für die Lokalbahn nach Frasdorf erforderte in Landl umfangreiche Erdarbeiten für die Bewältigung der großen Höhendifferenz. Karl Mair, 1913
20
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
In einem Gesuch an das Königlich Bayerische Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiten ba-ten die betroffenen Gemeindeverwaltungen am 27. August 1913 um Inbetriebnahme des Strecken-abschnittes bis zum Haltepunkt Samerberg, da der Bahnbau insgesamt durch das unkooperative Ver-halten eines Grundbesitzers dort verzögert wurde. Zu diesem Zeitpunkt lag der Bahnkörper bereits bis Samerberg und die Gleise konnten bis Rohrdorf befahren werden. Das Ministerium lehnte jedoch den Antrag wegen zu hoher Kosten für einen provisorischen Betrieb ab.
Wie das Problem „gelöst“ wurde, schreibt Hans Riedler in „Rohrdorf/Obb. Eine Ortsgeschichte“ Band 1:
„…Sogleich nach der Genehmigung des Vorhabens wurde mit den Verhandlungen über die not-wendigen Grundabtretungen begonnen, da ergaben sich so manche Schwierigkeiten. Besonders widerborstig zeigte sich der Heiglmüller im Achental; fauchte doch die Bahn direkt an seinem Haus vorbei. Von der Rohrdorfer-, wie von der Frasdorfer Seite her waren die Gleise, ausgenom-men sein Grundstück, verlegt, doch er wehrte sich gegen die Schließung der Gleislücke und zog sich damit den Unwillen der Verantwortlichen sowie der Bauarbeiter zu. Es gab eingeschlagene Fenster in seinem Haus und andere Unbillen. Das Gleisreststück wurde aber doch gebaut! Einer unserer Bürger, damals noch ein Schulkind in Höhenmoos, gab folgende Schilderung:
„Da san so fufz’g Arbeiter von Achenmühl loszog’n, mit Schubkarrn und Schaufel und Pickel, begleitet von einer Musi…
21
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
… und los is ganga, a paar Tag drauf is de Bahn gforn …“ – Links im Bild Polizist Tretter
Damit lagen 1913 die Gleise, die Kunstbauten (z. B. Brücken) sowie die Stations- und Neben-gebäude waren errichtet. Im Jahr 1914 wurden noch ausstehende Erd-, Fels- und Böschungs-, sowie Restarbeiten an den Bahnhöfen erledigt. Die Herstellung der Zufuhr- und Ladestraßen erfolgte durch die jeweiligen Gemeinden.
Gruppenbild an der Baustelle. Vier Bilder Jutta Strigl, Achenmühle
22
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
Neben den fast 3,5 Millionen Mark, die der Staat für Baukosten aufbrachte, steuerten die Stadt Ro-senheim 26.000 Mark, der Distrikt (Kreis) Rosenheim und Prien je 15.000 Mark bzw. 10.000 Mark, die Gemeinden Rohrdorf und Frasdorf je 10.000 Mark bei. Dies war bereits im Jahr 1899 festgelegt wor-den, ebenso weitere 75.000 Mark für die Grundstücksabtretungen.
Die Bauausführung erfolgte durch das Bauunternehmen Sager & Woerner, wobei alle Arbeiten weit-gehend noch von Hand erledigt wurden.
Eine Besonderheit bildete die Planung und der Bau des Industriegleises für den Ziegeleibesitzer Se-bastian Tiefenthaler. Er hatte am 31. Januar 1911 einen handgeschriebenen Antrag an die Königliche Eisenbahnbetriebsdirektion München gestellt:
„Erlaube mir an die Kgl. Eisenbahndirektion München ergebenst den Antrag zu stellen für den An-schluß meines Industriegleises einen Entwurf auszufertigen damit selber betreffs Genehmigung an das Kgl. Bezirksamt Rosenheim, wegen Straßenüberkreuzung, eingereicht werden kann.“
Darüber hinaus bat Tiefenthaler darum, die Kosten für das Anschlußgleis zu ermitteln, wofür auch ein Schuppen beseitigt werden mußte. Die dafür erforderliche Genehmigung bereitete dem Antrag-
Arbeiter bei Gleisbauarbeiten mit einem auf Schienen fahrbarem Dampf-Kran, der Biertransport erfolgte mittels zweispännigem Hundefuhrwerk. Bild: Quelle unbekannt, Besitzer Gemeindearchiv Frasdorf.
23
Die Entstehungsgeschichte der Strecke
steller einige Schwierigkeiten, da der Anschluß die parallel verlaufende Distriktstraße überqueren mußte. Aus Sicht des Königlichen Bezirksamtes würde der Gleisanschluß die verbesserten Steigungs-verhältnisse auf der neu ausgebauten Distriktstraße wieder zunichte machen. Die Pläne wurden zu-nächst abgelehnt. Die Hartnäckigkeit Tiefenthalers war schlußendlich doch erfolgreich. Er konnte die Vertreter des Bezirksamtes am Ende von seinem Vorhaben überzeugen. Im Juli 1913 schlossen Tie-fenthaler und die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen einen Vertrag über den Bau und die Benut-zung des Industriegleises ab.
Die Anschlußgleise für die Pulverfabrik Thansau und die Ziegelei Tiefenthaler wurden im Jahre 1914 gelegt, das Gleis zum Zementwerk erst viel später in den Kriegsjahren 1940/41.
Der erste Zug bei Einfahrt in das Zementwerk Rohrdorf. (Quelle: https://www.rohrdorfer.eu/unternehmen/)





























