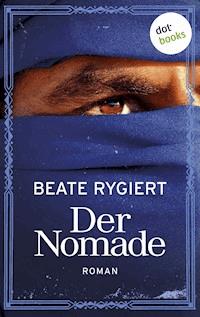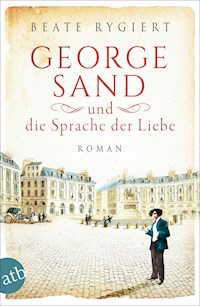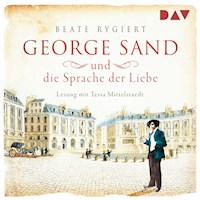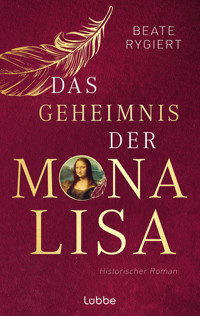
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Florenz, 1494: Lisa Gherardini und Giuliano aus der mächtigen Dynastie der Medici sind heimlich ein Liebespaar. Als die Medici aus der Stadt vertrieben werden, zwingt Lisas Vater die junge Frau zur Heirat mit dem viel älteren Seidenhändler Francesco del Giocondo. Doch ihr Herz hängt an ihrem Geliebten.
Venedig, 1495: Leonardo da Vinci ist der berühmteste Künstler seiner Zeit. Als Giuliano de' Medici ihn bittet, Lisa zu porträtieren, um seiner Geliebten auf diese Weise Nachrichten zukommen zu lassen, geht Leonardo auf das riskante Spiel ein. Dadurch gerät Lisa nicht nur in eine gefährliche Verschwörung - auch ihr Herz wird auf eine schwere Probe gestellt.
Das mitreißende Schicksal der Frau mit dem geheimnisvollen Lächeln
Bestsellerautorin Beate Rygiert entfaltet vor einem farbenprächtigen historischen Panorama die spannende Geschichte des berühmtesten Gemäldes der Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 824
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumZitat1 – DIE FLUCHT2 – DAS PFERD3 – DER SEIDENHÄNDLER4 – DER AUFTRAG5 – DIE ENTTÄUSCHUNG6 – DIE RÜCKKEHR7 – DAS PORTRÄT8 – NÄCHTLICHE SCHATTEN9 – DER DAMENZIRKEL10 – DER ZWEITE KANZLER11 – DAS VERHÖR12 – DER RIVALE13 – DAS TREFFEN14 – DER TRAUM VOM FLIEGEN15 – DIE HEIMKEHREPILOGNACHWORTÜber dieses Buch
Florenz, 1494: Lisa Gherardini und Giuliano aus der mächtigen Dynastie der Medici sind heimlich ein Liebespaar. Als die Medici aus der Stadt vertrieben werden, zwingt Lisas Vater die junge Frau zur Heirat mit dem viel älteren Seidenhändler Francesco del Giocondo. Doch ihr Herz hängt an ihrem Geliebten.
Venedig, 1495: Leonardo da Vinci ist der berühmteste Künstler seiner Zeit. Als Giuliano de’ Medici ihn bittet, Lisa zu porträtieren, um seiner Geliebten auf diese Weise Nachrichten zukommen zu lassen, geht Leonardo auf das riskante Spiel ein. Dadurch gerät Lisa nicht nur in eine gefährliche Verschwörung – auch ihr Herz wird auf eine schwere Probe gestellt.
Das mitreißende Schicksal der Frau mit dem geheimnisvollen Lächeln
Bestsellerautorin Beate Rygiert entfaltet vor einem farbenprächtigen historischen Panorama die spannende Geschichte des berühmtesten Gemäldes der Welt
Über die Autorin
Beate Rygiert wurde in Tübingen geboren und wuchs im Nordschwarzwald auf. Mit zwölf schrieb sie in ihr Tagebuch: »Eigentlich möchte ich Schriftstellerin werden!« Diesen Traum verwirklichte sie nach dem Studium der Musik- und Theaterwissenschaft und der italienischen Literatur in München und Florenz und nach einigen Jahren als Operndramaturgin an verschiedenen deutschen Bühnen. Ihre Romane erobern die Bestsellerlisten und werden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Heute lebt sie mit ihrem Mann im Schwarzwald, in Andalusien und immer wieder in Frankreich.
BEATE RYGIERT
Historischer Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2023 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Textredaktion: Marion Labonte, Labontext
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
unter Verwendung von Motiven von
© Alamy Stock Foto: IanDagnall Computing und © FinePic®, München
Copyright Kapitelillustration: © FinePic®, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4812-4
luebbe.de
lesejury.de
Wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid.
Leonardo da Vinci
1DIE FLUCHT
Florenz, 1494
Der graue Novemberhimmel lastete schwer über Florenz. Feiner Regen sprühte Lisa ins Gesicht, als sie durch die Gassen des Viertels Santa Croce hastete. Sie zog die Kapuze des groben Wollmantels so tief wie möglich in die Stirn, um nicht erkannt zu werden. Vom Gerberviertel am Ufer des Arnos wehte der beißende Gestank nach frischer Tierhaut und Alaun herüber, aus dem Gewirr der Gassen erklang Geschrei und das rasselnde Geräusch von aufeinandertreffenden Degen.
»Nieder mit den Medici!«
»Palle! Palle!«, antworteten andere mit deren Schlachtruf.
»Am Arsch kannst du sie haben, deine Palle«, brüllte jemand zurück. Dann klirrten ganz in ihrer Nähe blanke Klingen.
Lisa Gherardini begann zu laufen und wäre um ein Haar auf den feuchten Steinplatten ausgeglitten. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Aufruhr lag in der Luft, seit Piero de’ Medici am Tag zuvor von seinen Verhandlungen aus dem Feldlager des französischen Königs bei Sarzanello zurückgekehrt war. Lisas Vater Antonmaria Gherardini, der als Mitglied im »Rat der Hundert« am Morgen Pieros Bericht im Palazzo della Signoria mit angehört hatte, war außer sich vor Wut nach Hause gekommen. Am Mittagstisch hatte er von Verrat an den eigenen Leuten gesprochen und sich darüber empört, wie fahrlässig der Sohn und Nachfolger von Lorenzo, den alle nur »den Prächtigen« nannten, die Sicherheit der Republik aufs Spiel setzte.
»Was für ein Stümper«, hatte er sich aufgeregt. »Dümmer hätte er sich gar nicht anstellen können. Den richtigen Zeitpunkt zum Verhandeln hat er verstreichen lassen. Und dann muss er es im letzten Moment mit der Angst zu tun bekommen haben. Herrgott, stellt euch vor, er hat den Franzosen Pisa, Livorno und Sarzana in den Rachen geworfen! Und 200.000 Goldflorin noch obendrein. Dabei wird Charles VIII. Florenz keineswegs verschonen, oh nein. Was waren wir für Narren, diesem Bengel unsere Geschicke anzuvertrauen!«
»Er ist eben noch jung«, hatte Lucrezia, Lisas Mutter, sanft eingewandt.
»Sein Vater war noch jünger, als er die Macht übernahm«, hatte Antonmaria zornig zurückgegeben. »Aber Lorenzo hat seine Söhne verzogen. Feste! Turniere! Ballspiele! Pah!«
Lisa hätte gerne widersprochen. Was ihr Vater über Piero sagte, mochte stimmen. Sein jüngster Bruder Giuliano war jedoch aus vollkommen anderem Holz. Giuliano de’ Medici war nicht nur der schönste junge Mann in ganz Florenz, sondern auch klug und besonnen. Und er hatte ein gutes Herz. »Diese Sippe hat lange genug über uns bestimmt«, hatte ihr Vater schließlich gesagt. »Es wird Zeit, dass wir uns wieder auf unser republikanisches Erbe besinnen.«
Und dann hatte Betta, ihre Amme, ihr nach dem Essen diesen Zettel von Giuliano zugesteckt. Wir müssen fliehen, stand darauf. Komm so schnell du kannst zur Gartenpforte. Ich liebe dich. Nun war sie auf dem Weg dorthin.
Das Portal des Hauses, an dem sie soeben vorbeieilte, wurde aufgerissen. Vier Männer stürmten heraus. Rasch wich Lisa in eine Toreinfahrt zurück und ließ die Burschen vorüberziehen. Alle waren mit Knüppeln bewaffnet, zwei von ihnen hielten brennende Fackeln in den Händen, dabei war es noch längst nicht dunkel. Als Lisa ihnen nachspähte, sah sie, dass sich ihnen an der nächsten Straßenecke weitere bedrohliche Gestalten anschlossen. Die Horde schlug dieselbe Richtung wie Lisa ein, zur Via Larga, zum Medici-Palast.
Lisa raffte den Mantel und rannte weiter. Das Papier mit Giulianos Botschaft fühlte sie in ihrem Mieder, wo auch die feine goldene Feder steckte, die er ihr geschenkt hatte als Zeichen seiner Liebe. Ja, sie liebten sich, und Lisa hatte keinen Augenblick gezögert, sondern mit Betta Schuhe und Mantel getauscht, das Wenige an Schmuck, das sie besaß, hastig mit dem Garn ihrer Stickarbeit am Saum ihres Unterkleids festgenäht und war losgelaufen.
Hinter dem Chor der Kathedrale Santa Maria del Fiore blieb sie kurz stehen und rang nach Atem. Entsetzt beobachtete sie, wie von allen Seiten wütende Bürger in dieselbe Richtung strömten.
»Schlagt sie tot, die Verräter«, hörte sie eine schrille Stimme rufen.
»Hängt sie auf, die Bastarde!«, forderten andere.
Ein Trupp junger Männer in den Farben der Medici bahnte sich grob seinen Weg durch die Menge und begann, auf die Aufständischen einzuprügeln.
Lisa fühlte einen harten Stoß im Rücken. »Was stehst du hier im Weg«, fuhr eine Frau sie an und gab ihr erneut einen Schubs, der sie zum Stolpern brachte. Erschrocken griff Lisa mit beiden Händen nach der Kapuze, damit sie nicht hinabglitt. Dann rannte sie mit gesenktem Kopf weiter, wobei sie einen kleinen Umweg über die Gasse Borgo San Lorenzo in Kauf nahm, um den Menschenmassen auszuweichen. Ohnehin musste sie sich dem Medici-Palast von seiner Rückseite her nähern. Denn dort lag die Gartenpforte, wo ihr Geliebter sie erwartete.
Auf der Piazza San Lorenzo war es ruhiger, der Lärm der Kämpfenden drang nur gedämpft zu ihr. Kurz lehnte Lisa sich gegen eine Hauswand und versuchte, ihren Herzschlag zu beruhigen. Seit dem Sommer waren sie und Giuliano ein Liebespaar. Ihre Wangen wurden heiß bei dem Gedanken an ihre Umarmungen, an seine wundervollen Lippen, die Berührung seiner Hände, seinen Atem an ihrem Hals. Er war nur wenige Monate älter als sie, fünfzehn Jahre, der jüngste Spross der Familie, die seit Generationen die Geschicke des Stadtstaats Florenz lenkte. Lisa konnte nicht glauben, dass das an diesem schrecklichen Novembertag ein Ende finden sollte. Eilig machte sie sich wieder auf den Weg. Denn wenn es tatsächlich nötig war, würde sie Giuliano begleiten, und sei es bis ans Ende der Welt.
Es wäre zwecklos gewesen, ihren Vater um Zustimmung zu bitten. Zwar hatte er es anfangs nicht ungern gesehen, dass sie gemeinsam mit ihren Freundinnen zu Spielen und Festen bei den Medici eingeladen worden war. Auch wenn Antonmaria Gherardini die Bankiers noch immer als Emporkömmlinge betrachtete, was Lisa angesichts der Jahrhunderte alten Machtstellung und des Reichtums der Medici fragwürdig fand, so fehlte ihrer eigenen Familie trotz des ellenlangen Stammbaums genau das: Einfluss und Geld. Doch nun hatte sich das Blatt gewendet, und es war nicht zu erwarten, dass ihr Vater ihr erlauben würde, Giulianos Frau zu werden.
Eilig überquerte sie die Piazza di San Lorenzo und spähte die Via de’ Gori entlang. Von der Via Larga, in der sich der Haupteingang zum Palazzo befand, drang Geschrei und Lärm herüber, so als versuchten die Aufständischen, das mächtige Portal zu stürmen. Sie huschte in die Via de’ Ginori in Richtung der rückwärtigen Gartenpforte. Auf einmal hörte sie das Geräusch von sich nähernden Pferden und beeilte sich noch mehr. Zwei Reitknechte sprengten heran, jeder von ihnen führte ein edles Ross am Zaumzeug. Die eisenbewehrten Hufe schlugen Funken aus dem Pflaster, und Lisa musste achtgeben, von ihnen nicht getroffen zu werden. Dabei bemerkte sie nicht, wie ihr die Kapuze vom Kopf glitt.
»Zurück«, schrie einer der Knechte sie an und holte mit seiner Reitgerte aus.
Da flog die Gartenpforte auf.
»Lisa«, rief Giuliano und riss sie in seine Arme.
»Was soll das werden?«, schrie Piero hinter ihm. »Keine Zeit für romantische Abschiede, Bruder. Los. In die Sättel.«
»Sie kommt mit«, gab Giuliano entschlossen zurück. »Wir brauchen noch ein Pferd.«
»Herr, das ist unmöglich …« Der Rest des Einwands von einem der Knechte wurde vom Lärm anrückender Aufständischer verschluckt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der wütende Mob sie erreichte.
»Schluss mit den langen Reden«, hörte Lisa eine besonnene Stimme sagen. »Macht, dass ihr aus der Stadt kommt!«
Ein junger Mönch stand in der Gartentür. Erst auf den zweiten Blick erkannte Lisa Giovanni, den mittleren der drei Medici-Brüder, der mit seinen kaum neunzehn Jahren bereits Kardinal war. Doch warum trug er jetzt eine Mönchskutte?
»Ich nehm sie mit auf mein Pferd«, insistierte Giuliano und ergriff ihre Hand.
»Das wirst du nicht«, schrie Piero, der bereits auf seinem Ross saß, das nervös in der engen Straße tänzelte und panisch um sich blickte. »Wir belasten uns nicht mit einem Weib. Das ist ein Befehl!«
Entsetzt sah Lisa, dass das eine Ende der Via de’ Ginori von den Aufständischen blockiert war. Eine hochgewachsene Männergestalt löste sich aus der Gruppe und rannte auf sie zu. Mit einer eleganten Bewegung bestieg Giuliano sein Pferd, beugte sich zu Lisa hinunter, um sie zu sich hochzuziehen, während Piero bereits aus der Gasse sprengte.
Lisa griff nach seiner Hand, fühlte ihren festen Druck und sprang. Sie hatte bereits den Boden unter den Füßen verloren, als eine andere Kraft sie wieder nach unten zog, so heftig, dass ihr Giulianos Hand entglitt. Wütend schrie sie auf, doch ehe sie sich wehren konnte, wurde ihr ein Tuch über Kopf und Oberkörper gestülpt und fest um den Leib gezurrt. Vergeblich versuchte sie sich loszumachen, fühlte, wie sie hochgehoben wurde, an den Oberschenkeln gepackt und über eine Schulter geworfen.
»Lass mich los«, schrie sie, und doch kam nur ein Krächzen aus ihrer Kehle. Der dicke Stoff war so eng um ihren Kopf geschlungen, dass sie fast keine Luft bekam. Ihre Arme waren straff an ihrem Körper fixiert wie bei einem Wickelkind. Wer auch immer sich ihrer bemächtigt hatte, hielt ihre Beine umklammert und eilte mit ihr davon.
Ich werde verschleppt, dachte sie. In Todesangst mobilisierte sie ihre letzten Kräfte, versuchte, ihren Entführer zu treten und sich aus seiner Umklammerung zu winden. Vergeblich. Sie konnte nicht atmen. Und plötzlich war da ein hohes Sirren in ihren Ohren, füllte ihren Kopf vollständig aus, verdichtete sich zu einem hellen, flirrenden Ton. Dann wurde es schwarz um sie.
Als sie erwachte, glaubte sie zu träumen. Oder hatte sie alles andere nur geträumt? Sie lag auf einer gepolsterten Bank und blickte zur Decke empor. Dunkle Balken, dazwischen gemalte, wohlbekannte Rosetten.
»Ich glaube, sie kommt zu sich.« Das war Bettas Stimme.
Lisa fuhr hoch. Sie sah sich ungläubig um und schaute direkt in die erschrockenen Augen ihrer Mutter.
»Kind, was machst du nur für Sachen!« Lucrezia Gherardini klang zutiefst besorgt.
Lisa setzte sich auf. Sie wollte etwas sagen, doch ihre Kehle fühlte sich an, als hätte sie ein Wollknäuel verschluckt. Betta reichte ihr ein Glas, und Lisa trank mit vorsichtigen, kleinen Schlucken. Ihr Kopf dröhnte. Sie hatte keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hatte.
Ganz langsam kehrte die Erinnerung zurück: Giuliano hoch oben auf seinem Pferd und ihre ineinander verschränkten Hände. Der Augenblick, als er sie zu sich hochgezogen hatte. Und dann diese Gegenkraft. Der Ruck, der sie von ihrem Liebsten fortgerissen hatte. Und fortgetragen …
Die Tür flog auf, und ihr Vater kam herein.
»Was hattest du in der Via de’ Ginori zu suchen?« Seine Stimme hallte durch Lisas schmerzenden Kopf. Sie schloss die Augen, presste die Hände gegen die Schläfen. »Sprich mit mir!« Antonmaria packte ihre Handgelenke und zwang sie, ihn anzusehen. Der Griff war hart, er tat ihr weh. »Was hattest du vor?« Sein Gesicht befand sich nur wenige Zentimeter vor ihrem. Und als Lisa den Blick senkte und keine Antwort gab, fügte er leise und drohend hinzu: »Wolltest du tatsächlich mit diesen Burschen davonlaufen und deine Ehre in den Schmutz treten? Antworte!«
»Antonmaria«, mahnte Lucrezia sanft. »Ich bitte dich!«
»Ich will eine Antwort«, forderte ihr Mann und ließ Lisas Handgelenke los. Er war kein gewalttätiger Mensch. Noch nie hatte er seine Tochter geschlagen. Doch Lisa verstand, dass sie eine Grenze überschritten hatte. Und jenseits dieser Grenze galten neue Regeln.
»Warum bist du dort gewesen? Sag es uns«, bat ihre Mutter und behielt ihren Gatten ängstlich im Blick. Hinter ihr entdeckte Lisa das bleiche Gesicht ihrer Amme. Die gute Betta hatte die Augen geschlossen und bewegte die Lippen wie in einem stummen Gebet.
»Ich will ihm ins Exil folgen«, flüsterte Lisa und musste husten. Sie straffte sich. »Wir lieben uns.«
Ihr Vater starrte sie an, dann begann er zu lachen. »Ihr liebt euch? Von wem sprichst du?«, fragte er drohend. »Doch nicht etwa von diesem Versager Piero?«
Lisa verbarg ihr Gesicht in den Händen. Um keinen Preis würde sie ihre Liebe verraten.
»Es hat sich eine Botschaft gefunden«, hörte sie ihre Mutter sagen. »Ein Briefchen. Hier ist es.«
Entsetzt nahm Lisa die Hände vom Gesicht und sah, wie sie den Zettel mit Giulianos Nachricht an ihren Vater weiterreichte. Der las die Zeilen, presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf.
»Ich hab dich für klüger gehalten«, sagte er und betrachtete Lisa verächtlich. »Was für ein Glück, dass diese Dummheit vereitelt wurde. Du wirst niemandem in irgendein Exil folgen, Lisa. Wenn es stimmt, was ich gehört habe, sind die Brüder ohnehin schon tot.« Er stand auf und hob den Mantel auf, der vor der Bank auf dem Boden lag. Bettas Mantel. »Gehört der meiner Tochter?« Er betrachtete Lucrezia mit vorwurfsvoller Miene.
»Nein«, antwortete sie. Ihr Blick flog zu Betta, dann wandte sie ihn sofort wieder ab. Doch Antonmaria hatte es trotzdem gesehen.
»Meine Tochter hatte also eine Helferin«, sagte er und trat zu Betta. »Hier.« Er reichte ihr den alten Mantel. Die Amme nahm ihn und senkte den Kopf. »Pack deine Sachen und geh. Meine Frau wird dir deinen Lohn auszahlen. In einer Stunde will ich dich hier nicht mehr sehen.«
»Papa«, rief Lisa flehentlich aus. »Es ist nicht ihre Schuld.«
»Du hast recht«, antwortete ihr Vater heftig. »Es ist deine Schuld. Und ich hoffe, du begreifst, was du da angerichtet hast.« Betta schluchzte auf und verließ das Zimmer, während Antonmaria geräuschvoll einen Stuhl heranrückte, darauf Platz nahm und seine Tochter fixierte wie zum Verhör. »Von dir will ich nur noch eines wissen: Wie weit hast du es kommen lassen, mit diesem Giuliano de’ Medici?« Er spuckte den Namen geradezu aus. »Hat er dich entehrt? Ja oder nein.«
Lisa presste die Lippen aufeinander und wandte sich ab. Verzweiflung stieg in ihr auf. Sie dachte an die zärtlichen Stunden, die sie mit ihrem Geliebten verlebt hatte, dort in dem Garten zwischen Lorbeersträuchern und den antiken Statuen aus Rom und aus Griechenland, dachte an seine Berührungen, die ein Feuer in ihr entfacht hatten, von dem sie bis dahin nur eine vage Ahnung gehabt hatte, dass es in ihr schlummern könnte. Die unaussprechliche Süße seiner Küsse und die Wellen der Leidenschaft, in der sie miteinander verschmolzen waren, so natürlich und unausweichlich, weil das Schicksal sie füreinander bestimmt hatte und …
»Dein Schweigen sagt mir alles.« Ihr Vater erhob sich. »Wenn er nicht schon tot wäre«, presste er hervor, »würde ich das nur zu gern erledigen.«
»Lass mich mit ihr reden«, bat Lucrezia leise. »Allein. Das ist Frauensache«, fügte sie hinzu.
Antonmaria Gherardini lachte verbittert auf. »Frauensache«, wiederholte er verächtlich. »Ja, sprich mit ihr. Das hättest du längst tun sollen.«
Dann verließ er mit schweren Schritten das Zimmer. Dumpf schlug die Tür hinter ihm ins Schloss. Lisa brach in Tränen aus. Nicht, weil ihr Vater so zornig auf sie war. Sondern weil sie den Gedanken, Giuliano könnte tot sein, einfach nicht ertrug.
»Erzähl mir, was passiert ist. Und zwar von Anfang an.«
Lisa hatte sich unter dem wachsamen Blick ihrer Mutter umgezogen. Ihr Kleid hatte schwer gelitten, der Saum war verschmutzt und teilweise zerfetzt, einige Zierschlaufen an den Ärmeln abgerissen. Vergeblich hatte sie versucht, ihr Unterkleid mit den eingenähten Schmuckstücken zu verbergen, Lucrezia hatte alles entdeckt. Im Gegensatz zu ihrem Vater war Lisas Mutter jedoch die Geduld in Person, und das war auch notwendig bei sieben Kindern im Alter zwischen vier und fünfzehn Jahren. Alessandra, die Jüngste, stand nun auf der Schwelle, ihre Puppe im Arm, und betrachtete ihre älteste Schwester mit weit aufgerissenen Augen.
»Warum weint Lisa?«, fragte sie ängstlich. »Und warum ist Papa so böse?«
»Lass uns allein, Sandra. Geh mit den anderen Mädchen spielen.« Energisch schob Lucrezia die Kleine aus dem Zimmer. »Und nun will ich wissen, was passiert ist.«
Lisa sah sie im Spiegel hinter sich, während sie die Nadeln aus ihrer aufgelösten Frisur zog und eine Bürste zur Hand nahm, um sich zu kämmen.
»Wer war das?«, fragte Lisa zurück.
»Wen meinst du?«
»Wer hat mich wieder nach Hause gebracht?« Verzweifelt bearbeitete sie ihr langes, dunkelbraun glänzendes Haar mit der Bürste und tat sich dabei selbst weh. Aber das war immer noch weniger schmerzhaft als die Trennung von ihrem Liebsten.
»Das tut nichts zur Sache«, gab Lucrezia zur Antwort. »Wichtig ist nur, dass dich sonst keiner erkannt hat.«
»Wer immer es war, er hatte kein Recht …«
»Hör zu«, unterbrach ihre Mutter sie, nunmehr aufgebracht. »Es ist nicht der Moment, solche Fragen zu stellen. Offenbar hast du noch nicht begriffen, wie schlimm es um dich steht. Dein Vater ist entschlossen, dich in die Obhut seiner Schwester zu geben.«
»Seiner Schwester? Meinst du Tante Ginevra?« Nachdem Tante Lucia gestorben war, hatte ihr Vater nur noch diese Schwester. Und die lebte unter dem Namen Suor Albiera im Kloster. »Was willst du damit sagen?«, fragte sie erschrocken.
Statt zu antworten, ging Lucrezia erregt im Zimmer auf und ab. »Wie konntest du nur so unüberlegt handeln«, schimpfte sie. »Wir hatten so sehr gehofft, einen guten Mann für dich zu finden. Dass das angesichts unserer finanziellen Möglichkeiten nicht einfach gewesen wäre, das weißt du so gut wie ich.«
»Giuliano wäre eine glänzende Partie …«
»Hör auf!«, fiel ihr Lucrezia heftig ins Wort. »Wo ist dein Verstand geblieben? Die Zeit der Medici ist vorüber, sieh das endlich ein. Und das ist noch nicht alles. Jeder, der mit ihnen in Zusammenhang gebracht wird, schwebt in Lebensgefahr. Hörst du nicht, was da draußen los ist?« Lucrezia riss die schweren Vorhänge auf und öffnete eines der Fenster. Der Lärm, der ins Zimmer drang, war unbeschreiblich. »Es herrscht Bürgerkrieg. Der Mob hat den Palast an der Via Larga geplündert. Es würde mich nicht wundern, wenn sie ihn in Schutt und Asche legen. Die Dienerschaft, die nicht geflohen ist, wurde erschlagen oder aufgehängt. Und jetzt bekriegen sich die verschiedenen Parteien.« Sie schloss das Fenster und zog die Vorhänge wieder sorgfältig zu. Besorgt wandte sie sich zu ihrer Tochter um. »Falls dich irgendjemand gemeinsam mit den Medici-Brüdern gesehen hat, sind wir alle des Todes«, sagte sie leise. »Alle, nicht nur du. Und nun sag mir endlich, was zwischen euch war. Hast du dich ihm hingegeben?«
Lisa wandte sich trotzig ab. Und doch machte ihr das, was ihre Mutter gesagt hatte, Angst. Am besten war es vermutlich, sie schwieg. Lucrezia stöhnte auf, zog einen Stuhl heran und nahm ihrer Tochter die Bürste aus der Hand. »Hör gut zu«, sagte sie. »Dein Vater wird den Leibarzt rufen und dich untersuchen lassen. Willst du das? Oder möchtest du dich nicht lieber mir anvertrauen?«
Es hatte nicht viel geholfen, ihrer Mutter die Wahrheit zu sagen. Lucrezia Gherardini war bleich wie Kerzenwachs geworden, nachdem sie aus ihrer Tochter herausgepresst hatte, dass diese nicht etwa nur einmal, sondern ganze fünf Mal Giuliano beigeschlafen hatte. Dann hatte sie Lisa allein gelassen. Endlich.
Kaum war ihre Mutter gegangen, überlegte Lisa fieberhaft, was sie mit den Briefen anfangen sollte, die Giuliano ihr geschrieben hatte. Sie musste sich beeilen, schließlich teilte sie das Zimmer mit ihren kleinen Schwestern, mit der achtjährigen Ginevra, der knapp sechsjährigen Camilla und mit Sandra, dem Nesthäkchen. Die Gherardini wohnten zur Miete und das äußerst beengt. Und hätte sich nicht Lucrezias Vater, Galeotto del Caccia, der Sache angenommen, so hätten sie nicht einmal diese Wohnung in einem halbwegs anständigen Palazzo bekommen, sondern würden noch immer in dem dunklen Loch nahe dem Wollsiederviertel jenseits des Arnos wohnen, wo einem in der Gasse jederzeit eine Ratte über den Weg laufen konnte und es an heißen Sommertagen unerträglich roch. Erst vor einem halben Jahr waren sie hier eingezogen, direkt neben ihren Großeltern, und wenn sich auch der Vermieter, der unter ihnen wohnte, täglich über den Lärm der Kinder beschwerte, so war es hier viel schöner als auf der anderen Seite des Flusses.
Lisa öffnete ihre Truhe und tastete nach Giulianos Briefen. Auf keinen Fall durften sie in die Hände ihrer Eltern fallen. All die intimen Geständnisse, die zärtlichen Liebesschwüre. Sie drückte das Bündel an ihre Lippen. Was sollte sie damit tun? Und mit den Liebesgedichten, die sie für ihn verfasst hatte? Verbrennen? Bei dem Gedanken traten ihr schon wieder die Tränen in die Augen. Doch eine andere Lösung fiel ihr nicht ein, es war durchaus damit zu rechnen, dass der Vater ihre Habe durchsuchen lassen würde. Entschlossen ging sie zum Kamin und warf alles in die Flammen. Sie wandte sich ab, um nicht mit ansehen zu müssen, wie Giulianos Zeilen zu Asche zerfielen. Sie hatte ja immer noch die goldene Feder.
Wie von selbst wanderten ihre Hände zu ihrem Mieder, dorthin, wo sie das Kleinod seit Wochen verwahrte. Doch sie fand es nicht. Ein heißer Schreck durchfuhr sie. Hastig öffnete sie das Oberteil ihrer gamurra, dem Hauskleid, und zog es über den Kopf, drehte und wendete es. Die goldene Feder war nicht mehr da! Offenbar hatte sie, als sie von dem Unbekannten verschleppt worden war, auch Giulianos Liebespfand verloren.
So als erfasse ihr Verstand erst jetzt, was geschehen war, sank sie aufs Bett und weinte bittere Tränen. »Giuliano«, wimmerte sie verzweifelt. »Wo bist du?« Stimmte es, was ihr Vater gesagt hatte? War er getötet worden? Nein, sie konnte das nicht glauben.
Endlich versiegten ihre Tränen. Sie trocknete ihr Gesicht und zog sich wieder an. Dann beschloss sie, um eine Unterredung mit ihrem Vater zu bitten. Sie hatten sich immer gut verstanden, Antonmaria und sie. Wenn er auf die Landgüter der Familie gefahren war, hatte er sie häufig mitgenommen, und auf diesen Fahrten hatte er sie wie eine Erwachsene behandelt, ihr die Pachtverhältnisse erklärt und mit ihr über die Einkünfte gesprochen, die er aus ihnen bezog. Sie konnte verstehen, dass er im Augenblick zornig auf sie war. Irgendwann würde er sich wieder beruhigen, und dann konnten sie vernünftig über alles reden. So wie früher.
Als sie das Zimmer verlassen wollte, fand sie die Tür abgesperrt. Zuerst wollte sie es nicht glauben, rüttelte an der Klinke, doch die gab nicht nach. In einem Anflug von Panik trommelte sie mit den Fäusten gegen das Holz, bis ihr die Hände wehtaten.
»Lasst mich raus«, schrie sie und lauschte. War das ein Wispern und Tuscheln auf der anderen Seite der Tür?
»Papa hat gesagt, du darfst nicht raus.« Das war Franceschinos Stimme, und sie klang ziemlich altklug für einen Neunjährigen. »Damit du nicht nochmal wegläufst.«
Gegen Abend kam ihre Mutter und befahl ihr, die Truhe zu packen.
»Wo schickt ihr mich hin?«, fragte Lisa angstvoll.
»Vorerst in Bettas Kammer.« Lucrezia vermied es, ihr in die Augen zu sehen, und Lisa verstand, wie sehr ihr das alles zu schaffen machte. Es musste sie schwer treffen, dass ihre Tochter sie nicht ins Vertrauen gezogen hatte. Doch was hätte Lisa auch tun sollen? Sie hatte von Anfang an gewusst, dass ihre Mutter mit ihrer Liebe zu Giuliano niemals einverstanden gewesen wäre.
Folco erschien und schleppte die Truhe ins Dachgeschoss. Der Knecht fluchte nicht übel, denn das sperrige Ding passte kaum die schmale Stiege hinauf. Dann wurde Lisa von ihrer Mutter dorthin eskortiert, vorbei an ihren sechs Geschwistern, die ihr mit weit aufgerissenen Augen hinterherblickten.
»Wo geht Lisa denn hin?«, hörte sie Camilla flüstern.
»Sie war nicht artig«, antwortete Gigi, der älteste der drei Brüder. »Das muss sie büßen.«
»Aber da oben wohnt doch die Betta«, wandte der siebenjährige Noldo ein.
»Nicht mehr«, wusste Franceschino. »Papa hat sie weggeschickt.«
Bei dieser Nachricht brachen Camilla und Alessandra in Tränen aus, und Lisa hätte am liebsten mitgeweint. Betta war die Seele des Hauses gewesen, hatte sich um die Kinderschar gekümmert und nebenbei noch um alles andere, um die Wäsche, das Saubermachen, das Kochen. Nicht nur Lisa würde sie vermissen. Am schwersten traf ihr Verlust wohl die Hausherrin selbst.
»Hier bleibst du vorerst«, sagte Lucrezia, als sie oben waren, und sah sich besorgt in der winzigen Stube um. »Bis dein Vater sich entschieden hat.«
»Mutter«, bat Lisa leise. »Lass mich mit ihm reden.«
Lucrezia schüttelte traurig den Kopf. »Ich hab ihm das schon mehrmals vorgeschlagen. Er lehnt es ab.« Fröstelnd schlang sie die Arme um ihren Körper. »Folco wird einen heißen Stein fürs Bett bringen. Leg dich hin, Lisa. Und bete. Das ist das Einzige, was du noch tun kannst.«
»Weißt du etwas von Giuliano und Piero?«, fragte Lisa hastig, als ihre Mutter sich bereits zum Gehen wandte. Lucrezia schüttelte den Kopf, stellte die Kerze auf den winzigen Tisch und ließ sie allein.
Nun war sie also eine Gefangene im eigenen Haus. Ratlos sah Lisa sich um. Die Stube unter der Dachschräge war so klein, dass die Truhe hinter der Tür gerade so Platz fand. Ein Fenster gab es hier nicht, nur eine Dachluke von der Größe eines Buches, die mit gewachstem Papier verschlossen war. Nicht einmal den Himmel konnte sie mehr sehen, dagegen drang unbarmherzig die Novemberkälte herein.
Hier also hatte die Frau gelebt, der sie so viel verdankte. Mit der sie all ihre Geheimnisse geteilt hatte. Lisa schämte sich, als ihr bewusst wurde, dass sie Betta kein einziges Mal besucht hatte, seit sie hier eingezogen waren. Die Bettstatt bestand aus grob zusammengezimmerten Brettern, und obwohl sie mit frischen Laken bezogen war, wirkte sie schäbig und unbequem. Die Wände waren vor langer Zeit mit gelber Farbe aus Siena gestrichen worden, an vielen Stellen waren sie inzwischen abgestoßen und zerkratzt. Über dem Kopfende glaubte Lisa den Abdruck eines kleinen Kreuzes zu erkennen, vielleicht von jenem Kruzifix, das ihre Amme Zeit ihres Lebens begleitete, wie Lisa sich aus frühen Jahren erinnerte.
Verzagt ließ sie sich auf der Strohmatratze nieder. Sie hatte nicht nur ihr eigenes Leben zerstört, sondern auch das ihrer geliebten Amme. Was Betta wohl gerade machte? Wo hatte sie Zuflucht gesucht, so von einem Moment auf den anderen des Hauses verwiesen? Betta stammte aus einem Dorf der Gegend, sie war nicht verheiratet gewesen, und das Kind, dessen Vater unbekannt war, hatte nur einen Tag überlebt – mehr wusste Lisa nicht von ihr. Reue überfiel Lisa. Wie hatte sie die gutmütige Seele nur in ihr gefährliches Unterfangen hineinziehen können! Leichtsinnig war sie gewesen, hatte die Folgen nicht bedacht.
Schwere Schritte polterten die Stiege herauf. Lisa sprang vom Bett auf, strich sich das Haar aus der Stirn und legte sich sittsam ihr Schultertuch über den Scheitel. Halb hoffte sie, es wäre ihr Vater, dann könnte sie versuchen, alles wieder in Ordnung zu bringen, zumindest die Sache mit Betta, auch wenn sie sich vor der Begegnung mit ihm fürchtete. Doch es war nur Folco, der ihr mit einer Zange den versprochenen heißen Stein brachte und ihn sorgsam in den eisernen Heizkasten legte, der am Fußende des Bettes stand. Dann wandte er sich wortlos um und verschwand. Geräuschvoll drehte sich der Schlüssel im Schloss.
Eine Weile stand Lisa mitten in dem winzigen Zimmer und versuchte zu begreifen, dass sie das alles nicht nur träumte. Sie überprüfte, ob die Tür wirklich verschlossen war, holte ihr Nachtgewand aus der Truhe und machte sich zum Schlafen bereit.
Keine Waschschüssel mit warmem Wasser, kein Abendessen. Keine Gutenachtrituale mit ihren Schwestern, kein Kichern und Lachen. Als sie sich allein in dem unbequemen Bett zusammenrollte, sehnte sie sich nach der Körperwärme der Kleinen, die sich in dem großen Bett im Mädchenzimmer an sie gekuschelt hatten. Hier also hat Betta geschlafen, sagte sie sich immer wieder, und ihre Brust wurde eng vor Schmerz, wenn sie an die gute Frau dachte. Dann stieß sie mit den Füßen gegen etwas Weiches, Wollenes. Es war das Lieblingstuch ihrer Mutter! Lisa kamen die Tränen. Also hatte Lucrezia sie doch nicht ganz vergessen.
Sie sprang noch einmal aus dem Bett und schlang das Wolltuch um ihren Körper, legte sich wieder hin und zog die Decke über sich. Und mit dem tröstlichen Gedanken, dass ihre Mutter nicht wollte, dass sie fror, schlief sie trotz all ihrer Sorgen und Ängste ein.
Als sie am nächsten Morgen erwachte, wusste sie nicht, wo sie war. Das bleiche Rechteck an der Decke schimmerte fahl. Es war so kalt, dass ihr Atem kleine Wölkchen bildete.
Rasch schloss sie wieder die Augen und versuchte, in den Traum zurückzukehren, in dem sie eben noch so glücklich gewesen war. Sie hatte in Giulianos Armen gelegen, über ihnen war der Wind durch die Lorbeerbüsche gefahren, der Springbrunnen hatte geplätschert … Doch die Traumbilder verblassten, und ein anderes Geräusch drängte sich in ihr Bewusstsein. Es war Regen, der über das Dach strömte und gegen das gewachste Papier trommelte, das die Dachluke verschloss.
Sie starrte zu dem hellen Fleck an der Wand empor, den Bettas Kreuz hinterlassen hatte. Sie solle beten, hatte ihr die Mutter empfohlen. Sie versuchte ein Ave-Maria, war allerdings nicht bei der Sache. Bei dem Vers Und gebenedeit sei die Frucht deines Leibes sah sie wieder das entsetzte Gesicht ihrer Mutter vor sich, als sie ihr gestanden hatte, dass sie sich Giuliano hingegeben hatte. »Hast du nicht an die Folgen gedacht?«, hatte Lucrezia ihr entgegengeschleudert. »Was, wenn du schwanger bist?«
Natürlich hatte sie daran gedacht, sie war ja kein Kind mehr. Es hatte sie nicht geschreckt, denn Giuliano hatte von Heirat gesprochen, davon, dass er mit ihr eine Familie gründen wollte. Er hatte gesagt, dass er sich nach einem vollkommen normalen Leben sehnte, jenseits aller Diplomatie und Politik. Ein Leben mit ihr. Er hatte es ernst gemeint, sonst hätte er sie nicht gebeten, mit ihm zu kommen, hätte ihr nicht die Hand gereicht, um sie auf sein Pferd zu holen …
Lisa gab das Beten endgültig auf und schlug die Decke zurück. Fröstelnd durchsuchte sie die Truhe nach ihrem wärmsten Winterkleid und zog sich rasch an. Dennoch fror sie bis ins Mark. Sie prüfte den Stein im Heizkasten, er war nicht mehr warm. Wie spät es wohl sein mochte?
Ihr Magen knurrte. Seit dem vergangenen Mittag hatte sie nichts mehr gegessen. Mit einem Mal wurde sie schrecklich zornig, sprang auf und schlug mit den Fäusten gegen die Tür. Wie kamen ihre Eltern dazu, sie wie eine Gefangene zu halten?
Doch ihr Wutausbruch verhallte, und nichts geschah. Lisa fragte sich, ob man sie unten in der Wohnung überhaupt hören konnte. Vermutlich nicht. Resigniert schlang sie Lucrezias Wolltuch um die Schultern und versuchte sich zu beruhigen. Als ihr Körper vor Kälte zu zittern begann, schlüpfte sie, angezogen wie sie war, wieder ins Bett.
Sie musste eingeschlafen sein, plötzlich stand ihre Mutter in der Kammer und blickte besorgt auf sie herab. Lisa richtete sich auf und rieb sich die Augen. Ihr Kopf dröhnte.
»Darf ich runterkommen?« Sie räusperte sich. Ihre Kehle fühlte sich rau an, und ihre Glieder schmerzten.
Lucrezia schüttelte traurig den Kopf. Sie hatte einen Schemel ans Bett gezogen und ein Tablett mit einer kleinen Mahlzeit daraufgestellt. »Du musst Geduld haben«, mahnte sie und reichte Lisa den dampfenden Becher. »Dein Vater ist noch immer sehr zornig. Hier, trink.«
Es war ein Kräuteraufguss, Lisa blies auf die heiße Flüssigkeit, nahm mehrere kleine Schlucke, biss in das Maisbrötchen, das Lucrezia ihr bereitet hatte.
»Mein Hals tut weh«, sagte sie, legte das Brötchen weg und ließ sich zurück ins Kissen fallen.
»Du wirst hoffentlich nicht krank werden?«, fragte ihre Mutter erschrocken und legte ihr die Hand auf die Stirn. Dann seufzte sie tief auf. »Nun müssen wir den Leibarzt wohl doch noch rufen lassen.«
Drei Tage lang glühte Lisa im Fieber und wünschte sich sehnlichst, sterben zu dürfen. Zuerst fand sie es grausam, dass man sie so allein in der Mansarde liegen ließ, auch wenn ihre Mutter und das neue Hausmädchen fast stündlich nach ihr sahen. Dann wieder war sie froh darum, ihre Ruhe zu haben, reiste im Halbschlaf durch die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit, die sie mit Giuliano verbracht hatte. Jeden einzelnen zärtlichen Moment erlebte sie wieder, jeden seiner Sätze überdachte sie neu. »Wir müssen stark sein«, hatte er einmal gesagt, und sie hatte genickt, erst jetzt verstand sie allerdings, was er wirklich damit gemeint hatte. Dass sie sich nicht damit abfinden durften, was geschehen war. Und dass immer Hoffnung bestand. Nein, ihr Geliebter war nicht tot, er lebte, das fühlte sie ganz deutlich. Genau in diesem Augenblick dachte er an sie, da war sie sich sicher. Und hätte er sich erst selbst gerettet, würde er keine Mittel und Wege scheuen, um sie nachzuholen.
Das war der Gedanke, an dem sie sich festhielt. Er würde sich mit ihr in Verbindung setzen und sie zu sich holen. In ihrer Fantasie durchlebte sie bereits die abenteuerlichsten Fluchten, und jedes Pferdegetrappel, das von der Gasse herauf in ihre Kammer drang, erfüllte sie mit Hoffnung.
Je mehr das Fieber jedoch sank, desto mehr schwand auch die Euphorie. Natürlich würde er nicht persönlich kommen können, das war viel zu gefährlich. Er würde jemanden schicken, dem er vertraute, und der würde sie aus dieser Dachkammer befreien. Solche hoffnungsvollen Stunden wechselten mit anderen in tiefster Verzweiflung, wenn sie erkannte, dass der Lärm von unten von ihren Geschwistern herrührte und keineswegs von ihren Befreiern. Oder wenn sie sich eingestehen musste, dass es keine Möglichkeit gab, ihr eine Botschaft zukommen zu lassen, seit Betta des Hauses verwiesen worden war.
Lange grübelte sie darüber nach, wer es gewesen sein könnte, der sie dort in der Via de’ Ginori so jäh von Giuliano weggerissen hatte, um sie auf dem kürzesten Weg zurück nach Hause zu bringen. Vergeblich hatte sie ihre Mutter erneut danach gefragt. Lucrezia hatte nur den Kopf geschüttelt und darauf hingewiesen, dass Lisa Gott für diesen Schutzengel danken solle, der sie vor dem Schlimmsten bewahrt hatte.
Endlich wich das Fieber, ihre Kräfte kehrten zurück, und es wurde ihr erlaubt, nach unten in die Küche zu kommen, um dort in der Zinkwanne ein Bad zu nehmen. Lucrezia schickte das Hausmädchen fort und wusch ihrer Tochter eigenhändig das lange Haar, kämmte es liebevoll und half ihr schließlich in ihr Lieblingskleid. Lisa, erschöpft von der Anstrengung nach dem langen Liegen, sah zu, wie ihre Mutter ihr das Haar kunstvoll flocht.
»Dein Vater will dich gleich sehen«, sagte Lucrezia, schlang die vielen kleinen Zöpfe um Lisas Hinterkopf und steckte sie dort nach der neuesten Mode fest. Offenbar wollte sie, dass ihre Tochter einen guten Eindruck machte. Vielleicht hatte ihr Vater sich endlich beruhigt und würde ihr verzeihen?
Besorgt betrachtete Lisa sich im Spiegel. Sie war bleich, dunkle Schatten lagen unter ihren Augen, die größer wirkten denn je. Sie rieb sich die blassen Lippen und kniff sich in die Wangen, damit ein wenig Farbe in ihr Gesicht kam.
»Du bist schön genug«, hörte sie ihre Mutter sagen. »Vielleicht hat dein Vater mehr Mitleid mit dir, wenn er sieht, wie elend du bist.«
Sie legte ihrer Tochter einen dunklen Schleier über den Scheitel und prüfte, ob alles ordentlich saß. Lisa fühlte, dass auch Lucrezia beunruhigt war, und fragte sich bang, was sie wohl erwartete.
Antonmaria Gherardini saß in seinem Arbeitszimmer und blickte zunächst nicht von den Papieren auf, die er gerade studierte. Leise schloss Lucrezia die Tür, und Lisa war mit ihrem Vater allein. Er kontrollierte Abrechnungen, bestimmt von einem der gepachteten Güter, sie hatten sie oft gemeinsam durchgesehen, und da sie meistens nicht den Erwartungen entsprachen, konnte Lisa davon ausgehen, dass ihr Vater nicht gerade guter Laune war. Endlich legte er die Blätter beiseite und blickte auf.
»Lisa«, begann er, »morgen wirst du uns verlassen. Ich habe mit der Oberin von San Domenico di Cafaggio gesprochen, es ist alles geregelt. Deine Tante, Suor Albiera, wird ein Auge auf dich haben und dir helfen, dich einzuleben. Nicht dass du das verdient hättest. Aber meine Schwester, freundlich wie sie ist, besteht darauf.«
In Lisas Ohren begann es zu rauschen. Ihr Vater wollte sie tatsächlich ins Kloster schicken?
»Nun, sie weiß ja auch nicht, was du getan hast«, fuhr er fort. »Und das soll auch niemand erfahren, hörst du? Wir schweigen über diese Sache. Und du wirst das auch tun. Alles andere würde uns in höchstem Maße schaden.«
»Vater, ich …«, begann sie, doch Antonmaria hob die Hand und brachte sie damit zum Schweigen.
»Ich kann mir denken, dass du nicht glücklich darüber bist. Darauf kann keine Rücksicht mehr genommen werden. Du wirst dich meinem Willen fügen.«
»Ich will nicht ins Kloster! Bitte, du hast es mir versprochen.« Und als Lisa sah, dass ihn das nicht zu berühren schien, fügte sie heftig hinzu: »Wenn dir so wenig an mir liegt, dann lass mich Giuliano hinterherreisen.«
Der Schlag mit der Faust auf den Schreibtisch ließ sie zusammenfahren.
»Du musst verrückt geworden sein«, polterte ihr Vater los. »Selbst wenn dieser Hurensohn noch am Leben sein sollte – ist dir denn nicht klar, was dich an seiner Seite erwartet hätte?«
»Er liebt mich«, warf Lisa trotzig ein.
»Ich will von diesem Unsinn kein Wort mehr hören«, schrie ihr Vater sie an. »Ja, es mag sein, dass er von dir betört ist, schließlich bist du eine der schönsten jungen Frauen von Florenz. Weißt du eigentlich, wie gut deine Chancen standen, in eine der besten Familien einzuheiraten, trotz unserer finanziellen Lage? An der Seite eines ehrbaren Mannes, der dir ein sorgenfreies Leben hätte bieten können? Aber nein, du musstest ja einem Hirngespinst hinterherjagen. Kein Medici auf dieser Welt hätte dich je zu seiner rechtmäßigen Frau gemacht. Auch nicht Giuliano. Und weißt du warum?« Er starrte Lisa in die Augen, noch nie hatte sie ihn so aufgewühlt gesehen. »Weil sein Bruder Piero es ihm niemals erlaubt hätte.«
»Woher willst du das wissen?«, fragte Lisa empört zurück. »Er hat mir geschworen …«
»… er hätte seinen Schwur gebrochen«, fiel ihr Antonmaria ins Wort. »Denn die Medici heiraten seit Generationen ausschließlich aus strategischen Gründen. Das ist eines ihrer Mittel, ihre Macht zu bewahren. Warum hat Piero eine Orsini geheiratet? Nicht, weil er sie so glühend liebt, sondern weil die Orsini eine der einflussreichsten Familien in Rom sind und seine Stellung beim Papst stärken. Seine Schwester Maddalena hat er mit Francesco Cibo vermählt, auch dabei ging es nicht um Liebe, sondern darum, mächtige Verbündete zu gewinnen. Für seinen jüngsten Bruder hat er mit Sicherheit bereits großartige Pläne. Glaubst du, für ihn kommt eine Gherardini in Betracht?« Er lachte bitter auf. »Nie im Leben. Du wärst eine Weile Giulianos Spielzeug gewesen, bis er genug von dir gehabt hätte. Irgendwann hätte er eine andere geheiratet. Und dann? Du wärst noch verworfener gewesen, als du schon bist. Also schweig und gehorche. Ich will kein weiteres Wort mehr von dir hören.« Antonmaria ergriff die Tischglocke, mit der Lisa und ihre Geschwister in einem anderen Leben manchmal gespielt hatten, und läutete. Sogleich stand Lucrezia in der Tür und blickte ängstlich von ihrem Mann zur Tochter. »Bring sie wieder in die Kammer«, sagte Antonmaria unbarmherzig.
»Darf sie nicht wenigstens ihren letzten Abend mit der Familie …?«
»Nein«, unterbrach er seine Frau und erhob sich. »Für mich ist sie schon nicht mehr da.«
Lisa hatte nicht gewusst, dass sie noch so viele Tränen hatte. Sie weinte die halbe Nacht, tief verzweifelt und kummervoll. Sie wollte nicht ins Kloster, die düsteren Mauern von San Domenico di Cafaggio hatten ihr bereits als kleines Mädchen Angst eingeflößt, wann immer sie ihre Tante dort hatte besuchen müssen.
Die Gefahr, ein Leben als Nonne führen zu müssen, hatte stets über Lisa und ihren Schwestern geschwebt, denn trotz der zahlreichen Güter im Umland war ihr Vater nicht wohlhabend genug, um die horrende Mitgift zu bezahlen, die eine Familie von Rang erwartete, wollte man seine Tochter mit einem ihrer Söhne verheiraten. Zwar forderten auch Klöster eine beachtliche Summe von den Eltern ihrer Novizen, doch die war weitaus geringer als eine Mitgift. Vor einigen Jahren hatte Antonmaria Lisa allerdings versprochen, ihr dieses Schicksal zu ersparen. Das war während eines ihrer Sommeraufenthalte auf dem Land gewesen, in der Ca’ di Pesa im Chianti, ihrem bei Weitem schönsten Besitz. Damals hatte er ihr das Reiten beigebracht und sich darüber gefreut, wie mutig sie war und wie geschickt sie sich anstellte, fast so, als wäre sie ein Junge, hatte er gesagt. Nachdem Lisa zur Welt gekommen war, hatte Lucrezia zwei Fehlgeburten erlitten, und es waren nicht ihre ersten, bereits vor Lisa hatte sie ein Kind verloren. Erst vier Jahre später war endlich der Stammhalter Giovangualberto, von allen nur Gigi genannt, geboren worden, und doch blieb Lisa der Liebling ihres Vaters.
Das war nun wohl vorbei. Dabei wusste Antonmaria Gherardini genau, dass man Lisa nicht einsperren durfte, schließlich hatte er gesehen, wie sie frei wie der Wind über die Hügel des Chianti galoppierte. Und ihr deshalb die Angst vor einem Klosterleben genommen. Wie tief musste sie ihn gekränkt haben, dass er sein Wort brach. Trotzdem war es ungerecht.
Irgendwann musste sie eingeschlafen sein. Es war noch stockfinstere Nacht, als das neue Hausmädchen sie weckte. Sie hatte ihr eine Schüssel mit heißem Wasser gebracht, damit sie sich waschen konnte. Kurz darauf erschien ihre Mutter mit einem Glas warmer Milch und Lisas Mantel über dem Arm.
»Darf ich mich denn gar nicht von den Kleinen verabschieden?«, fragte Lisa kläglich.
»Sie schlafen noch«, antwortete Lucrezia und wandte sich ab, Lisa hatte gesehen, dass Tränen in ihren Augen standen. »Hättest du dich mir nur anvertraut«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen.«
Es war ein kalter Morgen. Grau erhoben sich Nebelfetzen aus dem Fluss. Dennoch sog Lisa nach den langen Tagen in der Dachkammer die frische Luft tief in ihre Lungen. Sie musste husten und schlang den Schal fester um ihren Kopf.
Schweigend legten sie den Weg zurück. Folco ging den Frauen voraus, die Fackel erhoben. Hin und wieder sah er sich nach ihnen um. Ob ihr Vater ihm aufgetragen hatte, besonders gut aufzupassen? Hatte er Sorge, Lisa würde erneut versuchen, wegzulaufen? Doch wo sollte sie hin? Eine bleierne Hilflosigkeit hatte von ihr Besitz ergriffen.
Scheu blickte sie um sich. Noch waren wenige Menschen auf den Beinen. Ein Bäckerjunge trug eine Kiepe voller Panini an ihnen vorbei und zog den verführerischen Duft nach frisch gebackenem Brot hinter sich her. Erschrocken bemerkte Lisa, dass viele der vertrauten Ladengeschäfte in ihrer Nachbarschaft mit Brettern vernagelt waren, in so mancher Gasse lagerten Überreste von Straßensperren. Beim Palazzo del Podestà stockte sie, als sie die Leichen bemerkte, die zur Abschreckung noch immer an der Fassade hingen. Offenbar hatte man einige der Gefolgsleute der Medici an den Fenstern des oberen Stockwerks gehenkt. Instinktiv zog Lisa den Wollschal vor Mund und Nase.
»Sieh nicht hin«, sagte Lucrezia leise und legte den Arm um die Schultern ihrer Tochter.
Doch Lisa hatte bereits die riesigen Schandbilder entdeckt, die man von Piero, Giovanni und auch von Giuliano angefertigt hatte, grotesk verzerrt prangten sie über den Fassaden auf der Piazza della Signoria, so als wollten sie Lisa verhöhnen. Von da an hielt sie den Blick aufs Pflaster gesenkt und versuchte, das fratzenhafte Konterfei ihres Geliebten aus ihrem Kopf zu bannen.
Als sie vor dem Klostertor angekommen waren, hielt Lisa ihre Mutter am Ärmel zurück. »Bitte«, sagte sie flehentlich, »versuch ihn umzustimmen. Ich kann das nicht, ich bin nicht wie Tante Ginevra.«
»Sie heißt Suor Albiera.« Tränen liefen ihrer Mutter über die Wangen. Fest schloss sie Lisa in die Arme und drückte sie an sich. »Ich will es versuchen«, flüsterte sie. »Aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen.«
Was darauf folgte, erlebte Lisa wie in einem schlimmen Traum. Die Pforte wurde geöffnet, eine der Dominikanerinnen empfing sie und brachte sie zur Mutter Oberin, wo ihre Tante bereits auf sie beide wartete. Vor Lisas Augen zerfloss alles in Tränen, kaum hörte sie, was man zu ihr sprach. Dann hieß es Abschied nehmen, Lucrezia küsste sie auf die Stirn, wandte sich hastig ab und ging. Noch lange hörte Lisa das Hallen ihrer Schritte, das sich langsam entfernte.
»Komm«, sagte Suor Albiera sanft. »Ich zeig dir den Schlafsaal.«
Doch alles, was Lisa wahrnahm, war das Geräusch der sich schließenden Pforte.
2DAS PFERD
Mailand, 1494
Leonardo betrachtete die prächtig gewandete Festgesellschaft. Seide und Brokat schimmerten mit Goldschmuck um die Wette, in den fließenden Bewegungen der paarweise Tanzenden blitzten hier und dort Diamanten und andere Juwelen auf. Am kostbarsten waren die Gastgeber selbst gekleidet, Ludovico Sforza, genannt Il Moro, und seine Gattin, Herzogin Beatrice d’Este, die mit der Markgräfin von Mantua an der Stirnseite des großen Saals standen.
Es war so weit. Leonardo gab das vereinbarte Zeichen. Fanfaren unterbrachen jäh die Musik. Überrascht hielten die Gäste in ihren graziösen Schrittfolgen inne und hoben die Köpfe, während die Beleuchtung bis auf wenige Kerzen erlosch. Das Portal öffnete sich, überirdisch wirkendes Licht strahlte mit solcher Helligkeit herein, dass die vornehmen Damen aufseufzten und sich so manch einer bekreuzigte.
»Als wäre die Sonne aufgegangen«, flüsterte eine hübsche Hofdame hingerissen in Leonardos Nähe, sehr zu dessen Vergnügen. »Ein Wunder.«
In diesem Moment erschien im Gegenlicht ein Reiter. Zunächst nur als dunkle Silhouette zu erkennen, verharrte er kurz, um dann bedächtig sein Pferd über die Schwelle zu lenken. Wie von selbst bildete die Hofgesellschaft eine Gasse, um dieser wunderbaren Erscheinung Platz zu machen, die in den nun wieder aufflammenden Lichtern ihre ganze Pracht entfaltete. Ein Raunen ging durch die Menge. Die Wirkung war in der Tat grandios. Pferd und Reiter waren über und über mit Goldblättchen bedeckt, dazwischen klebten hunderte von Pfauenaugen, die Leonardos Gehilfen aus den Federn der Vögel zurechtgeschnitten und als Ornamente auf das Kostüm aufgeklebt hatten. Das Spektakulärste jedoch verbarg sich im Helm des Reiters. Auf ihm prangte eine Erdkugel, bekrönt von einem goldenen Vogel, dessen Schweif fast den Rücken des Pferdes berührte. Eine Schar fantastisch maskierter Akrobaten folgte dem Reiter, schlug Saltos und Räder und formierte sich schließlich zu einer menschlichen Pyramide.
»Wie habt Ihr denn das geschafft?«, fragte Baldassare Taccone, der Hofkanzler, und wies auf den Reiter.
Leonardo lächelte und behielt dabei aufmerksam die Vorführung im Auge.
»Ach«, antwortete er gelassen, »Ihr glaubt nicht, was ein wenig Gold, Wachs und Pfauenfedern bewirken können.«
»Aber dieses Licht!«, rief Taccone begeistert aus. »Wie ist Euch das nur gelungen?«
»Ein paar Geheimnisse muss man doch noch bewahren dürfen, meint Ihr nicht?«, gab Leonardo liebenswürdig zurück, entschuldigte sich mit einer Verbeugung und entfernte sich eilig. Er wollte sich vergewissern, ob auf dem provisorisch eingerichteten Schnürboden über dem Saal, der durch Tücher verhängt worden war, alles nach Plan verlief. Dass er mit einem selbst entwickelten Reflektor arbeitete, indem er mehrere Spiegel miteinander kombiniert hatte, die das Licht einer einzigen, großen Fackel bündelten und zielgenau auf den Darsteller warfen, brauchte er nicht jedem auf die Nase zu binden.
Als Leonardo das Gerüst zu der von ihm gefertigten Wolke aus Pappmaché heraufgeklettert kam, hatte Salai seinen Platz bereits eingenommen. Schön wie ein Engel kniete Leonardos Lehrling in dem aufgeklappten, goldenen Ei, die flaumigen weißen Flügel am Körper angelegt, den Kopf mit der kunstvoll gestalteten Vogelmaske nach vorne gereckt.
»Raub ihnen den Verstand«, flüsterte Leonardo, wohl wissend, dass der Vierzehnjährige ihn nicht hören konnte, die Trompetenfanfaren waren viel zu laut.
Der funkelnde Reiter hatte die Mitte des Saals erreicht und brachte sein Pferd zum Stehen. Er nahm die Zügel in die linke Hand und machte mit der rechten eine weit ausholende Geste in Richtung des Hausherrn und seiner jungen Gemahlin. Und da geschah es: Aus dem Handschuh des Reiters sprühte ein Regen aus goldenen Lichtern, und nicht nur er, auch sein Gefolge war mit einem Mal in einen Schleier aus glitzernden Sternen gehüllt.
»Gleich geht es los«, raunte Leonardo den Männern zu, die die Seile betätigten. »Auf mein Zeichen. Salai! Schließ das Ei!«
Der Junge streckte ihm unter der Halbmaske die Zunge heraus und zog die obere Hälfte des Eis über sich. Harfenakkorde ertönten, mischten sich in den Beifall der Festgesellschaft, hallten von den Wänden wider. Unter diesen Klängen erhob sich der Vogel auf dem Helm des Reiters, reckte den Hals und färbte sich zum Entsetzen der Zuschauer blutrot. Dass dieser Effekt von gefärbten Glasplatten herrührte, die vor Leonardos optische Geräte geschoben wurden, konnte niemand wissen, und nun erhob sich der Vogel noch höher, entfaltete seine glühenden Flügel – und plötzlich schlugen Flammen aus seinem Schnabel.
»Los!«, rief Leonardo den Männern an den Zügen zu. »Lasst Salai fliegen!« Federn stiegen aus dem brennenden Vogel auf. Einige Damen waren einer Panik nah, da verglühte das Feuer bereits wieder, und andere Gäste sprachen besänftigend auf sie ein. Alles Theater. Alles Illusion.
Kaum hatte man sich ein wenig beruhigt, gab es erneut Aufschreie, denn vom gemalten Himmel der Saaldecke schwebte eine Wolke heran, darauf ein goldenes Ei, das sich öffnete. Ein überirdisches Wesen kam zum Vorschein, halb Vogelküken, halb Engel, und doch deutlich erkennbar ein wunderschöner Knabe.
Leonardo zwirbelte vor Aufregung an seinem goldblonden Bart, in den sich in letzter Zeit ein paar silberne Fäden gestohlen hatten. Nicht das erste Zeichen, dass er älter wurde. Leonardo da Vinci war sich durchaus der Zeit und seiner Endlichkeit bewusst. Trotzdem stieg er, als sei er nicht zweiundvierzig Jahre alt, sondern so jung wie Salai, die verborgene Leiter wieder hinunter und verfolgte, wie die Wolke sich weiter senkte und schließlich einige Ellen über dem Boden verharrte. Glücklicherweise hatte sich Ludovico Sforza gemerkt, was Leonardo ihm eingeschärft hatte, sich nämlich zu Beginn des Spektakels gemeinsam mit seiner Gattin zu dem Marmorstern in der Mitte des Saals zu begeben, und so konnte Salai ihn mühelos mit dem vergoldeten Lorbeerkranz krönen und der Fürstin das kostbare Diadem ins Haar stecken, das den Herrscher ein kleines Vermögen gekostet hatte.
So weit, so gut. Leonardo eilte zurück auf den Schnürboden, gab Instruktionen, die Wolke wieder elegant einzuholen, und während der junge Phönix, der sich aus der Asche erhoben hatte, echte Goldstücke über die Festgesellschaft regnen ließ, betätigten sechs Mann die Winden, um Leonardos Gehilfen, der sich im Vorfeld zweifelsohne schon seine eigenen Taschen mit Gold vollgestopft hatte, zurück auf das Gerüst zu ziehen.
»Das war …« Die Markgräfin von Mantua rang sichtlich um Worte, so begeistert schien sie. Und dies war bemerkenswert, denn die junge, resolute Herrscherin führte in Abwesenheit ihres Mannes, der als Militärkommandeur im Dienst der Republik Venedig stand, das kleine Herzogtum souverän und mit fester Hand.
»Wenn mein kleines Intermezzo gefallen hat, bin ich ein glücklicher Mensch«, half ihr Leonardo bescheiden aus und machte eine tiefe Verbeugung.
»Leonardo da Vinci, du bist ein außerordentlicher Impresario«, fuhr die Markgräfin fort. »Und doch halte ich deine Talente bei dieser Art von Zerstreuung für verschwendet.« Leonardo, der ahnte, worauf Isabella d’Este hinauswollte, verbeugte sich ein weiteres Mal und überlegte, wie er ihr am besten entkommen konnte. »Denn deine wahre Berufung liegt in der Malerei. Habe ich recht?«
»Durchaus«, pflichtete Herzogin Beatrice, ihre Schwester, ihr bei, die soeben zu ihnen getreten war. »Auch wenn das Spektakel hinreißend war. So beeindruckend. Mir ist schier das Herz stehen geblieben, als der Vogel in Flammen aufging.«
»War das nicht gefährlich?«, erkundigte sich ein Edelmann aus dem Gefolge der Markgräfin von Mantua in vorwurfsvollem Ton.
»Oh nein«, beruhigte ihn Leonardo. »Der Anzug des Reiters und die Schabracke des Pferdes waren mit einer nicht entflammbaren Substanz getränkt. Und was den Saal anbelangt, so lagen in allen seitlichen Türen Löschschläuche bereit.«
»Aber all die Funken?« Offenbar hatte dieser Gast mehr Angst gehabt als die Frauen.
»Es gab keine Funken«, erklärte Leonardo ihm freundlich. »Alles, was Ihr dafür hieltet, war goldener Flitter dramatisch in Szene gesetzt.«
»Du solltest ein Bildnis von mir malen.« Nun hatte es die Markgräfin doch noch geschafft, ihr Anliegen vorzubringen. Leonardo setzte ein unverbindliches Lächeln auf, um nicht unhöflich zu wirken. Herausfordernd blickte Isabella d’Este ihn an. Ihre himmelblauen Augen funkelten. »Wäre das nicht eine reizvollere Aufgabe, als diese …«, sie warf ihrer Schwester, der Gastgeberin, einen kurzen Blick zu, »… diese Konkubinen gewisser Herrscher zu porträtieren?«
Um sie herum wurde es auf einmal sehr still. Beatrice war bleich geworden, Leonardo empfand aufrichtiges Mitleid mit der jungen Frau. Mit nicht einmal zwanzig Jahren hatte sie dem Herzog bereits einen Sohn geboren und war erneut schwanger. Sie war sechzehn gewesen, als man sie Ludovico zur Frau gegeben hatte, der leicht ihr Vater hätte sein können. Eine strategische Heirat, wie so oft. Und ja, vor wenigen Jahren hatte Leonardo die wunderschöne und ebenfalls blutjunge Cecilia Gallerani gemalt, nach der Il Moro geradezu verrückt gewesen war, und das Gemälde war so unkonventionell wie vollkommen geraten, dass man in ganz Italien von diesem unerhörten Porträt sprach. Man nannte es die DAMEMITDEMHERMELIN.
»Nun, liebe Schwester«, warf Beatrice ein, die sich offenbar wieder gefangen hatte. Sie hatte nach ihrer Eheschließung höchstpersönlich dafür gesorgt, dass Cecilia den Palast verlassen musste. »Du wirst dich wohl kaum mit einem Nagetier abbilden lassen wollen.«
»Der Hermelin ist nicht irgendein Tier«, ließ sich Leonardo hinreißen, einzuwenden. »Er ist klug und mutig, und sein Wahlspruch lautet: Lieber sterben, als besudelt zu werden.« Außerdem hatte Ludovico im selben Jahr den Hermelinorden verliehen bekommen, also war das schöne Tier, dessen weißes Fell zu tragen sich keine dieser edlen Damen zu schade war, ein Sinnbild des Herzogs. Aber warum ließ er sich auf Diskussionen ein?
»Nein, mir schwebt ein großer Auftrag vor«, erklärte Isabella d’Este. »Ein offizielles Hofporträt, kein schlichter Zeitvertreib.«
Leonardo stockte der Atem. Schlichter Zeitvertreib? Hatte er richtig gehört? Nein, diese Frau würde zweifellos kein Bild von ihm bekommen. Offizielle Hofporträts konnten all die anderen Künstler malen, die keine Einwände dagegen hatten, sich bei der Darstellung der Markgräfin mit der Etikette und den höfischen Traditionen abzumühen. Was Leonardo bei der Arbeit an Cecilias Bild so außerordentlich genossen hatte, war die Freiheit, die Geliebte des Herzogs so darstellen zu können, wie es ihm seine Intuition eingab, und damit etwas noch nie zuvor Gesehenes zu erschaffen. Denn alles an diesem Bild war neu: die Haltung, die überraschende Drehung des Kopfes, der Blick, der weder auf den Betrachter gerichtet war noch, wie auf den traditionellen Hochzeitsbildern üblich, im strengen Profil in die Ferne ging. Die Dame mit dem Hermelin richtete ihre sanften, braunen Augen auf jemanden, der rechts neben dem Betrachter zu stehen schien, und zwar fast über ihre Schulter hinweg, so als hätte man sie gerufen, und selbstverständlich folgte das Tier auf ihrem Arm diesem Blick. Wer nicht verstand, was ihm da gelungen war, wie tief er dem Mädchen in die Seele geblickt hatte – mit solchen Leuten sollte er nicht diskutieren. Und malen würde er so jemanden schon gar nicht. Niemals. Für kein Geld dieser Welt.
»Du wirst uns hoffentlich nicht unseren wundervollen arbiter elegantiae abwerben wollen, verehrte Schwägerin?«
Der Herzog war zu ihnen getreten, und Leonardo musste schmunzeln, als er ihn so reden hörte. Schiedsrichter in Fragen des guten Geschmacks nannte er ihn – das klang durchaus nicht nach dem Spross eines condottiere, dem Anführer eines Söldnerheers, denn nichts anderes war Ludovicos Vater gewesen, ehe er die Visconti vertrieben und sich selbst des Herzogtums Mailand bemächtigt hatte. Erst vor kurzem, nachdem der letzte Erbe der Visconti unter mysteriösen Umständen im Alter von vierundzwanzig Jahren verstorben war, hatte sich Ludovico offiziell den Titel des Herzogs angeeignet, und zwar mithilfe von Charles VIII., dem französischen König, den er ins Land gerufen hatte und dessen Armee gerade in Rom einmarschierte, nachdem er die Toskana und schließlich Florenz unterworfen hatte. Ob Ludovico sich damit langfristig die Herrschaft über Mailand würde sichern können? Oder würde Charles auf seiner Rückkehr nicht auch noch dieses Herzogtum unter seine Gewalt bringen, trotz aller Verträge, die womöglich das Papier nicht wert waren, auf dem sie geschrieben standen? Das war keineswegs ausgeschlossen, und Ludovico spielte mit dem Feuer.
»Oh nein, mein Schwager«, gab Isabella d’Este lachend zurück. »Beratung in gutem Geschmack hab ich sicherlich nicht nötig. Allerdings wünsche ich mir sehr ein Porträt von des Meisters Hand.«
Ludovico betrachtete Leonardo aus seinen kleinen, schwarzen Augen und runzelte die Stirn. »Er ist beschäftigt«, sagte er kühl. »Wir haben große Pläne mit unserem lieben Leonardo. Eine Wand im Refektorium von Santa Maria delle Grazie wartet darauf, von ihm dekoriert zu werden. Hat er damit überhaupt schon begonnen? Und da wir davon sprechen – schuldet er mir nicht noch ein Marienbild?« Der Herzog sprach tadelnd, so als handele es sich um ein paar neue Stiefel, die der Schuster noch immer nicht angefertigt hatte. »Ich wollte es längst dem König von Ungarn geschickt haben.«
Leonardo, der mit dem Marienbild noch nicht einmal begonnen hatte und im Grunde auch nicht vorhatte, das zu tun, denn es war mehr als fraglich, ob er dafür bezahlt werden würde, machte eine elegante Verbeugung. »Gewiss«, sagte er sanft. »Alles zu seiner Zeit. Zuerst werden wir endlich das Reiterstandbild in Bronze gießen, auf das Eure Hoheit schon so lange warten.« Schließlich war das Tonmodell seit über einem Jahr fertig. Es stand im Schlosshof und war mit seinen gut sieben Metern Höhe zu einer der größten Attraktionen Mailands geworden. Und an Isabella d’Este gewandt fügte er hinzu: »Habt Ihr das Modell gesehen?«
Das hatte sie nicht, und Leonardo erklärte sich gern bereit, es ihr am folgenden Morgen zu zeigen.
Es war noch früh, als Leonardo am nächsten Tag durch die Zimmerfluchten des Cortile Vecchio schritt. Der riesige, an die vierhundert Jahre alte Palastkomplex, einst von den Visconti-Herzögen bewohnt, hatte seit Generationen leergestanden, ehe Leonardo mit seinem Tross an Gehilfen hier eingezogen war. Ludovicos Vater Francesco Sforza hatte bei seiner Machtübernahme die Fortalezza di Porta Giovia zu seinem Herzogssitz gemacht, eine ursprünglich kleine Festung an der nördlichen Stadtmauer. Nach und nach hatten die neuen Machthaber sie mit Geschmack großzügig ausbauen lassen, während der alte Palast der Visconti dem Verfall preisgegeben wurde. Bei seiner Ankunft in Mailand war Leonardo und seinen Mitarbeitern dieses alte Gemäuer aus dunkel gebranntem Ziegelstein als Wohnung und Arbeitsplatz angeboten worden, und gleich bei der ersten Besichtigung hatte er die Möglichkeiten erkannt, die ihm dieses verwahrloste Gebäude bot. Vor allem fanden sie in dem alten Visconti-Palast Platz im Überfluss, auch wenn sie zunächst ein Heer von Ratten vertreiben mussten und es notwendig war, den Flügel, den sie benutzen wollten, nicht nur vom Schmutz, sondern darüber hinaus von verblichenen und von Motten zerfressenen Vorhängen, zerbrochenem Mobiliar und halb von den Wänden hängenden Stofftapeten zu befreien. Hier in den schier endlosen Fluchten aus verschiedenen Sälen, aus einstmals prunkvollen Privatgemächern, Küchen, Ställen und sogar einem großen und einem kleineren Theatersaal gab es Raum für die vielen Dinge, die Leonardo durch den Kopf gingen. Noch nie hatte ihm so viel Platz zur Verfügung gestanden. Platz für seine Träume und Visionen.
In dem Gebäudetrakt, in dem seine Gefährten untergebracht waren, sah er gerade noch eine Gestalt davonhuschen. Leonardo musste schmunzeln. War das nicht Fiametta gewesen, eines der Modelle, die in der Malerwerkstatt ein- und ausging? Welcher seiner Gehilfen wohl der Glückliche war, der ihre Gunst errungen hatte? Vermutlich Marco, von dem die Mädchen die Augen nicht wenden konnten. Oder war sie bei Franco gewesen, den alle nur Il Neapolitano nannten?