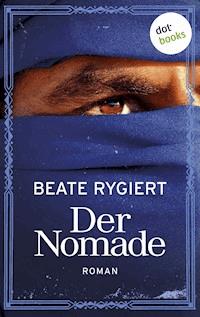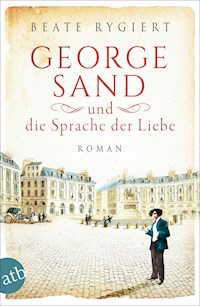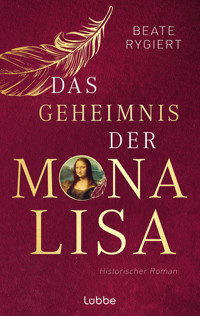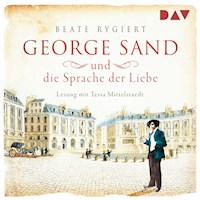6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch zu lesen ist die schönste Art, sich sein Herz stehlen zu lassen!
Tobias’ Buchantiquariat läuft nicht besonders gut, noch dazu hat er gerade eine schmerzliche Trennung hinter sich. Als er im Urlaub einen liebenswerten spanischen Straßenhund aufliest, beschließt er kurzerhand, ihn mit nach Heidelberg zu nehmen. Wie sich herausstellt, hat Zola die Gabe, für jeden Menschen die richtigen Bücher zu finden – denn in jedem »Herzensräuber« erschnuppert er die Gefühle, die die bisherigen Leser darin hinterlassen haben. So bringt er nicht nur Tobias’ Geschäft auf Vordermann, sondern nach und nach auch dessen chaotisches Liebesleben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Tobias’ große Leidenschaft sind Bücher, doch sein kleines Antiquariat läuft nicht besonders gut. Viel zu oft lässt sich der gutmütige junge Mann von seinen Kunden als Tauschbibliothek ausnutzen. Noch dazu hat ihn gerade seine Freundin Vanessa verlassen. Im Urlaub in Spanien, wo Tobias Abstand von seinen Sorgen gewinnen will, begegnet er einem liebenswerten Straßenhund und beschließt kurzerhand, ihn mit nach Heidelberg zu nehmen. Zola war einst der treue Begleiter des Postboten, doch seit dessen Tod musste er sich allein durchschlagen. Nichts wünscht er sich sehnlicher, als einen neuen Menschen zu finden. Als Tobias den Hund zum ersten Mal mit in sein Buchantiquariat nimmt, stellt sich heraus, dass Zola die Gabe hat, für jeden Menschen die richtigen Bücher zu finden – denn in jedem »Herzensräuber« erschnuppert er die Gefühle, die die bisherigen Leser darin hinterlassen haben. So bringt er nicht nur Tobias’ Geschäft auf Vordermann, sondern nach und nach auch dessen chaotisches Liebesleben …
Autorin
Beate Rygiert studierte Theater-, Musikwissenschaft und italienische Literatur in München und Florenz und arbeitete anschließend als Theaterdramaturgin, ehe sie den Sprung in die künstlerische Selbstständigkeit wagte. Nach Studien an der Kunstakademie Stuttgart, der Filmakademie Ludwigsburg und der New York Film Academy schrieb sie Bücher und Drehbücher, für die sie renommierte Preise wie den Würth-Literaturpreis und den Thomas-Strittmatter-Drehbuchpreis erhielt. Beate Rygiert reist gern und viel und hat eine Leidenschaft für gute Geschichten. Zu Hause ist sie im Schwarzwald und in Stuttgart. Herzensräuber ist ihr erster Roman bei Blanvalet.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Beate Rygiert
Herzensräuber
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text
enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt
der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten.
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss.
Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe
Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Das Zitat in Kapitel 14 stammt aus: Marcel Proust, In Swanns Welt. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 1. Übersetzt von Eva Rechel-Mertens. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1981
Das Zitat in Kapitel 19 stammt aus dem Klappentext zu: Marie Mannschatz, Buddhas Anleitung zum Glücklichsein: Fünf Weisheiten, die Ihren Alltag verändern. Gräfe und Unzer, München 2016
Umschlaggestaltung und -abbildung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
AF · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-20289-7V001
www.blanvalet.de
Für Cookie,
die mich zu einem besseren Menschen machte
1
Der neue Mensch
Ich träume …
Wohlig recke ich mich seiner Hand entgegen, damit er mich dort kraulen kann, wo es am schönsten ist: am Bauch, an der Brust und in den Beugen meine Vorderläufe. Weich und warm liege ich in meinem Körbchen, meine Welt ist in Ordnung, auch wenn mein Magen knurrt, denn ich weiß, es dauert nicht mehr lange, dann füllt er mein Schälchen auf. Schon jetzt strömt mir der Speichel ins Maul. Nur noch eine kleine Weile so daliegen, mich der Streichelhand hingeben, den Augenblick genießen. Aber was stößt mich denn da so unsanft in die Seite, wieder und wieder? Das kann nicht mein Mensch sein, ganz unmöglich! Und während die Tritte heftiger werden, verblasst seine Gegenwart, und mit dem Erwachen fällt die Wirklichkeit wieder über mich her. Ich liege in der Höhle über der Brandung, das Körbchen ist für immer verloren, denn mein erster Mensch ist nicht mehr.
Der Morgenwind weht die Neuigkeiten des noch jungen Tages herein. Da ist ein Geruch, ein bestimmter, der mich hellwach werden lässt, während die Tritte gegen meine abgemagerten Rippen immer heftiger werden. Es ist natürlich Tschakko, der Anführer des Rudels, dem ich mich angeschlossen habe, nachdem ich mein Zuhause verlor. Er will, dass ich die Kuhle räume. Es ist das einzige mit Sand gefüllte Lager in dieser verdammten Höhle, die ansonsten uneben ist und kantig. Ich denke nicht daran, diesen bequemen Platz aufzugeben. Schon gar nicht wegen Tschakko. Ich ziehe meine Lefze hoch, gerade so weit, dass mein Eckzahn zum Vorschein kommt, und werfe ihm einen gefährlichen Blick aus halb geöffneten Lidern zu. Aus den Tiefen meiner Brust lasse ich ein Knurren erklingen, das jedem vernünftigen Hund die Haare zu Berge stehen ließe.
Hörst du das, Tschakko? So klingt das bei einem echten Macho.
Er weicht zurück. Na bitte. Noch ein paar Tage, und das Rudel wird ihm den Rücken kehren und mir folgen, falls ich es darauf anlege. Als ob mir daran etwas gelegen wäre. Ich bin kein Rudelhund. Ich bin ein Menschenhund.
Da ist er wieder, dieser Duft. Unverkennbar nach Mensch. Auch Tschakko hat es bemerkt. Mein Herz beginnt wie wild zu pochen. Es ist sein Duft. Doch das ist nicht möglich, ich weiß es. Er hat aufgehört zu sein, der Tod hat ihn von innen zerfressen, langsam und unaufhörlich. Ich wusste es, lange bevor er es ahnte. Die Menschen sind so hilflos. Sie wissen so wenig. Ihr Geruchssinn ist besorgniserregend. Und doch sind sie mächtig. Wir gehören zusammen, Mensch und Hund. Nur gemeinsam können wir das Leben meistern.
Doch woher nur kommt sein Geruch? Ich hebe den Kopf und sauge die Luft ein. Schnüffle, wittere. Schmecke sie ganz hinten in meiner Kehle. Tschakko hat kein Interesse mehr an meiner Kuhle, und so kann auch ich ohne Ehrverlust aufstehen, zum Rand der Höhle gehen, dem Geruch folgen. Mit einem Stich der Enttäuschung muss ich mir eingestehen: Es ist nicht der Duft meines ersten Menschen. Er ist seinem nur ähnlich. Sehr ähnlich. Und je mehr ich von ihm in der Nase habe, auf der Zunge und an meinem Gaumen schmecke, desto aufgeregter werde ich. Doch auf einmal ist er verschwunden. Weg. Der Wind hat ihn fortgeweht. War er überhaupt da, oder habe ich auch ihn nur geträumt?
Ich stehe am Rand der Höhle, spitze die Ohren und sondiere die Lage: Da sind die üblichen Morgengeräusche von Pepes Bar dort hinten, ganz am anderen Ende des ewig weiten Strandes, und der ekelhafte Geruch nach dieser schwarzen Brühe, die Menschen dort so gerne trinken. Ich orte außerdem Zigarettenrauch und stelle bedauernd fest, dass Pepe heute offenbar eine ganz besonders miese Laune hat, die er aus jeder einzelnen seiner Poren verbreitet. Dass auch Pilar bereits in der Küche ist, höre ich an der Art, wie mit Geschirr geklappert wird, auch sie hat heute keinen guten Tag.
Ein Lieferwagen nähert sich. Am Motorengeräusch erkenne ich, wem der gehört, und ich weiß auch, was er geladen hat. Sein Besitzer war ein Freund meines ersten Menschen. Wir haben ihm die Post gebracht, und fast immer haben sich die beiden gemeinsam auf die Bank vor seinem Haus gesetzt, um bei einer Zigarette ein bisschen zu plaudern. Ob er sich daran noch erinnert? Meine Eingeweide ziehen sich schmerzhaft zusammen, seit Tagen habe ich nichts Vernünftiges mehr gefressen. Seit Felipe tot ist, will mich keiner mehr kennen. Ein Hund ohne Mensch ist nämlich nichts wert.
Mit ein paar Sätzen bin ich unten am Strand. Vielleicht fällt heute etwas für mich ab? Das Motorengeräusch erstirbt, die Heckklappe wird geöffnet, und mir wird ganz flau: Eine Kiste voll mit duftendem fangfrischem Fisch wird in Pepes Küche getragen. Makrelen! Während ich mir noch einen Plan zurechtlege, wie ich Pepe davon überzeugen könnte, mir die Abfälle zu überlassen, haben es auch Tschakko und die anderen Köter bemerkt. Wie eine wilde Meute jagen sie an mir vorbei. Sollen sie doch rennen, die dummen Tölen. Es ist viel zu weit. Sie werden die Bar nicht rechtzeitig erreichen, das Fischauto wird längst wieder fort sein, die Kiste in Pepes Kühlschrank verschwunden. Alles, was sie mit ihrem aufdringlichen Getue ausrichten werden, ist, dass Pepe wütend wird und uns alle verjagt. Diese Strandhunde haben einfach keinen Stil.
Verärgert wende ich mich ab. Ich schnüffle hier und dort an einem leeren Plastikbecher, einem vom Wind verwehten Einwickelpapier. Eine große Trostlosigkeit überfällt mich. Ich lecke ausgiebig die rechte Vorderpfote, mit der ich gestern in eine scharfe Muschel getreten bin. Was soll nur aus mir werden?! Ich habe es so satt, Mülleimer nach Essbarem zu durchsuchen und aus schmutzigen Drecklachen zu trinken, von denen man Bauchweh bekommt. Ich bin nicht geschaffen für dieses Streunerleben. Ich brauche dringend einen neuen Menschen.
Und auf einmal ist er wieder da, der Duft. Es ist ein Mann, und er kann nicht weit entfernt sein. Sein Geruch ist freundlich, aber auch ein bisschen traurig. Ich kenne das. Mein erster Mensch war genauso. An dieser Art Kummer ist immer eine Frau schuld.
Er kommt aus der Richtung des Leuchtturms den Strand entlanggeschlendert. Noch hat er mich nicht bemerkt. Jetzt heißt es, auf der Hut zu sein. Gut, dass Tschakkos Meute an Pepes Strandbar beschäftigt ist. Nicht auszudenken, wenn sie sich jetzt auf diesen Menschen hier stürzen würden. Ich versuche, genauso gelassen zu schlendern wie er. Aus Erfahrung weiß ich, dass es gut ist, die Bewegungen der Menschen zu imitieren. Er bleibt stehen und sieht hinaus aufs Meer? Ich tue dasselbe, auch wenn dort außer Wasser und Wellen nicht viel zu sehen ist. Ich halte die Nase in die Brise, es riecht nach Algen und nach den Motoren der Fischerboote, nach Abfällen, die vor Tagen ins Meer geworfen und hier angeschwemmt wurden. Wenn es einer wissen wollte, könnte ich ihm erzählen, wer gestern hier an welcher Stelle saß und dass dort hinter den angeschwemmten Planken ein Liebespaar heute Nacht beieinanderlag. Jeder hat seine Markierung hinterlassen inklusive seiner Gefühlsfarben, bis ins kleinste Detail. Ich weiß genau, welche Dramen sich an diesem Ort abgespielt haben und wer hier glücklich war. Aber mich fragt ja keiner …
Jetzt hat er mich gesehen. Mein Herzschlag setzt kurz aus. Doch in seinen Duft mischt sich keine Angst, keine Abwehr. Weder stockt sein Schritt, noch weicht er aus. Sein Duft sagt: Ich bin erfreut, dich zu sehen. Er sagt: Was bist du für einer?
Ich bin der, den du an deiner Seite brauchst, denke ich und gehe weiter langsam auf ihn zu. Mein Schwanz wedelt heftig. Mein Herz schlägt schneller. Dieser Mensch riecht so unverhofft wunderbar, nach Freundschaft, nach einem Zuhause.
Als uns nur noch wenige Hundelängen voneinander trennen, bleibt er stehen. Sofort verharre auch ich. Langsam geht er in die Knie und streckt die Hand aus. Nach mir? Ja, nach mir! Ist es eine Einladung? Es ist eine Einladung! Vorsichtig setze ich meine wunde Pfote auf und verfolge aufmerksam jede seiner Regungen. Dann stehe ich vor ihm. Meine Schnauze berührt fast seine ausgestreckte Hand. Tief sauge ich ihr Aroma ein. Wie wohl das tut. Es ist ein guter Geruch. Ein liebevoller Geruch. Ein Geruch mit Zukunft …
Er hebt die Hand über meinen Kopf, und ich weiche unwillkürlich zurück. Ich will es nicht, doch es ist stärker als ich. Zu oft in den letzten Wochen haben mich Menschenhände geschlagen. Ich will mich vor dieser Hand nicht wegducken, ich weiß, dass sie mich nicht schlagen wird. Doch ich kann nicht anders.
Er hat es verstanden, murmelt beruhigende Worte. Die Hand senkt sich wieder, und er dreht sie um, formt sie zu einer Schale. Ganz sachte mache ich mich lang und lege meinen Kopf in diese Schale. Dabei blicke ich ihm in die Augen, unverwandt, ohne zu blinzeln. Er hat gute Augen, und er schaut nicht weg. Er hält den Blick, ich fühle an meiner Kehle das Blut in seiner Hand pulsieren, sehe, wie seine Pupillen weich werden und weit. Ich sehe ihn lächeln und höre ihn freundliche Worte sagen und wünsche mir, dass dieser Augenblick niemals vergeht. Ich blicke ihm in die Augen und denke, so intensiv ich nur kann: Sei mein Freund. Und: Wir gehören zusammen. In seinen Geruch mischt sich eine neue Note. Und ich bin sicher: Er hat mich verstanden.
In diesem Moment bricht die Hölle über uns herein. Tschakko und seine Meute haben uns entdeckt. Kläffend umtanzen sie uns, Lili erdreistet sich gar, an meinem neuen Menschen, der sich erschrocken erhoben hat, emporzuspringen wie ein irre gewordener Vollgummiball. Mit aufgestelltem Nackenhaar fahre ich dazwischen, dass der Bande Hören und Sehen vergeht. Sie sind zu sechst, doch die Gegenwart des neuen Menschen verleiht mir Riesenkräfte. Meine Zähne erwischen Tschakkos schlappes Ohr, jetzt ist es auch noch geschlitzt, Blut fließt, das hat er davon. Lili ziehe ich mit der Pfote eins über, was sie nicht so schnell vergessen wird. Die anderen halte ich mit meinem gefährlichsten Kampfgebell in Schach. Tschakko versucht noch einen halbherzigen Angriff von der Seite, doch ich belehre ihn eines Besseren, und er zieht sich jaulend zurück. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt und hier die Führung über die Bande übernehmen. Doch ich habe andere Pläne. Schützend stelle ich mich vor meinen neuen Menschen, den Schwanz steil nach oben gerichtet, das Fell gesträubt.
Tschakko tut so, als interessiere ihn das alles gar nicht mehr, er schnüffelt hier, schnuppert dort, dann trollt er sich. Die anderen folgen ihm. Na bitte. Was habe ich gesagt?
Zufrieden wende ich mich meinem neuen Menschen zu. Der blickt mich nachdenklich an. Kratzt sich am Kopf und sieht der geschlagenen Truppe hinterher. Er sagt etwas, und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Lob ist.
Als er seinen Weg fortsetzt, folge ich ihm in respektvollem Abstand. Bei den Menschen weiß man nie. Einmal habe ich meinem ersten Menschen ein Kaninchen vor die Füße gelegt, das ich extra für ihn erjagt hatte. Damals kannte ich keinen größeren Liebesbeweis, als meinem Herrn ein Kaninchen zu bringen. Doch irgendwie muss er es falsch verstanden haben. Statt sich zu freuen, schien er bestürzt. Und statt es zu fressen, vergrub er die Beute in der Erde. Darüber habe ich lange nachgegrübelt und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen in der Tat merkwürdige Wesen sind. Manche ihrer Regeln sind einfach nicht zu verstehen. Doch das macht nichts. Ich liebte ihn trotzdem. Und das ist schließlich alles, was zählt.
Jetzt bleibt der neue Mensch stehen und setzt sich in den Sand. Ob auch er mich schon liebt? Ich tue es bereits mit jeder Faser meines Hundewesens.
Und darum setze ich mich leise neben ihn. Er braucht mich, wer sonst sollte ihn beschützen? Das Meer sieht ruhig aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass von dort je Gefahr gekommen wäre. Doch vielleicht weiß dieser Mensch ja etwas, das mir entgeht. Und darum behalte ich, genau wie er, den Horizont im Auge. Für alle Fälle. Man kann nie wissen.
Irgendwann wandert seine Hand meinen Rücken hinauf zu meinem Genick. Ich schließe die Augen und genieße die Berührung. Als seine Finger meine Ohrwurzeln erreichen und mich hier sacht kraulen, halte ich ganz still, und jedes Denken hört auf.
Irgendwann steht er auf, klopft sich den Sand von der Hose. Auf einmal ist sie wieder da, die Angst, er könnte mich davonjagen. Oder einfach weggehen. Ob ich ihm dann folgen darf?
Er geht ein paar Schritte, und das Herz wird mir schwer. Da wendet er sich um.
»Komm!«, sagt er. Es ist das erste Wort von ihm, das ich verstehe, denn er spricht in einer seltsamen Sprache, er ist nicht von hier.
»Komm mit!«
Seine Hand macht eine eindeutig einladende Bewegung. Im Nu bin ich an seiner Seite, entschlossen, nie wieder von ihr zu weichen.
2
Der neue Name
Mein neuer Mensch geht mit mir zu Pepes Strandbar. Unerschrocken folge ich ihm zu einem der Tische und lege mich ihm zu Füßen, schlage die Vorderpfoten übereinander und bette betont gelassen meinen Kopf darauf. In dieser Position verfolge ich aus halb geschlossenen Lidern, wie Pepe mit gerunzelter Stirn zu uns herüberstapft. Er duldet keine Hunde in seinem Cafébereich, und ohne meinen neuen Menschen hätte ich mich nie im Leben hierhergewagt. Er ist nicht gut auf Tschakkos Meute zu sprechen, und das kann ich ihm auch nicht verdenken. Doch ich gehöre nicht zu denen, eigentlich müsste er das sehr wohl wissen, schließlich haben mein erster Mensch und ich ihm viele Jahre lang die Post gebracht.
Pepe baut sich vor mir auf und stemmt die Fäuste in die Seiten. Ohne auch nur den Kopf zu heben, bohre ich ihm meinen schönsten Blick in die Pupillen. Erinnerst du dich nicht mehr?, denke ich eindringlich. Ich bin ein guter Hund. Wir haben dir deine Briefe gebracht!
Es wirkt: Pepe hält inne und stutzt. Er öffnet zwar den Mund, doch ehe er etwas sagen kann, spricht mein neuer Mensch:
»Wasser für den Hund, bitte«, sagt er. »Café con leche und eine Tostada für mich.«
Pepe klappt den Mund wieder zu. Er wirft mir noch einen drohenden Blick zu, dann verschwindet er in der Küche. Welch ein Sieg! Doch ich bleibe auf der Hut.
Als Pepe den Kaffee bringt und mir einen Eimer voll Wasser vor die Schnauze knallt, der nach eingelegten Oliven stinkt, wird er auf einmal gesprächig.
»Das ist der Hund von unserem Postboten«, erklärt er meinem neuen Menschen, während sein Lappen ein paar Krümel vom Tisch fegt.
»Ach«, sagt der, und seine Stimme klingt enttäuscht, »er hat also doch ein Zuhause?«
Pepe betrachtet mich nachdenklich, schüttelt den Kopf und kratzt sich hinterm Ohr.
»No Señor«, sagt er betrübt. »Felipe ist tot. Im Frühjahr gestorben.«
Beim Klang seines Namens wird mir schwer ums Herz. Ich kann nicht anders, ich lasse die Ohren hängen und fühle wieder mein ganzes Elend.
»Das heißt«, sagt der neue Mensch entsetzt, »so lange schon lebt der arme Hund am Strand? Kein Wunder ist er so dürr.«
Das ist Pepe nun doch zu viel.
»Hunde können selbst für sich sorgen«, sagt er barsch und räumt scheppernd eine leere Tasse vom Nachbartisch, dass ich zusammenfahre. Menschen können so grob sein. Und ständig machen sie einen solchen Lärm.
Sag, denke ich, so intensiv ich kann, in Pepes breiten Rücken hinein, dass ich ein guter Hund bin. Sag ihm, dass er mich ruhig aufnehmen kann.
Und wirklich, Pepe hält inne, wendet sich um und sagt: »Aber wenn Sie einen Hund gebrauchen können, Señor, dann machen Sie mit dem hier keinen Fehler.«
Sag es!, beschwöre ich ihn stumm.
»Er ist ein guter Hund!«, tönt es tatsächlich aus Pepes Mund. Und wenn ich nicht wüsste, wie verschreckt die Menschen darauf reagieren, würde ich jetzt vor Glück heulen wie ein Wolf.
7 7
Mein neuer Mensch führt mich zu einem der Häuser, die gleich hinter der Strandpromenade aneinandergereiht sind wie die Zähne im Gebiss eines Hundes. Hier wohnen, seit die Tage länger und wärmer geworden sind, die Fremden, die kommen und gehen und an die man sein Herz nicht hängen soll. Im Winter sind die Rollläden geschlossen, und der Wind pfeift durch die Vorgärten, zerzaust die Palmblätter und reißt den lilafarbenen Hecken die letzten Blüten vom Kopf. Doch im Sommer ist jedes der Häuser bewohnt, und zwischen ihnen und dem Strand herrscht reger Betrieb.
Ich kann mich nicht erinnern, dass Felipe und ich jemals Briefe hierhergebracht hätten, und für Tschakkos Bande ist dieser Bereich sowieso tabu. Dafür sorgt Señor Pizzarro, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Señor Pizzarro hasst Hunde. Er war es auch, der im vergangenen Sommer, als meine Welt noch in Ordnung war, vergiftete Fleischstücke am Strand verteilte, auch wenn er es bis heute abstreitet. Ich kenne mindestens fünf Hunde, die er auf dem Gewissen hat, und keiner hätte je darüber gesprochen, wäre nicht auch das winzige Schoßhündchen von Doña Maria Assunta gestorben, das bestimmt stets einen gefüllten Napf hatte und es gewiss nicht nötig gehabt hätte, am Strand vergammeltes Fleisch zu fressen. Doña Maria Assunta machte ein Riesentheater, Señor Pizzarro kaufte ihr einen neuen Köter, und damit war die Sache vom Tisch. Ich aber mache seither einen großen Bogen um diesen Mann. Zum Glück eilt ihm ein starker, hässlicher Geruch voraus, sodass man sich rechtzeitig in Sicherheit bringen kann.
Die Versuchung, sich trotz aller Gefahr in diese Siedlung zu wagen, ist aber einfach zu groß, vor allem dann, wenn man sehen muss, wie man allein durchs Leben kommt. Mitunter kannst du hier nämlich Glück haben, und jemand stellt dir ein Schälchen mit sauberem Wasser vors Tor oder schenkt dir einen Keks, ein Würstchen oder ein Stück altes Brot. Sind Kinder beteiligt, ist Vorsicht geboten. Manche sind nett, aber es gibt auch Biester, die gerne ausprobieren, ob sie dir ein Ohr abreißen können, oder sie finden es lustig, dir einen Luftballon an den Schwanz zu binden. Manchmal auch eine Blechdose, wie es Lili passiert ist. Vielleicht ist deswegen so ein Springteufel aus ihr geworden, wer weiß.
Manche Fremde gehen sogar extra in den Supermercado und kaufen für dich ein, was aber noch lange nicht heißt, dass sie dich am Ende nicht einfach zurücklassen, als wärst du einer dieser Beutel, prall gefüllt mit Müll. Eines Tages kommst du hin, und sie sind einfach weg. Aus dem Abfall duftet es nach den leeren Futterdosen, und außer der Erinnerung, einem knurrenden Magen und der Sehnsucht nach einem richtigen Zuhause bleibt dir nichts. Denn die Fremden kommen und gehen, wenn du Glück hast, bescheren sie dir ein paar Mahlzeiten. Aber einen richtigen Freund fürs Leben, den wollen sie nicht.
Ob mein neuer Mensch es ernst mit uns meint? Ob er weiß, dass ich hier eigentlich überhaupt nicht sein darf? Dass Señor Pizzarro einen Tobsuchtsanfall bekommen würde, könnte der sehen, dass er mir gerade die Gittertür aufhält und ich rasch hineinhusche? Hat er die geringste Ahnung, dass ich damit eine magische Grenze überschreite?
Ich überschreite auch gleich die nächste und folge ihm ins Haus. Hier ist es kühl und schattig. Die Geruchslandschaft ist klar und überschaubar: Hier wohnt mein neuer Mensch, sonst niemand. In der Küche dominiert der Gestank nach einer ganzen Meute Putzmitteln, lediglich zum Kühlschrank zieht mich eine verführerische, feine Spur nach rohem Fleisch. In den Polstermöbeln des Wohnzimmers hängen übereinandergeschichtet die Gerüche der vorherigen Familien. Am frischesten ist die Note meines neuen Menschen, vor allem auf einem bestimmten Sessel. Auf dem Tisch daneben schnuppere ich interessiert an zwei Stapeln seltsamer Gegenstände herum, die den Zigarrenkisten meines ersten Menschen ähneln. Nur dass sie überhaupt nicht nach Zigarren stinken, nicht ein kleines bisschen. Sie riechen nach … Menschenhänden, altem und neuem Menschenschweiß. Und nach den unterschiedlichsten Gefühlen …
Die Tür zum Schlafzimmer steht offen. Mein neuer Mensch holt eine Decke aus dem Schrank und legt sie im Wohnzimmer neben seinen Sessel. Er formt ein schönes Nest aus der Decke, so als hätte er nie etwas anderes getan. Er lächelt mich an. Doch noch ehe ich mich in dieses einladende Nest legen kann, hat er eine andere Idee.
Er geht ins Badezimmer, und augenblicklich weiß ich, was mir bevorsteht. Auch Felipe hat mir das von Zeit zu Zeit angetan.
»Komm«, lockt die Stimme meines neuen Menschen, »ich bin auch ganz vorsichtig.«
Mit eingezogenem Schwanz widerstehe ich dem Drang wegzurennen. Ich mache mich ganz steif und warte, was passiert. Mein neuer Mensch hebt mich hoch und stellt mich in die weiße, kalte Wanne. Lauwarmes Wasser strömt auf mich herab, schon habe ich es in den Augen, in den Ohren, und was das Schlimmste ist: in der Nase. Doch es kommt noch schlimmer. Mein schönes graubraunes Fell wird mit dieser schrecklichen Flüssigkeit einmassiert, mit der sich die Menschen ihre Haare waschen, bis ich aussehe wie die verrückte Lili mit ihrem schmutzig weißen Pelz und stinke wie Doña Maria Assunta, wenn sie frisch vom Friseur kommt. Gedemütigt und mit hängendem Kopf blicke ich auf die schmutzigen Seifenschlieren, die an mir herabrinnen. Ich bin durchaus ein reinlicher Hund. Gut, die vergangenen Wochen und Monate in der Höhle haben ihre Spuren hinterlassen. Doch an meinem ganz persönlichen Hundegeruch habe ich lange gearbeitet. Jetzt wird das alles den Gully hinuntergespült. Ein Glück, dass mich keiner so sehen kann.
Auf einmal ist das Wasser überall, prasselt auf mich nieder wie ein Wolkenbruch. Meine Pfoten verlieren jeden Halt, ich rutsche aus, und Panik überkommt mich. Mein neuer Mensch legt ein Handtuch über meinen triefenden Körper und hebt mich hoch. Ich bin viel zu groß, um hochgehoben zu werden, schließlich reicht ihm mein Rücken bis zu den Knien. Außerdem bin ich das nicht gewohnt und beginne heftig zu strampeln.
»Ist ja gut«, ächzt mein neuer Mensch unter meinem Gewicht, schleppt mich ins Wohnzimmer und setzt mich auf der Decke ab. »Jetzt bist du ein viel schönerer Hund.«
Na ja, denke ich und blase Wasser aus meinen Nüstern, das ist wohl Geschmackssache. Und dann: Vielleicht meint er es doch ernst mit uns. Sonst wäre es ihm nicht so wichtig, dass ich rieche wie er.
Dann denke ich nichts mehr und beginne, mich trocken zu lecken. Das ist viel Arbeit, und irgendwann fallen mir die Augen zu.
Es ist ein unglaublich verführerischer Duft, der mich aufweckt, und eine Weile wage ich es nicht, die Augen zu öffnen, aus Furcht, dass ich wieder einmal träume und am Ende doch nur in der verdammten Höhle über der Brandung liege, hungrig, wie ich bin. Dann aber fällt mir alles wieder ein. Ich bin nicht mehr in der Höhle, ich habe einen neuen Menschen, und schon springe ich auf, um ihn zu suchen. Er steht in der Küche und füllt gerade eine Schüssel mit … nein … ich kann es nicht fassen, womit er sie füllt. Nicht mit dem Futter, das mein erster Mensch für mich hatte, diesen kleinen trockenen Brocken, von denen ich immer so durstig wurde. Auch nicht mit dem leckeren Brei aus den Dosen, den ich von manchen der Fremden bekam. Nein: Mein wunderbarer neuer Mensch hat zwei richtige, köstliche Steaks gebraten, die ganze Küche schnuppert danach. Eines davon hat er in maulgerechte Stücke geschnitten. Und darunter hat er Reis gemischt – es ist mein absolutes Lieblingsessen, auch wenn ich es noch nie in meinem Leben gekostet habe. Innerhalb von drei Sekunden ist die Schüssel leer, und ich blicke meinen neuen Menschen an.
»Mehr?!«, fragt er ungläubig. Ich fahre mir mit der Zunge ums Maul, wo ein paar Reiskörner in meinem Zottelbart hängen geblieben sind.
»Na gut«, sagt er lächelnd und schneidet auch das zweite Stück Fleisch klein, das er sich schon auf den Teller getan hat, mischt Reis darunter und befüllt meine Schüssel neu. Sofort mache ich sie wieder leer.
»Das muss jetzt aber mal reichen«, bestimmt er, und ich füge mich widerstrebend.
Frisch gestärkt, beschließe ich, den Garten zu erkunden. Außerdem sollte ich dringend etwas für meinen Körpergeruch tun, ich stinke wie ein Schoßhündchen, und das muss sich so schnell wie möglich wieder ändern. Meine Nase weist mir den Weg in den hinteren Teil des Gartens. Unter einem der Büsche finde ich ein ganz besonders feines Aroma, ein kleines Mädchen hat hier vor einigen Tagen hingepinkelt. Mit Wonne werfe ich mich genau dort auf den Rücken und wälze mich hin und her, reibe mir diesen wunderbaren Duft ins Fell. Mein neuer Mensch ist mir gefolgt, er lacht und freut sich, und da ich schon auf dem Rücken liege, strecke ich probehalber alle viere von mir. Tatsächlich, er setzt sich zu mir ins Gras und beginnt mich am Bauch zu kraulen. Herrlich! Er kann das richtig gut, findet bald die Stellen, wo es sich am schönsten anfühlt, und mein Denken setzt aus …
Nur so ist es zu erklären, dass ich ihn nicht rechtzeitig wahrgenommen habe, diesen fürchterlichen Gestank. Auf einmal steht Señor Pizzarro über uns, und ich erschrecke fast zu Tode. Bei seinem Geschrei, das so sicher folgt wie die Nacht auf den Tag, springe ich mit allen vier Pfoten gleichzeitig auf und drücke mich von hinten gegen die Beine meines Menschen. Señor Pizzarro brüllt fürchterlich, und in meiner Aufregung höre ich: »… kein Hund, niemals …« Und: »… raus hier … sofort …«
Glasklar und entschlossen schneidet die Stimme meines neuen Menschen das Redegewitter ab. Ich verstehe zwar nicht, was er sagt, doch es klingt nach Chef. Es klingt nach: »Hier entscheide ich!«
So schnell gibt sich Señor Pizzarro natürlich nicht geschlagen. Er hat allerhand zu antworten, doch mein neuer Mensch macht eine Handbewegung und sagt: »Schluss jetzt!«
Ich blinzle zu ihm hoch, und was ich sehe, lässt mein Herz hüpfen vor Freude: Mein Mensch wird immer größer und Señor Pizzarro immer kleiner. Mein Mensch spricht ruhig und ohne Zorn, doch mit großer Bestimmtheit, während der Hundemörder immer mehr den Kopf einzieht und mit den Armen beschwichtigende Ruderbewegungen macht. So tritt er den Rückzug an.
Ich kann es nicht fassen. Noch niemand hat das fertiggebracht! Sogar mein erster Mensch, der mit Señor Pizzarro in ständigem Kriegszustand lebte, hat so etwas nie geschafft. Unbändiger Stolz erfüllt mich: Mein neuer Mensch ist stark. Mein neuer Mensch ist unermesslich mächtig. Er hat Señor Pizzarro besiegt.
7 7
Am Abend trage ich ein neues Halsband, besitze einen eigenen Napf, liege in meinem neuen Körbchen auf meiner neuen Hundedecke, die er für mich gekauft hat, und bin restlos erschöpft. Wir waren beim Tierarzt, und ich war so tapfer, wie es mir inmitten dieser Dunstwolken aus Todesangst, Krankheit und Schmerz nur möglich war, die hier alle möglichen Tiere hinterlassen haben und ständig erneuern. Als echter spanischer Macho, der ich nun einmal bin, ließ ich das Gepikse über mich ergehen, von denen die Menschen allein wissen, wieso sie uns Tiere damit quälen müssen. Erst als mir ganz am Ende ein kleines Metallstück in den Hals geschossen wurde, konnte man mich mindestens zehn Straßenzüge weiter jaulen hören. Wozu soll das gut sein?, wollte ich wissen. Doch wir Hunde kriegen selten Antworten auf unsere vielen Fragen.
»Morgen bekommst du einen eigenen Reisepass«, sagt mein neuer Mensch auf einmal. »Ist das nicht toll?«
Ich lege den Kopf auf den Rand des Körbchens und betrachte ihn voller Liebe. Auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, wovon er spricht.
»Dafür brauchst du aber einen Namen«, redet er weiter und denkt eine Weile nach.
»Ich heiße Tobias«, sagt er dann und zeigt mit dem Finger auf seine Brust. Tobias. Ein guter Name.
»Und wie heißt du?«, fragt er mich.
Das verwirrt mich. Wie ich heiße? Felipe hat mich immer nur perro genannt. Ist das ein Name?
Tobias nimmt eines dieser Dinger vom Tisch, die aussehen wie Zigarrenschachteln, aber keine sind. Er betrachtet es, dann klappt er es auseinander. Es ist wirklich keine Kiste, es besteht aus lauter Papier, so wie die Briefe, die wir früher verteilt haben, oder wie die Zeitungen. Nur kleiner und dicker. Papier. Mit Worten darauf. Dicke Briefe zwischen festen Deckeln …
»Ich hab’s«, sagt Tobias und schlägt den dicken Brief zu. Er tippt mit dem Finger auf den Umschlag.
»Ich nenne dich Zola. Nach Émile Zola. Der hat Geschichten über Leute geschrieben, die auch kein Zuhause hatten. Außerdem hatte er selbst einen Hund. Gefällt dir das? Zola?«
Ich lächle. Wir Hunde haben das von den Menschen abgeschaut, das Lächeln. Ein anderer Hund fühlt sich bedroht, wenn ich ihm meine Zähne zeige, doch Menschen tun das ständig, wenn sie es freundlich meinen. Tobias lächelt, nennt mich Zola, mit der Betonung auf dem »a«, und ich lächle zurück. Zola. Ein guter Name.
Als hätte ich nicht begriffen, zeigt er mit dem Finger auf mich und sagt mehrmals laut und deutlich: »Zola.« Dann deutet er auf sich selbst und sagt: »Tobias.« Ich lächle milde. Ja doch, denke ich, ist ja gut. Schließlich legt Tobias den dicken Brief zurück auf den Tisch und geht in die Küche.
»Zola«, höre ich ihn rufen, »komm her, Zola!«
Ist das ein Spiel? Ich erhebe mich, schüttle mich ein wenig und folge meinem neuen Menschen in die Küche. Der grinst wie einst Felipe, als wir das neue Postauto bekamen.
»Braver Zola, gut gemacht«, sagt Tobias und schenkt mir einen leckeren Kaustreifen.
Wenn das so ist, denke ich, während ich die Beute in mein Körbchen trage, können wir dieses Spiel noch stundenlang spielen. Ach, was sag ich: ein ganzes Hundeleben lang.
3
Die Reise
Die Tage vergehen, und bis auf die Sache mit den Herzensräubern bin ich mehr als zufrieden mit meinem neuen Menschen. Ich habe ihm beigebracht, dass wir morgens einen langen Spaziergang durch mein Revier machen. Er folgt mir tadellos, auch sein Tempo stimmt. Wir haben ein Arrangement getroffen, mit dem wir beide gut zurechtkommen: Auf unserem Weg durch das Städtchen führe ich ihn an der Leine, damit die Menschen sehen, dass ich auf ihn aufpasse und dass sie gefälligst Respekt vor ihm haben müssen, denn sonst bekommen sie es mit mir zu tun. Dabei haben sich überraschende Dinge ereignet: So manch einer der Freunde meines ersten Menschen, die durchweg alle nach seinem Tod so taten, als hätten sie mich noch nie gesehen, bleibt nun stehen, spricht Tobias an und erzählt ihm von Felipe. »Wie schön«, sagte neulich Doña Maria Assunta zu ihm, während ihr größenwahnsinniger Köter aus ihrer Handtasche zu mir herabknurrte, »dass dieser gute Hund endlich einen neuen Herrn gefunden hat. Pobrecito! Wir alle, die wir Don Felipe kannten und liebten, haben uns um ihn gekümmert und ihm immer wieder einen Leckerbissen zugesteckt. Nicht wahr, du Guter?«
Ich spitzte die Ohren und wunderte mich. Mir hat sie jedenfalls nie einen Bissen zugesteckt, nicht einen Blick hatte die alte Schachtel für mich. Doch was war, das war, ich habe jetzt Tobias, und ich platze schier vor Stolz, als er sich höflich von der Alten verabschiedet und sich von mir weiterführen lässt. Unsere Dorfrunde endet beim Strandcafé, wo wir unser Frühstück einnehmen und mit Pepe über alte Zeiten plaudern.
»Felipe hat ihm beigebracht«, erzählte er Tobias neulich, »den Leuten die Zeitung an die Tür zu bringen. Er kann toll apportieren, Felipes Hund, das sollten Sie mal ausprobieren.«
Tobias trinkt seinen Café con leche, isst eine Tostada, die Pilar mit Olivenöl, fein gehackten Tomaten und leckerem Schinken belegt, für mich gibt es den obligatorischen Wassereimer, der nach Oliven schmeckt. Brechen wir dort auf, um am Strand entlang zurück nach Hause zu gehen, lässt mich Tobias von der Leine, denn es wäre doch eine zu große Schmach, müsste ich angeleint an Tschakko und den anderen vorüberschleichen. Diese wilden Hunde, die nie einen Menschen hatten, haben ja keine Ahnung, dass wir es sind, die die Menschen führen, und aus purem Neid machen sie sich stets über Leinenhunde lustig. Dies ist außerdem die Gelegenheit, am Strand so richtig Gas zu geben und Tobias vorzuführen, was ich alles kann: rennen und Purzelbäume schlagen, große Löcher buddeln und jeden verrotteten Fisch finden, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Zeigen sich Tschakko und die Meute, jage ich sie ein bisschen durch die Gegend und veranstalte ein Riesenspektakel, damit Tobias sieht, was ich so drauf habe. Ruft er mich aber bei meinem neuen Namen, komme ich nur so angeflogen. Ich liebe es, wenn er mich ruft. Dann weiß ich, dass er mich braucht.
Sorgen machen mir in diesen Tagen nur zwei Dinge: Da ist zum einen sein Koffer auf dem Schlafzimmerschrank. Eines Tages wird er ihn von dort herunterholen, seine Sachen hineinstopfen, ihn in sein Auto laden und davonfahren. Was wird dann aus mir?
Darum versuche ich, nicht an die Zukunft zu denken. Das ist ohnehin nicht Hundeart, es ist Menschenart, doch wie so vieles habe ich auch dies von den Menschen gelernt. Will man mit ihnen leben, muss man lernen, sie zu verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, warum die Menschen so unruhig sind. So unstet. Hat ein Hund ein Revier, kommt er nicht auf die Idee, es aufzugeben, um sich woanders niederzulassen. Das macht er nur, wenn er dazu gezwungen wird. Doch die Menschen lieben es, alles Mögliche in ihr Auto zu packen und loszufahren, um irgendwo anders anzukommen und dort für eine Weile zu bleiben. Wie oft habe ich sie dabei beobachtet, wie sie todmüde und voller fremder Gerüche in der Siedlung ankamen, Sack und Pack ins Haus schleppten, Koffer leerten und auf dem Schlafzimmerschrank verstauten, um sie nach einer gewissen Zeit wieder herunterzuholen und alles wieder einzupacken. Anfangs dachte ich, es habe ihnen hier nicht gefallen. Vielleicht war Señor Pizzarro schuld daran, obwohl mir noch nie zu Ohren gekommen wäre, dass der auch Menschen vergiftet hätte. Doch die Fremden schienen immer traurig, wenn sie abreisten, und viele kamen im nächsten Jahr wieder. Das soll ein Hund verstehen, ebenso wie die Begeisterung der Fremden für das Meer. Die Menschen sind voller Rätsel, und darum beobachte ich genau, was Tobias tut.
Die meiste Zeit sitzt er in seinem Sessel und schaut in diese merkwürdigen Dinger, die aussehen wie dicke Briefe zwischen zwei harten Deckeln. Das kann er stundenlang tun, und ich frage mich, wer ihm all diese Briefe schreibt. Manchmal muss ich ihn gar daran erinnern, dass er jetzt einen Freund hat, der ab und zu hungrig wird oder sich dringend die Beine vertreten muss. Dann schreckt er auf, so als habe er geträumt, nur dass er hellwach war, das weiß ich ganz genau. Nicht nur weil seine Augen Zeile um Zeile die geschriebenen Worte entlangwandern, sondern auch weil seine Gefühle wechseln, als würde er etwas Aufregendes erleben. Dann etwas Trauriges. Oder etwas Schönes. Eine Gefühlsgeruchswelle nach der anderen. Dabei erlebt er doch gar nichts, er sitzt einfach nur in seinem Sessel! Das Schlimmste aber ist, dass ich fühle, wie er mir regelmäßig abhandenkommt, sobald er seine Nase in diese Dinger steckt. Wenn er liest, dann geht sein Herz auf Reisen, sein Herz erlebt Sachen, die mit mir nichts zu tun haben, und das macht mich traurig.
Von diesen Herzensräubern hat er ganze Taschen voll dabei. Auf der einen Seite stapelt er die, die er schon gelesen hat, auf der anderen jene, die noch darauf warten, ihn in einen Mann ohne Willen, ohne Achtsamkeit und jede Vorsicht zu verwandeln. Wie gut, dass er mich hat! Mit einem Seufzer verlasse ich mein gemütliches Körbchen, sondiere die Lage, prüfe die Schwachstellen unserer Behausung, bestimme den strategisch besten Platz, von dem aus ich alles im Auge habe, und lasse mich dort nieder. Und während die Herzensräuber ihr Teufelswerk an ihm tun, sorge ich dafür, dass ihm nichts passiert.
So geht es eine schöne Weile lang, die Tage werden unmerklich kürzer, der Wind vom Meer weht frischer, das weiße, unbarmherzige Licht des Sommers wird goldener. Morgens duften die Gärten nach Tau und der Süße von Verwesung, der Kraft, die alles im ständigen Wandel hält und vor nichts haltmacht. Die angrenzenden Häuser sind schon längst verwaist, und gerade als ich mich frage, ob mein neuer Mensch hier für immer bleiben wird, geschieht, was ich so sehr fürchte: Er holt seinen Koffer vom Schrank. Mein Herz fühlt sich an wie der Luftballon, auf dem ein Kind einmal so lange herumhüpfte, bis er platzte.
Alles hat ein Ende, denke ich und lege mich in die hinterste Küchenecke, damit ich das Elend nicht mit ansehen muss. Auch Tobias wird gehen und mich zurücklassen, und dann wird es so sein, als wäre er tot. So wie Felipe. Und dann denke ich gar nichts mehr, sondern lasse den Schmerz über mich branden wie eine stürmische See über ein gesunkenes Schiff.
»Was machst du da, Zola?«
Besorgnis geht von Tobias aus, der in der Küchentür steht. Und Ratlosigkeit.
»Ich hab dich gesucht. Warum versteckst du dich?«
Ich hebe den Kopf und blicke ihn aus waidwunden Augen an.
Du willst mich verlassen, denke ich.
»Nein«, ruft Tobias und kommt mit großen Schritten zu mir. Seine Hand in meinem Nackenfell bringt mich zum Erzittern. Warum liebe ich ihn so? Warum kann ich nicht wie Tschakko mir selbst genug sein und mein größtes Glück darin finden, ein paar abgerissene Köter herumzukommandieren? Warum muss ich immer und immer wieder mein Herz an einen Menschen verlieren?
»Du kommst natürlich mit«, sagt Tobias. »Was glaubst du, warum ich einen Pass für dich besorgt habe? Warum ich dir einen Namen gab? Wir fahren gemeinsam nach Hause.«
Sag das noch mal, denke ich. Ich muss mich verhört haben. Diese fremde Sprache ist mir noch nicht so recht vertraut. Ich verlasse mich auf das, was ich rieche, auf das Schwingen in seiner Stimme, niemand weiß so gut wie ich, wie trügerisch Menschenworte sein können. Ich rieche keinen Abschiedsschmerz, kein schlechtes Gewissen. In seiner Stimme liegt kein Bedauern, kein »Es tut mir leid, aber es muss einfach sein«. Und das eine Wort, das ich am besten verstehe, war auch darunter: das schöne Wort »komm«.
Ich setze mich auf und blicke ihm in die Augen. Er lächelt. Er schaut nicht weg. Seine Hand streicht mir ganz sanft über den Kopf. Schon lange ducke ich mich nicht mehr weg, wenn sie das tut. Jetzt richtet er sich auf und geht zur Eingangstür.
»Komm!«, sagt er. »Ich hab alles eingepackt. Nur du fehlst noch.«
Wie ein Blitz bin ich an seiner Seite. Draußen wartet Señor Pizzarro. Während er den Hausschlüssel entgegennimmt, wirft er mir einen hasserfüllten Blick zu.
»Sie werden diesen Köter doch nicht mit nach Deutschland nehmen?«, fragt er, und ich muss mich schwer zusammenreißen, um ihn nicht anzuknurren.
»Doch«, sagt Tobias fröhlich. »Genau das werde ich tun.«
Schwungvoll öffnet er mir die Heckklappe, wo er mein Körbchen schön mit seinen Taschen umbaut hat, ein richtiges Nest hat er mir bereitet. Mit einem Satz bin ich drin, drehe mich ein paarmal im Kreis, prüfe, ob da womöglich eine Tasche ist, die mich während der Fahrt erschlagen könnte. Um mich herum erschnuppere ich die Herzensräuber. Jeder einzelne von ihnen riecht nach einer anderen Geschichte. Dann lege ich mich hin und bohre triumphierend Señor Pizzarro meinen schönsten Siegerblick in die Pupillen.
Ohne eine Spur von Bedauern sehe ich, wie der Ort, der bis heute meine Welt bedeutete, an mir vorübergleitet und bald darauf verschwindet. Ich werde niemanden vermissen, und als der Wagen auf eine große, schnurgerade Straße einbiegt und an Tempo gewinnt, habe ich sie alle bereits vergessen: Tschakko und die Meute, Pepe und Pilar, Doña Assunta, Señor Pizzarro und all die anderen. Nur Felipe werde ich in meinem Herzen bewahren. Felipe war mein erster Mensch und wird es immer bleiben. Doch nun beginnt etwas Neues. Zola ist mehr als bereit dafür.
4
Das neue Zuhause
Am dritten Tag frühmorgens verlassen wir die große, gerade Straße, und ich spüre, dass unsere Reise zu Ende geht. Ich kann es an den Ausdünstungen erkennen, die mein Mensch aus jeder einzelnen seiner müden Poren verströmt. Tobias hatte nicht viel Glück während der Reise, wo auch immer er anhielt und nach einem Zimmer fragte, in dem wir beide unsere müden Häupter hätten zum Schlafen niederlegen können, wurde er weggeschickt. Perros no, hieß es am ersten Abend, Interdit aux chiens am zweiten. Ich rechne es meinem neuen Menschen hoch an, dass er mich nicht die ganze Nacht allein im Auto ließ, sondern seufzend die Rückenlehne seines Sitzes nach hinten klappte, soweit es die vielen Taschen voller Herzensräuber eben zuließen, und zu schlafen versuchte, während ich Wache hielt. In Wahrheit tat er kein Auge zu, und irgendwann während der Nacht klappte er seinen Sitz wieder hoch und fuhr weiter.
Jetzt aber sind wir beide hellwach. Ich setze mich auf und inspiziere die Umgebung. Was ich sehe, gefällt mir. Grün, so weit ich blicken kann. Dann ein paar Häuser. Felder und Wälder, mehr Häuser, groß und weiß und noch größer, und dann wird das Grün seltener, und die Häuser säumen die Straße wie das Riesengebiss eines Monsterhundes, das überhaupt nicht mehr aufhört. Tobias biegt um ein paar Ecken, dann hält er den Wagen an.
»Da sind wir«, sagt er zu mir gewandt. »Wir sind zu Hause, Zola.«
Er steigt aus, öffnet die Heckklappe, und mit einem Satz bin ich draußen. Schüttle mich. Blicke mich um. Halte die Nüstern in die Luft. Wittere die Präsenz von anderen Hunden. Vielen Hunden. Das Kommen und Gehen der letzten vierundzwanzig Stunden rekonstruiere ich mit ein paar gezielten Schnüfflern. Der letzte Konkurrent war vor fünf Minuten hier, ein älterer Herr, der seine Ruhe will. Rasch hebe ich mein Bein und markiere die Stelle. Ein paar Meter weiter die nächste. Alle sollen wissen, dass von nun an Zola das Viertel regiert …
»Zola«, ruft Tobias, und ich reiße mich widerstrebend los. Er öffnet eine gläserne Tür, und ein feines Glöckchen ertönt. »Komm rein«, lockt er mich, und schon bin ich drin.
Im ersten Moment bin ich fassungslos. Tausende von Schicksalsdüften prasseln von allen Seiten auf mich nieder. Glücklich lachende, verzweifelte, weinende, erwartungsvolle, suchende, findende, eifersüchtige, liebende, widerspenstige, hassende, sehnende, zornige und unzählige andere Gefühle samt ihren feinsten Schattierungen hängen in der Luft wie wispernde Stimmen, reißen an mir und machen mich ganz unruhig. Tobias schaltet das Licht an, und nun sehe ich, dass die Wände hier aus Herzensräubern bestehen, vom Boden bis zur Decke aufeinandergeschichtet und in Reihen geordnet, und selbst im Raum lagern sie übereinander wie die Gesteinsschichten der Felsen an meiner heimatlichen Meeresküste.
»Das ist mein Antiquariat«, sagt Tobias. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, für mich wird dies immer die Höhle der Herzensräuber sein. Und hier unter all diesen unzähligen Schicksalsgeschichten sollen wir wohnen?
Tobias öffnet eine Tür, die ich im ersten Schreck übersehen habe. Rasch folge ich ihm und befinde mich in einer Küche. Tobias öffnet Fenster und Holzläden und lässt die Morgensonne herein. Hier riecht es nach abgestandener Luft, nach einer toten Maus hinter dem Herd und … nach einer Frau. Hat mein neuer Mensch etwa eine Frau?
Ich untersuche den Raum und finde heraus: Sie ist weg. Für immer. Sie hat ihn verlassen. Vor gar nicht langer Zeit. Hier hat sie gestanden und es ihm gesagt, während er am Tisch saß. Seine Verzweiflung hängt noch jetzt in dem Sitzpolster des Stuhls.
Ich kenne mich aus mit Frauen, die ihre Männer verlassen. Auch Felipe wurde verlassen. Sie hieß Carmencita. Und war kein Verlust. Leider hat Felipe das nie eingesehen. Es hat ihn krank gemacht, das Liebesleid, und von innen heraus aufgefressen …
Ich bekomme einen Schreck. Tobias wird doch nicht krank werden? Das bittere Aroma nach Liebesleid habe ich schon am Strand aufgefangen, gleich bei unserer ersten Begegnung. Doch es verblich nach und nach, bei jedem Spaziergang ließ es ein wenig nach, der Wind wehte die Traurigkeit weg. Am Ende war nichts mehr davon übrig. Oder doch?
Ich suche Tobias und finde ihn im Zimmer nebenan. Hier hat er seinen Koffer auf das Bett gelegt und sitzt ganz verloren daneben. In den Händen hält er ein Stück Papier und betrachtet es traurig. Ich trete näher. Es riecht nach ihr. Alles hier riecht nach ihr. Man sollte die Fenster und Läden öffnen, die Sonne hereinlassen, damit sie sich auflösen, diese Phantome einer vergangenen Frau. Er sollte mit mir nach draußen gehen, ich spüre ein dringendes Bedürfnis, auch ihm täte ein Spaziergang gut. Ich stupse mit der Nase sanft gegen sein Knie und blicke ihm in die Augen. Er lächelt, stellt das blöde Foto weg und steht auf.
»Was soll’s«, sagt er, »jetzt beginnt etwas Neues«, und ich wedle zustimmend mit dem Schwanz. Laufe zur Türe und blicke zurück. Er versteht. Er ist ein wunderbarer Mensch. Wir gehören zusammen. Wir brauchen keine Frau. Weder eine Carmencita noch diese hier.
Als hätte er meine Gedanken gehört, nimmt er das Foto mit in die Küche und wirft es in die Mülltonne. Dann hat er auf einmal die Leine in der Hand. Ich mache ein paar Freudensprünge quer durch die Höhle der Herzensräuber, und schon bin ich an der Eingangstür. Am besten führe ich ihn jetzt ein bisschen herum und lasse mir von ihm die Gegend zeigen. Das bringt ihn sicher auf andere Gedanken.
7 7
Nach einem schönen Spaziergang und einem ordentlichen Frühstück schließt Tobias die Tür mit dem Glöckchen auf und beginnt, die Herzensräuber aus den Taschen zu holen und unter die Stapel zu mischen, die sich überall gen Decke recken. Mein Körbchen hat er neben einem Tisch platziert, der aussieht wie Pepes Theke. Sogar eine Kasse steht darauf. Ein paar Sonnenstrahlen reichen bis zu mir und kitzeln mich an der Nase. Ich bin kurz davor wegzudämmern, als mich das feine Klingen der Türglocke aus meinen Träumen reißt. Eine Gestalt steht in der Tür, und ich knurre sie an.
»Psst, Zola«, macht Tobias und hält den Finger senkrecht vor seinen Mund. »Nicht! Das ist Kundschaft!«
Ein neues Wort, das ich bereitwillig lerne. Kundschaft. Ich erhebe mich aus meinem Körbchen und beginne, die Kundschaft zu beschnüffeln.
»Seit wann sind Sie denn auf den Hund gekommen?«, fragt die Kundschaft. Es ist eine ältere Frau, und sie trägt eine freundliche Note nach Einsamkeit vor sich her.
»Ich habe Zola aus Spanien mitgebracht, Frau Nothnagel«, erzählt Tobias.
»Ein Spanier also«, sagt die Frau. »Darf ich dich streicheln, Zola?«
»Am besten«, erklärt mein Mensch, »Sie strecken ihm die Hand entgegen und kraulen ihn unterm Kinn. Er mag es nicht, wenn man ihm die Hand auf den Kopf legt.«
Wie klug er ist, denke ich und genieße das Kinnkraulen.
»Haben Ihnen die Bücher gefallen?«, fragt Tobias.
»Und wie!«
Leider richtet sich Frau Nothnagel schon wieder auf.
»Ganz besonders Das böse Mädchen! Haben Sie vielleicht noch mehr von diesem Autor? Und dann wollte ich Sie fragen«, fährt die Frau fort, kramt in ihrer Einkaufstasche und riecht auf einmal ein bisschen nach Verschlagenheit, »ob Sie vielleicht diese hier in Zahlung nehmen würden. Die hab ich schon alle gelesen.«
Tobias sieht alles andere als begeistert aus. Mit spitzen Fingern nimmt er Frau Nothnagel die Bücher ab und beäugt sie mit zusammengezogenen Augenbrauen.
»Ach«, sagt er und tut so, als fände er interessant, was er sieht, »Dostojewski und Tolstoi. Nun, leider habe ich diese Romane bereits in mehreren Ausgaben …«
»Aber noch nicht in dieser DDR-Dünndruckversion, oder?«, setzt die Frau hartnäckig nach. »Meine Schwester sagt, die haben inzwischen Seltenheitswert.«
Fieberhaft sucht Tobias nach einem magischen Spruch, der diese Herzensräuber zurück in die Einkaufstasche von Frau Nothnagel zaubern könnte, doch ihm scheint keiner einzufallen.
»Wir machen es so«, entscheidet Frau Nothnagel, »ich überlasse Ihnen diese beiden Raritäten im Tausch gegen einen Roman von diesem südamerikanischen Schriftsteller namens, wie heißt er noch? Vargas Llosa. Was halten Sie davon?«
Tobias windet sich wie ein Aal. Ich überlege mir, ob ich nicht doch wieder ein tiefes Knurren hören lassen soll. Gegen diese Frau Nothnagel scheint er machtlos zu sein, auch wenn ich nicht verstehe, warum.
Lass dich von dieser alten Frau nicht über den Tisch ziehen, denke ich, so intensiv ich kann.
»Ganz ehrlich, Frau Nothnagel«, sagt Tobias und räuspert sich, »diese DDR-Ausgaben will heute kein Mensch mehr lesen. Sie sind zu dicht und klein gedruckt. Und das Papier ist eine Katastrophe. Sehen Sie mal. Sieht aus wie umweltfreundliches Klopapier. Tut mir leid, aber Ladenhüter wie diese habe ich schon viel zu viele.«
Frau Nothnagel zieht scharf die Luft ein, hält sie so lange an, bis ich Sorge habe, sie könnte blau anlaufen und tot zu Boden fallen. Dann stößt sie den Atem mit einem Mal wieder aus, nimmt meinem Menschen ihre Herzensräuber aus der Hand und stopft sie in ihre Einkaufstasche, als müsse sie die Bücher vor ihm retten.
»Es ist beschämend«, sagt sie schnippisch, »wie respektlos Sie über diese Kostbarkeiten sprechen. Meine Schwester hat sich damals einen ganzen Tag lang anstellen müssen, um sie überhaupt ergattern zu können. Und Sie … Sie nennen sie … Klopapier.«
Tief beleidigt wendet sich Frau Nothnagel zum Gehen.
»Warten Sie!«
Tobias’ Stimme klingt nach Kapitulation. Er geht zu einem Regal und zieht einen dicken Herzensräuber heraus.
»Nehmen Sie das.«
Frau Nothnagel sieht sich gierig um. Und schon hält sie das Buch in der Hand.
»Tante Julia und der Kunstschreiber«, liest sie begeistert. »Von Mario Vargas Llosa. Also haben Sie es sich anders überlegt?«
Ihre Hand fährt in die Einkaufstasche, doch mein Mensch hebt abwehrend die seine.
»Behalten Sie Ihre Raritäten. Ich schenke Ihnen das Buch.«
Frau Nothnagel strahlt.
»Sie haben ein gutes Herz. Nicht wahr, Hund?«
»Er heißt Zola«, sagt Tobias resigniert. »Nach Émile Zola.«
Frau Nothnagel nickt flüchtig. Verabschiedet sich und ist weg.
Tobias seufzt und schüttelt den Kopf. Und ich frage mich, wozu er hier auf der Theke eine Kasse stehen hat, wenn er die Herzensräuber ohnehin verschenkt. Ich kann mich nicht erinnern, dass Pepe jemals einen Kaffee umsonst hergegeben hätte.
7 7
Die Stadt, durch die ich Tobias zweimal täglich führe, gefällt mir. Es gibt viele duftende Bäume, und an jedem bleibe ich stehen, um die neuesten Nachrichten der vielen fremden Hunde zu lesen. Hier ist was los, kein Vergleich zu dem verschlafenen Nest, in dem ich groß geworden bin. Ich habe Tobias beigebracht, mich von der Leine zu lassen, so kann er in seinem Tempo gehen und muss nicht ebenfalls vor jeder Spur und bei jeder Markierung stehen bleiben. Sobald er mich ruft, und sei es auch noch so leise, bin ich bei ihm. Dann freut er sich und ist sehr stolz auf mich, und ich bin es auch.
In dieser Stadt gibt es zwar kein Meer, aber einen mächtigen Fluss, den Tobias »Neckar« nennt und auf dem sogar Schiffe fahren. Breit und behäbig fließt er dahin, und sein Wasser schmeckt süß. In den Sträuchern an seinem Ufer riecht es nach Wasservögeln und ihren Jungen, doch Tobias erlaubt mir nicht, sie aufzuscheuchen und ein bisschen herumzujagen oder gar zu versuchen, einen zu erwischen. Widerstrebend füge ich mich seinem Wunsch, auch wenn es mir nicht leichtfällt. Hin und wieder sehe ich sie auf dem Wasser dahingleiten, ziemlich große Gänse in Grau und Hellbraun und riesige Kerle in weißem Gefieder und mit überlangen Hälsen, die mich aus ihren schwarzen Knopfaugen hinterhältig fixieren.