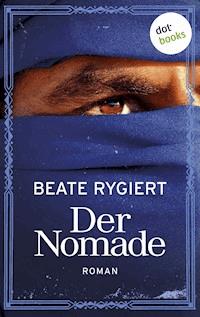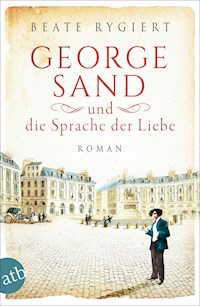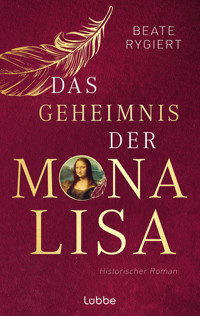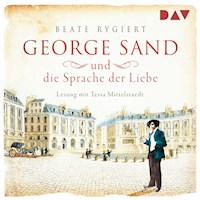4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dunkler Nacht leuchten die Farben ihres Lebens: Der bewegende Roman »Die Fälscherin« von Beate Rygiert jetzt als eBook bei dotbooks. Spanien, 1559. Die Malerin Sofonisba wird als Hofdame und Lehrerin der jugendlichen Königin an den Hof gerufen – in ihren Ohren klingt noch der eindringliche Rat ihres Vaters nach: »Vergiss niemals, ein Bild zu signieren.« Deutschland, 2000. Sofie Lenze sitzt in Untersuchungshaft. Der jungen Kunstrestauratorin wird vorgeworfen, Bilder der erfolgreichsten Künstlerin der Renaissance gefälscht zu haben, Sofonisba Anguissola. In den langen Verhören setzt Sofie dem ermittelnden Kommissar ihre eigene Wahrheit entgegen: Sie verfügt über die Gabe, wie die große Meisterin zu malen – und ihre Signatur können auch Experten nicht vom Original unterscheiden, weil sie Sofonisbas Erinnerungen teilt. Aber ist es wirklich möglich, dass die Malerin in Sofie fortlebt? DIE FÄLSCHERIN ist ein großer Roman über die Kunst, die Liebe, die fließenden Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion – und nicht zuletzt über die phantastischen Vexierspiele der Erinnerung. »Man ist nur noch Staunen: wie formvollendet diese Autorin die Geschichte der Restauratorin Sofie Lenze erzählt.« Frankfurter Rundschau Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Fälscherin« von Beate Rygiert verwebt auf faszinierende Weise den historischen mit dem Gegenwartsroman. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 914
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sofie Lenze sitzt in Untersuchungshaft. Der jungen Kunstrestauratorin wird vorgeworfen, die Bilder der italienischen Renaissancekünstlerin Sofonisba Anguissola gefälscht und teuer verkauft zu haben. Aber Sofie setzt Hauptkommissar Nagels scharfsinnigen Ermittlungen ihre eigene Wahrheit entgegen. Ihr Geheimnis: Sie verfügt nicht nur über Sofonisbas Erinnerungen, sondern auch über die Gabe, wie sie zu malen. Aber wie soll Sofie dem Hauptkommissar begreiflich machen, dass Sofonisbas Leben sie in ihren Träumen einholt?
DIE FÄLSCHERIN ist ein großer Roman über die Kunst,
die Liebe, die fließenden Grenzen zwischen Wahrheit
und Fiktion – und nicht zuletzt über die phantastischen
Vexierspiele der Erinnerung.
„Man ist nur noch Staunen: darüber etwa, dass
es wirklich eine deutsche Autorin ist, die uns so vollendet
die Geschichte der Restauratorin Sofie Lenze erzählt.“ Frankfurter Rundschau
Über die Autorin:
Beate Rygiert studierte Theater-, Musik- und Literaturwissenschaft in München und war danach als Dramaturgin an verschiedenen Theatern engagiert, bevor sie sich auch als Buchautorin eine große Fangemeinde eroberte. Mit dem Autor Daniel Oliver Bachmann gestaltet sie unter dem Namen „Salz & Pfeffer“ Lesungen und literarische Performances und schreibt Drehbücher für Spielfilme. Beate Rygiert lebt und arbeitet in Stuttgart.
Beate Rygiert veröffentlichte bei dotbooks bereits Bronjas Erbe, Der Nomade und Perlen der Macht.
Die Website der Autorin: www.beaterygiert.de
***
Überarbeitete Neuausgabe Oktober 2013
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co.KG, München
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2013 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Titelbildabbildung: Detail aus dem Selbstporträt von Sofonisba Anguissola
ISBN 978-3-95520-222-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Fälscherin an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.gplus.to/dotbooks
Beate Rygiert
Die Fälscherin
Roman
dotbooks.
Für Daniel Bachmann,
in Liebe
Mundus vult decipi. – Die Welt will betrogen werden.
Sebastian Brant, 1457–1521
Ama et fac quod vis. – Liebe, und tu was du willst.
Aurelius Augustinus, 354–430
Die meisten Menschen denken, dass die Zeit vergeht, und sie erkennen nicht, dass es einen Zustand gibt, der nicht vergeht.
Dogen Zenji, 1200–1253
1
Malgrund
nennt man das Material, auf dem die Malerei ausgeführt wird und das sie wie ein Grund trägt. Das kann Stein sein, Holz, Papier oder Leinwand ...
Die Erinnerung ist eine große Lügnerin. Darum fälsche ich meine Geschichten und schreibe sie damit umso wahrer, weil die Fälschung dieses Quäntchen an Möglichkeit bewahrt, die die Vergangenheit scheinbar ausgetilgt hat. „Es war einmal“ ist eine Formel der vorgegaukelten Abgeschlossenheit. Nichts ist abgeschlossen, schon gar nicht die Vergangenheit, denn in jeder guten Vergangenheit steckt ein Körnchen Zukunft.
Eines Tages werde ich diesen Ort verlassen. In Wirklichkeit verlasse ich ihn jede Nacht, keiner hält mich auf, ich gehe, wohin es mir beliebt, und am anderen Morgen erzähle ich Marie beim Wäschesortieren meine nächtlichen Erlebnisse, dass sie die Arbeit vergisst und mit offenem Mund dasteht, bis die Aufsicht kommt: He, Marie, mach’s Maul zu, es zieht! Und die anderen wenden sich um zu uns und lachen, aber die, die meine Geschichten kennen, lachen neidvoll, spitzen die Ohren, wie gerne würden auch sie meinen Worten lauschen, denn dann bewegen sich die Hände wie von allein, und der Tag vergeht in einem Wimpernschlag, auch die Aufsicht mit den Hasenzähnen liebt meine Geschichten, hat klug erkannt, dass die Frauen flinker arbeiten und weniger Unsinn treiben, wenn sie mich meine Geschichten laut erzählen lässt, so laut sie eben gegen die Wäschetrommeln ankommen.
Ich bin eine Geschichtenerzählerin, ich erzähle Geschichten, so oder anders. Ich fälsche sie, um sie der Echtheit zu bewahren. Die Ereignisse sind schillernde Spiegelungen der Luft, jeder erkennt eine andere Geschichte darin, befrage drei verschiedene Zeugen eines Geschehens, und du wirst drei verschiedene Geschichten erhalten.
Ich erinnere mich an Geschichten so weit zurück in der Vergangenheit, dass sie schon wieder in der Zukunft liegen. Und da sind andere in der unendlichen Halle meiner Erinnerung, die erst noch geschehen werden, ihre Erfüllung erst noch erhalten werden, Geschichtenkeimlinge, ich pflege sie in meinen Träumen, damit sie reifen können, bis ihre Zeit gekommen ist, denn nichts auf der Welt steht für sich alleine, keine Geschichte hat einen Anfang oder ein Ende, das behaupten allein die Schriftsteller, deren einzige Kunst darin besteht, so zu tun, als gäbe es diese Eckpfeiler, einen Anfang und ein Ende, Mittelteil und Wendepunkte, sie tun so, als wären Geschichten in ein Schema zu zwängen, drei Akte, mehr ertragen sie nicht in ihrer Angst, sich der Vielgestaltigkeit der Existenz auszusetzen.
Die anderen geben vor, sich an nichts mehr zu erinnern. Sie hätten mit diesem einen Leben schon genug am Hals, höre ich sie sagen. Kein Wort glaube ich davon. In mir leben sie alle weiter, jeder von uns schleppt seine Ahnen mit sich herum, nicht nur die des Blutes, sondern auch die Geschichtenahnen der Seele, des Geistes, denn eigentlich sind wir alle eine, all die vielen Stimmen in mir, sie drängen heraus, wollen erzählen, Gestalt annehmen, alle auf einmal, aber ich bewahre die Oberhand, weiß sie zu zähmen, verteile notfalls Nummern wie beim Arbeitsamt, schön der Reihe nach, damit man die Hörer nicht verwirrt, manchmal geraten sie für kurze Zeit in Vergessenheit, aber mit einem Mal, einem Blick, einem Hauch sind sie wieder da, unmittelbar und unwiederbringlich dahin die Ruhe eines geordneten Weltbilds zwischen Wecken und Lichterlöschen. Aus und vorbei und alle wieder da, so wie an jenem Abend, die Malerin regte sich mächtig, fuhr aus dem Grab dort unten in Palermo, rüttelte und riss, wollte Segel hissen und Schiffe beladen, Anker lichten und pfeilschnell hinüber zu ihm, ein gekonntes Seemanöver war nötig, zwischen Tischen und Stühlen, dort hinten am Hauptmast, nein: an der Theke, da stand er, ruhig, lächelnd, ein Glas in der Hand, und um mich war alles Schäumen und Wogen, die ersten wohlbekannten Anzeichen der aufkommenden Seekrankheit, das Schwanken unter den Füßen, das Brüllen der Brandung und Stimmengewirr: schwere See.
Ich lächelte über seine Lüge, er sei Musiker, ich kannte die Wahrheit, in Wirklichkeit war er Kapitän, nein, schrie es wieder, es ist doch der König, aber ja, ihr habt beide recht, es ist wahrhaftig der königliche Kapitän.
Er lachte auf meine Antwort, ich sei Geschichtenerzählerin, als wisse er es besser, ja dann, sagte er, nur los, erzähl mir eine Geschichte, und da wurde ich stumm und alle anderen in mir ebenfalls, nur die eine fiel mir ein, stand mir immerzu vor Augen, aber die Worte fanden ausnahmsweise keinen Ausgang aus mir. Er lachte wieder, diesmal leiser, vertrauter, und stumm wie ein Fisch erlaubte ich ihm, seinen Arm um meine Schultern zu legen, war froh, denn die Planken des Schiffes hatten sich noch lange nicht beruhigt, Gischt sprühte herüber vom Mann hinter der Bar, und als er vorschlug zu gehen, war es mir nur recht.
Ich habe ihn gemalt auf grünem Grund. Grün ist die Farbe des Hintergrundes, manchmal hell wie eine Sommerwiese, dann wieder düster wie die Schatten eines dunklen Zimmers. Dieses Grün bringt die Züge erst richtig zum Leuchten, den zarten Pfirsichteint der Damen, die Blässe der vornehmen Herren, aber selbst sein wetter- und sturmgegerbtes Gesicht erhielt diesen lebensechten Glanz erst vor diesem Fond. Für ihn ganz allein mischte ich das Grün des Meeres, der Wellen, windgepeitscht und drohend, und es fand eine Entsprechung in der Farbe seiner Augen, die graugrün waren und dunkel, so wie die Augen dieses Mannes, den ich erst vor ein paar Stunden traf, hier liegt er neben mir und schläft, und für einige wundervolle Momente glaubte ich, dich wiedergefunden zu haben, endlich. Aber es war wohl eher die Laune der Natur oder meiner Erinnerung, die Erinnerung ist eine gute Lügnerin, immer wieder falle ich auf sie herein, jetzt gilt es, leise die Kleider zusammenzuraffen und zu verschwinden, aber da blinzelt er schon, halt, sagt er, wohin willst du? Du schuldest mir noch eine Geschichte, und fasst mich um die Taille, zieht mich zu sich herunter, warme Haut und weich und fest, vielleicht ja doch keine Täuschung, vielleicht ja doch ..., Lippen so warm und voll, wer kann sich sträuben in solchen Armen, Musiker, dass ich nicht lache, nur ein Seemann hat solche Arme, und dann pocht mein Herz voll freudiger Erinnerung, als er mich sanft auf den Bauch dreht, meine Beine ein klein wenig auseinanderschiebt, sich auf mich legt, ganz wie damals, woher weiß er, kennt er unsere Lieblingsliebeslagerlage, und wie er sich auf mir bewegt, dabei sanft mit seinem Bauch meinen Hintern berührt, mit den Haaren seiner Brust meinen Rücken streichelt, beiße ich ins Kissen, um nicht laut aufzuschreien, denn ich erkenne den Rhythmus, er ist es, vor meinen Augen sehe ich Farben, das Grün zerbirst in rot aufsteigende Flecken, Flammenregen und tanzende Sterne, langsam, ganz langsam fühle ich sie aufsteigen, die Säule der Lust, Funkenregen und Feuerball, darin wir beide in inniger Umarmung, funkelnd wie ein Edelstein, zwischen meinen Zähnen knirscht der Stoff des Kissens, da umfasst er mich und rollt mit mir sanft zur Seite, schlingt beide Arme fest um meinen Leib, ich spüre seinen Atem heiß im Nacken, höre seine leisen hingestöhnten Worte, die sinnlos den Nüchternen, so kostbar den Trunkenen, dann liegen wir warm ineinander verwoben, sein Atem spricht weiter zu mir in der Stille, ich spüre, wie er schwer wird in der völligen Entspannung, schwer und schwerer, und während er langsam in den Schlaf hinübergleitet, beginnen in mir die beiden wieder zu streiten, er ist es doch, der Kapitän, nein, es ist der König, und ich seufze, bin es leid, könnt ihr nicht einmal die Klappe halten, mich einfach in Ruhe lassen, und obwohl ich weiß, ich werde alles verderben, stelle ich die Frage, nur um endlich Ruhe zu haben, frage ich also:
Wie ist eigentlich dein Name?
Als Antwort höre ich leises Schnarchen.
Das alles hast du wirklich erlebt, fragt Marie, und der Mund steht ihr offen, die Hände liegen wie kleine Vögel in ihrem Schoß, und ich stupse sie an, denn die Aufsicht macht schon einen langen Hals zu uns herüber, es ist nicht die mit den Hasenzähnen, und es ist besser, die Köpfe zu senken und einen Moment zu schweigen.
Natürlich, flüstere ich dann, wenn ich es dir doch sage, und ich weiß schon, was dann kommt, sie bettelt, ich solle doch weitererzählen, wie geht es denn weiter mit diesem Mann, hast du erfahren, wie er heißt, doch schon bereue ich meine Geschwätzigkeit, wie kommst du dazu, dieser Kellermaus deine Geschichte zu erzählen, hast du denn gar keine Scham mehr, ist dir denn nichts mehr heilig, ihn, den du auf grünen Grund maltest, so zu verraten? Kein Bild ist erhalten, sagen die Experten, aber da täuschen sie sich, alle sind sie noch da, hier, in meinem Kopf, meinem Herzen, das in der Uniform, schwarz mit den goldenen Knöpfen und Bändern, Orden und Auszeichnungen, dann das andere im prächtigen Staat der Lomellini, die Hand leicht auf das Modellschiff gelegt, auch das eine, das außer uns beiden nie jemand sah und nie jemand sehen wird, immer stand es mir vor Augen, wenn ich die Hand des Musikers fühlte.
Mein Name ist Luca, sagte er mir am anderen Morgen, und dass er aus Genua stammte, das wusste ich schon, wenn auch der Name ein anderer, so stimmt doch die Herkunft, diese Hand, unter Millionen würde ich sie wiedererkennen, und eine Sehnsucht brennt in meinem Innern, die keine Liebesnacht, auch nicht die am schönsten erzählte, mir stillen kann.
Ich weiß nicht, wem ich es zu verdanken habe, dass mir die Staffelei und Leinwand, Ölfarben und Pinsel in die Zelle gebracht wurden, vielleicht dem Gefängnisdirektor, ich habe keine Ahnung. Womöglich wollen sie, dass ich mich verrate, ich soll die Bilder malen, die als verschollen gelten, und mich damit selbst überführen, aber ich habe sie bereits gemalt, habe sie in Cremona gemalt, wo dank der Sorgfalt meines Vaters so gut wie alle erhalten sind. Sofonisba, hat er mir immer eingeschärft, du musst deine Bilder signieren, du ahnst nicht, wie wichtig das ist, und tatsächlich hatte ich keine Ahnung, habe es aber treu getan, wie mein Vater, Gott hab ihn selig, mir aufgetragen. Die Farben, die ich in meiner Zelle fand, taugen nicht viel, was gäbe ich darum, sie mir selbst zuzubereiten, wie der gute Campi es mich und Elena gelehrt hat. Ich bat um Veroneser Grün, aber die Aufsicht schüttelte nur missbilligend den Kopf, wog Farbtuben in der roten Metzgerhand – Karmesin und Caput Mortuum –, genügt der Dame etwa nicht, was hier ist, kann mich nicht erinnern, dass jemals eine einen solchen Luxus … und jetzt auch noch Sonderwünsche, Veroneser Grün, das ist ja wohl die Höhe …, und damit war sie auch davon, und es war besser so.
Lieber Vater, bester Vater, ich habe sie alle signiert, ganz, wie du es immer wieder gesagt hast, mit meinem ganzen Namen, denn es werden Zeiten kommen, früher oder später, wo sie nicht werden glauben wollen, dass eine Frau diese Bilder gemalt hat. Heute noch sehe ich ihn vor mir, und es sollte die letzte Erinnerung an das Gesicht meines Vaters werden, im Hausanzug sitzt er an seinem Schreibpult, ein Brief liegt vor ihm mit einem riesigen Siegel, das ich noch nie zuvor gesehen habe, und in seinen Zügen mischen sich Bestürzung und Freude, ungläubiges Staunen, Furcht und Stolz, all das lese ich gleichzeitig in seinem ebenmäßigen, schmalen Gesicht mit dem graublonden Vollbart und den hellen Augen, die sonst immer so ruhig und gefasst blicken und für alles eine Lösung wissen. Er hat mich rufen lassen, doch kaum sitze ich auf der äußersten Kante des Stuhls mit der hohen, strengen Lehne, da springe ich schon wieder auf, erst jetzt habe ich die Gestalt des Fremden bemerkt, der seitlich im Schatten der schweren Vorhänge sitzt. Mein Kind, sagt der Vater, das ist der Conte Broccardo, vielleicht erinnerst du dich noch an ihn, als du klein warst, hat er uns manchmal besucht, jetzt hat ihn ein ehrenvoller Dienst in die Ferne verschlagen.
Die Hand des Conte liegt warm und fest in der meinen, mir kommt der Heiratsantrag vom vergangenen Jahr in den Sinn, auch diesmal wird nichts daraus werden, unsere finanzielle Situation ist unverändert schlecht, und ein Anguissola geht lieber am Bettelstab, als dass er eine Tochter ohne angemessene Mitgift verheiratet. Aber es scheint mir unwahrscheinlich, dass es um eine Ehe geht. Der Conte hat uns eine hohe und ehrenvolle Anfrage gebracht, Sofonisba, sagt der Vater, ich kann es noch gar nicht glauben, und ob es ein Glück für uns ist oder doch eher ein Unglück, das wage ich ebenfalls noch nicht ...
Eine rasche Bewegung des Gastes unterbricht ihn, ein Unglück, wie kommt Ihr darauf, es ist eine Ehre, wie sie größer für Eure Tochter nicht sein könnte.
In dem Schweigen, das jetzt den Raum erfüllt, rasen meine Gedanken. Mein Blick klebt an dem Brief, aber sosehr ich mich auch bemühe, dieses Rätsel kann ich alleine nicht entwirren.
Möchtest du nach Spanien gehen, fragt mich da in heiterem Ton der Conte. Nach Spanien? Aber warum denn, in meinem Kopf dreht sich alles, ich habe keine Lust, einen Spanier zu ehelichen, ganz egal, wer er ist und wie ehrenvoll dieser Antrag auch sein mag ..., aber da sprechen sie endlich, beide gleichzeitig, Zeichenunterricht für die junge, erst vierzehnjährige Königin, Elisabeth de Valois, Isabel in der Sprache der Spanier, die aus Frankreich kommen wird und so gerne malt, ihre Hofdame soll ich werden, und dann wirbeln Zahlen durch den Raum, Bezüge und Renten und Sonderausgaben und Reisekosten, und nach einer Weile sitzt mein Vater zufrieden in seinem Sessel, sieht still vor sich hin, mit dem Blick, den er bei guten Geschäftsabschlüssen zu haben pflegt. Nicht schlecht, sagt er, der König lässt sich die Zerstreuungen seiner jungen Gemahlin etwas kosten, lebenslange Pensionen und Renten und Protektion, von der Ehre ganz zu schweigen …, aber Spanien ist weit, erklingt plötzlich die Stimme meiner Mutter, die unbemerkt eingetreten ist, wer weiß, wann wir unsere Tochter wiedersehen werden, wenn sie erst einmal am Königshof ist. Spanien ist weit.
Sie hatte recht. Spanien ist weit entfernt von Cremona, wenigstens damals lag es am Ende der Welt, oder doch fast. Nachdem ich mir alles gründlich überlegt und der Conte mir mein Leben als Hofdame der spanischen Königin in den glühendsten Farben geschildert, nachdem mein Vater ohnehin seine Entscheidung längst gefällt und dem König einen Brief geschrieben hatte, der oft in der Familie verlesen wurde, und über den man viele Tränen vergoss: Als Eurer Majestät devoter und gehorsamer Diener füge ich mich Eurem Willen, obwohl es mich in der Seele schmerzt und ich tief unglücklich bin, dass sich meine liebste Tochter so weit hinweg begibt, sie, die von mir und von allen wie das Leben geliebt wird und uns wegen ihrer Gaben und Sitten über alles gilt. So schrieb er an Felipe, und an dieser Stelle erhob er immer die Stimme: Aber ich tröste mich, sie dem größten und besten König gegeben zu haben, der über alle anderen erhaben, katholisch und christlich ist, und auch damit, dass Eurer Majestät Haus nach Ruf und Wirklichkeit einem Kloster gleicht.
Hoffentlich nicht so sehr, höre ich noch Lucia in der Nacht wispern, reicht es nicht, dass Elena Nonne wurde, werden wir denn alle so enden? Ich lache und sage, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und die Spanier gelten als feurig, pass auf, dass du dir also nicht die Finger verbrennst oder gar Schlimmeres, kichert Minerva. Über Nacht hatte sich alle Aufmerksamkeit auf mich gerichtet, mehr, als mir lieb war. Meine Schwestern wussten nicht, ob sie mich beneiden oder eher bemitleiden sollten, aber die große Reise hätte eine jede von ihnen gerne unternommen, von unserem kleinen Bruder ganz zu schweigen. Wenn er nur etwas älter gewesen wäre, er hätte mich mit Freuden begleitet.
Ich war glücklich. In meinem Herzen war die Abenteuerlust erwacht. Endlich hatte mein Leben eine Richtung. Bonne chance y buena suerte, wer weiß, welche Sprachen ich an diesem Hof noch würde lernen können. Ob ich mich mit der Königin gut verstehen würde? Aber was war sie anderes als ein vierzehnjähriges Mädchen, so alt wie meine Schwester Minerva, und seit wie vielen Jahren hatte ich sie und Lucia unterrichtet und ihnen alles beigebracht, was mich die beiden Bernardinos gelehrt hatten? Sie malten kaum schlechter als ich, und manchmal konnte man unsere Bilder kaum voneinander unterscheiden. Jedenfalls fast. Von dem feinen Unterschied sprachen wir nie, ohnehin sah ihn jeder.
Ich nenne es: Leben. Meine Gesichter leben, Vasari wird es später in seinem Buch so formulieren: Par che spirino e sieno vivissimi. Ja, nicht nur als würden sie atmen und leben, sie tun es tatsächlich. Von Anfang an war es mein Ziel gewesen, die Gesichter so auf die Leinwand zu bringen, dass man glauben könnte, im nächsten Moment würden sie zum Betrachter sprechen. Den Moment einzufangen, diesen einen unwiederbringlichen, in dem der Porträtierte all seine Wünsche und Ziele, Sorgen und Freuden in einen einzigen Blick legt. Das ist es, was ich will, und darum lieben die Menschen, die ich male, ihre Abbilder, weil ich sie liebe, weil ich sie studiere und erkenne bis tief in ihre Seele und dennoch niemals verurteile, nicht die Prinzessinnen-Witwe Juana in all ihrer Hässlichkeit, nicht Isabel von Valois mit ihrer plumpen Nase und ihrem unreinen Teint, dem tief in die Stirn hereinwachsenden Scheitel, nicht Felipe mit seinem vorgeschobenen Unterkiefer, der ihm das Kauen sauer machte, nicht Anna von Österreich mit ihrem Rotgesicht und den tränenden Augen. Ich habe sie nicht idealisiert, nicht schöner gemalt, als sie waren, sondern ich habe ihre innere Schönheit, ihre unverwechselbare Eigenart erkannt und zum Leuchten gebracht. Darum liebten sie ihre Porträts, besonders der arme Prinz Carlos, dem ich als eine der wenigen seine menschliche Würde zugestand, die er trotz aller Behinderung dennoch besaß.
Aber damals, vor meiner Abreise, da hatte ich ganz andere Gedanken. Ob ich wohl auch in Spanien die Farben bekommen würde, mit denen ich gewohnt war zu malen?
Dann malst du eben mit spanischen Farben, der Hof ist voller Maler, meinte mein Vater, alle Farben sind die richtigen, wenn die Malerin die richtige ist.
Die letzten Erinnerungen an mein Elternhaus? Helle Lichtbänder wie leuchtende Nebelfäden fingern sich schräg an den Vorhängen vorbei und tänzeln auf dem Bild, das nun doch nicht mehr fertig wird. Wie gerne hätte ich eine Kopie davon mitgenommen, das einzige Bild, das ich von meinem Vater malte, nie hat er Zeit gehabt, stillzusitzen, und jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten.
Das habe ich jetzt davon, sagt mein Vater beim Abschied, dass ich dich wie einen Mann erziehen ließ, jetzt gehst du davon und lebst dein eigenes Leben, ganz wie ein Mann. Aber vergiss nicht, weiter zu malen, als Zeichenlehrerin der Königin wirst du schwerlich in die Geschichte eingehen, denk daran, nur die Porträts der Großen zählen und werden überdauern, und vor allem: Vergiss niemals, ein Bild zu signieren.
2
Die Leinwand
gibt es in verschiedenen Webarten. Sie muss glatt aussehen, darf nicht haarig sein oder Knoten aufweisen. Die einfachste Webart ist die Leinenbindung. Römisches Gewebe ist aus zwei doppelt gedrehten Fäden gemacht und sehr stabil. Auch das Fischgrätenleinen ist ein sehr brauchbarer Malgrund, besonders für große Malereien.
Sie hatten mir alles genommen. Nackt stand ich da, einen Moment lang, einen Augenblick, der sich ins Unendliche dehnte und streckte und immer wiederkehren sollte, in seiner Absolutheit mich erschüttern bis ins Markt, nackt, fröstelnd noch von der Dusche, meine Sachen auf dem Tisch bei meinen Kleidern, ich streckte die Hand danach aus, nichts da, los, bücken, Kniebeugen machen, die Haare lösen, zeigen Sie mal Ihre Fußsohlen, ein Moment, der nicht mehr enden wollte in seiner Entwürdigung und Schamlosigkeit, bis mir die neuen Kleider gereicht wurden, ein blaugraues Bündel, fein säuberlich auf Kante gelegt, aber auch das täuschte nicht darüber hinweg, dass der Stoff alt war und schäbig, verwaschen und ausgebessert, und die fremden Stücke, die ich mit zitternden Fingern versuchte anzuziehen unter den gelangweilten Blicken der fremden Frau in Uniform, diese viel zu großen fremden Kleidungsstücke mit dem Geruch nach Seife und Desinfektionsmittel wisperten und raunten im Rascheln des Überstreifens unerhörte Geschichten von anderen Frauen, die hier gestanden, die sich hier ausgezogen vor fremden Blicken, die intimsten Hautfalten ausgeforscht, los, bücken, Kniebeugen machen, denen man alles genommen, um in ein neues Kleid zu schlüpfen, das namenlos hundert andere mit anderen Schicksalen gekleidet hatte, aber was uns alle verband, das war mir im selben Augenblick bewusst, was alle vereinte, wer immer sie auch waren, vor mir und nach mir, alle empfanden wir diese abgrundtiefe, abschließende Verzweiflung, als hätten wir mit den eigenen Kleidern unsere Identität hergegeben und schlüpften nun in eine neue, aufgezwungene, eine Identität der Anonymität und des Vergessens, denn vergessen werden die hinter diesen Mauern, vergessen und begraben in den Erinnerungen der Menschen, die einem bislang nahestanden, ausradiert und getilgt, und so wird man also eine Nummer, ein Fall, ein Aktenzeichen. Ein Nichts.
Hier die Unterschrift, heißt es dann, und ich zögere lange, die Signatur, natürlich, das abgegriffene Buch verschwimmt vor meinen Augen, gewiss, eine Unterschrift, aber wofür, was, frage ich mich, was geschieht mit meinen persönlichen Dingen?
Fein säuberlich aufgereiht liegen sie vor mir auf dem Tisch. Wie sie da so liegen, erkenne ich sie kaum wieder als die meinen. Fremd sehen sie aus und beliebig. Das alles hat sich also in meinen Taschen gefunden?
Langsam kehrt die Erinnerung zurück. Schlüssel zum Haus, Wohnung, Keller, Atelier, Auto, Fahrrad, Briefkasten – niemals war ich auf den Gedanken gekommen, diese bizarr geformten Metallstückchen könnten mir einmal so viel bedeuten. Fortan würde ich keine Schlüssel mehr besitzen, Schlösser, ja, die gibt es zur Genüge, aber die Schlüssel halten andere in Händen. Dann die Brieftasche, prall gefüllt mit Fotografien. Nein, keine Familienbilder. Oder ja, wenn man so will. Meine Familie ist eben über die ganze Welt verstreut. In den unterschiedlichsten Museen hängen sie an den Wänden. Mein Bruder Asdrubale brach mir also doch noch das Genick. Ich hätte es wissen müssen. Obwohl so etwas wie Waffenruhe geherrscht hatte am Ende, vor allem auch mit Hilfe der spanischen Leibrenten und Pensionen, die ich ihm übertragen hatte, war er mir doch bis zuletzt nicht besonders gut gesinnt. Er der Jüngste, ich die Älteste. Neidete er mir immer, dieser Esel, das Erstgeborenenrecht. Und jetzt, nach Jahrhunderten also die Rache. Dass ausgerechnet sein Porträt bei diesem britischen Sammler auftauchen musste. Mit einem Mal gab es zwei identische Bilder der Sofonisba Anguissola. Der Rest ist in den Zeitungen des März dieses Jahres nachzulesen. Ein Skandal. Aber während er längst schon Geschichte wurde, nahm man mir hier die privaten Dinge ab. Sperrte sie in ein Metallkästchen. Und ich starrte immer noch auf die Liste.
Unterschreiben, werde ich angeherrscht, hier, na wird’s bald, ich ergreife den Kugelschreiber, zögere, ziehe dann die vertrauten Linien, und da steht es, schön und stolz wie eh und je, Sofonisba Anguissola fecit, kühn geschwungen die Initialen, natürlich, mit dem kratzenden Kugelschreiber macht es weit weniger Effekt, Sofonisba Anguissola fecit, dumpf starrt der Hohlkopf in das große Buch mit meiner Signatur, schüttelt den Kopf und schlägt es achtlos zu.
Hände fassen mich an beiden Armen, erst jetzt höre ich, dass man etwas zu mir sagt, lauter und lauter, dann werde ich weitergezerrt, na wird’s bald, und krachend fällt hinter mir eine metallene Tür in ihr metallenes Schloss, und dieser Klang hat etwas so entsetzlich Endgültiges, dass mein Körper in eine Starre verfällt, steif und hart wird er wie ein Brett, nein, schreit Marguerite in mir, nein, nicht das, alles andere, aber nicht das, und weiter geht es im eisernen Griff, ich spüre, wie sich mir die Haare aufrichten, fast tragen sie mich, oder meine gefühllosen Beine bewegen sich mechanisch, Wände gleiten vorüber, grau, Gänge hinunter und durch metallene Türen, die alle, alle mit demselben Ton in ihr Schloss fallen, der mir ins Mark schneidet, Schritte hallen auf Korridoren, sind das unsere, sind das meine, eng und schmal und überall spüre ich Augen, verborgen, aber doch umso deutlicher sehend, es ist wie in dem einen Traum vom Sterben, einen langen, endlosen grauen Korridor entlang und am anderen Ende das Licht, aber hier ist kein Licht, hier wird es düsterer und nur immer noch düsterer, eine Welt ohne Farben, und das Grauen legt sich über mich, das habe ich nicht gewollt, Marguerite schreit in mir, dass ich den Verstand verlieren könnte, dieses Buch hab ich schreiben müssen, schreit sie, versteht ihr, auch wenn es mein Tod sein sollte, ich habe es einfach schreiben müssen, ich hatte keine Wahl, diese Bilder habe ich malen müssen, es ist doch mein Buch, es sind doch meine Bilder, keine Fälschungen, keine Einflüsterungen des Teufels, sondern Verzückung des Geistes, und mein Ich löst sich auf in der Zeit und im Raum, weiß nicht mehr, wer bin ich eigentlich und was und wo zerren sie mich hin, und hier setzt meine Erinnerung aus, dumpf wird es in mir, durch die Jahrhunderte katapultiert mein Sein, Marguerite und Sofonisba, ließ sie hinter mir im Tunnel der Zeit, grau war er und düster und nirgendwo ein Licht, so dämmerte ich dahin ohne einen Funken einer erzählbaren Geschichte, alles hatte ich vergessen, der Schock war endgültig, eine Fortsetzung meiner Traumzustände als heranwachsendes Mädchen, gegen die meine Mutter so verzweifelt ankämpfte, ein Schweben und Verlassen des Hier und Jetzt: Meine Rettung – ja, wie hätte ich bis heute überleben sollen in diesem Hier und Jetzt? Wie denn, nackt und bloß in den fremden Kleidern, in den fremden Räumen, dem fremden Bett ohne alles, nackt wie bei meiner Geburt, nachdem man mich zum Schreien gebracht und in ein fremdes Tuch gewickelt hatte?
Deine Geschichten bringen dich noch um Kopf und Kragen, hat meine Mutter immer gesagt, und sie hatte recht damit. Sie hatte nicht genügend Phantasie, um meine Geschichten zu schätzen. Der Funken Wahnsinn, den man braucht, um mir atemlos zuzuhören und alles andere zu vergessen, ging ihr gründlich ab. Mit Hilfe von Schlägen wollte sie mir die Flausen aus dem Kopf vertreiben, sie hasste Lügen und alles, was nicht der Welt entsprach, die sie sich zurechtgelegt hatte. Es hat nichts genützt. Und ich bin froh darum. Wenn sie mich früher in mein Zimmer sperrte, dann konnte ich ihr entfliehen, schlüpfte durch das Schlüsselloch, schwang mich durchs Fenster auf einem Sonnenstrahl hinüber in eine andere Existenz. Dort spazierte ich unter freieren Himmeln und glücklicheren Sonnen, traf Menschen, die mich verstanden, die mich weder anstaunten noch auslachten. Zweimal wäre ich fast nicht wiedergekommen. Meine Mutter schloss das Zimmer auf, aber ich war noch nicht zurückgekehrt, sie schüttelte meinen Körper, aber meine Seele war noch unterwegs, und wie ich die beiden so sah, meine Mutter, die Zeter und Mordio schrie über meinem wie schlafenden Körper, da wäre ich am liebsten einfach davongeschwebt, hinüber in eine andere Zeit und eine andere Existenz, möglich wäre es durchaus gewesen, aber ich hätte mich entscheiden müssen für ein anderes Hier und Jetzt, und diese Entscheidung habe ich bis heute nicht getroffen.
Ich fand mich also wieder, diesmal nicht mit meiner Mutter, und niemand kam, die Tür aufzusperren, vis-à-vis mit einem breiten, gutmütigen Pfannkuchengesicht, das sich neugierig über mich beugte.
Du bist also doch nicht gestorben, sagte das Pfannkuchengesicht und zeigte beim Grinsen große, feste Zähne, nein, ich war nicht gestorben, oder doch, täglich sterbe ich mehrere Tode, aber tun wir das nicht alle?
Wie heißt du?, fragte der Mund in dem Gesicht, das jetzt nicht mehr lächelte, prüfend betrachteten mich Augen von oben bis unten, am nackten Oberarm leuchtete ein hässliches Tattoo.
Zwei Betten übereinander. Und wie damals hatte ich das Gefühl, festen Grund unter den Füßen verloren zu haben. Eine ähnliche Tätowierung hatte ich schon einmal gesehen. Auf dem Arm eines Matrosen, meine Lippen schmeckten nach Salz und Meer. Schwere See? Gewisslich nicht, ruhig dümpelten wir die Adriaküste entlang, von Genua nach Savona, vorbei an der Küste Monacos, immer in Reich- und Sichtweite des schützenden Ufers, denn auf dem offenen Meer warteten gesetzlose Seeräuber nur darauf, einen Segler wie unseren auszunehmen wie eine reife Nuss. Während Emilia blass und stöhnend in ihrer Koje lag und mit schöner Regelmäßigkeit den Spuckeimer füllte, wusste ich nicht, wo ich genügend Augen, Ohren und Nasen hernehmen sollte, um all die Eindrücke in mich aufzunehmen. Eine Landratte wie ich, das Äußerste an Wasser, was ich gekannt hatte, war der Po, und jetzt stand ich hingerissen auf Deck, einen großen Wollschal um den Kopf geschlungen, und wenn auch meine Augen vom Seewind tränten, so konnte ich mich doch nicht sattsehen, dieses Meer, diese Farben, trunken wurde ich von all den Farben und Gerüchen, von der sich ständig wandelnden Linie der Küste, die unaufhörlich an mir vorüberglitt. Hin und wieder gingen wir vor Anker, und Emilia erhob sich aus ihrem Winkel, um sich ein paar Stunden auf einer festen Landscholle festzukrallen, jammernd, dass selbst das Festland sich hob und senkte und dass sie gewiss sterben würde, ehe wir die spanische Küste erreichten.
Emilia. Warum hatte ich sie nur mitgenommen? Ich wollte jemanden bei mir haben, der mir vertraut war, eine Frau aus meiner Heimat, vor allem Mutter fand, dass es nicht anging, mich alleine mit all diesen Männern auf eine solche Reise zu schicken. Zehn Jahre älter war sie als ich, und doch wie ein Kind, statt mir ein wenig Gesellschaft zu leisten, verwandelte sie sich in ein Häufchen Elend, die Ärmste, sicherlich, ich kümmerte mich um sie, wie um eine Schwester, und doch hatte ich ihr Gejammer spätestens vor Nizza satt. Kein Geld der Welt würde ihr diese Strapaze entgelten können, heulte sie, wenn ich damals gewusst hätte, welchen Ärger ich noch Jahre später mit ihr und diesen verfluchten 250 Golddukaten haben sollte, vielleicht hätte ich sie einfach dort gelassen, jammernd am Hafen, das Taschentuch gegen den Mund gepresst, oder über Bord geschubst, bei einem der wenigen Male, die sie sich auf unserer Fahrt an Deck sehen ließ.
Schließlich verbrachte ich doch meine Zeit mit den Männern, die mich geleiteten. Der Conte Broccardo war ein guter Geschichtenerzähler, er berichtete mir alles, was er über den König wusste und über Isabel, die zukünftige Königin, eine halbe Italienerin mit ihrer Medici-Mutter, und doch französisch erzogen natürlich, als älteste Tochter des Königs von Frankreich. Von Felipes Hof erzählte er mir, an dem man vor Jahren die Burgunder Zeremonie eingeführt hatte, und dabei wurde mir heiß und kalt, denn für nichts hatten wir Anguissolas weniger übrig als für Protokoll und Zeremonien, und die Hofetikette jagte mir schon im Voraus einen Schauer über den Rücken. Der Conte lachte, am besten, du benimmst dich einfach so wie zu Hause, sagte er zu mir, da liegst du immer richtig, und dein Charme, mein Kind, der muss erst noch geboren werden, der dem widerstehen kann.
Und der König, fragte ich, ist er auch charmant, und wieder sah ich ihn vor mir, wie ich ihn gesehen hatte von meinem Platz aus dem geschmückten Fenster unseres Hauses, um den ich mit meinen Schwestern kämpfen musste wie eine Löwin, selten hatte ich mich auf meine Rechte als Älteste berufen, aber hier galt es alles, denn Phillip von Habsburg, Prinz Felipe von Spanien, zog ein in Cremona, und unser Vater ritt in der städtischen Eskorte ihm entgegen. Die Stadt hatte Feststaat angelegt, wir konnten uns alle nicht sattsehen an den prächtigen Fahnen und herausgeputzten Reitern, die schönsten Pferde und Gewänder waren gerade gut genug, und zwischen all diesem Prunk ritt er, blond und schlank und groß erschien er mir auf seinem weißen Pferd, alle hielten den Atem an, davvero un principe, flüsterte meine Mutter, ja, ein Prinz wie aus dem Bilderbuch mit seinem weiß-goldenen Anzug und der stolzen Feder am Hut. Jedes Mädchen in Cremona und sicherlich auf der ganzen Welt, ganz egal, wo sie ihn sahen, träumte nachts von diesem Prinzen, die Töchter Anguissola machten da keine Ausnahme. Das war zehn Jahre her. Vierzehn Jahre war ich damals alt gewesen, und heute reiste ich diesem König entgegen.
Außerdem gibt es noch gar keinen richtigen Hof, riss mich der Conte aus meiner Erinnerung, der König war viele Jahre auf Reisen, hat Kriege führen müssen und die Länder seines weitläufigen Imperiums besucht, seine Schwester Juana hat so lange die Regierungsgeschäfte in Madrid geführt, aber nun wird sich alles ändern.
Oft dachte ich an meine Familie zu Hause, aber völlig ohne Schmerz, auch hier war ich das absolute Gegenteil von Emilia, die, wenn nicht vor Seekrankheit, dann aus Heimweh weinte. Ich dachte an das Leben, das ich bis jetzt geführt hatte, an die Bilder, die mich in Italien bereits bekannt gemacht hatten und, wie man an der spanischen Berufung erkennen konnte, weit über die Grenzen Italiens hinaus. Aber was nun, hatte ich mich das vergangene Jahr des Öfteren gefragt, vierundzwanzig Jahre, höchste Zeit zum Heiraten, aber ich hatte einfach keine Zeit dazu gehabt, und außerdem, wer will schon eine Malerin als Gattin, der einzige Heiratsantrag, den ich vor zwei Jahren erhielt, war eigentlich an dieser Sache gescheitert. Sicherlich, auch die Mitgift wäre ein Problem geworden, aber als Pierluigi zu verstehen gab, dass er und seine Familie die sichere Hoffnung hegten, dass, einmal verheiratet, ich die Pinsel würde ruhen lassen, und seine Villa nicht in eine botega verwandeln würde, da war es auch schon entschieden.
Die berühmtesten Häuser Italiens schätzen sich glücklich, ein Bildnis unserer geliebten Sofonisba ihr Eigen zu nennen, ihr Ruhm ist bereits weit über die Grenzen unseres Landes hinaus gedrungen, und in ein Haus, in dem ihre schönsten Gaben nicht erwünscht sind, wird sie selbstverständlich niemals Einzug halten. So hatte mein Vater geschrieben, und damit war die Sache abgetan.
Also keine Heirat, aber was mir Kummer bereitete, war die Vorstellung, als Blaustrumpf im Hause meiner Eltern mein Leben zu vermalen, das war es nicht, was ich mir erträumte, ich wollte hinaus in die Welt, wollte mein eigenes Leben führen, aber wie, als unverheiratete Frau, wie soll das gehen, denn wenn auch der Name Anguissola in Cremona äußerst angesehen war, so waren wir alles andere als reich. Nach dem ersten Schrecken war mir also die Einladung nach Madrid als eine wahre Fügung des Himmels erschienen.
Und so ließ ich mir alles berichten, alles wollte ich wissen, von Isabel und von Felipe, und viele Stunden verbrachte Broccardo, der sich liebenswürdig um mich kümmerte, damit, meine vielen Fragen zu beantworten. Ein klein wenig war er wohl auch verliebt in mich, aber wir taten beide so, als bemerkten wir es nicht.
Und so erfuhr ich alles, von Felipes erster Ehe, als er noch fast ein Kind war, genau wie seine Braut, Maria von Portugal, die kaum zwei Jahre später auch schon starb an den Folgen der Geburt des Infanten Don Carlos. Von Felipes Liebe zu Portugal, der Heimat seiner Mutter, die ebenfalls früh gestorben war, als Felipe gerade zehn Jahre alt war.
Von der anderen Maria erzählten sie mir erst nach ein paar Wochen während eines heiteren Essens, nachdem sie ein wenig Wein getrunken hatten und Emilia bereits wieder in ihrer Koje lag, Maria Tudor, der Königin von England, mit der Felipe in zweiter Ehe verheiratet gewesen war, ein wahres Monstrum von einer Frau, sagten sie, elf Jahre älter als er und unvorstellbar hässlich. Ja, sagte Broccardo, so ein König ist nicht zu beneiden, seine Ehen sind diplomatische Schachzüge, und da spielen die Liebe und die damit verbundenen Freuden nicht die geringste Rolle. Ein wenig verlegen sah er zu mir herüber, aber ich fragte weiter, stimmt es, dass die englische Königin ein Jahr lang glaubte, schwanger zu sein, und dann löste sich das Kind in Luft auf?
Einen Augenblick lang starrten sie mich alle an, natürlich, es war keine besonders schickliche Frage gewesen, Emilia hätte entsetzt aufgeschrien, aber was sollte dieses Getue, hier waren wir mitten auf dem Meer, seit vielen Tagen in enger Vertrautheit, und wenn diese Männer auch noch so erlaucht waren, so waren es doch Männer, und das Thema hatten schließlich sie auf den Tisch gebracht. Einen Moment also herrschte Stille, und dann brachen sie in unbändiges Gelächter aus, konnten sich kaum noch beruhigen, diese kleine Malerin, sagte Broccardo schließlich, sie trifft den Nagel auf den Kopf, in Luft aufgelöst, das ist das richtige Wort.
Seitdem behandelten sie mich wie eine von ihnen, der Kapitän ließ mich überall auf dem Schiff herumgehen, niemand scheuchte mich mehr von der Brücke, beantwortete mir sogar hin und wieder Fragen über die Navigation, einer der Offiziere, ein verwegener Mann mit einer Tätowierung auf der Hand, erzählte mir von Klippen und Riffen, den verborgenen Landschaften unter Wasser, die so gefährlich für ein Schiff sein konnten und die uns immer wieder zwangen, die Sicherheit der Küste aufzugeben und über das offene Meer zu navigieren. Drei große Segel blähten sich dann knatternd in der Brise, sie waren aus dicker Leinwand gemacht und so fest, wie ich niemals eine Leinwand gesehen hatte, das Muster der Flicken und Nähte leuchtete im Gegenlicht. Seile, stark wie meine Arme, lagen in ordentlichen Rollen auf dem Deck, gerne beobachtete ich die Seeleute, wie sie kunstvolle Knoten schlangen, dann blitzschnell die Segel refften, sah die Seile mit einem surrenden Geräusch wie lebendig gewordene Schlangen in die Höhe schnellen und die riesige Takelage sich ächzend in einen anderen Winkel neigen. Der Wind hatte gedreht. Ich lernte das Schiff kennen und lieben, nicht nur wurde es mir ein Zuhause für diese Reise, ein lebendiger Organismus war es, ich konnte es atmen und stöhnen hören, spürte seine Kraft, wenn der Wind sich erhob, fühlte, wie ein Ruck durch den ganzen hölzernen Rumpf lief und er sich knarrend in die Wellen legte. Was Emilia krank machte, erfüllte mich mit Entzücken, Esperanza, genau der richtige Name für mich und meine Reise, und kaum ein Winkel dieser „Hoffnung“ blieb mir verborgen. Sein gewölbter Bauch war labyrinthisch verschlungen wie das Innere eines Wales, immer tiefer ging es hinab, vorbei an der Kombüse, wo der Küchenjunge Rüben schabte und mich wie eine Erscheinung anstarrte, hinunter und vorbei an den Kajüten der Matrosen, tief hinab zum Lagerraum, wo sich Gallonen voller Wein aus dem Asti und Säcke mit Granturco stapelten. Dort unten war eine eigene Welt, dumpf roch es nach Teer und Tang, die Wände knackten, und die Vorstellung, dass mich nur diese Holzschale vom Meereswasser und seinen seltsamen Bewohner trennte, jagte mich wieder die Stiegen hinauf, einen kurzen Moment lang erfasste mich abgrundtiefe Panik, als ich die richtige Treppe nicht gleich fand, eine Tür war zugefallen und klemmte, das Schiff legte sich ein wenig auf die Seite, ich konnte mich gerade noch halten, und in diesen unendlichen Augenblicken des Eingeschlossenseins befiel mich eine Angst, die ich völlig vergessen hatte, eine Erinnerung an Marguerites Kerker, eine Vorahnung meiner jetzigen Zelle. Aber dann sprang die Tür auf, und wenige Minuten später stand ich an Deck, und der Herbstwind blies mir den Schrecken aus den Gliedern.
Auf der Höhe von Marseille begleitete uns zu meiner großen Freude einen Tag lang eine Schule von Delphinen. Lachend sah ich zu, wie sie ihre glänzenden Leiber aus dem Wasser hoben und dann wieder unter die Wellen schlüpften, jeder hatte eine andere Färbung, grau oder gefleckt, ein besonders mutiger, der sich so nah ans Schiff heranwagte, dass ich seine Augen sehen konnte, war von einem hellen Braun, Sepia mit Ocker vermischt, andere schimmerten nahezu schwarz. Sogar Emilia, die ich aus dem Bett gezerrt hatte, vergaß für ein paar Minuten ihr Elend und starrte mit runden Augen auf diese wundersame Eskorte.
Nachts, wenn die Hitze in unserer Kajüte unerträglich war, schlich ich mich an Deck und betrachtete die Gestirne des Himmels. Klein erschien mir da mein eigenes Leben, ein Wimpernschlag im Universum, und wenn ein Sternensplitter leuchtend seine Linie durch dieses Muster zog, um kurz darauf zu verlöschen, dann flüsterte ich meinen Wunsch in die Nacht, Herr, schenk mir ein günstiges Schicksal, dort, in der Fremde, mach, dass sie mich malen lassen und meine Bilder Gefallen finden, und noch leiser, unhörbar für Menschenohren, formten meine Lippen: Lass mich berühmt werden, wie Michelangelo, wie Tiziano, mach, dass meine Bilder überdauern.
Den Sternenhimmel. Wie lange habe ich nicht mehr auf ihn geachtet. Und heute. Einen Stuhl muss ich unters Fenster ziehen, mich hinaufstellen, und dann, wenn ich Glück habe, rücken zwei oder drei Gestirne in mein Gesichtsfeld.
Untersuchungshaft. Was hast du getan, fragte Marie gleich zu Beginn, eine Flut von Fragen und ich immer noch benommen, ein Traum, ein schlechter, ich war wieder in den Bauch des Schiffes geraten, muffig und dumpf die Luft und diese unvorstellbare Enge. Aber dieses Schiff hatte einen anderen Namen, keine Hoffnung trug mich nach Spanien, hier schien ich an einem Ende angekommen zu sein, und dieser Gedanke verschlug sogar mir die Sprache.
Die erste Zeit war mir der Mund wie zugenäht. Ich sprach kein Wort. Mit niemandem. Marie war es bald leid, mitunter schrie sie mich an, da hätte man sie ja genauso gut in eine Einzelsuite sperren können, die Wände anstarren, ganz allein, statt sie mit einer Schwachsinnigen und Stummen und Tauben einzuschließen, ja hat man noch Töne. Dann, irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann, das Gefühl für Zeit war mir endgültig abhandengekommen in diesem Einerlei aus Licht an und Licht aus, eines Tages, als die Zellen aufgesperrt waren, da packten sie mich, eine wirre Traube von graublauen Weibern, die Aufsicht war gerade mal nirgendwo zu sehen, packten mich und zogen mir das Kleid hoch, ich schrie wie am Spieß, aha, sagte jemand, schreien kann sie also, und suchten meinen Körper ab nach irgendeinem Mal, einem Zeichen, keine Ahnung, aber am nächsten Tag erklärte man mir, ich müsse mich tätowieren lassen.
Das kommt nicht in Frage, sagte ich ruhig.
Wie bitte, meinte eine große Schwarzhaarige mit kräftigen Wangenknochen und Augen wie Umbraerde, habt ihr was gehört? Das Frettchen kann sprechen.
Und ob ich sprechen kann, sagte ich möglichst ruhig, und tätowieren lasse ich mich von niemandem. Wenn, dann mach ich das selbst. Ich bin nämlich Malerin.
Da herrschte Schweigen. Manche sperrten das Maul auf, so überrascht waren sie von allem auf einmal, dass ich gesprochen hatte und von diesen verwirrenden Informationen, aber die Schwarze lachte und zeigte gefährliche, spitze Zähne, Malerin, höhnte sie, das kann ja jeder behaupten, und ich bin Sängerin, HoHoHoHo, schmetterte sie einen Dreiklang in die Luft, der ganz passabel klang, ein wenig blechern, aber kräftig.
Nicht schlecht, sagte ich. Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Du bist die schwarze Sängerin.
Alle lachten. Und ich begann zu erzählen. Erzählte einfach drauflos, wie es mir gerade in den Sinn kam. Von der schwarzen Sängerin und ihrer Liebe zu dem Kellner in der schäbigen Spelunke, in der sie auftrat und mit ihrer Stimme die Menschen verzauberte. Eine richtige Schnulze gab ich zum Besten, in der nicht die Intrigen fehlten noch der finstere Gangsterboss, der dafür sorgte, dass der Geliebte der Sängerin im Gefängnis landete, wo ihm die Mithäftlinge übel mitspielten. Ja, wirklich übel, denn er wollte sich nicht tätowieren lassen, um keinen Preis, nein, sagte er, meine Geliebte, die schwarze Sängerin, soll meinen Körper genauso wiederfinden, wie sie ihn kennt, ohne Mal und Zeichen, und ich dachte schon, jetzt hast du zu dick aufgetragen, aber die Zeit ging dahin, still und andächtig standen und saßen die Frauen um mich herum und lauschten, und als es Zeit zum Einschluss wurde, hatten die Aufseherinnen alle Hände voll zu tun, die Zeichen standen auf Meuterei, und erst, als ich versprach, am nächsten Tag weiterzuerzählen, wanderten sie in ihre Zellen. Still, ganz still.
Von da an war nie wieder die Rede von einem Tattoo.
So hätte es sein sollen. Ist doch eine schöne Geschichte. Die Erinnerung ist eine Tyrannin, die Wiederholung des Schreckens, das, was du von ihr erbittest, das hält sie verschlossen, aber die Schmerzen, die, die du vergessen willst, um Vergessen bettelst wie damals um die Gnade, die dir nicht zuteilwurde, heiß das Eisen auf deiner Haut, diese Szenen schickt sie dir immer wieder, quält dich aufs Neue, wie Marguerite, sie ist das beste Beispiel, und auch dieses Mal fuhr sie auf, und wieder gellte ihr Schrei durch alle Stockwerke, ihr Todesschrei, dass allen die Haare zu Berge standen, so lange ist das noch gar nicht her, die Wunden sind gerade eben vernarbt, außen, nicht innen, die Nächte zeigen mir immer aufs Neue, dass gar nichts verheilt ist. Und wenn mich eine von ihnen wieder anfasst am Arm, aus Versehen, oder um meine Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, muss ich mich beherrschen, nicht laut zu schreien, lass mich los, rühr mich nicht an.
So hätte die Geschichte sein können, oder auch anders, schließlich bin ich eine Geschichtenerzählerin, vielleicht hätte ich ihnen sagen sollen, dass ich sie nicht verachte, dass ich nicht aus Hochmut schwieg, sondern dass ich einfach noch nicht angekommen war in diesem Hier und Jetzt, aber die Worte waren anderswo, und überhaupt war keine Zeit zum Reden, und mit dem Eisen haben sie meine Ankunft beschleunigt. Ja. Jetzt bin ich angekommen. Das Land unter meinen Füßen hört zwar immer noch nicht auf zu schwanken, aber ich habe begriffen, was es heißt: Untersuchungshaft. Man schließt dich weg, um deinen Fall in Ruhe zu untersuchen. Aber das ist nicht alles. Man liefert dich aus. Denn hier gelten nicht die Paragraphen der Juristen. Hier herrschen andere Gesetze, ein Interregnum, das in dem Moment einsetzt, wenn die Wärterinnen wegschauen. Ja, Wärterinnen. Ich weiß, dass sie das nicht mögen. Wir sind doch nicht im Zoo, und ihr seid keine Tiere, hat mir die mit den Hasenzähnen neulich gesagt. Und was unterscheidet uns?, hab ich sie gefragt. Hier gelten die Gesetze der Tierwelt. Eine führt das Rudel. Einer Neuen im Revier wird erst einmal gezeigt, wer die Stärkere ist. Raubtiere hinter Gittern. Das sind wir. Nichts anderes. Schafe überleben hier nicht lange. Schafe werden gefressen. Ihr Fell findet sich am Morgen in der Zelle. Aber ich lasse mich nicht täuschen. Nichts wird jemals mehr sein, wie es war.
3
Um gebrannten Venezianischen Lack
zu erhalten, nimmt man Karmin aus den Cochenille-Schildläusen und brennt ihn unter ständigem Rühren im silbernen Suppenlöffel über dem Feuer.
Marguerite. Marguerite kann nicht schlafen, Marguerite liegt wach und sieht wieder das Feuer. Es ist stickig in unserer Zelle, eineinhalb Meter über mir die Zimmerdecke, unter mir atmet Marie die ganze kostbare Luft weg, ein Stöhnen, ein Raunen, der Kerker, die feuchte Luft, die wie die Angst in die Knochen kriecht, das härene Gewand und der Schrecken, der mich lähmt, ich schließe die Augen, versuche, mich zu entspannen, aber die Wunden schmerzen, nein, ich bin gar nicht in der Zelle, auf der Krankenstation liege ich, ja warum denn, was ist denn passiert ..., und Marguerite liegt wach, sie hält Wache, sie passt auf und wird mich warnen, wenn sie kommen, kann also beruhigt schlafen, aber ich werfe mich im Bett herum, wie Feuer brennt es zwischen den Beinen, mit weit gespreizten Schenkeln liege ich, wie in Erwartung meines Geliebten, aber kein Geliebter, keine Wonnen, sondern Schmerzen und Feuer. Marguerite schlägt Alarm, da sind sie wieder, und richtig, sie kommen, jetzt bin ich darauf gefasst, nicht wie damals, erst ein paar Tage, gerade erst hat man die Tür hinter mir geschlossen, noch sehe ich dieses Pfannkuchengesicht, werbistdu, wieheißtdu, washastdugetan, aber ich kann nicht reden, bin noch ganz benommen, bin noch gar nicht hier, will nicht hier sein, das ist ein Irrtum, sie werden kommen und mich herausholen, dasgehtdochnicht, daskönntihrdochnichttun, ich verkrieche mich in einer Ecke, washabichdenngetan, Gesicht zur Wand, wenn ich nicht hinsehe, dann sind sie auch nicht da, wenn ich sie nicht sehe, dann sehen sie auch mich nicht, alter Kinderirrtum, natürlich, hast du doch gewusst, und wenn Sofonisba schon hier gewesen wäre, wenn sie nicht noch so lange bei ihren Bildern verweilt hätte oder sonst irgendwo, vielleicht wäre alles gar nicht passiert, aber so erwachte Marguerite in mir, zitternd, mit aufgerissenen Augen, ich habe dieses Buch schreiben müssen, welches Buch verdammt noch mal, ich habe diese Bilder malen müssen, wovon redet die, ist vielleicht übergeschnappt, und von da an hör ich gar nichts, seh ich gar nichts, was gehen diese Schatten mich an, die Schatten aus einer anderen Zeit, und mit einem Mal werde ich gepackt, werde hochgehoben und auf die Beine gestellt, vor mir sehe ich eine Frau, groß, mit langen schwarzen Haaren, die Arme hängen wie die eines Affen seitlich an ihr herunter, ich kenne sie nicht, nein, auch Marguerite hat keine Erinnerung, kein Band verbindet mich mit dieser Frau, die jetzt den Mund öffnet, die Lippen bewegt, kleine spitze Zähne hat sie, aber ich kann nicht hören, was sie sagt, bin zu weit weg, bin aus einer anderen Zeit, das Gesicht wird kalt und hart, und plötzlich fährt ihre Faust nach vorne, ich kann sie ganz langsam auf mich zukommen sehen, wie in Zeitlupe, sehe von außen, wie sie in meinen Bauch trifft, mein Körper, den ich nicht fühle, klappt zusammen wie ein Taschenmesser, ich werde aufgefangen und aufgehoben und weggetragen, und finde mich wieder in der Küche, dort legen sie mich auf einen Tisch, zwei halten meine Arme, so zwingen sie mich nieder, ziehen mein Kleid hinauf, als wollten sie es mir ausziehen, aber auf halbem Weg lassen sie mich darin stecken, den Rock über dem Kopf, fange ich jetzt endlich an, mich zu winden, was mir nichts nützt, nur dass sie den Stoff fester um mein Gesicht ziehen und mir die Luft abschnüren, dann reißen sie meine Unterhose herunter, meine Beine werden gepackt und gespreizt, ich fange an zu schreien, zu rufen, aber noch immer weiß ich nicht, was geschieht, versuche zu strampeln, aber sie halten mich fest im eisernen Griff, und da fühle ich das Feuer, das Marguerite versengt, auf der Innenseite meines Schenkels, dort in der Leiste, wo der Schenkel endet und übergeht in die Scham, der Schmerz durchfährt mich wie die Spitze eines langen Messers, wühlt in mir, es zischt, und ich schreie, ich bäume mich auf und ich winde mich, ja, ich kenne diesen Schmerz, jahrhundertelang hat er auf mich gelauert in den geheimsten Verliesen meiner Erinnerung, Marguerite fährt auf, verlässt diesen Körper und sieht diese Szene, sieht mich auf dem Küchentisch liegen, fünf halten mich fest, Folterknechte wie damals, die schlimme Tortur, aber ich widerrufe nicht, nein, niemals, immer werde ich zu diesem Buch stehen, dem „Spiegel der einfachen Seele“, diese Seele hält alles aus, diese Seele überlebt und überdauert und sammelt alles an, um es so viel später, in anderen Zeiten und Welten, wieder auszuspucken, die Vereinigung der Liebenden ist wie ein loderndes Feuer, das brennt, ohne dass man es anfacht, aber hier ist keine Liebe, hier ist die Abwesenheit der Liebe, das Fegefeuer. Und diese Frau hält einen glühenden Löffel in der Hand, hält ihn mit einem Topflappen und plaziert ihn mit kalter Ruhe neben meinem Geschlecht, einmal, die Kante brennt sich tief in meine Haut an dieser zartesten Stelle, sie verwandelt sich in einen Teufel, hält einen glühenden Spieß, fürchtet das purgatorio, predigt der Bischof von Toledo, dass es mir den Schauder über den Rücken jagt, damals bin ich davongekommen, damals hat mich die Inquisition nicht erwischt, Gründe hätte man auch damals gefunden, nicht nur Marguerite hat gebrannt, so viele Autodafés, aber hier, diese Frau mit dem Löffel in der Stockwerksküche, damit diese Frauen sich auch mal selbst eine Mahlzeit zubereiten können, verwandelt sich die Küche in eine Folterkammer, die Frau hält den Löffel, den unschuldigen Suppenlöffel mit einer besonders schönen Rundung, hält ihn wieder über die Gasflamme am Herd, wieder und wieder, Marguerite sieht es genau, mit zwei Löffelbogen brennt sie mir ein Zeichen ein, einen Buchstaben, ein S, meine Stimme unter dem Kleiderstoff zerbricht, mir wird übel, mein Magen stülpt sich nach außen, ich huste, verschlucke mich an meiner eigenen Kotze, halt still, Fotze, hör ich die Frau, sonst rutscht er mir aus und erwischt deine Klit, so ein schönes Branding, wirst sehen, hat nicht jede, etwas ganz Besonderes, so wie du, und wieder spüre ich die Kante des Eisens, diesmal auf der anderen Seite, Marguerite sieht es mit Entsetzen, drei Mal berührt mich das Feuer, noch ein Buchstabe, ein A: S und A, damit dein Macker, die geile Sau, was zu lesen hat, wenn du ihm das nächste Mal die Beine öffnest, damit du niemals vergisst, wo du warst, aber da ist Marguerite wieder in mir, und auch Sofonisba ist wer weiß woher endlich angekommen, mir wachsen Riesenkräfte, vielleicht ist es auch das Gefühl zu ersticken, zu ertrinken im Schmerz, zu verbrennen, es gelingt mir, einen Arm loszuwinden, den Kleiderknebel von meinem Gesicht zu reißen, Luft fährt in meine Lungen, und da gellt dieser Schrei, Marguerites Todesschrei, über die Place de Grève schallt er und durch das ganze Gefängnis, durch diese ganze verdammte Stadt, diese Welt, durch die Zeit, Felipe Segundo an seinem Schreibtisch hebt stirnrunzelnd den Kopf, meine Mutter lässt in Cremona ihre Handarbeit sinken, auch er, der geliebte Kapitän, fährt auf aus seinem Schlaf in seiner Kajüte, Sofonisba, flüstert er, ist etwas passiert – ja was geht denn hier vor, höre ich die Stimme einer Aufsicht, und dann verliere ich das Bewusstsein, treibe hinüber zu ihm, sinke ihm in die Arme, tränenüberströmt, nimm mich mit, bettle ich, lasse mich dort nie wieder allein, und ich fühle wieder das Schwanken des Schiffes, das Wiegen seiner Arme und falle in einen tiefen, dunklen, abgrundschwarzen Schlaf.
Wäre ich doch nie wieder aus ihm erwacht. Jetzt erwache ich leicht, an dem kleinsten Geräusch, und dieses Haus ist voll davon. Dann liege ich da, lausche, fühle die Gegenwart von all diesen Frauen, wie sie aufgestapelt in den Zellen liegen, über und unter und neben mir, spüre ihr Atmen, einen singenden Ton ergibt es, einen durchaus vertrauten Klang, Marguerite kennt ihn, Marguerite liebte ihn, es war der Klang ihrer Heimat, ihrer Zuflucht, ein Haus voller Frauen, das war ihr Leben, jede ganz anders und jede so einzigartig, jede hatte eine andere Geschichte und ihren eigenen Grund, warum sie in das Haus der Beginen in Valencienne gekommen war, sich für diese Art von einem eigenen Leben entschieden hatte, fern der Familie wollten sie leben und waren nicht gewillt, eine Ehe einzugehen, Gott wollten sie dienen, aber nach ihren eigenen Vorstellungen, frei wollten sie sein und sich nicht Klosterregeln unterordnen, keinem Geringeren als Gott selbst wollten sie die Treue halten und keinem von Menschen formulierten Gelübde. Und Marguerite hört wieder den nächtlichen Atem ihrer Schwestern im Geiste, Francine, die Gärtnerin, die Hebamme Bernadette, Adeline, die die schönsten Tambourets und Handtrommeln baute, die man sich denken konnte, und die Melodien erfand zu Marguerites Liedern, Ich sag mich von der Tugend los, für alle Zeit ..., Adeline war es auch, die sie begleitete auf ihren Reisen in die Dörfer und Städte, die die große Trommel schlug bei ihren Vorträgen und den Takt angab für die Lieder. Aber – wie anders waren die Nächte im Haus der Beginen, ganz anders als hier, erst später, dem Ende zu, schlich sich die Angst ein unter diesem Dach, aber sie wurde nicht Herr, ich ließ es nicht zu, und meine Schwestern bestärkten mich, ich war erfüllt von der Zuversicht, dass der Herr mich sicher behüten würde, er war es, der mich dies Buch schreiben hieß, er hieß mich die Fackel entzünden, die Fackel der alles versengenden Liebe, er war der wirkliche Autor dieses Buches, was war ich anderes als sein bescheidenes Werkzeug? Aber die Angst, die damals so lange nicht von mir Besitz ergreifen konnte, erst ganz zuletzt, ganz zuletzt warf sie mich nieder auf das Pflaster der Place de la Grève an jenem 1. Juni 1310 zu Paris.
Und heute, heute fühle ich sie wieder, höre sie in den Geräuschen der Nacht dieser Vollzugsanstalt, diese Angst, die auch Sofonisba kennenlernen sollte, aber erst viel später, nicht im Schlafsaal der königlichen Hofdamen, nein, sagt sie, damals in Madrid, da hatte unser Schlaf einen ganz anderen Klang: sechszehn junge Frauen in sechszehn Betten, mit Paravents notdürftig voneinander abgetrennt, eine winzige Spur von Intimität, auch damals wurde das Licht gelöscht zu einer bestimmten Stunde, aber dort war es doch unser freier Wille, jede kam und ging, wie sie es wollte, jedenfalls des Tags, und keusch waren wir alle mehr oder weniger, und die süße Sehnsucht nach weniger Keuschheit, die Erwartung der Liebe, der körperlichen Freuden, die wilden Phantasien, all das stand jeden Abend deutlich im Raum, auch wenn sie noch eine Weile miteinander kicherten, sich neckten, das Nachthemd versteckten, zueinander ins Bettchen schlüpften, um sich zu kitzeln, bis sie schrien, so waren das alles Rituale des Wartens, getragen von dieser Wolke der Sinnlichkeit, diesem Duft der Lust, und der alte Haudegen, die Guardiamenor, tat gut daran, Fenster und Türen fest zu verschließen, auch wenn es kein wirkliches Hindernis darstellte – die, die unbedingt wollten, die fanden einen Weg zu ihren Liebsten, anders als hier, wo die Brunft mit ihrem bitteren Geruch über allen Gängen hängt, aber nicht die kleinste Hoffnung auf eine Erfüllung. Hier sind es die grausamen Rituale des Hasses und der Verzweiflung, die Hoffnung mag auch hier in den Ecken kauern, die Hoffnung zählt an den Fingern ab: Jahre, Monate – wie lange?, lautet hier die alles bestimmende Frage. Zwei Jahre. Oder drei. Und Marie, die unter mir liegt und schnarcht? Vier Jahre sechs Monate. Wie lange ist das? Eintausendsechshundertzwanzig Tage. Achtundreißigtausendachthundertachtzig Stunden. Zweimillionendreihundertzweiunddreißigtausendachthundert Minuten. Und gegen die Zeiger der Uhr geht sie in Revision, damit sie ihr ein kleineres Stückchen abschneiden vom Zeitkuchen, einen Happen, den sie glaubt, verdauen zu können. Und so ist die Hoffnung hier Zwillingsschwester der Verzweiflung, die Zeit verwarten müssen, die Zeit zur Gegnerin haben, endlose Minuten in den schlaflosen Nächten, unterbrochen von schweren Träumen, und wenn du hochschreckst, sind gerade einmal zehn Minuten vergangen.
Es ist stickig in dieser Zelle. Ich bekomme keine Luft. Marguerite spürt wieder die Panik in sich aufsteigen. Ich setze mich auf mit einem Ruck, fühle die Zimmerdecke kurz über mir. Das Fenster. Ich muss das Fenster öffnen! Ich strecke mich: An zwei Seiten erreiche ich Wand und oben die Decke, aber das Fenster, gerade mal ein halber Meter fehlt zwischen meiner ausgestreckten Hand und dem Griff, es nützt nichts, mich weiter aus dem Bett zu lehnen, ich habe es sicherlich schon hundertmal versucht.