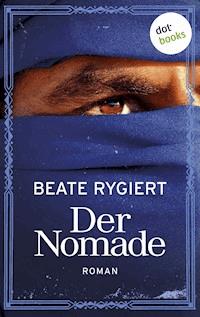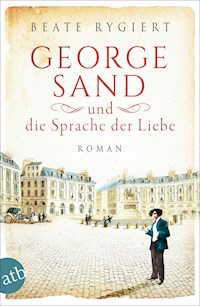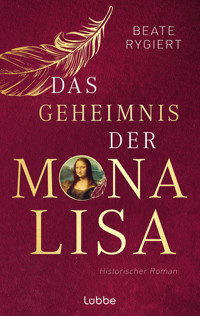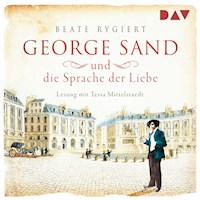9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch und Liebe
- Sprache: Deutsch
„Ohne Dich ist doch alles nichts.“ Christiane Vulpius Weimar, 1788.
Christiane Vulpius ist Putzmacherin in einer Kunstblumen-Manufaktur, als sie mit der Bittschrift ihres Bruders beim Geheimen Rat Goethe, dem begehrtesten Junggesellen Weimars, vorstellig wird. Gesellschaftlich trennen sie Welten, und doch ist es für beide Liebe auf den ersten Blick. Zunächst können sie ihr leidenschaftliches Verhältnis geheim halten. Als Christiane jedoch schwanger wird, schlagen ihr vonseiten der „guten Gesellschaft“ Hass und Verachtung entgegen. Wird Goethe zu ihr und dem Kind stehen? Christiane verliert nicht den Mut, sondern kämpft um ihre Liebe.
Die Geschichte einer unkonventionellen und mutigen Frau – kenntnisreich und hochemotional erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
»Ohne Dich ist doch alles nichts.« Christiane Vulpius
Weimar, 1788: Christiane Vulpius ist Putzmacherin in einer Kunstblumen-Manufaktur, als sie mit der Bittschrift ihres Bruders beim Geheimen Rat Goethe, dem begehrtesten Junggesellen Weimars, vorstellig wird. Gesellschaftlich trennen sie Welten, und doch ist es für beide Liebe auf den ersten Blick. Zunächst können sie ihr leidenschaftliches Verhältnis geheim halten. Als Christiane jedoch schwanger wird, schlagen ihr vonseiten der »guten Gesellschaft« Hass und Verachtung entgegen. Wird Goethe zu ihr und dem Kind stehen? Christiane verliert nicht den Mut, sondern kämpft um ihre Liebe.
Die Geschichte einer unkonventionellen und mutigen Frau – kenntnisreich und hochemotional erzählt
Über Beate Rygiert
Beate Rygiert wurde in Tübingen geboren und wuchs im Nordschwarzwald auf. Mit zwölf schrieb sie in ihr Tagebuch: »Eigentlich möchte ich Schriftstellerin werden!« Diesen Traum verwirklichte sie nach dem Studium der Musik- und Theaterwissenschaft und der italienischen Literatur in München und Florenz und nach einigen Jahren als Operndramaturgin an verschiedenen deutschen Bühnen. Heute lebt sie mit ihrem Mann im Schwarzwald, in Andalusien und immer wieder in Frankreich.
Im Aufbau Taschenbuch sind bereits ihre Romane »George Sand und die Sprache der Liebe« und »Die Pianistin. Clara Schumann und die Musik der Liebe« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Beate Rygiert
Frau von Goethe
Er ist der größte Dichter seiner Zeit, doch erst ihre Liebe kann ihn retten
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Impressum
Ich liebe dich recht herzlich und einzig,
Du glaubst nicht wie ich dich vermisse …
WOLFGANG AN CHRISTIANE,
FRANKFURT, 15. AUGUST 1797
Dein Garten steht gegenwärtig in seiner größten Pracht (…). Die Apfelbäume blühen in höchster Fülle, es steht Blüte an Blüte, die Rabatten vor Deinen Fenstern schmücken die schönsten gefüllten Tulipanen, deren schöne Farbe die stolzen Kaiserkronen verdunkeln, und trotz der geringen Wärme und den kühlen Nächten reift doch alles der Vollkommenheit entgegen. Möge Dich die schöne Blüte in Jena für diese Entbehrung reichlichst entschädigen.
CHRISTIANE AN WOLFGANG,
WEIMAR, 18. MAI 1816
1. Kapitel
Weimar, Juni 1788
Die Kutsche mit dem Wappen des Freiherrn von Stein donnerte den Graben herauf und bog derart ungestüm in die Neue Straße ein, dass Christiane nur knapp den Hufen der Pferde entkam.
»Seid ihr denn noch bei Trost?«, schrie sie auf und sah im selben Augenblick, wie der leichte Vorhang vor dem Fenster der Kabine zur Seite geschoben wurde. Ein eiskalter Blick traf sie aus hellblauen Augen unter einer kunstvoll aufgetürmten Steckfrisur.
»Himmel!«, hörte sie ihre Freundin Hanne rufen. »Die hätten dich glatt umgebracht. War das nicht ie Frau von Stein?«
Christiane besah sich ihren besudelten Rocksaum. Die Kutsche war mitten durch eine Pfütze gerumpelt und sie hatte das Schmutzwasser abbekommen.
»Sieh dir das mal an«, sagte sie aufgebracht. Erst neulich hatte sie das Kleidungsstück, das noch von ihrer Mutter stammte, gewendet und ihrer Größe angepasst.
»Das geht beim Waschen wieder raus«, tröstete Hanne. »Komm, wir sollten uns beeilen, sonst kommen wir zu spät.«
Hanne hatte wie Christiane und elf weitere Töchter aus gutem, jedoch verarmtem Hause in der Bertuchschen Manufaktur für Kunstblumen Arbeit gefunden. Dabei war es eine Schande, dass Hannes Vater als herzoglicher Amtsschreiber zu wenig verdiente, um seine Familie ernähren zu können. Christianes Vater war es, wie so vielen anderen, nicht besser ergangen. Johann Friedrich Vulpius hatte sogar ganze zehn Jahre umsonst für den Herzoglichen Hof arbeiten müssen, ehe er nach endlosen Bittschriften und Gesuchen endlich einen Hungerlohn erhalten hatte, der hinten und vorne nicht gereicht hatte. Vor zwei Jahren war er gestorben, und nicht nur er ruhte bei seinen Ahnen im Familiengrab auf dem Gottesacker rund um die Jacobskirche, sondern auch Christianes Mutter und ihre Stiefmutter samt sieben ihrer jüngeren Geschwister, die das Kindesalter nicht überlebt hatten. Jetzt hatte sie nur noch den um zwei Jahre älteren Bruder Christian, ihre vierzehnjährige Stiefschwester Ernestina und Tante Juliane, eine ledige Schwester ihres Vaters.
Das hätte nicht sein müssen, davon war Christiane überzeugt. Mit ausreichend Nahrung wäre so manch ein Familienmitglied noch am Leben. Doch es hatte an allem gefehlt, vor allem an Geld für einen Arzt und Medizin. Schaudernd dachte sie an diese schrecklichen Jahre zurück, besonders an 1782, als die beiden jüngsten, von ihr heiß geliebten Geschwister kurz hintereinander gestorben waren, ausgemergelt und viel zu schwach, um sich gegen Krankheiten wehren zu können. Inzwischen war es Christiane, die den kleinen Frauenhaushalt ernährte, während ihr großer Bruder, ein studierter Jurist, in Nürnberg eine Stelle als Schreiber innehatte. Einen äußerst schlecht bezahlten Posten, und es sah so aus, als sollte er auch den bald verlieren, weil ein anderer junger Mann seine Dienste für noch weniger Gehalt angeboten hatte. Und was dann? Es war so schwer, eine angemessene Stelle zu finden. Dabei war Christian so begabt …
»Hat Christian mal wieder etwas Neues geschrieben?« Hannes Augen leuchteten. Es war kein Geheimnis, dass sie für Christianes älteren Bruder schwärmte. Christian wiederum hatte Hanne als Vierzehnjähriger in einem handgeschriebenen und -gezeichneten Büchlein verewigt, genau wie seine Schwester und einige Klassenkameraden. Wenn einer vor Phantasie nur so sprühte, dann Christianes Bruder.
»Ich weiß nicht«, antwortete sie. »Sicher hat er keine Zeit mehr dafür.«
Hanne und sie hatten inzwischen das prächtige Gebäude am Baumgarten erreicht. Sechs Jahre war es her, dass Christiane Friedrich Justin Bertuchs Angebot angenommen hatte, in der damals gerade erst gegründeten Manufaktur zu arbeiten. Dies war ein Privileg, und Christiane verdankte es der Freundschaft ihres Vaters zu dem Geschäftsmann und Verleger. Bertuch war sogar Taufpate ihres jüngsten Bruders gewesen, und offenbar hatte er das Elend der Familie Vulpius nicht mehr länger mit ansehen können.
»Wie siehst du denn aus?«
Natürlich war es Friederike von Aberstein, die bei ihrer Ankunft in den Räumen der Manufaktur Christianes Rock mit gerümpfter Nase musterte. Die meisten der Putzmacherinnen saßen bereits auf ihren Plätzen, Henriette fehlte noch, genau wie Dorothea, die alle Dorle nannten.
»Eine Kutsche hätte sie beinahe totgefahren«, antwortete Hanne an ihrer Stelle, während Christiane ihr Umschlagtuch ablegte und die Arbeitsschürze überzog. »Das war der Wagen der Frau von Stein. Die Christel kann froh sein, dass es nur ihren Rock erwischt hat.«
»Die Frau von Stein?« Friederike lachte. »Die ist stocksauer. Wie ich hörte, macht sie allen das Leben zur Hölle, vor allem Franz, dem Kutscher. Kein Wunder, dass der die Pferde so jagt.«
Sie nahm am Tisch über Eck neben Christiane Platz, damit sie von ihr endlich lernte, wie man Seidenblumen herstellte. Lustlos schlug Friederike das Baumwolltuch auf, in dem sie wie alle anderen ihre Arbeit vom Vortag aufbewahrte, und betrachtete die einzelnen Blütenblätter, die einmal eine Mohnblüte ergeben sollten. »Seit der Geheime Rat aus Italien zurück ist, hat sie nur noch schlechte Laune. Und wisst ihr auch, warum?«
Frau Bertuch betrat den Saal, gefolgt von Auguste Slevoigt. Die beiden Schwestern hatten die Manufaktur gegründet und damit guten Geschäftssinn bewiesen, denn seit ein paar Jahren wünschte sich jede Dame, die etwas auf sich hielt, Seidenblüten, und je echter sie wirkten, desto besser. Bislang hatte man sie für teures Geld direkt aus Paris bezogen, um damit Kleider und Hüte zu verzieren oder sie als niemals welkende Arrangements auf dem Tisch oder der Anrichte zu platzieren. Aber warum aus Paris beziehen?, hatten sich die Unternehmerinnen gefragt und beschlossen, solche Blumen selbst zu produzieren. Der Erfolg gab ihnen recht. Die Manufaktur war bis auf Monate mit Bestellungen ausgelastet. Wer Blüten aus der Bertuchschen Blumenmanufaktur haben wollte, musste Geduld haben.
Die gutmütige Hanne versuchte, Friederike zu bedeuten, besser den Mund zu halten, die Direktorinnen schätzten es nämlich gar nicht, wenn ihre Schützlinge tratschten. Doch die bemerkte es nicht und fuhr unbekümmert fort: »Die von Stein ist so unglaublich wütend, weil …«
»Friederike von Aberstein«, schallte Frau Slevoigts Stimme durch den Raum. »Wenn Ihre Finger im Umgang mit Samt und Seide so behände wären wie Ihre Zunge, dann würden Sie die anderen bei Weitem überflügeln. Da dem aber nicht so ist, wünsche ich von Ihnen heute kein überflüssiges Wort mehr zu hören. Haben Sie mich verstanden?«
»Sehr wohl, Frau Slevoigt«, erklärte Friederike und zog eine Grimasse, die nur ihre Kolleginnen sehen konnten.
»Bislang gaben Sie uns kaum Anlass, mit Ihrer Arbeit zufrieden zu sein«, fuhr Auguste Slevoigt fort. »Wenn ich nicht irre, haben Sie keine einzige annehmbare Blüte zustande gebracht, seit Sie bei uns sind. Stattdessen verderben Sie das kostbare Material. Wenn sich das in absehbarer Zeit nicht ändert …«
»Es wird sich ändern«, unterbrach Friederike sie und senkte devot den Kopf. »Ganz bestimmt. Geben Sie mir ein wenig Zeit, und Sie werden begeistert sein.«
Caroline Bertuchs Mund verzog sich zu einem nachsichtigen Lächeln. Sie hatte ein gutmütiges Herz und überließ den Umgang mit den Putzmacherinnen meist ihrer Schwester, vor allem, wenn es etwas zu tadeln galt. Der Direktorin war es neben dem Profit auch ein Anliegen, verarmten Mädchen und jungen Frauen aus gutem Hause wie Christiane eine Existenz zu ermöglichen. Bei dem reißenden Absatz, den die wunderschönen Stoffblumen, die hier entstanden, in deutschen Landen und sogar in England fanden, war ihr dies möglich geworden. Und Christiane war mehr als dankbar. Ohne diese Anstellung hätte sie nicht gewusst, wie sie auf ehrbare Weise den Unterhalt für sich, Ernestina und die Tante hätte verdienen können.
»Denken Sie immer daran«, sagte Frau Slevoigt zu Friederike, »dass auf meiner Liste noch mindestens zwölf junge Frauen stehen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Ihren Platz einzunehmen.«
Friederike zog die Schultern ein und schwieg. Christiane warf einen Blick in die Runde an dem großen Arbeitstisch. Dorle und Henriette waren inzwischen unauffällig hereingeschlüpft und hatten sich wie alle anderen über ihre Handarbeit gebeugt. Das Schweigen währte allerdings nur so lange, bis die beiden Direktorinnen den Raum wieder verlassen hatten.
»Jetzt erzähl schon«, sagte Hanne mit Blick zur Tür, hinter der ihre Arbeitgeberinnen verschwunden waren. »Wieso ist Frau von Stein so wütend?«
»Na, weil er nichts mehr von ihr wissen will, der Herr von Goethe«, warf Henriette ein, doch Friederike war offenbar entschlossen, sich die Geschichte nicht aus der Hand nehmen zu lassen.
»Meine Schwester ist ja Zofe bei ihr«, erklärte sie wichtigtuerisch. »Und deshalb weiß ich alles aus erster Hand.«
»Ist deine Schwester nicht Dienstmädchen bei der Freifrau?«, mischte sich nun Marie Zoller ein. Ihr Vater war Jagdmeister beim Herzog und im Grunde, so fand Christiane, hatte sie es nicht nötig, hier zu arbeiten. Jeder wusste, wie begeistert der Herzog vom Jagen war, vor allem seit Herr von Goethe in Weimar lebte. Maries Vater bezog sicherlich ein besseres Gehalt als die anderen Beamten. »Die Nanni ist doch keine Zofe!«
»Das ist doch jetzt egal!« Friederike war rot geworden. Obwohl ihre Familie dem niederen Adel angehörte, waren die von Abersteins arm wie die Kirchenmäuse. »Jedenfalls hat sie erzählt, dass von der einstigen Harmonie zwischen den beiden nichts mehr übrig ist. Eisige Kälte herrsche zwischen Charlotte von Stein und dem Geheimen Rat von Goethe. Und das läge an Italien und was er dort alles so erlebt hat. Und ich spreche nicht nur von der Kunst«, fügte sie vielsagend hinzu.
»Er sieht wirklich gut aus«, rief Henriette verzückt aus. »Noch viel besser als früher. So schlank und braun gebrannt …«
»Wie ein Türke vor Wien, sagt mein Vater.« Marie kniff mit der Zange ein Stück Draht ab und tauchte es in eine Schale mit Leim. Protest erhob sich. Der Geheime Rat Johann Wolfgang von Goethe war der schönste und begehrteste Mann weit und breit, und es gab, so behauptete Henriette, keine Frau, die nicht für ihn schwärmte.
»Wahrscheinlich ist ihm in Italien klar geworden«, überlegte Dorle laut, »dass seine Liebe zu Frau von Stein keine Zukunft hat. Schließlich ist sie verheiratet und viel älter als er. Ich bin gespannt, wen er einmal heiraten wird.«
»Dich bestimmt nicht«, rief Friederike und einige kicherten.
»Natürlich nicht«, erwiderte Dorle, die rot geworden war. »Für unsereins ist so ein Mann unerreichbar.«
»Tja, solange man nicht dem Adel angehört«, gab Friederike spitz zurück. Dorle und Henriette wechselten vielsagende Blicke. Keine von ihnen konnte die arrogante Friederike wirklich leiden. Mal tat sie so, als gehöre sie zu ihnen, vor allem, wenn sie Hilfe bei der Arbeit benötigte. Dann wieder brüstete sie sich mit ihrem Adelstitel und gab sich als etwas Besseres.
»Ach, rechnest du dir etwa Chancen aus?«, wagte sich Marie Zoller vor und erntete schallendes Gelächter.
Nur Christiane stimmte nicht mit ein. Seit der Name des Geheimen Rats Johann Wolfgang von Goethe gefallen war, musste sie an das Versprechen denken, das sie ihrem Bruder gegeben hatte.
»Bitte, Christel, überreiche ihm diesen Brief«, hatte Christian gesagt. »Ich brauche eine neue Anstellung. Ich habe doch nicht jahrelang Jura studiert, um diesem einfältigen Mann den Schreiberling zu machen. Aber ohne Fürsprache komme ich aus diesem jämmerlichen Stand niemals heraus.«
»Warum gibst du ihn dem Herrn von Goethe nicht selbst?«, hatte sie gefragt und den versiegelten Brief gedreht und gewendet. Der Gedanke, bei dem Geheimen Rat vorzusprechen, war ihr unangenehm. Immerhin war Goethe neben dem Herzog höchstpersönlich der mächtigste Mann im Land.
»Kein Mensch weiß, wann er aus Italien zurückkommt. Und ich kann nicht länger warten, sonst bin ich meine Anstellung gleich los.«
»Könntest du den Brief nicht per Post schicken, wenn Herr von Goethe zurück in Weimar ist?«
Da hatte ihr Bruder ihre beiden Hände ergriffen und sie so flehentlich angesehen, dass ihr Widerstand dahingeschmolzen war. Von klein auf hatten sie zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Christian hatte ihr das Lesen und Schreiben beigebracht, denn nur Jungen durften kostenfrei das Gymnasium besuchen, während für Mädchen Schulgeld verlangt wurde. Das war eine dieser vielen Ungerechtigkeiten, die Christiane und ihre Freundinnen zu ertragen hatten, und deshalb hatte Christian seiner Schwester vieles von dem beigebracht, was an der Schule unterrichtet wurde. Lesen und Schreiben. Und vor allem das Rechnen. Sie liebte das Lernen. Und noch mehr liebte sie das Theater, das Komödienhaus, in das Christian sie regelmäßig mitgenommen hatte, als Gymnasiast hatte er oft Freibilletts bekommen.
»Wenn du ihm mein Bittschreiben überreichst«, hatte er gesagt, »hat das eine viel größere Wirkung.«
»Und warum soll das so sein?«, hatte sie misstrauisch gefragt. Spielte er etwa auf ihr Aussehen an? Sie konnte es nicht leiden, wenn die Männer ihr wegen ihrer dichten, schwarzen Locken und ihrem Busen hinterhersahen.
»Weil du ein so wundervolles Geschöpf bist, mein Schwesterchen«, hatte er geantwortet. »Weißt du noch, wie es dir gelungen ist, Vater aus dem Kerker zu holen?«
»Er war ja schließlich unschuldig«, hatte sie trotzig zurückgegeben. Ihr tat das Herz weh, wenn sie an die ungerechten Vorwürfe dachte, die man ihrem Vater gemacht hatte. Er sollte Geld unterschlagen haben. Ausgerechnet er.
»Wie eine Löwin hast du darum gekämpft, dass man ihn rehabilitierte«, fuhr Christian fort.
»Du weißt genau, dass mir das nicht gelungen ist«, entgegnete sie traurig.
»Immerhin hast du erreicht, dass er wieder in Dienst genommen wurde. Und als er starb, wer war es da, der die Ämter so lange bestürmt hat, bis uns eine angemessene Waisenrente ausgezahlt wurde? Das Tinchen bezieht sie ja immer noch. Du wirst auch erreichen, dass der Herr von Goethe mich nicht ganz vergisst. Schließlich bin ich Schriftsteller, so wie er. Bitte, tu mir den Gefallen, Christel.«
Seither lag dieser Brief wie Blei in der Schublade ihrer Kommode. Seit zwei Wochen war der Geheime Rat von Goethe zurück in Weimar. Auf welche Weise sollte sie ihm Christians Bittgesuch bloß überbringen, im Amt hielt er sich ja gar nicht mehr auf? Darüber zerbrach sie sich schon die ganze Zeit den Kopf …
Während sie solchen Gedanken nachhing, hatten ihre Hände die am Vortag zugeschnittenen Kelch- und Blütenblätter einer Kamelie mit ihrem Metallwerkzeug, das wie ein schmaler Löffel aussah, in die charakteristische gewölbte Form gebracht. Dazu hatte sie es über einer Kerze erhitzt und wie mit einem winzigen Bügeleisen eine Delle in die Mitte des Seidenstoffs gedrückt. An den Wänden der Manufaktur hingen botanische Kupferstiche, auf denen alle Arten von Pflanzen in allen Facetten dargestellt waren. Selbst das Innenleben der Blüten war auf diesen Radierungen anhand eines Querschnitts samt der exakten Form ihrer Blätter, Knospen und Samen offengelegt. Das war außerordentlich hilfreich, denn eine hochwertige Kunstblume musste von innen nach außen ihrer lebendigen Schwester genaustens nachgebaut werden, eine aufwendige Arbeit. Vor allem für die feinen Staubfäden und den Stempel brauchte man geschickte Finger, aber es lohnte sich. Durch diese Details wirkte die Arbeit erst echt. Und da keine Blüte in der Natur perfekt war, fertigte Christiane für besonders lebensechte Gestecke mitunter halb verblühte Exemplare und Knospen, so dass das Ganze wirkte, wie direkt vom Strauch geschnitten.
Christiane liebte Blumen. Es war ein Glück, dass es der Tante gelungen war, bei ihrer Wohnung in der Jacobsgasse auch den Garten anzumieten. Außerdem hatte Christiane gemeinsam mit ihrem Bruder ein kleines Stück Land vor den Toren der Stadt erworben. Hier wie dort pflanzten sie Gemüse an, allerlei Wurzeln, Kohl und Kartoffeln, und wenn sie ein paar Groschen übrig hatten, kauften sie Gurken- und Kürbissamen oder tauschten mit Nachbarn Jungpflanzen aus, um mehr Abwechslung auf den Teller zu bekommen. Ernestina sammelte auf den Wiesen vor den Stadttoren wilden Salat und essbare Blüten. Am Rand des Hausgartens wuchsen ein paar uralte Johannisbeersträucher, die sie erst vor Kurzem abgeerntet und aus den Beeren, die nicht gleich aufgegessen worden waren, Saft gekocht hatte. Christiane liebte die warme Jahreszeit, dann war ihr Speiseplan reichhaltig, während sie mit sauer eingelegtem Kohl, den eingebunkerten Kartoffeln und Rübchen und natürlich mit dem Korn, das Ernestina als Waise vom Rentamt jährlich erhielt, über den Winter kommen mussten. Die größte Freude hatte sie allerdings an ihren Blumen …
Den Stiel der Kamelie hatte Christiane bereits am Tag zuvor angefertigt. Nun befestigte sie an seinem Ende das Büschel leuchtend gelber Staubgefäße samt dem Blütenstempel und umwickelte den Blütenboden mit grünem Seidenband.
»Wie geschickt du bist!« Friederike betrachtete neidisch die Blüte, die unter Christianes Händen nach und nach Gestalt annahm. »Ich kann mir einfach nicht merken, welcher Schritt nach dem anderen kommt. Liebe, liebe Christel«, bettelte sie, »würdest du es mir noch einmal zeigen? Ich meine, von Grund auf?« Friederike sah sie mit einem Blick an, von dem sie wohl glaubte, er sei unwiderstehlich. Christiane stöhnte innerlich. Sie hatte ihr das schon so oft gezeigt.
»Natürlich erst, wenn du mit dieser hier fertig bist«, schob ihre Kollegin rasch hinterher.
»Pass bloß auf, Christel«, rief Marie vom anderen Ende des Tischs herüber. »Am Ende bringt sie dich dazu, die gesamte Blüte anzufertigen. So wie bei mir neulich. Immer lässt sie andere für sich arbeiten.«
»Gar nicht wahr!«
»Es ist wohl wahr«, gab Marie ärgerlich zurück. »Das ist doch nicht so schwer zu begreifen. Immerhin machst du nur ganz einfache Mohnblüten. Schau dir dagegen mal diese Pfingstrose an!« Sie hob eine prächtige, fast vollendete Päonie hoch.
»Aber diese gefiederten Blätter«, warf Friederike empört ein und wies auf den kolorierten Kupferstich an der Wand, auf dem eine blühende Mohnpflanze abgebildet war. »Seht euch die mal an. Wie soll man das bloß hinbekommen?«
»Ist schon gut«, beruhigte Christiane die Gemüter. »Ich zeige es dir noch einmal. Noch ein einziges Mal, hörst du, Rike? Danach musst du es selbst …«
»Ach, du bist ein Engel«, fiel ihr Friederike überglücklich ins Wort.
Seufzend besah Christiane sich, was ihre Kollegin bislang zustande gebracht hatte. Den Stiel konnte man zur Not so lassen, wie er war. Die Blätter hingegen waren nicht zu gebrauchen.
»Es ist wirklich nicht schwierig, wenn du es richtig anpackst«, begann sie zu erklären. »Du nimmst diesen feinen Draht hier und biegst damit das Blattgerüst zurecht. Dabei folgst du einfach den Blattadern.« Christiane hatte eine feine Zange zur Hand genommen und begann mit geschickten Bewegungen, die fedrige Struktur des Mohnlaubs nachzubilden. »Siehst du?« Friederike nickte eifrig. »Und nun muss es auf den Stoff geklebt werden.« Christiane tauchte das Blattgerüst kurz in ein Metallgefäß mit flüssigem Leim, ließ es eine Weile abtropfen und legte es auf ein Stück dunkelgrün gefärbter Seide. »Danach muss das Blatt auf seiner Unterseite mit einem Stück Organza doubliert werden, damit man den Draht nicht sieht.« Sie nahm einen Pinsel und trug sorgfältig etwas Leim auf das Blatt samt Drahtgeflecht auf, legte ein Stückchen Organza darauf und strich behutsam von innen nach außen den überschüssigen Klebstoff heraus.
»Sobald das getrocknet ist, schneidest du mit der Schere rund um den Draht die Blattform aus, so wie hier auf dem Bild.« Sie wies auf den Kupferstich. »Inzwischen machst du einfach Blätter auf Vorrat für weitere Blumen. Du wirst sehen, von Blatt zu Blatt wird es dir leichter fallen. Und wenn sie nicht alle exakt gleich werden, umso besser. Auch in der Natur gleicht kein Blatt dem anderen.« Friederike nahm zögernd das feuchte Blatt in die Hand und betrachtete es von allen Seiten. Christiane reichte ihr Draht und Zange und schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. Doch Friederike wirkte enttäuscht.
»Hier muss man ja erst noch die Kerben einarbeiten. Kannst du nicht vielleicht …«
»Rike, bitte, das hab ich dir schon zweimal gezeigt. Das schaffst du jetzt alleine.«
Christiane wandte sich ihrer Kamelie zu und setzte zügig die leuchtend roten Blütenblätter um den Kranz aus gelben Staubgefäßen, befestigte jedes einzelne geschickt mit Draht und fügte schließlich die Kelchblätter wie einen grünen Kragen rundherum an.
»Du hast gesagt, du machst mir die Blume von Anfang bis Ende«, begann Friederike zu quengeln.
»Nein, das habe ich nicht«, erklärte Christiane entschlossen. »Wir alle haben dir so oft geholfen. Jetzt musst du dich allein durchbeißen.« Konzentriert beendete sie ihre Kamelie und beachtete Friederike nicht weiter. Sie hoffte, an diesem Tag vier weitere Blüten fertig zu bekommen und außerdem für den folgenden Tag die Kelchblätter für die nächste Bestellung zu präparieren. Diesmal sollte es ein Körbchen voller Frühlingsblumen sein und sie freute sich auf die Herausforderung. Maiglöckchen waren in der Manufaktur bislang nicht hergestellt worden und Frau Slevoigt hatte Christiane mit dieser schwierigen Aufgabe betraut. Wenn sie auch mit diesen ihr Geschick bewiese, würde sie eine Zulage erhalten, hatte ihre Arbeitgeberin versprochen. Und die konnte sie wahrlich gebrauchen.
Christiane hatte gerade die zweite Kamelie an diesem Tag beendet, als nicht nur Frau Slevoigt, sondern auch das Ehepaar Bertuch in der Werkstatt erschien. Der Unternehmer ließ sich bei ihnen normalerweise nie sehen, und Christiane hatte sofort das Gefühl, dass sein Erscheinen nichts Gutes bedeuten konnte.
»Im Lager fehlt eine ganze Rolle Silberdraht«, begann er ohne Umschweife. »Da sie gestern noch da war, muss sie jemand von euch genommen haben. Ich möchte jetzt bitte wissen, wer das war.« Er machte eine Pause und sah jeder einzelnen streng in die Augen. »Wenn sich die Schuldige jetzt und hier meldet, werde ich davon absehen, die Sache den Behörden zu melden. Also bitte. Ich warte.«
Keine der Putzmacherinnen wagte zu atmen. Christiane war bestürzt. In den ganzen sechs Jahren, in denen sie hier arbeitete, war so etwas nicht vorgekommen. Allein der Gedanke, eine von ihnen könnte eine Diebin sein, war entsetzlich. Genauso empfand es wohl auch seine Frau, die mit zusammengekniffenen Lippen die Kupferstiche an der Wand zu betrachten schien und jeden Blickkontakt mit ihren Angestellten vermied. Ihre Schwester jedoch musterte ihre Belegschaft ungehalten.
»Na, es liegt ja wohl auf der Hand, wer das war«, unterbrach Friederike von Aberstein die angespannte Stille. »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.« Sie richtete ihren Blick auf Christiane. »Schließlich saß schon der alte Vulpius wegen Diebstahls im Kerker.«
Christiane schoss das Blut ins Gesicht. Wenn sie eins nicht ertragen konnte, dann waren es solche Reden über ihren Vater.
»Nimm das sofort zurück«, fauchte sie.
Friederike lehnte sich mit einem arroganten Lächeln zurück und verschränkte die Arme vor ihrer Brust. Auf einmal ging alles ganz schnell. Christiane schnellte von ihrem Stuhl hoch und verpasste ihr eine deftige Ohrfeige, die das Mädchen beinahe vom Stuhl gefegt hätte. Friederike stieß einen Schrei aus, sprang auf und wich vor Christiane zurück, die aussah, als wollte sie sich gleich erneut auf sie stürzen.
»Nimm das zurück!«
Doch ehe Christiane sie an den Haaren packen konnte, hielt Friedrich Justin Bertuch sie am Arm fest.
»Ganz ruhig«, sagte er leise. »Beruhige dich, Christel. Ich weiß, dass du das nicht getan hast. Ebenso wenig wie dein Vater damals schuldig war. Komm, setz dich hin.«
So rasch der Zorn sie überfallen hatte, so plötzlich wich er einer abgrundtiefen Traurigkeit. Einer Verzweiflung, die in ihr lauerte, seit ihre Mutter und all die anderen, die sie liebte, sie mit Christian und Ernestina allein zurückgelassen hatten. Und obwohl Christiane das alles sonst stets in den Tiefen ihres Innern verborgen hielt und immer ein fröhliches Gesicht zeigte, brach sie jetzt zum Entsetzen aller in Tränen aus.
***
Am Ende wurde es nichts aus dem Arbeitspensum, das sie sich für diesen Tag vorgenommen hatte. In ihrem Büro ließ Frau Bertuch Christiane auf dem Besuchersessel Platz nehmen und schenkte ihr ein Glas süßen Wein ein, damit sie sich beruhigte.
»Mein Vater war kein Dieb«, schluchzte Christiane und gab acht, dass sie nichts von dem Wein verschüttete, so sehr zitterten ihre Hände. Durch die geschlossene Tür drang die schneidende Stimme von Frau Slevoigt, die Friederike zurechtwies und herauszufinden versuchte, wer den Silberdraht entwendet hatte.
»Natürlich war er das nicht.« Herr Bertuch stand vor dem Regal mit den Auftragsordnern und hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Die Anklage wurde ja fallen gelassen. Vielleicht hatte irgendwer ein Interesse daran, ihm zu schaden, wer weiß.« Er wechselte einen Blick mit seiner Frau. »Am besten gehst du jetzt nach Hause, Christel.«
»Sie … Sie werfen mich doch nicht etwa raus?« Christiane sah ihn mit ängstlich aufgerissenen Augen an. »Ich hab den Silberdraht nicht genommen. Noch nie hab ich auch nur den kleinsten Fetzen Seidenstoff oder sonst etwas …«
»Das wissen wir«, unterbrach Frau Bertuch sie sanft. »Selbstverständlich wirst du weiterhin bei uns arbeiten. Wir trennen uns bestimmt nicht von unserer besten Mitarbeiterin. Aber nach der Aufregung geben wir dir heute Nachmittag frei. Komm morgen früh wieder, wenn du dich beruhigt hast.«
Christiane schluckte schwer.
»Ich kann es mir nicht leisten, auf einen halben Arbeitstag zu verzichten«, sagte sie leise. »Wir brauchen das Geld.«
Frau Bertuch nickte, öffnete eine Schatulle auf ihrem Schreibtisch und entnahm ihr eine funkelnde Münze.
»Das wollte ich dir eigentlich erst Ende der Woche geben. Ein Extralohn, weil du so gut und schnell arbeitest. Ich denke, du kannst ihn jetzt schon gebrauchen. Geh nach Haus und hör auf, dir Sorgen zu machen. Grüß mir deine Tante.«
Ein Strahlen lief über Christianes Gesicht, als sie das Geldstück entgegennahm, das einem ganzen Wochenlohn entsprach.
»Vergelte es Ihnen Gott«, sagte sie. »Das ist sehr großzügig von Ihnen.«
***
Draußen auf der Straße wusste sie zunächst nicht, was sie tun sollte. Wenn sie jetzt nach Hause ging, würde sie alles erzählen müssen und damit Ernestina und die Tante in Aufregung versetzen. Eigentlich hatte sie angenommen, dass inzwischen Gras über die Sache mit ihrem Vater gewachsen war. Die jüngeren Putzmacherinnen konnten sich an die Geschichte seiner Kerkerhaft und Degradierung schon gar nicht mehr erinnern. Doch nun hatte Friederike von Aberstein die alten Wunden erneut aufgerissen. Und wenn auch so bedeutende Männer wie Herr Bertuch sagten, dass er ihrer Meinung nach unschuldig gewesen war, so klebte allein an der Tatsache, dass er ganze vier Tage im Kerker hatte zubringen müssen, etwas Schändliches. Damals war Christiane von Pontius zu Pilatus gelaufen und hatte schließlich erreicht, dass Johann Friedrich Vulpius freigelassen wurde. Dennoch war er danach nicht mehr derselbe gewesen. Seinen alten Posten, den hatte er nicht mehr bekommen.
Die Sonne brach durch die Wolken und ihre Strahlen wärmten ihr Gesicht. Christianes Herz wurde ein wenig leichter. Es war nun einmal ihre Art, sich auch im größten Kummer die Zuversicht zu erhalten, dass alles gut werden würde. Einfach, weil die Welt so schön war und Christiane nicht aufhören konnte, über ihre Wunder zu staunen.
Die Münze lag warm in ihrer Hand. Sie könnte sich ausnahmsweise etwas Süßes kaufen, und allein beim Gedanken daran lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Nichts war tröstlicher als ein paar Mandelmakronen, wenn man traurig war.
Wie von allein trugen ihre Füße sie zur Zuckerbäckerei am Markt. Erst vor der prächtigen Auslage im Fenster besann sie sich. Sie sollte das Geld Tante Juliane bringen und es nicht für einen solch vergänglichen Genuss vergeuden. Und dennoch. Es war so lange her, dass sie etwas zum Naschen gehabt hatte. Das letzte Mal hatte sie sich an Weihnachten eine dieser Köstlichkeiten auf der Zunge zergehen lassen können. Heute hatte sie süßen Trost definitiv nötig.
»Drei Mandelmakronen«, sagte sie zu der Frau des Zuckerbäckers. Und als ihr plötzlich in den Sinn kam, wohin ihr Weg sie als Nächstes führen würde, korrigierte sie sich rasch. »Vier, meine ich.«
Sie nahm die rosa-weiß gestreifte, unten spitz zulaufende Papiertüte entgegen und zählte die vielen kleinen Münzen nach, die sie zurückbekam. An der Tür atmete sie noch einmal tief den Duft der Backwaren ein. Draußen kämpfte sie ihre Gier nieder, das Tütchen auf der Stelle leer zu futtern, und lief so schnell sie konnte zur Jacobskirche. Eilig stieg sie die steilen Treppen bis unters Dach zur Türmerwohnung hinauf.
»Onkel Fridolin!«, rief sie außer Atem. »Bist du da?«
»Wo soll ich wohl sonst sein?«, antwortete eine knarzige Stimme von oben. Fridolin Ernst Melchior Vulpius stand auf der Schwelle seiner winzigen Wohnung und reckte seinen Kopf, um zu sehen, wer da kam. »Ja, die Christel, glaub ich es denn! Pass auf deinen Kopf auf«, ermahnte er Christiane im breitesten Thüringisch und trat beiseite, um sie durch die niedrige Türöffnung hereinzulassen. »Groß bist du geworden«, sagte der Stadttürmer und musterte sie eingehend. »Richtig erwachsen.«
»Ich war schon ewig nicht mehr hier.« Verlegen umarmte Christiane den Onkel. Dünn und knorrig war er geworden. Wie genau sie um mehrere Ecken miteinander verwandt waren, wusste sie gar nicht so genau. »Hier«, sagte sie und hielt die Zuckerbäckertüte hoch. »Ich hab dir etwas mitgebracht.«
»Plätzchen?«, fragte der Alte erstaunt. »Eine Kanne Bier wär mir lieber.«
»Bier kannst du jeden Tag trinken«, gab Christiane lachend zurück. »Das hier ist etwas ganz Besonderes. Komm, probier mal.«
Sie nahm einen Teller von dem Bord an der Wand und legte eine der Mandelmakronen für ihn und eine für sich selbst darauf. Die beiden anderen hob sie für die Tante und Ernestina auf.
Andächtig aßen die beiden die seltene Leckerei. Dann erkundigte sich der Onkel nach Juliane und dem Tinchen, wie er Ernestina nannte. »Dass du dich an den alten Onkel Fridolin erinnerst«, sagte er forschend und betrachtete sie aus seinen hellwachen Augen. »Es ist hoffentlich nichts passiert? Im ersten Moment hast du mir einen Schrecken eingejagt.«
»Es ist nichts passiert«, beruhigte Christiane ihn und schluckte. Sie musste wieder an Friederike denken, die sie doch tatsächlich des Diebstahls bezichtigt hatte. Dennoch gab sie sich Mühe, fröhlich zu sein. »Ich hatte einfach Lust, dich zu besuchen nach der langen Zeit.«
Ihr Blick glitt an den Wänden entlang, blieb an der Trompete hängen, die griffbereit an einem Haken hing. Zweimal am Tag, morgens und abends, teilte der Stadttürmer der Bevölkerung mit seinem fanfarenartigen Spiel mit, dass es Tag beziehungsweise Nacht wurde und die Stadttore geöffnet oder geschlossen wurden. Auch bei Bränden schlug er Alarm. Erst vor vierzehn Jahren war das Stadtschloss nach einem Blitzschlag bis auf die Grundmauern niedergebrannt, Christiane erinnerte sich gut daran, obwohl sie damals erst neun gewesen war. Die schwarz verkohlten Ruinen gemahnten noch immer an diese fürchterliche Nacht. Seit der Zeit wohnte die Herzogfamilie im sogenannten Fürstenhaus gegenüber der Bibliothek.
Sie stand auf und trat an eines der schmalen Fenster. Der Blick über die Stadt war schwindelerregend. Mauersegler schossen um den Kirchturm. Sie flogen tief, bald würde es wohl Regen geben.
»Du hast es gut«, sagte sie nachdenklich. »Von hier wirkt das Treiben da unten wie Puppentheater. Den Lärm hört man gar nicht …«
»Ja, Ruhe gibt es reichlich, seit meine Rosalie tot ist«, antwortete Fridolin Vulpius mit diesem ironischen Unterton, der so typisch für ihn und fast alle männlichen Verwandten ihrer Familie war. Auch Christian hatte davon eine tüchtige Portion abbekommen, und deshalb waren seine Schriften so unterhaltsam. »Wann wirst du eigentlich heiraten? Gehst du noch mit dem Gust?«
»Nein«, antwortete sie und drehte sich zu ihm um. »Ich hab Schluss gemacht. Er hätte mich eh nicht geheiratet, sein Vater wäre niemals damit einverstanden gewesen.«
»Aber warum denn nicht?«
»Denen bin ich zu arm«, gab Christiane trotzig zurück. »Der alte Schmied will eine Schwiegertochter mit Mitgift. Und ich hab keine Lust, mich mit jemandem zu treffen, der es nicht ernst genug meint, um sich gegen seinen Vater zu behaupten.«
Lange sah Christiane aus allen vier Fenstern der Türmerwohnung, so lange, bis Gust aus ihren Gedanken verschwunden war und auch das dumme Gerede dieser blöden Gans von Aberstein und ihre unverschämte Anschuldigung an Bedeutung verloren hatte. Sie waren immer anders gewesen, die »Vulpiusse«, wie man sie nannte. Ihr Großvater mütterlicherseits war Strumpffabrikant und ein angesehener und wohlhabender Mann gewesen. Und auf der väterlichen Seite hatte es einen Pastor nach dem anderen gegeben. Erst als ihr Großvater statt Theologie unbedingt Jura hatte studieren müssen und ihr Vater ebenso, hatte ihr sozialer Abstieg begonnen. Weil die Herzöge es vorzogen, kostspielige Schlösser zu bauen und prunkvolle Feste zu feiern, Treibjagden zu veranstalten und sich Mätressen zu halten, statt ihren Beamten ihren Lohn auszuzahlen. Man fand keine Arbeit als Jurist, und wenn, wurde sie nicht honoriert.
»Du und der Christian«, unterbrach Onkel Fridolin ihre Gedanken, »ihr habt euch doch das Bürgerrecht erkauft.«
»Ja, vor vier Jahren«, antwortete sie stolz. Einfach war das nicht gewesen. Um in die Bürgerschaft aufgenommen zu werden, musste man Land besitzen, aus diesem Grund hatten sie auch das Gartengrundstück außerhalb der Stadttore gekauft. Die Eintragung ins Bürgerbuch und die Urkunden ließ sich der Herzog teuer bezahlen, außerdem mussten sie Brand- und Baumsteuer entrichten und einen Löscheimer aus Leder anschaffen.
»Das ist gut«, brummte der Alte. »Als Bürger können euch die feinen Herrschaften nicht ganz so arg auf den Kopf spucken. Es ist schon schlimm genug, wie sie unsereins behandeln.«
Eine Weile redeten sie noch über dies und das, Fridolin erzählte von seinem Sohn, der ihm bald im Amt nachfolgen und dann endlich heiraten würde.
»Große Sprünge kann man hier oben zwar nicht machen«, sagte er lakonisch und machte eine Geste, die sein wenige Quadratmeter großes Reich umfasste. »Nun, es ist besser als nichts. Und die Stellung ist wenigstens bezahlt.«
»Du bist der wichtigste Mann in ganz Weimar«, antwortete Christiane und ihre Augen blitzten vor Schalk. »Wenn du mal verschläfst, machen sie das Tor nicht auf am Morgen. Das Geschrei möchte ich hören!«
Onkel Fridolin verzog sein Gesicht zu einem breiten Grinsen.
»Wer weiß«, sagte er. »Vielleicht mach ich das an meinem allerletzten Arbeitstag.«
***
Beschwingt verließ Christiane den Kirchturm und nahm sich vor, bald wieder bei dem Türmer vorbeizuschauen. Bevor sie nach Hause ging, erstand sie von dem restlichen Geld, das sie an diesem Tag erhalten hatte, dringend notwendige Dinge. Eine neue Porzellankanne, denn bei der alten war zu Tante Julianes Leidwesen am Tag zuvor die Tülle abgebrochen. Nadeln und Faden zur Ausbesserung getragener Kleidung. Helles Mehl, um das grobe braune ein wenig zu verfeinern. Ein Töpfchen Schmalz und, als einzig Exotisches, eine Zitrone.
Sie wusste auch nicht so recht, warum. Die Früchte sahen so frisch und appetitlich aus mit ihrer leuchtend gelben Schale und dem dunkelgrünen Blättchen, das noch am Stiel haftete. Automatisch überlegte sie, wie sie es aus gelackter Seide nachbauen könnte. Und die Frucht selbst? Aus Wachs. Vielleicht sollte sie das Frau Bertuch mal vorschlagen?
»Wie blühen Zitronen eigentlich?«, fragte sie die Obsthändlerin.
Diese starrte sie aus kleinen Äuglein erstaunt an.
»Was weiß denn ich«, gab sie unwirsch zurück.
»Weiß«, tönte es aus dem Innern des Ladens. Aus der Tür trat ein Mann.
»Die Blüten sind weiß und sehen aus wie winzige, fünfzackige Sterne.« Dann ergriff er einen prächtig gefüllten Obstkorb, nickte der Verkäuferin zu und ging mit großen Schritten davon.
»Der Herr Seidel muss es wissen«, erklärte die Obsthändlerin gewichtig. Und als Christiane sie verständnislos ansah, fügte sie hinzu: »Na, das ist doch der Hausdiener bei dem Herrn von Goethe. Und der war ja gerade in Italien.«
Christiane wandte sich um, doch von dem Mann war nichts mehr zu sehen. Schade. Ihn hätte sie fragen sollen, wie sie am besten seinen Herrn persönlich sprechen könnte. Jetzt war es zu spät.
2. Kapitel
Weimar, Juni 1788
Ich bin nur hier, um meinen Lohn abzuholen.« Friederike von Aberstein stand trotzig mitten in der Manufaktur und vermied es, einer ihrer ehemaligen Kolleginnen in die Augen zu sehen.
»Kommst du nicht mehr zur Arbeit?«, wollte Lilli Schönthaler, eines der jüngeren Mädchen, mitfühlend wissen. »Man hat dir doch gar nicht gekündigt.«
»Nein, natürlich nicht«, entgegnete Friederike. »Schließlich habe ich mir nichts zuschulden kommen lassen, so wie manch eine hier.« Sie warf einen verächtlichen Blick in die Runde. »Aber mein Onkel hat endlich ein Machtwort gesprochen. Eine von Aberstein hat in einer Manufaktur nichts zu suchen, hat er gesagt. Das Mädchen wird reich heiraten und fertig.«
Christiane musste ein Kichern unterdrücken.
»Soso, reich heiraten und fertig«, echote Marie Zoller ironisch. »Nun, wenn das so einfach ist – viel Glück, Rike.«
»Ihr werdet alle noch von mir hören«, erklärte diese. »Lebt wohl!« Und damit drehte sie sich auf dem Absatz herum und verschwand im Büro der Direktorin.
Kaum war die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen, prusteten die meisten der Putzmacherinnen laut los, vor allem Hanne, Henriette und Dorle konnten kaum mehr an sich halten.
»Eine von Aberstein hat in einer Manufaktur nichts zu suchen«, äffte Dorle Friederike nach und die anderen wollten sich fast ausschütten vor Lachen.
»Was habt ihr denn?«, wollte Lili Schönthaler wissen. »Wenn die Rike die Gelegenheit hat, einen reichen Mann zu heiraten …« Der Rest ihres Satzes ging erneut in Gelächter unter.
»Einen reichen Mann«, meinte Marie Zoller und wischte sich die Lachtränen aus den Augenwinkeln, »wenn der so leicht zu finden wäre. Reichtum bleibt unter sich, sagt meine Mutter immer. Und Armut auch. Wer bitte schön sollte die Rike heiraten? Nun, wenn sie eine Schönheit wäre, stünde es vielleicht anders. Aber selbst dann würde ein reicher Mann sie höchstens zu seiner Mätresse machen. Schaut euch doch mal um im Herzogtum. Geheiratet wird unter Adelskreisen nach dem Stammbaum.«
»Wer weiß«, warf Henriette kichernd ein. »Womöglich haben die von Abersteins einen ellenlangen Stammbaum.«
»Ich würde es ihr gönnen«, erklärte Christiane und suchte nach der kleinen, scharfen Schere, die sie hütete wie ihren Augapfel, um neue Kamelienblüten aus der Seide auszuschneiden. »Denn fürs Arbeiten ist Friederike ganz eindeutig nicht geschaffen.«
Dem stimmten die meisten zu und langsam kehrte wieder Ruhe ein.
***
Erst nach der Mittagspause fiel Christiane auf, dass die kleine Anna Tuchwein gar nicht mehr da war.
»Sie hat es eingestanden, das mit dem Silber«, wisperte ihr Henriette zu, als sie sich vorsichtig nach dem Mädchen erkundigte. »Den Rest kannst du dir denken.«
Frau Slevoigt hatte sie entlassen. Wie traurig für Anna und ihre Familie, von der sie nur wusste, dass auch sie den Verdienst ihrer Tochter aus der Kunstblumenmanufaktur bitter nötig hatte.
Am Nachmittag begann Christiane, die ersten winzigen Blüten der Maiglöckchen anzufertigen, und Frau Slevoigt war voll des Lobes über die Ergebnisse. Hier und da regte sie Verbesserungen an, die Christiane sogleich umzusetzen versuchte. Darüber verging der Tag wie im Flug.
Als sie am Abend müde nach Hause kam, lag neben ihrem Suppenteller das versiegelte Bittgesuch ihres Bruders, das die ganze Zeit in der Kommodenschublade gesteckt hatte.
»Wann bringst du es endlich dem Geheimen Rat?« Tante Juliane warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu, während sie die Suppe austeilte. »Heute kam ein Brief vom Christian. Er fragt, ob du Goethe sein Bittgesuch schon überreicht hast. Du weißt, dass es dringend ist …«
»Ja, ich weiß«, antwortete Christiane. »Ich hab nur keine Ahnung, wie ich es anstellen soll.«
»Du bist doch sonst nicht so schüchtern«, hakte ihre Tante nach. Christiane biss sich auf die Lippen und schwieg. »Warum gehst du nicht einfach mal im Park auf ihn zu und sprichst ihn an? Frau Kirms sagt, er geht dort jeden Morgen zu seinem Gartenhaus. Da wohnt nämlich seit einiger Zeit der Herr Knebel, sein Freund.«
»Ich hab keine Zeit, ihm im Park aufzulauern«, entgegnete Christiane. »Ich muss arbeiten …«
»Vier Tage die Woche. Am Freitag nicht.« Juliane betrachtete sie forschend. Manchmal war sie wirklich hartnäckig. Jetzt faltete sie die Hände und sprach das Tischgebet. Christiane konnte sich nicht darauf konzentrieren. Die Tante hatte recht. Es wurde höchste Zeit.
»Na gut«, erklärte sie mit einem Seufzen, als sie ihren Teller leer gegessen hatte. »Am besten gehe ich gleich heute zum Frauenplan.«
Sie merkte, wie Ernestina neben ihr die Luft anhielt.
»Du bist aber mutig. Willst du dort einfach läuten?« Die kleine Schwester sah sie aus großen Augen an, als hätte sie etwas Ungeheuerliches vor.
»Ja, warum nicht?«
»Und was sagst du?«
»Dass ich den Herrn Geheimen Rat sprechen muss.«
»Ich würde mich das niemals getrauen.«
»Dafür bist du ja auch unser Nesthäkchen.« Christiane fuhr ihr zärtlich übers Haar, obwohl sie genau wusste, dass Ernestina das seit einiger Zeit nicht mehr leiden konnte. Im Gegensatz zu ihr hatte ihre Schwester feines, dunkelblondes Haar und das Gesicht eines Engelchens. Ihre eigenen Locken dagegen waren so dunkel, dass sie fast schwarz wirkten. Im Sommer trug Christiane sie offen und flocht ein Band ein, damit sie ihr nicht ins Gesicht fielen. Richtig schlimm wurde es jedoch, wenn die Luft feucht wurde, dann ringelten sie sich noch mehr und waren kaum zu bändigen. Außerdem wurde sie bei den ersten Sonnenstrahlen im Jahr braun im Gesicht wie die spanische Wahrsagerin des fahrenden Volks, das alle paar Jahre außerhalb der Stadttore sein Zelt aufschlug. Nein, sie entsprach nicht dem Schönheitsideal, nachdem man einen bleichen Teint zu haben hatte und möglichst golden schimmerndes Haar. Aber das war ihr egal.
Dass sie einmal einen Mann heiraten würde, der ihr gefiel, diese Hoffnung hatte sie nach der Erfahrung mit Gust aufgegeben. So manch einer hätte sie gern hinter eine Hecke gezogen und sich über sie hergemacht, wenn sie sich nicht so gut zu wehren verstünde. Sie zur Ehefrau nehmen würde sie hingegen keiner. Nicht mit diesem Aussehen. Und schon gar nicht ohne Mitgift. Sie war dreiundzwanzig Jahre alt und damit eine »Späte«, wenn nicht gar eine alte Jungfer. Ernestina sollte jedoch einmal heiraten können. Das hatte sich Christiane fest vorgenommen.
Gleich nach dem Essen zog sie ihr Sonntagskleid aus weiß-hellblau gestreiftem Sommerleinen an und bat die Tante um das himmelblaue seidene Busentuch, das in den weiten Ausschnitt duftig über Kreuz gelegt wurde und damit ihre schönen Brüste vollständig verhüllte und gleichzeitig auch betonte.
»Dazu passt mein Caraco gut«, sagte Juliane eifrig und reichte ihr das dunkelblaue Jäckchen, das direkt unter der Brust endete und hinten in einem gerafften Schößchen auslief.
»Zu eng«, antwortete Christiane, als sie vergeblich versuchte, es zu schließen. »Ich hab viel mehr Busen als du. Außerdem ist der Caraco zu warm. Besser, ich nehme mein Schultertuch. Es ist zwar nicht so hübsch, dafür sehe ich nicht aus wie eine Presswurst.« Ernestina prustete los, und auch Christiane lachte herzlich.
Endlich war sie bereit. Juliane zupfte noch ein wenig an dem Tuch herum, versuchte ihre Nichte vergeblich dazu zu überreden, einen ihrer Hüte zu tragen, und drängte ihr schließlich eine Handtasche auf, in die der Briefumschlag genau hineinpasste.
»Gott sei mit dir«, sagte sie an der Tür. »Hoffentlich kann der Herr von Goethe dem Christian helfen.«
***
Es war sieben Uhr abends. Die Sonne hatte sich gegen die Wolken durchgesetzt, ihr Licht brach sich auf den schwarzen Schindeln der Stadtkirche St. Peter und Paul, flutete über das Pflaster des Töpfermarkts und fing sich in den Kronen der Bäume auf dem Frauenplan. Erst hier hielt Christiane inne und holte tief Luft.
Das Gebäude, in dem Goethe wohnte, wirkte auf sie wie ein kleines Schloss. Auf jeden Fall war es kaum kleiner als das Fürstenhaus. Sechzehn Fenster zählte sie im zentralen Gebäude, die Mansardenfenster nicht mitgerechnet. An beiden Seiten gab es zwei kleinere Flügel mit je drei Fenstern über Toreinfahrten. Der Haupteingang, zu dem sechs Steinstufen emporführten, befand sich genau in der Mitte. Zwei Säulen zu beiden Seiten des Portals stützten ein winziges dreieckiges Dach.
Entschlossen ging sie darauf zu und pochte mit dem eisernen Ring gegen das massive Holz. Er ist nur ein Mensch wie wir alle, sagte sie sich, auch wenn alle Welt von ihm sprach wie von einem Halbgott. Sie hörte Schritte, die Tür wurde geöffnet. Es war der Mann aus dem Obstladen, der Diener namens Seidel.
»Ich möchte bitte den gnädigen Herrn sprechen«, sagte sie mutig. »Den Geheimen Rat von Goethe.« Hitze stieg ihr ins Gesicht. Hatte sie das jetzt richtig gesagt?
»Und was genau wünschen Sie von Herrn von Goethe?«, erkundigte sich Seidel.
Christiane straffte sich. »Das möchte ich ihm lieber selbst sagen, wenn Sie erlauben«, erklärte sie höflich.
Goethes Hausdiener schien unschlüssig. Dann sagte er: »Mein Herr ist ausgegangen. Vielleicht mögen Sie später wiederkommen?«
»Wann würde ihn ein kurzer Besuch am wenigsten stören?«, fragte Christiane. »Ich möchte nicht gern ungelegen kommen.«
Seidel nickte. »Sie möchten Herrn von Goethe um eine Gefälligkeit bitten, richtig?« Sie fühlte, wie sie rot anlief. »In diesem Fall wäre es das Beste, Sie bringen Ihre Bitte schriftlich vorbei.«
»Ich habe sie schriftlich dabei«, gab Christiane zurück und zog den Brief aus Tante Julianes Tasche. Doch als Seidel die Hand ausstreckte, um ihn entgegenzunehmen, wich sie zurück. »Nichts für ungut, Herr Seidel. Ich habe versprochen, diesen Brief nicht aus der Hand zu geben und nur Herrn Johann Wolfgang von Goethe persönlich zu überlassen, niemandem sonst.«
Ob der Hausdiener über ihre Antwort verärgert war oder nicht, konnte Christiane an seiner Miene nicht ablesen.
»Natürlich«, murmelte er. »Ganz wie Sie wünschen. In diesem Fall wäre es vermutlich das Beste, Sie schauen an einem Vormittag vorbei.«
Christianes Mut fiel in sich zusammen. Vormittags musste sie arbeiten. Außer Freitag und Samstag, und bis dahin war es noch ein paar Tage. Schade. Sie hätte die Sache so gern hinter sich gebracht.
»Verbindlichsten Dank«, sagte sie enttäuscht und deutete einen Knicks an. »Dann komme ich eben wieder.«
***
Der Abend war schön und Christiane beschloss, durch den Park an der Ilm entlang nach Hause zu gehen. Um ihre Befangenheit loszuwerden, rannte sie durch die Seifengasse, in der ihre Schritte widerhallten, vorbei am Palais des Freiherrn von Stein, und erst, als die Bäume des Parks in Sicht kamen, hielt sie inne und ging in normalem Tempo hinunter zum Fluss. Wie schön es hier war. Nie nahm sie sich Zeit, spazieren zu gehen. Ständig wartete Arbeit auf sie, auch außerhalb der Manufaktur. Die Gärten mussten bestellt werden, doch das machte sie gerne. Sie mochte das Einpflanzen, Harken und Ernten, das war ihr lieber, als Wäsche zu waschen und zu bleichen, zu bügeln oder zu flicken. Außerdem hatten sie immer etwas zu nähen, auch wenn es meist nur alte Kleider waren, die sie umarbeitete. Jemand musste Tante Juliane beim Kochen helfen, abspülen, die Wohnung auskehren und durchwischen. Einen Haushalt zu führen bedeutete eine Menge Arbeit, und obwohl Ernestina von klein auf mithalf, hatte Christiane nur sonntags ein paar Stunden Zeit für sich. Da traf sie sich am liebsten mit ihren Freundinnen und ging mit ihnen zum Tanzen, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Zu gerne würde sie ins Komödienhaus gehen, doch die Eintrittskarten waren teuer. Manchmal las sie, vor allem wenn Christian etwas Neues verfasst hatte, Sachen, die sie zum Lachen brachten und oft zum Nachdenken …
Sie sah sich um. Jetzt hatte sie vor lauter Träumen die falsche Richtung eingeschlagen. Vor ihr lag die hölzerne Brücke, die über die Ilm führte. Von der anderen Seite her näherte sich ein Mann. Ihr Herz machte einen zugleich erschrockenen als auch freudigen Sprung. Es war der Geheime Rat von Goethe, der gerade über die Brücke auf sie zukam, den Blick konzentriert auf die Planken gerichtet, so als dächte er intensiv über etwas nach. Gleich würde er an ihr vorübergehen. Wenn sie ihn jetzt nicht ansprach, wann dann?
»Ich bitte vielmals um Vergebung«, sagte sie höflich und machte rasch einen Knicks, schließlich wusste sie, was sich gehörte. Der Geheime Rat blieb stehen, richtete seine ausdrucksvollen, dunklen Augen auf sie, und Christiane glaubte, ein interessiertes Aufblitzen in ihnen zu erkennen. Meine Güte, dachte sie, und ihr Atem stockte kurz. Er ist tatsächlich ein wunderschöner Mann, so wie es alle sagen.
»Welcher Himmel schickt dich zu mir?«
Hatte er das gerade wirklich gesagt? Nein, sie musste sich verhört haben.
»Mein Bruder schickt mich«, entgegnete sie schnell. »Christian August Vulpius. Er hat mich gebeten, Ihnen dies zu geben.« Sie zog das Schreiben aus der Tasche. »Hier, Herr Goethe … ich meine, Herr von Geheimer Rat …« Sie hatte sich rettungslos verhaspelt und biss sich ärgerlich auf die Unterlippe. Als sie verlegen aufsah, stellte sie fest, dass er lachte.
»Schon gut«, sagte er amüsiert. »Herr von Goethe reicht völlig aus.« Er sah sie an, und obwohl sie normalerweise keineswegs schüchtern war, ging ihr sein Blick durch und durch. Ja, es stimmte, was sie gehört hatte. Er war schlank, braun gebrannt und strahlte etwas aus, was völlig neu für sie war. Eine Art Energie, der sie sich nicht entziehen konnte … Sie besann sich ihres Auftrags.
»Mein Bruder, Christian August Vulpius, braucht ganz dringend Ihre Hilfe. Vor ein paar Jahren haben Sie ihn schon einmal unterstützt, und ich bitte Sie von ganzem Herzen, tun Sie es noch einmal!«
»Was braucht er denn?«
Der Geheime Rat hatte den Brief genommen, machte allerdings keine Anstalten, ihn zu öffnen. Christiane holte tief Luft, dann sprudelte es nur so aus ihr heraus. Dass Christian so viele Begabungen hatte und nun als Privatsekretär eines reichen Mannes, der ihn schlecht behandelte, in Nürnberg regelrecht verkümmerte.
»Das Schlimme ist«, erzählte sie, »dass er auch diesen Posten bald verlieren wird, weil ein anderer angeboten hat, für noch weniger Geld dieselbe Arbeit zu verrichten. Dabei erhält Christian nur einen Hungerlohn. Was er braucht, ist eine Anstellung, die seiner würdig ist. Aber ohne Empfehlung ist das unmöglich. Es gibt viel zu viele Bewerber und zu wenig Stellen. Ich bitte Sie, Herr von Goethe! Sie sind doch mit der ganzen Welt bekannt. Tun Sie uns die Liebe und verwenden sich für ihn.«
Goethe sah nun nachdenklich auf den Brief in seiner Hand.
»Zunächst wird er Geld benötigen, hab ich recht?«
Christiane nickte beschämt und senkte den Blick zu Boden.
»Glauben Sie mir, Herr Geheimer … ich meine, Herr von Goethe«, stammelte sie und musste plötzlich Tränen niederkämpfen. »Wir sind eine ehrbare Familie und keine Bettler. Mein Bruder und ich besitzen das Bürgerrecht von Weimar und …«
»Ist Johann Friedrich Vulpius Ihr Vater?«
Christiane sah ihm trotzig in die Augen. Wenn er jetzt mit der Geschichte von der angeblichen Unterschlagung kam, würde sie ihm schon die Meinung sagen, Geheimer Rat hin oder her.
»Ja, das war er. Er ist vor zwei Jahren gestorben. Christian, meine jüngere Schwester und ich, wir stehen ohne Vater und Mutter da. Wir wohnen mit unserer Tante Juliane Vulpius zusammen in der Jacobsgasse in dem Haus, in dem wir alle zur Welt kamen.«
»Und wovon ernähren Sie sich, wenn ich das fragen darf?«
»Von meiner Hände Arbeit«, antwortete Christiane selbstbewusst. »In der Bertuchschen Seidenblumenmanufaktur. Ich bin seit ihrer Gründung dort angestellt.«
Goethe nickte nachdenklich.
»Ja, die ist mir bekannt«, sagte er. »Vor meiner Reise habe ich sie besucht. Da waren Sie allerdings nicht anwesend, oder? Nein. An Sie würde ich mich bestimmt erinnern.«
Seine Stimme klang auf einmal wie Samt und Seide, und in Christianes Brust breitete sich ein ihr bislang völlig unbekanntes Gefühl aus. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte. Schließlich räusperte sie sich, so belegt war ihre Stimme: »Ich weiß. An diesem Tag hatte mir Frau Bertuch freigegeben. Meine kleine Schwester hatte Fieber …«
Aber alle anderen, so fuhr sie in Gedanken fort, haben tagelang von diesem hohen Besuch geschwärmt, und ich habe es bitter bereut, nicht auch dabei gewesen zu sein.
»Wie lautet denn Ihr Name?«, erkundigte sich Goethe.
»Meine Taufnamen sind Johanna Christiana Sophia Vulpius.« Mein Gott, was war nur los mit ihr? Wieso klang ihre Stimme plötzlich so piepsig? »Mein Vater hat mich stets Christiane genannt.«
»Christiane und Christian.« Goethe lachte leise in sich hinein. Auf eine freundliche Art, irgendwie liebevoll, fand sie.
»Diese Namen sind Tradition in unserer Familie«, sagte sie. »Und eigentlich nennen mich sowieso alle nur Christel.«
Goethe nickte.
»Also, wir machen es folgendermaßen.« Er wurde eine Spur förmlicher. »Gleich morgen lass ich Ihrem Bruder etwas Geld anweisen, damit er fürs Erste aus der Not heraus ist. Um mir jedoch über seine weitere berufliche Verwendung ein genaueres Bild machen zu können, möchte ich Sie bitten, mich morgen noch einmal aufzusuchen. Ich wohne am Frauenplan, das große Haus mit der Nummer 1.«
»Ich weiß«, entfuhr es ihr. »Vorhin habe ich dort vorgesprochen. Sie waren ja nicht da.«
»Morgen werde ich da sein. Und da Sie tagsüber arbeiten, besuchen Sie mich am Abend. Gegen acht. Dann sehen wir weiter.« Er wandte sich zum Gehen. Doch im letzten Moment drehte er sich noch mal zu ihr um. »Sie erinnern mich an jemanden, Christel Vulpius. Und es ist eine schöne Erinnerung, sie hat mich sehr glücklich gemacht.«
Aufrecht und ein wenig steif schritt er über die letzten Planken der Brücke und nahm den Weg, den Christiane gerade erst gekommen war. Oder schon vor langer Zeit? Sie hatte jedes Gefühl dafür verloren. Ganz so, wie wenn sie in ein spannendes Buch versunken war und alles um sie herum vergessen hatte. Oder in einer Tanzfigur herumgewirbelt und in der Musik aufgegangen war. Nun aber nahm die Wirklichkeit um sie herum wieder Gestalt an. Ein elegantes Paar, das gerade vorüberflanierte, warf ihr neugierige Blicke zu. Offenbar fragten sich die feinen Herrschaften, was ein so vornehmer Herr wie Goethe mit einem einfachen Mädchen wie ihr zu besprechen hatte. Jetzt verzog die Dame sogar hämisch den Mund.
Christiane drehte sich abrupt um, raffte ihren Rock und rannte nach Hause. In ihr war eine jubelnde Freude, die sie sich selbst nicht erklären konnte.
***
»Morgen Abend um acht?« Ihre Tante musterte sie verwundert. »Da komme ich natürlich mit.«
»Nein, Tante, auf keinen Fall.« Erschrocken stellte Christiane das heiße Eisen auf den Ofen, mit dem sie gerade eines ihrer Mieder bügelte, das bessere, das sie sich erst im Frühjahr genäht hatte.
»Dann wird dich Ernestina begleiten.«
Ihre Schwester hob erwartungsvoll den Kopf von ihrer Stopfarbeit und sah gespannt von der Tante zu Christiane.
»Ich muss allein hingehen«, beharrte Christiane und prüfte, wie heiß das Eisen war.
»Das schickt sich nicht«, insistierte die Tante und betrachtete sie besorgt über den Rand der Brille ihres verstorbenen Bruders hinweg, die sie seit einer Weile zum Handarbeiten benutzte. »Du kannst nicht ganz allein zu einem unverheirateten Mann gehen. Ganz Weimar wird sich über dich das Maul zerreißen.«
Christiane schwieg und bearbeitete das feine Wäschestück mit dem Bügeleisen. Natürlich hatte ihre Tante recht. Aber aus unerklärlichen Gründen wollte sie niemanden dabeihaben, wenn sie mit Johann Wolfgang von Goethe über ihren Bruder sprechen würde. Warum das so war, darüber wagte sie selbst nicht nachzudenken. Auch nicht darüber, warum sie beschlossen hatte, unter dem Kleid ihre beste Wäsche zu tragen. Sie wollte einfach … nun ja, rundum einen guten Eindruck machen.
»Er hat gesagt, ich soll allein kommen«, schwindelte sie. »Ich bin schließlich kein junges Mädchen mehr.«
Sie sah Ernestinas Enttäuschung, die wohl zu gerne das Haus am Frauenplan an ihrer Seite betreten und den berühmten Dichter kennengelernt hätte.
»Die Leute werden reden«, wiederholte ihre Tante.
»Dann lass sie«, entgegnete Christiane trotzig. Und damit war für sie das Thema beendet.
***
»Wie war er denn so, der Geheime Rat?«, flüsterte Ernestina, als sie am Abend zu Bett gegangen waren. Die Schwestern teilten sich eine der Schlafkammern, die so eng war, dass zwischen den beiden Betten gerade genug Platz war, um sich hindurchzuzwängen. Christiane stieß sich regelmäßig die Schienbeine an den hölzernen Bettpfosten.
»Er war freundlich«, antwortete sie.
»Hat er den Brief gelesen?«
»Mitten auf der Ilm-Brücke? Nein. Bestimmt hat er ihn zu Hause in aller Ruhe geöffnet.«
»Hat er wirklich gesagt, dass er Christian Geld schickt?«
Christiane gähnte. »Das hab ich doch schon alles erzählt, Schwesterchen.«
Eine Weile schwieg Ernestina. Christiane konnte jedoch an ihrer Art zu atmen hören, dass sie nicht schlief, sondern intensiv nachdachte.
»Sieht er denn so gut aus, wie alle behaupten?«
Christiane dachte an die lebhaften Augen, die fast ebenso dunkel waren wie die ihren, an das strahlende Lächeln und diese eigentümliche Energie, die ihn umgeben hatte und für die sie keine Worte fand.
»Jetzt mach es nicht so spannend«, bettelte Ernestina. Sie schlüpfte aus ihrem Bett und setzte sich auf Christianes Bettrand.
»Er ist durchaus nicht hässlich«, gab sie amüsiert zur Antwort, zog die zarte Ernestina liebevoll zu sich ins Bett und begann sie zu kitzeln, wie sie es früher oft getan hatte, als ihre Schwester noch klein gewesen war. Das Mädchen kreischte auf und begann sich strampelnd zu wehren, bis Tante Juliane, die im Zimmer nebenan schlief, gegen die Wand klopfte und um Ruhe bat.
***
Den gesamten folgenden Tag konnte Christiane sich kaum konzentrieren, stets wanderten ihre Gedanken zu der kurzen Begegnung auf der Ilm-Brücke zurück. Als ihr bewusst wurde, dass sie selbst die kleinste Regung im Gesicht des Geheimen Rats immer wieder überdachte, rief sie sich zur Ordnung. Sie beendete ihren ersten vollständigen Maiglöckchenstängel, erntete Lob und Bewunderung, und eine Weile freute sie sich darüber und begann auf der Stelle mit einem neuen. Doch schon bald dachte sie nur an das, was ihr Besuch im Haus am Frauenplan wohl bringen mochte. Sie würde nichts weiter tun können, als die Lage ihres Bruders so anschaulich zu schildern, dass Herr von Goethe seine Bitte schnellstmöglich erfüllte.
Beim Abendessen war sie wortkarg und geistesabwesend, floh vor Julianes vorwurfsvollen Blicken in den Garten, wo sie eine halbe Stunde Unkräuter zupfte, bis es endlich Zeit war, sich zu waschen und die frischen Sachen anzuziehen, die seit dem Vortag bereitlagen: die »Unaussprechliche« mit den Spitzen, das einfache Hemdchen und darüber das Mieder, das ihre Brust in Form hielt. Schließlich schlüpfte sie in ihr Sommerkleid und legte dieses Mal nicht das von ihrer Tante geliehene, sondern ihr eigenes Busentuch aus dünner weißer Baumwolle in den Ausschnitt. Sorgfältig kontrollierte sie, ob alles richtig saß. Dann bürstete sie unter Ernestinas sehnsüchtigen Blicken ihre Locken gründlich durch, bis sie glänzten.
»Viel Glück!«
Die kleine Schwester war ihr bis zur Tür gefolgt, während die Tante sich seit dem Abendessen nicht mehr hatte blicken lassen.
»Danke, mein Schatz«, antwortete Christiane und verließ rasch die Jacobsgasse.
***
Der Frauenplan, so fand sie, war der schönste Platz in Weimar. Es gab einen Brunnen mit vorzüglichem Wasser. Da haben es die Anwohner gut, dachte sie. Christiane konnte ein Lied davon singen, welche Mühe es machte, einen Haushalt mit ausreichend Wasser zu versorgen. Seit sie einen vollen Eimer tragen konnte, und war er anfangs auch klein gewesen, war das ihre Aufgabe. Sie kannte die Qualität jedes einzelnen Brunnen in der Stadt, wusste, welcher sich besser zum Wäschewaschen eignete, welcher zum Bierbrauen und welches Wasser am besten schmeckte. Dieser hier vor Goethes Haus war für alles gut zu gebrauchen.
Sie erschrak, als auf einmal ein Mann neben ihr stand. Es war Seidel, der Hausdiener.
»Der Herr Geheime Rat hält sich gerade in seiner Rosenlaube auf, also ist es das Beste, ich bringe Sie durch die Gartentür von der Ackerwand her direkt zu ihm. Bitte folgen Sie mir.«