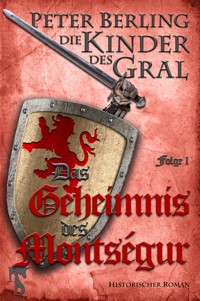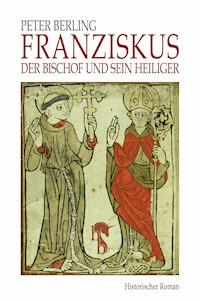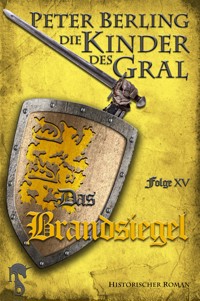3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Nach langen Jahren der Flucht sind Roç und Yeza ins ehemalige Katharerland im Süden Frankreichs zurückgekehrt. Der Orden der Tempelritter plant gegen den Widerstand der römischen Kirche und der französischen Krone die Errichtung eines neuen Staats, an dessen Spitze die Gralskinder stehen sollen. Doch selbst die Bruderschaft des Grals, die im Verborgenen die Geschicke der ›Königlichen Kinder‹ lenkte, ist gegen diese Entwicklung. Schon bald beginnen in ganz Frankreich die Scheiterhaufen zu brennen, Roç und Yeza können nicht verhindern, dass viele ihrer Freunde den Tod in den Flammen finden. Der ehrgeizige Orden der Templer und die wenigen verbliebenen ›faidits‹ aus den Reihen der ehemaligen Katharer wollen die Warnung der Mächtigen nicht verstehen. Als eine Delegation der Mongolen eintrifft, die Roç und Yeza zur Rückkehr auffordert, werden die Gralskinder mit einem verlockenden Angebot konfrontiert. Denn nach dem Sieg über den Kalif von Bagdad könnten die Mongolen als Einzige dem Königspaar die Alleinherrschaft über die Welt verschaffen. Angewidert von den Zuständen im christlichen Abend- und muslimischen Morgenland scheinen Roç und Yeza bereit, das Angebot aus dem fernen Osten anzunehmen … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil XI fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PETER BERLING
Das Geheimnis der Templer
Folge XI des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE X
Die Rose im Feuer
Je mehr sich die Mongolen der Verfügungsgewalt über die zukünftigen ›Herrscher des Restes der Welt‹ brüsten, desto stärker wachsen die Zweifel im Okzident, das Abendland der Ungewissheit einer Zukunft aus dem Osten auszuliefern. Die konservative Fraktion unter ihren Anhängern setzt sich durch und handelt.
Der Plan der geheimen Bruderschaft, die über das Schicksal des ›Königlichen Paares‹ wacht, zielt darauf, den zu patriarchalischen Würden aufgestiegenen William in Ungnade fallen zu lassen, so dass der Großkhan sich von ihm trennen muss, mit allen Zeichen dankbarer Ehrerbietung. Diese Geschenke müssen so gestaltet sein, dass sie den Kindern die Flucht aus dem Reich ermöglichen, – wenn sie es denn so wünschen, denn Roç und Yeza fühlen sich ausgesprochen gut behandelt vom Großkhan. Doch sie werden trickreich fortgelockt, verfolgt von ihren Gastgebern, und geraten ausgerechnet wieder an die Assassinen von Alamut.
Der Imam ist dem Wahnsinn verfallen, vermeint in seinem Wahn, den Mongolen eine tödliche Falle zu stellen: Er will die Kinder grausam vor den Augen ihrer Retter abschlachten. Doch der pervers-geniale Mechanismus der Rose wendet sich gegen den Techniker des Todes, die schützenden, glatten Wände ihrer Blätter füllen sich mit flüssigem schwarzen Blut der Erde.
Roç und Yeza können dem Inferno entkommen. Es war der Orden der Templer, der den Auftrag der Geheimen Bruderschaft erfüllte und die ›Kinder des Gral‹ wieder zurückführte in das Land ihrer Herkunft. Die unbezwingbare stählerne Rose jedoch vergeht in einem Feuersturm höllischer Glut …
I LUZIFER IM KIRSCHGARTEN
Ketzer unter Rosen
Das harte Gegenlicht der untergehenden Sonne blendete den Maler, verzerrte die Konturen, ließ die Farben grell aufleuchten und die weißen Blüten des Rosenhags tanzen, während das, was er eigentlich zu sehen begehrte, die Schrift, die unverständlichen Zeichen und Linien auf dem Stein, in dunklen Schatten versank. Das schwarze Epitaph – war es Marmor? – bot sich fleckenlos und ohne Adern dar, fremd, wie aus einer anderen Welt. Daran änderte weder der Sockel aus gleichfarbigem Granit etwas noch die kunstvoll geschliffene Abdeckung, in der kristallen die weiße Maserung mit karneolrötlichen Einsprengseln wechselte und die von der Wertschätzung zeugte, die dem so geschützten schlanken Quader entgegengebracht wurde.
Der sich mit den widrigen Umständen quälende Meister war überaus elegant gekleidet, wie es einem höfischen Maler wohl zukam. Rinat Le Pulcin hatte es eigentlich nicht nötig, in wilder Natur, zwischen Dornen und Insekten und unter den sengenden Strahlen der Sonne seiner Kunst nachzugehen. Er war beliebt in den Palästen ob seiner schmeichelhaften Porträts und ließ sich gern dafür verwöhnen. Auch diesmal hatte der Auftrag – gut bezahlt, doch anonym erteilt – nicht viel anders geklungen: Bei einer Burg, deren Name nichts zur Sache tue, werde er einen jungen Ritter und seine Damna[1] treffen, die er so zu konterfeien habe, wie er sie vorfände. Dass er seine Arbeit nicht wie gewohnt im Atelier verrichten sollte, sondern unter freiem Himmel, empfand er als eine Herausforderung an seine Kunst. Rinat war dennoch ein leichter Schauer den Rücken hinuntergelaufen, denn bei einer ähnlichen Umschreibung hatte er schon einmal vor Leichen von Liebenden gestanden, die noch warm waren. Doch als ihm nach mehrstündigem scharfem Ritt die Binde von den Augen genommen wurde, fand er die zu Konterfeienden erstaunt, aber durchaus lebendig vor.
Man hatte Maître Rinat eingeschärft, keinerlei Fragen zu stellen, weder an die Personen noch zu der Umgebung, die ihn erwartete. Die Burg, eigentlich ein alleinstehender, mächtiger Donjon[2], wirkte unbehaust, wenn auch nichts auf Zerstörung hindeutete. Das Tor stand weit offen, und soweit er einen schnellen Blick ins Innere hatte werfen können, schien zumindest die Halle verödet und leer. Kein Gesicht zeigte sich in dem hohen Fenster des Söllers, noch blitzten Spieße von Wachen oben hinter des Turmes Zinnen.
Sein Begleiter, ein hagerer Priester, wie am Gewand zu erkennen, ließ ihm keine Zeit, seine Neugier zu befriedigen, sondern führte ihn am Arm den Hang hinab zu einem dichten Hag weißer Heckenrosen. Der energische Griff des Mannes, der sich knapp mit »Gosset«[3] vorgestellt und dem noch, ohne mit seiner buschigen Augenbraue zu zucken, trocken ein »clericus maledictus«[4] angefügt hatte, lockerte sich erst, als sie schon um den Rosenbusch gebogen waren.
Das Bild, das sich Rinat bot, entsprach dem, was von ihm als Miniatur verlangt wurde. Ein akkurat gearbeitetes Gestell für die Holztafel stand für ihn bereit und gab ihm Position und Bildausschnitt vor. Rinat hatte eine solche Konstruktion noch nie gesehen, obgleich sie ihm sofort einleuchtete, ließ sie ihm doch beide Hände zur Arbeit frei. Zum Sichwundern wurde ihm weder Zeit noch Raum gelassen. Zur Rechten öffnete sich der Rosenhag, die dornigen Zweige waren rüde abgehackt worden, davon zeugten die frischen Blüten am Boden. Die künstliche Grotte gab den Blick auf das schwarze Epitaph frei, das die üppige Pracht zuvor zärtlich umhüllt und vor den Augen Nichtwissender verborgen hatte. Davor stand in Gedanken versunken der junge Ritter. Er hatte seine Rüstung nicht abgelegt, lediglich seine Handschuhe lagen auf dem Marmorgesims des steinernen Mals, und den Helm hielt er unter dem Arm.
Der prüfende Blick des Malers fiel auf die Farben des Brustpanzers. Sie zeigten geflammte rotgelbe Streifen, die ihn zunächst an das Wappen derTrencavel, das ruhmreiche Geschlecht der Vicomtes von Carcassonne, erinnerten, doch bei genauerem Hinsehen erkannte er ineinander verwobene Geparden und drachenähnliches Fabelgetier, das sich kunstvoll gegenläufig bewegte. Dererlei verspieltes Zeugs wurde in Paris angefertigt, seitdem die strenge Schule von Byzanz sich unter den Franken der Ornamentik des Orients geöffnet hatte. Der junge Ritter hatte den Meister weder gegrüßt noch aufgeschaut. Rinat imponierte dennoch die kühne Stirn über den weichen Zügen, umrahmt von verschwitzter dunkler Lockenpracht. Der Maler hätte gern die Augen gesehen, doch der Ritter hielt sie gesenkt hinter samtenen Lidern. Rinat Le Pulcin schluckte mit hörbarem Räuspern seine gekränkte Eitelkeit hinunter und packte Tiegel, zu Pulver zerstoßenen, gefärbten Kreidestein und Phiolen mit dickflüssigen Farben aus seinem Bündel. Er rührte die Töne an, die er in etwa brauchen würde, zum Aufhellen reichte die Zugabe von weißem Gipsmehl, zum Dunkeln zerstampfte Holzkohle. Die junge Dame hatte sich anfangs recht interessiert an den Vorbereitungen gezeigt, als verstünde sie etwas von Malerei, doch dann erging sie sich am Hang und ließ sich durch den lagernden Knappen in der Haltung vertreten, die sie dann wohl einzunehmen gedachte. Der Bursche fläzte zu Füßen des Ritters im Gras, den Kopf keck aufgestützt, die Pferde seiner Herrschaft lässig am Halfter, was ihn aber nicht hinderte, fest zu schlafen. Eines der Tiere schob seinen Kopf ins Bild und knabberte an seinem Ohr, der Knappe schlug die Augen auf und musterte Rinat kurz. Er dachte nicht daran, sein Maul zum Gruß zu öffnen, sondern schob nur die störende Pferdenase beiseite, bevor er wieder in seinen faulen Schlummer fiel.
Das Pferd würde also die linke Kante des Bildes begrenzen, oben erhob sich die Burg, doch was den Künstler störte, war die Position des Ritters. Er hätte ihn gern hinter den schwarzen Stein platziert, um den schwarzen Quader in die Mitte des Bildes zu rücken. So viel Freiheit zur Gestaltung müsste ihm ja wohl eingeräumt werden, wenn man ihn schon sonst nicht achtete. Er rief nach Gosset, der sich zur Dame am Hang gesellt und hinterlassen hatte, dass der Maler sich an ihn halten sollte, wenn er Fragen hätte.
»Cher clerc maudit«[5], diese Anrede nahm sich Rinat verärgert heraus, »verrückt den Stein oder die Burg, wenn sich sonst niemand bewegen mag.«
Da schaute ihn der junge Ritter freundlich an und befahl seinem Knappen: »Philipp, hack die Rückseite frei! Ich möchte hinter den Stein gewordenen Mittag treten, aber so, dass ich meiner Damna ins Auge schauen kann und auf mein Haupt kein Schatten fällt.«
Rinat bedankte sich mit einem Lächeln, das diesmal Erwiderung fand, während der Philipp geheißene Bursche sich erhob und der Satteltasche einen Krummsäbel, einen kostbaren Scimitar[6], entnahm.
»Damaszener Wertarbeit!«, stellte der Künstler anerkennend fest, während der junge Herr zur Seite trat und der Knappe auf das dornige Gestrüpp einhieb.
Inzwischen war Gosset, der Priester, herbeigekommen. Rinat zog es vor, jedem Vorwurf gleich die Spitze zu nehmen.
»Ich habe keine Frage gestellt«, begann er mutig ob der gerunzelten Augenbraue, doch der chevalier kam ihm zur Hilfe.
»Ich habe die Anweisung erteilt.«
Gosset fügte sich achselzuckend in die veränderte Lage. Glücklich schien er nicht. Unten, vom nicht einsehbaren Fuß des Burgbergs her, ertönten Gelächter und Gesang. Eine fröhliche Runde schien dort zu feiern. Gosset hob den Kopf und lauschte; sein Gesicht verfinsterte sich.
»E cels de Carcassona se son aparelhetz.
Lo jorn i ac mans colps e feritz e donetz
e, d’una part e d’autra, mortz e essanglentetz.
Motz crozatz I ac mortz e motz esglazietz·«[7]
Die Augen des Priesters suchten die seines Schutzbefohlenen, doch der junge Ritter interessierte sich nur noch für die Rückseite des schwarzen Epitaphs, das die Hiebe des Knappen jetzt freilegten.
»Peireiras e calabres an contral mur dressetz,
quel feron noit e jorn, e de lonc e de letz.
Lo vescoms, cant lo vi, contra lui es corrut
e tuit sei cavalier, que n’an gran gaug agut.«[8]
Die Taverne war in ihrem hinteren Teil in den Berghang getrieben, ein fensterloses Kellergewölbe, in das eine steile Treppe hinabführte. Der vordere Bereich diente als Stall für die Tiere, in den halbhohe Türen zumindest etwas Tageslicht fallen ließen. Die Luft war zum Schneiden, wenn auch die meisten der Zecher nicht mit Schwertern, sondern mit Bechern herumfuchtelten.
»Barò de Quéribus,
Xacbert de Barbera,
Leon de Combat!«[9]
Sie grölten laut den Refrain des Liedes, das von dem okzitanischen[10] Freiheitshelden Xacbert de Barbera[11] handelte, der, von den Franzosen aus der Heimat vertrieben, in der Fremde dem König Jaime von Aragon[12] dienen musste. Die Begeisterung für den Lion de Combat[13] geriet so lautstark, dass nur Wortfetzen zu verstehen waren. Es ging um Quéribus[14], seine uneinnehmbare Burg, die nur durch Verrat des Renegaten Oliver von Termes[15] in die Hände des Seneschalls[16] von Carcassonne gefallen war und somit in den Besitz der französischen Krone. Daran könne auch sein Freund Jaime, der Expugnador, nichts ändern. Doch eines schönen Tages würde er mit Xacbert über die Berge zurückkommen und die Okkupanten verjagen.
Der Lauten schlagende Troubadour, der mit solch starken Worten die Leute dazu brachte, mit ihren Krügen den Takt mitzuklopfen, besaß weiß Gott nicht die Statur eines furchterregenden Rebellen. Jordi Marvel[17] war eher ein Zwerg, ein Wicht mit dünnem Ziegenbart und dünnen Beinen, doch seinem verwachsenen Brustkorb entströmten die Töne machtvoll im Bariton, schwollen an zu schönster Melodik, die den rauen Männern Tränen in die Augen trieb. Die Stimme des Sängers entfachte Trotz und Wut und steigerte sich zum Donnerhall. Schon sprangen etliche der Zecher auf die Tische und feierten tanzend den Triumph über die Francos[18], bis dem Siegesdurst der Durst nach dem Sieg folgte. Der Wirt schenkte nach.
In die eingetretene Stille der Erschöpfung rief eine Stimme:
»Und jetzt, Jordi, sing uns von Roç und Yeza[19], dem Königlichen Paar!«
Und gleich fielen andere ein: »E viven los infantes del Grial!«[20]
Der Troubadour schien nicht sonderlich entzückt von dem Vorschlag. Statt in die Saiten zu greifen, schob er erst einmal dem Wirt seinen leeren Becher hin.
»Ich bin Katalane«, murmelte er, »und preise gern Helden von Fleisch und Blut. Diese reyes de paz[21], diese Friedenskönige, sind eine Legende, törichtes Traumgespinst, von Faidits[22] gesponnen! Ein sinnloses Gerücht wie der Gral[23]!«
Der Wirt zog ihm mit einem Ruck den schon gefüllten Becher wieder weg.
»Sagt das nicht noch einmal!« fauchte er, und seine Pranke schnellte vor, griff dem Zwerg ins Brustwams und drehte ihm wie ein Schraubstock die Luft ab. »Der Gral ist die Hoffnung dieses Landes!«
»Nichts für ungut«, keuchte eingeschüchtert der schmächtige Troubadour, »doch an diese Könige ohne Königreich mag ich nicht glauben!«
Der Wirt lockerte den Griff und schob Jordi mit der anderen Hand den Becher wieder unter die Nase.
»Trink, Katalane, und sing«, der Wirt hob seine Stimme, »das Lied von Roç und Yeza, den Königen des Gral!«
Da ließ der Troubadour seine Laute erklingen.
»Grazal dos tenguatz sel infants
greu partenir si fa d’amor
camjatz aquest nox Montsalvatz.
Grass vida farras cavalliers
coms Roç et belha Yezabel,
oltracudar infants Grazal,
rassa boratz bratz sporosonde,
Roç Trencavel et Esclarmonde.«[24]
Am Hang unterhalb der verlassenen Burg herrschte schläfrige Stille, sodass der Text des Liedes fast Wort für Wort zu vernehmen war.
»Papa di Roma fortz morants
peiz vida los Sion pastor
magieur vencutz mara sobratz.
Byzanz mas branca rocioniers
corns Roç et belha Yezabel,
oltracudar infants Grazal,
rassa boratz ains sporosonde,
Roç Trencavel et Esclarmonde.«[25]
Die junge Dame, die mit dem Knappen getauscht, lauschte den Zeilen voller Belustigung. Sie hatte den schönen Kopf aufgestützt, wie es der Maler schmeichlerisch erbeten hatte, la belle dormeuse[26]. Doch so unterhalten, fiel sie nicht in Schlummer, sondern ihre grüngrauen Augen wachten hinter dunklen Wimpern über alles, was rundherum geschah, und ihre hohe Stirn runzelte sich. In der Ferne erhob sich eine Staubwolke auf der Straße, die zu ihnen heraufführte. Kein anderer nahm das rasche Näherkommen eines Trupps Berittener wahr. Ihr jugendlicher Gespons stand hinter dem Stein, völlig in Gedanken versunken, über etwas rätselnd, das sie nicht sah.
Rinat Le Pulcin hatte auf der Leinwand mit Kohlestrichen die Gruppierung festgehalten, wobei auffällig war, dass er dem schwarzen Stein zentrale Bedeutung beimaß. Er hatte ihn schräger angeordnet, als es der Wirklichkeit entsprach, und war eifrig bemüht – er verrenkte sich fast den Hals –, die Zeichen und Linien zu entziffern, die von leichter Hand, doch sauber in die dunkle Fläche eingeritzt waren. Die Hände, von denen die unverständlichen Hieroglyphen stammten, mussten Diamanten benutzt haben oder mit einem Feuerstrahl von so unerhörter Hitze, wie ihn nur gebündeltes Sonnenlicht zu geben vermag, die runenhaften Symbole in das schwarze Epitaph gebrannt haben. Wie gesintert wirkten die Bilder – doch der Maler konnte sie nicht erkennen. Schräg fiel das Licht der Nachmittagssonne auf die spiegelglatte Fläche, blendete den Vorwitzigen, als wolle sie ihn mit dem Verlust seines Auges strafen.
Gosset, der verdammte Priester, stand hinter ihm, um nicht störend im Bilde zu sein, in Wahrheit kontrollierte er auf diese Weise jeden Spachtelauftrag, mit dem jetzt der Künstler seine Farben setzte, um sie dann mit Pinselstrichen zur gewünschten Wirkung hin zu verfeinern. Philipp[27], der Knappe – oder war er der Page der Schönen? –, lag schon wieder bei den Pferden und schlief. Finken fielen aufgeregt zwitschernd in den Rosenhag ein; ärgerliches Bienengesumm beantwortete die Störung beim Abernten der dotterfarbigen Blütenstempel; eine Spinne wob ihr Netz; und aus der Taverne am Fuß des Burghügels drang klar die Stimme des Troubadours:
»Grazal los venatz mui brocants
desertas tataros furor,
vielhs montanhiers monstrar roncatz,
mons veneris corona sobenier,
coms Roç et belha Yezabel,
oltracudar injants Grazal,
rassa boratz mons sporosonde,
Roç Trencavel et Esclarmonde.«[28]
Der junge Ritter war so in die Betrachtung des Steins versunken, von einem starken Zauber in den Bann geschlagen, dass er selbst wie versteinert wirkte. Die Rückwand des Epitaphs wies neben magischen Zeichen in der Mitte eine Vertiefung auf. Sie glich in ihren Umrissen einem Pokal, als hätte die Hand eines Zauberers den Kelch aus dem schwarzen Stein geschnitten, wie man ein Herz aus der Brust schneidet. Das Gefäß – wenn es denn ein solches war – musste zur guten Hälfte im Stein gesteckt haben und von außen nur als Relief sichtbar gewesen sein. Doch es war nicht die Höhlung noch der entrückte Kelch, dessen Geheimnis den Betrachter fesselte, sondern der Quell. Ein nadelfeiner Wasserstrahl trat oben in der Höhlung aus dem Stein. Genau in der Mitte fiel er, ohne zu zittern oder sich tröpfelnd zu unterbrechen, senkrecht nach unten und verschwand ohne Spritzer im Fuß des imaginären Pokals. Die silbrige Wassersäule stand so ebenmäßig, dass sie genauso gut von unten nach oben hätte fließen können. Des Menschen Auge vermochte es nicht wahrzunehmen, nur die trübe Macht der Gewohnheit ließ den Ritter annehmen, dass der silbrige Quell den Naturgesetzen folgte. Der junge Mann wollte sichergehen, keinem Spuk aufzusitzen, seine Augen vergewisserten sich unmerklich, dass keiner sein Tun beobachten konnte. Vorsichtig hob er die Hand, um mit der Fingerspitze den Strahl zu unterbrechen. Doch kaum näherte er sich der Höhlung, bog eine unsichtbare Kraft ihm den Finger zur Seite. Seine Hand begann zu zittern, als er es um ein anderes Mal versuchte. Sein Blick fiel auf den eisernen Ring, den er um den Finger trug. Das Liebespfand war aus Magnetstein, das wusste er. Entschlossen streifte er es ab und streckte erneut den Finger vor. Diesmal war es ihm, als hätte er einen schmerzhaften Schlag erhalten, so ungestüm flog seine Hand zurück, ohne auf irgendeinen beschreibbaren festen Widerstand gestoßen zu sein. Im gleichen Augenblick fielen ringsum die Blütenblätter zu Boden, was den Frevler noch weit mehr entsetzte. Erschrocken schaute er hinüber zu seiner Damna, doch ihr Blick schweifte gerade ins Tal, statt zärtlich den seinen zu suchen.
Auch der Meister schien nichts von alledem bemerkt zu haben. Die junge Schöne nahm wenig damenhaft einen Kiesel und warf ihn gezielt dem Knappen an den Kopf, dass der auffuhr.
»Philipp!« Sie schüttelte ihre blonde Mähne. »Dormire in lucem!«[29], schalt sie ihn. »Hol mir den Priester!«
Der Maler hielt irritiert inne. Philipp, der gescholtene Tagschläfer, erhob sich und sah sich verwirrt nach Gosset um, der doch keine zwei Schritt von seiner Herrin entfernt stand, aber der Priester begriff schneller, begab sich zum Lager der kriegerischen Amazone und beugte sich zu ihr herab.
»Schaut jetzt nicht hin«, flüsterte sie, »da unten kommen Franken, Mannen des Seneschalls von Carcassonne, und das kann für die Sänger in der Taverne nichts Gutes bedeuten. Eilt hinab, und warnt die braven Leute!«
Gosset winkte Philipp mit zwei Pferden zu sich und ritt mit ihm talwärts. Aus der Taverne tönte lauter denn je das Lied von Roç und Yeza, die das Land vom Joch der Capetinger[30] befreien würden.
»Ni sangre reis renhatz glorants
ni dompna valor tratz honor,
amor regisme fortz portatz
uma totz esperansa mier,
coms Roç et belha Yezabel,
oltracudar infants Grazal,
guit glavi ora ricrotonde,
Roç Trencavel et Esclarmonde.«[31]
Der Ritter hinter dem schwarzen Stein zeigte sich unbeteiligt. Er starrte auf die Höhlung des Kelches, in dem die zarte Wassersäule vor seinen Augen stieg oder fiel, als wolle sie seiner spotten.
Das unordentlich mit Schilf und Zweigen gedeckte Dach der Taverne ging in den Hang über, dass der offene Giebelspitz gerade noch die Karren durchließ, mit denen Heu und Stroh von oben unters Gebälk eingebracht werden konnten. Durch eine Futterluke werden so gemeinhin die Tiere in den vorne gelegenen Ställen versorgt, überlegte sich Gosset, als er der Öffnung ansichtig wurde. Er übergab die Zügel seines Pferdes Philipp und setzte den Weg allein zu Fuß fort. Wenn er zur Straße herabstieg, um von dort aus die Taverne zu betreten, lief er Gefahr, von den anrückenden Soldaten gesehen zu werden oder zu viel Zeit zu verlieren. Bis jetzt sah er allerdings weder Helm noch Speer zwischen den Bäumen blitzen, doch dass die Prinzessin sich getäuscht hatte, war kaum anzunehmen. Im Kriegerhandwerk stand die junge Dame ihren Mann. Der Priester verließ die Deckung des spärlichen Burgwaldes und schlich zum Giebel, in dem eine verrottete Holztür schief in den Angeln hing.
Der Refrain des letzten Liedes wurde unter Gelächter und Beifallsgetöse noch und noch wiederholt und drang gedämpft, doch deutlich vernehmbar zu ihm hinauf.
»E tant cant lo mons dura, n’a cavalher milhor,
ni pus pros, ni pus larg, pus cortes ni gensor …«[32]
noch strahlt der Gral in finstrer Höhlennacht, noch reckt sich der Pog[33] ins lichte Himmelsblau, Percevals[34] Blut in unseren Adern rinnt, und den welschen Pfaffen zeigen wir den nackten Arsch, pfaffen wir den welschen Arsch –«
Gosset ärgerte sich über das leichtsinnige Gegröle, er vernahm das Knacken hinter sich nicht, noch sah er die Bewegung in den Büschen am Waldesrand.
Da sprangen drei, vier Soldaten hinter der Tür aus dem Giebel hervor, und auch von der Seite bedrohten den Priester plötzlich gereckte Spieße. Ein kleiner, dicker Hauptmann befreite sich stolz von den grünen Zweigen, die als erfolgreiche Tarnung seinen Helm wie Hörner zierten, und baute sich vor Gosset auf.
»Wohin des Weges, Priester?« Er gab sich leutselig. »Hört Ihr nicht, welch’ Willkommen man Euch bereiten will?«
Gosset war um eine Antwort nicht verlegen.
»Einem Diener des Herrn steht es nicht an, sich von großsprecherischen Worten in die Flucht schlagen zu lassen. Überdies sind nackte Ärsche kein Argument, sie klatschen nur besser!«
»Seht nur zu, dass es nicht der Eure ist«, unterbrach ihn eine unangenehme Stimme. Aus dem Giebel trat ein Dominikaner, ebenso kurz gewachsen wie der Hauptmann, nur fetter. »Ich bin Bezù de la Trinité[35]«, setzte er im Falsett hinzu.
Das klang wie Dünnpfiff, schoss es Gosset durch den Kopf. Er hatte von dem biestigen Inquisitor schon gehört, ihn sich aber furchteinflößender vorgestellt. Da ihn niemand – wohl aufgrund seines klerikalen Habits – nach Namen und Begehr gefragt hatte, beschloss er, seinen zweifelhaften, zumindest verjährten Status als königlicher Gesandter erst einmal nicht aus dem Sack zu lassen.
Doch die fehlende Respektsbezeugung ärgerte den gewichtigen Inquisitor: Er zeigte die Instrumente.
»Wenn es Euch gelüstet, dort hinunterzusteigen, gesellt Ihr Euch für mich zu dieser Ketzerbrut.«
»Landesverräterisches Gesindel!«, schnaubte der Hauptmann, doch Bezù de la Trinité hieß ihn mit einem Knuff verstummen.
»Mengt Ihr Euch in dieses katharische Natterngezücht«, setzte der Inquisitor geifernd hinzu, »liefere ich Euch – ohne Ansehen Eures Rocks, ohne Anhörung Eures Arsches Ahnungslosigkeit – dem weltlichen Arm aus, hier vertreten durch meinen glorreichen kleinen Bruder.«
»Fernand Le Tris[36]!« Der Hauptmann plusterte sich auf, was ihm einen Tritt einbrachte, sodass sein hinzugefügtes »Hauptmann des Seneschalls von Car –« sich verkürzte und Bezù inquisitorisch fortfahren konnte.
»Ihr habt mit eigenen Ohren gehört, was für garstig Lied sie gesungen?« Ihm fiel auf, dass in der Taverne jetzt Ruhe eingetreten war, jedenfalls hatte das Gegröle sich erschöpft und dem üblichen Kneipenlärm Platz gemacht.
»Was soll ich gehört haben?«, fragte Gosset mit gespielter Treuherzigkeit. »Wurde unser Herr gelästert?« Seine Stimme wechselte in laute Empörung. »Sein treuer Diener ist gewarnt!«
Aus den Augenwinkeln sah er, dass Philipp verstanden hatte und sich mit den Pferden unter die Bäume zurückzog.
»Dies ist das Tor zur Hölle! Schreit nicht so!« schimpfte der Inquisitor.
»Die Verdammten möchten sonst dem Feuer entgehen, das sie erwartet.«
»Ihr wollt sie verbrennen?« Gosset gab sich begeistert und hoffte, jemand würde seine Stimme vernehmen.
»Wer den reinigenden Flammen entrinnt –«, bestätigte Fernand Le Tris zufrieden, »den knüpfen wir an den Bäumen auf.«
»Wundervoll!«, schrie Gosset im verzweifelten Bemühen, sich bis unten in die Taverne Gehör zu verschaffen. »So hat jeder dieser Faidits die Wahl, als Fackel für den rechten Glauben oder als Fähnlein im Winde für die Farben Frankreichs zu zeugen!«
Er hatte dabei seine Stimme in den Diskant erhoben, sie tönte schrill – doch sie erreichte keinen der Zecher, nur den empfindlichen Nerv des Inquisitors.
»Verschwindet, Mann Gottes«, fauchte der ihn an, »oder ich vergesse, dass Eurer Kehle auch das Lob Gottes entspringt –« und hatte plötzlich ein Messer gezogen. »Schweigt, oder –«
Gosset war entsetzt verstummt, zumal zwei Soldaten ihn am Arm gepackt hatten, sodass Bezù seine Drohung leicht hätte wahr machen können. Der Priester fiel auf die Knie, was den Griff seiner Bewacher erst einmal lockerte.
»Vergeht Euch nicht«, stammelte er sichtbar eingeschüchtert, »lasst mich laufen!«
Bezù begnügte sich damit, ihm einen Tritt in den Hintern zu geben, kaum dass er sich erhoben hatte.
Gosset torkelte den Hang hinauf auf die schützenden Bäume zu. Zurückblickend sah er, dass der Wald von Bewaffneten nur so wimmelte. Und rund um das Gehöft waren Bogenschützen aufgezogen. Sie hatten Brandpfeile aufgelegt. Nur die Straße vor der Taverne schien völlig einsam und leer, einladend zu trügerischem Entkommen.
Ausgerechnet jetzt setzten die Wahnwitzigen wieder mit ihrem Lied vom Montségur[37] ein.
»Mas cò qu’ es a venir no pòt hòm trespassar …
E morit en après la nuèit, a l’avesprar …«[38]
»Flamme der Freiheit!« Diese Narren! Gleich würden sie selber brennen, als Fackeln ihrer Unvernunft!
Das Gemälde auf der Staffelei war so weit fortgeschritten, dass Rinat Le Pulcin[39], der Maler, schon damit begonnen hatte, einzelne Rosenblüten als weiße Tupfer um den schwarzen Stein zu verteilen. Die junge Dame rekelte sich voller Ungeduld, ihr angewinkelter Arm war eingeschlafen. Sie verspürte keine Lust mehr, mit der aufgestützten Hand ihr Gesicht von der blonden Lockenpracht freizuhalten, ihre kühne Stirn, ihre strahlenden Augen, selbst die herbe, gerade Normannennase verschwanden immer häufiger unter herabfallenden Strähnen. Sie lauschte ins Tal hinab.
»Den Trovère[40] möcht’ ich um mich haben«, wandte sie sich fordernd an ihren ritterlichen Gefährten, von dem sie nur das gesenkte Haupt hinter dem Epitaph sehen konnte. »Seine Stimme ist zwar laut wie die Glocken eines Kirchturms, doch voller Wohlklang«, schob sie aufmunternd nach, und als ihr Begehr auch diesmal keine Antwort bewirkte, setzte sie aufreizend leise hinzu: »Sicher ein schöner Mann!«
Der junge Ritter verweigerte ihr den Gefallen, nicht aus Trotz noch aus Eifersucht, sondern weil er den Wunsch gar nicht vernommen hatte, so versunken war er in das, was dem Stein fehlte. Er träumte von dem schwarzen Kelch, der so klar seine Spur hinterlassen, wie der Quell, der ihn beweinte – oder sich über ihn lustig machte. Er hörte die Bienen summen und sah die Spinne weben. Dann merkte er, dass sie in den Stein gemeißelt waren, so lebensecht, dass er sich hatte täuschen lassen. Voller Wut streifte er den eisernen Kampfhandschuh über die bisher stets zurückgewiesene tastende Hand. Dieser lächerliche Strahl des verborgenen Quells sollte ihn nicht länger zum Narren halten. Er ballte die Faust, und ohne auszuholen, als müsse er den Zauberstein überlisten, rammte er sie in die Öffnung, den nadelfeinen Wasserstab rüde zerbrechend. Es war die schlagartig eintretende Stille, die ihn erschreckte. Die Vögel hatten aufgehört zu singen, die Bienen ihr Summen eingestellt, und das Netz der Spinne war zerrissen. Er starrte auf die behandschuhte Eisenfaust – Blut, rotes Blut, lief an ihr herunter. Er zog sie langsam zurück.
Seine Damna war aufgesprungen, doch sie schaute nicht zu ihm, sondern zu Philipp, der ohne Gosset zurückkam und wild gestikulierte.
Rinat Le Pulcin hatte all das nicht bemerkt. Zufrieden warf er einen letzten prüfenden Blick auf sein Gemälde und verglich es mit der Wirklichkeit. Da entdeckte er, dass der Rosenhag sämtliche Blüten abgeworfen hatte. Ein schneeweißer Teppich bedeckte den Boden. Und dann sah auch er das Blut, das in den Schnee tropfte, auch wenn der Ritter sich mühte, seine Hand zu verbergen.
»Ladoncs viratz lo pòble en auta votz cridar …«[41]
Trotziges Wutgeheul brüllte den Angreifern entgegen. Die Taverne war im hinteren Teil mit beißendem Rauch gefüllt, während vorne brennendes Stroh von oben zwischen Menschen und Tiere fiel. Die Faidits hatten sofort begriffen, dass sie in der Falle saßen und diese tödlich sein würde, wenn sie nicht schnell und gemeinsam handelten. Sie hatten sich gegen die Flammen Kübel und Fässer übergestülpt, gegen die Pfeile Tische und Bänke ergriffen und als Schutzschilde vorangetragen, die angesengten Pferde hinausgejagt und waren ihnen als dicht gedrängter Haufen gefolgt. Das zwang den Hauptmann unter dem Gezeter seines geistlichen Bruders, seine Leute aus den Verstecken beidseitig der Straße herauszubeordern und den Faidits entgegenzuwerfen, ehe diese sich ins Freie gekämpft hatten. Doch die verzweifelte Wucht der Eingeschlossenen war stärker als die zögerliche Aufstellung der Soldaten. Fernand Le Tris konnte seine Bogenschützen nicht einsetzen, denn schon waren Freund und Feind im dichten Qualm so ineinander verbissen, dass er auch seine eigenen Männer getroffen hätte.
»Schießt, schießt!«, kreischte Bezù, der Inquisitor. »Wir haben Reserven, die Hunde dagegen sind gezählt!«
Doch die Schützen dachten nicht daran, ihre eigenen Gefährten umzubringen, nur weil der Dicke eine Taverne mit Faidits ausräuchern wollte.
»Fall ihnen in den Rücken!«, schrie befehlend der Herr de la Trinité seinen Bruder an, den strategisch durchaus sinnvollen Einsatz der unwilligen Bogenschützen fordernd. Doch die kamen dem Feldherrn zuvor. Sie warfen Pfeil und Bogen weg, zogen ihre Dolche und warfen sich in das Getümmel, das zwischen dem verräucherten Ausgang und den brennenden Stallungen wogte.
Der Gesang war verstummt. Erbittert tobte der Kampf Mann gegen Mann. Der Wirt trug von hinten aus dem Gewölbe Zuber mit Wasser und nässte seine Gäste, hieb auch mal einem Soldaten ein leeres Holzfass auf den Helm, wenn es sich ergab, denn auch er hatte keine Gnade zu erwarten.
Mitgefangen, mitgehangen, dachte er grimmig und grinste über den schmächtigen Troubadour, der unter einem der Weinfässer hockte und mit beiden Armen seine Laute vor herabfallendem brennendem Stroh schützte. »Mach den Hahn auf!«, rief er ihm zu. »Den Wein wird keiner mehr –«
Weiter kam er nicht, denn ein Balken war ihm geradewegs auf den Kopf gefallen.
Jordi Marvel sprang entsetzt aus seinem Versteck, um den Balken von dem Wirt zu wälzen. Da stolperte ein verirrter Soldat über beide und hob seinen Dolch. Jordi schlug ihm die Laute ins erstaunte Gesicht, und der Angreifer fiel hintüber gegen den Spund des Weinfasses, das sich sofort mit dickem rotem Schwall zu entleeren begann. Der Franzose lachte dem Trovère aufmunternd zu und hielt seinen Helm unter das köstliche Nass. Das erboste den Wirt so, dass ihm die Kraft erwuchs, sich von dem Balken zu befreien. Er rammte das Holz gegen den Zecher und quetschte ihn mit voller Wucht gegen das Fass. Doch andere Franken eilten ihrem Freund zu Hilfe. Sie zerhackten den Wirt und wandten sich Jordi zu, der nichts als seine zerbrochene Laute zur Wehr besaß.
»Jetzt wirst du für uns singen!«, riefen sie und machten sich einen Spaß daraus, den Kleinen umherzuschubsen.
Da sprang über ihnen krachend die Luke im Deckengewölbe auf, und ein Ritter sprengte hoch zu Roß die steinerne Treppe hinunter.
Er hatte sein Visier geschlossen, und furchtbar blitzte das breite Schwert in seiner Faust. Dem Pferd gelang es, die steile Stiege zu überwinden, ohne den Reiter abzuwerfen.
Das entsetzte die Franken derart, dass sie auf ihre Übermacht pfiffen und sofort von dem wehrlosen Sänger abließen. Der Ritter mit den rotgelben Barren auf Schild und Brustpanzer griff im Sprung herab und riss den schmächtigen Troubadour zu sich hinauf, dann gab er dem Tier die Sporen und setzte über Bänke und Tische, über Freund und Feind hinweg und erreichte unangefochten den Ausgang. Vor ihm wichen auch die auf der Straße Kämpfenden zurück, als sei der Satan unter sie gefahren. Der Ritter zügelte sein Roß vor dem Hauptmann, der ergeben herbeitrat. Ein Schlag mit der flachen Klinge auf sein behelmtes Haupt war alles, was er empfing. Fernand Le Tris ging in die Knie, bevor er wie ein Sack vornüber fiel. Der Ritter wendete sein Tier und stob mit ihm hangaufwärts, was alle, die dort standen, zur Seite springen ließ. Dazu gehörte auch der Inquisitor, der allerdings »Halt, ich befehle: halt!« hinter ihm herrief. Bald war der geheimnisvolle Fremde mit dem kleinen Troubadour vor sich im Sattel zwischen den Bäumen des Burgwaldes verschwunden.
Die Faidits hatten durch die unerwartete Erscheinung Mut gefasst, noch einmal zu Tischen und Bänken gegriffen und waren in geschlossener Phalanx aus der Taverne gestürmt, über die Straße hinweg, den Hang ins Tal hinab. Die wenigen Franken, die ihnen folgten, wurden nie wieder gesehen.
Der Teufel in Rennes Le Château[42]
Die alte gotische Königsstadt Rhedae, zum Sitz des Grafschaftgerichts des Razès verkommen, war als Hochburg des Katharismus[43] noch einmal zu Ruhm gelangt. Sie leistete sich sogar einen Ketzerbischof, dessen Anhänger lange zähen Widerstand leisteten, sodass die fränkischen Eroberer schließlich nicht nur die trutzigen Wälle schleiften, sondern auch die Häuser der Stadt in Schutt und Asche legten. Nur die ehemalige Zitadelle ließen sie stehen als Kern eines verwunschenen Dorfes, das sie Rennes-le-Château nannten. Der eigentliche Grund für die Zerstörungswut war jedoch, dass sie den Schatz des Salomon suchten, den die Römer aus Jerusalem geraubt und die Van dalen angeblich aus dem Capitol hierher verschleppt hatten, bevor sie über die Pyrenäen weiterzogen. Dann schwappten die maurischen Eroberer ins Land, und als die Könige von Aragon[44] diese Fluten schließlich vertrieben hatten, konnte sich kein Mensch mehr erinnern, wo die Schätze vergraben worden waren.
So lag ein geheimnisvoller Schleier über den Mauern, düstere Geschichten nisteten in den Nischen und Winkeln. Es wurde gemunkelt, der Teufel habe Besitz von diesem Ort genommen, der zum größten Teil von der unsichtbaren Vergangenheit lebte. Ein Ort der Illegalität. Selbst die Templerburg war dort kaum aus strategischen Gründen errichtet worden, denn es befanden sich genügend Komtureien[45] des Ordens in allernächster Nähe.
Die Feste war das Werk eines einzelnen Mannes. Der Präzeptor[46] des Ritterordens, Gavin Montbard de Béthune[47], war eine außerordentliche Persönlichkeit. Schon zu Lebzeiten geheimnisumwittert und mit Sicherheit zu den höchsten Führungsrängen zählend, galt er als Sonderling. Er konnte sich Freiheiten herausnehmen, die mit seiner vielseitigen Tätigkeit als Gesandter allein nicht zu erklären waren. Seine Burg in der ehemaligen Zitadelle, die Gavin wie besessen fortwährend ausbaute, beherrschte längst Rennes-le-Château. Es ging das Gerücht, die Anlage habe sich unterirdisch weiter ausgedehnt als die alte Stadt und sei zum zukünftigen Sitz des Großmeisters[48] von Okzitanien bestimmt.
»Rhedae als Keimzelle des neuen Ordensstaates der Templer[49]?«
Es war Yeza, die in ironischem Ton diese Frage stellte. Sie ritt an der Seite von Gosset dem kleinen Trupp voran. Ihr »Hofmaler«, dazu hatte sie Rinat Le Pulcin kurzerhand ernannt, folgte ihr ebenso wie Jordi Marvel. Der so vereinnahmte Künstler besaß ein eigenes Packpferd, eine müde Mähre, die das Gestell zum Befestigen der hölzernen Bildtafel schleppte, als sei es die Last eines zerlegten Katapultes. Ihr frisch erkämpfter Troubadour hingegen war so geringen Gewichtes, dass sie ihn zusätzlich auf eines der Saumtiere gesetzt hatten, die Philipp mit dem Zelt und sonstigem Hab und Gut beladen hatte. Roç und der Diener bildeten den Abschluss.
»Das ist zweifellos die verblasene Idee, die Euer Freund, der Präzeptor, insgeheim hegt.«
»Ein souveränes Templarium, mit dem Herrn Montbard de Béthune als Despotikos?« Yeza lachte hellauf bei der Vorstellung. »Der sauertöpfische Gavin als der neue König Artus - und was sagen die Templer dazu?«
»Klugerweise erst mal nichts«, antwortete Gosset, »denn es bedarf schließlich der Zustimmung Frankreichs.«
»Sie könnten das Terrain kaufen.« Yeza wiegte ihren schlauen Kopf. »Bei den Schulden, die der König beim Orden angehäuft –«
»– wird Paris dennoch kaum das Land hergeben, das es gerade mit so viel Mühen und Blut erworben«, unterbrach sie der Priester.
»Mit Lug und Trug!« ereiferte sich die knabenhafte Reiterin und warf ihre Blondmähne zurück. »Und wider jedes Recht!«
»Es zählt der Erfolg, meine Königin. Nicht einmal Aragon streitet Ludwig noch den ordentlichen Besitz ab.«
»Aber ich!«, sagte Yeza.
»Nun gut«, wiegelte Gosset grinsend ab, »einen Anfang habt Ihr ja mit Quéribus gemacht.«
Sie waren die kahle Anhöhe in Serpentinen hinaufgeritten, die sich zwischen Gesteinstrümmern, geborstenen Mauern, eingefallenen Torbögen emporschlängelten, und näherten sich der Festung, die auf dem höchsten Punkt von Rhedae aufgetürmt war.
Eine wehrhafte Kirche ragte aus der Mauer empor wie ein vorspringendes Bollwerk. Ihr Dach war von gestaffelten Zinnen umkränzt und in die umlaufende Brustwehr der Burgmauer einbezogen. Eine steile Freitreppe führte zu der einzigen Pforte hinauf, die so klein und niedrig war, dass keine zwei Männer sie nebeneinander hätten passieren können und schon gar nicht zu Pferde. Die Ankömmlinge ließen ihre Tiere dennoch die Stufen hinaufsteigen und erreichten den mit Steinplatten belegten Vorplatz. Philipp wurde bei den Tieren zurückgelassen, Roç wollte stante pede die restlichen Stufen hinaufeilen, doch Gosset versuchte ihn zurückzuhalten.
»Dies kann nicht der offizielle Eingang sein«, gab er zu bedenken, doch Roç begeisterte sich an der Vorstellung, dass natürlich ein geheimer Zugang aus der Kirche in die Burg führen müsste.
»Das ist immer so«, behauptete er, »und ich werde ihn zu finden wissen.«
»Ich gehe mit«, erklärte Yeza.
»So bleibt mir nur, den Herrn Präzeptor darauf vorzubereiten«, sagte Gosset, »dass seine Gäste durch den Kamin oder eine Schranktür kommen werden, um ihm die Aufwartung zu machen.«
Das hörten die beiden schon nicht mehr, denn um die Wette stürmten sie bereits die Steintreppe empor, bedächtig gefolgt von Jordi und Rinat. Die Tür war unverschlossen, ein eingemauerter Totenschädel grüßte grinsend vom Tympanon[50] herab, darunter die Schrift »Terribilis est locus iste«[51]. Roç drückte die schwere Bohlenpforte auf, und das Licht fiel auf eine Teufelsfratze. Roç schreckte zurück, aber Yeza war nicht so leicht einzuschüchtern.
»Sieht dir irgendwie ähnlich«, wandte sie sich an den zwergwüchsigen Troubadour, der sie eingeholt hatte. Tatsächlich hockte der Gehörnte gleich neben dem Eingang und hielt seine Hand auf, als wolle er um Almosen betteln. Rinat entwand dem Katalanen die Laute und drückte sie der Gestalt geschickt so in die Hand, dass sie das Instrument zu spielen schien.
»Jetzt fehlt ihm nur noch deine Stimme, Rinat.«
Der Spott blieb Roç im Halse stecken, denn jetzt erscholl, das Gewölbe füllend, ein mächtiges Organ:
»Ein Ende hat Er gesetzt der Finsternis, und alle Vernichtung begrenzt Er durch den Stein von Dunkel und Todesschatten.«[52]
»Was war das?«, fragte Roç beklommen, kaum war der letzte Ton verrauscht.
»Hic domus Dei est.«[53] Den Text murmelnd, zeigte Jordi erschauernd auf eine weitere Inschrift, die vor ihnen im Boden eingelassen war. »Das war Gott!«, flüsterte er. »Du sollst Seinen Namen –«
Rinat entwand der Teufelsfigur die Laute und gab sie ihrem Besitzer zurück.
»Den rechten Weg hat Er gezeigt, denn wer ›nach der linken Seite wandelt und seine Wege unrein macht, der zieht alle schändenden Geister auf sich, denn nur einem solchen Menschen können sie anhaften.‹«[54]
Die Stimme ertönte ein zweites Mal. Sie wiederholte die Worte, doch sosehr sie sich im Halbdunkel der Kirche umschauten, sie entdeckten niemanden, und auch die Richtung, aus welcher der Sprechgesang gekommen war, ließ sich nicht bestimmen. Der tiefe Bass wehte durch das Kirchenschiff, schwoll an und ab, bis er wie ein Orgelton verklang. Eingeschüchtert drangen sie vor in den Innenraum, dessen Fensterlöcher hoch oben lagen, sodass das Licht nur auf bestimmte Stellen fiel. Es beleuchtete Nischen in der Wand, in denen Figuren standen, die alle auf die kleine Gruppe herabzustarren schienen. Ein drittes Mal erhob sich die Stimme:
»Besser ein Kind, das arm ist und weise, als ein König, ein alter und törichter, der sich nicht mehr in acht zu nehmen weiß.«
Ihr Hall füllte den Raum, wurde von den Wänden zurückgeworfen, sodass sie wieder die Quelle nicht ausmachen konnten.
»Der Weise hat seine Augen im Kopf, doch der Tor wandelt in Finsternis.«
Die Eindringlinge waren vor den Altar getreten. Dahinter erhob sich ein überlebensgroßes Golgatha. Ein natürlich anmutender Hügel türmte sich auf, mit den Kreuzen der Schacher rechts und links, und füllte die gesamte Apsis. Das Kreuz Christi schwebte noch halb über dem Boden. Henkersknechte machten Anstalten, es mittels Seilen aufzurichten, während ein Mann noch den letzten Nagel durch die Fußwurzel trieb. Ein Geräusch hinter Roç, Yeza und Jordi ließ sie herumfahren. Aus einer der Nischen, sie war mit »Joseph« beschriftet, war eine Gestalt herabgestiegen und verließ, in ein wallendes Gewand gehüllt, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, gemessenen Schritts die Kirche. Währenddessen sagte eine tiefe Stimme deutlich: »Shalom.«[55]
Der Priester Gosset saß auf einem Hocker und hatte reichlich Gelegenheit, sein Gegenüber im hohen Lehnsessel jenseits des Eichenschreibtischs zu betrachten, denn der Präzeptor von Rhedae schaute versonnenen Blickes durch das offene Fenster hinaus auf das Land. Gavin Montbard de Béthune mit dem markanten, wie von Bildhauern gemeißeltem Cäsarenkopf, das Haar kurz und eisgrau, war eine äußerst eindrucksvolle Erscheinung. Seine straffe Gestalt war statt in makelloses Weiß in eine völlig unübliche schwarze Clamys[56] gehüllt, die das blutrote Tatzenkreuz des Ordens auf der rechten Brust trug.
Das Protopoma[57] eines Templers, kam es Gosset in den Sinn, wenn da nicht die falsche Farbe gewesen wäre – und dann diese Augen, die unter schweren Lidern ein merkwürdiges Glitzern zeigten, und dieser weiche Mund zwischen der harten, bartlosen Kinnpartie und einer zerbrechlich wirkenden, feinen Nase.
Als Gosset das getäfelte Arbeitszimmer des Präzeptors betreten hatte, hielt der gerade drei jungen Männern, ihre Tracht wies sie als Novizen des Ordens aus, eine Standpauke. Denn sie ließen die Ohren hängen und hielten die Blicke gesenkt.
»Wenn Ihr die erste Regel nicht gelernt habt, nämlich Euch als hundsgemeine Soldaten des Ordens zu begreifen, gehorsam zu dienen, ohne zu fragen, dann schlagt Euch eine Aufnahme aus Euren edlen Köpfen!«, hatte er sie kalt gemaßregelt. »Ritterlicher Stand ist Vorbedingung, höfische Art entspricht jedoch mitnichten dem Stil der Lebensführung eines Templers.«
Der Ordensobere ließ seinen Blick höhnisch auf den Burschen ruhen.
»Euer Auftrag für Quéribus war, innerhalb der Wachmannschaft nicht aufzufallen. Jetzt hat Euch der Seneschall höhnisch an mich zurückexpediert, als »hochnäsige Hunde, die im Rudel stören, weil sie zu laut bellen und zu nachlässig wachen«. Damit habt Ihr mir ans Bein gepinkelt – und jetzt raus! »
Wie begossene Rüden waren die drei aus dem Saal geschlichen.
»Es sind nachgeborene Söhne der Eroberer, die kein Erbe zu erwarten haben und keine Lust zum Priesterberuf verspüren. Ehe sie als Raubritter enden –«
»Wollt Ihr sie dem Orden zuführen«, beschloss Gosset den Satz. »Denn Ihr seid auf gefügigen Nachwuchs aus, der dem Flecken Erde hier seit ein, zwei Generationen verhaftet ist, ohne vom okzitanischen Rebellenbazillus befallen zu sein, und der auch nicht der katharischen Irrlehre anhängt.«
»Das seht Ihr erstaunlich richtig für einen Priester, der Ihr jedoch nicht seid«, bestätigte Gavin, ohne die Spur eines Lächelns. »Ich brauche jeden Mann!«
Gosset nahm den Faden auf. »Ihr stellt Euch das zu einfach vor. Der Deutsche Ritterorden hat im ostpreußischen Ordensland einen Staat etablieren können, weil er rechtlose Heiden unterjochte und sich ihr Territorium angeeignet hat.«
Der Präzeptor wandte Gosset nachdenklich seinen unsteten Blick zu.
»Hier, Gosset, ist Ähnliches geschehen. Rom und Paris in trauter Gemeinsamkeit haben die Ketzer verfolgt, vertilgt und den eingesessenen Adel Okzitaniens vertrieben.«
»Das ergibt zwar keine sonderlich appetitliche Rechtsgrundlage«, unterbrach ihn der Priester ruhig, »aber die Tat hat Fakten geschaffen und wurde nicht von Euch begangen – leider.«
»Wir nehmen Frankreich die Sorge um eine aufsässige Provinz ab und der Kirche den Ärger mit den Ketzern. Das ist – zusammen mit einem Kaufpreis, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, einschließlich großzügigem Schuldenerlass – doch ein recht annehmbares Angebot?«
»Ihr Templer denkt wie Kaufleute. Dynastische Vorstellungen sind Euch eben fremd.« Gosset ließ sich den Ärger darüber nicht anmerken. »Ihr vergesst die gesta Dei per francos[58], dieses mystische Gewaber von gottgewolltem, gesalbtem Königtum, die Glorie Frankreichs, Vorstellungen von Blut und Boden, die sich mischen und längst heilig gesprochen sind. Ihr vergesst den französischen Adel, dessen Väter als Belohnung für ihre Teilnahme an dem Raubzug im Namen der Krone hier mit Lehen bedacht wurden. Ihr vergesst die Würdenträger der Ecclesia católica[59], für die sich im Languedoc[60] und Roussillon[61] fette Pfründe aufgetan haben. Die alle macht Ihr Euch zu Feinden! Selbst der Papst kann über solche Pläne nicht glücklich sein, und noch hängt Ihr von ihm ab.«
Gavin schaute belustigt auf den Priester hinab.
»Für die Christenheit wäre der Verlust des Papsttums ein Gewinn, und ein Großmeister des Tempels wäre allemal der bessere Papst!«
»Sicher«, sagte Gosset und lächelte. »Das gleiche Schicksal darf der König von Frankreich erwarten. Seine Majestät ist vor Freude schon außer sich!«
»Neue Lösungen bedürfen der Kühnheit des Gedankens«, entgegnete Gavin laut und erhob sich. »Die Durchführung ist eine Frage vorsichtiger Schritte und strengster Disziplin.«
Es klopfte an der Tür, dreimal.
»Mein Kabbalist[62]«, verkündete der Präzeptor mit gedämpfter Stimme, »Jakov Ben Mordochai Gerunde[63], also aus Gerona, ist mein Gast, weil ihn seine eigenen Talmud-Juden steinigen würden, so sie ihn erwischten.«
Gosset wollte etwas erwidern, aber Gavin hatte mit seinem Abakus[64] viermal vernehmlich auf die Tischplatte geschlagen, und die junge Templerwache ließ den Gelehrten eintreten.
Aus der Kapuze lugte ein bäuerlich derbes Gesicht voller Gutmütigkeit. Jakov blieb in der Tür stehen.
»Was haben die jungen Herren Pons de Levis[65], Mas de Morency[66] und Raoul de Belgrave[67] nun schon wieder angestellt, dass sie sich – bei entblößtem Torso – gegenseitig mit Weidenruten auspeitschen bis aufs Blut?«
»Sie sollten lieber ihre hohlen Schädel aneinander dreschen«, raunzte Gavin ungehalten. »Sie haben sich so dämlich angestellt, dass selbst Pier de Voisins[68] gemerkt hat, woher der Wind weht. Ihre Aufnahme in den Orden haben sie verspielt – fürs erste.«
»Gebt ihnen noch mal Gelegenheit, sich zu bewähren.« Der Gelehrte beugte demütig sein Haupt.
»Das Ansehen der Templer fordert, sich von Versagern zu befreien. Sie haben uns bereits Schaden zugefügt, weil sie sich als Agenten der niedrigsten Stufe haben entlarven lassen. Der Seneschall hat sie nicht einmal gestraft, sondern sie mir unversehrt zurückerstattet, eine freundliche Geste, die puren Hohn darstellt. Ich kann nur hoffen, dass jetzt nicht auch die übrige Mannschaft, die ich zum Schutz von Roç und Yeza auf Quéribus habe einsickern lassen, entdeckt und ausgeschaltet wird.«
»Lasst mich dafür Sorge tragen«, bot sich Gosset an. Doch Gavin wollte davon nichts wissen.
»Ihr seid als Beichtvater des Königlichen Paares bei unseren Gegnern akkreditiert. Seid froh, wenn Euch dieser Status erhalten bleibt.« Der Präzeptor schritt um den Tisch. »Was treibt die Kinder des Gral in unsere entlegene Mark?«
»Roç und Yeza sind schon längst keine Kinder mehr. Das hat das Königliche Paar schon den Mongolen bewiesen, denen sie nach der brutalen Vernichtung vonAlamut[69] den Rücken kehrten.«
»So gingen die Erben Dschingis Khans[70] der Hoffnungsträger verlustig. Und die Versöhnung zwischen Ost und West hat noch immer nicht stattgefunden.«
»Sie kehrten ins Abendland zurück, besuchten König Ludwig[71] in Paris, und jetzt stehen sie Euch ins Haus.«
»Ihr Entdeckungseifer wurde durch meinen Abgang möglicherweise gestört«, entschuldigte sich Jakob. »Aber ich musste mein Nischmat-Gebet[72] verrichten!«
»Ich weiß«, knurrte der Präzeptor. »Ihr Juden preist Jahwe selbst noch auf dem brennenden Scheiterhaufen, wenn der Talmud[73] es so vorschreibt. »
»Ich muss mich um Roç und Yeza kümmern«, drängte der Priester und wollte sich verabschieden.
»Ihr könntet von hier aus sehen, was und wie sie es anstellen, hinter die Geheimnisse des locus terribilis zu kommen. Ich bin neugierig.«
Gavin trat an die Wand, schob ein Paneel zur Seite und winkte seinen Gästen zu. Durch geöffnete Sehschlitze fielen ihre Blicke ungehindert in den Kirchenraum.
Magdalena vom Zodiak
»Ich sage dir«, flüsterte Roç deutlich vernehmbar Yeza zu, »in dieser Kirche liegt irgendwo der Schlüssel zum Schatz des Salomon, wenn nicht der Schatz selbst.«
Sie schaute ihn von der Seite an.
»Hier ist alles zu offensichtlich«, murmelte sie. »Schau dir die beiden Engel an oder wen diese weiß gekleideten Jünglinge sonst darstellen sollen, die da vorne den Felsklotz bewachen. Natürlich ist der beweglich, aber dahinter wirst du nichts finden.«
»Den Leichnam.« Roç schauderte es. »Denn das ist das Grab.«
»Nicht einmal einen Sarg!« beschied ihn Yeza und schenkte dem tonnenschweren Menhir keinen weiteren Blick.
»Ich werde ihn untersuchen.« Roç war beharrlich. »Wenn ich Spuren von Rollen …«
Yeza hörte nicht mehr hin, denn sie inspizierte mit Jordi die Nischen, nachdem Joseph einfach davongeschritten war. Der kleine Sänger war eifrig dort hinaufgeklettert, wo noch eine Trittleiter stand. Er hatte den Platz des Zimmermanns eingenommen, ohne ihn auszufüllen, aber dabei etwas entdeckt.
»Die heilige Germaine da nebenan in der Nische«, rief der Zwerg aufgeregt, »sie hält etwas Blitzendes versteckt in der Hinterhand!«
Roç und Rinat waren als erste bei der Figur, die eine Hand kokett vor sich hielt, als würde ihr knielang herabfallendes Blondhaar nicht reichen, ihre Scham zu bedecken. Doch wenn man es genau besah, formten Daumenspitze und Zeigefinger geradezu aufreizend, einladend obszön einen Ring. Die andere Hand war zurückgebogen, als habe sie einen Dolch im Rücken verborgen, den Zudringlichen zu strafen. Es war aber ein Spiegel. Roç legte mehr tastend als rüttelnd Hand an den Sockel, da spürte er bereits, dass der sich drehen ließ. Das Hinterteil der frommen Germaine wurde sichtbar. Es war nackt. Das war zu erwarten gewesen, doch nicht, dass sie mit der polierten Silberscheibe in der hohlen Hand ihren Hintern bespiegelte, als wolle sie ihre Pofalte erforschen.
»Meine edlen Herren!«, monierte die hinzugetretene Yeza scharf. »Soll ich Euch leuchten?«
»Vielleicht bestand das Martyrium der Heiligen darin, dass sie unter Hämorrhoiden litt?«, witzelte Rinat Le Pulcin, ärztliche Bildung verratend.
Da niemand darauf einging, blieben den anderen Erklärungen erspart.
»Ein Lichtstrahl müsste –« Roç sann laut über die Entdeckung nach. Sein Blick wanderte hinauf zum Spitzbogengewölbe des Kirchenschiffs. Dort fiel zwar ein Sonnenstrahl durch ein Loch in der Decke, er traf auch die Nische, nicht aber den Spiegel.
»Die Kehrseite der Keuschheit«, schnaufte der Troubadour, als keiner Anstalten machte, ihn heraufzuheben. Er war eilends aus der Josephsnische gestiegen, um den Einblick nicht zu versäumen. Enttäuscht ließen sie von der haarigen Schönen ab.
»Wir sollten auch die Künste der anderen Damen in Augenschein nehmen«, regte Rinat an, und der kleine Jordi eilte voran.
Flink kletterte er zur Muttergottes hinauf, die ihr Kind im Arm hielt, das sich im Wuchs durchaus mit ihm messen konnte. Dessen Platz einzunehmen musste wohl der frevlerische Wunsch des Zwerges sein, denn er reckte sich und machte Anstalten, Maria von ihrem Kind zu lösen. Und siehe da, es ließ sich von ihrer Brust wegklappen! Zum Vorschein kam ein Teufelchen, das aus der Rückseite des Jesuskindes geformt war, aber so, dass sein Kopf wie bei einer Fledermaus nach unten hing und eine lange, leckende Zunge sichtbar wurde, während der unschuldige Hinterkopf des Heilands des Teufels nackten Hintern bildete, der sich der zärtlichen Mutter entgegenreckte. Doch was die Schatzsucher viel mehr interessierte: Zwischen den hochgeschnürten Brüsten Mariens stak auch ein Spiegel als Medaillon – und diesmal fiel ein Lichtstrahl direkt auf das glänzende Metall!
»So«, sagte Roç, sich selbst bestätigend, »nun müssen wir nur noch den Weg finden, den der Stern von Bethlehem uns weist!«
Doch der Widerschein fiel auf den glänzenden Hintern des Teufels.
»Du machst die Rechnung ohne die sich verändernde Zeit«, sagte Yeza schlau, »den Lauf der Jahreszeiten!«
Da sprang Rinat auf.
»Der Zodiakos Kyklos[74]!«, rief er und starrte auf die Wölbung der Nische hinter Mutter und Kind. Die Wand war mit allegorischen Fresken geschmückt.
»Seht da oben den Wasserträger und den Kentauren[75] –« Er deutete aufgeregt auf das Bild, »und unten die Dioskuren[76] und den Löwen! Das sind die himmlischen Nachbarn des Solstiz[77]!«
»Ah«, sagte Yeza und wies in die Höhe, »nicht gezeigt wird der sommerliche Wechsel von den Zwillingen zum Cancer[78] sowie –«
Rinat fuhrwerkte mit seinem Zeigefinger in der Luft herum und kam ihr zuvor:
»– vom Jäger Chiron[79] zum Capricornus[80]!«
Aber Yeza zeigte sich überlegen:
»Es handelt sich zwar bei dem Schützen um Nessos[81], doch der Grundgedanke ist richtig. Nur fehlen Frühling und Herbst.«
»Ich hab’ sie gefunden!«, jubelte Roç. »Hinter der Germaine!«
Sie eilten zur Nische der Heiligen zurück. »Seht ihr das Meer, von Zeus, als Stier verkleidet, übersprungen, der Europa entführt?«
Rinat war Feuer und Flamme und diesmal Yeza voraus.
»Das soll nur ablenken von den Fischen im Wasser und dem verborgenen Gehörnten, der Äquinox[82] des Widders zur Linken. Und rechts steht die Virgo[83]. Sie hält sogar die Waage in der Hand! Die Tag- und Nachtgleiche findet zwischen ihnen statt, auch wenn oben der Adler[84] seine Kreise zieht.«
Yeza ließ dem Maler seinen Stolz und fügte nur hinzu:
»Das heißt, einschließlich des Skorpions werden wir hier bedient –«
»Aber wie?«, fragte Roç kleinmütig, den es schon wurmte, nicht wie gewohnt als der große Entdecker geglänzt zu haben.
»Denk nach!«, forderte ihn seine Damna auf. »Entweder muss das Licht dem Spiegel folgen, ihn also das ganze Jahr über erreichen – oder der Spiegel folgt dem Licht.«
»Helft mir da mal hoch«, bat Jordi.
»Du willst bloß der Blonden von hinten in die –«
»Schttt!«, verwarnte Roç den Maler. »Wir sind hier unter Damen.« Und er hob den Zwerg schon zur Nische hinauf.
»Der geile Wichtel!«, schimpfte Rinat, denn der Troubadour steckte seine Nase sogleich zwischen die Pobacken, um dann, vor Wonne prustend, mit hochrotem Kopf wieder zu erscheinen.
Er trippelte um die Figur herum und griff ihr schamlos, das schützende Haar zur Seite schiebend, zwischen die Schenkel. Zum Vorschein kam ein Rohr, das wohl bewusst an einen Penis gemahnte. Es passte genau in die gekrümmte Hand der guten Germaine. Er bewegte den hinteren Arm mit dem Spiegel, und die Bewegung übertrug sich auf den vorderen.
»In welcher Dekade der Jungfrau befinden wir uns?«, fragte Rinat mit vor Aufregung heiserer Stimme und gab sich gleich selbst die Antwort: »In der zweiten!«
Jordi drehte Germaine den Arm hinter den Rücken, als wolle er ihn verrenken, bis sich die Hand der Dame in der Höhe der entsprechenden Darstellung auf dem Fresko befand. Ein Lichtstrahl fiel gleißend in den Spiegel und wurde von dort durch das mitgeschwenkte Rohr vom Anus durch die Vulva geschickt. Er erschien als deutlicher Fleck an der gegenüberliegenden Kirchenwand. Darüber ragte ein Kerzenleuchter aus der Wand, der aus einem Fischleib geformt war.
»Opposition als Kontrolle!«, jubelte Yeza. »Die Klinke zur Tür!«
Sie schritten bedächtig durch das düstere Kirchenschiff.
»Nur keine falsche Bewegung«, flüsterte Roç.
Sie passierten den Golgathahügel[85], der sich vor ihnen aufbaute.
»Soll das alles nur Herrn Gavin zur Belustigung dienen?«, murmelte Yeza und schaute mehr sehnsüchtig als ehrfürchtig zu den aufragenden Kreuzen hinauf, mit den angelehnten Henkersleitern, den Seilen und Haltetauen, den eifrigen Knechten und den würfelnden römischen Legionären. Sie alle waren, wenn auch übergroß, lebensecht aus einem weichen Material, wohl Pappelholz, geschnitzt und so dick in mehreren Schichten farbig übermalt, dass es sich tönern anhörte, wenn man daran klopfte. Die Kreuze hingegen waren aus edlerem Holz gefertigt.
»Unser alter Freund, der Präzeptor, will uns prüfen. Ich spüre, dass seine Augen auf uns gerichtet sind.«
Roç wirkte weniger eingeschüchtert.
»Das mag schon sein, aber ich fühle, er benutzt uns und unsere ihm wohlbekannte Erfahrung als Schatzsucher, um sich zu vergewissern, ob seine Sicherungen funktionieren. Ich möchte wetten, dass wir noch nicht am Ziel sind. Er hätte sonst längst eingegriffen. Lasst mich allein zu dem Fisch«, wandte er sich an seine Begleiter, »und achtet genau darauf, was geschieht.«