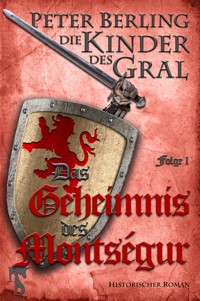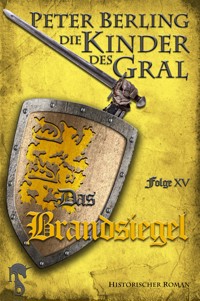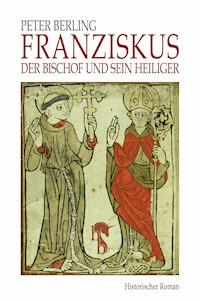
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Giovanni Bernardone wird als Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Assisi geboren. In der Hast wird weder Monat noch Tag, sondern nur das Jahr 1181 in das Register eingetragen. Der junge Giovanni genießt die Zugehörigkeit zur Oberschicht. Bis er nach langer Krankheit die Stimme Gottes erhört und sich von seinem alten Leben abwendet– freiwillig. Von nun an führt Giovanni das Leben eines Bettlers und pflegt Aussätzige in seiner Vaterstadt. Seine Anhänger machen ihn zum Anführer einer neuen Bruderschaft der Armut. Und so wird aus Giovanni, dem Sohn einer reichen Familie, Franziskus von Assisi ... Peter Berling fängt durch sein Wechselspiel zwischen dem Heiligen Franziskus und Guido II., dem Bischoff von Assisi, eine äußerst rege Darstellung des Hochmittelalters ein: Ketzerbewegungen und Kreuzzüge, pralle, verschwenderische Lebenslust, Askese und inbrünstiger Glaube an der Grenze zum Fanatismus und eine bis heute legendäre Heiligsprechung fließen zu einem lebendigen Schaubild zusammen. Der Roman über den großen Heiligen des Hochmittelalters – Franziskus von Assisi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Peter Berling
Franziskus
Der Bischof und sein Heiliger
Historischer Roman
Meinem Vater gewidmet
Vorgeschichte
Ich erinnere mich des Zaubers, den ich empfand, wenn meine Finger über Landkarten fremder Länder glitten, sich in Territorien verschieden gefleckter Bräunung verloren, vom tiefen Rot der Senken bis zu den eisschimmernden Kappen der Hochgebirge, über ein Netz von glatten, gestrichelten oder gepunkteten Linien mehr oder weniger dick eingekreiste Orte eroberten.
Als ich lesen lernte, ergriff mich eine seltsame Unruhe: Unmerklich trat die Dimension der Zeit hinzu, und raunend, flüsternd führte sie mich – nicht etwa in die ferne Zukunft –, sondern weit zurück in Epochen, wo sich Legenden und Geschichte vermischen.
Die Erprobung ihrer Grenzwerte zog mich magisch an, die Vermengung bezeugten Geschehens, dokumentarisch belegbaren Wissens, mit der »möglichen«, allein meiner Phantasie überlassenen »Belebung« einer ausgeglühten Tontafel, eines goldenen Ohrringes, einer abgebrochenen Pfeilspitze, eines »Namens«. Zwangsläufig geriet ich auf dieser Suche nach Verschmelzung von Fakten und Fiktion geradewegs ins Hohe Mittelalter, Aufbruchsstimmung und Krawall, tiefe religiöse Verinnerlichung bis zum Fundamentalismus, mit hauchdünner Trennlinie zur ketzerisch anarchischen Erneuerung.
Ich bereiste die Länder rund um das »mare nostrum«, spürte historische Stätten und Nebenschauplätze auf, bei der Suche nach verborgenen Spuren jenes unser heutiges Leben, unsere Sitten, Sprachen, Religionen, vor allem aber politische Zwiste und Grenzen noch immer präjudizierenden, umwertenden Abschnitts der Geschichte.
»Jerusalem« hieß das Zauberwort, das Hunderttausende dazu verleitete, »das Kreuz zu nehmen«, sich in Durst und Kälte, über Berge und durch Wüsten zu schleppen, Krankheiten, Hunger und Hitze sowie Drangsal durch Feinde zu erdulden, und sich auf diese »Bewaffnete Pilgerfahrt« zu begeben. Sie taten dies mit einer Lust, einer närrischen Entrücktheit, die uns heute verrückt vorkommen mag. Der Franciscus zugeschriebene Anspruch auf den Titel »Narr Gottes« traf damals auf viele zu.
Das Ziel, das Land der Ungläubigen vorher zu erkunden, hatte man nicht für nötig gehalten. Es sollte sich bitter rächen: Statt Heiden fanden die Kreuzfahrer Anhänger eines in sich gefestigten Glaubens vor, dessen Regeln sie nach dem Propheten im Koran niedergelegt hatten. Sie befolgten sie streng und fromm. Die christlichen »Befreier« sahen sich mit einer hochentwickelten Kultur konfrontiert, angesichts derer sie sich wie Barbaren (die sie auch waren!) vorkommen mussten. Statt dumpfer Ignoranz stießen sie auf verfeinerte Lebensformen, blühende Wissenschaften, Philosophie und Künste – und auf einen weitaus klareren Monotheismus, als sie selbst mit ihrer Trinität anzubieten hatten. Abgesehen vom desaströsen militärischen Ausgang dieses amateurhaft inszenierten Unternehmens schlug vor allem der Kultur- und Zivilisationsimpakt auf den Okzident zurück. Neben Parfum und Damast, Gewürzen und Naschwerk fluteten die Lehren von esoterischen Sekten und freidenkerischen Köpfen, von häretischem Schriftgut und liberalen Moralvorstellungen zurück in ein Europa, das in bebender Aufnahmebereitschaft harrte. Die Blütezeit der Minne stand bevor.
Doch Aufbruch auch in den erstarrten oder durch Prunk und Ausschweifung verkommenen Gliedern der »Alleinseligmachenden« ecclesia catolica des Petrus und des Paulus. Andere Jünger waren andere Wege gegangen. Jetzt hörte man von ihnen, hörte zum ersten Mal wieder direkt aus dem »Heiligen Land«, durch das der Herr Jesus höchstselbst geschritten, ob nun barfuß oder in Sandalen, doch keinesfalls so lasterhaft sich Simonie und Lotterleben hingebend wie die Herren der Kurie. Das »Zurück zu den Anfängen, zurück zur Wahrheit des Herrn!« wurde zum Signal der einsetzenden Bewegung der »Neuen Armen«. Das Auftreten eines Franciscus ist kein Zufall, sondern Frucht einer Epoche, eingebettet in so widerstrebende Strömungen wie tiefe Gläubigkeit und fanatische Intoleranz einerseits und die durch Scholastik aufbereitete »neue« Logik des Aristoteles, die rasch aufklärerisch wissensdurstige Neugier nach sich zieht. Am Horizont dämmert die Renaissance herauf.
Es hat mich immer gereizt, diese Zeit und ihr Lebensgefühl zu erfassen und darzustellen. Im Zuge solcher Nachforschungen – jemand hatte mich auf den Aufsatz von McKay in der NZZ (vom 5. Okt. 85) angesprochen und mir den »heißen« Tipp gegeben – war ich vor Jahren auf die Bibliothek einer kleinen Koranschule am Rande der Sahara gestoßen. Ich fand zwar nichts von dem, was ich suchte, doch eine Kiste voll ungeordneter Pergamente aus dem 12. und frühen 13. Jahrhundert, die ich ablichtete und archivierte.
In meiner Erinnerung handelte es sich um den Textentwurf zu einem Epitaph, in dem die Heiligsprechung des Franciscus bezeugt wurde, während irgendein Bischof der Verdammnis – »in gehennam« – anheimfiel.
Zwei Jahre danach werde ich in die italienischdeutsche Koproduktion »Franciscus« eingespannt. Regie: Liliana Cavani, in der Hauptrolle Mickey Rourke. Schon bei der ersten Drehbuchbesprechung bietet mir Liliana die Rolle des Bischofs von Assisi an, Guido mit Namen. Es macht keineswegs »Klick« bei mir.
Im Februar 1988 beginnen wir mit den Außenaufnahmen. Wir drehen überall, nur nicht in Assisi, denn dort hat der Francesco-Kult die wenigen ursprünglich erhaltenen Gebäude aus seiner Zeit museumsreif poliert, zu seinen Ehren »renoviert«. Wir nutzen die freigelegte Unterstadt von Perugia und die Kirchen von Tuscania. Hier wandele ich im vollen Ornat mit dem New Yorker Straßenkind in härener Kutte zwischen romanischen Säulen, und in meinen Kopf drängt sich die Vorstellung: Das habe ich doch schon einmal erlebt? Franciscus sanctus … sein Bischof fuhr zur Hölle – 1228 – Guido II Episcopus …
Wer war dieser Guido? Ein Leichtes in der Biblioteca Angelica im »Gams« nachzuschlagen, dass dieser tatsächlich gelebt hatte. Ein Anruf beim Episcopat von Assisi erbrachte die heitere Feststellung, dass man tief beschämt sei, eigentlich nichts – außer ein paar lokalen Querelen – über »il Vescovo di Francesco« zu wissen. Ich kramte die vergessenen Dias von der Koranschule heraus, die Seiten, die mit diesen merkwürdigen »Erinnerungszeilen« begannen, die offenbar in Stein gehauen existiert haben mussten und den Bischof nennen. Gab es diesen Stein noch und wenn ja, barg er ein Geheimnis, wie im weiteren Verlauf des Textes angedeutet? Das Schreiben – über mehrere Pergamentblätter hinweg – war wohl ein Abschiedsbrief, ohne Anrede, ohne Unterschrift …
Eine fremde Hand hatte es adressiert: »John, des Bischof Guido von Assisi Erster Secretarius. Untertänigst zu den treuen Händen S. E. des Herrn Jacobus, Bischof zu San Giovanni d'Arci von Caesarius, des obigen – Gott habe ihn selig – letzter Secretarius.«
Das alles, in umständlichem, aber fehlerlosen Latein, war grob durchgestrichen. Darunter hatte eine andere Hand in holprigem Arabisch gekritzelt:
»Johannes du Mont (djebel) auf Qalat al-Qarain, des allmächtigen Sultans, Bewahrer des Friedens – Allah schenke ihm ein langes Leben – Vertrauter und Bevollmächtigter.«
Qalat al-Qarain lag Tausende von Meilen östlich vom Fundort im Hohen Atlas, im heutigen Grenzgebiet Israels zum Libanon. Es war die Stammburg des Deutschen Ritterordens während der Kreuzzüge gewesen, heute findet man sie nur noch als die ›Ruine Montfort‹ verzeichnet. Und was hatte das alles mit Bischof Guido von Assisi zu tun? War er der Verfasser dieser wehmütig-trotzigen Zeilen, die dann so unvermittelt abbrachen, als habe irgendwas ihn am Weiterschreiben gehindert?
Ich melde mich in Assisi an und bekomme auch einen Termin bei S. E. Mons. Goretti, dem amtierenden Bischof, der mir ein fotokopiertes Dokument überreicht, in dem alle Guido II betreffenden Fakten zusammengetragen sind. Dann übergibt er mich Don Otello, der mich in seiner S. M. Maggiore warten lässt.
»Unter der Krypta befindet sich das Gemäuer einer römischen Villa?« begrüße ich ihn, eigentlich gar nicht fragend. »Oje«, lacht er, »›Propertius was here‹. Soll ich’s Ihnen zeigen?« Wir steigen zwei Stockwerke hinab und befinden uns tatsächlich zwischen römischen Mauern. Ein eisernes Gitter verhindert weiteres Vordringen. »Und irgendwo geht da ein Gang hinüber zum Palazzo Vescovile?« insistiere ich. »Allerdings, Professore«, bestätigt mir Don Otello leicht erstaunt. »Wir fanden eine zugemauerte Tür, brachen sie auf und standen im Flur der bischöflichen Kanzlei. Die ›Belle Arti‹ (die Altertumsaufsichtsbehörde Italiens) hat daraufhin alles verschlossen!«
»Und eine Tafel mit einer Inschrift habt ihr auch gefunden! Aus dem Jahre 1228?« »Nicht, dass ich wüsste.« (Er ist so sicher, wie ich vom Gegenteil überzeugt bin!) »Hier gibt es nur die aus dem Jahre 1216, oben in der Außenmauer der Apsis – allerdings liegt im Garten ein Teilstück, von dem keiner weiß…« Ich zügele mühsam meine Ungeduld. Das Plattenteil dient einer Geranienvase als Untersatz, »seitenverkehrt« (wie ich amüsiert feststelle). Von oben nach unten gelesen, bilden die Wortfetzen den rechten Rand, die Mitte des Textes, den ich kenne. Er fügt sich Zeile für Zeile in den Wortlaut, ich kann ihn inzwischen auswendig. Ich habe offensichtlich ein Stück des Epitaphs vor mir. »Die Worte ergeben keinen Sinn«, vertraut mir Don Otello an.
Das Bruchstück im bischöflichen Garten (und die Bruchkanten waren alt) lässt vermuten, dass in Assisi nichts mehr zu finden ist.
Der Spur des Pergaments nach Montfort zu folgen, erschien mir zu abstrus. Was hatte dieser John, Johannes du Mont, mit den Deutschen Rittern zu schaffen? Diesem Orden hatten Lübecker Kaufleute Anfang des dreizehnten Jahrhunderts die Burg gekauft. Die Deutschen tauften die Schenkung um in »Starkenberg«. Sie konnten sie bis 1271 halten. Dort noch etwas aufspüren zu wollen, grenzte an Aberwitz. Die siegreichen Mamelucken hatten mit Bedacht alles gründlich zerstört, was an die Präsenz der Christen hätte erinnern können. Ich handelte wie im Traum, rief nachts Freunde in Israel an, setzte mich offiziell nach München ab und bestieg dort das nächste Flugzeug nach Tel Aviv.
Mein Verbindungsmann, der kahlköpfige Jay Koller, erwartet mich im Hotel. Ich kenne ihn seit Jahren als Filmjournalisten und Gelegenheitseinkäufer auf Filmfestivals, halte ihn aber für einen Agenten. Gerade noch vor Ladenschluss kaufen wir meine Ausrüstung: Zelt, Spaten, Stricke, verschiedene Lampen, reichlich Batterien, Kerosin-Kocher und jede Menge Filme für meine beiden Kameras. Es fällt nicht auf, dass ich auch Hammer und Meißel erstehe. Spät nachts in Akkon angekommen, bringt er mich in einem Motel unter, muss aber dann plötzlich und sofort, unter Mitnahme des mir zugedachten Jeeps, zurück nach Tel Aviv.
Am nächsten Morgen begebe ich mich zum Taxistand in die Altstadt. Die Fahrer sind durchweg Araber in dieser Stadt, in der auch noch sieben Moscheen, fünf verschiedene christliche Kirchen, aber nur zwei Synagogen in Funktion sind. Doch wen ich auch anspreche, bei der Nennung des Namens »Montfort« klappen unsichtbare Visiere herunter. Wären sie gläubige Christen, hätten sie sich bekreuzigt! »Fahren Sie da nicht hin, Mister, das ist nicht gut.« Mehr ist aus keinem herauszukriegen. Wütend kehre ich ins Hotel zurück. Der deutschsprachige Patron nimmt sich sofort meiner an. Binnen zehn Minuten steht eine langgestreckte Mercedes-Limousine vor der Tür. Der Fahrer deutet »beruhigend« grinsend auf zwei Scorpio-MPs in dem Seitenfach der Tür »One for you – You know how to handle it?« Ich nicke. Wir fahren »obenrum«, die parallel zur unsichtbaren Grenze führende »Straße«. Er kennt sich aus. Der Weg nach Goren ist so zugewachsen, dass man keine zehn Meter weit sieht. Ich schiele zur Scorpio, jeden Moment können die Kopftücher palästinensischer Freischärler vor uns auftauchen – nichts da: Montfort! Da liegt es, gegenüber auf der anderen Talseite ragt die Ruine wie die Lorelei über den fast wasserlosen Flusslauf. Wir kraxeln mühsam hinab (derlei ist durch keinen Saumpfad vorgesehen), und drüben ebenso anstrengend wieder hinauf. Ich bin aufgeregt. Jagdfieber! Der Fahrer hilft mir noch beim Aufschlagen des Zeltes. Ich verabrede, dass er mich morgen um die gleiche Zeit wieder abholt.
Endlich allein. Ich kampiere mit Bedacht auf einer nicht einsehbaren Plattform, die mir aber erlaubt, drüben den Zufahrtsweg im Auge zu behalten. Schnell fällt die Dämmerung ein. Ich trinke nur etwas Wasser. Nur kein Licht jetzt! Ich wickele mich in meinen Schlafsack ein. Mit einem so starken Gefühl von völliger Einsamkeit hatte ich nicht gerechnet. Das leiseste Nachtgeräusch in den mich umgebenden Wäldern lässt mich den Atem anhalten. Unter mir die verwinkelten Bogengänge, eingefallene Treppenaufgänge und säulengestützte Säle der Ordensritter. Und irgendwo vielleicht die Platte, verborgen unter Schutt, überwuchert – wenn es sie gibt, werde ich sie finden …
Die Kühle weckt mich früh. Ich beginne sofort meine Expedition. Wenn der Stein in Assisi das Versteck in den Tiefen des Kellers abdeckte, dann würde hier vielleicht analog verfahren worden sein. Der tiefst gelegene Ort ist sicher die Zisterne. Ich traue mich nicht hinunter aus Angst, ich würde nicht wieder herauskommen, und beginne, die Burg von außen zu »erobern«. Ich finde den Fluchteinlass, den ich suche. Ein schmaler Gang, verwinkelt, mit gegenläufigen Schießscharten zur Verteidigung – halt! Demnach ist hinter den Mauern begehbarer Raum? Ich steige eine Ebene höher, die Stufen des Treppenschachtes sind kaum noch zu erkennen, und es fällt auch kein Licht in die Kavernen. Ich hole meine stärkste Lampe, binde mir das Seil um und lasse mich in die Schräge hinab. Es sind natürliche Grotten, die Menschenhand für ihre Zwecke nur wenig (durch Mauerteile) korrigiert hat. Durch jeden Schlitz kann ich jetzt das Tageslicht sehen, das durch die Öffnung der Fluchtpforte einfällt. Plötzlich kenne ich das Versteck. Und dann stehe ich auch schon vor dem Epitaph, dem genau das Stück fehlt, auf dem im Bischofsgarten zu Assisi der Geranientopf ruht. Es ist eine zugemauerte Schießscharte. Nichts leichter und unauffälliger als das! Genial. Ich ziehe mich wieder hoch, hole Hammer und Meißel, kontrolliere die Zufahrtsstraße gegenüber und die gesamte Umgebung – nichts.
Mein Hämmern erscheint mir so laut wie Kanonenschläge, ich halte inne, doch dann kommt der Rausch über mich, den Archäologen verspüren müssen, wenn ihr Schürfen sie endlich auf die Grabkammer stoßen lässt. Vorsichtig löse ich den unteren Teil der Platte, durch die diagonal ein dicker Sprung verläuft. Dahinter im Dunkel in Stoff gewickelte Bündel. Ein Glücksgefühl, gemischt mit Ehrfurcht, fast Furcht. Ich ziehe vorsichtig das vorderste heraus, öffne es mit Messer und Gabel – wie man einen Fisch tranchiert – die Rolle enthält Pergamentblätter in der gleichen Art wie mein Fund am Rande der Wüste: Latein oder eher latinesk, wie ich beim oberflächlichen Lesen konstatiere: Auffällig allerdings völlig voneinander abweichende Handschriften, als hätten mehrere Personen die Pergamente beschrieben. Ich zwinge mich, jetzt nicht in ein mühsames Entziffern zu verfallen, aber einige Schilderungen faszinieren mich doch. Es sind in der Ich-Form erzählte Eintragungen des Guido, meines Bischofs. Eine Art Tagebuch? Ich fördere noch weitere Bündel zutage und beginne, den Inhalt abzufotografieren, wobei ich jedes einzelne Blatt ausrollen und an den Ecken mit Steinen beschweren muss. Das wird mich Tage kosten, doch alles einzupacken, um dann am Flughafen Ben Gurion den (bekanntlich perfektesten) Sicherheitskontrollen in die Hände zu fallen? Also erst mal auf Nummer sicher. Fieber und Angst, irgendetwas könnte … gut, das Taxi würde ich zurückschicken, es war unmöglich, das vor mir liegende Pensum bis zum Abend zu schaffen. Zwei, drei Tage würde die Arbeit mich mindestens noch in Anspruch nehmen.
Unwirklich schiebt sich der blau-graue Lauf eines Schnellfeuergewehrs zwischen mein Objektiv und das unter mir liegende Pergament. Im langsamen Umdrehen vergeht eine eigentlich angebrachte Todesangst und weicht der Neugier. Ich bin also nicht tot, erschossen – dass sie mich am Leben lassen bedeutet auch, dass ich mich nicht mehr bücken muss! – Außerdem ist mein Adrenalinspiegel sowieso durcheinander. Sie stecken in olivgrünen Uniformen mit schwarzen Tarnflecken, die braungebrannten Gesichter, halb hinter Netzwulsten verborgen, die sie um die Stirn gewickelt tragen, und verstehen offensichtlich kein Hebräisch. Sie sagen nicht, wer sie sind. Einer spricht mich an: Mein Fund, »interesting, very interesting« (kühle Hochachtung) sei Eigentum des Volkes. Ich frage nicht, wessen, sondern sage artig, ich wolle nichts wegnehmen, sondern – im Gegenteil – ihn der Öffentlichkeit zugänglich machen. »Über eine Veröffentlichung (Publishing) bestimmen nicht Sie, noch wir (schwacher Trost). Man wird Sie benachrichtigen.«
Damit sammeln sie (es sind nur fünf Mann und keiner ist als Anführer auszumachen) meine Filme ein, sorgfältig, dass kein Lichtschaden entsteht, nehmen auch die belichteten aus der Fototasche, reichen mir die entleerten Kameras zurück. Sie helfen mir auch, mein Zelt abzubauen, ohne ein weiteres Wort an mich zu richten, sich aber ständig auf Arabisch leise und ruhig unterhaltend, als befänden sie sich nicht auf einem Kommando-Unternehmen im Land des Feindes, sondern auf einer Routinekontrolle »ihres« Territoriums. Sie tragen mein Gepäck über den Fluss und drüben wieder die Felsklippe hinauf, genau zu der Stelle, wo mich mein Taxi abgesetzt hat. Zwei von ihnen sichern mit schussbereiten Waffen die Aktion ab. Der Sprecher verwarnt mich (nicht unfreundlich, aber »unheimlich cool«), nochmals wiederzukommen oder irgendetwas über den Fund verlauten zu lassen. »You didn’t find anything, you didn’t meet anyone!«
Ich saß auf meinem Haufen, als das Taxi erschien. Wortkarg des Fahrers Fragen abweisend ließ ich mich direkt zum Flughafen fahren, ohne mich von meinen Freunden in Tel Aviv zu verabschieden.
Wieder in Rom, hatte ich noch wochenlang Zeit, die Ereignisse in meine Erinnerung zu rufen. Ich versuchte mich an einem Gedächtnisprotokoll – über den Inhalt der Pergamente. Aber wozu? Die Dreharbeiten waren wieder aufgenommen worden, und eines Tages stand auch der Bischof wieder auf der Tagesdispo.
Im August gehen die Dreharbeiten endlich zu Ende. Ich erhalte ein Telegramm aus Israel von Jay Koller, der mir empfiehlt, mich für ein paar Wochen in die Schweizer Berge zu begeben, »zur körperlichen und geistigen Anregung«. Er nennt mir die Kontaktadresse, ich erfahre durch Rückruf, dass ich tatsächlich erwartet werde und nichts mitzubringen bräuchte als eine Zahnbürste.
Ich fahre vom Veltlin kommend mit der Rhätischen Bahn ins Puschlav. Meine Bleibe oberhalb Poschiavos ist keine Hütte, sondern ein abgelegenes, großräumiges Gebäude, in dem außer mir (im Obergeschoß) noch eine Kaffeerösterei untergebracht ist. Ich beziehe Vollpension, habe Zugriff auf die damals beschlagnahmten Unterlagen, stehe aber unter Kontrolle. Ich könnte keine der DIN-A2formatigen Vergrößerungen unbemerkt entfernen, dafür verschwinden sie auch jeweils, wenn ich sie übersetzt und in den Computer gespeichert habe.
Nach etlichen Monaten – ich durfte unterbrechen, so oft ich wollte, was ich auch reichlich tat, näherte sich die Schreiberei ihrem Ende. Ich wusste, dass ich mit niemandem darüber sprechen durfte, auf die einfache Gefahr hin, bei meiner Rückkehr in mein Puschlaver ›Studio‹ kein Stück meiner Unterlagen mehr vorzufinden. Eines Tages war es dann so weit: Ich hatte ein Buch geschrieben, das meiner puren Phantasie entsprungen war? Nicht doch, auf meinem Schreibtisch waren etliche Fotoabzüge liegengeblieben, die mich auf Starkenberg zeigen, beim »Fund« des Epitaphs.
Peter BerlingPoschiavo, im Februar
Zur Ordnung und Gestaltung
Das geheime Tagebuch des Bischofs von Assisi weist originär zwei Autoren aus: den Guido II selbst und seinen ersten Secretarius John Turnbull. Ohne es zu wissen, lieferten dann der zweite, Roald von Wendower, und der dritte und letzte, Caesar von Speyer, weitere Beiträge, die Guido in das Diarium aufnahm, ebenso wie die Briefe seiner Base Jacoba de Septimsoliis und seines Kollegen Jacques de Vitry.
Die Blätter waren von zweiter Hand (zweifellos John) zeitlich geordnet und mit Jahreszahlen beziehungsweise Nummerierungen versehen worden. Ich habe diese übernommen und ergänzt, beziehungsweise kenntlich gemacht, indem ich den Namen des jeweiligen Verfassers obenan gesetzt habe. Auch die Einteilung in Kapitel und deren Überschriften stammen (dem Schriftbild nach) von Turnbull und sind wohl erst auf Starkenberg nachgetragen worden. Die Eintragungen von Guido und Jacoba waren in einem – im Mittelalter gebräuchlichen – Gemisch aus Latein und Italienisch, dem sogenannten »Latinesk« geschrieben, die von John in einem Latein mit stark provençalischem Einschlag (er hat sich wenig Mühe gegeben, seine Muttersprache, die »Langue d’Oc«, zu kaschieren). Roald schrieb ein wenig elegantes Latein (dafür aber mit Allgemeinfloskeln durchsetzt, auf deren Kenntnis er offensichtlich stolz war). Jacques de Vitry benutzte die Sprache des Virgil in geradezu klassischer Manier.
Ich habe mir erlaubt, bestimmte Redewendungen (auch wenn sie banal waren) stehenzulassen, desgleichen poetische Zitate und Liedertexte.
In die vorgesehene chronologische Ordnung habe ich nur insofern eingegriffen, dass ich – meiner eigenen »Erfahrung« dieser Dokumente entsprechend – den letzten Brief des Guido (vom Sonntag, dem 30. Juli 1228), mein Schlüsselerlebnis, nach vorne gesetzt habe. Danach die wohl vor dem eigentlichen Diarium entstandenen Schriftstücke.
Ich hoffe, dem interessierten Leser dieses Buches damit alle Wege zu einer angenehmen Lektüre geebnet zu haben.
Der HerausgeberRom, im Juli
I.PROLOGUS
Einführung in das Leben eines Bischofs
GUIDONIS LITTERA ULTIMA
Letzte Worte (1228)
CUM BENE IN CAELUM NITUIT CLARO LUMINE SOLIS NITUI; CUM EXTINTO, IAM EGO PEREO OBSCURA. CAECA REDDITA AD CULMINEM MOTUS PERVENTA NUNC ATRA IACEO IN ULTIMUM IGNEM. FRANCISCUS SANCTUS EPISCOPUS SUUM IN GEHENNAM MCCXXVIII GUIDO II EPISC
Worte in elegischen Distichen, die einem Properz zur Ehre gereichen würden, in den Stein gemeißelt. Bravo, Episcope! Nur wiegt die Tafel schwerer, als ich dachte. Der brave Steinmetz wollte sie gleich selber an Ort und Stelle einsetzen, doch diesen Ort konnte ich ihm schwerlich zeigen. Ich hätte den guten Mann sonst eigenhändig umbringen müssen, – da ziehe ich es vor, meine Hände mit der Arbeit selbst zu beschmutzen! Also habe ich die Steinplatte gestern schon in das Innere meiner Santa Maria tragen lassen, auf dass keiner aus meiner Gemeinde sieht, welch ungewohnt physischer Anstrengung sich der Herr Bischof am heiligen Sonntag unterzieht. Durch die verborgene Tür hinter dem Altar der Magdalena, Schutzpatronin aller Sünder, fällt der Einstieg in die Katakomben leichter, der zurückzulegende Weg ist kürzer als der über die verwinkelten Kellertreppen des bischöflichen Palazzos von Assisi. Gilt es doch, die störrische Platte allein Zoll für Zoll an ihren Bestimmungsort da unten in die Tiefe zu zerren!
Es herrscht eine Stille, in der ich nur mein Atmen höre – oder klopft mein Herz? Ich erinnere mich meiner Jugendzeit, als der Klosterschüler sich in den Beichtstühlen verbarg in der bangen Hoffnung, eine junge Frau würde kommen und ihn an ihren Sünden teilhaben lassen. Es kamen nur ganz alte, und ich zitterte, entdeckt zu werden.
Heute Vormittag habe ich hier noch Messe gehalten. Ein letztes Mal. Während der scheppernde Gesang meiner Schäfchen das Kirchenschiff erfüllte, ritt meine Garde unter Hartwolf aus, um endlich in ›meinem‹ Kloster Sant’ Apollinare den Mönchen von Sassovivo zu zeigen, wer hier das Recht hat, die Hand auf den Zehnten zu legen. Der Streit geht, solange ich Bischof von Assisi bin. Nur dieses eine Mal noch will ich auf dem incasso bestehen, dann sollen sie zahlen, an wen sie wollen!
Ich verschließe alle Türen der Kirche von innen, auch das Armsünderpförtchen. Ich will nicht überrascht werden und am Ende noch törichte Fragen tattriger Mütterchen beantworten müssen. Ich lausche nochmals, nichts Verdächtiges rührt sich, außer den Schwalben, die oben durch das Chorgebälk zwitschern.
Strahlen der schon hochstehenden Julisonne fallen steil durch die Fenster des Seitenschiffs. Ich öffne die Geheimverrieglung unter dem Rock der Magdalena, und die Tür gibt nach, Kühle schlägt mir entgegen.
Ich wuchte die Steinplatte durch die Öffnung. Auf der steilen Treppe kann ich sie Stufe für Stufe absetzen, was auch nötig ist, um zu verschnaufen. Unten im ›Gang‹ lässt sich das Biest endlich schleifen, doch dann beginnen die Verwinkelungen des Labyrinths, die Grundmauern der römischen Villa des besagten Properz. Ich muss die teuflisch unhandliche Tafel über Heizungskanäle heben, durch Mauerlücken zwängen. Endlich taucht vor mir die Zisterne des Badehauses auf, eine Steinlandschaft voller Löcher, in der es nicht auffällt, wenn es jetzt eines weniger gibt. Den toten Regenwasserkamin wird niemand vermissen. Hier kommt sie hin! Ich eile zurück in meinen Palazzo, von meiner Garde noch keine Spur. Hartwolf, dem Capitano, habe ich eingeschärft, die dreisten Brüder von Sassovivo nur zu verjagen, sie nicht zu verfolgen! Das Geld einkassiert und nichts wie zurück!
Ich werfe einen kurzen Blick von der Terrasse in den Garten, wo sich der alte Ripke, mein Gärtner und Majordomus, zu einem Nickerchen hingesetzt hat. Das trifft sich. Sonst will er mir noch helfen, die treue Seele. Er soll die Gartenpforte bewachen, doch wer soll jetzt schon kommen! Sonntagnachmittag herrscht Ruhe in Assisi, Treuga Dei. Gut, dass Sant’ Apollinare außerhalb der städtischen Bannmeile liegt, und ›Zehnten abkassieren‹ ist ja wohl keine kriegerische Handlung! Ich muss mich sputen, wir wollen gleich bei Anbruch der Nacht die Stadt auf Nimmerwiedersehen verlassen. Gepackt ist alles, nur Aufladen müssen wir noch.
Der angerührte Mörtel steht in zwei Eimern bereit. Ich schleppe sie durch mein Haus. Diese Lautlosigkeit, die meine Schritte in den Keller hinab begleitet! Ist da jemand? Wie auch? Ludmilla, die Köchin, hat Ausgang. Ich habe dennoch Herzklopfen zum Halse hinauf. Wenigstens hätte ich zwei der Gardisten hierbehalten sollen, doch Hartwolf wollte so massiv wie möglich auftreten, für alle Fälle –.
Ich trage den Mörtel auf, erst in die Öffnung, die ich hinterfuttere, damit es nicht so hohl klingt, dann auf die Kanten der Platte. Jetzt kommt das Schwerste: Ich muss sie hochstemmen und genau passend einfügen.
Ein letztes Mal huscht mein Blick über die Inschrift.
Keiner wird sie je zu Gesicht bekommen, denn ich setze die Tafel verkehrt herum ein, die unbearbeitete Rückseite nach außen. Die ganze Steinmetzarbeit, der ganze ausgeklügelte Text: alles nur Vorwand, um einen präzis passenden Verschlussstein für ›das Versteck‹ in die Hand zu bekommen. Sie sitzt – und hält! Ich klopfe sie fest – erschrecke vor den dumpfen Hammerschlägen. Wie lebendig begraben! Ich habe dahinter ja auch einen Teil, den wichtigsten, sicher auch den längsten Abschnitt meines Lebens verborgen. Seufzend verputze ich mit dem verbleibenden Mörtel die Fugen, verwische alle Spuren und beginne den Rückzug. Ich lösche nacheinander die Öllichter in den Mauernischen des Ganges, gehe noch einmal zur Kirche zurück, um zu kontrollieren, dass alles in unverdächtigem Zustand ist. Ein kurzes, bitteres Gebet auf meinem Schemel in der Apsis. Ich werde Assisi heute noch den Rücken kehren. Francesco ist tot. Ich habe ihn durch sein Leben begleitet, nicht immer gläubig, nicht immer würdig, aber treu! Und Francesco hat mir das zeitlebens vergolten. Aber die jetzt meinen Platz einnehmen wollen, kümmert das Vermächtnis des ›poverello‹ wenig, den sie zum ›Heiligen‹ gemacht haben. Pace e Bene!
Ich erhebe mich. Ich gehe, schließe die Türen wieder auf, draußen scheint die Nachmittagssonne warm und friedlich. Ich schreite über den Vorplatz – noch immer keine Spur von meiner Garde! Wovon lassen sie sich schon wieder aufhalten!? Selbst wenn sie die Mönche einzeln verprügelt hätten, müssten sie jetzt zurück sein! – Ich betrete meinen Palazzo. Ripke soll die Tür nicht immer offenstehen lassen, vor allem, wenn er über der Arbeit einschläft.
»Ripke!« Keine Antwort. Ich trete auf die Veranda, er sitzt immer noch im Garten und hält sein Nickerchen. Hartwolf soll ihn dann aufwecken. Es ist heiß. Jetzt, in der kühlen Brise, die vom Garten heraufweht aus dem Tal, fühle ich, wie verschwitzt ich bin. Ich gehe durch das stille Haus. In der Küche hat Ludmilla, wie es sich gehört, den Krug frischen Weines für mich unter das laufende Quellwasser gestellt. Ich trage ihn in die Bibliothek, wo ich an meinem Pult stehe und Dir schreibe, dear John. Ich trinke in tiefen Zügen … Wie angenehm weht die Brise, während der herbe Tropfen mir die Kehle hinabrinnt, leicht bitter mein Blick schweift aus dem Fenster neben meinem Schreibpult, über das Tal, verflimmert, wird unscharf, trübt sich – der Luftzug hebt mich wie ein Blatt, während mir die Beine zu Blei werden – ein Brausen – der Wind – welcher Wind? Das Brausen ist in meinem Kopf, trägt mich weit zurück – stürmt in das Dunkle vor meiner Geburt, weiter – weiter, ich verschwinde …
CURRICULUM VITAE EPISCOPI
Ein Lebenslauf des Herrn Della Porta (1174-1207)
Aus dem Dunkel der Vergangenheit taucht in gleißender Sonne ein Ritter auf, mein Vater? Der Wüstensand gerinnt zum Heiligen Land, das ich nicht kenne, an das ich keine Erinnerungen habe.
Im Schicksalsjahr 1174, als Sultan Nur-ed-Din und König Amalrich, die beiden Herrscher, die ob ihrer Weisheit und Weitsicht im Gebrauch des Schwertes keine Zukunft für Palästina mehr sahen, gleichzeitig starben, traf mein Vater, der flämische Ritter Gérard in ›outremer‹, dem Heiligen Lande jenseits des Meeres, ein. Aufgrund seiner Herkunft hätte er sich beim König von Jerusalem selbst verdingen müssen, aber in Ermangelung eines solchen nahm er Dienst beim Regenten, Graf Raimond, zumal dieser ihm die Hand der ersten geeigneten Erbin in seiner Grafschaft versprach.
In dieser Situation starb der Herr von Botrun, Besitzer großer Ländereien. Er hatte nur eine Tochter: Lucia. Herr Gérard wandte sich an den Grafen, doch ein Konkurrent, der Pisaner Plivano, stach den mittellosen Ritter aus: Er setzte die füllige Lucia auf eine Waage und hielt ihr Gewicht in Gold dagegen. Raimond zögerte nicht, ihm den Zuschlag zu erteilen.
Der erboste Ridfort wartete bis zur Nacht, stieg dann von seinem Pferde aus in die Kammer der verlorenen Braut, schwängerte sie und ritt davon. Durch Vermittlung von Reynald de Chatillon wurde er von den Tempelrittern aufgenommen, wo er es bald zum Seneschal brachte. So wurde ich gezeugt. Meine Mutter Lucia verspürte keine Lust, nach meiner Geburt noch länger im Heiligen Land zu verweilen, und ließ sich von einem pisanischen Handelsschiff nach Italien bringen.
Statt bei der Familie des Plivano in Pisa Wohnsitz zu nehmen, zog sie mit mir nach Rom. Das Kind wurde ihren Vorstellungen vom Leben in der Urbs schnell hinderlich, so dass sie es Klosterschwestern zur Erziehung übergab. Ich sah sie immer seltener und hörte eines Tages, sie sei an einer ›Fehlgeburt‹ gestorben. Man reichte mich von einem Kloster zum anderen weiter, ließ mich studieren. Ich absolvierte – von meiner Erziehung her zu nichts anderem inspiriert – die Examina eines Theologen, ohne jegliche Ambition für den Beruf eines Priesters. So ergriff ich die erste sich mir bietende Möglichkeit, in den Dienst der Kurie zu treten. Der neugewählte Papst Innozenz erkannte die in mir schlummernden diplomatischen Fähigkeiten. Nachdem er mich mit wechselnden Aufgaben betraut hatte, wobei er mir den ›nom de guerre‹ Della Porta zuwies (hoffentlich mit Zustimmung dieser noblen Familie), verpasste er mir meinen letzten Schliff auf etlichen Auslandsmissionen, die ich wohl zu seiner Zufriedenheit ausführte. 1204 schien es meinem Herrn an der Zeit, den vakanten Bischofsstuhl von Assisi wieder zu besetzen, und trotz meiner Jugend – ich war noch keine dreißig! – erhielt ich Weihe und Amt.
Seit drei Jahren bin ich nun Bischof dieser Stadt in Umbrien, habe wenig, genau gesagt, gar keinen oder schlechten Kontakt zu den Notablen der Oberstadt, den sogenannten ›majores‹, in deren Hände die Regierung der Kommune liegt, bin dafür beliebt – im Sinne von populär, wie es sich aus leutseligem Umgang ergibt – bei meinen ›minores‹ der Unterstadt, die sich um die ›assunta‹, die Heilige Mutter Gottes scharen, die in meiner Santa Maria del Vescovado steht. Gleich daneben liegt der bischöfliche Palazzo.
Ich habe eine Haushälterin, Ermengarda, die, wie es der Kodex vorschreibt, bei ihrer Anstellung im Jahre meiner Amtseinführung ihr vierzigstes Lebensjahr vollendet hatte. Ihr Mann war einer der unglücklichen Fußsoldaten Assisis, die im Jahre 1202 von den Perugini niedergemacht wurden. Ermengarda hat ein siebenjähriges Töchterchen namens Anna. Komplettiert wird mein bescheidener Haushalt von Emilio, dem ›Majordomus‹, der die Einkäufe besorgt, die Verbindung zur Außenwelt aufrechthält, was ihn jede Haushaltsarbeit versäumen lässt, wofür er allerlei Aushilfspersonal einstellt, über das nur die beiden, Ermengarda und Emilio, Übersicht haben. Ich: nie!
Mein Stolz ist die bischöfliche Palastwache, meine ›Garde‹. Ihr Capitano ist ein gewisser Pedro Peyrignac, den mir mein secretarius angeschleppt hat. Der Haufen umfasst bei fluktuierendem Personalstand rund zwanzig Mann, die mir gehörig auf der Tasche liegen und deren Verhalten meinem Assisi ziemlich auf die Nerven geht.
Last but not least (das habe ich von ihm gelernt!) ist da noch mein englischer secretarius John Turnbull. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich so heißt, noch ob er Engländer ist. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich ihn für einen Sohn der Kirche halten soll, auch wenn er alle Tage beim Namen ihrer Heiligen kennt. Aber er führt meine Kanzlei und meine Angelegenheiten mit Umsicht, drillt die Garde zu Pferde und schickt sie auf die Jagd, bringt mir höfische Manieren bei und Ermengarda zur Verzweiflung durch Einführung fremdländischer Küchenrezepte und das ständige Trinken von heißem Wasser, in dem er getrocknete Kräuter ziehen lässt.
Er hat Emilio in den Garten verbannt, nachdem er ihn mehrfach beim Lauschen an unseren Türen ertappt hatte.
Der Palazzo ist behaglich, besitzt einen sogenannten ›Kleinen Audienzsaal‹, einen ›großen‹ gibt es als Annex zur Santa Maria del Vescovado, eine umfangreiche Bibliothek, einen standesgemäßen Speisesaal, einen wohlsortierten Weinkeller und eine Terrasse mit einer wundervollen Aussicht ins Tal. Assisi ist ein Nest, von dem sich nur sagen lässt, dass es zwischen Perugia im Nordwesten und Spoleto im Süden liegt, eigentlich zum Kirchenstaat gehört und keinerlei Hoffnung – oder Gefahr (wie man will) – birgt, aus irgendeinem Grunde über seine Grenzen hinaus bekannt zu werden. Hier als Bischof eingesetzt zu sein, garantiert einen friedlichen Lebensabend, den ich mir mit 32 Lenzen offensichtlich schon verdient habe.
Redlich? Ich wüsste nicht, wessen ich mich anklagen müsste. Für jede Abwechslung ist man hier dankbar: In den nächsten Tagen gibt es einen Prozess, angestrengt vom Tuchhändler Bernadone aus der Oberstadt gegen seinen missratenen Sohn. Letzterer verspürt einen merkwürdigen Drang, das Geld seines Vaters unter nichtsnutzige Bettler zu verteilen, und macht sich an unseren verfallenen Kirchen der näheren Umgebung zu schaffen. Aber ich will unvoreingenommen urteilen und das seltsame Verfahren genießen! So beauftrage ich John, mir einen Bericht über den Werdegang des jugendlichen Delinquenten aufzustellen, mit besonderem Augenmerk auf mögliche äußere Einflüsse, die ihn zu einem solchen, unüblichen Verhalten hingeführt haben könnten. Den Gefahren der Häresie kann man nicht wachsam genug entgegentreten, mahnt uns mein Herr Papst! Doch sollte in jedem Fall die Kirche ein offenes Ohr haben für eine Rechtfertigung des Angeklagten. Es gibt für einen Bischof immer Erleuchtungen. Und Wir können verzeihen, solange Unser ausgeprägter Sinn für Recht und Ordnung nicht verletzt wird – oder Wir uns langweilen! In dubio pro reo? Quidquid id est, fiat voluntas nostra!
GUIDO II Assisanorum episcopusA. D. MCCVIII
Post scriptum: Ich habe diesen Brief eigens nicht diktiert, sondern mit eigener Hand geschrieben. Meine Ausbildung kommt mir da zustatten, ich kann es mit jedem secretarius aufnehmen! So war John jede Möglichkeit genommen, mir während des Diktats hineinzureden.
Das so erreichte Ergebnis – episcopus sine macula – befriedigt mich zwar noch immer nicht gänzlich, mag aber John genügen, um ihm als kategorischer Leitfaden zu dienen, wie er mich und meine vita in der Öffentlichkeit darzustellen hat.
II.IN FIDUCIAM
Aus der Jugend eines Heiligen (1175-1207)
Eminenz,
Euer Auftrag ehrt Euren Diener, ruft in ihm den homo historicus zur Pflicht der Wahrnehmung und Erinnerung, erweckt aber auch den homo politicus zur unziemlichen Neugier.
Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, Eminenz, mich Eurer Manipulation der Fakten, der – zugegebenermaßen meisterlich! – ausgeübten Kunst der Unterschlagung, durch Einbringen eigener Kombinationen zu widersetzen:
Die Versuchung, der törichten Wahrheit zum Siege zu verhelfen – gegen das Risiko Euren berechtigten Unmut auf mein Haupt zu häufen! »Was ist die Wahrheit?« werdet Ihr mit Sicherheit dagegenhalten. »Verba et voces!«. Doch da es sich um einen Bericht handelt, den Ihr lesen und danach vernichten könnt, erlaubt mir, die ars ignorandi auf Unwichtiges zu beschränken, und was Eure eigene Person, Herkunft und Werdegang, betrifft, Eurem Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen.
Die tragikomische Geschichte von Gérard und Lucia ist zu schön, um wahr zu sein.
Vielleicht wolltet Ihr Euch in Eurem curriculum vitae älter machen, als Ihr es wirklich seid? Es hätte Euch nur zwei Jahre gebracht, was allerdings entscheidend sein kann, wenn man einen Bischofsstuhl anstrebt.
Eure Zeugung fand en passant in Rom statt, weswegen Euch auch ursprünglich, nicht sonderlich liebevoll, der Name ›Romano‹ angehängt wurde, ein Täfelchen an ein kleines Bündel, ärgerliches Resultat einer flüchtigen Begegnung in des Wortes wahrster Bedeutung. Dass ihm nicht der Zusatz ›della Ruota‹ angefügt wurde, verdankt Ihr nur den ausgleichenden Händen des Standes, in den Ihr hineingeboren wurdet.
Caritas Cristi urget nos!
ANTE FACTO ET CONDITIONES TEMPORIS
Was vorausging (1175-1180)
Zu jener Zeit wird in Assisi, dem Ort Eurer späteren ›Berufung‹, die große Kathedrale von San Rufino fertiggestellt, deren Priors Unbotmäßigkeit Euch in der Folge noch häufig verärgern wird.
Eure zukünftige Braut »Assunta«, die ›Santa Maria del Vescovado‹, nebst anhänglichem bischöflichen Palais, kann zu diesem Zeitpunkt schon auf ein respektierliches Alter von 250 Jahren zurückblicken, und vorher stand an ihrer Stelle immerhin ein Tempel des zwiegesichtigen Gottes Janus.
In diesen Jahren verliert Assisi seine kaum gewonnene Selbständigkeit innerhalb des Kirchenstaats und fällt an das kaiserliche Spoleto, das zum Herzogtum erhoben wird. Ein Gunstbeweis Barbarossas für den treuen Markgrafen Konrad, der auch gleich darangeht, oberhalb der Stadt Assisi eine kaiserliche Zwingburg zu errichten: ›Rocca Alta‹.
Eminenz, sicher brauche ich Euch nicht an das letzte Konzil zu erinnern, das als wesentliches Resultat eine Mäßigungsempfehlung produzierte. Sie empfiehlt Roms Bischöfen, Äbten und Cardinälen dringend, bei Ausritten die Anzahl von Windspielen, Jagdfalken und Reitpferden auf 40 bis 50 zu beschränken. Damals wie heute eine Zumutung und auch kaum beachtet, wie ich an unserem Hofstaat sehe!
Nun ist die Armut der Kirchenfürsten auch kein äußerliches Problem. Würden die geistlichen Herren nicht ihren Reichtum zeigen, könnte man sie leicht für Häretiker halten. In der Schlichtheit des Geistes stehen sie den ›pauperes‹ ja kaum nach. Rom fühlt sich eben immer mehr von der zersetzenden Lehre der ›Katharer‹ bedroht, dabei besagt dieser gnostische Begriff im Griechischen nichts weiter als ›Die Reinem. Aber weil auch Eure Eminenz im Lande der Barbaren erzogen wurde, werft Ihr mit dem Wort »Ketzer« um Euch für alles, was Euch befremdlich erscheint. Dabei solltet Ihr Euch erinnern, dass sich die Teutonen nicht einmal die Ohren waschen! Die Stille, die uns damals umgab, war trügerisch.
Einschneidende Ereignisse lagen in der Luft wie dunkle Gewitterwolken, ob gute oder schlechte, war nur eine Frage des Standpunktes: Die Zeit war reif für neue, große Persönlichkeiten.
Mit dem weisen Saladin, dem schrecklichen Reynald de Chatillon und dem kühnen Löwenherz werden wir sie erleben! Gehört aber auch dieser Knabe dazu, dessen gestörte Entwicklung Ihr meiner Aufmerksamkeit empfohlen habt? Ehre, wem Ehre gebührt!
Mit sicherem Instinkt hat mein Bischof frühzeitig erkannt, wie fortschreitendes Fehlverhalten den Werdegang des Jünglings kennzeichnet, in einem Maße, das ›Außerordentliches‹ verheißt!
Gestattet mir, es Euch chronologisch zu unterbreiten:
INITIUM MIRANDI
Staunenden Blickes (1181-1184)
Seine Mutter hat heimlich – ohne Wissen des Vaters und weil sie sich als gute Christin schämte – von einem durchreisenden Astrologus aus Syrakus ein Geburtshoroskop anfertigen lassen: Trotz des Angebots fürstlicher Bezahlung weigerte sich der weise Mann, es ihr auszuhändigen. Es zeitigte eine so unglaubliche Konstellation, dass er in diesem Falle an seiner Fähigkeit der Berechnung und Deutung zweifelte und es vorzog, das Dokument seines Irrtums mit sich fortzunehmen.
Francesco wurde also als Sohn des hiesigen Tuchhändlers Pietro Bernardone und seiner Frau Pica in Assisi geboren. Der Vater stammt aus der (jüdischen?) Familie der Moriconi aus Lucca und war viel auf Handelsreisen, vor allem in Frankreich.
Dort befand er sich zur Zeit der Niederkunft seiner Frau, die er sich wie sein Tuch aus dem Rhonedelta mitgebracht hatte, angeblich Kleinadel der Provence. Mit der Verantwortung allein gelassen, ließ Dona Pica den Knaben sofort taufen, und zwar in San Rufino, wobei es in der Hast passierte, dass weder Monat noch Tag, sondern nur das Jahr 1181 in das Register eingetragen wurden.
Als Namen wählte sie Giovanni.
Dieses muss dem inzwischen zurückgekehrten Messire Pietro missfallen haben. Er lässt zwar die Taufe nicht wiederholen, aber in den Annalen unserer Maria Assunta erscheint jetzt ›Francesco‹, allerdings 1182 datiert.
Die Wahl dieses neuen Namens: ›Francesco, Français, Franzose!‹, wie alle ihn neckend nannten, ist dennoch merkwürdig und hierzulande zumindest ungebräuchlich. Doch nun gibt es Stimmen, die bis heute nicht verstummen wollen, Vater Pietro halte es heimlich mit den Katharern, und daher die ›hommage à la française‹.
Ich vermute in dem Kaufherrn eher einen ›Waldenser‹, einen Anhänger jenes Petrus Waldus, Kaufmann aus Lyon, mit dem er vielleicht sogar geschäftlich zu tun hatte.
Auf jeden Fall setzt sich der Name ›Francesco‹ durch, und ich halte das, als Anhänger der guten alten jüdischen ›Schem-Theorie‹, nach der ein gegebener Name auch eine entsprechende Identität vermittelt, für einen sehr wesentlichen Punkt für die weitere Entwicklung des Knaben. Mir selbst liegt die Form ›Frances‹, so wie in meiner okzitanischen Heimat gebräuchlich, am nächsten. Sowohl auf der Zunge wie für die faule Feder. Und ich werde mir zumindestens für den ›Hausgebrauch‹ erlauben, ihn fürderhin so zu nennen.
Das Jahr 1182 war übrigens das der Sediatur Eures Vorgängers Guido I.
Assisi trat der ›Umbrischen Liga‹ bei, wogegen erstaunlicherweise der Herzog von Spoleto keine Einwände erhob. Im Heiligen Land spitzte sich dagegen die Lage zu. Die Christen spielten mit dem Feuer, die Macht Saladins wuchs. Manchmal habe ich den Eindruck, unsere Barone dort unten und die Herren der Ritterorden suchten das Ende ihres grandiosen Abenteuers wie Motten das Licht.
MAXIMA PUER RECEPITREVERENTIA
Ein verwöhntes Kind (1185-1191)
Das Haus der Bernardone, in dem sich auch der Tuchladen und die Stofflager befinden, ist ein solider Palazzo gleich unterhalb der Piazza del Comune. Seine Rückgebäude und das kleine Gärtchen fallen steil ab, begrenzt von den engen Gässchen, die unweigerlich zu uns führen, auf den Vorplatz von Santa Maria del Vescovado und das Bischöfliche Palais. Frances wird sich dort herumgetrieben haben, bis ihn die Eltern in die Schule von San Giorgio schickten, unweit der Stadtmauer und nur ein kurzes Wegstück von uns entfernt. Manchmal besuchte auch Euer Vorgänger, Bischof Guido I, die Kirche und erzählte den Kindern die Geschichte von ihrem Schutzpatron, dem heiligen Georg, und seinem Kampf mit dem Drachen.
Als Schüler fiel Frances nicht auf. Seine erste religiöse Erziehung erhielt er in San Nicolo, der Pfarrkirche gleich neben dem Elternhaus.
Als besonderen Brauch pflegt man alldorten am Tag des Sankt Nikolaus eines der Kinder zum ›Episcopello‹ zu ernennen. Ob nun aus Ehrgeiz der Eltern oder Frances’ eigenem Antrieb: dem kleinen Bernardone wurde die Ehre gleich zweimal zuteil. Da hielt nun unser kleiner Bischof in vollem Ornat, die Mitra auf dem Kopf und den Krummstab in der Hand, seinen Einzug in die Kirche, und unter feierlichen Gesängen der Kinder nahm er auf einem Bischofsthron Platz. Das Schauspiel zieht stets eine große Menge an, und die Eltern sind stolz auf ihre festlich gekleideten Kleinen.
In jenen Jahren geschah in der Welt einiges, das der kleine Frances zwar noch nicht mitbekam, das aber in der Fülle von Heldengesängen und Rittermärchen sicher in den nächsten Jahren von ihm begierig auf gesogen wurde.
Sicher haben seine Eltern ihn mitgenommen, als nicht weit von Assisi Barbarossa zu Foligno seine zukünftige Schwiegertochter, die Normannenprinzessin vom Geschlecht derer d’Hauteville empfing, oder wie Ihr Italiener sagt ›Di Altavilla‹, auf dem Weg zu ihrer Hochzeit mit seinem Sohn Heinrich.
In Palästina überschlagen sich die Ereignisse. Die Templer wählen Gérard de Ridfort zu ihrem Großmeister. Diese Wahl erklärt mir nachträglich die Adoptiv-Gelüste Eurer Eminenz auf diesen Herrn als Euren Vater, aber für das Königreich von Jerusalem sollte sie sich bekanntermaßen als fatal erweisen. Der Verlust von Jerusalem war ein Schock für das gesamte Abendland. Der greise Kaiser Barbarossa nimmt unverzüglich zu Mainz das Kreuz, und auch Richard Löwenherz, der ein Jahr später auf den englischen Thron kommt, erklärt sich bereit, seine Feindschaft mit König Philipp von Frankreich zu begraben.
Alle drei großen Monarchen Europas treten gemeinsam zur Wiedereroberung Jerusalems an. Vergessen sind auch die Auseinandersetzungen des ›Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation‹ mit dem Papsttum.
Clemenz III, der vorher in Ferrara und Pisa residieren musste, darf nach Rom zurückkehren. Sich als Papst wieder stark fühlend, beschneidet er die Macht der Bischöfe des kaiserlichen Assisi an einer – wie sich später zeigen wird – empfindlichen Stelle, indem er die große Abtei Santa Croce di Sassovivo zu Foligno der bischöflichen Jurisdiktion entzieht. Drei Jahre später bestätigt Coelestin III dieses Privileg und fügt das Kloster Sant’ Apollinare del Sambro hinzu, obgleich dieses nun wirklich mitten in der Diözese Assisi liegt.
Euer Vorgänger vermag sich gegen diesen ›Apostolischen Schutz‹ nicht zu wehren.
Beunruhigt durch die bevorstehende Ankunft des Kreuzfahrerheeres, ließ Saladin seine Gefangenen von Hattin frei. Doch Gérard Ridfort führt sich mit seinen Templern sogleich wieder derart tolldreist auf, dass ihn der Sultan bei der nächstfälligen Festnahme nunmehr einen Kopf kürzer machen lässt. Seht Ihr, Eminenz, so wäret Ihr im zarten Alter von dreizehn Jahren dennoch bereits Vollwaise geworden.
IUVENILE VICIUM
Jugendliche Torheiten (1192-1197)
Die nächsten Jahre sollten zwar nicht gerade Assisi, doch dessen nähere Umgebung in den Blickpunkt der Welt rücken.
Der Tuchhandel des Pietro Bernardone ›En gros et en detail‹ nimmt weiteren Aufschwung. Zu den Klöppelwaren aus Flandern, den Leinen aus Lyon kommen jetzt mehr und mehr Stoffe aus dem Orient: ›Damast‹ aus Damaskus, Brokat und Seiden aus noch ferneren Ländern. Der Handelsherr ist ständig auf Reisen.
Sein Geschäft tätigt er zusehends bargeldlos und vergrößert sein Vermögen skrupellos durch Geldverleih, was eigentlich bisher den Juden überlassen war. Hohe Zinsen und mangelnde Zahlungsfähigkeit seiner Gläubiger bringen ihn rasch in den Besitz ›günstiger‹ Anliegen, Gehöfte, Felder und Weinberge. Sein Sohn Frances, sein ganzer Stolz, taucht schon ab und zu im väterlichen Geschäft auf – immer in elegantesten Wämsern und Beinkleidern, sogar zweifarbigen. Aushängeschild der letzten Mode, denn der durch die Kreuzzüge in Schwung gekommene Handel mit dem Orient versorgt auch die Florentiner Färberzunft mit immer neuen Zauberpülverchen. In der bedenkenlosen Zuwendung zu ihrem Sohn treffen sich die gluckenhafte Mutterliebe und Fürsorglichkeit von Dona Pica und die Eitelkeit von Messire Pietro.
Die Kunden schätzen den aufgeweckten Jungen, der jetzt zu Hause von einem Privatlehrer Italienisch, Französisch und Provençalisch beigebracht bekommt. Er ist ein unaufmerksamer Schüler, schwach in der Rechtschreibung, aber durchaus kein ›idiota‹, wie er sich gern später bezeichnen wird.
Mit Begierde nimmt er alles in sich auf, was an Liedern und Legenden durch die Luft schwirrt: Da ertrinkt der greise Friedrich Barbarossa beim Marsch durch die wilde Türkei. Obgleich sein Leichnam – in Essig eingelegt – auf dem Weiterzug in der Hitze zerfallt, verkünden die Deutschen, ihr großer Kaiser säße in einem Berge und werde doch noch eines Tages Jerusalem zurückgewinnen!
Oder König Richard! »Malek-Rik«, wie ihn die Muslime bewundernd rufen. Um Verhandlungen mit Saladin zu erzwingen, lässt er 2700 gefangene arabische Ritter und Emire auf die Mauern des tollkühn eroberten Akkon führen und jeden Tag im Angesicht des ohnmächtigen Sultans 900 von ihnen köpfen. Doch die Lieder der Troubadoure und Bänkelsänger, die durch Europa ziehen, preisen den Löwenherz als großen Helden.
Im Jahre 1194 wird zu Jesi, nicht weit von Assisi, auf der letzten Wegstrecke nach Ancona, der Staufererbe Friedrich geboren. Als die Kaiserin Constance ihre Stunde kommen fühlt, lässt sie auf dem Marktplatz von Jesi ein riesiges Zelt aufschlagen. Constanze zählt 40 Lenze, was gemeinhin als zu alt für die Geburt eines Kindes angesehen wird.
Um verleumderischen Gerüchten von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen, zitiert sie 18 Kardinäle und Bischöfe aus Rom und der näheren Umgebung zu sich, damit sie der Niederkunft mit eigenen Augen beiwohnen. Vergebens: die Geschichte vom untergeschobenen Balg der Metzgersfrau, die böse Zungen sogleich in die Welt setzen, wird Friedrich sein Leben lang nicht mehr los.
So geschehen am Tag des heiligen Stefan, wie auch Euer Vorgänger Guido berichtet, der dabei war.
All diese turbulenten Ereignisse, auch wenn die Berichte davon nur verzerrt oder geschönt in der umbrischen Provinz eintrafen, müssen bei einem verträumten Jungen wie unserm Frances, der ja unbedingt mal ›Ritter‹ werden wollte, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben.
Der kleine Friedrich blieb in der Obhut der Herzogin Margarete in Foligno zurück, die den Titel einer Gräfin von Assisi annahm. – Vielleicht einer der Gründe, dass Friedrich-Roger allhierselbst getauft wurde, und zwar über dem gleichen Porphyr-Taufbecken von San Rufino wie seinerzeit unser Knabe Frances.
ET HABUIT MATURITATEM SUAM
Ein reifender Jüngling (1197-1201)
Frances hat sein 14. Lebensjahr mittlerweile überschritten. Was macht er, was treibt ihn?
Das reichlich zur Verfügung stehende Geld seines Vaters, dessen großzügige Art dem Filius aber auch jeden Griff in die Ladenkasse und ins Magazin der kostbarsten Kleiderstoffe gestattet, benutzt Frances, um unter den jungen Nobeln eine herausragende Rolle zu spielen, die eigentlich seiner bürgerlichen Herkunft nicht entspricht.
Offensichtlich hatte der Handelsherr Bernardone Gründe, Frances’ ›dolce far niente‹ durchgehen zu lassen, ja es insgeheim mit Stolz zu fördern.
Einmal demonstrierte der reichgewandete Sohn (besser konnte sich auch der Adel nicht kleiden), den arrivierten Status, nicht nur seiner selbst, sondern der gesamten Zunft der Kaufleute, der Tuchhändler insbesondere. Zum anderen war der junge Bernardone die beste Werbung für seinen Laden. So ließ man Frances gewähren, er gab seinen Freunden Feste, hielt sie in den Trattorien aus, zahlte für die Musikanten, wenn er nicht selber zur Laute griff und die eigene wohlklingende Stimme begleitete.
Nicht selten schlug man über die Stränge, brachte jungen, oft schon verheirateten Damen mitternachts ein Ständchen, spielte Freunden derben Schabernack, war laut, ausgelassen und vulgär bis in den frühen Morgen. Ein Lebensstil, der sich bis heute im Lande keineswegs verändert hat.
Zu jener Zeit stirbt in Messina überraschend der erst 32jährige Kaiser Heinrich an der Malaria. Dieses Vakuum schafft die Voraussetzung für ein Ereignis, das nicht nur für Euer Leben von größter Bedeutung sein wird. Als nämlich 1198 Coelestin stirbt und der 37jährige Lothar von Segni zum Nachfolger bestellt wird: Innozenz III.
Sein Wappen, das der Grafen Conti, ein Blitze schleudernder Adler, sollte das Symbol seiner Herrschaft über ›orbis et urbis‹ werden. Erinnert Ihr Euch noch seiner Krönungsrede, in der er so eindeutig die ihm übertragene Gewalt und deren Ausübung auf Erden definierte?
Und schon kommt das Gerücht auf, Assisi erhalte den Rang einer umbrischen Kommune und falle an den Kirchenstaat.
Der aufgeschreckte Konrad von Urslingen eilt nach Narni, wo der magenkranke Papst gerade zur Kur weilt. Um ›sein‹ Herzogtum Spoleto zu retten, bietet er Innozenz an, es aus seiner Hand als Lehen zu empfangen, Assisi eingeschlossen oder nicht. Dort hat er jedenfalls in der Zitadelle ›Rocca Alta‹ noch immer seine deutsche Garnison sitzen.
Des Herzogs überstürzte Abreise hat sich herumgesprochen. Die Einwohner Assisis warten das Ergebnis seiner Verhandlungen gar nicht erst ab. Sie stürmen die verhasste Zwingburg, jagen deren kaiserliche Besatzung davon und reißen sie erst spontan, dann sorgfältig ab, denn die Vorstellung einer zukünftigen ›papalen‹ Faust im Nacken war ihnen ebenso zuwider.
Die Steine der Befestigung benutzten sie alsgleich zur Stärkung der eigenen Stadtmauern.
Wir können davon ausgehen, dass sich der junge Bernardone, jetzt 16 oder 17, wie die gesamte Jugend Assisis an dieser Aktion beteiligt hat. Ein Überraschungsversuch päpstlicher Truppen, sich der Stadt zu bemächtigen, scheitert an einer kurzlebigen Allianz mit Perugia. Innozenz begnügt sich, mit einer Bulle ›In eminenti‹ des Bischofs Besitzstand zu definieren. Ihre Empfangnahme war wohl die letzte Amtshandlung Eures Vorgängers, denn im gleichen Jahr schließt Guido I die Augen, und in Assisi tritt erst mal eine Sedisvakanz ein.
Als der Adel, gleich dem Herzog von Spoleto, auf die Seite Ottos schwenkt, den Innozenz zur Zeit favorisiert, und die neugewonnene Unabhängigkeit der Stadt aufgeben will, kommt es zum Volksaufstand.
Als Erstes wird der Palast der Sassorosso angegriffen. Die Familie flüchtet nach Perugia.
Ihrem Beispiel folgen andere, so auch die Offreduccio. Ihre Häuser werden geplündert und dann in Brand gesteckt. Wieder müssen wir vermuten, dass Frances mit von der Partie war, denn Assisis Jugend, ob arm oder reich, ließ sich diesen Spaß nicht entgehen.
Und der inzwischen 18- oder 19jährige Bernardone war einer ihrer feurigsten Anführer! Es dürfte Euer Eminenz nicht schwerfallen, sich diese Brandschatzungen und Expulsionen gar deftig grausam vorzustellen (denke ich daran, wie Ihr Eure bischöfliche Garde zuweilen hausen lasst, wenn’s keiner sieht!). Es floss Blut, nicht nur aus durchschnittenen Kehlen, sondern auch aus – pardon für einen Mann der Kirche! – aus den verwüsteten Gärtlein zerstochener Jungfern von Geblüt, denen dann nur noch der Weg ins Wasser blieb, meist von ihren eigenen Vätern oder Brüdern gestoßen. Das gab viel böses Blut, das nach vendetta schrie.
Bei der Gelegenheit bildet sich die heute noch typische Spaltung heraus: San Rufino in der Oberstadt wird zum Treffpunkt der ›Majores‹; während sich das Volk in der Unterstadt um ihre ›Assunta‹, in unserer Santa Maria del Vescovado, schart, so dass es dem zukünftigen Bischof zufallen wird, sich als Schutzherr der ›Minores‹ zu sehen. Die Bernardones liegen räumlich genau dazwischen, Messire Pietro wird nach ›oben‹ tendiert haben, vielleicht ein Grund, dass Frances später aus Protest gegen den Vater sich nach ›unten‹, zu uns hin, orientiert.
Der Hass gegen den feudalen Landadel, der in Assisi nur seine Stadt-Palazzi unterhielt, einte sie nur kurz. Doch unterschlagen wir nicht, dass diese Landplage, Sassorosso und edle Kumpanei, höchst willkürlich mit den Bürgern umsprang, sie schröpfte, wenn sich’s lohnte, oder mit dem ›jus primae noctis‹ piesackte, wenn sonst nichts zu holen war. Die kleinen Handwerker, Tagelöhner, Träger und Marktleut wurden geschunden, bei Nichtigkeiten, zu denen sie oft der Hunger trieb, verstümmelt, gerädert oder von der Ritter Streitrossen in vier – oft nicht mal gleiche! – Teile zerrissen. Doch wo kein Kläger, ist auch kein Richter, und ein Gerechter, wie Ihr, Euer Eminenz, war damals noch nicht in Amt und Würden. Gott sieht zwar alles, doch ohne seine geweihten Vertreter vermag er offenbar nicht einzugreifen.
Eure Eminenz sollte nicht vergessen: Erst damals wurde in Assisi die Sklaverei abgeschafft, nicht jedoch Leibeigenschaft. Assisi nimmt auch lieber ein Edikt in Kauf, verzichtet lieber auf einen Bischof, als sich nochmals jemandem zu unterwerfen, und sei’s dem Papst!
Es sind dies die Jahre, in denen Innozenz versucht, die gärende Unruhe unter den Armen in ganz Europa in den Griff zu bekommen. Er greift zugunsten der ›Pauperes‹ ein, wenn sie sich nicht zu weit vom Dogma der römisch-katholischen Mutter entfernt haben und bereit sind, grundsätzlich in ihren Schoß zurückzukehren.
So approbiert er versöhnlich die ›Regel‹ der ›Humiliaten‹, doch gegen die ›Ketzer‹ in Südfrankreich gedenkt er schonungslos vorzugehen.
Mit ihrer Verfolgung beauftragt er Peter von Castelnau, den er dafür eigens in den Stand eines ›Legaten‹ erhebt.
Auch im ›eigenen Lande‹, als solches betrachtet er zumindest Mittelitalien, räumt Innozenz auf. Er bannt Philipp von Schwaben und trotzt Otto im Vertrag von Neuss die Abtretung der Reichsrechte ab, in allen, von ihm, Innozenz ›rekuperierten‹ Gebieten. Und dieses ›Wieder-in-Besitz-Nehmen‹ soll noch lange anhalten und für entsprechende Unruhe sorgen. Unserm jungen Frances, mittlerweile bald zwanzig, wird also noch genügend Gelegenheit geboten, seinen Tatendrang zu beweisen. Einem ›Cuor di leone‹ will er’s gleichtun. Hoffentlich mit mehr Fortune!
Dies ist auch das Jahr, das in Eurem Leben, Eminenz, noch Bedeutung gewinnen soll. Ein schlummerndes Talent wie das Eure konnte dem Adlerauge des neuen Papstes nicht länger verborgen bleiben. Es beginnt Eure Dressur an langer Leine, das Namenskärtchen des Findelkindes ›Romano‹ wird gegen die nicht minder phantasielose Bezeichnung ›Monsignore Della Porta‹ ausgetauscht.
INTER ARMA
Zu den Waffen (1202-1203)
Nach dem Auszug, oder besser der Vertreibung, des Adels aus Assisi, dem Perugia bereitwillig Asyl geboten hatte, vergingen zwei Jahre, die angefüllt waren mit Scharmützeln zwischen den beiden verfeindeten Städten. Die Feindseligkeiten eskalierten am Tag der heiligen Lucia des Jahres 1202, als die Glocken sämtlicher Kirchen nicht nur die Milizen, sondern auch die Contraden Assisis zu den Waffen riefen.
Das Volk und vor allem die Jugend sind nicht länger gewillt, Perugias hochmütige Provokationen hinzunehmen. Vorweg der ›Carroccio‹, der Fahnenwagen, umgeben von den Reitern. Unter ihnen befindet sich auch Frances, den sein Vater aufs Prächtigste ausstaffiert hat, denn es gefällt ihm, seinen Sohn mitten zwischen den Söhnen der Noblen zu sehen. Es gab in Assisi immer noch einen Stadtadel, der sich mit der neureichen Bürgerschicht assimilierte, sich lokalpatriotisch verhielt und wohlgelitten war (ziert doch die Anrede ›contessa‹ jede Holzhändlerstochter, wie deren Aussteuer die Schatztruhen dieser hochwohlgeborenen Herren füllte!). Unter deren Söhnen hat unser Frances die meisten Freunde, mit ihnen reitet er eitel ins Gefecht. Der Rest ist Fußvolk.
Die kleine Armee, wohl eine Mischung zwischen Karnevalsumzug und feierlicher Prozession, beginnt den Abstieg vorbei an der Leprosenstation von Collestrada zum Tiber hinunter, der die Grenze bildet. Die überlegenen Perugini überschreiten den Fluss bei Ponte San Giovanni und stürzen sich auf den Haufen aus Assisi. Ein Massaker!
Dass unser junger Degen die Gelegenheit fand, bei diesem einseitigen Gemetzel einen Gegner zu töten, ist nicht anzunehmen. Frances musste froh sein, selbst mit dem Leben davonzukommen! Vor allem der vertriebene Adel, der natürlich auf der Seite des Feindes kämpft, rächt sich für die geplünderten und verbrannten Palazzi. Das Fußvolk wird zu Paaren getrieben, wer nicht auf dem Schlachtfeld niedergemacht wird, den lässt man später in der Gefangenschaft erbarmungslos über die Klinge springen: nutzlose Fresser! So viel Platz ist in Perugias Kerkern auch nicht! Nur bei denen, die einen Adelsrang vorweisen können – oder wenigstens ein Pferd –, kann man davon ausgehen, dass sie ihrer Verwandtschaft auch ein gesalzenes Lösegeld wert sein werden.
Frances kann von Glück reden, dass sein Vater ihn derart von seinen bürgerlichen Gefährten abgehoben hat. Die meisten sieht er nicht wieder. Doch das wird ihm erst später klar werden, wenn er in den nassdunklen Verliesen von Perugia genügend Zeit hat, über sich und seine Lage nachzudenken.
MILES ET PLAGATUS
Der Ritter und der Aussätzige (1204-1205)
Ende 1203 sind die letzten Gefangenen aus den Verliesen von Perugia freigekauft, so auch unser Frances, inzwischen 22.
Zwischen Adel und Bürgern von Assisi wurde vertraglich festgelegt, welche Entschädigung Ersteren zu leisten war, andererseits verpflichteten sich die heimkehrenden Noblen, zukünftig keine Allianzen mehr mit Perugia einzugehen. Man könnte annehmen, dass Frances vom Kriegshandwerk mit allen seinen Launen und Tücken die Nase voll hat, doch keineswegs!
Auch sein sonstiges Leben nimmt er wieder auf, als sei nichts geschehen, selbst eine leichte Lungenkrankheit, die er sich in der Gefangenschaft zugezogen hatte, ist schnell vergessen. Nur seine Vergnügungssucht ist rabiater geworden, seine Manieren sind gröber. Ein Jahr Kerker will nicht nur nachgeholt werden, es hinterlässt auch seine Spuren!
Es wird noch mehr getrunken, noch lauter gellen die ›Farandoles‹ durch die nächtlichen Gassen, und die Goldstücke des alten Bernardone fliegen in die aufgehaltenen Kappen der Musikanten, und wieder ist Frances der König dieses wilden Treibens.
Er gründet eine Bande von ›Tripudianti‹, also von diesen Tramplern, die rhythmisch stampfend mit ihm durch die Nacht ziehen.
Der Papst hat diese Unsitte bereits mehrfach gerügt, denn sie versetzt die berauschten Teilnehmer (beiderlei Geschlechts wohlgemerkt!) in zügellose Ekstase. Ihr einziges Trachten zielt dahin, miteinander zu kopulieren wie die tollen Hunde!
Auch macht die so entfachte Sinnenlust keineswegs vor den Kirchentüren halt, im Gegenteil: Die schützende Geborgenheit, das Halbdunkel der heiligen Orte ist die beliebteste Endstation vieler, die sich so gefunden haben oder zu finden wünschen. Sie treiben es im Stehen an den Säulen, auf den Bänken, in den Seitenaltären. Nicht einmal die leerstehenden Beichtstühle sind vor ihrem Gerammel sicher!
In Perugia, das in puncto lockere Sitten immer voranging, veranlassen die Klagen aufgebrachter Kirchengänger Innozenz schließlich, per Bulle einzugreifen. Wir dürfen unsere Augen nicht davor verschließen, dass unser Frances diese Periode seines Lebens kaum in Keuschheit verbracht haben kann. Einer, der auf diesem Gebiet, sicher mehr mit dem Maul als mit dem Schwanz – Mit Verlaub! –, keine ›Siege‹ vorzuweisen hat, kann sich nicht als Anführer einer ›Brigata‹ halten, der letztlich der Sinn nach nichts anderem steht. Und von Frances’ Attraktion auf seine Umgebung wissen wir – wieso also nicht auf Frauen anderer Männer und Töchter ahnungsloser Väter?
Geht nicht das Gerücht, die kleine Offreduccio himmele ihn an? Und wenn wir der behüteten Clara auch nichts unterstellen wollen, so gibt es doch sicher ausreichend Mädchen, die weniger streng bewacht werden oder sowieso schon liederlichen Umgangs pflegen, und an Goldstücken fehlt es Frances ja nicht.
Irgendwann hat sich unser Held dann doch wohl genügend ausgetobt und beginnt sich seiner leichtsinnigen Umgebung von merkwürdiger Seite zu zeigen.
Schon im Gefängnis von Perugia hat Frances seine Mitgefangenen damit genervt, ihnen wieder und wieder zu erzählen, er werde eines Tages zu einem von allen verehrten Heiligen. Jetzt will er plötzlich Prinz sein und ›die schönste Dame der Welt‹ freien, und damit es ihm seine Kumpane auch glauben (›pazzo‹! rufen sie), schließt er sich von einem Tag auf den anderen einem Adligen aus Assisi an, dem Grafen Gentile, der auszieht, um sich mit Walther De Brienne in Apulien zu vereinen.
Vater Bernardone greift noch einmal tief in die Taschen, denn da kommen sich der Alte und sein Sohn in ihren Wunschbildern nahe: Hier ist noch einmal die Chance, aus Frances einen richtigen Ritter zu machen. Rüstung, Pferd und Knappe kosten zwar den Gegenwert eines Landgutes, samt den dazugehörigen Leibeigenen, doch das ist der Einsatz wert. Der kleine Trupp verlässt im Morgengrauen die Stadt und verschwindet in Richtung Foligno. Von da ab gibt es nur noch sich widersprechende Berichte beziehungsweise Mutmaßungen. Wahrscheinlich war Frances von Gefangenschaft, Krankheit und nachfolgenden Ausschweifungen noch viel zu geschwächt, um die Strapazen einer solchen Reise durchzuhalten.
Dann könnten sie auch in der Höhe von Spoleto auf Ottos eisenstarrendes kaiserliches Heer gestoßen sein, was zumindest in Frances schlagartig Erinnerungen an die Überlegenheit der Perugini wachgerufen hat und ihm die Aussichtslosigkeit ihres Vorhabens krass vor Augen führt. Vielleicht haben ihn auch seine Mitstreiter ob seiner bürgerlichen Herkunft und seiner schlechten Figur im Sattel gehänselt. Es gibt da auch die Geschichte von einer überirdischen Stimme, die ihn zur Rückkehr anhält. Auf jeden Fall macht Frances schlapp. Er dreht um.
Hier hatte sicher die Vorsehung ihre Hand im Spiel, denn wer weiß, ob er nicht das Schicksal Walthers geteilt hätte, der bald darauf von den Deutschen im Schlaf überrascht wurde. Sie schnitten ihm die Zeltleinen durch und vergnügten sich, den ohnmächtig unter der Plane Strampelnden mit vielen kleinen Lanzenstichen ins Jenseits zu befördern.
Nicht einmal seine schimmernde Wehr und sein Ross bringt Frances mit zurück, denn wieder in Foligno, trifft er auf einen ›echten Ritter‹, dem es jedoch genau an einer Rüstung und einem Pferd ermangelt, Dinge, die Francesco jetzt nur noch lästig sind. Sie tauschen einfach ihre Kleidung, und Frances schleicht sich erschöpft zurück in die Stadt. Seine Krankheit holt ihn wieder ein. Er hört nicht einmal die Vorwürfe seines arg enttäuschten Vaters.
Wir kommen zu dem Jahr, in dem Innozenz beschließt, den vakanten Bischofsstuhl von Assisi wieder zu besetzen. Er stellt die Befreiung vom immer noch anhaltenden Interdikt in Aussicht, doch da gibt es einen schwerwiegenden Hinderungsgrund: Die Kommune hat in den Jahren der ›Obstruktion‹ dem Heiligen Vater noch den zusätzlichen Tort angetan, einen erklärten Katharer, Gerardo De Gilberti, als Podestà zu wählen. Der päpstlichen Verhandlungsdelegation unter dem alten Cardinal Colonna gehört auch Monsignore Della Porta an. Ihm ist der Bischofssitz von Innozenz zugesichert worden. Natürlich unter einer Bedingung, Eminenz! Wir kennen doch das menschenverachtende Fingerschnippen unseres Herrn … Es vergeht keines Jahres Frist, und der junge Bischof ›in spe‹, bei Amtsantritt noch nicht mal dreißig, kann nach Rom melden, »bedauerlicherweise« sei der Podestà von unbekannter Hand heimtückisch erdolcht worden. Es reist der Cardinal Leone di Brancaleone an, hebt die Exkommunikation Assisis unverzüglich auf und nimmt die Weihe des treuen Dieners vor, der unter bescheidener Berufung auf die Tradition und seinen geachteten Vorgänger den Namen Guido II wählt.
Das Verbrechen wird verziehen. Nicht etwa das des Mordes am Podestà, sondern das der Stadt, ihn in seinen Mauern geduldet zu haben.
Frances ist soweit wieder hergestellt, dass er zu Fuß durch die Umgebung Assisis streifen kann. Er ist nicht mehr der Alte. Er meidet die Stadt und die Freunde und sucht die Einsamkeit. Der Ort, der ihn immer wieder magisch anzieht, ist das Leprosenheim von Collestrada. Dabei können wir davon ausgehen, dass Frances, wie jeder normale Mensch, einen abgrundtiefen Ekel vor dieser Krankheit und ihren Trägern empfindet.
Eines Tages wird er von einem dieser Aussätzigen um Geld angebettelt. Von Panik gepackt läuft Frances davon, besinnt sich dann und wirft dem Mann ein Goldstück vor die Füße. Zu seinem Entsetzen ergreift der Beschenkte seine Hand, um sie vor Dankbarkeit zu küssen. Im ersten Moment will er sie wegziehen, doch dann überwindet er sich, umarmt den Kranken und gibt ihm sogar den Bruderkuss.
Dann stürzt er nach Hause, besorgt sich eine größere Menge Geldes, kehrt in das Heim der Leprösen zurück und verteilt die Münzen an jeden der Insassen. Und nun ist er es, der jedem der Kranken die Hand küsst.
PAUPER IN URBE
Ein Bettler in Rom (1205-1206)
Der neueingesetzte Bischof beißt zwar nicht die Hand, die ihn füttert, erweist sich aber seinem Herrn und Gönner gegenüber keineswegs so dankbar, wie das eigentlich zu erwarten wäre. Er versucht sofort, Sant’ Apollinare del Sambro wieder an sich zu ziehen.
Mit Eurem Anspruch geraten Eure Eminenz in herben Kontrast mit dem ›Rekuperations‹-Programm des Papstes, dem mit Recht eine Rückführung in bischöflichen Besitz zu unsicher ist, da Assisi, als zu Spoleto gehörig, mitsamt all seinen kirchlichen Territorien, immer wieder von den deutschen Kaisern vereinnahmt wird.
Da Innozenz weder Eurer Einsicht noch Eurer Selbstlosigkeit traut, unterstellt er das Kloster, zum Schutz vor Eurem Zugriff, dem Herzog Konrad von Urslingen, der aber jetzt Parteigänger Ottos ist – und damit hattet Ihr nicht gerechnet!
Frances’ Genesung ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass ihm der Gedanke kommt, nach Rom zu pilgern. Es ist wohl das erste Mal, dass er eine solche Reise zu Fuß unternimmt, denn bisher, wenn er seinen Vater begleitete, wurde selbstverständlich geritten.
Da dessen Handelstätigkeit immer eng mit Frankreich verknüpft war, kannte der Filius wohl Florenz, Genua und den Norden, aber in Rom war er noch nie gewesen.
Er ›vergeudet‹ seine Zeit auch nicht damit, erst mal die Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt zu bewundern, sondern eilt geradewegs zum Vorplatz von San Pietro.
Frances drängt sich in das Innere der Kirche und wird Zeuge, wie ein König, Peter von Aragon, seinen religiösen Eifer dadurch bekundet, dass er umringt von seinem glänzenden Gefolge Innozenz seine Aufwartung macht und ihm ›sine ullo commodo‹ den Lehnseid leistet. Er wird mit einer Krone von ungesäuertem Brot gekrönt und empfängt vom Heiligen Vater die königlichen Insignien, diese legt er auf dem Altar des heiligen Petrus nieder, wofür er ein Schwert und den Titel eines ›Ersten Alferez‹ oder Bannerträgers der Kirche erhält. Einige aus dem Gefolge sind mit dem Burschen ins Gespräch gekommen, der so flüssig Provençalisch parliert. Als Frances sieht, wie jeder eine Spende in den Schlitz zu Füßen der Apostelfigur wirft, will er nicht nachstehen. Wie um sie alle zu übertrumpfen, leert er seinen gesamten Beutel mit Goldstücken in den Opferstock. Das trägt ihm zwar Bewunderung ein, auch etliches Kopfschütteln, aber ihn reut es eigentlich sofort. Er muss an die Bettler vor der Kirche denken, denen er mit seinen Münzen ganz andere Freuden hätte bereiten können. Auch ist seine Gabe in diesem prunkvollen Betrieb um Apostel, Papst und König schon nach Minuten auch wieder vergessen. Beschämt schleicht er sich hinaus und gesellt sich zu den Armen.
Es gelingt ihm, einen der Bettler zu überreden, mit ihm die Kleidung zu wechseln. Mit dessen Bettelschale zieht Frances los, um von den Pilgern, die die Basilika verlassen, Almosen zu erheischen.
Er spricht sie auf Französisch an. Vielleicht schämt er sich noch etwas oder möchte jedenfalls nicht erkannt werden. Doch in dem Maße, in dem sich seine Schale füllt, durchströmt ihn eine ungeahnte Süße, ›dolcezza‹, die sich nur noch dadurch steigern lässt, dass er die jeweils volle Schale an die anderen Bettler verteilt.
Er isst mit ihnen, frisst, müsste man sagen, aus den gleichen Näpfen, die gleichen Abfälle, nur aus Gier, es ihnen gleichzutun. Ich habe ihn selbst zu dieser Geschichte vernommen, und er sagte mir wörtlich: »Ich habe die heilige Armut gewählt zu meiner Herrin, um meiner geistigen und leiblichen Wonnen und Reichtümer willen.«