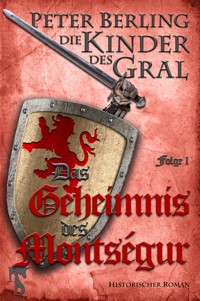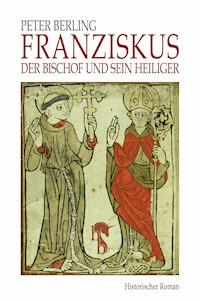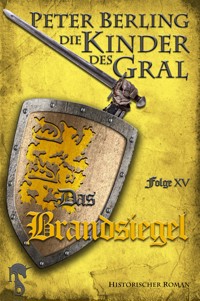3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Roç und Yeza sind unterwegs nach Jerusalem, um dort den Thron als Weltfriedenskönige zu besteigen. Vor Sizilien aber geraten sie erneut in die tückischen Machtspiele der Mächtigen, allen voran Manfred, ein Bastardsohn des verstorbenen Stauferkaisers Friedrich II. Manfred giert nach der Krone von Byzanz, jedes Mittel ist ihm recht. Als die Gralskinder erfahren, dass sich auch ihr alter Freund William von Roebruk in Sizilien befindet, laufen sie die Insel an. Doch anstelle der erhofften Vorbereitung auf ihre Rolle als Friedensherrscher verlieren sie sich in einem Strudel aus Drogen, Gewalt, Giftmischerei und amourösen Verwicklungen, die auch Roç und Yeza voneinander wegtreiben. Dann aber wird Yeza, die sich mit einem Freibeuter eingelassen hat, vor der Küste Salernos von der Templerflotte aufgebracht, sie soll in Rom dem rachsüchtigen Papst überbracht werden. Alle Hoffnungen auf Rettung ruhen nun bei William von Roebruk, dem Franziskaner und langjährigen Beschützer der »Kinder des Gral« … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil XIII fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PETER BERLING
Die Braut von Palermo
Folge XIII des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE XII
Ein blutig Hauen und Stechen
Im ›Turnier vom Montségur‹ begegnen sich: Einheimischer Landadel Okzitaniens, die sog. ›faidits‹ (immer noch insgeheim katharische Ketzer) und Söhne der Eroberer aus dem Norden. Und es geht natürlich um die Damen. In fremde Rüstungen gehüllt nehmen sowohl Ritter Roç als auch seine Dame Yeza an den blutigen Waffengängen teil. Das Treffen gerät außer Kontrolle, schlägt um in Mord und Totschlag. Der König von Frankreich und für die Geheime Bruderschaft deren Großmeisterin müssen eingreifen, in Rom geifert der Papst. Die regional zuständige Komturei der Templer von Rennes-les-Château wird aufgelöst. Zuvor soll es Roç und Yeza noch gelungen sein, den dort verborgen aufbewahrten, sagenhaften ›Schatz der Templer‹ zu entdecken und in der Tiefe verschwinden zu lassen, bevor er Paris oder Rom in die Hände fallen konnte. Oder ist das alles nur vorgetäuscht, und sie werden ihn mit sich führen, den Templern zum Dank – oder zum rechten Tort, wenn sie Okzitanien verlassen müssen? Die ›Grande Maîtresse‹ ihrer geheimen Schutzmacht bietet dem ›Königlichen Paar‹ den verwaisten Thron des Königreiches von Jerusalem an. Roç und Yeza kennen den uralten Plan der Bruderschaft und wissen, wer alles dem erbittert entgegensteht: sämtliche Kirchen, die sich auf die Nachfolge Christi berufen, das kaiserliche Byzanz, die Juden und vor allem jedwelche Glaubensrichtung innerhalb des Islam …
I VON FERNEN INSELN
Vor Hellas wird gewarnt
Der mächtige Dom von Palermo wies bis auf die von zwei Türmen eingefasste Stirnseite, die noch an die schlichte Art seiner normannischen Erbauer erinnerte, nirgendwo mehr auf den Einfluss der imperialen Staufer hin, als an der von dem prächtigen Portikus beherrschten Flanke. Die Schwaben hatten die fremde Bauhütte und ihre Meister aus dem Norden geholt zur Verwirklichung des uralten Traumes vom lieblichen Süden; hier wollten sie ihr Leben genießen, hier sollten ihre Gebeine ruhen. Eine Liebe, die eher von den noch immer präsenten Sarazenen[1] erwidert wurde als von der noblen Verwandtschaft der letzten Normannenprinzessin, die in ihrem Herzen nie staufische Kaiserin wurde. Johannes von Procida, der schon ihrem einzig geliebten Sohn Friedrich als Leibarzt gedient hatte, war sich der Problematik bewusster als Manfred, sein junger Herr, auf den er seine Treue zum kaiserlichen Hause übertragen hatte.
Der Kanzler zog es vor, durch eine Seitentür der Stirnseite nahezu ungesehen in das düstere Innere der Kathedrale zu schlüpfen. Ähnlich hatte es auch der hohe kirchliche Würdenträger gehalten, mit dem er verabredet war, der Bischof von Grigenti[2]. Nur dass dieser den noch versteckteren Eingang für den Klerus benutzt hatte, gleich neben der Apsis. Der Grund für die Heimlichkeit war, dass der eigentlich für die Krönungszeremonie vorgesehene Erzbischof die Stadt unter einem fadenscheinigen Vorwand vorzeitig verlassen hatte. Der Papst hatte ihn rechtzeitig nach Rom beordert.
Natürlich konnte es der Ecclesia romana nicht gefallen, dass dieser Schritt von einem gewöhnlichen episcopus provinciae[3] unterlaufen wurde. Doch dem Hirten von Grigenti war seine Haut näher als der rote Mantel, und er war der dringenden Aufforderung des Kanzlers gefolgt. Johannes von Procida fand den rundlichen Herrn in die Betrachtung der marmornen Sarkophage vertieft, die in den Seitenkapellen standen, wuchtig wie fremdartige Kampfschiffe, bereit zum Auslaufen in die Schlacht, wenn auch Baldachine sie zur Ruhe, der letzten und wohl einzigen Ruhe ihres stürmischen Lebens, gemahnten.
»Eine würdige Grabkammer«, sagte der Bischof, der als solcher nicht zu erkennen war, denn er trug weder Hut noch Stab. »Ich habe sie noch erlebt.« Er zeigte auf den Sarg der Constanza de Aragon, der ersten Frau von Friedrich. »Der Kaiser hat sie sehr geliebt, so sehr wie danach keine andere mehr. Ihr hat er die eiserne Krone der Normannen mit ins Grab gegeben.«
»Wohl auch ein Symbol dafür, dass dem Kaiser spätestens zu jenem Zeitpunkt bewusst war, dass es ihm nie vergönnt sein würde, ein friedliches Leben als König beider Sizilien zu führen und zu beenden, während das ferne Reich durch gehorsame Söhne und treue Vögte regiert wurde. Dafür sorgte schon Rom«, entgegnete der Kanzler nachdenklich.
Der Mann der Kirche überging den anzüglichen Schlenker. »Nun liegt er hier, stupor mundi, das Staunen der Welt fürwahr, in dunkelroten Porphyr eingeschlossen, von vier Löwen getragen, geheimnisvolle Zeichen aus uralter Zeit –«
»›Er lebt, und er lebt nicht‹, sagte die Sybille«, unterbrach ihn Johannes ungeduldig. »Wir sind hier, um für die Lebenden zu sorgen: für die festliche Krönung seines zweifellos meistgeliebten Sohnes Manfred.«
»Vom unglücklichen Enzio[4] einmal abgesehen, den er sicher vorgezogen hätte.«
Der Bischof aus dem Süden der Insel, wo zwischen griechischen Tempeln nur Ziegen weideten, hatte also seine Vorliebe, doch ehe sich der beredte Kenner staufischer Familienwirren um Kopf und Stola reden konnte, fiel ihm der Kanzler ins Wort.
»Doch den halten die unbeugsamen Bolognesen von jedem Griff nach dem Erbe fern. Vielleicht zu seinem Glück«, fügte er sinnend hinzu. »Ein König Manfred wird sich auch mit der Kaiserkrone auf dem Haupt noch lange nicht ungetrübt der Schönheit seiner Insel erfreuen können.«
»Eben dafür stehen die Sarkophage seiner Vorfahren«, begründete der Bischof sein beharrliches Verweilen bei den Grabmalen der Toten. »Der des grausamen Heinrich[5] und der sanftmütigen Constance de Hauteville. Sie mahnen Imperium und Papst zur Versöhnung. Davon will ich dem Volk sprechen, den offiziellen Gästen aus deutschen Landen ebenso wie den heimlichen Lauschern aus dem Castel Sant’ Angelo, die Oktavian degli Ubaldini uns mit Sicherheit schickt –«
»Der Graue Kardinal«, entfuhr es Johannes, gerade noch dass er den erschrockenen Ausdruck seiner Stimme zurücknehmen konnte, »dieser Florentiner? Ich will froh sein, wenn es sich nur um verkleidete Spitzel und nichts Übleres handelt.«
»Berühmt ist der Ring des Kardinals, und unsichtbares Gift gilt als eine Spezialität der orefici fiorentini[6]«, stellte der Bischof stoisch fest. »Ihnen kommen nur die Byzantiner gleich.«
Es war Johannes von Procida endlich gelungen, den Bischof von den Sarkophagen fort vor den Altar zu führen, indem er ihn sacht am Ärmel zupfte.
»Hier wird Herr Manfred vor Euch niederknien, doch Ihr werdet ihn aufheben und zu diesem Thron aus Goldmosaik geleiten.«
»Aber das ist doch der angestammte Platz Seiner Eminenz des Erzbischofs?«
»Eben.« Johannes überging den schüchternen Einwand trocken. »Dort wird Herr Manfred sich zur Strafe niederlassen, und Ihr werdet ihn salben und ihm dann die Krone aufs Haupt drücken, die ich Euch reichen werde, sofern sich kein Würdigerer finden lässt.«
»Und dann läuten die Glocken?«
»Lasst das alles meine Sorge sein«, beschied ihn der Kanzler. »Übt jetzt die Zeremonie! Ihr verfügt über alle Priester und Prioren dieser Stadt samt Chören, Messknaben und Adlaten.«
»Ich will lieber erst mal meine Predigt bedenken, die rechten Worte –«
»Fasst Euch kurz, und vor allem stolpert nicht während des heiligen Officiums. Die Palermitaner sind abergläubisch, sie werden Euch totschlagen, wenn Ihr ihnen die Feier verderbt.« Mit diesen ermutigenden Worten ließ der Kanzler den Bischof allein unter dem byzantinischen Holzkreuz, das eingangs des Chorraums an einer Kette von der Decke hing.
Johannes von Procida verließ die Kathedrale durch das pompöse Hauptportal, weil er sich in der Eingangshalle erwartet wusste. Seine Zeit war genau eingeteilt.
»Der Festzug versammelt die Ritter hinter dem Palazzo«, erläuterte ihm sogleich der Oberste Kämmerer, der als Zeremonienmeister den Ablauf der Festlichkeiten plante, insbesondere den Weg, den der feierliche Krönungszug nehmen würde. »Er zieht durch die Porta di Castro auf San Cataldo und die Martorana zu, wo die hohe Geistlichkeit ihn erwartet, dann schwenkt er in die Maqueda ein, überquert den Cassaro[7], biegt in die Bandiera ab, die zum Kloster des heiligen Dominikus führt. Hier erwarten ihn die Abgeordneten der Bürgerschaft und der Zünfte. Bei der Porta Carbone erreichen wir die Cala, wo am Kai die ausländischen Gesandten seiner harren. Somit komplett, ziehen wir feierlich den Cassaro wieder stadteinwärts, bis wir hier eintreffen.«
Die beiden Männer standen nun, umgeben von sich wichtig gebenden oder eifrig umherschwirrenden Mitgliedern des Festkomitees, auf den Stufen der Freitreppe der »Kathedrale«, wie die Palermitaner ihren der Assunta[8] geweihten Dom nannten. Sie schauten den Cassaro hinab, die breite Hauptstraße, die von der Cala, dem Hafenbecken, hinaufführte zum »Qasr«[9], der mächtigen Burg, wie selbst die Staufer den Palazzo dei Normanni noch gerne riefen. Es war der traditionelle camino real[10], der Königsweg, der die Form eines Kreuzes beschrieb und die engen und verwinkelten Gassen der Altstadt nicht mied, sondern alle vier Quartiere, Capo, Loggia, Kalsa[11] und Albergaria, berührte. Manfred hatte darauf bestanden, auch wenn seinem Kämmerer nicht ganz wohl dabei war.
»Zu leicht können sich Bogenschützen auf den Dächern verbergen, Assassinen aus irgendwelchen Löchern hervorstürzen.«
»Ganz einfach, lieber Maletta[12]«, tröstete ihn der Kanzler ungerührt, »stellt Euch vor, Ihr selbst seid der gedungene Meuchelmörder. Wo würdet Ihr angreifen?« Johannes war mit seinem Vorschlag sogleich zur Hand. »Geht den Weg ab, und überall, wo Ihr die Möglichkeit eines Attentats seht, da postiert Ihr Armbrustschützen oder Doppelwachen.«
»Ich bin aber als Attentäter völlig ungeeignet, schon weil mir sofort schwindlig wird, wenn ich an den Rand eines Daches trete.«
»Der Anschlag auf das Leben des Königs wird mit ziemlicher Sicherheit nicht gewaltsam geführt werden«, erklärte Johannes dem ängstlichen Hofbeamten, »sondern perfiderweise mit Gift. Wir haben die Aufgabe, jeden Trunk, jeden Bissen während der Festmahles – vom Topf des Koches oder des Mundschenks Krug bis zum Munde des Herrschers – im Auge zu behalten, ohne dass wir seine Fröhlichkeit stören.«
»Der Grottenmolch soll jetzt hinken?«
»Bedauerlicherweise! So ist Oktavian gezwungen, einen Attentäter zu entsenden, der uns unbekannt ist.«
»Ihr erwartet den Biss einen Reptils noch vor der erfolgreichen Krönung?«
»Den erwarte ich jederzeit«, knurrte der Kanzler, »zumal sich diesmal auch Hellas bemüht. Nicht so sehr um unseren Herrn, sondern um das Goldene Horn! Habt acht auf alles, was vom Bosporus kommt!«
Der Kanzler verließ mit seinem Gefolge den Platz vor der Kathedrale von Palermo und begab sich zum benachbarten Palazzo Arcivescovile[13], wo er eine Verabredung mit Thomas Bérard hatte, dem Großmeister der Templer. Der wird nicht bis zur Krönung bleiben, sagte sich der Kanzler mit Ingrimm. Denn der hohe Herr des Ritterordens weilte incognito in der Stadt und hatte sich geweigert, den Königspalast zu betreten. So hatte er ihn in dem erzbischöflichen ›Castel San’Arcitrotz‹ untergebracht, wie Herr Manfred, der ansonsten kein Wort Deutsch sprach, den Sitz seines römischen Widersachers nannte. Es gefiel Johannes, das Gehäuse des verhinderten Hausherren als Ort geheimer Zusammenkünfte zu nutzen. Der Palazzo Arcivescovile hatte mehr geheime Zugänge und Fluchttunnel als der des Königs, und einer führte bis hinunter zur Cala.
Der gemauerte unterirdische Gang mündete in der Krümmung des Hafenbeckens, genau dort, wo zwischen Lagerhäusern eingezwängt das Kirchlein der Santa Rosalia lag, der Schutzpatronin der Stadt, gleich neben einer Weingroßhandlung. Für einen spirituellen Einstieg durch die Krypta war ebenso gesorgt wie für einen weltlichen im hinteren Fasskeller. Davor ankerte ein auffälliges Schiff, ein dickbäuchiger Zweimaster, das den Großmeister in geheimer Mission hierher getragen hatte, ohne jedoch dessen Stander zu setzen. Die unter allen Kampfschiffen, die das Mittelmeer befuhren, herausragende Konstruktion eines Triremen[14] vermochte nur ein in Seekriegen Erfahrener richtig einzuschätzen. Das von seinem Äußeren eher plump wirkende Schiff musste ungeheuer schnell sein, denn es verfügte über eine gewaltige Segelfläche und alle Ruder waren mit drei Sklaven statt einem besetzt, wie es die ansteigende Sitzanordnung anzeigte. Es wirkte wie eine gefährliche Echse. Dieser furchterregende Eindruck wurde noch verstärkt durch den riesigen Rammdorn, in den der Bug auslief wie beim Schnabel des Sägefischs. Er konnte tief unter die Wasseroberfläche abgesenkt werden. Die am Kai versammelten Kapitäne und Offiziere der anderen Schiffe ärgerten sich über die Postenkette von Templersergeanten, die das Betrachten aus der Nähe oder gar das Betreten der schwimmenden Kampfmaschine strikt verwehrten. Vorläufer, wenn nicht Vorbild für die ›Atalanta‹[15], so sollte das Wunderwerk angeblich heißen, auch wenn das nirgendwo geschrieben stand, sei die berüchtigte Triëre[16] der Gräfin von Otranto gewesen, die als ›Äbtissin‹ das Mittelmeer unsicher gemacht hatte, bis es still um sie wurde. Aber auch die ›Atalanta‹ war nur selten östlich des Djebl al-Tarik zu Gesicht zu bekommen. Es wurde gemunkelt, sie segle jenseits der ›Säulen des Herkules‹[17] von Cadiz aus in den Ozean hinaus zu den ›Fernen lnseln‹, was auch immer damit gemeint sein mochte, war doch dahinter die Welt zu Ende. Schon um solch ärgerliche Gerüchte zu vermeiden, zeigten die Templer ihr hässliches Flaggschiff auch nicht gern. Man munkelte, es führe meist bei Nacht, und viele auf unerklärbare Weise verschwundene Fischerboote seien in Wahrheit Opfer der im Dunkeln über das Meer rasenden ›Atalanta‹. Deshalb war es mehr als erstaunlich, dass sie hier so friedlich in der Cala lag, wenn auch von ihren herabgelassenen Segeln fast verhängt. Vielleicht sollte man die festmontierten Bordkatapulte nicht zu Gesicht bekommen, die zwanzig Trebuchets für Brandpfeile – zehn auf jeder Breitseite – und die wuchtigen Bailisten, stark genug, um Fünfzigpfünder zu verschießen oder dickwandige, kugelrunde Amphoren mit Griechischem Feuer. Beide hatten schon bei einem einzigen Treffer die Vernichtung und den Untergang jedes noch so wendigen Feindes zur Folge.
Wie um die Aufmerksamkeit von dem Meeresungeheuer abzuziehen, rauschte jetzt ein weiterer mächtiger Templersegler in das Hafenbecken, schlug allerdings einen Haken, kaum dass er der ›Atalanta‹ ansichtig wurde, um an der äußersten Mole zu ankern, in der Höhe der Santa Maria di Catena, der Kirche, von deren Mauer aus die Hafenkette hinüberlief zum verlassenen Quartier der Genuesen. Das Schiff stand unter dem Kommando des Taxiarchos, der in Begleitung der drei jungen Ritter aus dem Languedoc, Raoul de Belgrave, Mas de Morency und Pons de Levis, eintraf.
Aber eigentlich war diese Ankunft kein Ereignis, es liefen dieser Tage, oft nur im Abstand von Stunden, so viele bedeutsame Schiffe ein, gar Zweimaster und Großgaleeren mit Hunderten von Mann Besatzung, dass sich nur der Hafenkommandant um den frisch eingetroffenen Schnellsegler des Ordens kümmerte.
»Geht nur schon«, schlug der Penikrat Taxiarchos seinen Dreien vor, »und sucht die Hafentaverne aus, die am verruchtesten wirkt. Mir ist nicht nur nach einem kräftigen sizilianischen Roten –«
»– sondern auch nach einer feuchten, schwarzen fica«, beendete Pons den üblichen Satz seines Admirals.
»Hier soll’s auch blonde geben«, sagte Mas, als sie im Gänsemarsch das Fallreep hinunterstiefelten, »der normannische Beitrag.«
»Das ist der Adel der Insel. Die haben gerade auf Mas de Morency gewartet, einen armen Ritter ohne Lehen.«
»Aber geil!« verteidigte sich der gegen die überlegene Art des Belgrave. Doch der winkte ab.
»Bei Blonden dauert es immer so lange, bis sie verstehen, was Burschen wie wir wollen.«
»Aber dafür sind sie dann auch gut zu haben«, trug Pons aus der Truhe seiner Erfahrungen bei.
»Mir sind die Dunkelhaarigen lieber, die sind schon nass, bevor du überhaupt hingeschaut hast.«
»Schau nicht hin!«, trompetete Mas. »Augen zu, Hose runter und –«
»Wenn ihr vorgeblichen Weiberhelden noch lange Maulaffen feilhaltet, statt Eure Ärsche in die Richtung zu bewegen, die Euer Admiral Euch geheißen, tret’ ich Euch in die Eier«, rief der Taxiarchos ihnen nach, als sie immer noch unschlüssig auf dem Kai herumstanden, »dass sie euch als Glocken im Himmel klingeln!«
Die drei zogen los, während der Hafenkommandant an Bord kam.
Das Hafenbecken wimmelte in der Tat von Schiffen der aus allen Ecken der Welt, vom Mittelmeer bis zum fernen Ostseestrand, angereisten Gäste. Das glorreiche Trio drängelte sich durch das gaffende Volk.
»Was sollen wir hier eigentlich?« maulte Mas de Morency. »Ich möchte gern mal wissen, warum wir das Schiff kapern mussten, und das nicht einmal wie aufrechte Korsaren, sondern heimlich wie Diebe in der Nacht!«
»Die Mannschaft gehorchte dem Taxiarchos doch aufs Wort«, wiegelte Raoul ab.
»Aber das Schloss an der Kette in Perpignan trug das Siegel der Templer, auch wenn unser Herr Admiral es schnell und geschickt zerbrach, ich hab’s doch gesehen.«
»Und warum mussten wir wie die Teufel – ohne Proviant aufgenommen zu haben, ohne Halt, auch bei stockfinsterer Nacht – bis hierher durchsegeln?« Pons hatte Mangel gelitten.
»Du bist völlig vom Fleische gefallen, armer Levis!«, spottete Raoul. »Der Grund ist einfach: Der Taxiarchos konnte es nicht verwinden, erst vom Präzeptor um seinen Anteil an der Fracht, dann vom Königlichen Paar um den Schatz geprellt zu sein. Er hetzte nicht hierher, damit wir endlich den Dienst bei Ritter Roç Trencavel antreten, sondern weil er hofft, ihn und seine treffliche Gefährtin Yeza noch abfangen zu können!«
»Sind die denn schon da?«, fragte Pons ungläubig.
»Was weiß ich!« schnappte Mas dazwischen wie ein Hund, dem der Knochen weggezogen wird und der nicht zugeben will, dass er ihn gern wieder zwischen den Zähnen hätte. »Auf jeden Fall hab’ ich keine Lust, lange nach der ›verruchtesten‹ Taverne von Palermo zu suchen. Wir nehmen die erstbeste!«
»Sobald du sie betrittst«, erklärte Raoul, »erfüllt sie sowieso die gestellte Bedingung!«
Sie umgingen die Sperrkette der Templersergeanten und verschafften sich Einlass in der Weinhandlung gleich daneben. ›Oleum atque Vinum‹[18] stand über der offenen Tür geschrieben, und ein Ausschank schloss sich gleich zur Hafenmole hin an. Alekos[19], der Patron, war Grieche und taute sofort auf, als er hörte, dass die drei mit Taxiarchos, dem Penikraten von Konstantinopel, fuhren, ja, er konnte es kaum abwarten, dass sein mehr berüchtigter als berühmter Landsmann die bescheidene Probierstube mit seinem Besuch beehren würde.
So bescheiden war es nicht, was die Gewölbe beherbergten. Amphore neben Amphore köstlichen kalt gepressten Olivenöls verschiedenster Provenienz steckten in Haltern und gruben sich in das Sandbett. In der Tiefe lagerten Eichenfässer in langen Reihen und verströmten bald einen herb irdenen, bald einen schweren harzigen Duft, wenn Alekos seine Knollennase zum geöffneten Spundloch herabsenkte. Das tat er gerade, denn er wollte seine Gäste mit dem besten Tropfen ehren, den er in seiner Schatzkammer flüssigen Goldes ausmachen konnte.
Alekos war ein Strohmann des Templerordens, dem eigentlichen Besitzer von ›Oleum atque Vinum‹ nebst dazugehörigen Lagerhallen und dem Kirchlein der heiligen Rosalia. Ansonsten besaßen die Herren vom Tempel in Palermo nichts, kein Quartier, keine Kommanderie. Das war für den Orden, dessen oberster Herr schließlich der Papst war, seit Beginn der Stauferherrschaft auf Sizilien weder angebracht noch wünschenswert, denn es hätte ihn erpressbar gemacht. Der jetzige Zustand genügte ihnen vollauf. Sie saßen nicht nur in unmittelbarer Meeresnähe, sondern am Spundhahn des römischen Einflusses; sie hatten die höchste geistliche Autorität am Wickel, statt umgekehrt, wie der Erzbischof es gern gesehen hätte. Und ihr Verhältnis zur weltlichen Macht blieb unsichtbar. Dafür sorgte schon Johannes von Procida.
Alekos hatte den Wein kredenzt, aber der Taxiarchos war noch immer nicht aufgetaucht. So hatte der bemühte Wirt begonnen, sich und den drei fremden Rittern die Zeit zu vertreiben, indem er ihnen anhand der Schiffe im Hafen den Stand der königlichen Gästeliste erläuterte.
»Die blaue Galeere dort«, er zeigte auf den langgestreckten Ruderer mit dem hohen Bugschnabel, »das ist der Emir von Tunis. Er hat seinen Obereunuchen geschickt, der für ihn die Sklavenmärkte abgrast, und gleich daneben liegt der schnittige Segler des Herzogs von Gandia, der den König von Aragon vertritt.«
»Ah!« entfuhr es Pons. »Don Jaime, der Expugnador!«
»Wir haben gegen Xacbert de Barbera gefochten!«, fügte Mas voller Stolz hinzu. »Der hat für ihn Mallorca erobert!«
Alekos lachte und schenkte nach.
»Ich kenne nur sein Schiff, die ›Nuestra Señora de Quéribus‹, dessen Planken die alte Landratte angeblich nie betreten hat!«
»Die Farben kenn’ ich!«, rief Pons und wies auf eine gerade anlegende betagte Galeere. »Das muss der Graf von Malta sein.«
»Der Großadmiral der sikulischen[20] Flotte? Nein, das ist zwar das Wappen der Admiralität …, es ist doch nicht etwa ›Die Äbtissin‹?! Nein, das kann nicht sein!«
Alekos beließ es dabei, seine Aufmerksamkeit wurde schon wieder von neuen Ankömmlingen beansprucht. »Seht Ihr die reich geschmückten Reitkamele, die gerade entladen werden? Das ist Manfreds treueste Garde, die Sarazenen aus Lucera.« Er nahm einen kräftigen Schluck und schenkte allen nach. »Aus Apulien, aus der Terra di Lavoro[21] und selbst aus Kalabrien sind viele von des Königs Lehnsleuten und Verwandten übers Meer gesegelt, anstatt den beschwerlichen Landweg zu nehmen. So führen sie wie die Schnecken auch gleich ihr Haus mit sich.«
Alekos bereitete es unbändigen Spaß und auch Stolz, denn schließlich war er hier geboren, die jungen Burschen einen Zipfel von der großen weiten Welt des mächtigen Königreichs von Sizilien erhaschen zu lassen.
»Der Fürst von Tarent, die Herzöge von Amalfi, mit ihnen die von Benevent und Capua sind so angereist, die Grafen von Sorrent und Aquin desgleichen, auch der von Lecce und Brindisi. Und aus dem nördlichen Reich sind der Herzog von Spoleto und der von Montferrat gekommen.«
»Sicher haben auch Foggia, Messina und Neapel Vertretungen ihrer Bürgerschaft und der Universität geschickt?!«, mokierte sich Mas.
»Gewiss! Sonst wäre die Stadt nicht so voll und nicht jede Ecke zugeschissen!«
Es war keine Liebe des Alekos für die Brüder jenseits des Tyrrhenischen Meeres zu spüren, weder für die lärmenden, aufgeplusterten aus der Campania noch für die hochnäsigen aus Apulien, die darin wetteiferten, Palermo den Rang als Hauptstadt des Königreiches abzulaufen. Alekos spie verächtlich auf den Boden.
»Und aus anderen Staaten, wer entsendet seine Botschafter?« Raoul hatte bisher nur aufmerksam zugehört.
»England war doch immer ein guter Freund?«
Alekos war auch da mit Neuigkeiten bereitwillig bei der Hand. Er füllte nur erst die Becher auf, feuchtete auch seine Kehle und fragte besorgt:
»Wo bleibt denn der Taxiarchos? Er müsste doch –«
»Als wir das Templerschiff verließen, ging gerade der Hafenkapitän an Bord«, erklärte Mas, doch den Wirt beunruhigte etwas ganz anderes.
»Templerschiff?« hakte er nach.
»Sicher!« protzte Pons. »Das gleiche, mit dem wir nach den ›Fer‹ –« Weiter kam er nicht, weil ihm Raoul kurz und schmerzhaft aufs Maul geschlagen hatte.
»Ihr wolltet uns die Gäste aus fernen Landen weisen«, wandte der Belgrave sich verbindlich lächelnd an den Gastgeber, und der zog es vor, die Fragen zu unterlassen, die sich plötzlich auftaten, und die Zeit bis zur notwendigen Klärung mit Kurzweil zu überbrücken.
»Also«, begann er und wischte sich den Wein aus den Spitzen seines Schnurrbarts, »da hätten wir den Despoten von Epiros; der hat seinen Bastardsohn gesandt. Demnächst wird ja wohl seine schöne Tochter folgen, Elena Angelina.« Er ließ den Namen schnalzend auf der Zunge zergehen. »Denn sie ist unserem Herrn Manfred versprochen. Doch auch das Weib ihres Halbbruders würde ich nicht von der Bettkiste stoßen! Als die rassige Walachenprinzessin[22] gestern an Land ging, haben sich alle die Hälse verrenkt, selbst der zweithöchste Ordensritter der Johanniter, Herr Hugo von Revel[23], der in Vertretung seines Großmeisters kurz vor ihr anlandete; der Châteauneuf[24] ist mittlerweile zum Reisen zu altersschwach. Die feurige Walachin –«
Die hatte es wohl auch dem Alekos angetan, Mas und Pons bekamen enge Hosen.
»– trug Kostüm und Schmuck ihrer wilden Heimat, allesamt Schafhirten dort und Räuber! Jedermann gaffte, und die Matrosen pfiffen hinter ihr her. Ihr Ehegespons platzte schier vor Eifersucht!«
»Die will ich sehen!« brüstete sich Mas de Morency.
»Sie wartet nur auf dich!«, sagte Raoul und wandte sich an den Wirt. »Sie hat doch gleich ihre Zofe geschickt, um zu erfragen, ob Mas de Morency schon eingetroffen ist.« Raoul hatte die Lacher auf seiner Seite.
»Weiter!«, rief Pons. »Kommt denn kein König oder Kaiser, kein Sultan–?«
»Der Hof befürchtet, der Lateinische Kaiser Balduin von Konstantinopel könne anreisen. Das wird dann teuer, denn der verkauft Reliquien zu völlig überhöhten Preisen, nur weil er den Titel noch trägt. Dabei ist er völlig bancarotta[25]! Keinen Besanten[26] hat Herr Balduin in der Tasche, sodass er auf der seiner Gastgeber zu liegen pflegt, ich glaube, der kann nicht einmal mehr das Reisegeld zusammenkratzen!«
»Nicht einmal ein Kaiser!« Pons war enttäuscht, doch in diesem Moment ging draußen ein blutjunges Mädchen vorbei, umgeben von sarazenischen Leibwächtern und einem Schwarm von Zofen. Die Jungfer war gut im Fleisch und schaute unbekümmert mit frechen Kindsfrauaugen über das Gewimmel hinweg, denn sie überragte ihre Umgebung um Kopfeslänge. Ihr Blick fiel durch die geöffnete Tür auf die Runde der Zecher, und sie blieb stehen, um die drei Burschen ungeniert zu betrachten. Dann grinste sie und ließ sich von ihrem Geparden weiterziehen. Pons und Mas blieben mit offenen Mäulern hocken. Das Lächeln der Maid hatte Raoul gegolten, denn der hatte ihr einladend zugezwinkert.
»Pu!« entrang sich Pons und rang nach Luft. »Wie die mich angeschaut hat!«
»Dich?« schnappte Mas.
»Das war König Manfreds einzige und heiß geliebte Tochter Konstanze[27]!« klärte Alekos die jungen Recken auf. »Sie ist noch ein Kind –«
»Ein Kind?«, sagte Raoul. »Dann will ich Kinderschänder sein!«
Mas sprang auf, um hinter der abziehenden Gesellschaft herzustarren. »Und den Geparden nehm ich als Dreingabe!« Er war völlig hingerissen. »Die Göttin Diana[28] ist herabgestiegen, um mich in ihre festen Arme zu schließen.«
»Die verfüttert dich an ihre Bestie, bevor du überhaupt aus den Hosen kommst!« Raoul kannte keine Gnade, wenn’s um die Hose ging·
Der Wirt beendete den Disput. »Konstanze ist eine ehrenwerte Jungfrau und dem Infanten von Aragon anverlobt.«
»Das letzte muss das erste nicht mit sich schleppen!«, verkündete Pons altklug, während vor der Taverne wieder Unruhe entstand.
Die Postenkette der Templersergeanten machte diesmal bereitwillig einem Trupp Soldaten Platz, der, angeführt vom Hafenkommandanten, geradewegs auf die Tür von ›Oleum atque Vinum‹ zusteuerte. Während seine Leute schon eindrangen, rief der Hafenkommandant: »Im Namen des Gesetzes, alle stehen unter Arrest!«
Die Soldaten griffen sich das Trio, bevor auch nur einer von ihnen seine Waffe ziehen konnte, rissen ihnen die Arme hinter den Rücken und fesselten die Handgelenke. So wollten sie auch mit dem Wirt verfahren, doch man kannte sich schließlich.
»Mitkommen müsst Ihr dennoch, Alekos!«, forderte ihn einer der Beamten auf.
»Ich? Wieso?«
»Weil Ihr Grieche seid!« lautete der bündige Bescheid. »Es geht um ein byzantinisches Komplott«, fügte er, selbst tief beeindruckt, noch hinzu. »Hochverrat!«
Die glorreichen Drei wurden hinausgestoßen, und Alekos trottete kopfschüttelnd hinter ihnen her.
Der Flickschneider und der Kanzler
Der Segler des Hafsiden ankerte in einer verschwiegenen Felsbucht der Insel Ustica[29] im Norden Siziliens. Der Sklavenhändler hatte die kürzeste Route gewählt, geradewegs zwischen dem südlichen Korsika und der Nordspitze Sardiniens hindurch, wo es gemeinhin von Korsaren und sardischen Banditen nur so wimmelte. Doch alle Piratenboote, die angeschossen kamen, beschränkten sich auf ehrerbietiges Winken, sobald sie das stolz gesetzte Tuch Abdals erkannten. Sein furchterregendes Banner zeigte im schwarzen Unterfeld zwei gekreuzte Scimtars, mit silbrigen Fäden auf das teure Tuch gestickt, und darüber im grünen Capo das Haupt eines Mohren mit einer weißen Binde über den Augen, als sei der Kopf gerade abgeschlagen worden. Doch das Tuch flatterte fröhlich im Wind, so wie auch der Schiffsherr von blendender Laune nur so strotzte. Der Hafside trug noch immer das mit Juwelen übersäte Fantasieornat eines Großmetropoliten von Bethlehem. Es gefiel ihm ungemein, aber er hätte es auch als sichtbaren Dank an Allah getragen, der ihm, ohne dass er seinen ringgeschmückten kleinen Finger rühren musste, so viel Gold auf sein Schiff gehäuft hatte. Gerührt schaute Abdal vom Ruderdeck durch das Gitter in den Bauch seines Schiffes hinab, in dem sich diesmal keine ebenholzfarbenen Sklavenleiber, sondern hölzerne Christenheilige aneinanderdrängten, alle prallvoll mit Gold. Man musste sie nur noch aufschlitzen, das hatte ihm jedenfalls Herr Georges insgeheim geschworen, von dem seine Geschäftspartner immer annahmen, er sei im Kopf so töricht, wie seine schwammigen Gesichtszüge es vorgaukelten.
Der Komtur der Templer war eitel und gerissen zugleich. Und das Spiel vom habgierigen Herrn und betrogenen Diener spielten sie jedes Mal neu, auch mit vertauschten Rollen, jeweils den erdenkbar bizarrsten Umständen zwischen Orient und Okzident angepasst.
Ein christlicher Ordensoberer und ein muslimischer Sklavenhändler in vollkommener Symbiose, wie man sie ansonsten nur auf dem Meeresboden zwischen der Purpurschnecke und der schmarotzenden Seerose findet. Wo gab es denn noch Männer, die in dieser verlogenen Welt, inmitten des an seinen verträumten Helden untergehenden Rittertums und des mehr dahin – denn heraufdämmernden Zeitalters der Kaufleute, bereit und fähig waren, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen? Als Herren, als Eroberer! Die Untertanen schleppten sich von einem Waffenstillstand zum nächsten, mogelten ihren schlaffen Körper durch die feudalen Zwänge, verfettete Seelen, die Würmern gleich durch die täglichen Gebete krochen, ohne aufzubegehren! Wirklich freie Herren waren, außer ihm, Abdal, nur noch Männer wie der Penikrat von Konstantinopel, dieser Taxiarchos oder dessen Freund, der undurchsichtige Priester Gosset. Auch Gavin wollte er gern zu diesem Kreis zählen, doch den hatten die Grauen, die gesichtslose Prieuré, schon zur Strecke gebracht. Es blieben nur noch wenige Aufrechte im Orient und Okzident. Die sollten zusammenstehen und diese Welt verändern, dachte grimmig der Hafside, nicht um den faulen Frieden auf Erden zu erhalten, das war eh vergebliche Liebesmüh, sondern um ihrer selbst willen, ihres Lebens als neue Menschen! Das wollte er gern Roç und Yeza sagen, diesen königlichen Friedensstiftern! Die trugen das Zeug zu Besserem in sich, das spürte der Menschenhändler. Die sollten sich befreien von den unsichtbaren Fesseln, welche die Prieuré, diese Versammlung lebender Toter, ihnen um die jungen Leben geschlungen hatte! Das musste er ihnen sagen, und er würde ihnen auch mit all seiner ihm zur Verfügung stehenden Macht bei der Befreiung behilflich sein. Die beiden an der Spitze eines Aufbruchs in eine neue Zeit, zu neuen Ufern, zu den ›Fernen Inseln‹!
Hier wurde Abdal in seinem Höhenflug unterbrochen, denn unten an Deck hieß Monseigneur Gosset das Eisengitter zum Frachtraum aufschließen, und einige der Moriskos[30] glitten an Tauen hinab zu den hölzernen Leibern. Dem Priester war Jordi, der Troubadour des Königlichen Paares, gefolgt. Gespannt betrachtete er das perfekte Schauspiel, das arg an das Entern von Piraten erinnerte.
Georges Morosin stieg hastig zu seinem Partner hinauf.
»Wir sollten jetzt aufpassen, dass keiner von der Heiligen Familie beiseite gebracht wird«, murmelte der Doge aufgeregt. »Ich habe sie gezählt «
»Im Gegenteil«, beschied ihn der Hafside, der längst einen Blick des Einverständnis heischenden Priesters aufgefangen und mit stummem Nicken seine Zustimmung signalisiert hatte. »Eure Neugierde könnte als Misstrauen ausgelegt werden und würde auch unser Wissen um den wahren Gehalt dieser Holzpuppen verraten.«
»Sprecht nicht so leichthin über die Leidtragenden, deren Schmerz uns Christen –«
»Was sie tragen«, unterbrach ihn Abdal und lachte, »werden wir ja sehen. Ihr habt mir geschworen, dass es mir nicht leid tun würde. Also geht jetzt mit mir ins Zelt, damit ich mich an Euren Qualen weiden kann, der Ihr auf den Augenblick der Wahrheit warten müsst, den Ihr – so scheint’s mir – kaum erwarten könnt.«
»Ihr wollt Euch nur nicht allein betrinken, weil das als Heimlichkeit gelten könnte und eines guten Muslims unwürdig ist«, gab es ihm der Doge heraus und fügte sich anscheinend der Einladung. »Statt in Eurem stickigen Zelt durch die Schaukelei getrübten und miserabel temperierten Rebensaft zu schlürfen – wie zwangsweise während der gesamten Reise –«, fuhr Herr Georges beredt fort, »würde ich es allerdings vorziehen, an Land, unter dem Schatten eines Olivenbaums, einen Krug frischen Weines dieses köstlichen Eilands zu genießen.« Sprach’s und stiefelte zur Reling, um das Fallreep hinabzusteigen. Der Sklavenhändler hielt ihn nicht auf.
»Ich weiß zwar nicht, wo Ihr auf diesem kahlen Felsenriff auch nur einen einzigen Baum seht«, brummte er, während er seinem Freund folgte, »aber auf diese Weise können wir uns unauffällig zum Königlichen Paar gesellen und mit ihnen die Ankunft der hölzernen Passion erleben.«
»Für einen Nichtchristen zeigt Ihr erstaunliches Mitgefühl«, entgegnete der Doge hämisch, der sich unterhalb des Hafsiden die Strickleiter hinunterhangelte. Da trat Abdal ihm auf die Hand.
Es gab kein eigentliches Dorf auf Ustica, eine Anzahl von Häusern klebte in den Felsen über dem Strand, und hoch über allem thronte ein mächtiger normannischer Wachturm, der offensichtlich unbemannt war, denn eine Besatzung hatte sich nicht gezeigt. Vielleicht hatte sie sich wie die Bewohner des Ortes bei der Ankunft des Schiffes versteckt. Üble Erfahrungen mit Piraten ließ dies angeraten sein, und der Anblick, den Abdal und seine Moriskos boten, war sicher nicht dazu angetan, Misstrauen und Furcht der Einheimischen zu beseitigen. Nur die Köpfe der Männer waren zu sehen, die, mit Fischspeeren, Sensen und Dreschflegeln bewaffnet, hinter der aufgeschichteten Steinmauer hockten, wohl eher furchterfüllt als furchterregend, aber dennoch bereit, das Leben ihrer Frauen und Kinder so teuer wie möglich zu verkaufen.
Auf halber Höhe zwischen dem grauen Sandstrand und ihnen hatten Roç und Yeza ihr Zelt in dem in Terrassen aufsteigenden Hang aufschlagen lassen, auf einem Plateau, das von einem mächtigen Feigenbaum beherrscht wurde. Die Last der vollreifen, schon aufplatzenden Früchte bog die Äste nieder, und Yeza ließ es zu, dass ihre Frauen sie pflückten und zubereiteten, gegen jeden Einwand Roçs zugunsten des Eigentümers. Er war jedoch der erste, der sich eine der saftigen dunklen Früchte aus dem Korb griff, sie mit seinem Messer genüsslich halbierte, das Innere herausstülpte und mit obszöner Zungenbewegung zum Munde führte.
»Weißt du, wie dié Leute hier das nennen?«, fragte er herausfordernd die Potkaxl, nachdem er sich vergewissert hatte, dass auch Geraude zuschaute. »Fica!«
Die Potkaxl grinste, Geraude errötete, doch Dame Mafalda, die das Pflücken beaufsichtigte, rief:
»Ihr solltet sie nicht so lange lecken, sondern sie Euch in den Hals stopfen!«
Yeza dankte es ihr mit einem Lachen, in das alle Frauen einfielen. »Doch verschluckt Euch nicht!«
Roç lutschte das klebrige Fruchtfleisch zwar noch aus, was ihm gnädig die Sprache verschlug, aber den prickelnden Beigeschmack hatte es nun nicht mehr. Zu seiner Freude erschienen jetzt der Hafside, der die steilen Stufen der Terrassen trotz der Mächtigkeit seines Körpers behänd bezwang, und der Doge, der ihm stöhnend folgte und immer wieder stehen blieb. Der Sklavenhändler warf einen Blick hinauf zur Mauer der Wehrhaften, die sich wie auf ein Kommando duckten und nur noch die Tuchmützen sehen ließen, unter denen sie die Köpfe zusammensteckten. Abdal lachte. »Sie fürchten Georges Morosin, den schröcklichen Dogen von Askalon!« Er wandte sich galant an Yeza. »Sie winken bereits mit der weißen Fahne, zum Zeichen, dass sie sich Euch auf Gnade oder Huld ergeben wollen –«
Er nahm dankend eine der frischen Feigen, die Mafalda ihm von Geraude auf einem Tablett reichen ließ, und biss geübt hinein, um dann nach einem genüsslichen Schmatzer fortzufahren: »– bevor wir ihnen ihre gesamte Obsternte wegfressen!«
»Diese Eingeborenen machen sich, scheint’s, nichts aus Feigen«, wandte Roç gerade zu seiner Entschuldigung ein, als oben ein dürres Männlein mit einem viel zu großen Turban über die Mauer stieg, gefolgt von einem riesigen Schwarzen, der einen schirmartigen Fächer aus Federn und Schilf über dem Kopf seines Herrn bewegte, was dem Mohren wenig Mühe kostete, reichte ihm der Turban doch nur bis zur Brust. Voran lief ein merklich weniger dunkelhäutiger Knabe mit krausem Haar, der wie wild die weiße Fahne schwenkte.
Der Doge hatte gerade keuchend die Plattform erreicht, als das Männlein so würdig wie möglich von oben die Stufen heruntergehüpft kam, kaum dass sein Fächerträger ihm zu folgen vermochte.
»Seine Exzellenz Kefir Alhakim[31], Gouverneur seiner Majestät Kaiser Friedrich auf Ustica«, stellte ihn der große Schwarze der Runde vor, und zwar in breitestem Schwäbisch, was hier und aus diesen vollen Lippen nicht auf Heiterkeit, sondern auf allgemeines Unverständnis stieß. Nur Roç und Yeza waren des Alemannischen mächtig und übersetzten das Gehörte ins Arabische und Französische, damit alle Anwesenden wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Das Männlein wehrte jedoch mit ungeduldiger Handbewegung ab.
»Ich bin der Doktor dieser Insel«, sagte er mit Nachdruck. »Ich heile alle Gebresten[32] der Leute, vom Fieber, das durch den Stich der Trachinidae[33] oder des Scoropaena scrofa[34] entsteht, bis zu Blutungen im Kindsbett, von den Folgen des Genusses schlechter Muscheln bis zum Liebesleid!«
Kefir Alhakim sah sich herausfordernd um, und das ließ sich Roç nicht entgehen.
»Dann habt Ihr also in Salern studiert und seid approbiert, wie es das Gesetz –« Schon hier wurde er unwillig unterbrochen.
»Ich bin Arzt der Heilkräfte, die, in der Natur verborgen, zu finden sind. Ich bin einer der letzten Kundigen der Myketologia[35], der größte Kenner der geheimen Muscaria[36] und der gewöhnlichen Sporangia[37].«
»Mein Vater«, griff hier vorlaut der Knabe ein, er schaute dabei nicht etwa zu dem Schwarzen auf, sondern deutete mit der Fahnenspitze auf den Turban des Kefir, »ist der Schneider des Dorfes, seit ihn der Statthalter des Kaisers, der Herr Berthold von Hohenburg aus Neapel, hierher verbannt hat.«
»Der Leibarzt, dieser Johannes von Procida –« Der Vater empörte sich zu schwach, um seinen kecken Sprössling zurückzuhalten.
»– hatte ihn angezeigt wegen unbefugter Ausübung des ärztlichen Berufes.« So beendete der Filius unbarmherzig den Satz.
»Ich hatte nur nicht das Geld, den Hohenburg zu fetten!«
»Was nichts daran ändert, dass mein erhabener Vater ein hervorragender Schneider ist, dem man jeden Fetzen vom Basar in die Hand drücken kann, damit er daraus ein Prunkgewand macht«, schloss in erstaunlicher Wende der sprachgewandte Knabe. »Ich kann ihn Euch nur empfehlen, meine werten Damen und Herren!«
Erst jetzt bemerkten alle, wie ungewöhnlich kostbar die Delegation gekleidet war, angefangen mit dem Heroldstappert des Negers, das, akkurat in Goldfäden gestickt, das Wappen des Staufers zeigte, selbst wenn er darunter nichts trug als schwarze Haut. Auch der vorwitzige Knabe steckte in damastenen Pluderhosen und einer schönen samtenen Weste.
»Und dich lässt er wohl studieren?«, fragte Yeza, die sich mit ihren Frauen ein Kichern kaum verkneifen konnte, wenngleich ihr der Herr Kefir Alhakim eigentlich leid tat, der zusehends unter seinem Riesenturban geschrumpft war, sodass fast nur noch seine Nasenspitze hervorschaute.
»O ja«, antwortete sein Sprössling, »ich besuche zu Palermo das Kolleg der Benediktiner und werde einmal professore[38] oder Kardinal werden! Ich bin nur zu Besuch hier, zur Hochzeit unseres Herrn Manfred am 18. August will ich wieder in die civitas[39] zurückgekehrt sein!«
»Soso«, sagte der Doge, »dann wirst du uns jetzt auch sicher Brot, Öl und frischen Wein von der Insel besorgen können, denn deswegen habe ich mich eigentlich bis hier hinaufgemüht.«
»Wir backen selbst Brot von unserem Getreide, keltern unseren Wein und pressen Oliven –«
»Du meinst, deine Mutter?«, wandte der Doge ein.
»Die ist tot«, sagte der Schwarze, und Yeza übersetzte es.
»Du willst behaupten«, ging der Hafside das Bürschlein an, »auf diesem felsigen Eiland wächst das alles?«
»Auf der anderen Seite, hinter dem Vulkan, in der Tramontana, ist der Boden fruchtbar und vor den Winden geschützt. Wir leiden keinen Mangel!«
»Dann lauf, und bring dem Herrn Komtur das Gewünschte!«
Der Doge warf dem Knaben eine Münze zu, die der geschickt im Fluge auffing, bevor er davonrannte, die weiße Fahne schwenkend.
»Heißt das, dass wir von Euch nichts zu befürchten haben?«, wollte der Gouverneur wissen.
»Das heißt, dass wir Euch alles bezahlen werden, was ihr uns gebt«, antwortete Roç, »angefangen vom Trinkwasser –«
»Wein!«, rief der Doge. »Wir feiern ein Fest, und alle Bewohner des Ortes sind eingeladen!«
»Auch unsere Frauen?« traute sich jetzt der baumlange Fächerträger selbst eine Frage zu stellen, und das mit erst argwöhnischem, dann erschrockenem Blick hinab zum Strand, wo die Moriskos anscheinend erschlagene Schwarze aus dem Bauch des Schiffes holten und im Sand ablegten.
Der Sklavenhändler bemerkte das Entsetzen und lachte schallend.
»Die sind schon vor über tausend Jahren gestorben«, erklärte er, was den Schwarzen noch mehr verwirrte.
Da griff Yeza ein. »Seid unbesorgt wegen Eurer Frauen. Meine Damen werden ihnen gern Gesellschaft leisten, wie es sich gehört.«
Das gefiel auch dem Herrn Kefir. »Ich danke Euch.« Er verneigte sich erst vor Yeza, dann vor allen anderen. »Ich werde mich jetzt zurückbegeben, die frohe Kunde verkünden und alle notwendigen Anordnungen treffen.«
Mit wiedergewonnener Würde winkte er seinen Herold und Fächerträger zu sich und begann den Aufstieg.
»Wenn ich solch ein Leichtgewicht von Gouverneur wäre«, seufzte der Doge, »würde ich mich auf den Schultern tragen lassen!«
»Er ist eben kein echter Gouverneur, sondern nur der Inseldoktor«, tröstete ihn sein Freund Abdal, doch das mochte Roç nicht stehen lassen.
»Er ist der Flickschneider!«
»Aber ein guter!«, meinte Yeza gerade, als Gosset die letzten Stufen hinaufstolperte.
»Wir hatten einen blinden Passagier!«, verkündete er frohgemut. »Als ich vor dem Beginn des Ausladens von oben noch einmal zählte, kam ich jedes Mal auf eine Figur mehr, als ich mir in Perpignan notiert hatte. Dann trat einer der Moriskos auf einen Heiligen, der laut und vernehmlich ›Jachwei‹[40] schrie, und wir fanden Jakov in enger Umarmung mit seinem Joseph, dem Zimmermann.«
»Das wundert mich nicht«, sagte Roç, »wo sollte der auch sonst –« Doch Gosset schnitt ihm grinsend die unschuldige Erklärung ab.
»Was mich jedoch wundert, ist, dass er die Überfahrt wohlbehalten und bei vollen Kräften überstanden hat, müsste er doch eigentlich verschrumpelt sein wie eine gedörrte Feige.« Gosset ließ seinen Blick von Roç zu Yeza wandern, die mit keiner Wimper zuckte.
»Nebbich a Wunder!«[41], sagte sie leichthin und reichte dem Priester das Tablett mit den frischen Früchten von dem Baum, dessen Abernten die Potkaxl gerade beendete, indem sie sich von Philipps Schultern aus von Ast zu Ast hangelte. Roç ertappte den Dogen, wie der den Vorgang angestrengt verfolgte, nur dass seine kurzsichtigen Augen sich nicht in den höchsten Zweigen verloren, sondern tiefer auf Potkaxls Schenkel geheftet waren. Wie immer trug die Toltekenprinzessin nichts unter dem Röcklein.
»Ich habe also Jordi als Aufsicht unten gelassen und Jakov den Auftrag erteilt, sich nützlich zu machen und sogleich mit dem Schlachten der Figuren zu beginnen, sobald alle an den Strand ins Trockene verbracht sind!«
»Sehr vernünftig, lieber Gosset«, sagte Roç, »aber da sollten wir dabei sein, denn wenn er mit dem Aufhacken und Sägen beginnt, wird –«
»Wird nicht«, unterbracht ihn Gosset. »Josephs Vertreter auf Erden gebärdet sich ärger als der Papst und hat wieder ›Jachwei!‹ geschrien, diesmal so oft und heftig, dass selbst die Moriskos innehielten, auch wenn sie nichts vom Zorn Jehovas verstanden, den er mit Donnerstimme auf unsere Köpfe herab beschwor, falls wir es wagen sollten, diese einmaligen Zeugnisse abendländischer Holzschnitzkunst zu zerstören.«
»Da hat dieser Jakov völlig recht!« mischte sich autoritär der Sklavenhändler ein. »Wenn Euch Ungläubigen schon’erlaubt ist, vom Allerhöchsten und Einzigen Bilder anzufertigen und ihn mit Familie zu umgeben, sind diese Figuren Gegenstände eines sakralen Kults und daher –«
»Sieh an!«, spottete der Doge, von Potkaxls drallen Formen lassend. »Ein Frommer vom Stamme Israel und ein lässlicher Anhänger des Propheten traulich vereint als Hüter kirchlicher Kunst von höchst zweifelhaftem Geschmack!«
»Zum einen leiten wir uns beide vom Hause Abrahams ab, zum zweiten verhält es sich mit dem Christentum wie mit der Kunst, beide leben vom Dogma, nicht etwa vom Glauben!«
Diese Erkenntnis aus dem Munde des Hafsiden war für seinen Freund so erstaunlich, dass er mit offenem Munde stehen blieb. Mafalda reichte ihm vom Tablett mit anzüglicher Gebärde eine der Feigen.
»Nehmt mit dieser Frucht vorlieb. Die im Baum hängt für Euch zu hoch, noch hat sie die rechte Reife.« Sie schlitzte eine Feige mit einem ihrer langen Nägel auf und ließ sie durch den Druck ihrer spitzen Finger aufplatzen.
Fica! dachte Roç, und das mit gelinder Wut. Fica!
Aller Blicke richteten sich nach oben, doch ihre Aufmerksamkeit wurde sogleich von der Potkaxl abgelenkt, die gerade selbst mit einem satten Plumps von Philipps schmerzenden Schultern wie eine reife Feige zu Boden fiel.
Oben hinter der steinernen Wehrmauer war jetzt Bewegung entstanden, die Köpfe der Männer waren verschwunden, aber der baumlange schwarze Herold mit dem Fächer erschien. Er geleitete den munteren Sohn des vielseitigen Gouverneurs, der eine Schar von Gleichaltrigen oder Jüngeren kommandierte, die Körbe und bauchige Steinkrüge auf den Köpfen balancierten und damit hurtig die Stiegen herabsprangen.
»Ah«, schnalzte der Doge befriedigt, »da kommt unser Imbiss!«
»Wenn damit nur nicht die Vorräte dieser armen Leute aufgebraucht sind«, wandte Roç leise ein. »Sicher presst der Gouverneur, dieser quacksalbernde Flickschneider, selbst noch das aus ihnen heraus, was sie sich für den Winter zurückgelegt haben!«
Angesichts der Üppigkeit der Speisen, die aus den Körben quollen, war dieser Gedanke gar nicht so abwegig.
Der dunkelhäutige Krauskopf ließ weiße Linnentücher vor den Gästen der Insel ausbreiten, irdene Becher und Schalen verteilen und packte eigenhändig die Körbe aus, seine Waren dabei laut anpreisend, während der Herold sich darauf beschränkte, dem Herrn Studiosus zuzufächern.
»Wein wurde auf Ustica schon zu Zeiten des Tiberius[42] angebaut und ob seiner Süße sogar dem Kaiser kredenzt«, begann der Gouverneur vollmundig, und der Herold wies auf die Krüge. Die Knaben begannen ziemlich ungelenk mit dem Ausschenken, sodass die Potkaxl und Geraude ihnen zur Hilfe eilten.
»Unser Brot ist einzigartig im gesamten Imperium. Kleie und Gerstenschrot mit Maronen und Rosinen vermengt und mit Sesam und Koriander gewürzt, ein unvergleichliches Backwerk!« Die Körbe mit den Brotfladen gingen herum, und stolz fuhr er fort: »Käse aus der Milch unserer Ziegen, Oliven, eingelegt mit Kräutern der Insel, in Meersalz und von der Sonne gedörrte Sardellen –«
»Sag mal«, schmatzte der Doge in die voller Eifer vorgetragene Laudatio hinein, »wie heißt du eigentlich?«
»Kadr ibn Kefir ad-Din Malik Alhakim Benedictus![43] Ihr könnt mich auch einfach Beni nennen, meine Mitschüler heißen mich ›Beni der Kater‹«, ergänzte er stolz, »weil ich weiß, wo die Mäuse ihr Löchlein haben!« Dabei schaute er die Potkaxl frech an, was diese mit Vergnügen erwiderte. Bevor sie sich gegenseitig auffressen konnten, traf Jordi ein.
»Alles ist bereit. Meister Jakov hat sich überwunden, will aber die Eingriffe samt und sonders persönlich ausführen.«
»Das kann eine Ewigkeit dauern!« begehrte Roç auf.
»Nicht ganz so lang«, entschied der Hafside. »Lassen wir ihn erst mal warten, weil wir uns für das Kommende noch stärken müssen. Setzt Euch zu uns, Herr Studiosus Kadr ibn Kefir ad-Din Malik Alhakim Benedictus – und Ihr, lieber Jordi, goldene Kehle Katalaniens, greift zu Eurem Instrument, und singt uns die Ballade von Roç und Yeza.« Er verneigte sich galant vor der Prinzessin. Sie suchte die Huldigung abzuwehren, was der Hafside aber geflissentlich überging. »El canzo de los enfantes del Grial!« Roç nickte geschmeichelt.
»Viel habe ich das Mittelmeer hinauf und hinunter von den Taten des Königlichen Paares gehört«, erging sich der Sklavenhändler in einer Eloge, »doch keiner soll es so bewegend besingen wir Ihr, Jordi de Marvel y Gandia, Conde de Urgél.«
Der Zwerg war puterrot angelaufen. Doch er ließ nicht erkennen, ob vor Scham, Ärger oder Freude. Es war das erste Mal, dass Roç und Yeza von seiner noblen Herkunft erfuhren! Um sich weitere Peinlichkeiten durch Abdal zu ersparen, griff der Troubadour behänd in die Saiten.
»Grazal dos tenguatz sel infants
greu partenir si fa d’amor
camjatz aquest nox Montsalvatz.
Grass vida tarras cavalliers
coms Roç et belha Yezabel,
oltracudar infants Grazal,
rassa boratz bratz sporosonde,
Roç Τrencavel et Esclarmonde.
Papa di Roma fortz morants
peiz vida los Sion pastor
magieur vencutz mara sobratz.
Byzanz mas branca rocioniers,
coms Roç et belha Yezabel,
oltracudar infants Grazal,
rassa boratz ains sporosonde,
Roç Trencavel et Esclarmonde.
Grazal los venatz mui brocants
desertas tataros furor
vielhs montanhiers monstrar roncatz,
mons veneris corona sobenier,
coms Roç et belha Yezabel,
oltracudar infants Grazal,
rassa boratz mons sporosonde,
Roç Trencavel et Esclarmonde.
Ni sangre reis renhatz glorants
ni dompna valor tratz honor;
amor regisme fortz portatz
uma totz esperansa mier,
coms Roç et belha Yezabel,
oltracudar infants Grazal,
guit glavi ora ricrotonde,
Roç Trencavel et Esclarmonde.«
Der zwischen Kathedrale und königlicher Burg gelegene Palazzo Arcivescovile war wie ein mächtiger normannischer Donjon errichtet, als hätten seine Erbauer schon das spätere Zerwürfnis zwischen dem sich als oberster Lehnsherr begreifenden Papst und der sich schon bald »Könige« nennenden Eroberer vorausgesehen.
»Roms so abgrundtiefen Hass auf die nachfolgenden Staufer kann sich keiner vorgestellt haben«, sagte Johannes von Procida nachdenklich, als er an dem schmalen Fenster hinter den dicken Mauern stand und hinabschaute auf die Stadt, in das Gewimmel der engen Straßen, die sich hinunterwanden zur Cala, von der nur die Mastspitzen der ankernden Schiffe zu sehen waren.
»Und doch ist das der einzige Grund, aus dem ich hier an Eurem Festtag nicht mehr sein kann.« Thomas Bérard, amtierender Großmeister des Tempels, vermied sogar, sich am Fenster zu zeigen. »Es gibt Anlässe zur Provokation der Kurie, die so wesentlich sind, dass wir sie auf uns nehmen. Eine Krönungsfeier gehört nicht dazu, wohl aber die Entwicklung in Griechenland.«
»Der Griff Nikäas nach Kontantinopel treibt Euch um«, stellte der Kanzler fest, »sein Kaiser ist mit den Genuesen verbandelt, also sucht Ihr nach Mitteln und Wegen, wie dies zu verhindern sei, oder nach einem Verbündeten, mit dem Ihr Eurem alten Rivalen zuvorkommen könnt!«
»So mag es Euch scheinen Johannes von Procida.« Der Kanzler stellte fest, welch starke Macht von einem Großmeister des Tempels ausging, selbst wenn dieser nur mit herrischer Geste seinen Gastgeber aufforderte, sich zu setzen.
»Es kommt darauf an, Entscheidungen für den Weg in die Zukunft zu treffen: Soll sich der Orden auf das westliche Mittelmeer beschränken lassen, wenn ihm dereinst die Basis in Palästina entzogen sein wird – wie unseren Freunden vom Hospital[44]?«
Er warf einen prüfenden Blick auf sein Gegenüber, hatte es Sinn, einem vom Leibarzt zum Staatsmann emporgestiegenen Agenten – denn mehr war Johannes in seinen Augen nicht – Vorstellungen einer ganz anderen Dimension näherzubringen, als den Erhalt des Königreiches von Sizilien für den letzten Staufer, einen Bastard? »Jerusalem ist mehr als der Sitz des Großmeisters«, fuhr er leise fort, »es ist die spirituelle Quelle unserer Existenz. Versiegt sie, vergeht auch der Orden. Wir müssen also den Tempel – das, was ihn ausmacht – hinaustragen in die Welt, ohne territoriale Einschränkungen! Wir dürfen niemandem gestatten, Barrieren zu errichten, Monopole oder sonstige Handelsschranken, weder in Ost noch West!«
Johannes reizte es, den visionären Denker aus den Wolken zu holen. »Die Templer über die ganze Welt verteilt, so wie es Euer Gavin Montbard de Béthune im Süden Frankreichs versucht hat?«
»Das war zu klein gedacht und ohne der Realität Rechnung zu tragen –«
»Naja«, sagte der Kanzler, »es war ein ganz schönes Stück Erde, das der Präzeptor da im Auge hatte, groß und wohlhabend genug für die Capets, um grausame Eroberungskriege zu führen. Freisinn und Ketzerei hatten den Boden gedüngt –«
»Genau das! Doch jetzt düngen Blut und Asche Schuldiger und Unschuldiger den reichen Boden der französischen Provinz. Gavins Idee war verbrecherisch!« rügte der Großmeister die Emphase.
»Ihr habt ihn büßen lassen.«
»Büßen?« Der Großmeister lachte. »Büßen kann er jetzt – obgleich ich das bezweifle –, wir haben ihm nur Gelegenheit dazu gegeben, reichlich spät! Der Schaden war schon angerichtet.«
»Mangelnde Aufsicht«, nörgelte der Kanzler, aber nur leise, er wollte den mächtigen Herrn nicht vor den Kopf stoßen, denn er wollte etwas von ihm. Doch der hing mit seinen Gedanken noch dem selbstherrlichen Präzeptor von Rhedae nach.
»Es war und ist keineswegs in der Linie des Tempels, in bestehende Feudalsysteme einzugreifen wie in die Frankreichs, geschweige denn für die Katharer Partei zu ergreifen. Das war immer eher die Herzensangelegenheit unserer Freunde vom Hospital.«
»Was wissen die Johanniter denn vom Gral? Für die ist er nichts als eine Trinkschale!«
»Auch wir verehren das Gefäß, in dem das Blut Christi aufgefangen –«
»Der Montbard de Béthune fühlte sich einem anderen Konzept verpflichtet –?«
»Gavin nährte seit früher Jugend, er war kaum in den Orden aufgenommen, einen Schuldkomplex gegenüber den Anhängern des Gral. Er war es, der dem Trencavel seinerzeit zu Carcassonne als unser Herold freies Geleit zusagte.«
»Ein Wort, das schmählich gebrochen wurde, dem Perceval den Tod brachte und dem Orden nicht gerade Ehre.«
»Wir hätten uns damals durchsetzen können, doch was soll’s! Es war Krieg, und wir standen auf der Seite, die uns vom Papst zugewiesen.«
»Und mit diesem Orden, der sein Fähnchen zugegebenermaßen nach dem Wind hängt, wollt Ihr uns ein Zusammengehen vorschlagen?«
Der Großmeister sprang nicht etwa zornbebend auf. »Der Wind weht, wie er will«, flüsterte er, »er verweht die Spuren der Ungerechtigkeit, er bläht die Segel zu neuen Abenteuern, er vermag blitzschnell zum vernichtenden Sturm umzuschlagen.« Hatte er dabei noch durch seinen Gesprächspartner hindurchgeschaut, ging er ihn jetzt direkt an: »Als Vertreter eines von der Kirche verdammten und gebannten Hauses führt Ihr eine kühne Sprache. Seht Ihr die Gefahren nicht, die Eurem Herrn Manfred drohen?«
»Was habt Ihr vorzuschlagen?« entgegnete Johannes kühl.
»Ein Bündnis zur Eroberung von Konstantinopel, dem auch Venedig beitreten würde, die Landgewinne hälftig geteilt –«
»Wie? Venedig die Hälfte, und wir teilen uns den Rest?«
»O nein! Sizilien sei der Anteil des Löwen gegönnt, uns reichen die Niederlassungsrechte.«
»Wie gütig! Faustgroße Läuse im Pelz des Königs!« Johannes bemühte sich, durch heiteren Sarkasmus das Gewicht seiner kaum verbrämten Absage zu mindern. Doch die nicht offen erklärte Feindseligkeit kroch in den Adern der Männer hoch wie das Gift nach dem Biss einer Viper, ihr Schatten hockte sich auf die dunklen Eichenmöbel des düsteren Refektoriums, strich über die lange Tafel, die Kerzen in ihren eisernen Haltern an den Wänden flackerten. Der Kanzler musste es zu Ende bringen.
»Und was sonst noch?«
»Das Recht des Tempels, sein Hauptquartier nach Sizilien zu verlegen und seine Flotte auf dieser Insel zu stationieren.«
Jetzt war die Katze aus dem Sack, fauchend und mit gespreizten Krallen.
Johannes zeigte sein Erschrecken nicht. »Ich werde mit dem König über Euer Angebot reden«, sagte er mit trockenem Mund. Es klopfte an der Tür.
»Der Herr Sigbert von Öxfeld!«, meldete die Wache. »Komtur des deutschen Ritterordens!«