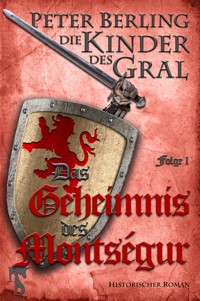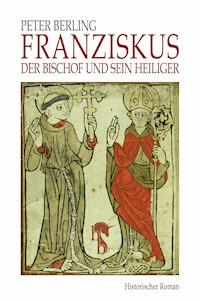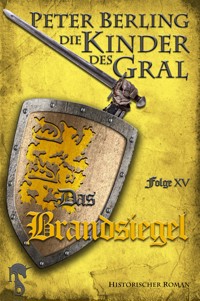3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Am Montségur findet ein Turnier statt, Roç und Yeza nehmen neben Rittern aus aller Herren Länder heimlich an den Waffengängen teil. Doch bald schon artet der Wettkampf in Mord und Totschlag aus. Nur das Eingreifen des Papstes, des französischen Königs und der Bruderschaft des Grals verhindert Schlimmeres. Die Templer werden entmachtet, doch ihr Schatz ist verschwunden. Die Gralskinder werden verdächtigt, mehr über seinen Verbleib zu wissen. Als ihnen die Grande Maîtresse der Gralsbruderschaft das Angebot unterbreitet, den verwaisten Thron des Königreichs von Jerusalem zu besteigen, wissen Roç und Yeza, dass ein uralter Plan vor dem Abschluss steht. Doch auch das Angebot aus dem fernen Reich des Großkhans, sich erneut unter seinem Schutz zu begeben, steht noch. Und gegen die Besteigung des Throns in Jerusalem stehen eine Unzahl an erbitterten Gegnern der »Königlichen Kinder«: sämtliche Kirchen, die sich auf Christus berufen, das Kaiserreich Byzanz, das Judentum und schließlich alle Glaubensrichtung innerhalb des Islam. Niemand aus diesen Reihen möchte Roç und Yeza auf dem Thron des Tempelbergs sehen … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil XII fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PETER BERLING
Ein blutig Hauen und Stechen
Folge XII des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE XI
Das Geheimnis der Templer
Roç und Yeza in Rennes-le-Chateau? Aus der fernen Mongolei zu den Templern in Okzitanien? Das ehemalige Katharerland, in dem nur noch ›faidits‹ den Widerstand gegen die französischen Eroberer wachhalten, erscheint dem Orden wie geschaffen, hier einen eigenen Staat zu errichten. Was legitimiert einen derartigen Akt des Umsturzes mehr als das ›Königliche Paar‹ an der Spitze eines solchen Gebildes?
Die Kinder sind des Beistandes ihres Hüters William von Roebruk beraubt, den die Mongolen weiter mit sich schleppen, als sie jetzt, nach der brutalen Vernichtung der Assassinen von Alamut, gegen das Kalifat von Bagdad ziehen.
Weder die Krone von Paris noch die Kirche Roms sind bereit, die hochverräterischen Pläne der Templer hinzunehmen, die sich damit auch über den Willen der hinter ihnen stehenden Macht, jener geheimen Bruderschaft, hinwegsetzen. Ein Freizügigkeit, wenn nicht Freiheit versprechendes ›Carnevale‹ lockt die ›faidits‹ Okzitaniens aus ihren Untergrundverstecken, die Franzosen stellen die Häscher, das Inquisitionstribunal die Büttel und Henker: Die Scheiterhaufen lodern! Roç und Yeza können nicht verhindern, dass viele ihrer Freunde verbrannt werden, und die ehrgeizigen Templer begreifen nicht, dass der Schlag auch als Warnung gegen sie gerichtet ist.
Eine hochrangige mongolische Delegation hat die weite Reise unternommen, um die Kinder zur Rückkehr aufzufordern. Nach dem grausamen Auslöschen des Kalifats von Bagdad sehen sich die siegreichen Mongolen jetzt in der Lage, dem ›Königlichen Paar‹ die Alleinherrschaft über den ›Rest der Welt‹ anzudienen. Angewidert von den Zuständen im christlichen Abendland ebenso wie vom verrotteten muslimischen Morgenland, erklären Roç und Yeza sich bereit, das Angebot zu überdenken …
I BLINDE EITELKEIT
Girlanden und Damenflor
Der Frühling war ins Land gezogen, das Languedoc und das Roussillon standen im zarten Grün, die Kirschbäume in voller Blüte. Darüber wölbte sich der azurblaue, wolkenlose Himmel. Die fernen Spitzen der Pyrenäen waren noch schneegekrönt, die näheren Berge ragten schroff in grauem Granit aus den dunklen Wäldern, doch der Pog, der schönste von allen, trug, einem Kleinod gleich, auf der ausgestreckten Hand die Mauern des Montségur. Wie eine geöffnete Frauenhand, zur Sonne anbetend erhoben, mochte er allen erscheinen, denen er Freund und Tröster war, wie eine geballte Faust jenen, die zu seinen erbitterten Gegnern zählten.
Die drei Ritter, die ihre Rüstungen abgelegt hatten, sahen ihr Ziel schon von Weitem. Die am Sattelknauf hängenden Schilde und die aufgeschnallten Helme samt Zimier[1] wiesen sie als Söhne jenes Adels aus, der nicht seit alters her in Okzitanien beheimatet war, sondern den es als Eroberer aus dem Norden Frankreichs hierher verschlagen hatte. Und doch fühlten die jungen Burschen sich zu Hause, wieder zu Hause, denn sie kehrten nach Verbüßung ihrer Strafe auf einer Templergaleere heim.
Angeführt wurden sie von Raoul de Belgrave, einem blonden Recken, der sich seiner einnehmenden Wirkung, auch auf Frauen, gewiss war. Er stammte aus altem Normannengeschlecht und führte den Geißbock als Helmzier, und der chevron[2] wiederholte sich samt drei Silberrauten als Hermelinsparren auf rotem Grund im Wappen.
Mas de Morency, der zweite im Bunde, war schon früh ein Waisenknabe, eine bittere Erfahrung, die sich sichtbar in wölfischen Zügen, stets lauernder Haltung und misstrauischer Verschlossenheit niedergeschlagen hatte.
Der dritte war Pons de Levis, der dickliche Sohn des regierenden Grafen von Mirepoix, ein stämmiger, ungeschlachter Kerl, halb anhänglicher Tollpatsch, halb grausamer Blödel.
Das Jahr als Rudersklaven unter der strengen Fuchtel des Taxiarchos hatte sie alle drei nicht zu besseren Menschen gemacht, nur verschlagener.
»Ich seh’ dich noch als Wikinger auf Grünland[3], Mas!« Wenn Raoul lachte, zeigte er sein weißes Raubtiergebiss. »Wie der Eisbär dich jagte und die Robbenmutter dich rettete, als du von der Eisscholle ins Wasser fielst.«
»Das war ein eifersüchtiges Walross«, gab der Morency heraus, »und dich schleppten diese Eismongolen in ihren Iglu, damit du ihre in Tran gewälzten Ehefrauen beglücktest, was du ja auch mit Eifer betrieben hast wie ein Schlittenhund!«
»Mit Recht!« verteidigte Pons seinen Anführer. »Danach gab’s nicht einmal mehr eine Elchkuh, bis wir endlich in der Biskaya wieder Land unter die Füße, aber noch längst keine Möse unter den Schlegel bekamen. Doch am Montségur, auf dem Turnier, da werden endlich richtige Weiber sein; für dich, Raoul, sicher jede Menge!« Ein Sehnsuchtsseufzer entrang sich der Brust des kleinen Pons, der als letzter ritt und sich auch gleich wieder der Hackordnung fügte. Der erste und beste Bissen gebührte dem bewunderten Belgrave, dem stärksten und schönsten von ihnen, dem alles einfach nur so zufiel.
»Diesmal wird dir die Herrin des Stechens nicht ihr schönes Gesäß weisen, Pons. Es ist die ehrbare Dame, aus deren Hand du die Siegeskrone empfangen wirst«, stichelte Mas de Morency, »falls du nicht beim ersten Stoß aus dem Sattel auf den Hintern fällst!«
»Hauptsache, sie bricht mir nicht wieder den Arm!« maulte der Gehänselte.
Raoul kam ihm zu Hilfe.
»Wenn ich Mas wäre, würde ich meine Hand verstecken, wenn wir Ihr vorgestellt werden.«
»Und sollten uns unsere Helme vom Herold des Königlichen Paares nicht schon vor Betreten des Turnierplatzes wieder vor die Füße geworfen werden«, dämpfte Mas de Morency die Zuversicht des Anführers, »dann wird die Dame Yeza – so sie uns wiedererkennt – uns sicher nicht gegen ihren Ritter Roç antreten lassen, schon aus Angst, wie könnten ihm den Stößel stauchen oder das Blech verbeulen!«
»Wenn ein junges Weib drei Burschen wie uns abhängt wie gestochene Ferkel an die Haken, dann kannst du davon ausgehen, dass ihr Herr sehr wohl weiß, wie man Hieb und Stich austeilt. Der Penikrat hat mir von ganz anderen Taten dieses Roç Trencavel berichtet: Allein und nur zu seiner Freude ist er stets gegen eine Zehnerschaft mongolischer Krieger angetreten, nur mit einer Bambusstange bewaffnet.«
»Na und?« Mas hörte das nicht gern.
»Er sprang über sie hinweg und trat sie in den Hintern.«
»Und dann?« Pons war neugierig.
»Als sie sich umdrehten, saß er längst im nächsten Baum. Sie schossen mit Pfeilen auf ihn, aber keiner traf.«
»Die konnten wohl nicht so gut zielen wie die kleine Hexe, die dich nagelte«, nörgelte Mas.
»O doch!« Raoul lachte. »Aber ich verrat’ dir nicht, wie dieser Roç es fertigbringt, dein Schwert zu zerbrechen, als sei es aus Holz. Und er schlägt dir mit der bloßen Hand auf deinen behelmten, aber törichten Schädel, dass dir die Tränen in die Augen schießen!«
»Mir? Nie!«
»Gut oder schlecht, wenn du nicht weinen kannst, dann ist der Schmerz noch heftiger, Mas«, entgegnete Pons.
»Das werden wir sehen!« kläffte Mas, lustlos, den Streit fortzuführen.
»Statt uns zu hacken«, forderte Raoul, »sollten wir lieber überlegen, wie wir vorgehen, wenn wir nicht wie begossene Rüden mit eingezogenem Schwanz fortgeschickt werden wollen. Ich will in die Schranken reiten, das ist meine Lust!«
»Der edle Ritter!« höhnte Mas. »Hast ja auch dem Taxiarchos dein Ehrenwort gegeben, dass wir nach diesem Abstecher –«
»Ein Turnier ist kein Abstecher, sondern ein ehrenvolles Eintreten –«
»Ich meine, du hast versprochen, dass wir uns ›nach diesem Umweg‹ brav und folgsam wie die Novizen bei den Templern in Rhedae einfinden und uns gnädigst von unseren Sünden lossprechen lassen.«
»Ja«, sagte Raoul ganz ruhig. »Passt dir das nicht, Mas?«
»Ich denke doch nicht daran!«, bellte der. »Bei Präzeptor Gavin zu Kreuze kriechen –«
Er kam nicht weiter, denn Raoul langte zu ihm hinüber, griff mit der einen Hand an Mas’ Eier, packte ihn mit der anderen am Kragen, hob ihn hoch und setzte ihn neben sein Pferd. Er hatte ihn einfach fallen lassen.
»Wenn ich mein Wort gebe«, sagte er laut, »dann wird das von uns dreien gehalten, nicht wahr, Pons? Oder wir sind nur noch zu zweit!«
Der Angesprochene nickte heftig, während Mas sich die Erde von den Hosen klopfte.
»Ist schon recht, Raoul!«, erklärte er vernehmlich, worauf Pons ihm die Zügel seines Tieres zuwarf, damit er wieder aufsteigen konnte.
»Also«, fuhr Raoul fort, »wir wollen doch nicht umsonst unsere Rüstungen geputzt, die Pferde und die Schabracken[4] hergerichtet und diesen weiten Ritt gemacht haben. Als wir vor dem Gericht der Templer standen, hat das Königliche Paar uns verziehen.«
»Seiner Gnade verdanken wir, dass wir noch unsere Köpfe auf den Schultern haben!«, rief Pons und wandte sich gegen Mas. »Auch du den deinen!«
»Streitet jetzt nicht!« mahnte Raoul. »Und du, Pons, hast damals versprochen, solche ›Gunst‹ eines Tages ›dienend zu erstatten‹. Dem wurde nicht widersprochen. Also kommen wir nun und treten in den Dienst! Wie findest du das, Mas?«
»Grandios!«, rief statt seiner Pons. »Raoul, du bist der Größte!«
»Und Pons ist ein Herkules an Weitsicht! Ich bin von Genies umgeben! So knie ich also nieder vor dem Ritter Roç und der Dame Yeza und sage: ›Nehmt mich, armes Waisenkind, Mas de Morency, Pflegesohn des ehrenwerten Grafen Lautrec und seiner anmutigen wie feinsinnigen und zarten, lieben, edlen Frau Esterei[5], als Euren untertänigsten Diener!‹?«
»So ist es richtig«, erwiderte Raoul, »nur verkneif dir den Schwanz an Brunftgeschrei aus Zuneigung zu deiner Ziehmutter!«
»Zuneigung?« fauchte Mas. »Ich verzehre mich in ihrer Anbetung, ich wichse mit ihrem Bild vor den Augen, ich brenne vor Leidenschaft!«
»Gewiss, aber du stellst sie bloß, wenn du dich zu solchem Lob ihrer Tugenden hinreißen lässt.«
»Du hast ja recht, immer hast du recht, Raoul!«, sagte Mas de Morency gepresst. »Ich tröst’ mich mit Huren!«
»Die werden wir am Montségur kaum finden«, sagte Pons traurig. »Ich hätt’ viel lieber einen knackigen Weiberarsch zwischen den Schenkeln, als mit diesem Ross auf lange Lanzen zu galoppieren –«
»Bei dir währt’s eh nur kurz«, tröstete ihn Mas. »Und dann hast du tagelang kein Verlangen mehr nach Mösenstoßen –«
»Ich kann es kaum erwarten!«, rief Raoul. »Lasst uns schneller reiten, sonst kommen wir noch zu spät!« Er preschte los, dass seine Gefährten Mühe hatten zu folgen.
Auf der grünen Wiese, in die der Camp des Crémats flach auslief, war eine hölzerne, in der Mitte überdachte Tribüne aufgeschlagen, mit der Rückseite zum Montségur. Yeza hatte die Burg zwar im Auge behalten wollen, aber in Anbetracht der Familien, denen der Scheiteracker noch wie ein Pfahl im katharischen Gemüte stak, hatte sie mit Feingefühl darauf verzichtet.
»Die Damen sollen ja auch nicht vom Stechen abgelenkt werden«, hatte Rinat ihr die Sache schmackhaft gemacht. »Und wer von den Rittern zu Euch herübergrüßt, dem wird ein unvergleichliches Bild geboten: Der ungekrönten Herrin des Pog schwebt die Gralsburg als Krone über dem edlen Haupt!«
»So will ich dann von Euch gemalt werden!« rief Yeza. »Im Vordergrund bitte noch zwei aufeinander zusprengende Ritter, die Lanzen eingelegt, die Schilde aller edlen Teilnehmer am Bildrand, Jordi mit Laute zu meinen Füßen, und von oben stößt eine Taube herab mit einem Zweiglein im Schnabel.«
»Nein, vor Euch kniet Herr Roç Trencavel und empfängt aus Eurer Hand den blumengewirkten Siegerkranz.«
Rinat verneigte sich. Er war mit der Ausgestaltung der Festwiese und der Damentribüne beauftragt worden und hatte alle Hände voll zu tun.
Rechts und links in einigem Abstand seitlich versetzt, waren jeweils die Fahnenständer aufgebaut, wo die Herren ihr Banner, so sie eines hatten, je nach Zugehörigkeit zu einer der beiden sich befehdenden Parteien einstecken konnten. Zur Rechten flatterten bereits die rotgelben Streifen, einmal drei, einmal vier für die Grafschaften Foix und Roussillon, sowie das Schlüsselkreuz der Tolosaner, gelb auf rotem Grund. Der Einzige, der seine Fahne schon dazugegeben hatte, war Roç. Um sein Wappen hatte es einigen Streit beim Königlichen Paar gegeben. Roç bestand auf den Farben der Trencavel, aber Yeza wies darauf hin, dass diese längst vom französischen Seneschall für Carcassonne vereinnahmt waren. Yeza schlug ihm das tolosanische Kreuz vor, verbunden mit der Lilie der Prieuré von Sion, so wie sie es beide in ihren Ringen trugen. Aber Roç wollte nach den schlimmen Erfahrungen mit den Einrichtungen der Kirche Roms, mit der Inquisition und auch den Templern, auf keinen Fall im Zeichen eines Kreuzes antreten.
»Und bei der Lilie, da denkt jeder an Frankreich!«
Yeza bot ihm in Erinnerung an seine Mutter, die er nicht gekannt hatte, die drei Geparden der Staufer an, schließlich sogar den schwarzen Reichsadler des Kaisers. Aber all das machte ihren Trencavel nicht glücklich.
Schließlich schlug Jordi vor, auch das Problem der Heraldik[6] dem Rinat aufzubürden. Der hatte dann den Bordrand rot umfasst und in gleicher Breite diagonal geteilt, bande de gueules[7], wie er es nannte, und auf dem »goldenen« Grund – er war schlicht gelb! – hatte er oben den schwarzen Adler und unten die Geparden platziert. En terrasse[8] brachte er auch noch die katalanischen roten Streifen, die pals, unter. Das Ensemble wirkte sehr gewichtig, und Roç war es zufrieden.
Zur linken Hand sollten die Franken sich einfinden, aber noch war kein Vertreter Frankreichs erschienen. Und niemand hatte daran gedacht, wenigstens eine einladende Oriflamma zu besorgen. Der Kübel gähnte leer, sodass der Graf von Mirepoix zähneknirschend einen Knappen losschickte und die Trois chevronnels[9], seinen fast fernöstlich anmutenden Stander, aufpflanzen ließ.
Jourdain de Levis war mit großem Familienaufgebot erschienen. Das Turnier bot dem alten Grafen Gelegenheit, seine Schwester und seine älteste Tochter Melisende[10] wiederzusehen. Sein Eidam Burt de Comminges war schon von Weitem erkennbar an dem roten Tatzenkreuz[11] auf weißem Grund, das in der Form dem der Deutschen ähnelte. Das wuchtige Emblem entsprach Burts Charakter, der keiner Schlägerei aus dem Wege ging und lieber zu Kampfspielen wie diesem unterwegs war, als dass er sich um sein scheues Weib auf der Stammburg kümmerte. Melisende schien dort wie eine weiße Lilie einsam dahinzuwelken. Dafür war der Graf von Comminges dem Mirepoix ein verlässlicher Gesell. Die jüngste Schwester, Esterei de Levis, war mit Gaston de Lautrec verheiratet, ein stiller Mann, der dem derben Ritterleben zwischen Fehden, Hatz und Stechen wenig abgewinnen mochte. Es hieß, er lese und könne auch schreiben. Die ruhige Ehe der beiden war kinderlos geblieben. Deshalb hatte Gaston den verwaisten Mas de Morency aufgenommen und sich auf das Unterfangen eingelassen, dem Knaben eine Erziehung angedeihen zu lassen. Der Versuch war gründlich fehlgeschlagen, er verstand sich mit dem aufsässigen Mas überhaupt nicht. Nur bei seiner Frau Esterei, einer reifen Schönheit voll von Vitalität und sprühendem Witz, schmolz die bockige Feindseligkeit des verschlagenen Mas wie Butter, und er wurde sanft wie ein Lamm, was sie gar nicht verlangte.
»Er bewundert dich so sehr, meine Teure«, hatte ihr Gaston erklärt, »dass es ihm nicht nur die Boshaftigkeit austreibt, sondern auch die vulgäre Sprache verschlägt.«
»Das Traurige ist, Mas kann nicht lachen«, vertraute ihm seine Frau an, »sosehr ich auch mit ihm scherze!«
Ihre Nichte Mafalda[12], des Jourdain jüngste und völlig verzogene Tochter, hatte dies Gespräch zwischen den Eheleuten gehört.
»Sie sollte einfach mal mit ihm schlafen!« gab sie ihre Überzeugung an ihre Schwester Melisende weiter, die darob einen roten Kopf bekam, was Mafalda auch bezweckt hatte.
Mafalda war Gers d’Alion[13] versprochen, einem dunkellockigen Knaben, der ihr ungestümes Begehren erstaunlicherweise zu befriedigen verstand. Das war nicht eben wenig, denn Mafalda war ebenso stattlich wie sinnlich. Doch Gers gelang es, sie wahnsinnig zu machen, unersättlich in ihrem Verlangen nach seinem Körper, nur seinem allein. Ihr stellten viele Männer nach, aber sie ließ sie stolz und satt abblitzen. Sie hielt das für Liebe.
Vielleicht war es die tiefe Gleichgültigkeit des Gers d’Alion gegenüber dem weiblichen Geschlecht, die ihn so anziehend machte.
Seine Zuneigung galt ganz klar seinem Vetter Simon de Cadet. Gers war ein trefflicher Ritter, sicher in Hieb und Stich, doch auch das nur, weil Kriegsspiel und Kampf dem Simon so sehr gefielen. Beide waren sie Neffen des Levis, der sie gern um sich hatte. Da der Graf keine weitere Tochter hatte, die er dem Simon hätte geben können, riet er ihm, auch in Anbetracht seiner Neigungen, zu den Templern zu gehen. Jourdain de Levis betrachtete die Männerfreundschaft seiner Neffen als eine stete Bedrohung der zukünftigen Ehe Mafaldas. Das Mädchen war sein Augapfel, und er ließ der frühreifen Wildkatze auch durchgehen – gefragt hatte sie ihren Vater eh nicht –, ihrer Leidenschaft für Gers d’Alion vorehelich und hemmungslos zu frönen. Doch Mafalda und Simon waren einander zugetan, schon in ihrer Liebe zu Gers. Er bewunderte ihre strotzende Weiblichkeit, ohne ihren Körper zu begehren, und Mafalda nahm ihn als angenehmen Bewunderer und stillen Verehrer, auf den ihr Gers nicht einmal eifersüchtig war. So sah der bedächtige Simon keinerlei Grund, das stimulierende Dreiecksverhältnis zu verlassen und sich den muffigen Templern anzuschließen.
Yeza empfing auf der Tribüne die Damen. Die heitere Esterei hatte sie sofort in ihr Herz geschlossen und an ihren Busen gedrückt. Melisende hielt sich scheu zurück. Vielleicht neidete sie der jüngeren Yeza Elan und Umsicht, war eingeschüchtert von ihrer Schlagfertigkeit, verschreckt ob des kämpferischen Naturells, alles Eigenschaften, mit denen sie nicht ausgestattet war. Dafür hielt sie sich für fraulicher.»
Darf ich Euch meine ältere Schwester Melisende vorstellen? Ein Ausbund von Tugend!« Damit schob Mafalda die Zögernde vor. Das gab ihr die Möglichkeit, die nahezu gleichaltrige Yeza in Augenschein zu nehmen. Die Dame Yeza lebte bekanntermaßen in morganatischer Ehe mit ihrem Roç, und das seit Jahren. Doch machte sie davon kein Aufhebens, weder turtelte sie mit ihrem Galan herum, noch gab es Szenen der Eifersucht und wilde Versöhnung, all die Kräche, ohne die sich Mafalda die wahre Liebe nicht vorstellen konnte. Alles, was diese Gralsprinzessin tat, schien einfach und selbstverständlich, und ihr Verhältnis zu ihrem Herrn Roç schien von so viel sichtbarem Vertrauen und stillem Einverständnis und dazu von einer ganz starken Liebe geprägt, dass Mafalda ganz neidisch wurde. Dazu kam die unbefangene Art, mit der Yeza auch mit anderen, älteren oder jüngeren, Männern umging. Die konnte denken wie ein Mann. Und Mafalda spürte, dass Yeza sie als pez de fica[14] ansah, ansehen musste, weil sie, Mafalda, ja wirklich nichts anderes war als Arsch, Titten und dazwischen ein nasses Loch. Mafalda hasste Yeza wegen ihres Kopfes. Die hatte eben nicht nur schönes blondes Haar, sondern darunter noch Hirn und wusste damit umzugehen, und zwar mit einer so leichten Würde, dass keinem Mann der Respekt, den er ihr unwillkürlich zollen musste, als Last erschien.
Mafalda hatte kastanienrotes Haar, dunkle, feurige Augen und war im Gegensatz zu Yeza mit einem üppigen Busen ausgestattet, und die dürre Prinzessin hatte grad mal einen Ansatz dazu. Das musste als Trost herhalten, Gers d’Alion würde auf die nicht fliegen! Doch gerade jetzt musste sie sehen, wie ihr Liebster und auch Simon, der Verräter, völlig unbefangen mit Yeza lachten und scherzten und selbst deren Zofe mit einbezogen! Eine Prinzessin der Tolteken sollte die sein, der Name war unaussprechlich. Die Kleine hatte eine Nase, mit der ein Streiter als Axt ins Feld hätte ziehen können. Doch die Kakpotzl schämte sich dieses Adlerschnabels keineswegs, sondern plapperte fröhlich mit den Kerlen, und ihre Herrin verbot ihr nicht einmal den Mund.
Rinat hatte die Schranken inspiziert, eine doppelte Bande aus geschälten Stämmen in Höhe der Kruppe, die den Reitenden als Richtschnur und Barriere diente. Wenn man geschickt war, konnte man den Gegner darin so abdrängen, dass sein Spielraum eingeschränkt und er dem Stoß nicht mehr auszuweichen vermochte. Ebenso war dieser Zaun auf der einen Seite als Sicherheitsabstand zur Tribüne gedacht, damit kein Kämpfer in voller Rüstung zwischen die Frauen krachte, wenn er vom Pferd flog.
In der Mitte des Turnierfeldes, genau gegenüber der überdachten Ehrenloge, hatte der Zeremonienmeister ein Podest aufgestellt. Hier wurden die Lanzen in einer Reihe in Haltern senkrecht aufgestellt. Wenn die Parteien feststanden, dann ritten die Gegner rechts und links um die Schranken herum dorthin, trafen ihre Wahl, griffen sich die Lanzen oder ließen sie sich von Pagen reichen und begaben sich zu ihrem Fahnenstand, dem Ausgangspunkt ihres Ritts. Soweit war alles fertig und bereit, nur der Gegner fehlte. Jourdain de Levis konnte schließlich schlecht allein für Frankreich reiten.
Wolf von Foix, der alte Freund des Mirepoix und der Einzige, dessen Sippe keineswegs als Eroberer ins Land gekommen war, hatte deshalb vorgeschlagen, auch Gaston und Burt sollten ruhig unter die Oriflamma treten; er wolle es wohl »für ein freies Okzitanien!« mit allen aufnehmen.
Wolf von Foix hatte gut reden. Er lebte als Faidit ständig auf der Flucht und schlug sich täglich mit seinen Verfolgern. Er war bereits Legende geworden, und dass er noch in Fleisch und Blut hier auftreten konnte, verdankte er seiner unerschöpflichen Kampfkraft, seiner Schnelligkeit und nicht zuletzt seinem Freund Jourdain, der ihn schützte, wo er nur konnte.
Die Grafen von Foix waren sowohl mit denen von Toulouse versippt als auch mit den Trencavels von Carcassonne. Die Vicomtes von Mirepoix waren einst ihre Vasallen gewesen, aber das alles spielte keine Rolle mehr. Wolf von Foix weilte seit Jahren als Gast auf der Burg von Mirepoix, wenn er nicht ruhelos das Land durchstreifte, das einst seinen Vorvätern gehört hatte.
»Nein«, entschied Jourdain, »das Vergnügen bereiten wir Euch nicht: Der einsame Wolf reißt drei, vier, fünf fränkische Lämmer – das würde Euch endgültig zum Mythos erheben wie den Perceval!«
»Also, Lämmer ist auch übertrieben.« Der Foix lachte. »Ich will nicht sagen Hammel, aber Widder, ordentlich gehörnte, die könnt’ ich unter Euch schon finden!«
»Er will uns nur herausfordern.« Burt grinste. »Ich will lieber als Hammel geschlachtet werden denn als Gehörnter!«
»Wer die Sittsamkeit zum Weibe hat, der kann sich leicht den Aries[15] zum Zeichen wählen, steht ihm doch Mars im Stechen zur Seite«, sagte Gaston bedächtig. »Ich bin schon ein alter Steinbock, mir würde ein Stoß unseres Freundes alle Rippen brechen!«
»Na gut«, knurrte der Wolf und lachte. »Dann warten wir eben auf die echten Franken, die der Seneschall uns schicken wird!«
Und sie gingen wieder zu den Frauen, um ihnen die Zeit zu vertreiben.
Die Girlanden auf der Tribüne, die einsamen Fähnlein in den Flaggenständen, die farbigen Bänder, mit denen die Schranken festlich umwickelt waren, die blütengleichen Seidentücher der edlen Damen unter dem Dach und die bunten Kleider der Frauen aus der Umgebung, die auf den Bänken unter freiem Himmel saßen, alles flatterte erwartungsvoll in der Frühlingsbrise, die vom Pog herabstrich.
Die Wahl der Farben
Die Sonne stieg höher, mit ihren warmen Strahlen spielte der Wind, der noch kühl von den schneebedeckten Gipfeln der Pyrenäen herabwehte, die Blüten zauste und um die Gesichter der Männer strich, die seit dem frühen Morgen warteten. Es waren Soldaten, die Gilles Le Brun, der Konnetabel von Frankreich, herbeigeordert hatte, weil er dem alten Seneschall von Carcassonne und dessen Mannen nicht traute.
Pier de Voisins war schlicht überfordert mit der Aufgabe, das Turnier vom Montségur als große Falle für herbeiströmende Faidits anzulegen. So hatte Gilles es übernommen, um den Pog einen stählernen Ring zu legen, damit ein jeder kampfeslustig hinein – und keiner unangefochten wieder hinaustraben konnte. Doch wie schon einst die Belagerer des Montségur mit einem weitaus größeren Heer daran verzweifelten, diesen verfluchten Berg abzuriegeln, sah sich auch der Konnetabel schnell zum Scheitern verurteilt. Zu wild geklüftet war die bewaldete Umgebung mit ihren felsigen Schluchten und reißenden Bächen in tiefer Klamm. So beschränkten sich die beiden ungleichen Befehlshaber darauf, nur an den ihnen bekannten Zugängen und erkennbaren Wegen Straßensperren vorzubereiten, in aller Heimlichkeit, denn niemand sollte gleich wieder umdrehen oder Mittel und Pfade finden, sich dem Zugriff zu entziehen.
Der Anreiz, zum Gelingen des Unternehmens beizutragen, war bei beiden Männern äußerst ungleich. Gilles Le Brun vertrat die Krone Frankreichs an allen Fronten, im ständigen Krieg mit England, von Bordeaux bis Cherbourg, bei Aufständen der Bretonen oder Flamen bis hin zu den lästigen Reibereien mit dem mächtigen Nachbarn im Osten und im Süden, wo dem Deutschen Reich seit Langem die starke Hand eines Kaisers fehlte. So war das Languedoc für ihn völlig unbedeutend und zudem ein Kriegsschauplatz, der eigentlich keiner sein durfte, hatte Frankreich doch das eroberte Ketzerland dem königlichen Bruder Alphonse von Poitou übergeben. Der hatte sogar Johanna, die letzte Erbin von Toulouse, geehelicht, doch befriedet hatte er die Region nicht. Er saß im fernen Poitiers, und ein Erbe war ihm versagt geblieben. Gilles Le Brun kannte sich mit den okzitanischen Verhältnissen nicht aus und hatte auch nicht vor, das zu ändern. Sein Untergebener, der Seneschall von Carcassonne, hingegen war schon zum zweiten Mal hierhergeschickt worden, obwohl er sich schon in seiner ersten Amtszeit zu schnell angepasst hatte, was der Konnetabel, der für hartes Durchgreifen war, als falsche Rücksicht und Laschheit zieh. Damit hatte er wohl recht, doch ob seine Methoden hier Erfolge zeitigen würden, musste Herr Gilles erst einmal beweisen. Danach konnte er auf Ablösung des zu nachgiebigen Pier de Voisins drängen.
Bei den Herren stand Oliver von Termes, den der Konnetabel im Grunde seines rauen Herzens verachtete, denn Oliver war und blieb für ihn ein Überläufer, dem er grundsätzlich nicht traute. Doch war der wieder eingesetzte Herr von Termes bis jetzt der Einzige, der sich hier eingefunden hatte, um für die Farben Frankreichs in die Schranken zu reiten. Gilles Le Brun sah mit Zorn, wie der schon die heilige Oriflamma, »sein« Kriegsbanner, zur Hand genommen hatte, um es auf den Turnierplatz zu pflanzen. Da wäre er schon lieber selbst dort erschienen, um die Ehre der Krone zu verteidigen, doch das war nicht seine Aufgabe.
»Wo bleiben denn Eure Ritter?« ging er schlecht gelaunt seinen Seneschall an. »Verkriechen sich die edlen Herren, wenn es gilt, für den König einzutreten, aus dessen Hand sie ihr Lehen empfingen?«
»Es sind die Herren, von deren Einstellung ich Euch schon berichtet«, entgegnete resigniert Pier de Voisins und zwirbelte seinen traurigen Seehundsbart. »Ihr wolltet es ja nicht glauben, aber sie pfeifen auf Paris.«
»Das will ich ihnen austreiben!« Der Konnetabel stampfte auf.
»Dazu müssten sie Euch zuvor die Reverenz erweisen«, spottete Oliver, der den eingebildeten Nordfranken auch nicht leiden konnte. »Wenn sie überhaupt hier zum Stechen erscheinen, dann nicht über den Weg, an dem Ihr Euch aufgestellt habt. Vielleicht sind sie längst auf der Wiese?«
Das ärgerte den Konnetabel noch mehr.
»Wenigstens wird einer aus Paris kommen«, trumpfte er auf, »der sie alle mores lehren wird.« Er schwieg, weil er schon zuviel gesagt hatte.
Aber Oliver war neugierig und vor allem ungläubig. »Wer soll das schon sein?!« reizte er den obersten Kriegsherrn Frankreichs, und das mit Erfolg.
»Der Schwarze Ritter!« Der Seneschall sah sich veranlasst, den Schleier des Geheimnisses ein wenig zu lüften. »Paris hat sein Kommen angekündigt. Wir wissen auch nicht« – er warf dem Konnetabel misstrauisch einen fragenden Blick zu, dem dieser aber auswich –, »wer es sein wird.«
Pier Le Voisins war gerade der berechtigte Verdacht gekommen, dass Gilles sehr wohl wissen könnte, wer dahintersteckte, wenn er es nicht sogar selbst war, der eine solche Inszenierung bestellt hatte.
»›Der Schwarze Ritter‹?« spöttelte Oliver, als hätte er das Gleiche gedacht. »Das klingt nicht nach einem Helden auf der Suche nach Abenteuer, sondern riecht eher nach finsterem Komplott.«
»Wer auch immer es sein mag, mein lieber Oliver«, antwortete Pier de Voisins, weil sich der Konnetabel immer noch in abweisendes Schweigen hüllte, »wir sind angehalten, weder nach seinem Begehr zu fragen noch seine Identität zu lüften und vor allem, ihm keinen Stein in den Weg zu legen.«
»Die Anordnung lautet«, fuhr ihm Gilles Le Brun dazwischen, »alles zu unternehmen, was die Aufgabe des Unbekannten erleichtert!« Er blickte streng zu Oliver. »Ich erwarte auch von Euch, dass Ihr seinen wie auch immer gearteten Wünschen ohne Widerrede nachkommt!«
»Wird der seltsame Herr denn mit mir sprechen?«, fragte Oliver erstaunt. »Ich könnte ihn doch an seiner Stimme erkennen!«
»Sorgt Euch lieber, dass Euch ein Anderer nicht erkennt«, zahlte es ihm jetzt der Konnetabel heim. »Wir haben gehört, dass Euer alter Freund Xacbert de Barbera dies Turnier nicht meiden will, obgleich wir auf ihn warten, nur weil er noch eine offene Rechnung mit Euch hat, Herr Oliver.«
Das brachte den Herrn von Termes allerdings zum Schweigen. Das Herz rutschte ihm hörbar in die Hose.
»Es ist nicht gewiss«, versuchte der mitfühlende Pier de Voisins den Schreck zu mildern, doch der Konnetabel drehte genüsslich das Schwert in der Wunde; in die Eingeweide hatte er den Renegaten getroffen.
»Ich wünsch’ mir, dass der alte Herr von Quéribus hier aufkreuzt, damit ich ihn endlich baumeln seh’, dann hätt’ ich meine Zeit hier nicht vertrödelt.«
Er unterbrach sich und winkte wie ein Jäger, der sein Wild wittert, die beiden hinter sich ins Gebüsch, denn es war Pferdetrappeln auf dem Weg zu hören, der sich unter ihnen vorbeischlängelte. Die im Wald versteckten Soldaten gingen in Deckung. Auf dem engen Pfad tauchten drei Reiter auf, zu jung, als dass der Gesuchte darunter wäre. Auch verbargen sie ihre Gesichter nicht, ihre Helme baumelten am Sattel, ebenso ihre Schilde.
»Den ersten kenn’ ich nicht«, flüsterte Pier de Voisins seinem Vorgesetzten zu. »Der zweite scheint ein Lautrec zu sein, altes Tolosaner Geschlecht, und der letzte muss ein Sohn des Grafen von Mirepoix sein, der junge Levis!«
Als auch der vorübergeritten war, ertönte ein Pfiff. Die Soldaten sprangen herab und versperrten mit gefällten Tannen den dreien Weg und Rückzug. Der Seneschall stieg umständlich zu den Arretierten herab, die keinerlei Anstalten gemacht hatten, nach ihren Schwertern zu greifen. Eher amüsiert betrachteten sie den waffenstarrenden Trupp, sodass Pier de Voisins sie auch ganz freundlich anging:
»Wohin des Weges, meine Herren?«
Sie lachten.
»Das ist der Herr Seneschall von Carcassonne!«, rief Oliver, der seinem Freund nachgeklettert war und jetzt die Böschung hinabsprang, dabei aber fiel. Da lachten die drei noch mehr.
»Raoul de Belgrave«, erstattete der Anführer der Burschen Meldung. »Mas de Morency und Pons de Levis auf dem Weg zum Pog«, fügte er noch hinzu. »Ist es etwa nicht recht, am Turnier teilzunehmen?«
Raoul hatte in dem einen Jahr auf der Templergaleere gelernt, Ärger zu vermeiden. Inzwischen war auch Gilles Le Brun erschienen und hatte sich den von Oliver schmählich vergessenen Stander des Konnetabels von Frankreich hinterdreintragen lassen. Daraufhin saßen die drei Reiter auf der Stelle ab.
»Zu Euren Diensten!«, brüllte Raoul, dass es weithin hallte.
»Leise, mein Freund«, befahl Gilles, ohne zu lächeln. »Ihr seid jetzt in geheimer Mission.«
»Wir wollen aber zum Stechen!« maulte Mas.
»Das sollt Ihr auch«, erläuterte ihm der Seneschall, »aber für die Farben Frankreichs.«
»Ich ernenne Euch zu Rittern der güldenen Lilie[16]«, fügte der Konnetabel feierlich hinzu. »Tragt die heilige Oriflamma ins Feld, und legt Eure Ehre drein, sie mir als stolze Sieger zurückzuerstatten!«
Raoul de Belgrave hatte gerade den Satz, mit dem er sie höflich, doch entschieden zurückzuweisen gedachte, mit einem lächelnden »Solcher Auszeichnung sind wir nicht würdig« begonnen, als Pons schon nach dem Schaft griff und das Banner stolz emporhielt. Deshalb setzte Raoul nur hinzu: »Doch wir wollen unser Bestes geben, Euch nicht zu enttäuschen!« Damit gab er seinem Pferd die Sporen, und seine beiden Gefährten trabten hinter ihm her. Kaum waren sie außer Sicht der Straßensperre, zügelte Mas wütend sein Tier.
»Dir kann man auch einen Lappen Scheiße hinhalten«, fauchte er den strahlenden Fahnenträger an, »und du grapschst danach! Ich denke nicht daran, am Montségur für Frankreich aufzutreten!« wandte er sich trotzig dem Anführer zu.
Raoul de Belgrave maßregelte ihn diesmal keineswegs.
»Auch ich bin hier geboren und mir widerstrebt es, für eine Sache zu reiten, die sicher nicht die meine ist.«
»Aber du hast doch versprochen –«, begehrte der bitter enttäuschte Pons auf.
»›Unser Bestes zu geben!‹« belehrte ihn Mas. »Aber was heißt das schon! Wenn der Konnetabel uns für –«
Mas unterbrach seine Rede. Hinter ihnen war Oliver gehetzt auf dem Weg erschienen, offenbar bemüht, sie einzuholen, denn er fiel nun in den Schritt.
»Gib ihm die blöde Fahne!«, raunzte Mas mit unterdrückter Stimme den dicklichen Pons an, und Raoul rief:
»Wir haben auf Euch gewartet, Oliver von Termes, denn Euch gebührt die Ehre, den Stander ins Feld zu führen.« Und er wand Pons die Stange aus der Hand.
Oliver ergriff die Oriflamma hoch erfreut. Ihm ging es vor allem darum, sich nicht ohne Begleitung dem Turnierplatz zu nähern, wo vielleicht im Walde der furchtbare Xacbert auf ihn lauerte. Doch kaum hatte er die Fahne geschultert, da galoppierten die drei grußlos davon und ließen ihn einfach stehen.
»Sagt, dass Ihr mich liebt!« Mafalda flüsterte ihr Begehren nicht, denn alle sollten es hören. Alle, das war das Königliche Paar mit seiner Entourage[17], zwei Zofen und einem Diener, der abwechselnd als Knappe seines Herrn und als Page der Dame Yeza auftrat und als Gehilfe des Zeremonienmeisters Rinat Le Pulcin Girlanden gewunden und Fähnchen gesteckt hatte.
Nun hoffte Philipp, endlich verschwinden zu dürfen. Die Potkaxl verdrehte schon die Augen und wies auf die Holztreppe, die zum Hinterausgang führte. Doch Roç orderte nun schneegekühlten Rosastro aus dem Roussillon für alle, schon um das Warten »auf den Feind« leichter zu machen.
Jordi nahm seine Laute zur Hand, um die Damen zu erfreuen:
»Novel’ amor que tant m’agreia
me fai lo cor dejoi chantier,
per que la moia penseia
me fai mon chan renovelier.«[18]
Mafalda trat unter der Bank ihrem Geliebten auf den Fuß. »Gesteht, dass Ihr mich heiß begehrt?«
Gers d’Alion schaute sie erstaunt an, wie aus Träumen gerissen. »Wisst Ihr das nicht?«
»Ich mag es hören von Euren Lippen«, schmachtete Mafalda, »legt Euer Herz hinein!«
»Mein Herz hab’ ich mir längst herausgerissen, ma damna, als ich Euch das erste Mal sah.« Der Schöne lächelte, er lächelte durch sie hindurch zu Simon de Cadet, der Mafaldas Hand hielt. »Dann warf ich meine Augen hinterher und riss mein Haar aus, zerschnitt mir Wangen, Hals und Haut, und so ging es fort, bis alles Euer war, verzehrt von der Feuersbrunst Eurer Liebe. Mich gibt es gar nicht mehr!«
»Mein Gott, mein Gers, wie herrlich Ihr solch’ Worte sprecht!« Mafalda atmete heftig, es nahm ihr beinah die Stimme. »Rasend könnt ich werden vor Lust, Euch auffressen könnt’ ich auf der Stelle!«
»Das nenn’ ich Liebe!«, dröhnte Burt de Comminges, der nicht etwa bei seiner Frau Melisende hockte, sondern bei den Männern stand und der vorbeistrebenden Geraude schnell an den Hintern griff, was beide erröten ließ, Geraude und Melisende, die es gesehen hatte.
»M’ amor, ge no l’ en quier ostier.
Ja non falsoia
m’amia moia,
si de bon cor me vol amier.»[19]
Der Einzige, der wohl gern bei seinem Weib saß, war Gaston de Lautrec. Doch Frau Esterei hielt es nicht länger als einen Wimpernschlag auf ihrem Sitzkissen. Mal herzte sie Yeza, mal munterte sie ihre Nichten auf. Sie wärmte die einsame Melisande und dämpfte die Glut der Mafalda, auf dass sie nicht vor dem Königlichen Paar dem Alion an die Hose ging, der Mafalda umfasste, während eine Hand auf Simons Schulter ruhte.
Jourdain de Levis stand bei seinem Freund Wolf von Foix, und sie schauten unruhig auf das leere Feld. Die Sonne stieg höher.
»Keine Wolke am Himmel, das ideale Turnierwetter«, sagte der Graf gerade mit einem Anflug von Enttäuschung, da tauchten gegenüber drei Reiter auf. Im letzten erkannte er seinen Sohn. Eigentlich kein Grund zur Freude, doch jetzt war ihm selbst der Bengel herzlich willkommen. Ganz ähnlich dachte Gaston de Lautrec, als er seinen Ziehsohn Mas erblickte. Seine Frau Esterei stieß dagegen einen Freudenschrei aus.
»Da kommt unser Mas!«, rief sie und sprang auf.
»Wie glücklich wird er sein, uns hier zu sehen, der Arme, nach allem, was er durchgemacht!« Sie hätte sicher noch weiter darauflos geplappert, hätte ihr Mann sie nicht freundlich in die Rippen geknufft und ihren Blick auf Yeza gelenkt, die blass geworden war. Aber Roç sah sie fest an, und Yeza fing sich wieder.
Noch eine war erst kalkweiß, dann puterrot geworden, Melisende. Sie schaute schnell nach ihrem Mann, bevor sie sich traute, dem vordersten der Ankömmlinge entgegenzusehen. Sie schloss die Augen. Es war zu viel.
Gers d’Alion und Simon de Cadet schätzten die drei Reiter, Raoul, Mas und Pons, als mögliche Gegner ab. Burt empfand nichts, weil die Burschen ihm auf den ersten Blick allesamt schlagbar vorkamen. »Kroppzeug!«, murmelte er zum Foix hin, und der schaute nur kurz hin, um zu wissen, dass für ihn kein ebenbürtiger Gegner auf dem Turnier zu finden war. Den Comminges, der sich für einen gewaltigen Stecher hielt, hatte er schon dreimal hinter sein Pferd gesetzt.
Die drei saßen vor der Tribüne ab. Während Pons seinem Vater zugriente, was den irgendwie rührte, und Mas seiner Stiefmutter winkte und wirklich glücklich schien, trat Raoul de Belgrave vor das Königliche Paar. Er kniete vor Yeza nieder, beugte kurz sein Haupt und sprach dann zu Roç.
»Wir sind gekommen, Euch zu dienen, wie Ihr uns dies als Gunst gewährt habt.«
Roç konnte sich daran zwar keineswegs erinnern, fand aber die Unverfrorenheit beachtlich.
»Von Gunst kann nicht die Rede sein, doch Bewährung sei Euch vergönnt. Auf die Huld meiner Damna müsst Ihr diesmal noch verzichten.«
»Wir danken Euch«, sagte Raoul mit trockener Stimme. Das wäre überstanden, und später sehen wir weiter! Er stand auf und begrüßte Jourdain de Levis, den Wolf von Foix, den er noch nie gesehen, dessen legendäre Taten aber seine Bewunderung fanden. Raoul fühlte sich jetzt doppelt froh, weil er unter den Augen dieses Helden in die Schranken reiten durfte. Er ließ sich auch von Frau Esterei umarmen, weil er ein Freund von Mas war, verneigte sich knapp vor Melisende, ohne ihr in die Augen zu schauen, sondern grinste stattdessen frech in ihren Ausschnitt.
Mittlerweile war Pons zu seinem Vater getreten, und auch Mas hatte sich von seiner Ziehmutter Esterei losgerissen, in deren Armen er gern geblieben wäre.
»Wir reiten für Okzitanien, Vater!« erklärte Pons ungefragt. Der alte Graf schaute ihn missbilligend an.
»Wir tragen hier keinen Buhurt[20] aus«, rügte er, »sondern ein freundschaftliches Treffen, Mann gegen Mann. Und wer für wen antritt, das werden wir sehen.«
»Wir wollen aber die Fahne Francias nicht über uns oder hinter uns wissen!« giftete Mas de Morency, sodass Jourdain de Levis, als sein Schwager Gaston de Lautrec hilflos die Schultern hob, seinen aufkommenden Ärger schluckte und sich lieber an Raoul, den Anführer, hielt.
»Eure Väter haben wie ich alle der Krone Frankreichs den Treueid geschworen. Wir kommen also nicht umhin, ihr auch die gebührende Ehre zu erweisen.«
»Warum reitet Ihr mit Euren Freunden dann nicht für sie?« drängte sich Pons schon wieder vorlaut dazwischen. »Die alten Herren –« Weiter kam er nicht, weil sein Vater ihm mit dem Handschuh übers lose Maul schlug.
»Leg auf der Stelle den Schild der Levis de Mirepoix ab!«, brüllte er seinen Sprössling an. »Du wirst überhaupt nicht –«
»Seht Pons seine jugendliche Torheit nach!« Der Lautrec schob sich begütigend zwischen Vater und Sohn, doch sein Ziehkind Mas, das den Pons weggezerrt hatte, hieb in die gleiche Kerbe.
»Wir pfeifen auf –«
Raoul drängte beide Gefährten so heftig zur Seite, dass sie ins Stolpern gerieten.
»Verschwindet!«, befahl er drohend, wobei er sie schon fast die Hintertreppe heruntergeworfen hätte. Dann wandte er sich an den Grafen: »Am besten ist, Ihr lasst das Los entscheiden, wer für –«
Ausgerechnet jetzt setzte sich Mafalda in Szene. Mit »Mein Gers wird die Farben tragen, die ich ihm erwählt!« trotzte sie ihrem Vater. Der drehte sich um und sprach zu seinem Freund Wolf:
»Ihr habt keine Familienbande am Hals, ich sag’ nichts mehr.«
»Ihr habt bisher noch gar nichts gesagt, nur Eure Brut reißt den Schnabel auf!« Der Foix lachte.
»Entscheidet Ihr, Wolf von Foix«, rief Raoul voller Bewunderung, »und alle werden sich fügen.«
»Gut«, erklärte der.
»Silentium!«, brüllte Burt de Comminges, den das Ganze allmählich anwiderte.
»Also«, begann der Foix bedächtig, »Jourdain de Levis, Burt de Comminges und Gaston de Lautrec dienen der Lilie, dazu tritt auch Oliver von Termes, den ich soeben antraben seh’. Er hat die Orifiamma gleich mitgebracht, so weiß er, wohin er gehört, der Renegat!«
Das letzte hatte er nur gemurmelt hinzugefügt »Roç Trencavel kann schlecht unter diesem Zeichen antreten, genau wie meine Wenigkeit, und wenn Mafalda ihr schönes Köpfchen durchsetzen will, dann reitet auch Gers d’Alion für Okzitanien, allerdings muss dafür Simon de Cadet ins Lager der Franken.«
Die beiden Freunde sahen sich an, und Simon nickte. Mit einem Jubelschrei umarmte ihn Mafalda, bevor sie ihren Gers abküsste.
»Und wir?« maulte Mas de Morency.
»Alle drei im Dienst des Roç Trencavel!«
»Seid bedankt, Wolf von Foix«, sagte Raoul mit belegter Stimme. »Ihr seid der Mann, den dieses Land braucht.«
Der lachte bitter.
»Vergesst einen räudigen Faidit wie mich. Roç Trencavel, das wäre die Zukunft – wenn es überhaupt noch eine gibt.« Und er wies auf Roç, der das nicht gehört hatte, weil Oliver gerade dem Königlichen Paar seine Aufwartung machte.
»Mein Verbot für die Farben der Levis bleibt bestehen, mein Sohn und Erbe kann sich –«
»Dafür steht eine Lösung schon bereit«, beruhigte ihn Raoul und zeigte zur Treppe, wo jetzt Pons mit einem alten, verbeulten Schild auftauchte. Er zeigte im blauen Schildhaupt drei fünfzackige Sterne und unter dem Balken auf rotem Grund einen goldenen Fisch.
»Jesus Maria!« entfuhr es dem Comminges. »Wo habt Ihr den denn aufgetan?«
»Auf dem Speicher unserer Burg Mirepoix«, musste Pons zugeben.
»Das geht erst recht nicht«, erklärte bewegt der Vater. »Das muss der Schild meines Vorgängers sein, des Belissensohns[21] Pierre-Roger de Mirepoix. Er war der letzte Kommandant, der Verteidiger des Montségur.« Jourdain de Levis übermannte die Rührung. »Er starb im Kerker zu Carcassonne. Sei’s drum!« rief er mit plötzlichem Entschluss und umarmte den erstaunten Pons. »Trag ihn in Ehren!« Und zum Foix gewandt, setzte er hinzu: »Ihr seid nun arg in der Überzahl, doch steht ja noch zu hoffen, dass endlich ein richtiger Franke sich traut, hier aufzutreten. Derweilen lasst uns beginnen. Der erste Tjost[22] steht unserem Gastgeber zu.«
»E lo vescoms estec pels murs e pels ambans
e esgarda la osi, don es meravilhans.
A cosselh apelec cavaliers e sirjans,
sels qui so bo per armas ni milhors combatans:
›Anatz, baro‹, ditz el, ›montatz eis alferans‹.«[23]
Alte Rechnungen, dickes Blut
Oliver hatte das Lilienbanner an den linken Stand gesteckt, sodass es jetzt herausfordernd dem rotgelb gestreiften gegenüber zur Rechten flatterte. Die Damen nahmen die Plätze in der vordersten Reihe der Tribüne ein. Yeza gebührte als Herrin des Turniers die Mitte, doch mochte sie Mafalda nicht allein den Part Okzitaniens überlassen. So rückte sie leicht, doch unübersehbar samt Hofstaat nach rechts. Viel lieber hätte sie die lustige Esterei mit in ihrer Partei gehabt, doch die vertrat jetzt zu ihrer Linken zusammen mit der stillen Melisende die Farben Frankreichs.
Rinat und Jordi halfen Roç beim Anlegen der Rüstung. Er hatte sie in der Waffenkammer des Turms von Quéribus gefunden. Die meisten Harnische waren ihm viel zu groß – Xacbert de Barbera musste ein mächtiger Geselle sein –, doch dann war er auf einen schmaleren, nie benutzten gestoßen, und der saß wie angegossen. Den Helm hatte Rinat hergerichtet. Er hatte ihn weder mit dem Reichsadler noch mit einem Waiblinger Geparden bestückt, sondern mit einer blank erhobenen Damaszenerklinge als Zimier: »Schneid mittendurch!« Und um dessen Bedeutung noch zu unterstreichen, hatte er rechts und links je zwei halbierte Ballen in Rot und Gelb wie Flügel herabsinken lassen. Roç nahm den Helm ab, als er jetzt vor seine Damna trat. Yeza war stolz auf ihren Ritter, doch sie verbarg es wohl.
»Flieg’ mir nicht davon!«, scherzte sie, auf die Schwingen weisend, und Jordi sagte wohlwollend:
»Das vermag einen Schlag auf den Helm schon zu dämpfen, von dem einem sonst die Ohren klingen!«
»Wer wird Euer Gegner sein?«, fragte Yeza. »Außer dem Comminges habt Ihr keinen zu fürchten, und auch der scheint mir nicht gerade gewitzt.«
»Er vertraut zu sehr auf seine Muskelkraft«, beruhigte Roç sie, »ich seh’ hier nur einen, gegen den ich nicht bestünd’, doch der Foix streitet in unseren Reihen.«
Er küsste Yeza auf Stirn, Augen und Mund, blitzschnell fuhren ihre Zungen ineinander; das war Versprechen und Ritual. Sie steckte ihm ein Tüchlein zu aus feinem Batist. Er kannte es, sie hatte es ihm damals in Ägypten als Liebespfand überlassen, als sie getrennt wurden und Yeza als Geisel bei dem gefürchteten Baibars zurückbleiben musste. Er hatte es ihr treu – na ja – zurückerstattet, als sie sich bei den Assassinen wiedersahen.
Rinat und Jordi hoben Roç aufs Pferd. Jordi trug jetzt den rotgelben Tappert[24] des Herolds und hatte seine Laute mit einer Drommete[25] vertauscht. Er begleitete Roç, denn er würde sich draußen beim Lanzenstand aufstellen, grad gegenüber der Tribüne und immer das Signal blasen, wenn er sah, dass die Herren bei den Fahnen bereit waren.
Roç ritt außen an den Schranken entlang nach rechts zum rotgelben Banner. Das war bereits die Herausforderung. Er drehte sich nicht um. Solch’ Neugier zu zeigen war nicht die feine Art. Wenn er, oben angekommen, sein Pferd wenden würde, dann sollte sein Gegner sich schon auf den Weg gemacht haben, denn den Herausforderer lange warten zu lassen galt als feige oder tückisch.
Es war Simon de Cadet, der die Forderung annahm. Er war so schnell vorgeprescht, dass er Mas und Raoul zuvorkam, die beide darauf aus waren, Roç hinter sein Pferd zu setzen, und sich um den Vortritt noch stritten. Da die Kontrahenten gleichzeitig ihre Fahnen erreichten, ritten sie gleich weiter zu den Lanzen. Jeder wählte eine der langen Stangen, die sich verjüngten und auf der abgesägten Spitze ein Krönlein trugen. Das verhinderte ein Abrutschen des Gegners, war jedoch hart genug, um den Stoß schmerzhaft spüren zu lassen, wenn man ihn nicht mit dem Schild abfing. Brach es ab, musste die Lanze gegen eine neue ausgetauscht werden, denn ohne das Krönlein konnte die zugespitzte Stange leicht zur tödlichen Waffe werden.
Roç sah, mit welcher Ruhe Simon seine Wahl traf. Der Cadet hatte bestimmt schon manchen Tjost geritten, für ihn, Roç, war es dagegen das erste Mal. Gut, er war sicher der bessere Reiter, doch mit einem solchen Baum unter dem Arm war es dann doch wohl anders. Roç überflog in Gedanken alles, was er bei den Mongolen gelernt hatte, während er langsam zurück zu seiner Fahne ritt. Gleich beim ersten Ritt wollte er die Entscheidung herbeiführen. Roç wendete sein Pferd. Er klemmte die Lanze nicht fest unter den Arm, sondern bereitete sich darauf vor, sie im Anritt locker in die Hand zu bekommen. Seinen Schild brachte er vor sich.
Das war für Jordi das Zeichen, dass er bereit war. Da auch Simon jetzt das Visier seines Helmes schloss, was Roç fast vergessen hätte, setzte Jordi die Drommete an und blies das Signal.
Die Tribüne antwortete mit begeistertem Schreien, endlich ging es los! Schrill war die Stimme Mafaldas herauszuhören. Roç dachte an Yeza, als er seinem Pferd die Sporen gab und rasselnd losritt. Er ließ das Tier zunächst selbst das Tempo bestimmen. Durch das Gitter seines Kübelhelms sah er den Gegner herankommen. Von den Bänken erschollen die Anfeuerungsrufe des Volkes.
Simon de Cadet ritt wohl so, wie es sich gehörte, in tadelloser Haltung, sein Ross zu immer schnellerer Gangart antreibend, bis es in den Galopp fiel. Er hielt auf Roç zu, ohne jeden Arg, auch ohne jede List. Roç wich nicht aus, was den anderen irritierte, denn er zog nun zur Seite. Roç ließ die Lanze aus der Armbeuge in die tief hängende Hand fallen. Das Gebrüll auf der Tribüne steigerte sich, die spitzen Schreie der Frauen gellten den Reitern in den Ohren. Jetzt war Simon heran, Roç warf sich geschickt zur Seite und brachte dadurch die Lanze ziemlich quer. Da der Stoß des Kontrahenten ins Leere gegangen und dessen Körper dem unvorbereitet gefolgt war, kostete es Roç keine Mühe, ihn vom Sattel zu wischen wie eine Feder. Er riss sein Pferd herum und ritt schnell zu dem Gestürzten. Simon war jede Art von Kampfspiel gewöhnt, aber es überraschte ihn, ohne spürbaren Stoß aus dem Sattel zu fliegen.
»Habt Ihr Euch verletzt?«, fragte Roç teilnahmsvoll.
»Wie denn?«, fragte Simon zornig zurück. »Ihr habt mich ja nirgendwo getroffen!«
»Und warum liegt Ihr dann hier?«, fragte Roç spöttisch grinsend.
»Lasst uns noch mal –«, forderte Simon, sprang auf und griff zuversichtlich nach den Zügeln seines Tieres, das bei ihm stehengeblieben war.
»Heute nicht«, beschied ihn Roç freundlich. »Wir haben spät begonnen, und die anderen wollen auch noch ihre Kräfte messen. Und außerdem« – er ritt auf Simon zu und gab ihm die Hand –, »es würde Euch wieder so ergehen.«
Damit ließ er ihn stehen und ritt zurück zu seiner Damna, um ihr das Tüchlein zurückzuerstatten.
»Ganz sauber war Euer Mongolenschubs grad nicht, mein Ritter!« Yeza lachte.
»Aber dafür hab’ ich ihm nicht den Arm gebrochen, meine Damna«, gab es ihr Roç ebenso grinsend zurück und ließ sich vom Pferd helfen.
Währenddessen war schon Herr Jourdain losgeritten, dessen knallgelbes Schild drei schwarze Sparren trug. Sein Sohn Pons wollte ihm folgen und winkte ihm mit dem zerbeulten Schild mit dem Fisch der Miralpeix schon hinterdrein. Doch da ging sein Freund Mas dazwischen, er drängte Pons hart an den Rand der Tribüne.
»Das machst du nicht!« fauchte er ihn an. »Den Tort[26] hat dein Vater nicht verdient!« Und er gab seinem Pferd die Sporen und ritt an der rotgelben Fahne vorbei zum Stangenstand. »Es ist mir eine Ehre, Graf Jourdain«, keuchte er und riss eine Lanze aus dem Ständer, »gegen Euch bestehen zu dürfen.«
Der Alte musterte ihn freundlich.
»Keine Hast, Mas de Morency, einen Tjost gewinnt man frohen Mutes, kühlen Kopfs und nicht mit verkrampften Muskeln!«
»Ihr solltet mich nicht belehren«, schnaufte der Junge verärgert, »sondern lieber fest im Sattel sitzen!«
»Die Lehre ist schnell erteilt!«, rief der Graf im Wegreiten.
Die beiden nahmen ihre Plätze ein, die Drommete ertönte. Mas preschte los, die Lanze weit vor sich gestreckt, den Schild fahrig vor die Brust haltend bis unters Kinn, wo er ihm gegen den Kiefer schlug. Während er ihn noch zur Seite brachte, wütend über den Schmerz, denn er hatte sich auf die Zunge gebissen, war der alte Jourdain schon gemächlich herangetrabt, fast erstaunt, seinen jungen Gegner in derartiger Verfassung vorzufinden. Er nahm sich Zeit, ihn maßgerecht aus dem Sattel zu heben. Mas’ Lanze ließ er leicht am Schild abgleiten, und dann setzte er ihn hinter die Kruppe des Tieres in die Wiese. Da saß der Mas und schrie.
»Gebt mir sofort Revanche, wenn Ihr ein Mann von –«