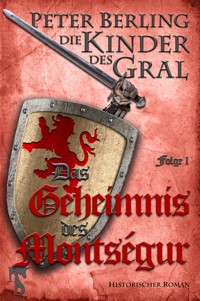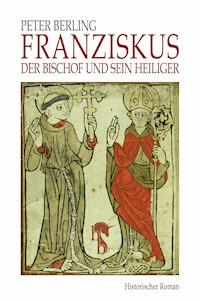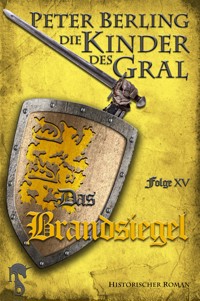3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Der Gral-Zyklus: In der aufregendsten Zeit des Hohen Mittelalters erzählt Peter Berling in 17 Romanen das Schicksal jener Kinder, die aufgrund ihres Blutes als Träger der Krone auserwählt wurden. Die Gral-Serie besteht aus 17 Bänden: – Das Geheimnis des Montségur – Der Häscher des Kardinals – Im Lügengespinst von Byzanz – Die Piratin der Ägäis – Kreuzzug ins Verderben – Schicksal am Nil – Höhle der Muräne Christi – Im Banne der Assassinen – Geiseln des Großkhan – Die Rose im Feuer – Das Geheimnis der Templer – Ein blutig Hauen und Stechen – Die Braut von Palermo – Die Spur des Kelches – Das Brandsiegel – Das Haupt des Drachens – Ein Teppich in der Wüste Den Kindern des Gral, Roç und Yeza, ist die Flucht vom Montségur gelungen. Doch das Land konnten sie nicht verlassen, immer noch befinden sie sich auf römischem – und damit brandgefährlichem – Boden. Die mittelalterliche Inquisition hat inzwischen ihren übelsten Bluthund auf sie angesetzt: Vitus von Viterbo! Atemlos gejagt, fliehen die beiden Kinder durch das gesamte Abendland, selbst vom Stauferkaiser Friedrich II. ist keine Hilfe zu erwarten. Niemand will sich der Ketzerei bezichtigen lassen und sich gegen die Inquisition stellen. Und in den Reihen der Unterstützer von Roç und Yeza bricht Streit aus. Ist der Anspruch der Königskinder auf die mystische Krone denn wirklich gerechtfertigt? Hilfe erhalten Roç und Yeza schließlich von unverhoffter Seite. Denn William von Roebruk, ein junger Franziskaner, hat die beiden seit ihrer abenteuerlichen Flucht aus der belagerten Gralsburg in sein Herz geschlossen. Während er ihrer Spur folgt, zieht er unfreiwillig die Verfolger auf sich, bis Roç, Yeza und William schließlich auf der Triëre im Hafen von Otranto zusammentreffen. Doch die Verfolger sind ihnen dicht auf den Fersen … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil zwei fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PETER BERLING
Der Häscher des Kardinals
Folge II des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE I
Das Geheimnis des Montségur
1244. Über ein Jahr lang hatte die letzte Trutzburg der Katharer, eine gnostisch-manichäisch-christliche Sekte, der Belagerung durch den Norden Frankreichs getrotzt. Als die Verteidiger des Montségur sich endlich zur Kapitulation bereit finden, verlangen sie einen letzten Aufschub, zur Feier ihres ketzerischen ›Consolamentum‹ – wie die frohlockenden Katholiken meinen. In Wahrheit werden in dieser Nacht zwei Kinder heimlich aus der todgeweihten Festung geschmuggelt. Danach besteigt die Besatzung freudig die auf sie wartenden Scheiterhaufen.
Roç und Yeza, ›die Kinder des Gral‹, sind gerettet! Und es beginnt eine gnadenlose Jagd auf sie, ihre Beschützer und Anhänger. Falsche Fährten werden gelegt, Getreuer Leben als Opfer gebracht, die mörderische Inquisition sieht sich herausgefordert – und doch gelingt es ihren Hütern, Templern, Assassinen und Deutschen Ordensrittern, sie nach Otranto in Apulien zu schaffen, von wo aus ein Schiff sie in die Freiheit des Meeres bringen soll. So steht es geschrieben im ›Großen Plan‹, dessen geheime Urheber auch in den Reihen der ›Sancta Ecclesia Romana‹ zu Recht vermutet und verfolgt werden. Nicht zu unterschätzen ist die Gefahr, die von den ›Kindern des Gral‹ für die Kirche ausgeht …
I DAS OHR DES DIONYSOS
Auf falscher Fährte
Chronik des William von Roebruk
Otranto, Herbst 1245
Ich wachte auf, weil es klopfte. Wie immer dachte ich, jetzt kommt die vergiftete Mahlzeit, und war nicht bereit, sie zu essen. Dabei hatte ich sie am Ende jedes Mal heruntergewürgt und lebte immer noch. Auch diesmal stand sie schon auf dem Tisch, und das Klopfen kam nicht von der Tür, sondern von unter mir. Ich sprang aus dem Bett und half den Kindern aus der Klappe.
»Du hast ja wieder nicht gegessen!« warf Yeza mir vor, kaum dass sie der Herrlichkeiten auf dem Tisch ansichtig wurde: kalter Hummer, ausgelöstes Kalbfleisch mit gehackten Oliven, Kräutern, Zwiebeln, Öl und Eigelb angemacht, geröstetes Landbrot, nach Knoblauch duftend und mit Nüssen durchsetzt, die heimischen Kakteenfrüchte in Honig eingelegt und mit Zitrusfrüchten mariniert und allerlei gebackenes Naschwerk zu zwei verschiedenen Karaffen Wein, ein heller herber und ein dunkler, fast orangefarbener von schwerer Süße. Roç wollte sofort zugreifen, in der schnellen Einsicht, dass dies alles für eine Person, selbst eine verfressene wie mich, bei Weitem zu viel sei, aber ich riss ihm die Krebspastete weg; sie konnte ja vergiftet sein. Roç war völlig verdattert ob meiner Reaktion.
»Lass mich erst kosten!« versuchte ich mein Verhalten verständlich zu machen. »Ich will sicher sein, dass es dir auch bekommt!«
»Du kannst alles allein essen!«, sagte er trotzig.
»Sei doch nicht so gierig«, kam mir Yeza zu Hilfe. »William lässt doch immer erst alles kalt werden, damit es ihm richtig schmeckt.«
»Ich hab’ keinen Hunger!« beschied uns Roç und wechselte das Thema. »Da ist eine Frau gekommen, die nach dir fragte, William.« Er ließ mich jetzt zappeln. »Die Gräfin war sehr böse, sie nannte sie eine ›Cortisone‹ oder irgendwie eine Hofdame und traf sich mit ihr in den Pferdeställen, weißt du, diese großen Gewölbe, die unter der Burg liegen, wo auch das Pferdefutter ist …«
Ich wusste es natürlich nicht, dachte mir aber laut den Umstand: »Dorthin kommt man vom Meer aus, ohne die Burg betreten zu müssen?«
»Richtig«, bestätigte eifrig Roç. »Dort geht auch eine Rutsche ab, für das Getreide und alles, was man zum Essen braucht; es rutscht direkt aufs Schiff –«
»Wenn eins da ist!« berichtigte ihn Yeza. »Ich glaub’ nicht, dass die Dame die Rutsche hochgekommen ist –«
»Sie hat natürlich die Treppe genommen, die ist genau daneben, das weiß aber niemand.«
»Und wer war nun die Frau?« drängte ich, ohne auch nur die leiseste Ahnung, um wen es sich handeln könnte. »Hast du sie gesehen?«
»Nein«, sagte Yeza, »wir waren ja auch hinter der Wand, aber die Gräfin war wütend und hat den Bombolone angeschrien, der dich hierher gebracht hat …«
»Und dich mögen sie auch nicht leiden!«, fügte Roç hinzu, offen lassend, ob er sich dem anschloss oder ob er mir meinen kleinlichen Geiz vergeben hatte.
»Aber wir mögen dich leiden, William!« Yeza war bemüht, jeden Zweifel auszuräumen.
Roç hatte sich inzwischen wieder in die Ecke des Raumes begeben. Es war noch nichts zu hören.
»Das ist das Ohr des Nasengotts!« klärte mich Yeza auf.
»Eher sein Nasenloch!«, scherzte ich.
»Doch«, sagte Yeza, »Sigbert hat es gesagt: ein Ohr des ›DioNaso‹, weißt du, der, der an einen denkt, wenn man niest!«
Ich war gerührt: »Wenn Sigbert das gesagt hat …«, und beließ sie bei dieser Einsicht. Heidenkinder waren sie allemal, und hier, bei der Gräfin, wurden sie sicher auch nicht in Weihwasser gebadet.
»Weißt du, dass Crean noch hier ist?« brachte Roç mich wieder dazu, auf ihn einzugehen. »Er darf aber nicht mit in den Saal da oben, er muss draußen vor der Tür warten!« Roç war stolz auf seine Erkenntnisse, mit denen ich nichts anfangen konnte.
»Wer ist denn der alte Herr?«, fragte ich.
»Der ist mit Yezas ›Musselmann‹ zusammen mit unserem Schiff gekommen, mit dem Sigbert und der Rote Falke weggefahren sind.«
»Und wer ist der ›Rote Falke‹?«
»So heißt der Konstanz wirklich, ich meine, bei sich zu Hause«, klärte mich Roç auf, »und der alte Mann ist der Vater von Crean, obgleich er ihn ›John‹ nennt, damit es keiner merkt!«
»Und der ist mit wem zusammen gekommen?«
»Na, mit dem netten Mann mit dem Turban!« Yeza verstand gar nicht, dass ich Schwierigkeiten haben konnte, alle auseinanderzuhalten.
»Und wer ist nun die Frau, die nach mir fragte?«
In diesem Moment ertönten über uns Schritte und Stimmen:
»… da schickt mir jemand eine billige Straßendirne auf den Hals, und die gibt mir ein Kopfbild von Eurem Mönch, Elia« –, die Gräfin musste vor Empörung beben –, »das sie auch noch wiederhaben will – das heißt, eigentlich will sie diesen William –, und darunter steht angeblich eine wichtige Nachricht, seht her!«
»Das ist Griechisch!« Elias Stimme übersetzte: »›Die große Hure Babylon –‹«
»Eine Unverschämtheit von diesem Weibsbild –!«, unterbrach ihn die Gräfin.
Elia las weiter: »›… sucht den Vater der beiden Kinder, von dem sie weiß, dass er bei Euch weilt.‹«
Schweigen im Raum.
»Man sollte diese Kebse und diesen unwürdigen Mönch auf der Stelle zusammen an einen Mühlstein binden und ins Meer werfen!« Das war der freundliche Muslim.
»Mit der großen Hure Babylon«, schaltete sich Elia ein, »ist keineswegs die Überbringerin gemeint, sondern die Kurie«, erläuterte er; »von ihr droht also Gefahr. ›Der Vater der beiden Kinder‹, das zielt auf William in seiner Eigenschaft als der Kirche bisher als einzig bekannte Obhutsperson, von der sie allerdings jetzt auch weiß, dass sie hier in Otranto ist.«
Wieder Schweigen, dann setzte der Muselmann nach: »Von wem hat das Weib eigentlich Bild und Botschaft erhalten?«
»Von einem Mönch, einem Franziskaner mit Lockenkopf, den sie angeblich vor dem Zugriff eines päpstlichen Häschers bewahrt hat«, ergänzte die Gräfin den Bericht von ihrer Unterhaltung mit der aufdringlichen Frauensperson.
»Das kann nur einer gewesen sein: mein Vertrauensmann im Castel Sant’ Angelo –« Elia dachte nach. »Eigentlich müsste Lorenz auf dem Weg nach Lyon sein, zum Papst –«
»Schöner Vertrauensmann!« höhnte Yezas Turbanträger. »Er wollte mich unbedingt warnen, traf mich aber nicht mehr an.« Elia wehrte sich nicht, sein Verhalten wurde offensichtlich von den anderen als töricht angesehen; er hätte mich in die Wüste schicken, auf Cortona einkerkern sollen, wenn er schon nicht übers Herz gebracht hatte, mich durch Gersende vergiften zu lassen. »Lorenz hatte keine Zeit, wurde überdies verfolgt, so wählte er klug und unverdächtig eine reisende Marketenderin als Überbringerin der Botschaft, die sich – wie Gott es so fügt – in diesen unglückseligen William verliebt hatte. Wie heißt sie eigentlich?«
»Ingeliese, Ilselinde oder so ähnlich, eine Deutsche«, legte die Gräfin geringschätzig nach. »Aus Metz!«
Mir fuhr der Schreck ins Glied! Doch dann dachte ich: eine freudige Überraschung! In meiner Lage konnte sie mir nur hilfreich sein. Ihr Auftauchen könnte mich retten. Oder wir würden beide sterben …
Inquisitionsprotokoll
»Ihr seid eine freie Frau – Ihr könnt gehen, Roxalba Cecilie Stephanie von Cab d’ Aret, genannt ›Loba, die Wölfin‹!«
Der Inquisitor, der dem Tribunal vorsaß, war Monsignore Durand, der Bischof von Albi. Aus seinem Ärmel ragte eine Eisenklaue, und sein Hals war in eine steife Ledermanschette gezwängt, die seinem Kopf keinen Bewegungsspielraum ließ. Doch seine blitzenden Augen, die flink durch den Raum wanderten, zeigten, dass er mit seiner Invalidität zurechtkam.
»Den Namen gab Euch Peire Vidal [1], nicht wahr?«, scherzte er zu der Befragten, die sich jetzt erhob und ihr kräftiges Gebiss hinter breiten roten Lippen zeigte, als sie verächtlich antwortete:
»Der Tropf, in minniglicher Sucht erbrannt, verkleidete sich als Wolf – meine Hunde haben ihn arg gebeutelt –«
»– während Ihr es mit Ramon-Drut [2] triebt, dem Infanten von Foix!« hinterfragte lüstern-lauernd der Bischof, doch sie blieb ihm die Antwort nicht schuldig:
»Der Infant hatte die Poesie in seiner Lanze, er sang mir nicht die Ohren voll!«
Der Schreiber des Tribunals legte die Feder beiseite und haspelte monoton das Protokoll des Verhörs herunter, das Loba die unbedenkliche Tätigkeit als Heilkräutersammlerin bestätigte und in dem befriedigenden Satz mündete: »… ist das Glaubensbekenntnis geläufig, wusste das Ave Maria zu sagen, bezeugte ihre Ehrerbietung vor den hier anwesenden Priestern, steht ergo unbedenklich im Glauben der katholischen Kirche.«
Loba sah aus dem Fenster des unscheinbaren Steinhauses am Marktplatz von Aigues Mortes, wo neben dem Galgen ein schwarz verkohlter Pfahl aus einem noch glimmenden Aschehaufen ragte, Schicksal, das ihr erspart geblieben war.
»Ihr könnt gehen, Madame«, sagte Durand nochmals höflich, »oder auch der weiteren Verhandlung beiwohnen, damit Ihr eine Vorstellung erhaltet, wie sehr sich die Kirche im Kampf um die Wahrheit müht.«
Loba verharrte unsicher, nahm dann doch Platz. Außer dem Bischof von Albi, der sie hierher zitiert hatte, wie alle verdächtigen Bewohner des Landes um den Montségur, der Grafschaften von Foix und Mirepoix, die man in den Wäldern und Höhlen aufgestöbert hatte, bestand das Tribunal aus dem von Rom entsandten Vitus von Viterbo und dem vom König delegierten Yves. Drei Dominikaner fungierten als Beisitzer. Ein Schreiber und ein Dutzend Soldaten des Inquisitors vervollständigten es.
Loba spürte die neugierigen, missgünstigen, ja enttäuschten Blicke der Zuschauer in ihrem Rücken. Es waren meist biedere Frauen der Garnison, Fourageure und Waffenschmiede, die sich hier die Zeit um die blutrünstigen Ohren schlugen, nicht etwa bis zum Beginn des Kreuzzuges, sondern nur bis zur nächsten Verurteilung, zum Scheiterhaufen. Manche hätte sie gar zu gern brennen gesehen!
Zur murrenden Enttäuschung des Publikums ließ der Bischof jedoch jetzt den kleinen Saal räumen. Auch die Soldaten wurden vor die Tür geschickt.
Der Schreiber räusperte sich. »Bericht aus Palermo«, fasste er knapp zusammen. »Esclarmonde von Perelha« – niemand bemerkte, wie Loba plötzlich aufhorchte – oder doch? – »kopulierte dort mit dem exkommunizierten Friedrich, längste Zeit Kaiser und zu verdammender Antichrist! Resultat: eine weitere Bastardtochter, geboren auf der zerstörten Festung Satans, ungetauft, Name: ›Isabella-Constanze-Ramona‹«
»›Isabella‹ steht für die Prätendenz auf die Krone von Jerusalem, ›Cons tanze‹ für die geballte Hausmacht des Erzeugers, die normannische Mutter, die Verbindung mit Aragon«, erläuterte der Bischof, »und ›Ramona‹ für die okzitanische Linie der Gebärerin des Balges!« Mehr und mehr zeigte sich die Verbitterung des Verkrüppelten, sein Ton wurde geifernd. Yves der Bretone zuckte angewidert die Schultern und verließ den Raum.
Dem Schreiber lag daran, die ihm vorliegenden Informationen loszuwerden: »›Protokoll der verschärften Befragung der Mora von Cugugnan, Köchin auf der Festung des Satans und Schwester der Amme dortselbst, und ergänzende Erkenntnisse Seiner Exzellenz, des Monsignore Durand – durch besonderen Erlass vom secretumconfessionis befreit‹«, las er hastig vor. Des Bischofs Augen leuchteten begierig auf, seine eigenen – so teuer bezahlten – Nachforschungen vorgetragen zu hören, aber auch Loba lauschte voller Unruhe. »›Eine Frauensperson namens »Blanchefleur«, Mutter unbekannter Adel Frankreichs, Vater ebenderselbe Friedrich, also selbst Bastardin, kopulierte mit dem Letzten der Linie Trencavel, vormalige Vicomtes von Carcassonne, Ramon-Roger III. Resultat: ein männlicher Bastard, geboren auf eben derselben Feste Satans, ungetauft, Name: »Roger-Ramon-Bertrand«.‹«
»Hier steht ›Roger‹ für den Erzeuger, aber auch für beide Großväter«, klärte der Bischof eifrig seine Zuhörer auf, »›Ramon‹ desgleichen, und ›Bertrand‹ –?« Der Bischof schien mit sich zu ringen. »Tut ja auch weiter nichts zur Sache«, entschuldigte er sich für sein diesbezügliches Schweigen.
»Wir haben es hier mit der klaren, wenn auch schandbaren Absicht des Staufers zu tun«, zog Vitus von Viterbo grollend seine Schlussfolgerung in das nachdenkliche Schweigen Durands hinein und in die aufsteigende Empörung Lobas, »der heiligen Kirche einen Schlag ins Gesicht zu geben, indem dieser Satansdiener gezielt seinen Samen mit Ketzerblut vermengte; heute noch heimlich, doch morgen wird er diese Brut als Herrscher einer ›neuen Welt‹ präsentieren, einer Welt, in der das Amt des höchsten Priesters – oder der Priesterin – mit dem des irdischen Herrschers zusammenfällt – ein ketzerisches Stauferkaiser-Papsttum auf immer und ewig!«
Der Bischof hatte ihm verwundert zugehört. »Das hättet Ihr dem Konzil vortragen sollen, Vitus, doch Ihr kommt zu spät, die Würfel zu Lyon sind schon gefallen.«
»Die Kirche, der Papst haben zwar einen schönen Sieg davongetragen, doch der Antichrist ist nicht vernichtet – noch züngelt die Brut!«
»Habt Ihr je bedacht, Vitus von Viterbo«, entgegnete der Bischof nachdenklich, »dass es sich auch anders verhalten könnte? Dass wir hier einer weltweiten Konspiration gegenüberstehen, in der Satan seinen verderbten Samen, unter Zuhilfenahme von Ketzerblut oder noch Ärgerem, mit der ›Macht auf Erden‹ verbinden will. Denn noch breitet sich das imperiale Spinnennetz von Lübeck bis Akkon, von Nicaea bis Zaragossa, und wenn Friedrich dereinst zur Hölle fährt, dann stehen vielleicht Erben bereit, die nicht unbedingt die Farben der Staufer hochhalten, sondern sich unter einem ganz anderen Banner sammeln: die Heerscharen des Fürsten der Finsternis! Ich warne Euch: Hier greift ein geheimer Bund nach der Herrschaft. Der Staufer in seiner Deszendenz wird nur benutzt, das neue Herrscherpaar ist Frucht einer bewussten, groß angelegten Planung –«
Durand hatte sich in Rage geredet, Loba wunderte sich, dass er nicht aufgesprungen war; seine Eisenklaue zeichnete seltsame Linien in die Luft – der andere Arm war wohl gelähmt –, als er jetzt mit verklärtem Blick rezitierte: »›Uf einem grüenen achmardi truoc si den wunsch von pardis daz waz ein dinc, das hiez der gral!‹«
Da stand Loba auf; ihre Augen funkelten. »Ihr zielt zu hoch – und daneben, meine Herren: Wenn nicht auch Sitten und Gebräuche der Pharaonen eingeführt werden, können Eure zukünftigen Weltenherrscher einander nicht heiraten: Sie sind Geschwister, Zwillinge!«
»Wachen!«, brüllte Vitus, und die kamen sofort hereingestürzt. »Fesselt dieses Weib!«
»Keine Not!« fauchte Loba. »Wem sein Augenlicht lieb, bleibe mir fern! Wollt Ihr mich tot oder geständig?«
»Lasst sie reden!«, befahl der Inquisitor, und Vitus gab sich drein.
»Das Kind der Blanchefleur war eine Totgeburt: Ich habe den Sud zum abortus selbst bereitet, den foetus als Dank erhalten.«
»Hexe!«, schnaubte Vitus. »Verdammte Hexe!« Loba lachte ihm ins Gesicht, eine zähnefletschende Wölfin. »Esclarmonde hatte Zwillinge geboren aus einem Verhältnis mit einem Reitknecht, der auf der Burg diente –«
»Elende Lügnerin!«, heulte Vitus auf. »Der Kaiser war’s!«
»Die Vergewaltigung durch den Staufer hat sie erfunden, weil sie den Zorn ihres Vaters fürchtete. Sie suchte meinen Rat zu spät; über die Dauer der Reise war zu viel Zeit vergangen. Wir versuchten alles, um das werdende Leben abzutöten – was auch nicht ohne Folgen blieb –, doch die Schwangerschaft war zu weit fortgeschritten, und Esclarmonde war ein kräftiges Weibsbild. Die Kinder sind die zwei unseligen Bastarde der Ketzerin, blöd geboren!«
»Kommt näher!« lockte der Inquisitor mit seiner eisernen Klaue. »Wer hat dich bezahlt für die Abtreibung der kleinen Blanchefleur?« spie er Loba wie eine Schlange sein Gift ins Gesicht. »War es eine hohe Dame?«, schrie er sie an mit überschnappender Stimme. »Hast du sie gesehen?«
Loba schüttelte stolz ihre schwarze Mähne.
»Kam sie in einer Sänfte?«
»Nein«, sagte Loba ruhig.
»Sie ist es, sie ist es!«, kreischte Durand schrill dazwischen.
Vitus gab den Soldaten ein Zeichen. Je zwei traten rechts und links neben den zeternden Bischof und hoben ihn gleichzeitig hoch, zusammen mit seinem Stuhl. Durand hatte keine Beine mehr. Sie trugen ihn hinaus.
»Nein«, wiederholte Loba, »Blanchefleur wusste nicht, dass ihr Kind tot im Leibe war, als man sie mir brachte. Ich leitete den Abgang erst ein, als ich sicher war, dass die Tochter des Kastellans Zwillinge unterm Herzen trug.« Angelockt durch den spektakulären Auszug des Bischofs, hatte Yves der Bretone wieder den Raum betreten. Er hörte sich auch den Schluss des Berichtes an.
»Blanchefleur«, schloss Loba furchtlos, »hat es nicht gemerkt, dass das Kind neben ihr, als sie erwachte, nicht ihr eigenes war!«
»Als Kindsmörderin gehört sie unters Schwert, als Hexe verbrannt«, sagte Yves. »Übergebt sie mir!«
»Sie hat keinen Mord begangen«, entgegnete Vitus, »und was eine Hexe ist, bestimmt die Kirche.« Er ließ den Bretonen stehen. »Fesselt sie!«, wies er die Wachen an, und diesmal ließ es Loba mit sich geschehen.
Draußen hob Vitus sie auf sein Pferd und verließ mit ihr Aigues Mortes. Sie ritten durch die sommerliche Blumenpracht der Camargue, zwischen stark duftenden Sträuchern und aufgelockerten Birkenwäldchen, bis sie an ein offenes Wasser kamen. Vitus sprang ab und hob sie vom Pferd. Sie hatten kein Wort gesprochen bisher.
»Du willst mir mein Leben nehmen«, sagte Loba, es war keine Frage.
Vitus nickte, ohne sie anzuschauen. Sie ging vor ihm auf das Wasser zu, Vögel schwirrten auf.
»Du kannst mir nicht die Wahrheit sagen«, sagte Vitus, »und ich muss die Kinder finden.«
»Mach deine Arbeit gut«, sagte Loba und blieb stehen.
Sie mochte die Fünfzig überschritten haben, sie war immer noch ein stattliches Weib. Er trat hinter sie, legte seine kräftigen Hände um ihren Hals, die Daumen auf den Nackenwirbel und drückte zu, bis ein Knacken ihm verriet, dass ihr Genick gebrochen war. Er beschwerte ihren gefesselten Körper mit zwei schweren Steinen und schleifte sie in den See, bis ihm das Wasser bis zur Hüfte ging. Dann stieg er auf sein Pferd und ritt von dannen.
Der Inquisitor samt seinen Beisitzern, dem Schreiber und dem mitgeführten Protokoll, erreichte Albi nie. Es hieß, faidits, angestiftet von Xacbert de Barbera, hätten sie erschlagen, weil sie Loba die Wölfin auf ihrer Heimreise nicht mehr bei sich führten.
Das Schnauben des Drachen
Chronik des William von Roebruk
Otranto, Herbst 1245
Das Zünglein des kleinen Geckos schnellte vor und umwickelte die Fliege in genau berechneter Flugbahn, kaum dass sie losschwirren wollte.
Die Fliegen rasteten auf der weiß gekalkten Wand, weil am Boden davor die leergegessenen Schüsselchen standen, mit den stark duftenden Resten von saurer Milch mit Honig und dem süßen Saft ausgequetschter Feigen. Das Geschirr hatten die Kinder dort hingestellt, um dem Gecko eine Freude zu machen. Es hatte etwas gedauert, bis das scheue Tier die Einladung angenommen hatte und Yeza es unterließ, ihn streicheln zu wollen. Roç lag bäuchlings am Boden und scheuchte die Fliegen zur Wand. Beide gingen völlig in der Spannung auf, ob die Geduld des Gecko die dumme Ruhelosigkeit der Fliegen überlisten würde.
Ich hatte mir den Stuhl in die Ecke des Nasengottes gerückt und war zunehmend erleichtert über das, was ich hörte, und froh, dass die Kinder nichts davon mitbekamen.
»Wenn ich es recht sehe«, meldete sich John, der Alte, zu Wort, »können wir bis auf Weiteres auf einen lebenden William von Roebruk nicht verzichten. Die Gefahr, die es nun einzig und allein zu bannen gilt, ist, die Schergen des Antichristen von den Kindern fernzuhalten, nach deren Blut sie lechzen. Vielleicht stehen die Henker des Papstes schon vor der Tür, vielleicht sind Meuchelmörder schon hier eingedrungen. Das sangreal muss sofort –«
»Beruhigt Euch, ehrwürdiger Meister«, unterbrach ihn Elia. Johns Stimme war zitternd vor Erregung abgebrochen. »Noch ist keine Gefahr, Otranto ist sicher –«
»Innen und außen«, beeilte sich die Gräfin zu versichern. »Meine Leute sind mir treu ergeben; sie würden sich für mich in Stücke hacken lassen! Und so erginge es auch jedem Verräter!«
»Die Lage ist ernst«, fasste der kühle Moslem zusammen. »Ohne jetzt Schuldzuweisungen auszuteilen: Der Aufenthaltsort der Kinder ist nicht länger geheim!«
»Die Kinder müssen sofort in Sicherheit gebracht werden!«, zeterte der alte John. »Ihr, Tarik, als Kanzler der Assassinen, die Ihr auf das heilige Blut geschworen habt, ihre Rettung –«
»Venerabile maestro«[3], unterbrach ihn nachsichtig der Angesprochene, »lasst uns den gemachten Fehlern keine neuen hinzufügen. Wohl muss dieser William Otranto lebend verlassen, und zwar mit den Kindern. Aber müssen es denn die Kinder sein? Wer kennt sie denn? Nur wir. Es muss also doch möglich sein, einen Jungen und ein Mädchen ungefähr gleicher Statur und gleichen Alters aufzutreiben. Ich werde sofort meine Leute ausschicken –«
»Halt!«, sagte die Gräfin. »Tarik, ich schätze Eure Übersicht und Eure Entscheidungsfreudigkeit, doch es gäbe unnötig böses Blut in Otranto, wenn Ihr hier wie die Piraten Kinder raubtet. Das Volk würde mich verdammen, und, was schwerwiegender wäre, es gäbe böse Zungen und übles Gerede, und am Ende wär’ all der Aufwand umsonst.« Sie überlegte nicht lange. »Wohltätig unterhalte ich am Hafen ein Waisenhaus, dort könnt Ihr Euch bedienen; nach den namenlosen Würmern kräht kein Hahn, zwei Schnäbel weniger!«
»Ach Laurence«, säuselte Elia, »was wären wir ohne Eure Tatkraft!«
»Das, was Ihr seid, Elia, ein schwacher Mann!«
»In dem Fall, Gräfin«, unterband der Assassinenkanzler aufkommenden Streit, »reicht mir Euren starken Arm und begleitet mich zu Euren Küken. Wir haben keine Zeit zu verlieren!«
Das Geräusch von sich entfernenden Stimmen hatte uns überhören lassen, dass jemand in mein Zimmer getreten war. Ein junger Mann.
»Das ist Hamo«, sagte Roç, »der Sohn von Tante Laurence.« Er stand schweigend hinter uns. Wie lange hatte er schon mitgehört? Die Kinder wirkten ziemlich verstört; anscheinend hatten sie doch etwas von dem mitbekommen, was da aus dem Ohr des Nasengottes zu uns herabgeschallt war.
»Sollen wir jetzt fort aus Otranto?«, fragte Yeza aufgeregt. »Du hast es doch gehört.«
Roç gab sich überlegen. »Sie wollen uns los sein!« Er dachte angestrengt nach: »Gut ist nur, dass William mit uns segeln kann!«
»Aber das Schiff ist noch nicht da«, wagte Yeza anzumerken.
»Dummerchen! Die nehmen der fremden Frau eben einfach ihr Schiff weg – die können sie sowieso nicht leiden – wetten?«
»Ich finde«, Hamo wirkte sehr erwachsen auf mich, »Ihr müsst jetzt hier verschwinden. Sie werden Euch suchen und sollten Euch nicht bei William finden – wie seid Ihr überhaupt hier reingekommen?«
»Durch die Tür, wie Ihr!« sprang ich schnell ein, gab ihm im Übrigen aber meine Unterstützung. »Ihr solltet jetzt besser gehen«, und als ich ihre Ratlosigkeit sah, fügte ich aufmunternd hinzu: »Wir haben ja wieder eine lustige Reise vor uns, da sind wir jeden Tag zusammen.« Das stimmte sie heiter, und sie stürmten aus dem Zimmer, dessen Tür Hamo hatte offen stehen lassen.
»Ihr könnt auch fliehen, William!« lud er mich ernsthaft ein. »Noch habt Ihr die Gelegenheit!«
Doch ich dachte nicht daran. Ich fühlte mich den Kindern verpflichtet, ob ich nun als ihr ›Vater‹ tituliert wurde oder als Mutterersatz, so wie ich mich selbst empfand.
»Was drängt Euch, junger Herr, zu so viel Anteilnahme an einem Unwürdigen?«, fragte ich vorsichtig.
»Ich hasse es, wie sie da oben Schicksal spielen – hört nur!«
Der zurückgebliebene John und Elia hatten ihr Gespräch wieder in die Reichweite unseres ›Ohres‹ verlagert.
»Ich werde meine Soldaten zur Verfügung stellen, und wir sollten Tarik vorschlagen, dass er Crean zum Führer bestimmt«, erörterte der Bombarone seinen Plan. »Der Trupp sollte so auffällig wie möglich mit William und den ›Kindern‹ durch die Lande reisen, gen Norden. Dicht an den Grenzen des Patrimonium Petri[4] entlang, doch nicht so nah, dass sie angegriffen und verhaftet werden könnten; denn diese Puppen darf natürlich keiner aus der Nähe zu Gesicht bekommen, nur ihr Ruf muss sich verbreiten, bis zur Engelsburg, bis zum Papst …!«
»Eine ausgezeichnete Idee, lieber Bombarone«, krächzte John, »so ausgezeichnet, dass ich mich frage, warum Ihr nicht gleich darauf gekommen seid. Hättet Ihr William direkt von Cortona aus zur Hölle oder zu den Mongolen geschickt –«
»Ehrwürdiger Meister«, Elia gab sich kleinlaut, »hätte ich William laufen lassen sollen, ohne vorher Eure Einwilligung zu holen? In Cortona konnte ich ihn nicht lassen. Wie wir erfahren haben, erdreisten sich die Päpstlichen dort, wie die Mäuse auf den Tischen zu tanzen –«
»Kaum ist Elia, der schwarze Kater, aus dem Haus!« Der alte John hatte seinen Humor nicht verloren.
»Hätte ich Euren preces armatae[5] nicht gehorchen sollen, mit denen Ihr mich – kraft Eures hohen Amtes – im Namen jenes Ordens, dem wir beide dienen, hierher bestellt habt? Ich hatte abzuwägen und tat es, nach bestem Wissen und Gewissen! Vergebt mir!«
»Fehler darf die Prieuré nicht verzeihen, unser Pakt mit den Assassinen ist der Garant für die notwendige Konsequenz, aber« – der alte John gab sich menschlich; er durfte es wohl, seine Stellung erhob ihn nicht über jede, aber über gewöhnliche Kritik – »Ihr konntet nicht wissen, dass William verfolgt wurde. Dass er überhaupt noch lebte, hatte Crean, mein Sohn, zu verantworten – Ihr konntet nicht wissen, dass die Kinder hier in Otranto waren. Das System, dass nicht alle in alles eingeweiht sind, hat seine Vor- und Nachteile. Wer nichts weiß, kann auch nichts verraten. Ihr wart unwissend, also kein Verräter, nur von der Glücksgöttin verlassen. Damit müsst Ihr leben. Ich spreche Euch frei.«
Elia schwieg lange. »John Turnbull, Conde du Mont-Sion, Ehrwürdiger Meister, Ihr seid ein kluger Mann – Ihr wisst, dass ich ein Mann des Kaisers bin; Ihr habt auch Euer eigen Fleisch und Blut bedacht. Warum fühlt Ihr kein Mitleid mit William, der auch nur unwissend, aber nicht als Verräter handelte?«
»Weil man Allahs Winken folgen soll«, griff überraschend die schneidende Stimme von Tarik wieder ein. »Aber, wie Euer Philosoph Boëthius[6] es sieht, wenn einer einmal unter das Rad des Schicksal gefallen ist, ist es besser, den Unglücklichen gleich zu erschlagen, bevor er Schaden anrichtet – oder gar wieder zur Höhe aufsteigt. Und wenn eine Fliege gleich zweimal in die Suppe fällt, venerabile, dann macht sich sogar der Koch strafbar, der sie herausfischt, ohne sie zu Tode zu bringen!«
»Wir haben«, verkündete mit verletzter Autorität John Turnbull, »eine Lösung gefunden, die die Situation sogar gegenüber dem status quo ante[7] verbessert –«
»Das Bessere ist des Guten Feind!«, warnte Tarik spöttisch, doch John ließ sich nicht beirren.
»Dazu bedarf es allerdings eines umsichtigen, energischen Führers – wir haben an Crean gedacht –«
»Kommt nicht infrage!«, erklärte Tarik schroff. »Ich musste schon bereuen, dass ich Crean de Bouviran einmal für dieses Unternehmen zur Verfügung gestellt habe. Er war durch seine Ortskundigkeit prädestiniert und hat doch in der Verantwortung versagt. Ein weiteres Mal verbietet sich schon aus diesem Grunde. Wir sind nicht emotionsbeladen wie Ihr aus dem Abendland, wo man aus Gefühlsduselei eine ›zweite Chance‹ willig erteilt. Und Befehlsgewalt über Crean habe nur ich, venerabile John Turnbull!«
»Ich will Euch dennoch, werter Kanzler, den Plan schildern«, mischte sich Elia missgelaunt ein. Nachdem das Damoklesschwert seiner eigenen Verurteilung von ihm genommen war, hatte er wieder Oberwasser, der alte arrogante Bombarone war zurückgekehrt. »Unser geliebter Heiliger Vater schickt zur gleichen Zeit, die wir hier vergeuden, Missionen in alle Welt: meinen Lorenz von Orta nach Antiochia, desgleichen den Dominikaner Andreas von Longjumeau. Den einen wegen Verhandlungen mit der griechischen Kirche, den anderen, auf dass die Jakobiter[8] seine Oberhoheit anerkennen mögen! Den Bruder des Letzteren, Anselm, nach Syrien und Täbriz –«
»Was, bitte, ist unser Interesse daran?« blaffte Tarik. »Wartet: Der Franziskaner Giovanni Pian del Carpine[9] bricht gerade auf, um über Süddeutschland und Polen die Tataren zu missionieren. Er soll bis nach Karakorum, an den Hof des Großkhans, reisen –«
»Ja, und?«
»Ihm werden wir William und die Kinder beigesellen; so können wir sicher sein, dass für die nächsten zwei Jahre ihr Schicksal in aller Munde ist, die Herzen bewegt, und – wenn sie dann nicht wieder auftauchen – tief betrauert werden; aber niemals wird ihre Reise angezweifelt werden, von niemandem! Pian ist eine über allen Verdacht erhabene Person, auch – und vor allem – in den Augen des Papstes und seiner Clique! Es geht also nur darum, William und die Kinder bis zu dem Punkt zu führen, wo sich die Wege schneiden – je länger wir zögern, desto weiter entfernt er sich!«
»Ich brauche Crean für andere Aufgaben.« Der Kanzler blieb hart.
»Ich werde sie führen!« erklang plötzlich Hamos Stimme über mir. Es war mir nicht aufgefallen, dass er mein Zimmer längst wieder verlassen hatte – wahrscheinlich hatte er aber dennoch dem Gang der Dinge gelauscht.
»Warte bitte draußen, bis man dich hereinruft!« war die erste Reaktion, die der Gräfin, der nicht anzumerken war, ob sie stolz war auf ihren Sohn, zufrieden, ihn aus dem Haus zu bekommen, oder als Mutter voller Angst und Sorgen. Bevor eine allgemeine Diskussion einsetzen konnte, hatte Laurence die Zügel wieder in der Hand. »Zu Tisch, meine Herren!«
Der Raum über mir leerte sich schnell. Kurz darauf wurde auch mir ein reichliches Abendessen gebracht, und in der Gewissheit, dass man mich noch lebend bis zu den Tataren verfrachten wollte, fraß ich mit größtem Appetit. Vorweg frische Austern, von mir mit Pfeffer bestreut und mit dem Saft einer Zitrone besprüht. Sie zuckten, wie es sich gehört, und meine Lebensgeister erwachten wieder in mir. Jetzt sollte Ingolinde mir gegenübersitzen; wir würden sie uns gegenseitig in den Mund stopfen, sie von unseren Zungen schlürfen. Aber das gute Mädchen aus Metz war wahrscheinlich längst beleidigt und enttäuscht wieder abgereist. Ich tröstete mich mit einer hervorragenden Fischsuppe, schleckte die Schalentiere ab, zerbrach die Krusten, lutschte und leckte und sog an Beinen, Köpfen und Gräten. Die fette, gedünstete Muräne, mit Fenchel und Salbei und schwammigen Morcheln, bekam ich kaum noch herunter. Wie gut hätte mir jetzt ein scharfer Ritt mit Ingolinde, meiner stattlichen Hur, getan! Doch zum Nachtisch gab’s nur Trauben ohne ihre feuchten Lippen, kein wogender Busen, kein dunkler Schoß ließ die Beeren tanzen, platzen oder verschwinden. Ich schob sie lustlos in mich rein und sank auf mein Bett.
Die Tür ging auf, und herein traten Elia und die Gräfin. Sie war eine herrische Gestalt, das wohl mit Henna nachgefärbte rote Haar straff zurückgekämmt, grüne Augen von einer leuchtenden Gefährlichkeit. Sie trug kaum Schmuck, einen kostbaren Ring, einen breiten Armreif.
Ich war sofort aufgesprungen. Während sie ans Fenster trat, befahl sie zwei ihrer Wachen, die rechts und links an der Tür Aufstellung genommen hatten: »Holt jetzt Hamo!«
Elia betrachtete die Reste meines Mahles. »William«, sagte er, »du hast dich hoffentlich gut erholt, denn heute Nacht geht die Reise für dich weiter –« Ich tat erstaunt und neugierig. »Der Sohn der Gräfin wird das Kommando über meine Soldaten haben, und ich erwarte von dir – zu deinem eigenen Besten – das gleiche einsichtige Betragen wie schon zuvor. Der Versuch, ein Wort mit einem Fremden zu wechseln, bedeutet das Ende deines noch so jungen Lebens, von einem Fluchtversuch ganz zu schweigen!«
»Seid unbesorgt, mein General«, antwortete ich mit der gebotenen Folgsamkeit. »Ich werde gehen, wohin Ihr mich schickt, wenn Ihr befehlt, bis ans Ende der Welt, nur lasst mich gehen – ich meine, macht mich nicht wieder auf einem Pferd sitzen! Noch mal halte ich das nicht durch, da wär mir ein schneller Tod, ein Stich ins Herz lieber als tausend Dolche in meinem –« Ich verschluckte das Wort in Anbetracht der Anwesenheit einer Dame, die mich sowieso schon streng musterte, als ich zur Gegenrede ansetzte.
»Er braucht sich um seinen dicken Arsch«, wandte sie sich an Elia, »nicht zu sorgen. Ich gebe euch eine weitere Sänfte mit, eine für ihn, eine für die Kinder. Das ist auch auffälliger!« Elia nickte, ich auch, voller Dankbarkeit.
»Du wirst«, fuhr Elia fort, »Bruder Pian del Carpine treffen und mit ihm Weiterreisen bis zum Großkhan. Du kannst die Kinder bis dorthin mitschleppen oder dich – nach Betreten des mongolischen Reiches – ihrer entledigen. Hauptsache, sie verschwinden spurlos, und ihr kehrt ohne sie zurück!«
Hamo war ins Zimmer getreten und hatte die letzten Sätze mitgehört. Er richtete seine Ansprache an Elia: »Um William mache ich mir keine Sorgen. Er hat verstanden, um was es für ihn geht. Aber um die Kinder. Sie brauchen für die Reise, wenigstens für den Teil, in dem wir im Licht der Öffentlichkeit stehen, unter den argwöhnischen Augen päpstlicher Spitzel, eine weibliche Begleitperson –«
»Nein!«, sagte die Gräfin schrill. »Nein!«
»Doch«, sagte Hamo fest und grausam. »Ihr Wohlbefinden, die Erfüllung ihrer Bedürfnisse allein garantieren ihr Wohlverhalten. Werden sie krank, schreien sie ihr Leid heraus, wird die Bevölkerung uns in den Arm fallen – die Entdeckung ihrer Identität ist dann die mögliche Folge, eine Gefahr –«
»– die wir nicht eingehen dürfen!« Der Turbanträger hatte leise den Raum betreten. »Klar gedacht und wohl gesprochen, junger Herr; ich sehe, Ihr seid Eurer Mutter ein würdiger Sohn – und ich nehme, was Euren Charakter angeht, den Vorwurf der Unreife zurück. Es bleibt, das ist nicht Eure Schuld, die Unerfahrenheit. Zusätzliche Risiken wollen wir nicht eingehen!«
»Ich verlange«, sagte Hamo mit leichter Verbeugung, »dass Clarion uns begleitet und sich um die Kinder kümmert!«
»Im Waisenhaus sind drei Ammen, ich verfüge über ein Nonnenstift, du kannst dir jede raussuchen, die du willst. Sie haben auch mehr Übung im Umgang mit Kindern als –«
»Ich bestehe auf Clarion.« Er wandte sich an Tarik, ohne seine Mutter eines Blickes zu würdigen. »Es handelt sich um ein Unternehmen von einer solchen Wichtigkeit und höchsten Vertraulichkeit, dass ich die Verantwortung nicht übernehme, wenn Ihr, Mutter, mir Clarion als Begleitung verweigert.«
Schweigen. Die Gräfin starrte aus dem Fenster, rüttelte kaum merkbar an den Gitterstäben, ihre Knöchel traten weiß hervor.
»Ich werde sie benachrichtigen«, entrang sich ihrer trockenen Kehle. »Sie wird sofort ihre Reisevorbereitungen treffen«, fügte sie dann sachlich hinzu, ohne sich umzudrehen. Sie verließ den Raum schnellen Schrittes.
Das wird sie ihrem Sohn nicht vergessen, dachte ich, diese Frau kann hassen …
»Ihr, William, folgt mir nun.« Hamo hatte das Kommando übernommen. »Ich möchte vermeiden, dass man Euch noch in diesem Zimmer antrifft.« Ich wusste, er meinte die Kinder, und mir war’s auch recht so. Der Abschied hätte mir das Herz zerrissen, hofften sie doch, mit mir reisen zu dürfen.
»William«, sagte Elia, »auch ich muss sofort abreisen, der Kaiser bedarf meiner. Mach unserem Orden der Minderen Brüder keine Schande.« Er klopfte mir aufmunternd auf die Schulter. Etwas wenig für das, was er mir eingebrockt hatte. Doch sind wir alle Diener irgendeines Herrn, und in seinem Falle waren deren, selbst in Anbetracht der Tatsache, dass die Kirche sich von ihm getrennt hatte, zumindest noch zwei geblieben.
Die beiden Wachen nahmen mich in ihre Mitte und führten mich Treppen und Gänge hinunter, einen selten oder nie benutzten Flügel des Kastells, zur Meeresfront hin gelegen. Das mussten wohl die Pferdeställe sein, von denen Roç berichtet hatte. Es herrschte Unruhe, ein Kommen und Gehen. Die Tiere wurden gefüttert und aufgezäumt. Aus den Rüstkammern wurden die Waffen verteilt.
Von der Besatzung der Burg hatte ich bislang nie jemanden zu Gesicht bekommen. Sie betraten wohl den Haupttrakt, in dem ich inhaftiert war, nur im Falle eines feindlichen Angriffs, einer Belagerung. Ich war erstaunt über die vielen Soldaten und Offiziere, die plötzlich das Souterrain des Castells bevölkerten.
Hamo, der hinter uns schritt, ließ die beiden Wachen wegtreten. Wir waren allein.
»Ich bin nicht Euer Henker, William. Gegessen habt Ihr schon, gut und reichlich. Was Ihr die letzte Stunde vor unserem Aufbruch für Eure Verdauung treibt, ist Eure Angelegenheit!«
»Ich hoffe, mein Stuhlgang wird sich rechtzeitig einstellen«, versicherte ich ihm. Hamo lachte.
»Ich meine mehr die seelischen Blähungen, die kleinen Herzensfreuden!« Ich war verwirrt – was hatte er mit mir vor –, zumal seine nächsten Worte meinen Argwohn noch steigerten: »Keiner sieht Euch zu, aber denkt daran, dass die Regel bereits Gültigkeit hat: Ein Wort nur, ein einziges Wort – und Ihr seid des Todes. Und nicht nur Ihr, sondern auch die Person, die es vernahm!«
Er schob mich in eine Kammer und schloss die Tür hinter mir: Auf dem Heu hingestreckt lag vor mir, im Halbdunkel des Raumes, Ingolinde.
»Mein William, endlich!« Sie breitete ihre Arme aus und war bereit, mich an ihren bereits entblößten herrlichen Busen zu ziehen. Ich legte den Finger auf den Mund und versuchte, ihr durch Gestik klarzumachen, dass mir das Sprechen untersagt war. Sie musste denken, ich spinne, bin infolge Haft und Folter nicht mehr Herr meiner Sinne. »Mein armer Kleiner, was haben sie mit dir gemacht?«
Ich beschloss, ihr den Mund zu stopfen, denn auch unbeantwortete Fragen konnten verräterisch wirken, und ich wollte jetzt, gerade jetzt, nicht sterben! Ich warf mich zu ihr ins Heu, wir rollten in dem weichen, duftenden Bett, das auf so angenehme Weise nackte Haut erregt. Das gute Mädchen aus Metz hatte Sinn für meine Hast, öffnete sogleich ihre weichen Schenkel und nahm mich unfreiwilligen Trappisten zur Brust. Ich rammelte, als ginge es um mein Leben; dabei tat ich es mehr auf Vorrat, denn mit dem Nachlassen des ersten Ungestüms – zwei, drei Wochen hatte ich nur einen Pferderücken als Widerpart meiner Lenden gespürt – wurde mir drückend bewusst, dass nun Monate der einsamen Hose vor mir lagen. Meine Bewegungen erschlafften bei dieser tristen Aussicht, doch gerade diese Trägheit entflammte den Schoß der Dame, der sonst von schnellen Attacken lebte. Sie stöhnte, ihre schönen Augen füllten sich mit Tränen, sie schrie vor Lust, und ich vögelte sie ratlos weiter, immer nur an mein blödes Schicksal denkend, an eisige Nächte in fernen, felsigen, menschenleeren Gebirgen, an Durst und Hitze in Steppe und Wüste, ich erlosch langsam zur völligen Leblosigkeit, nur noch mechanisch Schritt vor Schritt setzend, es federte nur noch der Heuhaufen, doch Ingolinde erbebte unter ihnen, als würden Reiterregimenter, ganze Tatarenhorden über sie herziehen; sie tobte, wand sich, bäumte sich auf und fiel schließlich zurück in die Kuhle aus getrocknetem Gras, die wir uns wie die Kaninchen gerammelt hatten; ihr Busen zitterte.
Endlich schlug sie die tränennassen Augen wieder auf, lächelte mich an.
»Hallo, schöner Fremder!«
Ich küsste sie zärtlich auf den Mund, ohne ihren Schoß im Stich zu lassen, ja bereit für einen neuen Ritt. Es pochte an die Tür.
»Es ist Zeit, William!«
Ingolinde schaute mich fragend an. Ich zog den Abschied nicht in die Länge. Ich erhob mich, klopfte die Halme von meiner Kutte und ließ sie auf dem Lager unserer Lust zurück. Ohne mich noch einmal nach ihr umzudrehen, schloss ich die Tür hinter mir. Die beiden Wachen standen davor und ließen sich nicht anmerken, ob sie uns zugesehen oder -gehört hatten, oder beides. Schweigend führten sie mich zum Haupttor.
Es war bereits tiefe Nacht, wenige Fackeln erhellten das Torgewölbe. Die Zugbrücke war noch nicht heruntergelassen. Man hieß mich warten. Ich bestieg die mir zugewiesene Sänfte und schlief auf der Stelle ein.
Leere Betten
Nur in dem gräflichen Wohnteil der Burg fiel noch Licht aus den hohen Fenstern. Laurence stand in ihrem Schlafzimmer und starrte hinaus in die Nacht, auf das Meer. Hinter ihr eilte Clarion geschäftig hin und her, zog Kleider aus Schränken und Truhen, hielt sie probehalber an sich, verwarf sie, tauschte sie aus, verstaute Bänder, Gürtel, Tücher und Taschen in verschiedene Reisekörbe, von denen bereits eine beachtliche Anzahl bereit stand, weggetragen zu werden.
»Willst du mich auf immer verlassen?«, spottete Laurence. »Zur Erfüllung deiner Aufgabe als Zofe von zwei namenlosen Waisenbälgern brauchst du nicht die Aussteuer einer Prinzessin mitzuschleppen!«
Clarion ging nicht darauf ein, sondern packte verbissen weiter.
»In zwei, drei Monaten bist du spätestens zurück«, suchte die Gräfin einzulenken. »So viel Bagage belastet dich doch nur, und du wirst auch kaum dazu kommen, von all der Pracht Gebrauch zu machen!« Laurence schritt die Körbe und verschnürten Bündel ab, geringschätzig mit der Fußspitze an sie stoßend.
Ohne ihre Tätigkeit zu unterbrechen – sie hatte jetzt Schmuckschatullen auf dem Bett ausgeleert und begann ihren Inhalt neu zu sortieren –, gab Clarion ihr Antwort:
»Erstens muss ich sie nicht schleppen, dafür gibt es Lasttiere und Personal! Zweitens: Kann ich ein schönes Kleid nur einen einzigen Abend tragen, hat sich die Mühe dafür schon gelohnt!«
Laurence war vor ihr, auf der anderen Seite des Bettes , stehen geblieben. Sie beherrschte ihren Ärger mühsam: »Also doch auf Brautschau?« Sie wühlte mit ihrer Hand in den Ketten, Broschen und Ringen, die von Clarion mühsam hergestellte Obersicht mutwillig zerstörend, griff sich einen Goldreif: »Habe ich dir das alles geschenkt, damit du vor Männern damit prunkst, ihr geiles Gefallen suchst?!«
»Wenn ich nur einem gefalle, nur für eine Nacht –« Clarion kam nicht weiter, Laurence hatte blitzschnell zugeschlagen.
Clarion biss die Zähne aufeinander; ihre Augen funkelten. »Gehört irgendetwas dir, Laurence, dann nimm es bitte an dich. Ich –«
»Du gehörst mir!« Mit dem Satz einer Tigerin war Laurence auf das Bett gesprungen und schlang ihre Arme um Clarions Hüfte. Das Mädchen war so beeindruckt, dass es das Geschmeide in seinen Händen fallen ließ und sich zu ihr niederbeugte. Ungeachtet der spitzen und harten Juwelen, Nadeln und Schnallen stürzten beide auf das Lager.
»Du hast mir befohlen zu reisen«, schluchzte Clarion. »Du hättest es mir ja verbieten können, du hättest mich schützen –«
Laurence suchte und fand ihre Lippen, bevor sie sich seufzend erhob. »Es musste sein. Die Prieuré hätte mir die Weigerung nicht verziehen.«
Auch Clarion richtete sich wieder auf und trocknete ihre Tränen. »Es ist ja nicht für lang, Laurence – und wenn wir alle Opfer bringen müssen, dann sollten wir es uns nicht unnötig schwer machen.«
»Du hättest dich ja auch weigern können«, entschuldigte Laurence ihre Heftigkeit. »Es hätte nichts genutzt, aber ich hätte gespürt, dass du mich liebst, nur mich!«
Clarion streichelte über das Haar der Gräfin, die sich Hilfe suchend an sie lehnte. »Bald bin ich wieder bei dir, bin wieder deine Hur, dein Liebling, dein schamloses Mensch!« Beide mussten lachen. »Was treibt eigentlich diese Dirne«, lenkte Clarion ab und begann wieder Ordnung in die Schatullen zu bringen, »die so scharf auf unseren Mönch ist?«
Laurence war wieder ans Fenster getreten, konnte aber das Schiff des Weibsstücks im kleinen Hafen im Dunkeln nicht mehr ausmachen. Sichtbar flackerte dort unten nur das Leuchtfeuer der Hafeneinfahrt.
»Diese Person besitzt die Frechheit, die Weiterfahrt zu verweigern, bis man ihr William ausliefert. Um Ärger zu vermeiden, hat Hamo ihr für heute Nacht gestattet, noch zu bleiben.«
»Und morgen früh sind wir mit ihrem Schatz längst über alle Berge«, frohlockte Clarion. »Sie wird sich wundern!«
»Morgen früh werde ich sie davonjagen!«
»Lass sie wissen«, warf Clarion ein, die von Hamo über Sinn und Zweck der Reise informiert war, »dass William mit den Kindern vor ihr geflohen ist. Je mehr Gerede um die Reise des Mönches William von Roebruk entsteht, desto besser ist sie gelungen – nur deswegen nehme ich auch diesen kostbaren Tand mit, um unterwegs so viel Aufsehen zu erregen wie nur irgend möglich!«
»Liebling, du bist und bleibst eine Hur!« Laurence umarmte ihre Ziehtochter; sie küssten sich wie Ertrinkende, ihre Hände tasteten sich mit zunehmender Gier über ihre Körper, schwankend bereit, nochmals aufs Bett zu fallen. Dann riss Clarion sich los.
»Sie warten auf mich!«
Die Gräfin läutete nach den Trägern, und sie begaben sich durch die nächtliche Burg zum Haupttor, wo sich auch Elia eingefunden hatte, der Hamo die letzten Anweisungen für die Reise gab.
Laurence verabschiedete Clarion vor dem Fallgitter. Sie hatte nicht vor, ihren Sohn zu verabschieden.
In dem dunklen Zimmer, das William beherbergt hatte, knarrte leise die Bodenluke unter dem leeren Bett.
»William?«, flüsterte Yezas Stimmchen. »William!«
Keine Antwort. Nur das Mondlicht fiel durch das vergitterte Fenster. Sie stieß die Klappe mit aller Kraft unter die Matratze, einige Male, mit zunehmender Sorge, die sich zur Angst wandelte.
»Er ist weg«, sagte sie traurig zu dem sie haltenden Roç.
»Bist du sicher?«
»Wenn er schläft, schnarcht er«, flüsterte Yeza. »Sie haben ihn weggebracht!«
»Aufs Schiff, Yeza!«, knurrte Roç und zog sie heftig an ihren Beinen zurück. Die Klappe knallte über ihren Köpfen. »Aufs Schiff«, fauchte er in wütender Genugtuung, »wie ich dir gesagt habe!«
Sie krochen den Gang zurück, bis sie an eine Maueröffnung kamen, von der aus sie den Lastensegler an der Mole sehen konnten. Er war also noch da.
»Komm!«, sagte Roç energisch. »Die legen uns nicht rein!«
Sie stiegen die in der Mauer verborgene Wendeltreppe hinab, sich in völliger Finsterkeit vortastend.
»Ich werde im Zimmer unsere Sachen packen«, ordnete Yeza verschwörerisch an. Wenn es um den entscheidenden Anstoß zu Streichen und Abenteuern ging, war sie immer die erste; für Vorbereitung und Durchführung war Roç zuständig. Aber sie kommandierte: »Und du schleichst dich in die Küche und klaust Schinken und Äpfel. Wir brauchen nämlich Proviant!«
Roç war die Arbeitsteilung recht, und nur, um von seinem Sachwissen auch etwas beizusteuern, ermahnte er sie: »Nimm auch Wollzeug und warme Decken mit, auf dem Meer ist es nachts sehr kalt!«
»Wir treffen uns an der Rutsche, bei den Futterkammern, hinter den Ställen«, flüsterte Yeza. »Die Treppe ist zu gefährlich, jemand könnte uns begegnen.«
»Und dann rutschen wir den Geheimgang runter und kommen genau beim Schiff raus –«
»– oder fallen ins Wasser!« Während Yeza trotz ihrer Fantasie und der schnellen Bereitschaft, etwas auszuhecken, stets auch ein gesundes Misstrauen bewies, wurde Roç mit zunehmendem Einstieg ins Abenteuer vom aufmerksamen, beharrlichen Forscher zum tollkühnen Draufgänger. Angst kannten sie freilich beide nicht.
»Ach was«, sagte Roç.
»Wir waren bis da unten doch noch nie!« insistierte Yeza.
»Ich weiß es aber!« beharrte Roç.
»Ich weiß, es ist gefährlich, wie Ertrinken«, sicherte ihm Yeza zu. »Deswegen ist es ja auch schön!« Sie lachte ihr silberhelles Elfenlachen im Dunkeln. »Vor allem, wenn’s keiner weiß!«
Roç kamen Bedenken: »William müssen wir aber Bescheid sagen! Er muss uns ja auch verstecken!«
»Quatsch!«, sagte Yeza. »Wir verstecken uns selber auf dem Schiff, und wenn wir dann auf dem Meer sind, machen wir William eine freudige Überraschung!«
Roç wusste, dass jeder Widerspruch sinnlos war. »Wir müssen uns beeilen, sonst fährt er ohne uns ab!«
So hatte er wenigstens das letzte Wort, und beide machten sich auf den Weg.
II DES KAISERS MINORIT
Der Köder
Chronik des William von Roebruk
Otranto, Herbst 1245
Es war weit nach Mitternacht, als unser Zug aufbrach. Ich war kurz aufgewacht, als sich meine Sänfte in Bewegung setzte. Ich sah noch, wie ein junges Mädchen in die andere stieg – das musste Clarion sein, Hamos Halbschwester oder zumindest die schöne Ziehtochter der Gräfin.
Zwei Bündel wurden ihr nachgereicht, so wie Yeza und Roç damals von Lobas Hütte fortgeschafft worden waren. Heute würden sich die Kinder, wie ich sie jetzt erlebt hatte, eine solche Verpackung herzlich verbitten!
Wann würde ich sie wohl wiedersehen? Dass ich nicht das letzte Mal ihren Weg gekreuzt hatte, war für mich inzwischen zur Gewissheit geworden. Weit lag Frankreich zurück, sein frommer König und auch der Montségur. Hätten mich nicht die Kinder noch einmal darauf gebracht, für die die verlorene Mutter noch immer ein Problem war, ich hätte ihn längst vergessen. Ich war eingetaucht in ein neues Leben, ich war ein anderer Mensch, mit zufällig noch dem gleichen Namen. Ich befand mich auf eine merkwürdige Art in Gottes Hut, wenngleich ich ihm weniger diente als je zuvor in meinem Leben; ich betete kaum noch, ließ ihn – wie mich – einen guten Mann sein, und doch schenkte er mir reuelosen Genuss und vor allem Selbstvertrauen.
Genau besehen, hatte ich indes wenig Grund, so zuversichtlich gestimmt zu sein. Vor mir lag mit Sicherheit eine strapaziöse Reise, gespickt mit mir noch unbekannten Abenteuern. Unser nächstes Ziel war Lucera. Dort sollten die beigefügten Soldaten der Gräfin gegen Mannschaften aus der sarazenischen Garnison ausgetauscht werden, um Otranto nicht schutzlos zu lassen. Die Sarazenen sollten uns bis Cortona geleiten, wo Elia Anweisung für einen ersten Zwischenaufenthalt erteilt hatte.
»Danach wäre dann auch der gefährlichste Abschnitt passiert, das Durchqueren der Abruzzen, wo Unsicherheit herrscht und sich Päpstliche und Kaiserliche überfallartige Scharmützel liefern. Die späteren Pässe über den Apennin und dann über die Alpen waren fest in der Hand des Staufers – lombardische Unwägbarkeiten mal beiseite gelassen!« Hamo hatte sein Pferd neben meine Sänfte gelenkt, kaum dass wir Otranto verlassen hatten. Ich hatte das Gefühl, dass er ganz froh war, in mir einen vielgereisten und verständigen Gesprächspartner zu haben, bei dem er nicht – wie gegenüber den langgedienten Soldaten, die er jetzt befehligte – den überlegenen, allwissenden Feldherrn spielen musste.
Doch es war vor allem ein einfacher Sergeant, ein alter, o-beiniger Seeräuber, Guiscard d’ Amalfi, auf den sich Hamo verließ. Der Normanne hatte schon dem verstorbenen Grafen als Bootsmann gedient, hatte alle Ecken des Mittelmeeres besegelt, bevor er auf dem Kastell von Otranto als gräflicher Waffenmeister zur Landratte geworden war.
»Guiscard ist ein kartografisches Genie – er hat Land und Wüsten im Kopf wie andere die Äneis des Vergil[10]; mit wenigen Strichen zeichnet er Flüsse, Gebirge mit ihren Furten, Straßen und Pässen in den Sand, deren Proportionen wie auch seine Entfernungsangaben immer genau stimmen, wie du feststellen wirst«, pries Hamo ihn mir.
Sein Defekt war allerdings, wie sich schnell herausstellen sollte, dass es nichts auf Erden gab, was er sich nicht zutraute; jede Tollkühnheit schien ihm normal, jeder Wahnwitz eine Herausforderung. Sein Wahnsinn flatterte ihm voran wie eine Fahne und – das war das Schlimme – sprang auf Hamos junge Hundeohren über wie ein Rudel Flöhe.
Ich befand mich in einer schwierigen Lage – Gefangener einerseits, und doch von den Nornen eingeladen, an unser aller Schickal mitzuweben. Hamo mochte ich nicht trauen, zu sehr schien mir sein Handeln von verletztem Stolz und törichter Eitelkeit bestimmt und durch keinerlei Erfahrung mit dem rauen Alltag eines kriegerischen Unternehmens zur Besonnenheit gedämpft. Der Sergeant hingegen war mit allen Wassern gewaschen, Krieg war sein Handwerk, doch leider suchte er das Abenteuer auch, wenn er es nicht schon vorfand.
Hätte ich mich aus allem rausgehalten, hätte ich mich gefühlt wie zwischen zwei Mühlsteinen. So konnte ich mir wenigstens einbilden, mein Rat sei das Wasser, das sich auf die eine oder andere Mühle goss. Wo ich mich schon entschlossen hatte, nicht wegzulaufen, mochte ich auch nicht als störrischer Esel dastehen.
Eine bequeme Sänfte war der erste Lohn für solch positive Einstellung. Um mein übriges leibliches Wohlergehen machte ich mir keine Sorgen. Häftlingsschicksal ist wahrscheinlich nur grässlich, wenn man ohne Hoffnung und persönliche Ansprache Teil einer grauen Masse ist. Hat sich einer über diese erhoben, Beachtung erzeugt und gefunden, ist gute Behandlung eigentlich die logische Folge. Ich könnte mir den Rest meines Lebens als Sonder-Gefangener gut vorstellen. Gefahr ist nur gegeben, wenn das Interesse der Höheren an dir erlischt, dann lassen sie dich tief fallen, präzise in den Tod, während in dem grauen Heer der Namenlosen ein Überleben gegeben ist. Doch was für ein Leben?
Im Morgengrauen zogen wir an den Mauern von Lecce vorbei. Die zum Markt strömenden Bauern zogen den Hut vor mir …
Böses Erwachen
»Die Kinder! Die Kinder sind verschwunden!«
Von diesem Lamento ihrer Zofen und Zimmermädchen wurde die Gräfin jäh aus ihrem Tiefschlaf gerissen. Die Sonne stand schon hoch am Himmel. Sie sprang aus dem Bett, stieß die Ankleiderin, die Badefrau und die Kämmerin beiseite und raste zum Zimmer der Kinder. Die Decken der Betten fehlten, wie auch etliche Wäsche.
»Was steht ihr noch dumm herum?!« fuhr sie Köchin, Amme und Gouvernante an. »Sucht sie!«
Sie ließ die Wachen rufen; keiner hatte die Kinder an diesem Morgen gesehen. Die Soldaten erhielten Zutritt zu den inneren Gärten und den Gebäudeteilen, die sie ansonsten nicht zu betreten hatten.
Crean tauchte auf; er wollte sofort Tarik wecken lassen. Die Gräfin hielt ihn davon ab.