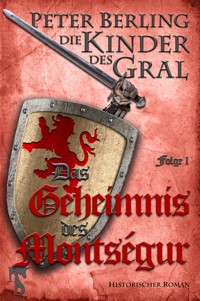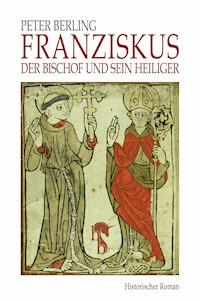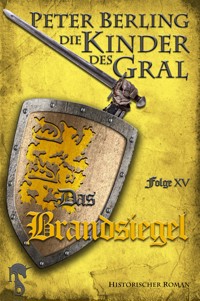3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Roç und Yeza ist die Flucht aus Jerusalem gelungen, sie haben die Stadt, die in Hass zerfällt, hinter sich gelassen. Sie ziehen mit einer Karawane des Sultans von Damaskus, die den größten Teppich der Welt an die Truppen des Großkhans als Friedensangebot überbringen soll. Doch die Karawane wird von einem Emir überfallen, erneut werden Roç und Yeza getrennt. Während Roç seine Zeit mit leichtlebigen Abenteuern vertändelt, entbrennt um Yezas Gunst ein blutiger Balztanz, erst in der Oase von Palmyra findet sie Frieden und Ruhe vor ihren Verehrern. Inzwischen haben die mongolischen Truppen, die ihnen den Thron zur Welt ermöglichen sollen, das Land verwüstet, auch Palmyra bleibt davon nicht verschont. So wartet Yeza nur auf Roç, um dem Großkhan mitzuteilen, dass »Die Kinder des Gral« den angebotenen Thron nicht besteigen wollen. Dann aber erreicht sie Nachricht aus Karakorum: Der Großkhan ist tot … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil XVI fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PETER BERLING
Das Haupt des Drachens
Folge XVI des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE XV
Das Brandsiegel
Mehr tot als lebend schwemmt es Roç an die Küste Syriens. Helfer und Unterstützer pflegen ihn gesund.
Nachdem der Freibeuter Yeza sicher an Land gebracht hat, stellt er sich den Templern. Kaum ist Yeza im Nildelta gelandet, hört sie, dass der neue Sultan der Mameluken sie abzufangen gedenkt. Freunde helfen ihr, vom Süden her, also übers Rote Meer, nach Jerusalem vorzustoßen.
Der kühne Seefahrer wird in Askalon vor das Hochgericht der Templer gezerrt. Roc, als Zeuge zum Prozess geschafft, kann das Todesurteil des Rivalen nicht verhindern. Yeza erreicht Jerusalem.
Der Freibeuter soll gehängt werden, obgleich man ihm ehrenvolle Enthauptung zugesagt hat. Roç zwingt den Henker, den letzten Wunsch des Mannes zu erfüllen.
Die Armee der Mongolen erstürmt Aleppo. Yeza und Roç, wieder vereint in Jerusalem, nehmen Quartier in der Al-Aqsa, dem Sitz der Templer, jener Moschee, unter der sich die ›Pferdeställe Salomons‹ befinden. Das ›Königliche Paar‹ hat alle gegen sich, Christen, Juden, Muslime. Hoffnung können sie nur in die herannahenden Truppen des Khans setzen.
Jerusalem bereitet sich auf den Mongolensturm vor. Die ›Kinder des Gral‹ steigen in die Tiefe der Al-Aqsa, finden das Becken, dessen dunklen Wassern der Schwarze Kelch entstiegen. Freiwillig begeben sie sich in den ungewissen Born, versinken vor den Augen Williams … Die Außenmauer des Tempels birst, sie gelangen unversehrt, aber doch als ›andere‹, wieder ans Licht, durchqueren die Bresche, um das in erbitterter Feindschaft verstrittene Jerusalem hinter sich zu lassen.
Christen, Juden, Muslime schlagen sich in mörderischem Hass, ein gewaltiger Sturm zieht auf, Roç und Yeza schreiten unbeirrt hinein in das Wüten der Natur …
I DER UNHOLD VON MARD’HAZAB
Die Macht des Schamanen[1]
Die Karawane hatte – um die Sümpfe im Südteil des Urmia-Sees zu – einen weiten Bogen geschlagen und war dabei tief in die Wüste geraten. Auch hatte man ihnen in Täbriz eingeschärft, die Nähe des Sees unter allen Umständen zu meiden, denn auf einer Landzunge in dessen Mitte würden die Mongolen gerade eine Zwingburg errichten, weniger um das Land zu knechten, als um die unermesslichen Schätze zu horten, die ihnen bei der Eroberung von Bagdad und Aleppo in die Hände gefallen waren. Es wimmelte von mongolischen Streifen, mehreren Hundertschaften, deren Aufgabe es war, die Sklaven zu bewachen und anzupeitschen, die im pausenlosen Strom das Gold heranschleppten. Um die Festungsanlage von Schaha herum hatten die Mongolen zudem einen ehernen Ring gelegt. Wer unbefugt innerhalb dieses Sperrbezirks angetroffen wurde, hatte sein Leben verwirkt. Er wurde auf der Stelle niedergemacht. Es war aber nicht die Sorge um ihr Leben allein, die jene Karawane aus Täbriz vom kürzesten Weg abgebracht und in die Wüste gedrängt hatte, sondern ihre absonderliche Schwerfälligkeit, denn wie einen riesigen Rammbock schleppten die achtundzwanzig Kamele eine gewaltige Teppichrolle, die zwischen den Tieren an breiten Gurten aufgehängt war. Je vier von ihnen schritten nebeneinander, und sieben solcher ›Gespanne‹ folgten einander dicht an dicht. Das Gewicht ihrer Traglast hielt sie zusammen und schob die Tiere vorwärts, ließ keinen Ausbruch, kein Einknicken zu, dafür sorgten schon die sie umschwärmenden Treiber. Die Beduinen auf ihren schnellen Reitkamelen waren vor allem bemüht, vorausschauend im steinigen Gelände den geeignetesten Weg zu finden, mit den geringsten Hindernissen, um den bedächtig sich dahinschleppenden Tross nicht zum Stillstand kommen zu lassen.
Denn auch abrupte Richtungsänderungen ließ die starre Last nicht zu.
So war es geschehen, dass sie sich mehr und mehr von ihrer ursprünglichen Marschroute entfernt hatten und bald nicht mehr wussten, wie sie ihren Kurs korrigieren sollten. Lagern inmitten der Wüste kam nicht infrage, die jetzt noch gleichmütig voranstapfenden Tiere brauchten Wasser. Die Beduinen, die sich und die Kamele bis dahin mit lauten Rufen angefeuert hatten, verfielen nach und nach in bedrücktes Schweigen, ihre Blicke richteten sich erst fragend, dann vorwurfsvoll auf den Ältesten, ihren Anführer, doch dessen Turban senkte sich zusehends immer tiefer, sich dem Unausweichlichen schließlich fügend. Stumm zog die Karawane ihres verlorenen Weges.
Keiner wusste später zu sagen, wer ihn zuerst gesehen, woher er gekommen. Die seltsame Gestalt, in einen weiten Mantel gehüllt, an dem Silberplättchen die Sonne spiegelten, Federn und Knöchelchen von Vögeln baumelten, schritt plötzlich vor der vordersten Viererreihe und lenkte sie, ohne ein Wort zu sagen, ohne einem der Tiere ins Halfter zu greifen, in eine neue Richtung. Dass die sonst so starrsinnigen Kamele ihm so willig folgten, mochte auch an der zotteligen Bestie gelegen haben, die sich hinter dem Fremden auf ihren Tatzen aufrichtete: ein ausgewachsener Bär, der seinem Herrn und Gebieter mit großer Selbstverständlichkeit folgte. Arslan[2] der Schamane strahlte eine Ruhe und Zuversicht aus, der sich die Lastkamele viel schneller ergaben als die verstörten Söhne der Wüste. Als er schließlich der Karawane mit Sanftmut seinen Willen aufgezwungen und sie behutsam gewendet hatte, hob Arslan ebenso langsam seinen Arm und deutete zum Horizont, wo sich die Hügelkette erhob, die sie überwinden mussten. Im flirrenden Dunst der Hitze erblickten die Beduinen die Palmenwipfel einer Oase – zwar immer noch in einiger Entfernung, aber verlockend nahe, verglichen mit der hoffnungslosen Weite der Steinwüste, der sie gerade entronnen waren. Sie wagten nicht den seltsamen Alten anzusprechen, schon aus Furcht, er könnte sie wieder verlassen. Der Schamane schien der Karawane voranzuschweben wie ein guter djinn[3], selbst der hinter ihm herzottelnde Bär glitt über den harschigen Felsengrund, als sei es der glatte Wasserspiegel eines Sees. Da die Kamele dem neuen Führer bedingungslos und zügig folgten, hielten sich die Treiber – auf einen herrischen Wink ihres Ältesten – zurück und vermieden alles, was den Fremden und seinen pelzigen Begleiter stören könnte. In gebanntem Schweigen und gebührendem Abstand ritten sie hinter ihren Tragtieren her, nur ihr Anführer hielt seinen Blick fest auf die dicke Teppichrolle gerichtet, als habe er Angst, dass die kostbare Last sich plötzlich in Luft auflösen könnte. Diesen Zauberern aus dem fernen Osten war jeder teuflische Trick zuzutrauen! Wer weiß, ob dieser alte Hexer es nicht einzig und allein auf den ›Vater der Teppiche‹ abgesehen hatte? Doch weder der Schamane noch sein Bär drehten sich auch nur einmal nach dem unhandlichen Beweis exquisiter Webkunst um. Unbeirrt schritten sie auf den fernen Palmenhain zu, der nicht näher kommen wollte, obgleich die Beduinen schon das Wippen der grünen Wedel im leichten Wind deutlich wahrzunehmen vermeinten.
Lang zog sich der mühselige Marsch, und als endlich das ersehnte Ziel von Labsal und Schatten in greifbare Nähe gerückt schien, verblasste plötzlich das dunkle Grün der Palmen wie ein Trugbild, und übrig blieb ein Haufen unwirtlicher Felsbrocken in der vor Hitze glühenden Landschaft. Inmitten dieser trostlosen Einöde erhob sich neben einem von Steinen sorgsam eingefassten Brunnen ein ärmliches erdfarbenes Zelt, und davor saßen im würdevollen Schneidersitz zwei junge Menschen, die so wenig mit ihrer Umgebung gemein hatten wie der auf sie zutappende Bär. Erwartungsvoll und völlig furchtlos sahen sie den Ankommenden entgegen. Die Frau war unverschleiert und trug nicht einmal ein hijab[4], langes blondes Haar fiel ihr über die Schultern. Der Jüngling neben ihr wirkte eher wie ein schön gewachsener Knabe als wie ein Krieger, und auch die Art, mit der er das stolze Weib neben sich duldete, wies ihn in den Augen der Beduinen nicht gerade als geborenen Herrscher aus. Doch der ihnen voraneilende Schamane verneigte sich ehrfürchtig vor dem Paar und wandte sich um zu der Karawane. Der gleichmütige Trott der Kamele kam zum Stillstand, die Beduinen drängten sich neugierig, aber noch scheu und befangen vor.
»Lobt Allah, Euren Gott, und dankt ihm für die Euch erwiesene Gnade«, sprach Arslan mit fester Stimme. »Ihmidu allah! Neigt Euer Knie vor den Königen der Welt!«
Während die Beduinen noch verunsichert auf ihren Ältesten schauten, knickten die Kamele wie auf unhörbares Kommando die Vorderbeine ein und ließen dann langsam auch die kräftigen Hinterläufe folgen, die Teppichrolle berührte auf ganzer Länge gleichzeitig den Boden und kam zwischen den Tieren zu liegen. Da beugte der Älteste sein Knie vor Roç[5] und Yeza[6], und alle seine Mannen taten es ihm nach.
»Al hamdu lillah, gepriesen sei Allah!«, rief der Mann. »Er ist groß und allmächtig!« Dann richtete er das Wort an den Schamanen. »Mir blutet das Herz, das erhabene Königliche Paar auf nacktem Felsengestein lagern zu sehen.« Er verneigte sich ums andere Mal. »Gestattet uns, den Kelim vor diesen Königen auszurollen, damit seine kühle Glätte ihre zarten Glieder umschmeichelt!« Er war sich so sicher, dass sein Vorschlag vollste Zustimmung erfahren würde, dass er seinen Leuten bereits das Zeichen gab, sich über die Rolle herzumachen, doch da sprang der Schamane mit Vehemenz zwischen sie, der Bär stieß ein drohendes Brummen aus.
»Untersteht Euch«, fauchte Arslan den erschrockenen Alten an, »diesen Teppich weltlicher Macht vor den Königen auszubreiten, deren Herrschaft allein die Stärke ihres Geistes bestimmt, kraft des Blutes, das in ihren Adern fließt!«
Die Beduinen waren eingeschüchtert zurückgewichen. Weniger als Entschuldigung als zur Erklärung seiner Heftigkeit wandte sich der Schamane Roç und Yeza zu, die keine Miene verzogen hatten. »Euer Erscheinen auf der Bühne dieser Welt, meine Könige, sollte nicht länger auf sich warten lassen«, beschwor er sie eindringlich, »doch der Pfad, den Ihr betreten müsst, ist schmal und dornig.« Er blickte den beiden in die Gesichter, in das von Yeza, über das jetzt ein wissendes Lächeln huschte, und in das trotzig fragende von Roç. »Hütet Euch vor dem bequemen Weg, der Euren Trieben und Launen entgegenkommt, der leichte Erfüllung Eurer Wünsche verspricht und Euch äußerliche Macht, billigen Ruhm und kleines menschliches Glück vorgaukelt – « Arslan hielt kurz inne, die Wirkung seiner Worte musste er nicht überprüfen, er spürte den Widerstand von Roç und die Skepsis von Yeza auch, ohne ihnen in die Augen zu schauen, dennoch sollte die Warnung nicht unausgesprochen bleiben. »Auf diesen Teppich setzt ungestraft keiner seinen Fuß. Hütet Euch vor dem Kelim, so verlockend er sich Euch auch andienen wird.« Der Schamane schien noch eine Steigerung seiner Beschwörung auf der Zunge zu haben, eine dunkle Bedrohung, die von der ungeöffneten Rolle ausging, die ihr innewohnte wie ein böser djinn, doch er schloss nun Mund und Augen. So wie er gekommen war, verschwand er auch.
Keiner der Beduinen konnte sich erinnern, dass er ihn und seinen Bären hatte davonziehen sehen. Arslan hatte sich in Luft aufgelöst. Roç und Yeza erstaunte das nicht. Der abrupte Abgang des Schamanen bewirkte zumindest, dass seine Worte einen Nachhall in ihren Herzen fanden. Seiner magischen Kraft konnten sie sich nicht verschließen. Sie erhoben sich als Könige und wiesen die Beduinen an, ihr Zelt abzubrechen und auf einem der Tragtiere zu verstauen. Mit größter Selbstverständlichkeit machten Roç und Yeza sich die Karawane dienstbar, indem sie solcherart ihren Willen bekundeten, dass sie mit ihr ziehen würden. Sie stellten sich nicht etwa in ihren Schutz, sondern übernahmen stillschweigend die Beduinen als ein vom Schicksal gesandtes, ihnen anvertrautes Gefolge. Der Erste, der das begriff, war der Älteste. Er bat Roç um die Erlaubnis, die Tiere aus dem Brunnen tränken zu dürfen. Danach trat die Karawane den Weitermarsch an.
Das Richtschwert des Bretonen
Wie ein Monolith stand ein einzelner Reiter auf einer Hügelkuppe in der Steinwüste. Unverkennbar ein Ritter des Westens. Das Visier seines mächtigen Helms war hochgeklappt, sein Blick schweifte über den Horizont des nordsyrischen Berglands. Er wartete. Seine Rüstung war ohne jeden Zierrat, sein Schild führte kein Wappen, auffallend war einzig das riesige Schwert im Seitengehänge seines Sattels.
Die Augen des Einsamen verengten sich. Über den zerklüfteten Konturen der ihm gegenüber liegenden Felswände blinkte vereinzelt kaum wahrnehmbares Glitzern auf. Er verharrte unbeweglich. Zu den jetzt deutlich erkennbaren stählernen Speerspitzen gesellten sich die hoch aufragenden fremdartigen Feldzeichen, Vogelschwingen, Schwanzbüsche von Wolf und Pferd, die ersten runden Kampfhauben wurden sichtbar, ihre bronzenen Pickel schoben sich voreinander, nicht länger zu unterscheiden. Endlose Kolonnen: Das Heer der Mongolen! Ein gewaltiges Bild, eine beklemmende, den Atem abschnürende Vorführung von unentrinnbarer, gesichtsloser Gewalt! Keine Kommandorufe ertönten, nur das Geräusch der schnaubenden Pferde war zu vernehmen, je näher sie rückten, das harte Scheuern von Leder, kaum das Klirren der Waffen. Stumm wie mit zusammengebissenen Zähnen schob sich die breite Mammut-Echse mit mächtigem Panzer über Klüfte und Zacken. Ein Lavastrom, der die Landschaft aufriss, unter sich begrub, das Gebirge selbst schien sich in Bewegung gesetzt zu haben. Versetzt gestaffelt die Blöcke von Hundertschaften, die sich mit der Disziplin von Raubameisen voranwälzten, Tausendschaften in ihrer erschreckenden, das wilde Land lähmenden Einförmigkeit, unterlegt vom Knirschen der Räder, Ächzen der hochrädrigen Karren mit den schwarzen Jurten[7]. Das Stampfen der Hufe erzeugte kein Dröhnen, keinen Donner, aber die Erde erzitterte!
Furchtlos schweifte das Auge des Ritters über den sich dahinwälzenden Mahlstrom. Doch selbst in seiner Bewegungslosigkeit wirkte er menschlicher als dieser mechanisch vorwärts malmende Drachenleib aus Tausenden von Hufen und Stiefeln, Helmspitzen, auf den Rücken geschnallten Bögen und vollen Köchern. In diesem wogenden Lanzenwald öffnete sich jetzt ein frei gelassener Raum mittendrin: In pausenlosem Staccato mit eiserner Disziplin stetig vorangestoßen, glich er auf seltsame Weise dem magischen Geviert eines Tempelbezirks, dessen unsichtbare Einzäunung – von Zauberhand gezogen – von Mensch und Tier strikt geachtet wird. Das so ehrfurchtsvoll gehütete Heiligtum musste jenes überdimensionale Gefährt in seiner Mitte darstellen, eine prunkvolle Stufenpyramide auf Rädern. Dräuend auf hohen Stelzen, erhob sich über der obersten Plattform ein goldener Thron. Doch wie ein Käfig wirkte das kunstvolle Gehäuse, das diesen bedingungslose Anbetung, nahezu würdelose Unterwerfung einfordernden, ein merkwürdiges Dauern und Schauern erregenden Doppelsitz umschloss, ein fremdartiges unwirkliches Gebilde inmitten der graubraunen Kriegermasse, der mit ihren Pferden bizarr verwachsenen Kentauren[8]. Weniger die geometrisch pedante Einhaltung des Gevierts erstaunte den einsamen Reiter, sondern das Verhalten der Dienerscharen, die in respektvoller Distanz rechts und links hastend, hechelnd mit dem Gefährt Schritt zu halten versuchten und jedes Mal, wenn es sie überholte, sich platt zu Boden warfen und im demütigen Kotau[9] verharrten, bis das leere Throngehäuse – von vier Doppelgespannen gezogen – an ihnen vorübergewankt war.
Der Ritter wartete geduldig, bis der Block der mongolischen Heeresführung in Sicht kam – gut erkennbar an den größeren Zelten und den noch höher gereckten Insignien der Macht, dann ließ er sein Pferd gemessenen Schritts hinabsteigen. Viel anders wäre ihm auch nicht zu raten gewesen, denn in seinem Rücken waren längst Bogenschützen aufgezogen. Die stumm auf ihn gerichteten Pfeile ließen ihm keine Wahl.
Der Ritter wurde vor den kommandierenden General Sundchak[10] geführt und stellte sich als ›Yves der Bretone‹[11] vor, ›Gesandter des Königs von Frankreich‹. Das beeindruckte den General wenig, geschweige denn das Begehr des Bretonen, vor den Il-Khan Hulagu[12] persönlich gebracht zu werden. Yves musste sich in Geduld fassen, was ihm keinerlei Mühe bereitete. Die zu seinem Geleit abgestellten zwei jungen Mongolen, die derweil neben ihm herritten, denn das Erscheinen des Gesandten hatte mitnichten das Heer der Mongolen in seinem Vormarsch aufgehalten, flankierten den Fremden mit gewisser Scheu. Kaum konnten Khazar[13] und Baitschu[14] ihre Neugier gegenüber dem Gast zügeln. Vor allem dessen enorme Waffe, breit und lang wie ein Zweihänder, erregte mit leichtem Schauder ihr Befremden. Yves kam ihrer Wissbegierde durch herablassend gezeigtes Interesse entgegen. »Was hat es mit diesem Thron auf sich, dem so viel Ehre erwiesen wird?«, fragte er. Baitschu, der jüngere seiner jugendlichen ›Bewacher‹, konnte kaum an sich halten: »Dies ist der Thron des ›Königlichen Paares‹, von Roç Trencavel und der Prinzessin Yeza Esclarmunde!«
Der Bretone lächelte unmerklich. Er hatte die Frage nur gestellt, um völlig sicher zu gehen. Eine solche Monstrosität, nur um ihren Anspruch auf das Königliche Paar zu unterstreichen, konnte nur den Mongolen einfallen. Geradezu abgöttische Züge hatte die Verehrung des Steppenvolks für das Königliche Paar angenommen, je länger sich Yeza und Roç von der ihnen zugedachten Aufgabe entfernten. Die Mongolen kannten den ›Großen Plan‹[15] nicht – hatten wahrscheinlich noch nie von ihm gehört. Wieso auch? Er war eine derartig elitäre conceptio[16], dass nicht einmal ›der Rest der Welt‹, also das Abendland, sie ganz verstand – geschweige denn sie zu akzeptieren sich bereit gefunden hatte. Yves der Bretone war zwar kein ›Ritter des Gral‹[17], dessen hatte ihn die hochnäsige geheime Bruderschaft nicht für würdig befunden, und doch wusste er, der einfache Knecht des Königs, mehr über den Großen Plan als manch einer dieser feinen Brüder! Und er war gewillt, ihn durchzusetzen – auch wenn keiner es ihm dankte. Der Bretone war treu! Gegenüber seinem König Ludwig[18] – und eben in allem, was das Königliche Paar anbetraf und dem hohen Ziel, das diesem vorgegeben war.
Unerbittlich und unbeirrbar zeigte sich der Bretone, und deswegen stand er jetzt auch hier.
Mit keiner Miene gab Yves zu erkennen, dass ihm die ›Kinder des Gral‹[19] und ihre Bestimmung seit ihrer frühesten Jugend durchaus vertraut waren, im Gegenteil, er stellte sich völlig unwissend. Das verleitete Khazar und Baitschu, den Neffen und den Sohn des mongolischen Oberbefehlshabers Kitbogha[20], dem Fremden bereitwillig von der Bedeutung des Königlichen Paares zu berichten, das zwar gerade nicht beim Heere weile …
»– auf unserem siegreichen Vormarsch ist es uns ›abhanden‹ gekommen«, räumte Khazar, der Ältere, ungehalten ein, »weil wir nicht genügend Acht gaben –«
»– weil wir es ihnen an Achtung fehlen ließen.« Sein jugendlicher Begleiter legte Wert auf den feinen Unterschied. »Die großmächtige Heeresleitung weiß nicht einmal«, setzte der Knabe Baitschu noch naseweis hinzu, »wo Roç und Yeza sich zurzeit aufhalten!«
Dem stämmigen Khazar ging die Plauderei nun doch zu weit, er fuhr Baitschu über den Mund. »Wir alle sind sicher, das erhabene Königliche Paar in Bälde –«
»– zu versöhnen?!« Der Knabe blieb renitent.
»– wieder seiner ›Bestimmung‹ zuführen zu können!«
Der kecke Baitschu konnte über diese protokollarisch korrekte Verbreitung von Zuversicht nur grinsen, hinter dem breiten Rücken des Älteren. Der Bretone fing den belustigten Blick – wider seine sonstige herbe Art, sich für menschliche Regungen empfänglich zu zeigen – mit einem wohlwollenden Hochziehen seiner buschigen Augenbraue auf. ›Bestimmung‹!? Yves lächelte gequält. Roç und Yeza wussten sicher nicht, was ihnen bevorstand – er, Yves, übrigens auch nicht. Vielleicht ahnten sie das Ungemach, das sie erwartete, und hielten sich deswegen versteckt – oder zumindest von den Mongolen fern. Würden sie erst einmal als Königliches Paar vom Il-Khan auf den Schild gehoben, als zukünftige Herrscher von ›Outremer‹[21], das die Mongolen mit Sicherheit sich zu unterwerfen gedachten, dann würden den jungen Königen schlagartig mehr erbitterte Feinde sich entgegenstellen, als Skorpione unter jedem Stein in der Wüste zwischen Tigris und Nil hockten! Zu bezweifeln war auch, ob die christlichen Barone des Königreiches von Jerusalem[22]sonderlich erpicht auf eine solche »Oberherrschaft« waren – ganz zu schweigen vom Patriarchen, der Speerspitze der ›ecclesia católica‹[23] Roms. Nicht einmal für den Orden der Templer wollte er, Yves, seine Hand ins Feuer legen …
»Niemand kann seiner Bestimmung entgehen«, murmelte der Bretone mehr zu sich selbst.
Ein köchelndes Pilzgericht
Jerusalem war eine wüste Stätte. Seit eingefallene Choresmierhorden[24] den letzten Überbleibseln christlicher Herrschaft noch zu Lebzeiten des großen Staufers[25] endgültig den Todesstoß versetzt hatten, lag nicht nur die Stadt in Schutt und Asche, auch alles Leben schien aus ihr gewichen. Der ägyptische Souverän hielt es nicht einmal mehr für nötig, dort noch eine Garnison zu unterhalten. Lediglich einige Torwachen waren zurückgeblieben, sich selbst überlassen, sie lebten von der kargen Maut, die sie jedem abknöpften, der einen der offiziellen Zugänge zur Stadt in Anspruch nahm oder ihr zu entfliehen suchte.
Der Franziskaner William von Roebruk[26] – das armselige Kloster des Ordens neben der Basilika des Heiligen Grabes war bis auf die Grundmauern niedergebrannt – hatte durch mächtige Gönner Zuflucht auf dem Montjoie gefunden, jenem Hügel, der frommen Pilgern den ersten beglückenden Anblick der glänzenden Kuppeln und trutzigen Türme des seligen Hierosolyma[27] darbot wie himmlisches Manna. Das Schiff des den ›Berg der Freude‹ krönenden Wallfahrtskirchleins war eingestürzt, doch der wehrhafte Glockenturm – seines Geläuts längst beraubt – bot dem Minoriten eine sichere Bleibe, konnte er doch die zur Glockenstube hinaufführende Leiter jederzeit einziehen.
Für sein leibliches Wohl sorgte der alte Sakristan, der den angrenzenden Pilgerfriedhof in einen Gemüsegarten verwandelt hatte und sehr geschickt darin war, von den Stauden und Knollen angelocktes Getier in Fallen und Netzen zu fangen, auch streunende Hunde und Katzen gingen ihm arglos in die Schlingen – ebenso arglos wie sein einziger Kostgänger William die würzig angerichteten Eintöpfe begierig verschlang. Wer weiß schon, wie ein fetter Maulwurf oder gar ein Igel schmeckt, wenn ihr ausgelöstes Fleisch zwischen Rüblein und Kürbisgurken, Rettichwurzeln und reichlich Zwiebeln gar gesotten, mit Äpfeln, Feigen und Datteln und vielerlei Beeren versüßt, schließlich mit der Schärfe kleiner Pfefferschoten, wildem Thymian, einem Zweiglein Rosmarin, Oliven und gestampften Maronen wohlig abgerundet, einem hungrigen Magen dampfend vorgesetzt wird. Anfangs hatte der Franziskaner sich noch mit gelindem Argwohn an den Ingredienzien seines täglichen Mahls interessiert gezeigt, doch in die Töpfe gucken ließ sich Odoaker nicht, und was seine Rezepte anbetraf, war er keiner klaren Auskunft mächtig, sie hatten ihm die Zunge so weit herausgeschnitten, dass die Laute, die er von sich gab, weitaus eher dazu angetan waren, William den Appetit zu verderben, als etwa ein genaueres Wissen um die Herkunft der Speisen zu geben. Der Sakristan hätte gewiss keinen Hehl aus den Zutaten und der speziellen Zubereitung gemacht, war doch William der einzige Mensch, dem er sich mitteilen konnte. Wie gern hätte er ihn an dem Gedeihen seines Gärtleins teilhaben lassen oder ihn mit den Listen und Tücken der allfälligen Jagd vertraut gemacht, die zur Vervollständigung des Küchenzettels vonnöten waren.
Odoaker war mit Recht stolz auf seine Küche. Sein Lohn bestand seit Langem aus dem Privileg, dass William ihm jeden Tag das vorlas, was er in seiner Turmstube zu Pergament gebracht hatte. Er musste es dem wissbegierigen Sakristan täglich vor dem späten Mittagsmahl, dem einzigen des Tages, zu Gehör bringen, sonst gab es nichts zu essen. An der Reichlichkeit, mit der er seinen Napf gefüllt bekam, mochte der Schreiber zudem ermessen, wie weit er die Erwartung seines einzigen Zuhörers getroffen hatte. Doch auch William profitierte von dieser Symbiose zwischen Kochkunst und der handwerklichen Leistung, die ihm aus der Feder fließen musste. Odoaker gab mit starker Mimik und gelegentlichem Röcheln, Husten und heiserem Bellen seinem Gefallen unmissverständlich Ausdruck, lauschte auf besondere Art schweigend, wenn die Spannung auf ihn übergriff, und schämte sich auch keiner Tränen, wenn das Geschehen ihn tief berührte, oder gackernder Lachstöße, wenn er seinen Spaß hatte. Nicht besonders häufig, aber schon einige Male hatte William seinen Text überarbeitet, wenn Odoaker sichtlich gelangweilt war oder ihn verständnislos anglotzte. Der Sakristan war für den Skribenten[28] ein idealer, weil stummer Lektor[29]. Dass William ihm die Seiten nicht einfach zum Lesen gab, lag an der furchtbaren Klaue des Franziskaners, der seine Pergamentseiten so hastig und eng mit Schriftzeichen zu bedecken pflegte, dass er sie kaum selbst zu entziffern imstande war. Und doch bildete diese von beiden Seiten sehnlichst erwartete Köchelstunde, in der die Schwaden verheißungsvoll dem Deckel des Topfes entwichen und Williams immer weiter vorangetriebener Erzählfluss den Odoaker umwaberte, ins Traumreich fremder Welten versetzte, in wilde Abenteuer voll mit Rittern und schönen Frauen, in denen der gedrungene Franziskaner mit seiner recht beachtlichen Wampe und seinem schütteren, rötlichen Haarwuchs nicht selten den strahlenden Helden spielte, längst auch für William den einzigen Moment einer menschlichen Begegnung in der Einsamkeit des Montjoie. Nur noch selten verirrten sich mutige Pilger auf den Hügel – und wenn sie ihn erklommen, dann nur, um schleunigst weiterzueilen, dem verheißungsvollen Ziele eines heiligen Grabes entgegen. William hatte sein Faktotum[30] im Verdacht, die frommen Reisenden gezielt in Augenblicken solcher Glückseligkeit um ihren Proviant zu erleichtern, denn an Tagen derartigen Besuches gab es oft harten Käse oder geräucherten Speck, Kostbarkeiten, die Odoaker nun mal nicht herzustellen in der Lage war. Auch die Hühner – wenn sie der Fuchs nicht holte – warfen höchst selten die unverzichtbaren Zutaten für einen leckeren Eierfisch ab, und der Holzofen wurde nur sonntags angefeuert, die erhofften handtellergroßen Fladen von grobschrotigem Gerstenbrot blieben meist entweder ungare, klebrige Kleiebatzen, oder sie waren bereits verkohlt, wenn der Bäcker sie aus dem verrußten Loch zerrte. Heute war Sonntag, und im Topf schmurgelte ein Pilzgericht …
Aus der Chronik des William von Roebruk
… schnell zeigte sich der Pferdefuß, die zugedachte Aufgabe geriet zur Bürde des Gewissens, unvereinbar mit dem Selbstverständnis der jungen ›Friedenskönige‹ Roç und Yeza. Die Mongolen sahen sie als ihren verlängerten Arm, die eiserne Faust der Unterdrückung unter einem verzierten Kinderhandschuh aus weichem Lammleder verdeckt. Als Roç und Yeza die grausame Vernichtung ihrer Freunde miterleben mussten, gipfelnd in der sinnlosen Zerstörung des Wunderwerks von Alamut[31], kehrten sie den Mongolen abrupt den Rücken, weigerten sich fortan, willige Figuren in deren Spiel abzugeben. Mit meiner Hilfe, was mich um Stab und Hut eines Patriarchen von Karakorum brachte, flohen die beiden nach Jerusalem, versuchten auf eigene Faust zur Erkenntnis zu gelangen, welches Schicksal ihnen bestimmt, wie die Verheißung zu erfüllen sei, die mehr und mehr unheilvoll auf ihnen lastete. Sie forderten den Gral heraus, der sich ihnen nicht zeigen wollte. Der schwarze Kelch, aus dem sie trotzig tranken, brachte uns allen, die wir uns zu Jerusalem um sie versammelt hatten, nur schlimmes Unheil, nur wenige der Getreuen überlebten den Sturm des Bösen, der losbrach. Roç und Yeza verschwanden, wie verschluckt von der dunklen Wolke entfesselter Macht des Demiurgen[32]. Noch immer weine ich ihnen nach, meinen beiden Königen … Leer und sinnlos will mir das Dasein nach ihrem Fortgang erscheinen, alles würde ich drangeben, auch mein törichtes Leben, wenn ein solch geringes Opfer sie denn zurückholen könnte in eine Welt, die ihrer so sehr bedarf, so wie ich damals ohne jedes Zögern ihnen zu folgen versuchte, bereit, mit ihnen zu sterben, zu verderben, doch wurden sie meinem Auge für immer entzogen –
Der Tag neigte sich schon dem Abend zu, als Roç und Yeza an der Spitze der Karawane wenig abseits vom Weg das Kamel erblickten, am Boden hingestreckt und an den Hals des Tieres geklammert einen Menschen. Beide schienen am Rande völliger Erschöpfung durch Hitze und Durst, allerdings verriet der sich noch schwach hebende und senkende Bauch des Tieres, dass zumindest noch nicht alles Leben aus ihm gewichen war. Doch auch der Mann hob beim Näherkommen der ersten Beduinen mühsam sein vom verrutschten Turban verdecktes Haupt, um es dann gleich wieder mit dramatischer Gebärde auf den gestreckten Hals des liegenden Tieres sacken zu lassen. Die Reiter der Vorhut, denen es oblag, der schwerfälligen Transportkarawane den geeigneten Pfad zu weisen, blickten fragend auf das Königliche Paar. Aus eigenem Antrieb sahen sie in der Begegnung kaum Anlass, das mechanische Vorwärtsschreiten der Kamele mit der Teppichrolle aus dem mühseligen Trott zu bringen.
Roç hob den Arm. Das Zeichen zum Halt wurde befolgt. Die Tiere, die den zusammengerollten Kelim trugen, knieten auf der Stelle nieder und übergaben ihre Last dem steinigen Boden. Zwei der Beduinen stiegen ab und traten, sichtbar unwillig, zu der störenden Gruppe am Rand des Weges. Unsanft zerrten sie den Mann hoch. Sein bartloses Gesicht war blutverschmiert, den Grund erkannten Roç und die Umstehenden sofort, die Halsschlagader seines Tieres wies eine hässliche Schnittwunde auf, wie ein Vampir hatte sich der Verdurstende des Lebenssafts bedient. Nicht nur dieser Gedanke stieß Yeza unangenehm auf. Als das geopferte Kamel jetzt seine großen Augen noch einmal auf sie richtete, bevor es ermattet seine Beine von sich streckte, fiel ihr Blick auf das Gesicht des Mannes – und das gefiel ihr noch weniger. Etwas Stechendes lauerte in seinen Augen, außerdem schielte er auf eine unverzeihliche Art. Dass er auch noch sein eines Bein hinkend nachzog, als die beiden Beduinen ihn jetzt vor Roç und Yeza führten, wunderte sie schon gar nicht mehr. Sie war diesem Menschen in ihrem Leben schon einmal begegnet, da war sie sich sicher, und die Umstände waren höchst unguter Natur, nur entsann sich Yeza nicht mehr, bei welcher Gelegenheit. Roç schien von jeglichen Reminiszenzen frei zu sein, zumindest gab er sich völlig unbefangen, er ging auf in seiner Feldherrnrolle, die mit dem Heben der Hand begonnen hatte – woraufhin die gesamte Karawane zum Stillstand gekommen war –, und setzte sich jetzt fort, indem er den Geborgenen keines Blickes würdigte, sondern mit generös wegwerfender Geste den Beduinen überließ.
Yeza betrachtete das sterbende Kamel. Sie musste sich beherrschen, nicht abzusteigen und es zu umarmen. Ein Zittern lief durch den Leib des Tieres, dann war es von seinem Leiden erlöst.
Der feurige Sonnenball näherte sich dem Horizont der hinter ihnen liegenden Wüste. Sie waren bereits zuvor in die Geröllhalden einer sich vor ihnen auftürmenden Gebirgskette eingestiegen, deren Überwindung noch vor ihnen lag. Sie heute noch in Angriff zu nehmen, verbot sich schon angesichts der schroffen Klippen, deren blauschwarze Schatten bedrohlich schnell wuchsen. Roç erteilte den Befehl, das Nachtlager aufzuschlagen.
Dass es sich bei dem Geretteten nicht um einen Sohn der Wüste handelte, war auch den Beduinen klar, deren Anführer sich des Mannes angenommen hatte, nachdem das Königliche Paar kein weiteres Interesse an ihm zeigte. Von seiner Kleidung her zu schließen, war er sicher ein Städter, und wahrscheinlich auch kein Araber, wenngleich er den Dialekt der Kurden gut beherrschte. Er gab sich als Kaufmann aus, der unter Räuber gefallen sei, grad' sein Leben habe er dank des treuen Reittieres retten können. Der Ton von Betroffenheit, ja Trauer über den Verlust, versöhnte die ihn umringenden Beduinen, und sie drangen nicht weiter in ihn. Er war ihr Gast.
In Wahrheit stand der hinkende Naiman[33] in ägyptischen Diensten, war Spion der Mamelucken[34], die dringend in Erfahrung zu bringen wünschten, welches die nächsten Schritte der Mongolen sein könnten, vor allem, welche Absichten sie bezüglich des Sultansthrones von Kairo hegten. Dass sich der Il-Khan Syriens bemächtigte, war vorerst nicht mehr zu verhindern, doch damit wurden diese unersättlichen Eroberer zu Nachbarn, deren Gefährlichkeit – im Gegensatz zu den verstrittenen Ayubitenherrschern[35] von Homs, Hama und selbst Damaskus – nicht zu unterschätzen war. Naiman hatte das Vorwärtsdrängen dieser Kriegswalze beim Fall von Aleppo miterlebt, wo es ihm nur mit knapper Not gelungen war, seine eigene Haut zu retten, indem er sich unter das Gefolge des Gouverneurs schmuggelte, dem wider alles Erwarten freier Abzug gewährt wurde. In Aleppo hatte er auch zum ersten Mal – nach langer Zeit – von dem ziemlich unglaubwürdigen Gerücht über das Wiedererscheinen des Königlichen Paares gehört. Er, Naiman, hatte Roç und Yeza seit den turbulenten Ereignissen von Jerusalem und ihrem Verschwinden in jenem Sandsturm nicht für verschollen, sondern für tot gehalten und dies beruhigende Ergebnis auch nach Kairo gemeldet. Dann verdichteten sich die Hinweise, sie seien in Kurdistan gesichtet worden, und er hatte sich auf den Weg gemacht, denn es war ihm äußerst peinlich, seinem Herrn, dem Sultan, eine Falschmeldung geliefert zu haben, dazu eine von solcher Tragweite. Da verstanden, wie er wusste, die Mamelucken keinen Spaß, weder Sultan Qutuz[36] noch sein Generalissimus Baibars »der Bogenschütze«[37]! Falls Roç und Yeza tatsächlich noch unter den Lebenden weilten und er, Naiman, seinen Kopf retten wollte, dann musste er dafür sorgen, dass seine voreilige Nachricht sich schnellstens bewahrheitete! Naiman hatte lange genug die intrigengeschwängerte Luft der Paläste von Kairo geatmet, um nicht genau zu wissen, was die Mameluckenherrscher angesichts des Königlichen Paares in heftige Besorgnis versetzte. Sollten Roç und Yeza in einem zweifellos genialen Schachzug der Mongolen – das musste er neidlos anerkennen – in Syrien auf den Thron gehoben werden, dann würde das nicht nur eine Stärkung – weil Befriedung!– des christlichen Königreiches bedeuten, sondern es bestand auch die imminente Gefahr, dass die versprengten und oftmals untereinander verfeindeten Ayubiten, diese nichtsnutzigen, aufrührerischen Nachfahren des großen Saladin[38], sich unter solch lockerer Oberherrschaft vereinten, mit den fränkischen Baronen Frieden schlossen und gemeinsam mit den Mongolen sich gegen Ägypten wenden würden. Einer derartigen geballten Übermacht hätten dann die Mamelucken – in den Augen vieler Ayubiten immer noch dreiste Usurpatoren[39] der Macht am Nil! – wenig entgegenzusetzen. Also musste dieses unheilige, aber leider charismatische Königliche Paar vom Schachbrett gefegt werden. Und zwar unverzüglich!
Nun war der hinkende Agent kein Mann der Tat im Sinne der zupackenden eigenen Hand. Selbst einen todbringenden Dolchstoß zu führen war ihm zuwider, allenfalls Gift war für ihn vorstellbar, aber lieber ließ er auch solche Handreichungen von anderen besorgen. Naiman war ein geborener Intrigant, er liebte das aufregende Spiel, Fallen zu stellen und Netze auszuwerfen, in denen sich die Leute verfingen, die dann willig das taten, was er ersonnen. Dabei war er keineswegs feige, im Gegenteil, er scheute keine noch so prekäre Situation und vergnügte sich, in den abenteuerlichsten Verkleidungen aufzutreten und durchaus sein Leben zu riskieren, um sein Ziel zu erreichen. So hatte er tagelang in der Wildnis gelauert und wäre tatsächlich beinahe elendiglich verdurstet, bis er endlich die Karawane aus der Wüste auftauchen sah. Stunden hatte er in der glühenden Sonne gelegen und nicht ohne Not das Kamel zur Ader gelassen – immer in der Sorge, die Karawane aus Täbriz könnte im letzten Moment einen anderen Weg einschlagen. Naiman war zäh, er vertraute keinem mehr als sich selbst, weswegen er auch viel Mühe und viele Geschenke aufgewandt hatte – das Umsichwerfen mit Goldstücken hätte ihn verdächtig gemacht und höchstens die Aufmerksamkeit von Räubern erregt –, um alle Reisenden aus dem Nordosten eingehend zu befragen, bis er schließlich in Erfahrung gebracht hatte, dass die Gesuchten sich wahrscheinlich einer Teppichkarawane angeschlossen hätten, die ein Geschenk für den Il-Khan mit sich führte.
Seine Ausdauer war belohnt worden: Roç und Yeza lebten also noch, so ärgerlich es ihm war, wenigstens dieser Zweifel war nun ausgeräumt! Dass die beiden ihn nicht wiedererkannten, verschaffte ihm eine zusätzliche Befriedigung, seine Tarnung war eben perfekt! Jetzt musste er nur noch diese Beduinen dazu bringen, das Königliche Paar als Bedrohung anzusehen, er musste sie gegen Roç und Yeza so aufhetzen, dass sie zu ihren Dolchen griffen – oder die beiden zumindest barfuß in die Wüste jagten, wo sie dann grässlich umkommen würden …
Meldereiter preschten vor. Das Heer der Mongolen fächerte weit auseinander, kaum, dass die Vorausabteilungen die Ebene erreicht hatten, während die Nachhut im Abstieg innehielt und absichernd die Berghänge besetzte. Die Kriegsmaschine kam zum Stehen.
Yves der Bretone hatte sich im Gefolge Kitboghas einreihen müssen und wurde erst zum Oberbefehlshaber vorgelassen, als dessen Zelt in Windeseile aufgeschlagen war. Der französische Gesandte konnte nicht umhin, diesem reibungslosen, präzisen Mechanismus insgeheim Bewunderung zu zollen. Denn das alles geschah in größter Schweigsamkeit, kaum, dass Kommandorufe zu hören waren. Die Befehle wurden durch Flaggensignale weitergegeben, ebenso wie ihre erfolgte Ausführung stumm zurückgemeldet wurde. So erging auch die Aufforderung an die ›Bewacher‹, den Gesandten jetzt zu dem berühmten Kriegsherrn zu geleiten.
Kitbogha, für die meist kleinwüchsigen Mongolen ein Hüne von einem Mann, mit bartlosem bronzefarbenem Gesicht, das in seiner gutmütigen faltigen Fleischigkeit den Bretonen an die riesigen Hütehunde rund um das Kloster des heiligen Bernhard auf der Passhöhe in den Seealpen erinnerte, empfing den Gast im kurzärmeligen Wams vor seinem Zelt und bot ihm als Willkommenstrunk nicht – wie zu erwarten – Kumiz[40] an, sondern einen Becher Wein. Yves achtete beim Betreten des Zeltes sorgsam darauf, nicht auf die Schwelle zu treten, was den Mongolen als böses Omen[41] galt und unerfreuliche Folgen zeitigen konnte. Dem Bretonen lag nichts daran, wegen eines solchen faux pas[42] seinen Kopf zu verlieren, und so saßen sich die beiden Herren nach Austausch der üblichen Begrüßungsfloskeln endlich gegenüber und fixierten sich mit freundlichem Lächeln. Yves selbst war hager von Gestalt, sein Schädel kantig und seine Züge scharf geschnitten wie die eines Greifvogels. Das Auffälligste an ihm waren seine überlangen, muskulösen Arme, und da er seinen kräftigen Brustkorb meist vornübergeneigt hielt, wirkten sie wie die eines Primaten. Dass er sich der physischen Bedrohung, die von ihm ausging, im Innersten schämte, war höchstens aus den tieftraurigen Augen zu schließen. Er war kein schöner Mann und keiner, der in seinem Kriegerdasein viel Liebe empfangen hatte.
»Wisst Ihr«, eröffnete der alte Feldherr seufzend das Gespräch, »wo wir die Kinder finden können?« Kitbogha erwartete eigentlich keine Antwort und fuhr fort. »Ihr Fehlen durchkreuzt den Plan unseres Herrscherhauses, sie als Friedenskönige in dem Teil der Welt einzusetzen, dessen Eroberung jetzt vor uns liegt.«
Dem Bretonen lag jetzt nicht daran, die Vorgaben des Il-Khan als solche infrage zu stellen, obgleich die Mongolen von der, seiner Meinung nach irrigen, Vorstellung ausgingen, dieser ›Rest der Welt‹ würde sich ihnen willig unterwerfen. So griff er lediglich die Eingangsfrage auf, die Kitbogha wohl nur als vorübergehendes Missgeschick betrachtete: Das ›verschwundene‹ Königliche Paar.
»Es gibt im Leben von Roç und Yeza nur eine Figur, die Ihr immer wieder an ihrer Seite finden werdet, das ist dieser William von Roebruk!« Yves ließ keinen Zweifel über seine Wertschätzung des Minoriten aufkommen. »Der Franziskaner ließ sich noch nie lange abschütteln, er hängt ihnen an der Kehle wie ein Frettchen dem Kaninchen! Besorgt Euch also William und heftet Euch an seine Hacken. Er wird Euch über kurz oder lang zu den Gesuchten führen.«
Seinem Gegenüber schien die Vorgehensweise, das Einspannen einer solchen Person, weder zu behagen noch dem Selbstverständnis von der Macht der Mongolen angemessen. »Ich hatte eher an Arslan den Schamanen gedacht«, ließ er seinen Besucher wissen, »der bewies schon oft ein magisches Gespür im Auffinden seiner Zöglinge«, erklärte er nicht ohne Stolz. »Seine Fähigkeit, mit ihnen Verbindung aufzunehmen, sollte uns schneller ans Ziel bringen –«
»Und was hindert Euch, diesen genialen Schamanen längstens mit der Aufgabe betraut zu haben?!« Yves mochte seinen Spott nicht verbergen.
»Wir wissen nicht, wo er sich zurzeit aufhält.« Kitbogha war ein mächtiger Mann und konnte es sich leisten, behebbare Schwächen im strategischen Konzept offen zuzugeben. »Der Il-Khan, der erhabene Hulagu, und die Dokuz Khatun[43] erwarten Euch«, verkündete er gelassen und erhob sich.
Odoakers Schluchzen richtete das Augenmerk Williams auf den irdenen Topf mit den Pilzen. Es roch angebrannt. Statt den vor Rührung zerfließenden Sakristan deswegen mit Vorwürfen zu überhäufen, zerrte der hungrige Mönch kurz entschlossen das Gefäß vom Feuer, und bald darauf schon löffelten die beiden Einsiedler vom Montjoie ihr Mahl, tunkten ihr ausnahmsweise knuspriges Gerstenbrot in den würzigen Sud und schmatzten unter Tränen um die Wette. Schnell versöhnt mit seinem Schicksal glitt der Blick des Franziskaners über das selig leuchtende Jerusalem im warmen Licht der Nachmittagssonne. Ein dürres Männlein kam den Pfad heraufgeschritten, der sich von der Ruine des Kirchleins hinabschlängelte zur Stadt. Es handelte sich um keinen heimkehrenden Pilger, William erkannte den rüstigen Alten sofort. Es war der secretarius venerabilis[44], der Generalbevollmächtigte der geheimnisvollen Bruderschaft, die den Minoriten William von Roebruk unter ihre Fittiche genommen hatte — unter ihre Fuchtel! Der Alte war ihr Sprachrohr. Aus den Reihen seiner anonymen Auftraggeber die einzige Person aus Fleisch und Blut, die William je zu Gesicht bekommen hatte, aber sein Wort galt! Lorenz von Orta[45] gab sich zwar – nach seinem Habit[46] zu schließen – ebenfalls und immer noch als schlichter Franziskaner, doch wenn Bruder William sich gelegentlich der Sünden des Fleisches zeihen musste, dann waren es beim Herrn von Orta gewiss die eines notorisch ketzerischen Geistes, und die wogen schwerer! Doch solche aufsässigen Gedanken behielt William lieber für sich! Leichten Fußes erklomm der silberhaarige Greis die letzten Stufen. William kratzte schnell den Rest seines Pilzgerichts in der Schale zusammen, wischte sie mit dem Brot aus und stopfte alles hastig schlabbernd ins Maul, nicht, dass er sich schämte, sondern weil er ungern sein karges Mahl mit dem Bruder teilte. Franziskaner sind immer hungrig!
»Pax et bonum!«[47], grüßte Lorenz mit überlegenem Lächeln den Mampfenden, der den Gruß mit vollem Mund nicht erwidern konnte. Ohne zu fragen, ließ sich der Herr von Orta am Tisch nieder und nahm einen Schluck Wasser aus Williams Becher. »Wie weit ist deine Totenklage gediehen?«, erkundigte er sich wenig mitfühlend bei William, um dann gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. »Noch solltest du an dich halten, den Gegenstand deines wehleidigen Nachrufes in Tinte und Tränen zu ertränken: Das Königliche Paar soll im Norden des Landes gesichtet worden sein.«
»Wie das!?«, prustete William ungläubig, er hatte sich verschluckt, und er war empört. »Ich hab sie doch mit eigenen Augen –«
Der Secretarius schnitt ihm Entrüstung und Lamento[48] ab. »Ich komme aus Antioch« – erklärte er seinen Zuhörern, denn auch Odoaker zeigte augenrollendes Interesse – »dort im Fürstentum geht schon seit einiger Zeit das Gerücht um, Yeza und Roç seien am Leben, ein Schamane habe sie gerettet vor elendem Verdursten in der Wüste …«
»In Antioch wird viel erzählt!« William hatte den letzten Happen heruntergeschluckt und seine Fassung wiedergewonnen. »Und warum schickt man nicht sogleich Ritter in alle Himmelsrichtungen aus?! Muss es nicht dem dortigen Normannenhof als die vornehmste aller Aufgaben erscheinen, das edle Paar –?!«
»Das Fürstentum hat andere Sorgen«, versuchte der Weißhaarige die Lage zu vermitteln. »Abgeschnitten von den letzten Bastionen der Kreuzfahrer, ist es dem Zugriff der Mongolen ausgeliefert: Es braucht jeden Mann!«
»Wichtigeres als das Schicksal von Roç Trencavel und seiner Prinzessin Yeza kann es nicht geben!«, empörte sich William. »Treuloses Pack! Blutsbrüderschaft hat Bohemund[49], der junge Fürst, dem Königlichen Paar dereinst geschworen!«
Lorenz belächelte den Ausbruch. »Es gibt keinen Grund, die Sache zu überstürzen, denn wahrscheinlich liegt dem Königlichen Paar zurzeit wenig daran, gerade jetzt aufzutauchen und sofort den Mongolen in die Hände zu fallen«, sann der Herr von Orta mit leiser Stimme. »Vielleicht wollen sie – nach all den bitteren Erfahrungen – gar nicht mehr als Paar auftreten, dem alle Konflikte aufgehalst werden, die Ost und West, Islam und Christentum zu lösen sich nicht in der Lage sehen, diese Last eines Königtums des ewigen Friedens in einer Welt, die nur auf Krieg, Unterdrückung und Machterweiterung aus ist«, gab der alte Herr zu bedenken, wenn er auch mehr zu sich sprach.
»Ich will ja nur wissen, wo ich sie finden kann?«, warf William kleinlaut ein »Zu ihnen eilen, ihnen zur Seite stehen, sie brauchen mich!« Davon war er selbst nicht ganz überzeugt, sodass Lorenz das Anerbieten übergehen konnte.
»Jeder Diener des ›Großen Plans‹«, rief er den Verstörten zur Ordnung, »hat jetzt vor allem an dem Platz zu stehen, der ihm zugewiesen!« Lorenz fügte als geübter Prediger zum Pathos noch die Strenge. »Dir, William, wurde auferlegt, die Geschichte von Roç und Yeza niederzuschreiben – und zwar von Anfang an!«
»Aber die ist ja nun noch nicht zu Ende!«, begehrte William auf. »Der Muttergottes sei Dank! Allein schon aus dem Grund sollte ich unverzüglich –«
Der Weißhaarige unterbrach ihn schroff. »Hier sollst du deine Arbeit fortführen, William!«, befahl er streng. »Mit einer Gewissenhaftigkeit, an der du es bis jetzt gewaltig hast fehlen lassen!« William klappte zusammen wie ein Faltstuhl. »Nur deswegen haben wir dich an diesem lieblichen Ort einquartiert!« Der rundliche, um nicht zu sagen ziemlich dickliche Chronist dauerte seinen feingliedrigen Zuchtmeister. »Sollten wir dich andersorten brauchen, werden wir es dich rechtzeitig wissen lassen!«
Der Besucher hatte sich erhoben, die Dämmerung legte sich über die Stadt, die flach einfallenden Strahlen der Sonne warfen lange Schatten, ihr Licht vergoldete die Steine. »Es ist ja nicht einmal gesagt«, fügte er abmildernd hinzu, »dass an dem Gerücht etwas dran ist. König Hethum von Armenien traf kurz vor meiner Abreise bei seinem Schwiegersohn, dem Fürsten Bohemund, ein. Auf seiner gesamten Reise durch den Norden hatte der Monarch nichts dergleichen vernommen.«
Das gereichte William kaum zum Trost, er bockte. »Der Armenier scheißt sich doch in die weiten Pluderhosen, wenn es um die anrückenden Mongolen geht, da will der Feigling schon gar nichts von den armen Kindern wissen.«
»Mehr und mehr erinnerst du mich an eine feiste, weinerliche, alte Amme«, unterbrach ihn Lorenz bissig, »die das Drehen des Rades, das Fortschreiten der Jahre nicht mehr mitbekommt! Die du immer noch als ›deine Kleinen‹ siehst, an deinen schwabbeligen Busen zu drücken suchst, haben längst ein Alter erreicht, in dem andere schon selber Kinder zeugen oder gebären.« Diese Zurechtweisung gefiel William noch weniger. Unverständliches maulend, wollte er sich in sein Turmgemach zurückziehen, doch sein gestrenger Besucher hielt ihn am Ärmel seiner Kutte fest. »Wenn dir so viel an Roç und Yeza liegt«, legte er unnachsichtig dem Verwirrten nahe, »dann schreib sie herbei!« Der Secretarius senkte seine Stimme, als ginge es um ein großes Geheimnis. »Die Macht des geschriebenen Wortes hat schon Tote wieder zum Leben erweckt.« Damit ließ er William stehen und schritt von dannen.
Der Mönch schaute ihm nach, beeindruckt, aber vor allem ziemlich verstört. Er verspürte wenig Lust, seine Arbeit wieder aufzunehmen, hatte er sich doch mit schmerzendem Herzen innerlich von Roç und Yeza verabschiedet, und jetzt stand alles wieder infrage! Sein eigenes Schicksal, das wohl untrennbar an das der Kinder gekettet war, lag plötzlich vor ihm wie ein unbeschriebenes Blatt, zu dem ihm nochmals der erste Satz einfallen musste, wo er sich gerade erst zu einem zwar wehmütigen, aber würdigen Abschluss der Chronik durchgerungen hatte. Er seufzte tief, schon aus Mitleid mit sich selbst. Das Problem waren weniger die Mongolen, sondern die Pläne, die sie mit dem Königlichen Paar hatten.
Doch beim Hinaufsteigen der Leitersprossen verspürte er erstmals wieder die unbändige Freude aufkeimender Hoffnung: Wenn Roç und Yeza lebten, dann würde er sie wiedersehen, ›die Lieben‹, egal, wie alt sie inzwischen! So um die zwanzig, überschlug er die vergangene Zeit. Für ihn blieben Roç und Yeza seine Kinder – in jedem Fall und in alle Ewigkeit!
Der Flügelschlag des Vampirs
Dass Roç und Yeza – inzwischen beim gemeinsamen Nachtlager mit der Karawane – dem zugelaufenen Fremden kein weiteres Augenmerk schenkten, war höchst leichtsinnig. Naiman, der Agent des Sultans von Kairo, sann auf nichts anderes, als das Königliche Paar zu verderben, selbst, wenn er dafür die Beduinen aufwiegeln musste. Doch das offensichtlich gute Verhältnis zwischen diesen verdammten mongolischen Friedensfürsten und den braven Beduinen ließ mitnichten einen solchen Umschwung von Ehrfurcht zu wütendem Hass erwarten. Sollte er die stupiden Kameltreiber vielleicht glauben machen, Roç und Yeza beabsichtigten, ihnen den Teppich zu entwenden? Einzig und allein auf das kostbare Stück hätten die beiden es abgesehen!
Naiman begann auf den Ältesten, den Anführer der Karawane, einzuwirken, er solle doch den Kelim jetzt und hier ausrollen, damit das Königliche Paar, dessen uneingestandenes Verlangen es sei, von dem einzigartigen Stück Besitz zu ergreifen, sich auf ihm niederlassen könnte. Denn die beiden wüssten genau, welche magischen Kräfte dem Teppich innewohnten: Tausend djinn hausten im Verborgenen zwischen den meisterlich gewebten Wollfäden und warteten nur auf den Befehl, sich gegen die treuen Hüter zu wenden.
Doch statt, wie von Naiman erwartet, sich voller Empörung oder wenigstens heftigem Misstrauen gegen die Friedenskönige zu wenden, ging der Älteste erfreut, ja begeistert auf Naimans Vorschlag ein. Er beorderte alle seine Mannen zwischen die ruhenden Kamelgespanne, und auf sein Kommando schulterten sie die schwere Rolle, schleppten sie mit weichen Knien vor zu Roç und Yeza. Stolz breiteten sie den riesigen Kelim vor ihnen aus. Als Yeza ihre hoffnungsgläubigen Gesichter sah, nahm sie den strengen Ton etwas zurück, etwa wie man mit kleinen Kindern spricht.
»Hatte der Schamane euch nicht untersagt« – ermahnte sie die von der Anstrengung noch schwer atmenden Beduinen – »die Rolle zu öffnen, bis das Ziel erreicht?!«
»Aber der Fremde –«, der Älteste empfand den Vorwurf als ungerecht, seine Augen suchten nach Naiman, um ihn als Unterstützung vorweisen zu können, »aber der Fremde hat doch gesagt, dass es Königen zukomme, auf diesem größten Meisterwerk, das Menschenhand je erschaffen –!?«
»Hat er das!?«, schnitt ihm Roç das Wort ab. »Wo steckt der Kerl, der sich erlaubt –?«
»Er ist der Versucher!«, flüsterte Yeza, doch Roç ging nicht darauf ein. Der Älteste hielt noch Ausschau nach Naiman, als vom anderen Ende der lagernden Karawane Stimmen laut wurden: In der einbrechenden Dunkelheit hatte sich der hinkende Agent aus dem Staub gemacht, auf einem gestohlenen Kamel war er in der Nacht verschwunden.
Die energische Yeza sorgte dafür, dass der Teppich wieder eingerollt wurde, denn sie hatte das begehrliche Leuchten in den Augen ihres Gefährten sofort bemerkt. Gewiss wäre es auch ihr angenehmer gewesen, Roçs Liebeswerben, das sie – wie jede Nacht – erwartete, und das durchaus mit Freude an der Lust ihrer Körper, statt auf steinigem Boden auf der weichen Unterlage dieser engmaschig gewirkten Wolle nachzugeben. Aber seit dem Auftreten dieses schielenden, verschlagenen Hinkebeins, das sich sogleich wie eine eklige Zecke an der Karawane festsaugte, hatte der wunderschöne riesige Teppich für Yeza ein menschliches Antlitz bekommen, eben das von Naiman. Selbst jetzt noch – inzwischen hatten die Beduinen den Kelim enttäuscht wieder verstaut – starrte es sie an aus dem Laubwerk der kunstvollen Ornamentik mit ihren Paradiesvögeln und anderen Fabelwesen – wie die verführerische Schlange aus dem Paradies, hinter der sich allemal der Teufel verbarg.
Langsam und geschmeidig, seiner Kraft bewusst, schlich sich der schwarze Panther durch das feuchte Unterholz. Die heiße Nässe ließ sein Fell so glatt anliegen, dass er sich wie eine nackte Echse anfühlte, pulsierend unter der gestrafften Haut, bis hin zu seinem wohlgeformten, aufrecht erhobenen Haupt. Mit leicht angezogenen Knien auf der Seite ruhend, schob Yeza unmerklich dem lautlos Herandrängenden unter der rauen Kamelhaardecke ihr Hinterteil entgegen. Sie hörte Roçs Atem schon deshalb so deutlich, weil sie sich selber zwang, keinen Laut von sich zu geben. Das Tier kannte seinen Weg, es tastete nicht vorwärts – was Yeza zweifellos vorgezogen hätte –, sondern schob sich zielsicher wie ein Python durch das fremde unterirdische Reich. Yeza ärgerte es zwar, mit dieser Selbstverständlichkeit in Besitz genommen zu werden, aber sie harrte erwartungsvoll des Augenblicks, in dem sich die perfide Schlange häutete und sich in den Feuer speienden Drachen verwandelte. Sein unberechenbares, sie immer wieder überraschendes Toben – gekonnt unterbrochen von zitterndem Innehalten, gedehntem Gleiten und kurzen schnellen Stößen – würde sie für alles entlohnen. Yeza hielt die Luft an, weil das Gefühl der sich anbahnenden Ohnmacht erfahrungsgemäß ihr Glücksgefühl noch steigerte. Sie wartete – nicht lange, doch vergebens! Roç schien es sich anders überlegt zu haben, der Python mutierte blitzschnell zur Blindschleiche, der schwarze Panther schnurrte zu einer Maus zusammen, die, ohne eine, wenn auch noch so törichte, Erklärung abzugeben, sich im Schutz der kratzigen Decke davonstahl. Yeza biss die Zähne zusammen und zwang sich, kein Wort zu sagen. Sie rollte sich zusammen, presste stumm vor Wut die Fäuste in den Schoß, bis ihre Erregung verklungen war, und suchte den Schlaf zu finden. Es war nicht das erste Mal, dass Roç sie schnöde um ihre Lust betrog und sich jeder Aussprache verweigerte. Yeza lag noch lange wach. Die verglimmenden Lagerfeuer der Beduinen leuchteten im Dunkeln wie glühende Augen.
Am nächsten Morgen brachen sie schon in aller Frühe auf, um die kurze Zeit der Frische zu nutzen, bevor die Hitze wieder einsetzte. Als Yeza einen letzten Blick zurückwarf auf das verlassene Lager, sah sie schon die ersten der über ihnen kreisenden Geier flatternd niederfahren, grad' auf die Stelle zu, wo zwischen den Felsen das verblutete Kamel lag.
Khazar und der Knabe Baitschu, die ständigen Begleiter des Gesandten, hatten den Bretonen zum Rastplatz des Il-Khan gebracht, wo eine Wagenburg die Zelte Hulagus, seiner Frauen und seines Hofstaats hufeisenförmig umringte. Durch Wachen und Wartende wurde Yves ins Audienzzelt geführt, wo ihm ein Platz zugewiesen wurde, bis die Reihe an ihm sei. Während Khazar sich diszipliniert an das Redeverbot hielt, ließ es sich der junge Baitschu nicht nehmen, den Fremden flüsternd mit Erläuterungen zu versorgen zu dem, was sich gerade vor dem erhöhten Sitz des Herrschers abspielte. Die rundliche Matrone auf dem kleineren, leicht zurückgesetzten Thronsessel, das war natürlich Dokuz Khatun, die ›Erste Gemahlin‹, die Christin. Einem Pagen oblag es, eilfertig die Audienzsuchenden, Ankläger, Beschuldigten, Beschwerdeführer und Bittsteller den Wünschen des erhabenen Hulagu entsprechend herbeizuholen, dem Oberhofmeister des Herrschers ihre Namen ins Ohr zu flüstern, den dieser dann dem Ersten Sekretär weitergab. Der hin und her hastende schlanke Page, der die Abgefertigten – nach wiederholtem Kotau – an ihren Platz zurückzugeleiten hatte, wenn sie nicht den Wachen übergeben wurden, hingegen schien Baitschu eines belustigten Kommentars wert.
»El-Aziz[50] ist unsere Geisel! Sein Vater, der Sultan von Damaskus, hat ihn uns unaufgefordert hergeschickt wie ein Gastgeschenk, samt Bediensteten, Kämmerlingen und Leibköchen«, Baitschu konnte ein helles Lachen kaum unterdrücken, »damit es dem Prinzlein bei uns Barbaren an nichts mangelt.« Er blinzelte zu Yves, um sich dessen Einverständnisses sicher zu sein. Der Bretone hob jedoch nur die buschige Augenbraue, was alles bedeuten konnte, den Knaben aber ermunterte fortzufahren. »Dabei zeigt es nur, dass ihm am Leben seines Sohnes wenig liegt – und Damaskus nehmen wir uns sowieso!«
Die Aufmerksamkeit des Gesandten richtete sich längst auf einen wohlbeleibten Würdenträger, der jetzt wie eine gewaltige Kugel vor den Thron rollte. Seine kurzen Beinchen waren kaum zu sehen.
Ein Herold verkündete: »Zur Huldigung ist erschienen: Der großmächtige Badr ed-Din Lulu[51], seines Zeichens Atabeg von Mossul!«
Der Dicke ließ sich ächzend auf den Bauch fallen, gestützt von zwei jungen Männern. Kaum hatten sie den Schnaufenden wieder aufgerichtet, warfen sie sich selbst zu Boden, während der Atabeg sich heftig atmend für sie verwandte.
»Die Prinzen Kaikaus[52] und Alp-Kilidsch[53], Söhne des Sultans der Seldschuken, habe ich auf Wunsch ihres kranken Vaters mitgebracht, der diese weite Reise nicht überlebt hätte. Sie bitten für ihn um Eure gnädigste Huld, Hulagu!« Die Rede hatte Lulu noch mehr angestrengt als das lange Stehen, doch niemand schob dem vor Erschöpfung Zitternden einen Sitzschemel unter. Der Il-Khan flüsterte mit seinem Secretarius, der Majordomus[54] tat das Verdikt des Herrschers kund: »Dieser säumige Sultan hätte den Weg zu uns auf einer Tragbare finden sollen, das hätte sein verwirktes Leben vielleicht verlängert. So gilt unser Verzeihen nur den Söhnen, die sich mit Recht unserer Macht unterworfen haben. Sie sollen sich zu unserer Verfügung halten!« Mit einer wegscheuchenden Handbewegung wurden die beiden aus dem engeren Gesichtskreis des Il-Khan entfernt. »Was aber Mossul betrifft, dessen Atabeg Ihr wart, Badr ed-Din Lulu, erwarteten wir von dieser reichen Stadt eigentlich mehr als Euer unnötiges Erscheinen.«
Der Dicke war längst – schon weil er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte – auf die Knie gesunken, seine vorgestreckten Hände stützten den schweren Körper ab. »Der Kelim«, stöhnte er verzweifelt, »ich reiste schneller, als die ihn transportierende Beduinenkarawane, wofür ich um Verzeihung bitte, wollte ich doch wie ein Vogel im Wind nicht rasten noch ruhen, bis ich vor Euer gütiges Antlitz –«
»– mit leeren Händen getreten!«, höhnte der Oberhofmeister ohne Rücksprache mit seiner Herrschaft, was den flinken Schweinsäuglein des Atabeg nicht entgangen war. Lulu wagte zwar nicht den Blick zum Thron zu erheben, aber er hielt sich nun direkt an die nächste Stufe, den Secretarius.