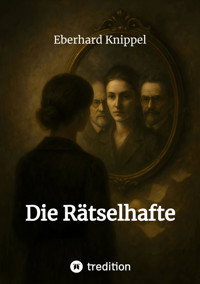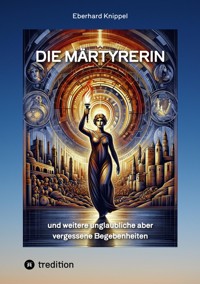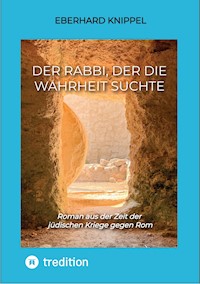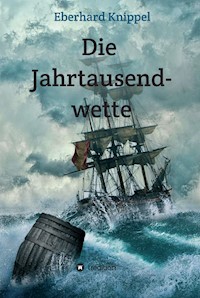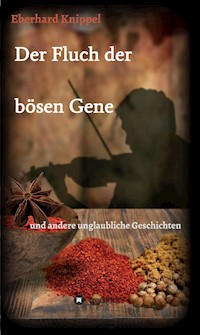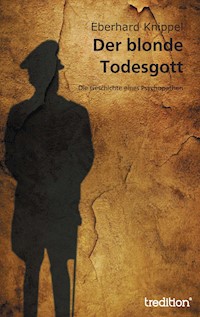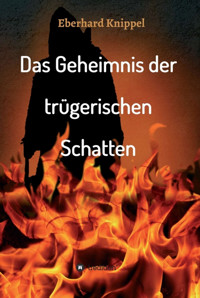
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Norden Italiens zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts. Die Amtskirche blickt mit Sorge auf eine religiöse Bewegung, die ihre Autorität als alleinige Hüterin der „einzigen Glaubenswahrheit“ in Frage stellt: Die Apostelbrüder unter der Führung des charismatischen Mönches und Wanderpredigers Dolcino und seiner Gefährtin Margherita leben die christlichen Ideale von Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Armut und erheben sich gegen die immer stärker voranschreitende Verweltlichung der Papstkirche, die sich von diesen Idealen schon längst entfernt hat. Während sich ihm immer neue Anhänger anschließen, gelingt es Dolcino, den Truppen des Bischofs von Vercelli erfolgreich Widerstand zu leisten. Als er sich jedoch mit seinen Getreuen, darunter viele Frauen und Kinder, im Winter des Jahres 1306 auf den Monte Rubello zurückziehen muss, braut sich über den Aufständischen ein bedrohliches Unwetter zusammen, und ein menschliches Drama nimmt seinen Lauf, wie es diese Gegend noch nicht gesehen hat. Erzählt nach einer wahren Begebenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Autor
Eberhard Knippel wurde 1947 in Berlin geboren. Er ist Naturwissenschaftler und arbeitete lange Zeit in der medizinischen Forschung. Nun hat er sich der Belletristik zugewendet. Von ihm erschienen bereits die ErzählungDer Tempelsowie die RomaneAmina,Der blonde TodesgottundDer Fluch der bösen Gene.
...Ich will Ihnen ein großes Geheimnis verraten, mein Lieber. Warten Sie nicht auf das Jüngste Gericht: Es findet alle Tage statt.
Albert Camus
Es ist nie passiert. Nichts ist jemals passiert. Sogar als es passierte, passierte es nicht. Es spielte keine Rolle. Es interessierte niemanden.
Harold Pinter
Die hier vorliegende Schilderung der Ereignisse um die Bewegung der Apostelbrüder folgt, was die handelnden historischen Personen und die chronologische Abfolge der Geschehnisse betrifft, im wesentlichen zeitgenössischen Dokumenten aus den Archiven der Katholischen Kirche und der Städte und Gemeinden des Piemont.
Eberhard Knippel
Das Geheimnis der trügerischen Schatten
© 2017 Eberhard Knippel
Umschlaggestaltung: Bartlomiej Zalewski
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-0843-7
Hardcover:
978-3-7439-0844-4
e-Book:
978-3-7439-0845-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
Der Sieg
Margherita
Erfolg
Die Kirche schlägt zurück
Der Gaukler
Das Blatt wendet sich
Die Schlinge zieht sich zu
Agonie
En ma fin est mon commencement
Epilog
Nachwort
Dramatis Personae
Historisch verbürgte Personen
Apostelbrüder
Fra Dolcino
Mönch und Wanderprediger, charismatischer Anführer der Sekte der Apostelbrüder. 1307 in Vercelli verbrannt.
Margherita von Trient
seine Gefährtin, 1307 in Biella verbrannt.
Gerardo Segarelli
Gründer der Sekte der Apostelbrüder, 1300 in Parma hingerichtet.
Longino Cattaneo
Vertrauter Dolcinos
Ambrogio Salomone
Vertrauter Dolcinos
Milano Sola
Vertrauter Dolcinos
Gerardo Segarello
Vertrauter Dolcinos
Bischöfliches Lager
Bertrand de Got
Erzbischof von Bordeaux, 1305 als Papst Clemens V. inthronisiert.
Raineri Avogadro
Bischof von Vercelli, führte den Kampf gegen Dolcino an.
Bernard Gui
Bedeutender französischer Dominikaner, Inquisitor und Historiker.
Emanuel Testa
Dominikaner, der für Vercelli vom Papst bestimmte Inquisitor.
Nicholas Trivet
Anglo-normannischer Dominikaner und Chronist, der in den Kampf gegen die Apostelbrüder entscheidend eingriff.
Philipp IV. (gen. der Schöne)
König von Frankreich, regierte von 1286 - 1314.
Bruder Andreas
Abt des Benediktinerklosters Sacra di San Michele (1298 - 1308).
Fiktive Personen
Bruder Ernesto
Dominikaner, Vertrauter des Bischofs von Vercelli.
Paulus
Konvertierter Jude, der sich den Apostelbrüdern anschloss.
Vorwort
Man schreibt den 18. März 1314. Jaques Molay, der dreiundzwanzigste und letzte Großmeister des Templerordens, stirbt in Paris den Flammentod. Einer nicht verbürgten Legende nach verflucht er noch auf dem Scheiterhaufen Papst Clemens V. und den französischen König Philipp IV., genannt Philipp der Schöne, und wünscht sie vor das Gericht Gottes. Und was niemand für möglich hält geschieht: Der Fluch geht tatsächlich in Erfüllung. Der Papst stirbt nur einen Monat später, der König noch am Ende des Jahres.
Was war geschehen? In einer beispiellosen konzertierten Aktion waren sieben Jahre zuvor zahlreiche Ritter des Templerordens von den Soldaten des Königs verhaftet und unter Anklage gestellt worden. Ihnen wurde unter anderem Ketzerei, Blasphemie und Homosexualität vorgeworfen. Wie man heute weiß, waren die Anschuldigungen entweder frei erfunden oder unter der Folter erpresst worden, denn die Zerschlagung dieses mächtigen Ordens war für Philipp den Schönen die einzige Möglichkeit, die ihm von den Templern drohende Gefahr zu bannen und sich des sagenumwobenen Templerschatzes zu bemächtigen. Doch ganz eigenmächtig konnte der französische König nicht gegen den Orden vorgehen oder ihn gar verbieten. Diese Entscheidung war dem Papst vorbehalten.
Hier kommt nun der zweite Machtfaktor ins Spiel, Papst Clemens V. Intelligent aber willensschwach, vor allem jedoch frankophil, war der mit der Zeit immer mehr zu einem willfährigen Werkzeug Philipps geworden. Das wusste dieser geschickt zu nutzen. Er drängte den Papst mit der Drohung, die Kirche Frankreichs von der Mutterkirche abzuspalten und Verfehlungen in dessen Privatleben öffentlich zu machen, dazu, den Templerorden auf dem Konzil von Vienne im Jahre 1311/12 zu verurteilen. Der Papst beugte sich schließlich dem königlichen Druck, da er erkannt hatte, dass die Kirche nur zu retten war, wenn er dem Willen des Königs nachgab. Er verfügte im Jahre 1312 durch die BulleVox in excelsodie Auflösung des Ordens. Wie das erst kürzlich im Vatikan aufgefundene sogenannte Chinon-Dokument vom 17. August 1308 allerdings zeigt, verfolgte er durchaus auch eigene Ziele, denn er sprach den Templerorden darin von den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen und Vorwürfen frei und erteilte ihm die Absolution.von den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen und Vorwürfen frei und erteilte ihm die Absolution.von den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen und Vorwürfen frei und erteilte ihm die Absolution.von den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen und Vorwürfen frei und erteilte ihm die Absolution.
Insgesamt stand das Pontifikat Clemens V. aber unter keinem guten Stern. Alles begann im Jahre 1304 mit dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Benedikt XI; das Konklave zur Wahl des neuen Papstes in Perugia dauerte fast ein Jahr, weil sich die fünfzehn Teilnehmer nicht mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit auf einen geeigneten Kandidaten aus ihrer Mitte einigen konnten. Insbesondere die offen ausgetragenen Streitigkeiten zwischen „französischer“ und „italienischer“ Partei innerhalb des Konklaves führten dazu, dass man sich schließlich auf einen auswärtigen Kandidaten einigte. Bei der Abstimmung am 5. Juni 1305 fiel die Wahl auf den Franzosen Bertrand de Got, den Erzbischof von Bordeaux. Fünf Monate später erfolgte dessen Inthronisierung in Lyon in Anwesenheit Philipps des Schönen durch den Dekan des Kardinalskollegiums Napoleone Kardinal Orsini. Während der Zeremonie schlug ihm eine einstürzende Mauer die Tiara vom Kopf, was allgemein als ein schlechtes Vorzeichen für seine zukünftige Amtszeit gewertet wurde. Das teilweise schwache Pontifikat, die Auflösung des Templerordens, seine spätere Krankheit sowie die Zerstörung seines Grabmals in Uzeste durch den Bildersturm der Religionskriege schienen diese Vermutung zu bestätigen.
Dennoch war eine seiner frühen Entscheidungen von herausragender Bedeutung und griff massiv in die Piemontesischen Religionskriege ein. Im Norden Italiens, vor allem in der Gegend des Piemont, haben von der Amtskirche abweichende Auslegungen der christlichen Lehre in der Bevölkerung eine lange Tradition. Schon im Jahre 371 starb in der Gegend von Vercelli der Bischof Eusebius den Märtyrertod durch die Arianer. Später folgten die Gazarer und Patarener, die sich den Dogmen der Römischen Kirche widersetzten. Selbst die bedeutenden
Häresiebewegungen der Katharer und Waldenser im Westen Europas fanden im Piemont über lange Zeit treue Anhänger.
Seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts kam es insbesondere in Frankreich, Italien und Deutschland zu religiösen Bewegungen, die ein nahes Ende der Welt vorhersagten. An ihrer Spitze standen Eremiten und Wanderprediger, aber auch ganze Gruppen von Geißlern, die weite Teile der armen Bevölkerung in ihren Bann zogen und auf diese Weise der Kirche zu einer unliebsamen Konkurrenz wurden.
Ein hervorragender Vertreter dieser neuen Bewegung war ein gewisser Gerardo Segarelli, Anführer der sogenannten Apostelbrüder, der das bedürfnislose Leben des Jesus von Nazareth und seiner Jünger als urchristliches Ideal zum Vorbild nahm und eine strenge Form von Armut und Besitzlosigkeit praktizierte, ohne jedoch eine eigene Lehre zu verbreiten. Weil Segarelli und seine Anhänger den Papst als das Oberhaupt der Kirche ablehnten, wurde im Jahre 1274 auf dem Konzil in Lyon der Kirchenbann über sie verhängt. Da dieser jedoch keine Wirkung zeigte, eröffnete die Inquisition im Jahre 1299 ein Verfahren gegen sie, in dessen Verlauf Segarelli als rückfälliger Ketzer ein Jahr später in Parma verbrannt wurde.
Im Sommer des Jahres 1306 nun rief Papst Clemens V. zum Kreuzzug gegen die fratres apstolici, die Apostelbrüder, auf, jene einstmals von Segarelli gegründete Laienbewegung unter der neuen, tatkräftigen Führung des charismatischen Mönches Dolcino und seiner Gefährtin Margherita, die in immer radikalerer Form die Verweltlichung der Amtskirche in Rom anprangerte. Diese Bewegung mündete schließlich in einem bewaffneten Kampf. Erst die im Rahmen des Kreuzzugs erfolgte Verstärkung seiner Streitmacht durch auswärtige Truppen ermöglichte es Raineri Avogadro, dem Bischof von Vercelli, im Frühjahr 1307 zu einem vernichtenden Schlag gegen die abtrünnige Bewegung der Apostel auszuholen.
Und so nahm eine Tragödie ihren Lauf, die schließlich im Flammentod Dolcinos und Margheritas endete. Damit fand eine heute zu Unrecht fast vergessene, zu ihrer Zeit aber bedeutende und sehr lebendige Bewegung ihr blutiges Ende. Eine Bewegung, welche die Ideale des Urchristentums predigte, von denen sich die Römische Kirche immer weiter entfernt hatte, weil sie den Mächtigen im Wege standen. In ihrer historisch kurzen, nur fünfzig Jahre dauernden Existenz sorgte die Sekte der Apostelbrüder zweifellos für eine nachhaltige Erschütterung der Papstkirche in Norditalien.
Häresie, das heißt eine von der Amtskirche abweichende Auslegung der christlichen Botschaft, gibt es, solange die Kirche existiert. Im Rahmen dieses Widerspruchs formte sich die heute noch gültige Struktur der Kirche heraus. Ausgehend vom absoluten Wahrheitsanspruch des Christentums galten der Amtskirche nicht nur Angehörige anderer Religionsgemeinschaften als Ungläubige, die diskriminiert oder bekehrt werden sollten, sondern auch Abweichler oder Ketzer in den eigenen Reihen, die verbindliche Dogmen und Hierarchien und somit die gesamte Kirche als alleinige Hüterin der „einzigen Glaubenswahrheit“ in Frage stellten, wurden bekämpft. In zunehmendem Maße, insbesondere mit Schaffung des Instruments der Inquisition, diente die Ketzerverfolgung nicht nur dem kirchlichen, sondern auch dem politischen Machterhalt weltlicher Herrscher.
Mit dem religiösen Aufbruch im Europa des elften Jahrhunderts und einem damit einhergehenden geschärften spirituellen Bewusstsein der Menschen, die zu der Erkenntnis kamen, dass jeder Christ auch unabhängig von der Kirche dazu verpflichtet sei, sein Leben eigenständig nach den christlichen Geboten auszurichten, erlangte die Gegenreaktion der Amtskirche eine neue, grausame Dimension. Nachdem im zwölften Jahrhundert die großen Ketzerbewegungen der Katharer und Waldenser für Unruhe gesorgt hatten, griff die Kirche nun zu drastischeren Mitteln wie dem Albigenserkreuzzug und der Beginenverfolgung. Von der Härte der Auseinandersetzungen zwischen den Abweichlern und der Römischen Kirche in jener Zeit zeugt ein Ausspruch des päpstlichen Legaten Arnaud Amaury kurz vor der Einnahme der Katharerstadt Beziers:Tötet sie alle, Gott wird die Seinen schon erkennen!Einen Höhepunkt der Ketzerbekämpfung im frühen vierzehnten Jahrhundert bildete zweifellos der schon erwähnte Kampf der Kirche gegen die Apostelbrüder.
Doch was sagt die nüchterne, auf historischen Fakten beruhende Beschreibung dieser gewaltsamen Auseinandersetzungen schon darüber aus, wie viel Leid und bittere Not sich dahinter verbargen. War das Leben der Ausgestoßenen und Verfolgten, das die Apostelbrüder über Jahre hinweg führten, schon schwer genug zu ertragen, so erwartete sie in der Höhle auf dem Monte Rubello, ihrer letzten Zufluchtsstätte, noch eine ungleich größere Herausforderung, die an die Grenzen jedes Menschen stoßen musste. Nur der titanischen Willenskraft ihres Anführers Fra Dolcino und seiner Gefährtin Margherita, die ihnen gezeigt hatten, dass eine Idee zur Waffe werden kann, ist es zu verdanken, dass die Sektenmitglieder Hunger, Kälte und dem militärischen Druck der Truppen des Bischofs von Vercelli so lange standhalten konnten.
Die von den Strapazen gezeichneten Menschen, geisterhaft bleichen Lemuren ähnlich, standen im Bann ihres Anführers und begegneten ihm bis zur letzten Minute mit Ehrerbietung und Respekt, obwohl zum Schluss offensichtlich war, dass seine Macht die Grenzen der Höhle nicht mehr überschritt. Man kann annehmen, dass in dieser Ausnahmesituation, den sicheren Tod vor Augen, all das geschah, was in solchen Situationen am Rande des Abgrunds gewöhnlich geschieht: Das endlose Fragen nach dem Warum, verzweifelte Hoffnung und Euphorie, tiefes Misstrauen gegen die langjährigen Gefährten, Veränderungen der Persönlichkeit durch den quälenden Hunger, aber auch bedingungslose Treue, Mitmenschlichkeit und Todesverachtung.
Die Höhlenbewohner waren die Figuren in einem schaurigen Bühnendrama, doch nur zwei von ihnen spielten die Hauptrolle: Fra Dolcino, charismatischer Mönch und Soldat, standhaft bis zum bitteren Ende, aufopfernd und solidarisch, aber auch selbstverliebt, zunehmend jeder Kritik unzugänglich und fanatisch bis zur Selbstaufgabe, und Margherita, seine Geliebte, sanft und energisch zugleich, der Idee und ihrem Verkünder verfallen, sodass sie trotz ihres kritischen Geistes, der die Schwächen der Apostelsekte sehr wohl erkannte, bewusst den sicheren Tod wählte.
Würde man die Apostelbrüder und –schwestern heute zu ihrem Aufenthalt in der Höhle auf dem Monte Rubello befragen, könnten sie die verschiedenen Facetten ihres Verhaltens wahrscheinlich nicht erklären, wie das wohl bei den meisten traumatischen Ereignissen solchen Ausmaßes der Fall ist. Doch wie auch immer sie ihre Situation empfanden, sie gehörten genauso unwiderruflich zu den dramatis personae wie auch die Vertreter der Römischen Kirche, allen voran Raineri Avogadro, der Bischof von Vercelli, und der Dominikaner Emanuel Testa, der für die ordnungsgemäße Beendigung dieses Dramas zuständige Spürhund Gottes und der Heiligen Inquisition, die Repräsentanten der weltlichen Obrigkeit in den Städten und Kommunen und nicht zuletzt die Söldner des bischöflichen Heeres.
Alle waren in den gleichen Kampf verwickelt, in den ewigen Kampf des Menschen gegen seinesgleichen, den verbissenen Kampf um Macht, Herrschaft und Deutungshoheit, der gegensätzlicher als die Lehre des Religionsstifters Jesus von Nazareth nicht sein konnte und der überall auf der Welt geführt wurde und wird, mit einer menschenverachtenden Grausamkeit, die einen sprachlos zurücklässt. Dieser Kampf offenbart in Bezug auf die christliche Religion ein Phänomen, das sich durch deren ganze Geschichte zieht, nämlich den allzu offensichtlichen Widerspruch zwischen der reinen Lehre und dem praktischen Handlungsmuster der Römischen Kirche sowie der sich auf sie berufenden weltlichen Herrscher. Dieser eklatante Widerspruch ist heute noch genauso aktuell wie zur Zeit der Apostelbrüder.
Folgen wir nun der ebenso hoffnungsvollen wie auch tragischen Geschichte der Apostelsekte. Sowohl die Handlungen der beteiligten historischen Personen als auch die Abfolge der Ereignisse orientieren sich in allen wesentlichen Aspekten an den zeitgenössischen Quellen.
Prolog
Die Ereignisse, über die hier berichtet wird, trugen sich auf dem Gebiet des heutigen Piemont zu, einer Landschaft im Norden Italiens, die zu Recht als ein irdisches Paradies bezeichnet werden kann. Und doch ist dieser Boden reichlich mit Blut getränkt, das vor allem in den gegen die Papstkirche gerichteten Bewegungen des Mittelalters, den Piemontesischen Religionskriegen, vergossen wurde.
Schon in prähistorischer Zeit besiedelt, wurde diese Region in vorrömischer Zeit von Galliern und Ligurern bevölkert und später von den nach Norden vordringenden Römern besetzt. Erst mit dem Verfall des Römischen Reiches erlangte sie eine gewisse Eigenständigkeit zurück. Nach einer wechselvollen Geschichte, in der es im zwölften Jahrhundert infolge des Kampfes der lombardischen Städte gegen das deutsche Kaisertum zur Bildung verschiedener Markgrafschaften und Lehensgüter wie Savoya, Turin, Ivrea, Monferrato, Ceva und Saluzzo kam, gewannen die großen Städte der Region immer mehr an Einfluss.
Der Name Piemont tauchte zum ersten Mal im dreizehnten Jahrhundert auf und beschrieb eine Landschaft, die von den Alpen und den Flüssen Sangone und Po eingeschlossen wird. Sie gliederte sich in die im Norden und Osten gelegenen grandiosen, schneebedeckten Alpengipfel und Täler, das sanfte Hügelland im Südosten mit seinen malerischen Weinbergen, die der Frühling in ein üppiges Grün, der Herbst aber in ein leuchtendes Rot taucht, und schließlich die größeren Städte wie Turin, Vercelli, Novara, Biella, Asti und Alessandria in der Poebene.
Und über allem schwebte vor siebenhundert Jahren der Geist des Mittelalters. Der Mythos vom allmächtigen Gott, der über den ohnmächtigen, sündhaften Menschen herrscht, bestimmte das Leben des Volkes. Die von Gott gewollte Ordnung, der man in Demut folgte und zu der es keine denkbare Alternative gab, bestimmte unwiderruflich Hierarchien und Rangunterschiede, Besitz und das tägliche Handeln. Wer über dieses Schema hinausdachte oder gar etwas an Gottes ewigem Plan ändern wollte, erntete die Skepsis seiner Zeitgenossen, vor allem aber die der weltlichen und geistlichen Herrscher.
Und so kam es für die Menschen darauf an, im Rahmen der vorgegebenen Ordnung zu überleben und die Beziehungen zu jenen Menschen zu pflegen, die ihnen bei der Bewältigung der überall lauernden Gefahren zur Seite stehen konnten, sei es innerhalb der Familie, der Nachbarschaft oder der lokalen Obrigkeit. Nur die Gemeinschaft sicherte das Überleben, der Einzelne zählte damals wenig.
Man kannte außerhalb seines Wohnortes keine oder nur wenige Menschen, und weil die Verkehrswege abseits der Städte, die ihre Einwohner und deren Habe durch Mauern schützten, als unwegsam und bedrohlich galten, war das Reisen auf den unbefestigten Straßen und Pfaden ohne ausreichende Orientierung und unter ständiger Gefahr von Raubüberfällen nur mühsam zu bewältigen. Deshalb verließen auch die meisten Menschen des Mittelalters ihre Scholle zeitlebens nicht. Viel unterwegs waren nur Händler und Hausierer, die ihre Waren auf den städtischen Marktplätzen anboten, dazu Pilger und Schausteller, Handwerker auf der Walz, Menschen, die ihren Wohnsitz wechselten und Herren der weltlichen und geistlichen Obrigkeit, die ihre weit verstreuten Besitzungen inspizierten, um ihren Herrschaftsanspruch zu demonstrieren.
Wer unterwegs war, musste tief in die Tasche greifen. Da man wegen drohender Überfälle oft in größeren Gruppen reiste, waren Geleitabgaben fällig, dazu Mittel für Verpflegung und Übernachtung in den meist einfachen Gasthäusern am Wegesrand sowie Löhne für Ortskundige und Fuhrleute. Das Reisen zu Pferde belastete den Geldbeutel in besonderem Maße. Man war allgemein in einfacher, schlichter Kleidung unterwegs, um Räubern und Plünderern zu entgehen. Adel und Geistlichkeit reisten, um Überfälle möglichst zu vermeiden, mit bewaffnetem Geleit.
Der Reisende kam auf den holprigen Wegen nur langsam voran; oft war man zu Pferde oder gar zu Fuß schneller als mit der Kutsche, besondere bei schlechtem Wetter, wenn knöcheltiefer Schlamm die Wege aufgeweicht hatte. Zentrale Routen wurden stärker befahren als abgelegene, so die durch das Susatal im Piemont führende Straße nach Frankreich, der sogenannteFranzosenweg, der zu den Alpenpässen von Moncenisio und Monginevro führte. Er war für die Bewohner der Poebene das Tor zu Frankreich und dem ganzen Westen Europas und diente den Pilgern aus Santiago de Compostela, dem Süden Frankreichs und dem Norden Europas zur Überquerung des Alpenmassivs auf ihrem Weg nach Rom.
Und so wogte auf ihm ein nie abreißender Strom von Menschen, Tieren und Wagen durch die faszinierende Bergkulisse. Es zogen Händler mit ihrem Vieh, mit Getreide und Wein durch das Tal und Soldaten, welche in den Krieg marschierten oder bereits gekämpft hatten und nun zurückkehrten. Es zogen Spielleute, Gaukler und Schausteller dahin und Herren der weltlichen und geistlichen Obrigkeit mit bewaffnetem Geleit. Am Wegesrand fanden die Reisenden in einfachen Gasthäusern Unterkunft und Verpflegung. Oder sie reisten wie die zahlreichen Pilger in die nahe gelegenen religiösen Zentren weiter, um dort ein Nachtlager zu finden: nach Santo Antonio di Ranverso, die Abtei Novalesa oder die weithin berühmte, auf dem Gipfel des Pirchiriano erbaute Benediktinerabtei Sacra di San Michele.
Langsam, unaufhaltsam strömte der Zug der Reisenden durch das Tal, teilte sich, wenn er dem Gegenverkehr ausweichen musste, floss wieder zusammen, atmete, versiegte, wenn die Sonne hinter den Bergen versank, ergoss sich bei Tagesanbruch erneut ins Tal. Jeden Tag aufs Neue, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt, langsam, bedächtig, Reisende verlierend, andere wieder sich neu einverleibend, immer in Bewegung bleibend, niemals ganz versiegend.
Kutschen schoben sich an Wanderern vorbei, Reisende zu Fuß wiederum an festgefahrenen Kutschen. Schneller waren nur die Reiter, sie zogen an der Karawane vorbei, Kuriere und Meldereiter mit wichtigen Dokumenten, bestimmt für wichtige Personen, die ihre Tiere irgendwo am Straßenrand kurz tränkten oder, wenn sie gar zu schnell und ohne Unterbrechung geritten waren, das Pferd eilig wechselten, sofort wieder aufsprangen, die gewünschte Richtung einschlugen und bald, umgeben von einer dichten Staubwolke, am Horizont verschwanden.
Der Zug der Reisenden aber bewegte sich immer weiter, er wurde niemals unterbrochen. Er symbolisierte gleichsam das Leben, das seine Bahn zog, unbeirrbar, von unsichtbaren Gesetzen gelenkt, scheinbar bis in alle Ewigkeit. Und doch wird diese Bewegung manchmal unterbrochen. Dann hält die Zeit den Atem an, für die Geschichte nur einen Wimpernschlag lang, für die Betroffenen aber eine Ewigkeit. Meist sind diese Unterbrechungen der unendlichen, gleichförmigen Bewegung banalen Ursprungs, zuweilen aber sind sie bedeutend und tragisch. Die Ereignisse, von denen hier berichtet wird, waren sowohl bedeutend als auch tragisch. Sie veränderten das Leben vieler Menschen und wirkten noch für lange Zeit im kollektiven Gedächtnis der Piemontesischen Bevölkerung nach.
Am Beginn des vierzehnten Jahrhunderts kam es also zu einem solchen Ereignis. Es tobte einer der erbittertsten Kämpfe in der Geschichte der Römisch-Katholischen Kirche. Ein Kampf um die Deutungshoheit über die christliche Lehre und damit letztlich um die Macht. Denn nur wer die ganze Macht hatte, konnte die Geschicke der Menschen in seinem Sinne lenken.
Die Abtrünnigen und damit die Gegner der Kirche waren in jener Gegend die Apostelbrüder, eine Laiensekte, die die reine Lehre des Jesus von Nazareth in Armut und Demut zu leben versuchte und damit zwangsläufig in Widerspruch zur Papstkirche geriet, weil diese die Botschaft ihres Religionsstifters schon längst vergessen hatte. Und so kam es zu einer menschlichen Tragödie ungekannten Ausmaßes, die mit einem denkwürdigen Ereignis zu den Ostertagen des Jahres 1307 nahe der piemontesischen Ortschaft Trivero seinen vorläufigen Höhepunkt fand.
Der Sieg
Feldlager der bischöflichen Truppen bei Trivero, Gründonnerstag, 23. März 1307, kurz vor Mitternacht. Überall herrscht noch geschäftiges Treiben, in Gruppen stehen die Söldner im Schein der Lagerfeuer beisammen und lassen diesen denkwürdigen Tag an sich vorüberziehen. An Schlaf ist nicht zu denken, die Erregung des Kampfes ist noch nicht abgeklungen, sie zittert übermächtig durch ihre Körper, und noch stehen riesenhaft und plastisch die schrecklichen Bilder der bizarren Höhle auf dem Monte Rubello vor ihren Augen, die den Apostelbrüdern als letzter Rückzugsort gedient hatte: gespenstergleiche, magere Gestalten, ausgemergelte Weiber mit starren, ausdruckslosen Augen, ihre verhungerten Kinder fest an sich gedrückt, als wollten sie diese niemals mehr loslassen, todesmutige, fanatisch kämpfende und bis zum Skelett abgemagerte Männer, die sich bis zum letzten Blutstropfen verteidigten. Und dann diese Ströme von Blut, als die bischöflichen Soldaten alles, was atmete und sich bewegte, Männer, Frauen und Kinder, erbarmungslos niedermachten und schließlich, als alles zu Ende war, die Höhle auf Befehl des Bischofs Avogadro ausräucherten. Nichts sollte mehr an die schreckliche Zeit ihrer Niederlagen und Demütigungen erinnern.
Und so glich das Lager in dieser Nacht einem aufgescheuchten Bienenstock, alles war um diese nachtschlafende Zeit auf den Beinen, sich ununterbrochen Aufgaben und Herausforderungen suchend, um nicht zur Besinnung zu kommen. Bis einen der Schlaf übermannte und alles Schreckliche auslöschte. Die ganze übermenschliche Anspannung des Tages musste hinausgeschrieen, die Rache ausgelebt, die schrecklichen Bilder im Alkohol ertränkt und sich immer wieder vergewissert werden, dass alles gut gewesen war und voller Sinn und sie auf der richtigen Seite gekämpft hatten. Immer wieder versicherte man sich gegenseitig, dass die Apostelbrüder die eigentlichen Unmenschen gewesen waren, die wie die wilden Tiere über die Bevölkerung, einfache, rechtschaffene, vor allem aber unschuldige Christen, hergefallen waren und ihre Kameraden niedermetzelten.
Jeder konnte sich an andere schreckliche Taten der Abtrünnigen erinnern, der eine an die fünf getöteten Ritter, deren Blut das Wasser des Flusses Riccio rot gefärbt haben soll, andere an die beiden abgeschlachteten und verstümmelten Priester, die die Dolcinianer beim Spionieren überrascht hatten, wieder andere an die gefallenen Kameraden bei der ersten, im Fiasko endenden Erstürmung des Monte Rubello durch die Bischöflichen. Jeder schmückte die Vorfälle in allen grausigen Einzelheiten aus, ohne auch nur im Entferntesten an die eigenen Bluttaten zu erinnern, die sie vollständig aus ihrem Gedächtnis gestrichen hatten.
Und überhaupt: Was erdreisteten sich die verfluchten Häretiker, die von Gott erschaffene Ordnung hier auf Erden in Frage zu stellen und mit ihr die Heilige Kirche selbst. Immer wieder und wieder mündete die innere Erregung der bischöflichen Söldner in einer Flut von Emotionen, in der Genugtuung über ihren grandiosen Sieg und die Tilgung der Schande, dass die Apostelbrüder sie über Jahre an der Nase herumgeführt hatten.
Nicht viel anders war die erwartungsvolle Stimmung im Zelt des Bischofs, wo die im Winterlager verbliebenen und die im Verlauf des Tages herbeigeeilten Würdenträger der umliegenden Städte und Kommunen, die im Kampf gegen die Sekte der Apostelbrüder ein Bündnis eingegangen waren, sich versammelt hatten: die Konsuln, Deputierten, Geistlichen, der Capitano von Vercelli und der vom Papst für diese Region bestimmte Inquisitor, der die ganze Zeit auf der Lauer gelegen hatte, als der Fuchs Fra Dolcino noch in Freiheit war, um nun die eigentliche Arbeit zu tun, im Hintergrund die Fäden zu ziehen und die Heilige Mutter Kirche zu rehabilitieren, der Dominikanermönch Emanuel Testa. Schließlich in seiner schüchternen, zurückhaltenden Art Bruder Ernesto, wie Testa Dominikaner und, wie man sich hinter vorgehaltener Hand zuflüsterte, mit einem gewissen Einfluss auf Raineri Avogadro, den Grafen von Biella und Bischof von Vercelli.
Alle Anwesenden waren bis zum Äußersten gespannt, denn sie warteten auf ein Ereignis, das sie seit Jahren sehnlicher herbeigewünscht hatten als alles andere, nämlich die Vorführung des gefangenen Anführers der Apostelbrüder oder, wie es im Sprachgebrauch der Katholischen Kirche und deren Inquisition hieß, der Pseudoapostel. Es war den bischöflichen Truppen gelungen, ihn lebend in die Hand zu bekommen, nun sollte er in Kürze im Lager eintreffen. Lauthals jubelten da die versammelten hohen geistlichen und weltlichen Herrn, als sie diese Nachricht vernahmen. Ihre Würde und die Etikette vollständig vergessend, fielen sie sich wie von Sinnen um den Hals und priesen Gott den Herrn aus vollem Herzen. Nun standen sie dicht gedrängt und erregt im bischöflichen Zelt und zählten die Minuten bis zu dem vielleicht bedeutendsten Augenblick ihres Lebens
Doch war es nun eine Laune des Schicksals oder aber ein hintergründiger Wink der Geschichte, in der geschäftigen und emotional aufgeheizten Stimmung des Militärlagers ging jenes Ereignis, auf das alle mit solcher Inbrunst warteten, fast vollständig unter, und die Ankunft des Pferdegespanns mit den Gefangenen wurde im allgemeinen Trubel nicht einmal bemerkt. So hielt das Gefährt still und unerkannt vor dem Zelt des Bischofs, die Bewachungsmannschaft meldete dem Oberbefehlshaber ihre Ankunft und wartete auf den Befehl, die Gefangenen vor ihn zu führen.
Als Raineri Avogadro, Bischof von Vercelli, die Nachricht von der Ankunft der Pseudoapostel vernahm, verspürte er anfangs nichts als eine große innere Leere und Schwäche. Er war erschöpft, denn der Jüngste war er nicht mehr. Dass ihm auf seine alten Tage das hier geschah, diese übermenschliche Kraftanstrengung zur Niederschlagung des Apostelaufstandes, verbitterte ihn. Doch schon im nächsten Augenblick durchströmte ihn ein heißes Gefühl der Genugtuung, dass diese Angelegenheit, die sich zunächst so zäh entwickelt hatte, doch noch zu einem guten Ende gekommen war. Er schickte ein Stoßgebet zum Himmel, der ihn diesen grandiosen Sieg noch erleben ließ. Und gab Befehl, die Gefangenen hereinzuführen.
Schwankend, aber aufrecht betraten Fra Dolcino und Margherita das Zelt und wurden von den Soldaten vor die Füße des Bischofs gestoßen. Ungleicher konnte das Bild, das sich den Anwesenden nun bot, nicht sein: Hier Avogadro, ein älterer, ergrauter Herr mit leicht gerötetem Gesicht, stand fest und wuchtig in seiner Rüstung da, eine seltsame Mischung aus Krieger und Gottesmann, ganz souverän und überzeugt von sich und seiner Bedeutung. Er hielt sich bewusst aufrecht, nur wenige Eingeweihte wussten, dass ihm sein Alter zu schaffen machte. Ansonsten gut genährt und im Vollbesitz seiner Kräfte, dazu ausgefüllt vom Rausch des Sieges, unbändigem Hass und dem süßen Gefühl der Rache. Dort die Abgemagerten, mühsam aufrechtstehend aber trotzig, mit Verachtung im Blick, deren elende Körper von unendlichen Strapazen gezeichnet waren. Jeder Schritt bedeutete Qual, völlig mittellos und ohne Macht waren sie, nur am Leben gehalten von einer Idee, einer Illusion vielleicht, an die sie mit jeder Faser ihres Körpers glaubten und die ihnen diese übermenschliche Kraft verlieh, der Übermacht zu trotzen. Jeder im Zelt spürte, hier waren trotz aller Schwäche noch Kraft und Widerstand. Die Besiegten hatten sich entgegen aller Hoffnung keineswegs aufgegeben.
Raineri Avogadro, Bischof von Vercelli und Oberster Feldherr im heiligen Kampf gegen die vom rechten Glauben abgefallenen Pseudoapostel, glaubte sich in diesem Augenblick am Gipfelpunkt seines Lebens. Dies konnte ihm der Papst nicht vergessen. Hier, in seiner Diözese, hatte sich das Schicksal der Katholischen Kirche entschieden, hier hatte er den filius debial, den Teufelssohn, besiegt, und hier würde er ihn auch unschädlich machen. Niemand konnte das ungeschehen machen, keiner ihm je diesen Sieg nehmen. Obwohl jetzt, da der Sieg errungen war, viele ihren Anteil an der Beute einforderten. Sie kamen nun aus ihren Löchern hervorgekrochen, in denen sie sich versteckt hielten, als er sie gebraucht hätte. Aber egal, noch nach Generationen würden sich die Menschen dieser Geschichte erinnern, die vor allem seine Geschichte war, und in Ehrfurcht an ihn denken, an ihn, Raineri aus dem Geschlecht der Avogadro, einstmals Bischof von Vercelli.
Auch der Inquisitor des Papstes, Emanuel Testa, warf einen Blick auf die Gefangenen, und ein bitterböses Lächeln verzerrte seine gleichmäßigen Gesichtszüge. Wie die Nüstern eines Raubtieres zuckten seine Nasenflügel beim Anblick des Todfeindes, starr war sein Blick auf die Beute gerichtet. Nun, wo das Wild erlegt war, begann seine eigentliche Arbeit, die eines harten, aber gerechten domini canes, eines Spürhundes Gottes. So wahr er an den einen Gott glaubte, wollte er sich dieses Namens würdig erweisen.
Bruder Ernesto, der Dominikaner und inoffizielle Berater des Bischofs von Vercelli, seinen gekrümmten Rücken mit einem weiten Kapuzenmantel verdeckend, stand in der zweiten Reihe. Er hatte sich nicht vorgedrängt. Keinen Hass wie die anderen spürte er gegenüber den Abtrünnigen, wenngleich er ihre Taten scharf verurteilte, weil sie der heiligen göttlichen Ordnung auf Erden widersprachen. Nicht solchen unbändigen Hass hatte er auf den Häretiker wie der Bischof, der der Kirche diente ohne Wenn und Aber, und für den es nur unbedingten Gehorsam gab, bedingungslose Unterordnung unter den Willen der gottgewollten Obrigkeit. Für ihn war die Welt einfach zu begreifen, es gab nur Gut und Böse, und wer nicht zu den Guten zählte wie er selbst, die Kirche und die weltliche Obrigkeit, musste bekämpft, und wenn es denn sein musste, ausgerottet werden. Nur die Sache zählte, die Mittel waren gleich. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es schon in der Bibel stand. Der göttlichen Ordnung zuliebe. Ein Schauer des Ekels und der Abscheu durchzitterte den feingliedrigen Körper des Dominikaners und Schöngeistes Ernesto. Erst versuchte er, diese seelische Anwandlung ebenso wie seinen krummen Rücken wie immer vor den versammelten Herren zu verbergen. Doch plötzlich tat er etwas, das er noch nie getan hatte: Er reckte sich, streckte seinen dürren Sperberkopf in die Höhe und zog den weiten Kapuzenmantel eng um sich, seinen krummen Rücken auf diese Weise ostentativ zur Schau stellend, und drehte sein Gesicht mit dem frechen, aufmüpfigen, von Ekel gezeichneten Ausdruck den Versammelten zu, sodass jeder seine heimliche Abneigung erkennen konnte.
Indessen ruhte der feindselige Blick des Bischofs auf Dolcino, eine Spur zu lange, wie es manchem Anwesenden schien. Doch der Oberste Befehlshaber wollte seinen Gegner bis in den letzten Winkel ergründen, den Menschen, der ihm viele Jahre so zugesetzt hatte, ihn immer wieder narrte, der die Kirche, den Papst und damit ihn selbst nicht akzeptierte, ihn verhöhnte und seine Leute massakrierte. Dem er Angebote gemacht hatte, von denen andere nur träumen konnten, und der aus Verstocktheit alles ablehnte. Sogar Oberführer bei den bischöflichen Truppen hätte er werden können. Der Bischof schüttelte den Kopf, er konnte es immer noch nicht begreifen. Er war fest entschlossen, das Innerste dieses Abschaums nach außen zu kehren, und wenn es sich nicht nach außen kehren ließ, hatte er Mittel und Wege und gute Verbündete dazu, die der verstockten Natur auf die Sprünge helfen würden. Wenn er in den letzten Jahren ein Wort verlernt hatte, dann war esGnade. Auch für den Fall, dass er sich damit versündigte, Gnade würde es für diesen Auswurf der Menschheit nicht geben.
„Auf die Knie, du Hund! Weißt du nicht, wer vor dir steht?“ zischte er.
Die zerlumpte, blutverschmierte Gestalt wankte bedrohlich, fand jedoch schnell ihr Gleichgewicht wieder, machte aber keine Anstalten niederzuknien. Einer der Landsknechte, die ihn hereingeführt hatten, versuchte, Dolcino in die Knie zu zwingen. Vergeblich, der Gefangene stand wie ein Denkmal und blickte den Bischof höhnisch an.
Avogadro schaute zu Margherita hinüber; er sah sie heute das erste Mal ganz aus der Nähe, wusste von ihrer legendären Schönheit und erinnerte sich an die Schlagkraft der Apostelamazonen, die sie angeführt hatte. Ihre Schönheit war trotz der Entbehrungen noch deutlich sichtbar, gestand er sich ein, aber auch hier verriet ihm ein Blick in ihr entschlossenes Gesicht, dass sie sich jedem Befehl verweigern würde.
Der Blick des Bischofs wanderte wieder zurück zu Dolcino. Immer noch nicht hatte dieser sein Knie gebeugt, aufrecht wie eine römische Statue stand er vor ihm, und wie er noch mit erstauntem Gesicht die Frechheit seines Todfeindes registrierte, geschah etwas ganz und gar Ungeheuerliches, das selbst ihn fassungslos machte. Der Gefangene spie verächtlich vor ihm aus, und der Bischof hatte im gleichen Augenblick eine Erkenntnis, die ihm von nun an unwiderruflich erschien: Dieser Abschaum würde nur dann reden und ihn respektieren, wenn man ihm alle Knochen im Leibe bräche. Nun gut, der Häretiker wollte es so, er würde sie ihm brechen, nichts würde mehr von ihm bleiben. Er winkte den Wachen, sie sollten die Gefangenen in die sichere Festung von Vercelli bringen.
Als die Gefangenen das Zelt verlassen haben, hebt ein Stimmengewirr an, alle gestikulieren, erregen sich, lachen und stoßen mit ihren Weinkelchen auf den Sieg an. Am liebsten möchte der Bischof diesem Chaos entfliehen, um ein wenig Ruhe zu finden. Doch er hat Verpflichtungen, das weiß er, sowohl geistlicher als auch politischer Art. Jetzt, wo das Wild erlegt ist, kommt die Zeit, Bündnisse für die Zukunft zu schmieden, vorteilhafte Beziehungen zu festigen und Pfründe zu sichern. Spät in der Nacht, als der Morgen schon graut und sich das Zelt zu leeren beginnt, zieht auch er sich zur Nachtruhe zurück. Doch an Schlaf ist nicht zu denken. Er kommt nicht zu Ruhe, seine Nerven sind zum Zerreißen gespannt, und so beschließt er, die frohe Siegesbotschaft an den Papst jetzt zu schreiben, um sie dem Boten schon im Morgengrauen überreichen zu können. Der Heilige Vater soll so schnell wie möglich von seinem grandiosen Sieg erfahren.
Avogadro geht zum großen Eichentisch, legt die schwere Rüstung ab und lässt sich erschöpft in den Stuhl fallen. Alle Knochen tun ihm weh, und sein ganzer Körper ist voller Schmerzen. Er hat ihm ohne Zweifel in der letzten Zeit zu viel zugemutet. Keine Pause hat er sich gegönnt, keine Ruhe, immer unterwegs war er in seiner schweren Rüstung, nur Anspannung von früh bis spät. Er sehnt sich nach etwas Stille und Geborgenheit. Und trotzdem, der Bischof möchte den gegenwärtigen Zustand um nichts in der Welt gegen ein beschauliches Leben im Ruhestand eintauschen. Den hätte er sich freilich verdient, davon ist er schon überzeugt, doch er ist nicht der Typ fürs Nichtstun, für den Müßiggang, für das theoretische Studium der Heiligen Schrift. Er ist vielmehr ein Mann der Tat, er muss die Personen auf dem Schachbrett des Lebens hin und her schieben, ihre Positionen verändern, ja, er gibt es unumwunden zu, ein bisschen Gott möchte er schon spielen.
Und hat er nicht gerade etwas bewegt, Großes geleistet, einen triumphalen Sieg errungen? Der filius debial ist erlegt, das große Ärgernis der Amtskirche beseitigt. Der Papst wird es zu würdigen wissen, er wird es würdigen müssen. Doch was, wenn er den Prozess gegen die Pseudoapostel an sich zieht, nach Bordeaux, Poitiers, Toulouse oder wo immer der Papst sich jetzt, wo er dauerhaft in Frankreich residiert, aufhält. Wird er nicht den Sieg wegen seiner großen Bedeutung für sich verbuchen wollen und er selbst, der kleine Bischof von Vercelli, irgendwo hinter den französischen Alpen, geht leer aus? Immerhin hatte der Heilige Vater zum Kreuzzug gegen die Sekte der Apostelbrüder aufgerufen.
Der stämmige, alte Mann steht unvermittelt auf und geht erregt im Zelt umher, fünf Schritte in die eine Richtung, sechs in die andere. Die Rötung seines Gesichts ist eine Spur intensiver als sonst. Aber das ist doch sein Sieg, der da errungen wurde, er hat gekämpft und gelitten, die Befehle gegeben, seine Leute verloren. Er selbst hat die Verbrecher lebendig gefangen und Ketten über sie werfen lassen, hat die Sekte mit Stumpf und Stiel ausgerottet, sodass sie ihr freches Haupt nie mehr erheben wird, und persönlich für Ruhe und Ordnung in dieser geschundenen Region gesorgt.
Endlich hat nun all das Chaos ein Ende, die Überfälle, Brandstiftungen, der Raub des Viehs, die fürchterlichen Gemetzel und Verstümmelungen. Er denkt an die ungezählten Bürgermeister der Gemeinden, die bei ihm vorstellig wurden und in ihrer Not um Hilfe gebeten hatten. Soll das alles umsonst erlitten sein und die Ernte nun von anderen eingefahren werden? Die geschundene Bevölkerung dieser Gegend hat ein Recht darauf, hier an Ort und Stelle Genugtuung zu erfahren für die jahrelange Unruhe, unter der sie litt. Nein, der Prozess muss hier stattfinden, in Vercelli, Biella oder Novara, in seiner Diözese und nicht etwa irgendwo in Frankreich. Oder will vielleicht gar Philipp, der französische König, den Prozess in sein Land holen, der heimliche Strippenzieher hinter dem Papst? Genug Einfluss auf die Kirche hat er ja jetzt, nachdem der Heilige Vater in der ersten Amtshandlung seines Pontifikats zehn Kardinäle berief, wovon neun Franzosen waren. Das Gesicht des alternden Bischofs verzieht sich zu einem hintersinnigen Lächeln. Der Papst soll nicht denken, die Welt durchschaue ihn nicht.
Nein und abermals nein, der Prozess muss hier in seiner Diözese stattfinden. Und mit einem Urteil enden, das jedem das Blut in den Adern gefrieren lässt, wenn er nur daran denkt, sich der Kirche zu widersetzen. An ihn wird man dabei denken, mit Respekt, vor allem aber mit Angst. Und das ist gut so. Er wird sich jetzt an die Formulierung der Papstbotschaft machen und dem Pontifex damit seine eigenen Gedanken ins Hirn pflanzen.
An das Papstschreiben über den grandiosen Sieg schließt er noch einen Brief an Bruder Andreas an, den Abt der Benediktinerabtei Sacra di San Michele, die am Wege des Papstboten liegt. Nachdem er beide Briefe versiegelt hat, lässt er einen verschwiegenen Boten kommen und ermahnt ihn, die Post sicher und schnell an ihre Adressaten zu bringen. Nachdem er ihn gesegnet hat, verlässt der Bote eilig das Bischofszelt. Es ist Karfreitag, der 24. März 1307, am frühen Morgen. Am heutigen Abend kann er in San Michele sein. Er wird den Franzosenweg durch das Susatal nehmen. Wenn alles gut geht, wird der Bischof sich für diesen Vertrauensdienst erkenntlich zeigen.
Der Bote mit der bischöflichen Botschaft jagte dahin. Die Landschaft flog an ihm vorüber, und genauso flogen ihn die Gedanken an, dazu kamen die bösen Bilder, die er in den letzten Stunden tapfer zu verdrängen suchte. Er fühlte fast körperlich tiefe Dankbarkeit, dass er das Gemetzel am gestrigen Tage überlebt hatte. Gott ließ ihn leben und schenkte dem Bischof den Sieg, dem Vertreter des rechten Glaubens, gegenüber dem abtrünnigen Hund. Sein Urteil war klar: Wer sein freches Haupt gegen den Bischof, den Papst gar erhob, hatte sein Leben verwirkt. Dessen Irrlehren mussten ausgebrannt werden aus dem Gedächtnis der rechtschaffenen Christenmenschen. Die Apostelbrüder hatten das Leben gestört, gegen die Soldaten des Bischofs gekämpft, tapfer, das musste man ihnen lassen, todesmutig gar, aber eben gemordet aus Verblendung und die Gegend bis zur Parete Calva unsicher gemacht. Regen Zulauf bekamen sie am Anfang, ganze Dörfer waren zu den Aufständischen übergelaufen, später dann aber, als sie erkannten, dass sie verführt worden waren, wandten sie sich in Scharen von den Aposteln ab.
Die Gedanken des Boten schweiften zurück. Für eine lange Zeit schien die Apostelbrüder tatsächlich nichts aufhalten zu können, zu überraschend und klug operierte ihr Anführer Fra Dolcino, der abtrünnige Mönch, der so gut mit seinen Waffen umzugehen verstand. Zu uneinig und zerstritten waren auf der anderen Seite die Bischöflichen. So handelten sie sich eine Niederlage nach der anderen ein, und er war immer mitten im Schlachtengetümmel gewesen. Es dauerte lange, zu lange, bis sich das Schicksal endlich wendete und die Truppen des Bischofs die Oberhand gewannen. Der eigentliche Wendepunkt war zweifellos die Bulle des Papstes mit dem Aufruf zum Kreuzzug gegen die aufrührerische Sekte, der dazu geführt hatte, dass viele neue Mannschaften die bischöflichen Reihen auffüllten. Und nicht zu vergessen der normannische Kirchenmann und Ritter Trivet, der den bischöflichen Truppen Zuversicht und Mut eingepflanzt hatte.
Nun würde Dolcino seine gerechte Strafe erhalten. Recht geschah ihm, was hatte er sich auch eine solche verkehrte Irrlehre ausgedacht. Er stellte alles auf den Kopf, besudelte die Kirche, schmähte den Papst und versuchte, die Gläubigen vom rechten Weg abzubringen. Richtig zu schaffen hatte er den Söldnern gemacht, denn klug war er schon, der Teufelssohn, wenn er nur daran dachte, dass sich die Sekte über Jahre halten konnte und einen Sieg nach dem anderen erfocht.
Und erst sein Weib, diese Margherita. Ein wahres Teufelsweib war sie, das hatte er am eigenen Leibe erfahren. Er erinnerte sich, wie er sie letzte Nacht kurz sah, als sie mit ihrem Gefährten ins Lager gebracht wurde: abgemagert, aber aufrecht und mit erhobenem Haupt, noch Reste ihrer einstigen Schönheit auf ihrem Gesicht, die das harte Leben nicht hatte zerstören können. Wo nahm dieses Weib die Kraft her? Nach all den Entbehrungen im Winterlager auf dem Monte Rubello, das sie gestern gestürmt hatten. Der Bote schüttelte nachdenklich den Kopf, mit rechten Dingen konnte das nicht zugehen, ein schwaches Weib und trotzdem so viel Kraft und Mut. Sie musste mit dem Teufel im Bunde sein. Er bekreuzigte sich hastig.